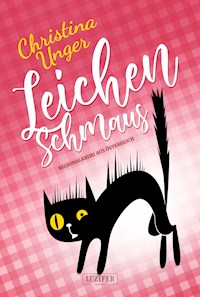Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Luzifer-Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Henry Bridges lebt trotz seiner 42 Lenze immer noch im Haus seiner Mutter in New York. Diese versucht verbissen, ihren Sohn unter die Haube zu bringen, aber Henry zeigt keinerlei Interesse an Frauen oder einer Familie. Stattdessen hegt er einen lange verborgenen Traum: eine Bildungsreise nach Europa und eine Safari in Afrika. Eines Tages bucht Henry einen Flug nach London … und von da an kennt sein Schicksal nur noch Chaos und Katastrophen. Schöne und weniger schöne Frauen werden ihm regelmäßig zum Verhängnis. Er findet einen Koffer voller Geld, der kolumbianischen Drogenhändlern gehört und die ihn bis Amsterdam verfolgen. Henry flieht nach Paris und weiter nach Neapel – wo er in einem unheimlichen Dorf landet, in dem nur Männer leben – entkommt mit knapper Not und in Unterwäsche nach Sizilien, gerät dort an einen Mafioso und landet schlussendlich bei einem Naturvolk vom Stamm der Ponga-Ponga in Afrika. Nach einigen erfolgreichen Regionalkrimis schickt Christina Unger uns und ihren Protagonisten in die weite Welt hinaus – und auf eine irrwitzige und urkomische Jagd um den Globus.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 319
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der seltsame Mr. Bridges
Impressum
überarbeitete Ausgabe Copyright Gesamtausgabe © 2024 LUZIFER Verlag Cyprus Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Cover: Michael Schubert Lektorat: Manfred Enderle
Dieses Buch wurde nach Dudenempfehlung (Stand 2024) lektoriert.
ISBN E-Book: 978-3-95835-665-8
Folgen Sie dem LUZIFER Verlag auf Facebook
Sollte es trotz sorgfältiger Erstellung bei diesem E-Book ein technisches Problem auf Ihrem Lesegerät geben, so freuen wir uns, wenn Sie uns dies per Mail an [email protected] melden und das Problem kurz schildern. Wir kümmern uns selbstverständlich umgehend um Ihr Anliegen.
Der LUZIFER Verlag verzichtet auf hartes DRM. Wir arbeiten mit einer modernen Wasserzeichen-Markierung in unseren digitalen Produkten, welche Ihnen keine technischen Hürden aufbürdet und ein bestmögliches Leseerlebnis erlaubt. Das illegale Kopieren dieses E-Books ist nicht erlaubt. Zuwiderhandlungen werden mithilfe der digitalen Signatur strafrechtlich verfolgt.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Inhaltsverzeichnis
»Die Liebe ist nichts weiter als der schmutzige Trick der Natur, damit die Menschheit nicht ausstirbt.«
Ein Mann mit Geheimnissen
»Mutter«, protestierte Henry Bridges, »ich will diese Frau nicht kennenlernen. Warum lässt du mich nicht in Frieden?«
Julia ignorierte ihn. Sie hielt eine winzige Garnele zwischen ihren sorgfältig manikürten Fingernägeln und tauchte sie in die Cocktailsauce auf dem Tisch. Sie schob die Garnele zwischen die Lippen und leckte sinnlich ihre Fingerspitzen ab.
»Sie wird jeden Augenblick hier sein, Schatz. Streng dich ein bisschen an und versuche, erfreut auszusehen, ja?«
Henry verdrehte die Augen. Sie hatten dieses Ritual unzählige Male durchgespielt, aber Julia gab nicht auf. »Wie heißt sie überhaupt?«, fragte er resigniert.
Julia richtete ihre violetten Strahleaugen auf ihn. »Rosemary.«
»Rosemary«, wiederholte er voll Abscheu.
»Sie ist hinreißend, Schatz, zweiunddreißig, blond, Sekretärin eines erfolgreichen Anwalts … Ich habe sie letzte Woche auf Vanessas Gartenparty kennengelernt.«
»Zehn Jahre jünger und verdient wahrscheinlich zweimal so viel wie ich. Wieso glaubst du, dass sie sich ausgerechnet für mich interessiert?«
»Weil du mein Sohn bist«, entgegnete Julia ohne zu zögern, »und ein attraktiver und interessanter Mann. Glaube mir, ich kenne mich da aus.«
Davon stimmte nur, dass er ihr Sohn war und manchmal bezweifelte er sogar das. Sie hatten nämlich nicht das Geringste gemeinsam. Julia war trotz ihrer neunundfünfzig Jahre unerhört attraktiv und extravagant, während Henry sich keinerlei Illusionen hingab. Er war zu groß, zu dünn, zu linkisch und zu introvertiert.
Seit seinem einundzwanzigsten Lebensjahr hatte Julia versucht, ihn unter die Haube zu bringen – und immer noch nicht aufgegeben.
Die Türglocke schlug an. »Das muss Rosemary sein.« Julia erhob sich graziös, durchquerte das geschmackvoll eingerichtete Wohnzimmer und hielt an der Tür inne. Sie drehte sich zu ihm um und hob missbilligend die Augenbrauen.
»Mach keinen krummen Rücken, Henry.«
Henry verkroch sich noch tiefer in seinem Polsterstuhl, einen missgelaunten Ausdruck auf dem Gesicht.
Julia erschien eine Minute später, gefolgt von einer Frau. Henry erhob sich wohlerzogen. »Freut mich, Sie kennenzulernen.«
Sie war weit davon entfernt, hinreißend zu sein, schien aber entschlossen, einen guten Eindruck zu machen. »So erfreut, Ihre Bekanntschaft zu machen, Mister Bridges«, säuselte sie.
»Du kannst ruhig Henry zu ihm sagen«, bot Julia ihr an.
Rosemarys Lippen teilten sich zu einem erfreuten Lächeln, wobei sie ein gelbes Pferdegebiss entblößte.
»Ich wünsche euch viel Spaß«, flötete Julia und rauschte aus dem Zimmer.
Schweigen senkte sich über den Raum.
»Wollen Sie sich nicht setzen?«
Rosemary ließ sich auf dem Sofa nieder und blickte erwartungsvoll zu ihm hoch. Henry nahm neben ihr Platz. »Tee?«, fragte er.
»Ja, bitte.«
Er goss Tee in eine von Julias zarte Porzellantassen.
»Milch?«
»Sehr gerne.«
»Zucker?«
»Nein, danke. Ich bin auf Diät.«
»Ich verstehe.« Er reichte ihr die Tasse. »Ich habe gehört, Sie arbeiten für einen Anwalt?«, versuchte er Konversation zu machen.
»Ja«, hauchte sie.
»Gefällt Ihnen diese Arbeit?«
Sie zuckte die Schultern. »Ich brauch natürlich das Geld, aber wenn Sie mich schon fragen – ich bin der Ansicht, dass eine Frau zu Hause bleiben und Kinder großziehen sollte. Meinen Sie nicht auch?«
»Habe noch nie darüber nachgedacht«, gab Henry zu.
Ihr Gesicht begann zu glühen. »Mein größter Wunsch wäre ein halbes Dutzend Kinder.«
Er schauderte. »Ich hasse Kinder.«
»Aber sie sind doch so allerliebst!«
»Es sind lärmende, kleine Monster«, brummte er.
»Seltsam«, murmelte sie, »Julia hat mir erzählt, Sie lieben Kinder.«
»Sie hat gelogen.«
»Julia sagt, der Grund, warum Sie behaupten, dass Sie keine Kinder mögen, ist, weil sie noch nicht die richtige Frau gefunden haben.« Sie lächelte triumphierend.
»Was immer Ihnen meine Mutter erzählt hat – ich hasse Kinder. Wirklich.«
»Wenn sie aus Ihrem Fleisch und Blut wären, würden Sie sie auch lieben!«
Schön langsam begann sie, Henry auf die Nerven zu fallen. »Da gibt es aber einen Haken.«
»Jaaa?«
»Keine Frau würde meine Kinder wollen«, sagte er mit Trauer in der Stimme.
»Aber warum denn nicht?«
Er sah sie schräg von der Seite an. »Versprechen Sie mir, dass Sie es nicht weitererzählen?«
Sie legte die Hand auf ihre Brust. »Ich schwöre es!«
Er senkte die Stimme. »Ich leide an epileptischen Anfällen.«
»Ohhh!«
»Und es ist vererblich.« Er rückte ein Stück näher und platzierte seine rechte Hand auf ihrem linken Knie. »Leider ist das noch nicht alles. Manche Nächte träume ich davon, dass ich statt im Bett zu liegen auf der Toilette sitze und dann – na ja – Sie können sich das Weitere selbst ausmalen. Es ist ein schreckliches Leiden, Rosemary, und sehr unappetitlich.«
Rosemary rückte etwas von ihm ab. »Sie bedauernswerter Mann! Haben Sie schon einen Arzt aufgesucht?«
»Mehrere. Alle sagen, es sei psychosomatisch und da gäbe es leider nichts, was man dagegen tun könnte.«
»Das tut mir leid.«
»Ich leide auch an schlechtem Atem«, fuhr er angespannt fort. »Haben Sie das noch nicht bemerkt? Riechen Sie selbst …«
Rosemary versteckte sich hinter ihrer Teetasse.
»Aber das Allerschlimmste habe ich noch gar nicht erzählt!«
Rosemary wand sich auf dem Sofa. »Sie meinen, es gibt noch Schlimmeres?«
»Leider ja.« Er nickte bekümmert. »Es ist mir peinlich, mit einer Frau darüber zu sprechen, aber Ihnen vertraue ich. Versprechen Sie mir, es niemandem weiterzuerzählen?«
Sie nickte benommen.
»Ich leider unter nächtlichen Ejakulationen.«
Rosemary schluckte.
»Sehen Sie, im Traum erscheinen mir die hinreißendsten Frauen und darüber gerate ich in solche Ekstase …«
Mit einem lauten Klirren stellte Rosemary ihre Tasse ab und erhob sich. »Es tut mir so leid, Mister Bridges, aber jetzt muss ich wirklich gehen.«
Henry sprang auf die Füße. »Oh, gehen Sie noch nicht!«
Rosemary ergriff ihre Tasche und eilte zur Tür. »Es war mir ein Vergnügen, Mister Bridges. Und«, fügte sie verschwörerisch hinzu, »meine Lippen sind versiegelt. Von mir erfährt niemand etwas.«
Nachdem sich die Tür hinter ihr geschlossen hatte, begann Henry leise in sich hineinzulachen.
Julia stürmte ins Wohnzimmer. »Ich habe Rosemary fortgehen sehen, Henry. Was hast du mit ihr gemacht? Sie war vollkommen durcheinander.«
»Nichts. Wir haben über Kinder gesprochen …«
Julia stemmte die Arme in die Hüften. »Hast du ihr erzählt, du leidest an Epilepsie?«
»Warum sollte ich so etwas erzählen?«
»Weil du das auch Annie, Susie und Violet erzählt hast. Du bist unmöglich, Henry. Ich bringe dir die nettesten Mädchen und du verdirbst alles.« Sie war den Tränen nahe. »Du wirst nie eine anständige Frau finden!«
»Ich will keine Frau, Mutter. Warum siehst du das nicht endlich ein?«
»Was willst du denn dann, sag’s mir!«
»Ich will reisen.«
»Reisen? Wohin?«
»Nach Europa zum Beispiel. Es war immer schon ein Traum von mir.
Ich möchte nach England, der Heimat von Charles Dickens. Ich möchte Paris sehen, Amsterdam …«
»Du hast mir nie davon erzählt.«
»Du warst nie daran interessiert. Du warst zu sehr mit dir selbst beschäftigt.«
»Wirfst du mir vor, dass ich eine schlechte Mutter war?«
»Nein, keine schlechte, aber du hast mich von vornherein nicht gewollt, du sagtest, ich war ein Unfall. Erinnerst du dich?«
Julia zerdrückte eine Träne. »In der damaligen Zeit war jedes Kind ein Unfall. Wir hatten keine Antibabypillen, wir waren nicht aufgeklärt über Sex, immer mussten wir aufpassen …«
»Coitus interruptus«, nickte Henry ernst, »sehr ungesund.«
»Genau«, schnappte sie. Nach einigem Zögern fragte sie: »Ist es dir wirklich Ernst mit der Reiserei?«
»Mir war noch nie etwas so ernst. Ich habe lange genug gewartet – zweiundvierzig Jahre. Davon zwanzig Jahre in der Bibliothek zwischen verstaubten Büchern. Ich möchte endlich auch etwas von der Welt sehen, bevor ich Schimmel ansetze. Kannst du das denn nicht verstehen?«
Julia nagte an ihrer Unterlippe. Plötzlich hob sie den Kopf und lächelte gewinnend. »Ich will alles wiedergutmachen, Henry. Ich komme mit dir!«
Henry riss alarmiert die Augen auf und schwor sich im selben Moment: Höchstens über seine Leiche!
Schock in der Bibliothek
Die Bibliothek in Stamford, New York, lag im Stadtzentrum. Der Chefbibliothekar James Cunningham saß in einem verstaubten Büro hinter einem riesigen wurmstichigen Schreibtisch und sah stirnrunzelnd über seine Brille hinweg.
»Europa, aha. Wie lange gedenken Sie, der Arbeit fernzubleiben?«
»Mindestens drei Monate.«
»Drei Monate! Die Leute fahren für höchstens drei Wochen nach Europa. Was würden Sie denn dort drei lange Monate machen?«
»Mir alles ansehen.«
Cunningham wühlte in seinen Papieren. »Es tut mir leid, aber ich fürchte, das wird nicht gehen. Wir können so lange nicht ohne Sie auskommen. Ich gebe Ihnen aber drei Wochen.«
Henrys Gesicht wurde lang. »Ich habe seit zehn Jahren keinen richtigen Urlaub mehr gemacht«, protestierte er.
Cunningham zuckte die Schultern. »Das ist Ihre eigene Schuld. Sie wollten ja nie mit mir nach Vermont kommen, der Himmel weiß, ich habe Sie oft genug gefragt.«
»Vermont«, wiederholte Henry verächtlich. »Ich will die Welt sehen! Fischen interessiert mich nicht, es langweilt mich zu Tode. Ich möchte den Louvre
besuchen, das Reichsmuseum, Westminster Abbey, den Eiffelturm besteigen und einen Pernod trinken mit Paris zu meinen Füßen.«
»All das können Sie doch in drei Wochen erledigen, oder nicht?«
»Nicht ganz.« Henry zögerte. »Sehen Sie, da ist nämlich noch etwas. Ich möchte auch nach Afrika reisen.«
Cunningham blinzelte. »Um Gottes willen, Henry, wer hat Ihnen denn diesen Floh ins Ohr gesetzt?«
»Hemingway. Ich möchte auf Safari gehen, so wie er.« Henry blickte wehmütig an seinem Chef vorbei zum Fenster hinaus. »Ich möchte den Schnee auf dem Kilimandscharo sehen. Ich habe von diesen Plätzen geträumt, seit ich ein kleiner Junge war. Ich habe jedes Buch von Hemingway, Dickens und Baudelaire verschlungen. Genau genommen war das alles, was ich in meinen Leben getan habe. Es ist an der Zeit, dass ich etwas unternehme, verstehen Sie das nicht?«
»Ich habe einen kleinen Bungalow am Moosehead Lake gekauft.«
Henrys Blick kehrte vom Fenster zurück. »Verzeihung?«
»In Maine. Ich werde Ihnen die Schlüssel geben.«
»Wozu?«
»Damit Sie dort Urlaub machen können.«
»Haben Sie mir denn nicht zugehört?«
Der Chefbibliothekar seufzte.
»Meine Mutter besitzt selbst einen Bungalow«, sagte Henry. »In New Haven.«
Cunningham betrachtete Henry mit sorgenvoller Miene. »Das ist auch so eine Sache, die mir Sorgen bereitet, Henry. Sie sind wie alt? Fünfundvierzig?
»Zweiundvierzig«, stellte Henry richtig.
»Sie sind zweiundvierzig Jahre alt und wohnen bei Ihrer Mutter. Meinen Sie nicht auch, dass das ein wenig merkwürdig ist?«
»Was ist daran merkwürdig?«
»In Gottes Namen, Henry!«, explodierte Cunningham. »Haben Sie denn nie den Wunsch verspürt, eine nette Frau zu finden und sich mit ihr in einem eigenen Heim niederzulassen? So wie andere Männer?«
»Nein.«
Cunningham wischte sich über die Stirn. »Warum eigentlich nicht?«
Henry suchte nach Worten. »Ich hatte nie das Bedürfnis.«
Cunningham räusperte sich. »Darf ich Ihnen eine persönliche Frage stellen? Äh … hatten Sie je ein Verhältnis mit einer Frau?«
Henry starrte ihn mit offenem Mund an.
Cunninghams Augen bohrten sich in die seinen. »Dann lassen Sie es mich anders ausdrücken. Finden Sie in gewissen Situationen den weiblichen Körper abstoßend?«
»Was geht das Sie an!«
»Andersherum. Haben Sie sich jemals, also wie soll ich es sagen, haben Sie sich jemals zu einem Mann hingezogen gefühlt?«
»Wollen Sie damit behaupten, dass ich … dass ich …!«
Jetzt ging Cunningham aufs Ganze. »Sind Sie schwul, Henry?«
Die Farbe wich aus Henrys Gesicht. »Ich kann Ihnen versichern, dass ich völlig normal bin.«
»Ich wollte nur helfen.« Cunningham strich sich über den kahlen Vorderkopf. Er erhob sich vom Schreibtisch und zog seine Hosen hoch. Schließlich sagte er: »Ihre Mutter ist eine sehr liebe Frau, Henry, aber Sie bereiten ihr beträchtliche Kopfschmerzen.«
»Woher wissen Sie das schon wieder?«
Cunningham grinste geheimnisvoll. »Ich habe sie kennengelernt, als sie eines Tages in die Bibliothek kam. Ich mag Ihre Mutter sehr und – sie mag mich auch.«
»Schön für Sie«, antwortete Henry gleichgültig.
»Genau genommen sind wir sogar ein paar Mal miteinander ausgegangen.«
»Das hat sie mir gar nicht erzählt.«
»Nein, wahrscheinlich nicht. Na ja …« Cunningham grinste verlegen. »Ich muss Ihnen etwas gestehen, Henry.«
»Jaaa?«
»Ihre Mutter und ich werden heiraten!«
Henry fiel auf den nächsten Stuhl.
Cunningham legte einen Arm um Henrys Schulter und sagte mit Rührung in der Stimme: »Du wirst mein Sohn sein, Henry! Verstehst du nun, warum ich mir Sorgen um dich mache?«
»Ihr S-s-sohn?«
Die Augen des Älteren wurden feucht. »Du kannst Papa zu mir sagen.«
Henry erhob sich in Zeitlupe.
»Wünschst du mir denn nicht alles Gute?«
»A-a-aber natürlich.«
»Umarme mich endlich – Sohn!« Cunningham breitete die Arme aus.
Henry legte seine dünnen Arme um ihn. »Ich wünsche euch alles Gute – äh, Papa.«
»Ich danke dir.« Cunningham zog ein Taschentuch aus der Hosentasche und schnäuzte sich geräuschvoll. »Seit meine Frau verstorben ist, bin ich ein richtiger Griesgram gewesen.«
»Ich weiß.«
»Aber deine Mutter hat mir die Freude am Leben wieder zurückgegeben. Sie ist eine wunderbare Frau. So einfühlsam …«
»Ist mir bisher entgangen.«
»Ihr Mann, also dein Vater, ist ja schon vor Langem verstorben, soviel ich weiß.«
»Ja, er ist auf einer Bananenschale ausgerutscht und hat sich den Hals gebrochen.«
»Oh, das tut mir aufrichtig leid. Deine Mutter hatte das nie erwähnt.«
»Sie dachte, es würde ihr ohnehin keiner glauben.«
»Ich verstehe. Ein schreckliches Ende.«
Henry nickte. »Seit dem Unfalltod meines Vaters habe ich immer nach Bananenschalen auf Gehsteigen Ausschau gehalten.«
»Das kann ich gut nachvollziehen. Aber in Afrika essen die Menschen ziemlich viele Bananen.«
»Also macht es dir nichts mehr aus, wenn ich nach Afrika reise?«, fragte Henry hoffnungsvoll.
»Ach, Henry, ich wünschte, du würdest es nicht tun.«
»Bitte – Papa?«
»Oh, du!« Cunningham wischte sich die feuchten Augen. »Also in Gottes Namen, fahr nach Europa, fahr nach Afrika, aber versprich mir, dass du gut auf dich Acht gibst. Pech kann in der Familie liegen, weißt du?«
»Ich verspreche es.«
Cunningham sagte vorsichtig: »Ich werde bei euch einziehen. Ich hoffe, du hast nichts dagegen?«
Henry zögerte.
»Das Haus deiner Mutter ist so viel größer als meines, Henry, und du weißt ja, dass es mit unserem Gehalt nicht ganz leicht ist, über die Runden zu kommen.
Außerdem erhält sie nach deinem Vater eine schöne Rente und da hat sie selbst vorgeschlagen …«
»Ist ja gut«, unterbrach Henry, dem es peinlich war, über Geld zu reden.
Cunningham schien erleichtert. »Aber da ist noch eine Sache.« Er sah Henry unschlüssig an. »Ich habe zwei Töchter, achtzehn und neunzehn.«
In Henrys Stimme mischte sich Panik. »Willst du sagen, die ziehen auch ein?«
Cunningham grinste unbehaglich. »Wenn ich sie vorher nicht verheiraten kann.«
Henrys Gedanken überschlugen sich. Ein Haus voller Menschen. Gelächter, Geschrei, zwei dümmliche Teenager, die den ganzen Tag herumlungerten, kichernd und sich streitend. Es würde die Hölle auf Erden sein.
»Ich hoffe sehr, dass du sie vorher verheiraten kannst!«, antwortete er mit Inbrunst.
»Meine Hochzeit mit deiner Mutter ist aber schon in zwei Wochen …«
Henry starrte schockiert in Cunninghams Gesicht.
»Weibliche Gesellschaft wird dir guttun«, predigte Cunningham. »Sie sorgt für ein natürliches Gleichgewicht im Leben.«
»Ich habe seit meiner Geburt weibliche Gesellschaft genossen«, erinnerte Henry ihn an seine Mutter.
»Diesmal ist es anders, sie werden deine Schwestern sein!«
Henry schloss verzweifelt die Augen. Da er aber ein höflicher Mensch war, sagte er: »Wir werden sicher gut miteinander auskommen«, und hasste sie schon jetzt.
Teenager und Barbaren
»Wollen Sie, Julia Bridges, diesen Mann, James Albert Cunningham, zu Ihrem Ehemann nehmen, ihn lieben und ehren, bis dass der Tod Sie scheidet, so antworten Sie mit Ja.«
Von diesem Augenblick an änderte sich das Leben für Henry schlagartig. Gleich am nächsten Morgen buchte er einen Flug nach London. Die Cunningham-Horde zog zwei Tage später ein und Henry betete, dass die restlichen Tage bis zu seiner Abreise mit einem Minimum an Tortur vorbeigehen würden.
Aber die Cunningham-Schwestern waren entschlossen, ihm das Leben zur Hölle zu machen. Sie nannten ihn Henry-Darling und süßer Henry-Schatz, kamen unangemeldet in sein Zimmer, unterbrachen ihn bei seiner Reiselektüre und bestanden darauf, dass er ihren zahlreichen Problemchen Aufmerksamkeit schenkte. Wie zum Beispiel: Welcher Lidschatten zu welchem T-Shirt passte und welcher der widerlichen, lautstarken jungen Männer, die im Stundentakt an der Türglocke schellten, bei ihm den besten Eindruck hinterlassen hatte.
Sie küssten ihn morgens zum Frühstück und abends vor dem Schlafengehen, pressten ihre abscheulichen, dünnen Körper gegen den seinen und hüllten ihn in eine Wolke billigen Deodorants. Es war hundertmal schlimmer als befürchtet. Er war ein nervliches Wrack!
Julia und Cunningham saßen bloß da, hielten Händchen, lächelten schwachsinnig und betrachteten die monströsen Teenager als wunderbare Gesellschaft. Und dann eines Nachts passierte etwas Furchtbares. Er lag im Bett und hatte einen Albtraum. Er träumte, dass er an einem sonnigen Strand lag, als plötzlich Amanda und Yolanda aus einer Nebelwolke traten. Sie trugen winzige Bikinis und auf ihren Lippen tanzte ein verheißungsvolles Lächeln. Die Mädchen knieten nieder und beschäftigten sich mit seinem Körper, bis Henry laut aufstöhnte und Amanda keuchend auf seinen Schoß zog, während Yolanda mit Engelslächeln zusah.
Als er in Schweiß gebadet aufwachte, entrang sich seiner Brust ein Schrei. Auf seinem Bett leibhaftig saßen Amanda und Yolanda, in durchsichtigen Nachthemdchen. Voller Besorgnis blickten sie auf ihn nieder, flüsterten tröstliche Worte und taten mit ihren Händen Unaussprechliches, bis Henry endlich die Kraft aufbrachte, sie aus seinem Zimmer zu werfen.
Beim Frühstück vermied er ihre widerlich grinsenden Gesichter.
»Hast du nicht gut geschlafen?«, fragte Amanda scheinheilig.
»Du siehst abgespannt aus, Henry, Sweetheart«, säuselte Yolanda. »Hattest du einen bösen Traum?«
»Das Reisefieber«, murmelte er und wünschte, die beiden Schwestern würden tot umfallen.
»Noch Kaffee?«, fragte Julia und Henry nickte geistesabwesend.
Cunningham reichte ihm den Brotkorb. »Noch ein Stück Toast, Sohn?«
Henry verneinte und wünschte, Cunningham würde endlich aufhören, ihn Sohn zu nennen. Er war schließlich nur zwölf Jahre älter. Mit der Serviette betupfte er seine Lippen und als er den Kopf hob, bemerkte er, dass ihn alle anstarrten. Er runzelte die Stirn. Stand sein Hosenstall offen? Steckte ein Krümel verbrannter Toast zwischen seinen Zähnen?
Er räusperte sich. »Stimmt was nicht?«
Amanda brach in Kichern aus, bis Cunningham sie zurechtwies.
»Wir haben eine Überraschung für dich«, verkündete Julia und sah dabei ihren frisch angetrauten Ehemann verschwörerisch an.
Sie kann in ihrem Alter unmöglich schwanger sein, durchzuckte es Henry. »Eine Überraschung?«, echote er schwach. Er hasste Überraschungen. Sie machten ihn nervös.
»Wir dachten«, begann Julia, »dass es besonders nett wäre, wenn James und ich auf Hochzeitsreise gingen.«
Henry stieß erleichtert die Luft aus. »Eine Woche in Vermont und eine Woche in Maine. Eine wirklich gute Idee.«
Julia und Cunningham wechselten einen Blick. »Dieses Jahr fahren wir weder hierhin noch dorthin.«
»Nein?«
»Nein.« Liebevoll drückte Julia den Arm ihres Mannes. »Sag’s du ihm doch, Jimmy.«
Cunningham erhob sich feierlich vom Tisch. »Sohn«, verkündete er, »deine Mutter und ich haben beschlossen, mit dir nach London zu kommen.«
Die Nachricht traf Henry wie ein Keulenschlag. Unbeweglich klebte er an seinem Stuhl und starrte verzweifelt in seinen schwarzen Kaffee. Dann hob er die Tasse und leerte sie mit einem einzigen Schluck.
»Ist das nicht irre!«, kreischte Amanda. »Ich war noch nie in London!«
Henry verschluckte sich und prustete den Kaffee quer über Julias neues Tischtuch.
Cunningham musste ihm ein paar brutale Schläge auf den Rücken verpassen.
Henry starrte sie voll Entsetzen an. »Soll … soll das heißen, ihr alle kommt mit nach London?«
»Die ganze Familie«, versicherte Cunningham freudig.
»Mit demselben Flugzeug?«
»Mit genau demselben.«
Alternativlos
Es stellte sich als keine leichte Aufgabe heraus, die Cunninghams abzuhängen. Sie klebten an seinen Fersen, als ob sie seine Gedanken lesen könnten. Die ersten beiden Tage hatte es unaufhörlich geregnet und Henry begann bereits zu verzagen. London wartete darauf, erforscht zu werden, stattdessen hatte Cunningham sie in einem Hotel voll mit Amerikanern einquartiert, zweimal in ein und dasselbe amerikanische Restaurant geschleppt, wo jeder einen Hot Dog gegessen hatte (englisches Essen war nicht geheuer). Er zwang Henry, mit ihnen Karten zu spielen und sich das bedeutungslose Geschwätz der beiden Gören anzuhören. Henry wurde mit jeder Stunde rastloser.
Der Flug war ein glatter Albtraum gewesen. Eingeklemmt zwischen beiden Schwestern, musste er zusehen, wie Julia und Cunningham im Vordersitz herumknutschten. Und das in ihrem Alter! Dann hatte es eine Ewigkeit gedauert, bis sie endlich ihr Hotel gefunden hatten, wo Henry wegen des zu erwartenden Jetlags sofort zu Bett gegangen war. Am nächsten Morgen erwachte er durch ein Klopfen an der Zimmertür. Er kroch aus dem Bett und sah sich einer strahlenden, unternehmungsfreudigen Familie gegenüber.
»Guten Morgen, Henry!«, begrüßten sie ihn im Chor.
Es sollte der erste regenfreie Tag werden und die Familie bestand darauf, dass er sie zur Wachablöse vor dem Buckingham begleitete. Das zumindest war für ihn als Fan der Königlichen Familie kein allzu großes Opfer. Danach wollten sie die Kronjuwelen besichtigten, was zwei Stunden Schlange stehen im wieder einsetzenden Regen bedeutete. Als die Reihe endlich an sie kam, sperrte man ihnen vor der Nase das Tor zu. So kamen sie am nächsten Morgen wieder, eingekeilt zwischen lärmenden Touristen.
Amanda zog eine Grimasse. »Diese Juwelen sind natürlich nicht echt. Mich können die nicht so leicht an der Nase herumführen.«
Henry hatte das Verlangen, ihr für diese Blasphemie den dürren Hals umzudrehen.
»Widerlich«, steuerte auch Yolanda bei, »diese Zurschaustellung ihres Reichtums, während es im Land Menschen gibt, die hungern.«
»Seid still, Kinder«, ermahnte Cunningham.
»Niemand hungert in England«, behauptete Henry ärgerlich.
Wieder auf der Straße, schlug Julia vor: »Wollen wir einen Bootsausflug auf der Themse machen?«
»Bei diesem Regen?« Yolanda sah nicht begeistert aus.
»Regen ist gut für die Haut«, erklärte Julia.
»Gut für die Haut älterer Damen.« Dafür heimste sie von Julia einen aufgebrachten Blick ein.
Henry sah seine Chance gekommen. »Warum macht ihr nicht eine Schiffstour und ich schaue mir Big Ben an?«
»Wenn ich es mir recht überlege«, sagte Julia, »hätte ich gegen Big Ben auch nichts einzuwenden.«
Die beiden Mädchen machten unzufriedene Gesichter. »Sehenswürdigkeiten anschauen ist laaangweilig«, beklagte sich Yolanda.
»Laaangweilig«, echote Amanda. »Warum können wir nicht was Aufregenderes machen? Soho zum Beispiel.«
»Nö, ich will MadamTussauds Wachsfigurenkabinett sehen«, quengelte Yolanda. »Ich habe gehört, dort stehen am Eingang zur Schreckenskammer zwei Wachsfiguren von Charles und Camilla.«
»Ich habe eine noch bessere Idee«, versuchte Henry einen neuen Anlauf. »Warum trennen wir uns nicht und jeder macht, was er will?«
»Das kommt überhaupt nicht infrage«, bestimmte Cunningham. »Wir sind zusammen gekommen und wir bleiben zusammen. Wir sind schließlich eine Familie.«
Julia nickte. »James hat ganz recht.«
Henry sah die beiden hasserfüllt an. Warum musste Julia immer seiner Meinung sein? Er hatte sie noch nie so passiv und sanft erlebt. Sie hing an Cunninghams Arm, himmelte ihn an und war so widerlich zufrieden mit dem Leben! Was genau sah sie in diesem kleinen, glatzköpfigen Bibliothekar, der noch nicht einmal Geld besaß?
Und was, fragte er sich, sah sie bloß in seinen Töchtern? Sie waren ausgesprochen hässlich mit ihren senffarbenen, struppigen Haaren, den vorstehenden Glupschaugen, abstehenden Ohren und dümmlichen Gesichtern. Wenn die Ehe einen Menschen derart blind machte, dann wollte er noch weniger als bisher etwas damit zu tun haben.
Der einzige Höhepunkt dieses Tages bestand darin, dass Amanda von einem bunthaarigen Punk geohrfeigt wurde, als sie ihn fotografierte. Er nannte sie eine blöde amerikanische Ziege, worauf Amanda in Tränen ausbrach.
An diesem Abend ging Henry wieder früh zu Bett und verbrachte die Nacht grübelnd, wie er sie endlich loswerden konnte. Bis zum Morgengrauen hatte er einen neuen Plan ausgearbeitet. Er stand früh auf und jagte die Familie aus dem Bett. Mit grimmiger Zufriedenheit sah er zu, wie sie gähnend und mit verschwollenen Augen im Zimmer herumstolperten.
»Was wollen wir denn heute unternehmen?«, fragte Amanda beim Frühstück.
»Ich werde euch zu Madam Tussauds Wachsfigurenkabinett mitnehmen«, bestimmte Henry den Tagesablauf.
»Au ja!«, freute sich Yolanda. »Gehen wir auch in die Schreckenskammer?«
»Ich möchte in den Tower«, widersprach Amanda, »und mir die Stelle ansehen, wo man Mary Stuart den Kopf abgeschlagen hat.«
»Man hat ihr den Kopf im Schloss zu Fotheringhay abgeschlagen«, belehrte Henry sie, »aber bei Madam Tussauds kannst du eine Szene ihrer Enthauptung sehen, wenn du so wild auf Blutrünstiges bist.«
»Könnten wir nicht einen Spaziergang im Hyde Park unternehmen?«, wandte Julia ein.
»Und wieder geohrfeigt werden?«, protestierte Amanda.
»Das war deine eigene Schuld«, sagte ihr Vater. »Man macht von fremden Leuten keine Fotos, ohne sie vorher zu fragen. Das ist schlechtes Benehmen.«
»Er war ein Arschloch.«
»Gebrauch nicht solche Worte, Amanda.«
»Also«, unterbrach Henry ungeduldig, »wollen wir uns nun auf den Weg zu Madam Tussauds machen und die U-Bahn-Station suchen?«
Julia sah ihn besorgt an. »Die Untergrundbahnen in London sind gefährlich, Henry.«
»Nicht gefährlicher als die in New York.«
»Dann lasst uns endlich abhauen!« Yolanda erhob sich ungeduldig vom Tisch. »Ich will diesen verrückten Australier in Wachs sehen.«
»Crocodile Dundee?«, fragte Amanda aufgeregt.
»Nein, Adolf Hitler.«
»Das war kein Australier«, korrigierte Cunningham, »das war ein Deutscher.«
»Als Chefbibliothekar«, konnte Henry nicht widerstehen, »müsstet du wissen, dass Hitler Österreicher war.«
Cunningham fixierte verlegen seine Schuhspitzen. »Damit hast du natürlich recht.«
»Ist doch sowieso das Gleiche!«, schrie Amanda.
»Schrei doch nicht immer so«, tadelte Julia ihre Stieftochter.
Bei der Hotelrezeption erstand Henry einen U-Bahn-Plan und alle starrten verwirrt darauf.
»In diesem Labyrinth kennst du dich aus?«, fragte Yolanda bewundernd.
»Natürlich. Wir nehmen die blaue Linie bis King’s Cross und mit der gelben gelangen wir direkt zu Madame Tussauds. Haltet euch nur an mich.«
Die Familie hatte Schwierigkeiten, mit Henrys langen Schritten mitzuhalten, aber schließlich saßen alle im richtigen Zug, bis Henry ein Zeichen gab, dass es Zeit war, umzusteigen. King’s Cross war eine bedeutende Station und Züge trafen im Minutentakt ein. Die Menschenmassen waren erdrückend und die Cunninghams klammerten sich aneinander wie verängstigte Affen.
»Springt! Schnell!« Cunningham flatterte mit den Armen wie ein aufgeregtes Huhn, schob Julia und die Mädchen in den Wagen und folgte schnell, bevor sich die Türen schließen konnten. Leute schoben einander vorwärts und eine alte Dame wurde beinahe zu Tode getrampelt. Henry half ihr beim Einsteigen, wobei er sich extra viel Zeit nahm und dafür mit einem dankbaren Lächeln belohnt wurde. Die Cunninghams winkten Henry wie wild zu, während sie immer weiter ins Wageninnere geschoben wurden. Dann schlossen sich die automatischen Türen.
Die Familie stieß einen einstimmigen Protestschrei aus, als sie merkte, dass Henry noch auf der Plattform stand. Der Zug setzte sich in Bewegung und das Letzte, was Henry von ihnen sah, waren ihre plattgedrückten Gesichter hinter einer Fensterscheibe. Er hob den Arm und winkte. Danach verschwanden die Cunninghams im Tunnel.
Henry strich sich durch sein schütteres Haar und eine unvorstellbar große Erleichterung durchflutete ihn.
Allein! Frei! Endlich!
Zwielichtige Gestalten
Henry fuhr mit der U-Bahn zurück ins Hotel und räumte sein Zimmer. Er konsultierte seinen Reiseführer und wählte ein gutbürgerliches Hotel unweit von Victoria Station. Morgen würde er den Zug nach Dover nehmen, dann die Fähre nach Calais und den Zug nach Brüssel. Es war nicht ratsam, in London zu bleiben. Die Gefahr, den Cunninghams über den Weg zu laufen, war zu groß und der Teufel schlief bekanntlich nie.
Er hinterließ Julia eine Nachricht, dass es ihm gut gehe, er aber andere Pläne habe, und ihnen nach Stamford schreiben wollte. Dann bat er den Portier, ihm ein Taxi zu rufen und trat durch die Drehtür auf die Straße.
Eine Gruppe kaffeebrauner Männer mit beeindruckenden Schnurrbärten war gerade dabei, mit einem Taxifahrer zu streiten. Der Taxifahrer weigerte sich, alle fünf einsteigen zu lassen, da er nur Platz für vier hatte.
»Hijo de puta!«, schimpfte einer. »In Kolumbien wir fahren zehn in ein Taxi!«
»Wir sind nicht in Kolumbien«, erinnerte ihn der Taxifahrer. »Wir sind in England.«
»England ist Scheiße!«
Der Taxifahrer zuckte philosophisch die Schultern. Er selbst war aus Jamaika und wollte sich nicht streiten.
»Wir müssen fahren zu Victoria Station!«, rief ein anderer Mann. »En seguida! Keine Zeit, comprendes?«
»Ich sagte bereits, dass ich nur vier von Ihnen mitnehmen darf.«
Eine hitzige Debatte entbrannte unter den Kolumbianern. Als Henrys Taxi eintraf, bot er den Männern kurz entschlossen an: »Mein Hotel liegt unweit von Victoria Station. Einen von Ihnen könnte ich mitnehmen.«
Die Kolumbianer starrten ihn schweigend an. Sie sahen ausgesprochen zwielichtig aus, dachte Henry, aber was zum Teufel! Er war endlich die Cunninghams los und befand sich in euphorischer Stimmung.
»Haben Sie sich geeinigt, wer mitfährt?«, fragte er.
»Ich!« Ein kleiner, fetter Mann mit öligem Haar und einer Narbe über der linken Gesichtshälfte trat vor. Er umklammerte einen braunen Koffer und sprach etwas in Spanisch zu den anderen. Die anderen kletterten zögernd in ihr Taxi.
»Gracias«, bedankte sich der Kolumbianer und maß ihn gleichzeitig von Kopf bis Fuß. »Du nicht Englisch?«
»Nein, ich bin Amerikaner.«
»Ahhh! Amerikanisch, viel besser.« Er schob den Koffer in das Taxi und begann nachzuklettern.
Der Fahrer machte ihn aufmerksam, dass das Gepäck in den Kofferraum musste.
»Por qué?«, schnappte der Kolumbianer.
»Vorschrift.«
Der Kolumbianer blickte den Taxifahrer böse an. »Was ich dir sagen«, wandte er sich an Henry. »Englisch alles Scheiße!«
Der Fahrer schloss den Kofferraum mit einem lauten Knall und setzte sich hinter das Steuerrad. »Wohin?«
»Richtung Victoria Station«, informierte ihn Henry.
Der Kolumbianer zitterte. »England ist kalt. Ich lieben heiße Sonne in Kolumbien.«
Henry musterte die teure Kleidung des Mannes. »Sind Sie geschäftlich in England?«
Der Kolumbianer sah ihn misstrauisch an. »Warum du wollen wissen?«
»Wie …?«
Der Mann wurde freundlicher, schließlich verdankte er diesem Amerikaner eine Mitfahrgelegenheit. »Ich geschäftlich hier. Und du?«
»Ferien. Morgen reise ich weiter nach Brüssel und dann nach Amsterdam.«
»Amsterdam, eh?« Der Mann grinste anzüglich. »Du suchen mujeres, no?«
»Mujeres …?«
»Weiber!« Er küsste die Fingerspitzen seiner Hand. »Schöne Weiber in Amsterdam.«
Henrys Stimme wurde frostig. »Ich reise nach Amsterdam, um das Reichsmuseum zu besuchen. An den Frauen dort bin ich nicht interessiert.«
Der Kolumbianer lachte schallend. »Nicht interessiert, eh? Dein Typ ist schlimmster von allen. Du sehen schöne Frau und Kopf hört auf zu denken.«
Welch ein unmöglicher Mensch!, dachte Henry und bereute schon, ihn mitgenommen zu haben.
»Ich Carlos Rodriguez«, stellte sich der Mann vor und hielt Henry eine schweißfeuchte Hand hin, die Henry nur unwillig schüttelte. Mit Erleichterung sah er das graue Gebäude von Victoria Station vor ihnen auftauchen.
»Welches Hotel du wohnen?«, wollte Carlos wissen.
Henry informierte den Taxifahrer: »Lassen Sie mich bitte vor dem Hotel Belgrave raus.«
Carlos verfiel in Schweigen und seine gekräuselte Stirn deutete an, dass er sich wichtigen Gedanken hingab. Schließlich verkündete er: »Ich mit dir kommen!«
Henry beäugte ihn voll Misstrauen. »Ich dachte, Sie hätten es so eilig?«
»Jetzt ich habe nicht mehr eilig!«
Drei Minuten später hielt das Taxi vor dem Hotel und der Fahrer schaltete den Zähler ab. »Das macht elf Pfund fünfzig.«
Henry zog seine Geldbörse heraus, aber Carlos war schneller. »Carlos zahlen«, sagte er feierlich.
Henry stritt sich nicht lange. Er wollte diesen Menschen so schnell wie möglich loswerden. Das Belgrave schien ein respektables Hotel zu sein und Henry bekam ein Einzelzimmer im zweiten Stock. Er nahm den Schlüssel mit der Nummer 203 in Empfang und Carlos zeigte ihm seinen Schlüssel mit der Nummer 205.
»Ich dich einladen auf Drink.«
Henry schüttelte den Kopf. »Nein, danke, ich werde ein Schläfchen halten.«
Carlos war beleidigt, aber Henry ließ ihn in der Hotelhalle stehen und folgte dem Hotelpagen zum Aufzug. In seinem Zimmer gab er dem Jungen ein großzügiges Trinkgeld und schloss die Tür hinter sich. Er entkleidete sich bis auf die baumwollene Unterhose, streckte sich auf dem Bett aus und schloss die Augen.
Aber Schlaf entzog sich ihm. Er konnte nicht anders, als an die Cunninghams zu denken und an ihre panischen Gesichter hinter dem Fensterglas. Er kicherte. Das war ziemlich gemein von ihm gewesen, aber im Augenblick war ihm das egal. Zu lange schon hatte er sich auf diese Reise gefreut.
Ein leises Klopfen an der Tür schreckte ihn aus seinen Gedanken. »Wer ist da?«
Eine gedämpfte Stimme antwortete: »Carlos!«
Verdammt, der Kolumbianer. »Was wollen Sie?«
»Ich müssen reden mit dir.«
Henry warf sich leise fluchend einen Morgenmantel um und tappte zur Tür. Draußen stand Carlos mit einem breiten Grinsen, seinen braunen Koffer in der Hand. Er drängte an Henry vorbei ins Zimmer und schloss die Tür ab.
»Ich sagte Ihnen doch, dass ich ein Schläfchen halten möchte.«
Carlos hielt ihm den Koffer hin. »Du aufpassen auf Koffer, ja? Ist muy importante!«
Henry betrachtete den Koffer misstrauisch.
»Sehr wichtige Papiere«, erklärte Carlos. »Geschäftspapiere, du verstehen? Ich großer Geschäftsmann, aber ohne Papiere – keine Geschäfte, comprendes?«
»Warum passen Sie dann nicht selber auf?«
»Ich müssen weg, aber du sagen, du bleiben in Hotel und machen Schläfchen. Ich nicht wollen Koffer allein in Zimmer, du verstehen?«
»Nein.«
»Vielleicht wird gestohlen.«
»Warum sollte jemand ausgerechnet Ihren Koffer stehlen?«
»Ahhh, du nicht wissen, aber in Kolumbien jeder alles stehlen.«
»Wir sind aber nicht in Kolumbien«, bestand Henry.
Carlos zuckte die Achseln. »Angst ist in Blut. Aber ich dir vertrauen. Du guter Mann.«
Henry seufzte. Zwar hatte er nach dem Schläfchen einen Spaziergang geplant, aber wer weiß, vielleicht war es tatsächlich sicherer, im Hotel zu bleiben, zumindest was die Cunninghams betraf.
»Also gut«, sagte er.
»Gracias.« Carlos gab ihm einen enthusiastischen Schlag auf den Rücken, dass Henry nach Luft japste.
»Ich zurück in zwei Stunden.«
Henry stellte den Koffer auf den Boden neben seinen eigenen.
»No, no, no!«, rief Carlos. »Du müssen verstecken.«
»Aber ich bin den ganzen Tag über hier.«
»Ist besser, wenn verstecken.« Carlos sah sich im Zimmer um und trug den Koffer zum Kleiderschrank. Er schob ihn hinein und versteckte den Schlüssel im Kopfkissenbezug. Henrys Augen folgten ihm mit Verwunderung.
»Ich sehr misstrauischer Mann«, erklärte Carlos.
»In der Tat.«
Carlos ging zur Tür. »Hasta la vista.« Er öffnete die Tür einen Spalt, lugte vorsichtig hinaus und trat in den Korridor. »Zusperren«, sagte er, bevor er verschwand.
Henry tat kopfschüttelnd, wie ihm geheißen und kletterte zurück ins Bett. »Seltsamer Zeitgenosse«, dachte er noch, dann war er eingenickt.
Eine schöne Frau und eine Leiche
Henry erwachte aus einem Albtraum, in dem Carlos eine unheimliche Rolle gespielt hatte, gemeinsam mit Amanda und Yolanda, die ihn wieder einmal verführen wollten. Verwirrt sah er sich in dem fremden Zimmer um, ehe er sich erinnerte, wo er war. Er stieg aus dem Bett und bemerkte zu seinem Entsetzen, dass er eine Erektion hatte. Noch mehr beunruhigte ihn aber, dass Carlos noch nicht zurück war. Es war sieben Uhr abends und Carlos war seit über sechs Stunden fort.
Er kleidete sich an, verließ das Zimmer und klopfte an die Tür zu 205. Nichts rührte sich. Er klopfte wieder, diesmal etwas lauter, doch aus dem Zimmer drang kein Geräusch. Er drehte den Türknopf und zu seiner Überraschung ließ sich die Tür öffnen. Von Neugierde gepackt, steckte Henry den Kopf ins Zimmer, aber es war leer. Er rief, bekam jedoch keine Antwort. Da er nicht weiter eindringen wollte, schloss er rasch die Tür und kehrte in sein Zimmer zurück.
Draußen war es inzwischen dunkel geworden und Henry verspürte Lust auf einen kleinen Spaziergang. Aber in Carlos’ Abwesenheit wagte er nicht auszugehen und beschloss, die Hotelbar aufzusuchen. Vielleicht war Carlos zurückgekehrt, während er geschlafen hatte, und er hatte sein Klopfen nicht gehört. Er steckte etwas Geld ein, die Zimmerschlüssel und nahm den Aufzug nach unten. In der Bar saßen nur ein verliebtes Pärchen und eine junge Frau, die in einem Buch las und an einem Weinglas nippte.
Kein Carlos.
Die junge Frau hob den Kopf und sah flüchtig zu ihm herüber. Ganz gegen seinen Willen bemerkte er, dass sie schlanke Beine hatte und glänzendes schwarzes Haar. Rasch wandte er die Augen ab und bestellte bei dem gähnenden Barkeeper ein Lager-Bier. Er würde Carlos noch eine Stunde geben. Danach würde er den Koffer beim Empfangschef deponieren. Er wollte mit dem zweifelhaften Gepäck dieses paranoiden Kolumbianers nichts mehr zu tun haben.
Die junge schwarzhaarige Frau lächelte Henry zu und er runzelte die Stirn. Er mochte Menschen, die Bücher lasen, aber das Lächeln fand er unangebracht. Er starrte in sein Bier und fragte sich, was sie wohl las. Aus dem Augenwinkel bemerkte er, dass sie ihre Aufmerksamkeit wieder dem Buch gewidmet hatte und er versuchte, den Titel zu entziffern. Seine Stimmung erlebte einen radikalen Höhenflug. Sie las »Don Quijote«