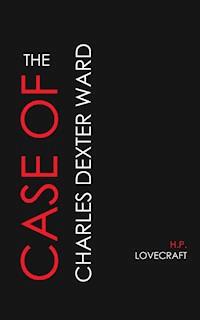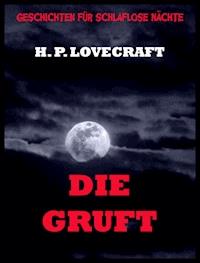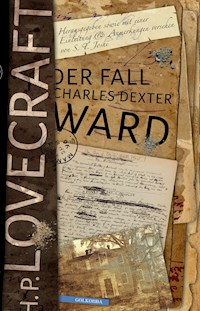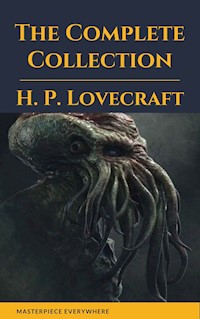4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Festa Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Nach der zweibändigen CHRONIK DES CTHULHU-MYTHOS folgen mit DIE LAUERNDE FURCHT und DER SILBERNE SCHLÜSSEL H. P. Lovecrafts restliche Horror- und Fantasygeschichten. Diese vier Bände enthalten das komplette unheimlich-fantastische Werk Lovecrafts (abgesehen von Kooperationen mit anderen Autoren). Inhalt: Die Aussage des Randolph Carter - Der silberne Schlüssel - Durch die Tore des silbernen Schlüssels - Die Traumsuche nach den unbekannten Kadath - Die Straße - In den Mauern von Eryx - Iranons Suche - Das Verderben, das über Sarnath kam - Polaris - Der Baum - Hypnos - Der Übergang des Juan Romero - Das Weiße Schiff - Celephais - Jenseits der Mauer des Schlafes - Die anderen GötterDie Katzen von Ulthar - Geschichten aus der Kinderzeit (7 bis 12 Jahre alt): Die kleine Glasflasche - Das Rätsel des Friedhofs oder 'Die Rache des Toten' - Die geheime Höhle oder John Lees Abenteuer - Das geheimnisvolle Schiff - Parodien: Ibid - Old Bugs - Sonett-Zyklus: Saat von den Sternen (Fungi from Yuggoth) - Muriel E. Eddy: Erinnerungen an Howard Phillips Lovecraft Stephen King: 'Der größte Horrorautor des 20. Jahrhunderts ist H. P. Lovecraft - daran gibt es keinen Zweifel.' Clive Barker: 'Lovecrafts Werk bildet die Grundlage des modernen Horrors.' Markus Heitz: 'Die zahlreichen Geschichten rund um den Cthulhu-Mythos beinhalten für mich bis heute enorme Kraft und Wirkung.'
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 633
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Horrorgeschichten
Die Aussage des Randolph Carter
Ich kann nur wiederholen, Gentlemen, dass Ihre Befragung sinnlos ist. Halten Sie mich hier fest, so lange Sie wollen. Sperren Sie mich ein oder richten Sie mich hin, wenn Sie ein Bauernopfer brauchen, um die Illusion, die Sie Gerechtigkeit nennen, aufrechtzuerhalten, doch ich kann Ihnen nicht mehr sagen, als ich schon gesagt habe. Alles, woran ich mich erinnere, habe ich Ihnen ganz offen mitgeteilt. Ich habe nichts übertrieben oder verheimlicht, und sollte noch etwas unklar sein, so liegt das an der dunklen Wolke, die meinen Verstand umhüllt – an dieser Wolke und der nebulösen Natur des Grauens, das sie über mich gebracht hat.
Ich wiederhole noch einmal, dass ich nicht weiß, was aus Harley Warren geworden ist, auch wenn ich glaube – ja geradezu hoffe –, dass er Frieden gefunden hat, sollte es diesen gesegneten Zustand überhaupt geben. Es ist wahr, dass ich fünf Jahre lang sein engster Freund gewesen bin und zum Teil an seinen schrecklichen Nachforschungen des Unbekannten teilnahm. Auch wenn meine Erinnerung unsicher und unklar ist, will ich gar nicht abstreiten, dass Ihr Zeuge uns beide auf der Gainsville Pike gesehen haben kann und dass wir, wie er sagt, in jener schrecklichen Nacht um halb zwölf Uhr in Richtung des großen Zypressensumpfes gingen. Dass wir Taschenlampen, Spaten und eine sonderbare Drahtspule mit daran angeschlossenen Geräten bei uns trugen, kann ich sogar bestätigen, denn all diese Dinge spielen eine Rolle in der einen grausigen Szene, die sich in mein erschüttertes Gedächtnis eingebrannt hat. Doch was dann folgte und warum man mich am nächsten Morgen alleine und benommen am Rand des Sumpfes fand – ich muss darauf beharren, dass ich nicht mehr weiß als das, was ich Ihnen ja wieder und wieder erzählt habe. Sie meinen, es gäbe im Sumpf und dessen Umgebung nichts, was den Schauplatz dieser entsetzlichen Episode bilden könnte. Ich kann nur wiederholen, dass ich nicht mehr weiß als das, was ich gesehen habe. Mag es nun Einbildung oder ein Albtraum gewesen sein – ich hoffe inständig, dass es nur Einbildung oder ein Albtraum gewesen ist –, es ist jedenfalls alles, was in meiner Erinnerung übrig ist von den Geschehnissen in jenen fürchterlichen Stunden, als wir aus der Sicht der Menschen verschwunden waren. Und warum Harley Warren nicht zurückkam, das weiß allein er oder sein Schatten – oder ein namenloses Ding, das ich nicht beschreiben kann.
Wie ich bereits sagte, waren mir Harley Warrens merkwürdige Untersuchungen sehr vertraut und bis zu einem gewissen Maß arbeitete ich selbst an ihnen mit. Aus seiner gewaltigen Sammlung seltsamer, seltener Bücher über verbotene Themen habe ich alle gelesen, die in einer Sprache verfasst sind, die ich verstehe, doch das waren nur wenige im Vergleich zu denen, deren Sprache ich nicht beherrsche. Die meisten davon, schätze ich, sind arabisch, und das teuflische Buch, das das Ende herbeiführte – das Buch, das er beim Verlassen dieser Welt in seiner Tasche trug –, war in Schriftzeichen geschrieben, wie ich sie noch nie gesehen hatte. Warren wollte mir nie sagen, was in diesem Buch stand.
Was unsere Forschungen angeht – muss ich nochmals wiederholen, dass ich nicht länger über meine vollen Geisteskräfte verfüge? Und das scheint mir eine Gnade zu sein, denn es handelte sich um schreckliche Forschungen, denen ich eher aus zögerlicher Faszination denn aus echter Neigung nachging. Warren war sehr dominant und manchmal hatte ich Angst vor ihm. Ich weiß noch, wie es mir in der Nacht vor dem schrecklichen Geschehen vor seinem Gesichtsausdruck graute, als er unablässig von seiner Theorie sprach, weshalb bestimmte Leichen nie verwesen, sondern tausend Jahre fest und fett in ihren Gräbern ruhen. Doch inzwischen habe ich keine Angst mehr vor ihm, denn ich vermute, dass er Schrecken jenseits meiner Vorstellungskraft erlebt hat. Jetzt habe ich Angst um ihn.
Noch einmal muss ich Ihnen versichern, dass ich keine klare Vorstellung davon habe, was wir in dieser Nacht eigentlich vorhatten. Es hatte sicherlich mit diesem Buch zu tun, das Warren bei sich trug – dieses uralte Buch mit den unlesbaren Schriftzeichen, das ihn ein Monat zuvor aus Indien erreicht hatte –, doch ich schwöre, dass ich nicht weiß, was wir zu finden erwarteten. Ihr Zeuge sagt, dass er uns um halb zwölf auf der Gainsville Pike sah, unterwegs in Richtung des großen Zypressensumpfes. Das trifft wahrscheinlich zu, aber ich kann mich nicht klar daran erinnern. Das Bild, das sich in meine Seele gebrannt hat, zeigt nur eine Szene, die sich lange nach Mitternacht zugetragen haben muss, denn der sinkende Halbmond stand hoch am dunstumwölkten Himmel.
Der Ort war ein uralter Friedhof, so alt, dass ich angesichts der vielen Zeichen unermesslicher Jahre erschauderte. Er befand sich in einem tiefen, feuchten Talkessel, überwuchert von wilden Gräsern, Moos und eigenartigem kriechenden Unkraut und erfüllt von einem undefinierbaren Gestank, den meine Fantasie absurderweise mit verfaulendem Gestein in Verbindung brachte. Überall waren die Anzeichen von Vernachlässigung und Verfall zu sehen, und mich beschlich der Gedanke, Warren und ich seien seit Jahrhunderten die ersten Lebewesen, die in diese tödliche Stille einbrachen. Über den Rand des Tales spähte ein fahler, abnehmender Sichelmond durch widerwärtige Dünste, die aus unbekannten Katakomben aufzusteigen schienen, und in den schwachen, unsteten Mondstrahlen konnte ich ein abstoßendes Aufgebot uralter Grabplatten, Urnen, Ehrengräber und Mausoleumsfassaden erkennen – alle bröckelnd, moosbedeckt, von einem feuchten Film überzogen und teilweise von der eklen Üppigkeit ungesunder Vegetation verborgen.
Der erste lebhafte Eindruck meiner eigenen Anwesenheit in dieser schrecklichen Nekropole setzt ein, als ich mit Warren vor einer halb zerstörten Grabstätte stehen blieb und einige der Lasten, die wir anscheinend hergetragen hatten, auf den Boden fallen ließ. Nun sah ich, dass ich eine Taschenlampe und zwei Spaten bei mir trug, während mein Begleiter mit einer ähnlichen Lampe und einem tragbaren Telefongerät ausgerüstet war. Kein Wort wurde gesprochen, denn der Ort und unsere Aufgabe schienen uns bekannt zu sein. Ohne Zögern ergriffen wir unsere Spaten und machten uns daran, Gräser, Unkraut und abgetragene Erde von der flachen, altertümlichen Grabstelle zu entfernen. Nachdem wir die gesamte Oberfläche, die aus drei riesigen Granittafeln bestand, befreit hatten, gingen wir einige Schritte zurück, um die morbide Szenerie zu betrachten; Warren schien im Geiste irgendwelchen Berechnungen nachzugehen. Dann ging er zu der Grabstätte zurück und benutzte seinen Spaten als Hebel, um die Platte anzuheben, die gleich neben einem Haufen Steine lag, der vielleicht mal ein Mahnmal gebildet hatte. Es gelang ihm nicht und er forderte mich auf, ihm zu helfen. Mit vereinten Kräften gelang es uns schließlich, den Stein zu lockern, anzuheben und zur Seite zu kippen.
Durch das Entfernen der Platte kam eine schwarze Öffnung zum Vorschein, der ein Ausfluss unreiner Faulgase entströmte, so ekelerregend, dass wir entsetzt zurückwichen. Nach einer Weile näherten wir uns wieder dem Grab und fanden die Ausdünstungen nicht mehr ganz so unerträglich. Unsere Lampen enthüllten uns den Beginn einer steinernen Treppe, triefnass von den widerlichen Sekreten der Erde und umgrenzt von feuchten Wänden, die mit Salpeter verkrustet waren. Und jetzt erinnere ich mich der ersten gesprochenen Worte – Warren sprach mich mit seiner weichen Tenorstimme an, eine Stimme, die eigenartig unberührt angesichts dieser grausigen Umgebung klang.
»Ich muss dich leider bitten, hier an der Oberfläche zu bleiben«, sagte er, »denn es wäre ein Verbrechen, jemanden mit deinen schwachen Nerven dort mit hinunterzunehmen. Trotz allem, was du gelesen hast und was ich dir erzählt habe, hast du keine Vorstellung davon, was mich dort erwartet und was ich erledigen muss. Es ist eine teuflische Arbeit, Carter, und ich bezweifle, dass ein Mann, dessen Nerven nicht aus Stahl sind, sie durchführen und lebendig und bei klarem Verstand wieder heraufkommen kann. Ich möchte dich nicht beleidigen, und der Himmel weiß, wie gern ich dich an meiner Seite hätte, doch in gewisser Weise ruht die Verantwortung auf mir, und ich könnte ein Nervenbündel wie dich da unten nicht gebrauchen, weil das den Wahnsinn oder den sicheren Tod bedeutet. Glaub mir, du hast keine Vorstellung davon, um was es in Wirklichkeit geht! Aber ich verspreche dir, dass ich dich über das Telefon über jeden meiner Schritte auf dem Laufenden halte – du siehst, ich habe hier genügend Kabel dabei, um damit zum Mittelpunkt der Erde und wieder zurück zu laufen!«
Ich höre noch immer diese kühn gesprochenen Worte und ich erinnere mich, dass ich protestierte. Offenbar war ich regelrecht darauf versessen, meinen Freund in die Tiefen des Grabes zu begleiten, doch er gab nicht nach. Irgendwann drohte er sogar, das ganze Experiment zu beenden, sollte ich weiter darauf beharren; eine effektive Drohung, da ja nur er allein die Sache ganz erfasste.
An all das kann ich mich noch erinnern, auch wenn ich nicht mehr weiß, wonach wir überhaupt suchten. Nachdem ich meine zögerliche Zustimmung zu seinem Vorhaben gegeben hatte, nahm Warren die Rolle mit dem Kabel und klemmte die Telefone an. Auf sein Nicken hin nahm ich eines davon und setzte mich auf einen vom Alter verblichenen Grabstein dicht bei der frischen Öffnung. Warren schüttelte mir noch die Hand, schlang die Kabelrolle über die Schulter und verschwand in diesem unbeschreiblichen Beinhaus.
Eine Minute lang sah ich noch das Glühen seiner Taschenlampe und hörte das Rasseln des Drahtes, den er nach sich zog, dann erlosch das Glühen abrupt, als sei er um eine Biegung der Treppe gebogen, und ebenso rasch erstarb jedes Geräusch. Ich war alleine und doch mit den unbekannten Tiefen verbunden über die magischen Kabel, deren Isolierung im launischen Licht des abnehmenden Mondes grün schimmerte.
Ich sah im Licht meiner Taschenlampe fortdauernd auf die Uhr und lauschte fieberhaft in den Telefonhörer, hörte aber über eine Viertelstunde lang nichts. Dann vernahm ich ein leises Klicken im Gerät und mit gepresster Stimme rief ich nach meinem Freund da unten. So besorgt ich auch war, ich war nicht vorbereitet auf die Worte, die aus der unheimlichen Gruft heraufdrangen. Sie klangen ängstlich, erregt, anders als alles, was ich je zuvor von Harley Warren gehört hatte. Er, der sich gerade noch so selbstsicher verabschiedet hatte, sprach nun von dort unten zu mir mit einem zittrigen Flüstern, das bedrohlicher wirkte als der lauteste Schrei.
»Gott! Wenn du sehen könntest, was ich hier sehe!«
Ich konnte nicht antworten. Stumm wartete ich ab. Dann vernahm ich wieder die panischen Worte: »Carter, es ist schrecklich – ungeheuerlich – unfassbar!«
Dieses Mal versagte mir die Stimme nicht und ich rief eine Flut aufgeregter Fragen in den Hörer. Panisch wiederholte ich immer wieder: »Warren, was ist da? Was ist da?«
Noch einmal erklang die Stimme meines Freundes, noch immer heiser vor Furcht und jetzt offenbar von Verzweiflung ergriffen: »Das kann ich dir nicht sagen, Carter! Es ist weit jenseits des Vorstellbaren – ich wage nicht, es dir zu beschreiben – kein Mensch könnte mit diesem Wissen weiterleben – großer Gott! Das hätte ich mir nie träumen lassen!«
Wieder Stille, mit Ausnahme meiner stockenden Fragenflut. Dann die Stimme Warrens in einem Tonfall wilder Fassungslosigkeit: »Carter! Um der Liebe Gottes willen, schieb die Grabplatte zurück auf ihren Platz und verschwinde von hier, wenn du es kannst! Rasch! – Lass alles liegen und flieh von diesem Ort – das ist deine einzige Chance! Tu, was ich dir sage, und stell keine Fragen!«
Ich verstand, vermochte aber nur, meine panischen Fragen zu wiederholen. Mich umgaben Gräber und Finsternis und Schatten – unter mir befand sich eine Gefahr jenseits des menschlichen Fassungsvermögens. Doch war mein Freund in größerer Bedrängnis als ich und trotz meiner Angst verspürte ich so etwas wie Groll darüber, dass er mich für fähig hielt, ihn in einer solchen Lage zurückzulassen.
Wieder klickte es mehrmals und nach einer Pause erklang ein kläglicher Schrei von Warren: »Hau ab! Um Gottes willen, schieb die Platte drauf und hau ab, Carter!«
Etwas in der Ausdrucksweise meines verstörten Gefährten brachte meine Handlungsfähigkeit zurück. Ich fasste einen Entschluss und rief ihm zu: »Warren, reiß dich zusammen! Ich komme runter!«
Doch auf diese Ankündigung antwortete mein Zuhörer mit einem Schrei reinster Verzweiflung: »Nein! Du kannst es nicht begreifen! Es ist zu spät – und meine eigene Schuld. Schieb die Platte zurück und lauf – es gibt nichts, was du oder sonst jemand jetzt noch tun könnte!«
Wieder veränderte sich sein Tonfall, jetzt klang er weicher, nach hoffnungsloser Resignation. Und doch hörte ich die ängstliche Erregung weiter heraus.
»Schnell – bevor es zu spät ist!«
Ich hörte nicht auf ihn, versuchte, die Betäubung zu lösen, die mich gefangen hielt, und mein Vorhaben auszuführen, ihm dort unten zu Hilfe zu kommen. Doch sein nächstes Flüstern fand mich noch immer reglos in den Ketten blanken Horrors.
»Carter – beeil dich! Es ist sinnlos – du musst gehen – besser einer als zwei – die Grabplatte –«
Stille, weiteres Klicken, dann Warrens schwache Stimme: »Es ist fast vorbei – mach es nicht schlimmer – versperre diese verfluchte Treppe und renn um dein Leben – du verlierst Zeit – lebe wohl, Carter – werde dich nicht wiedersehen.«
An dieser Stelle schwoll Carters Flüstern zu einem Schrei an, einem Schrei, der allmählich zu einem Kreischen wurde, erfüllt von Grauen aller Zeitalter …
»Verflucht sei diese teuflische Brut – Heerscharen – mein Gott! Hau ab! Hau ab! Hau ab!«
Danach war es still. Ich weiß nicht, wie unermesslich lange ich wie betäubt dasaß und in dieses Telefon flüsterte, murmelte, brüllte und schrie, immer und immer wieder: »Warren! Warren! Antworte mir – bist du noch da?«
Und dann kam das unübertroffene Grauen – das Unglaubliche, Unvorstellbare, geradezu Unaussprechliche. Ich habe gesagt, dass seit Warrens letzter verzweifelter Warnung ein unermesslicher Zeitraum verstrichen zu sein schien und dass nur noch meine eigenen Rufe die entsetzliche Stille zerrissen. Doch nach einer Weile klickte es wieder im Hörer und ich lauschte gebannt. Wieder rief ich: »Warren, bist du noch da?«
Als Antwort darauf hörte ich das, was mich überschnappen ließ. Ich werde nicht versuchen, Gentlemen, eine Erklärung für – diese Stimme – zu finden. Ich kann sie auch nicht genauer beschreiben, da ich schon nach den ersten Worten die Besinnung verlor und in ein schwarzes Loch fiel, aus dem ich erst im Krankenhaus wieder erwachte.
Soll ich sagen, dass diese Stimme tief war, hohl, gallertartig, weit entfernt, nicht von dieser Welt, seelenlos, körperlos? Was kann ich sagen? Es war das Ende meines Erlebnisses, und es ist das Ende meiner Geschichte. Ich hörte sie, und dann weiß ich nichts mehr – hörte sie, während ich wie versteinert auf diesem unbekannten Friedhof in der Talsenke saß, inmitten bröckelnder Steine, eingestürzter Gräber, wild wuchernder Vegetation und giftigen Dünsten – hörte sie aus den unauslotbaren Tiefen dieses verdammten offenen Grabes, während ich zusah, wie unförmige, aasfressende Schatten unter dem verfluchten, abnehmenden Mond tanzten.
Und dies hat die Stimme gesagt: »Du Narr, Warren ist tot!«
Der silberne Schlüssel
Als Randolph Carter dreißig Jahre alt war, verlor er den Schlüssel zum Tor der Träume. Zuvor war er der Eintönigkeit des Lebens in nächtlichen Ausflügen entflohen, zu fremden, uralten Städten jenseits des Weltraums, in zauberhafte, unbeschreibliche Gartenlandschaften hinter wohlriechenden Meeren – doch nun, da die mittleren Lebensjahre sich über ihn legten, fühlte er, wie ihm diese Freiheiten nach und nach entglitten, bis er schließlich gar keinen Zugang mehr zu ihnen fand. So konnten seine Galeeren den Fluss Oukranos nicht mehr aufwärtssegeln, vorbei an den goldenen Türmen von Thran, noch vermochten seine Elefantenkarawanen durch die parfümierten Dschungel Kleds zu ziehen, wo vergessene Paläste mit Säulen aus geädertem Elfenbein lieblich und unbeschadet unter dem Mond schlafen.
Er hatte viel darüber gelesen, wie die Dinge wirklich sind, und mit viel zu vielen Menschen gesprochen. Wohlmeinende Philosophen hatten ihn gelehrt, die logischen Beziehungen zwischen den Dingen zu beachten und die Vorgänge zu analysieren, die seinen Gedanken und Tagträumen Gestalt verliehen. Das Wunderbare war entschwunden, und er hatte vergessen, dass das Leben nicht mehr ist als eine Folge von Bildern im Gehirn, bei denen es egal ist, ob sie der Wirklichkeit oder Träumereien entstammen, es also auch keinen Grund gibt, das eine höher zu werten als das andere. Die Gewohnheit hatte ihm eine abergläubische Ehrfurcht vor allem Greifbaren und körperlich Existenten eingeprägt und insgeheim verspürte er Scham darüber, früher in Visionen geschwelgt zu haben. Weise Männer hatten ihm erklärt, seine armseligen Tagträumereien seien kindisch und albern und völlig absurd, weil ihre Akteure vortäuschten, voller Bedeutsamkeit und Geltung zu sein, wo sich doch der blinde Kosmos ziellos immer weiterschleift – vom Nichts ins Dasein und vom Dasein wiederum ins Nichts, ungeachtet der Wünsche oder der Existenz der Geister, die eine Sekunde lang in der Dunkelheit aufflackern und dann wieder verlöschen.
Man hatte ihn mit den realen Dingen verkettet und anschließend die Funktionen dieser Dinge so lange erläutert, bis alle Rätsel aus der Welt vertrieben waren. Als er sich darüber beklagte und sehnsuchtsvoll in die Reiche des Zwielichts entfliehen wollte, wo Magie all die kleinen, lebhaften Bruchstücke und geliebten Assoziationen seines Geistes zu Bereichen von atemloser Erwartung und unendlichen Entzückens fügte, lenkten sie seine Aufmerksamkeit auf die neuesten Wunder der Wissenschaft und forderten ihn auf, im Wirbeln der Atome und in den Dimensionen des Himmels Mysterien zu finden. Und als es ihm nicht gelingen wollte, diese Empfindungen für Dinge zu hegen, deren Gesetzmäßigkeiten bekannt und messbar waren, da nannten sie ihn einfallslos und unreif, weil er die Illusionen des Traumes den Illusionen unserer fassbaren Schöpfungen vorziehe.
Und so versuchte Carter zu leben, wie andre leben, und gab vor, dass die gewöhnlichen Geschehnisse und die Empfindungen weltlicher Gemüter bedeutsamer seien als die Fantasien seltener und zärtlicher Seelen. Er widersprach nicht, als man ihm sagte, der animalische Schmerz eines verletzten Schweins oder eines Bauern mit Verdauungsstörungen seien großartiger als die unerreichte Schönheit Naraths mit seinen hundert aus Chalzedon gemeißelten Portalen und Kuppeln, an die er sich dunkel aus seinen Träumen erinnerte; und dank ihrer Unterweisungen entwickelte er ein biederes Gespür für Mitleid und Tragödien.
Doch nicht immer vermochte er darüber hinwegzusehen, wie seicht, unbeständig und bedeutungslos alle menschlichen Bestrebungen sind und welch schwachen Antrieb unsere realen Taten im Vergleich zu unseren hohen Idealen abgeben. Dann suchte er Trost in einem höflichen Lachen, das man ihm beigebracht hatte als Waffe gegen die überspannte, künstliche Welt der Träume; denn er erkannte, dass das tägliche Leben unserer Welt in jeder Hinsicht ebenso überspannt und künstlich war. Zudem verdiente diese viel weniger Respekt, mangelte es ihr doch an Schönheit und der Aufrichtigkeit, sich den eigenen Mangel an Vernunft und Sinn einzugestehen. Darüber wurde er zu einer Art Spaßmacher, weil er nicht erkannte, dass in einem unbeseelten Weltall, das keiner wirklichen Norm von Beständigkeit oder Auflösung folgt, selbst Humor bedeutungslos ist.
In den ersten Tagen seiner Knechtschaft hatte er sich dem sanften kirchlichen Glauben zugewandt, der ihm wegen des naiven Vertrauens seiner Väter lieb geworden war, denn in diesem Glauben erstreckten sich mystische Alleen, die einen Ausweg aus dem Leben versprachen. Erst bei näherer Betrachtung erkannte er die längst verwelkte Schönheit, die entkräfteten, prosaischen Phrasen, den schulmeisterlichen Ernst und den grotesken Anspruch, die absolute Wahrheit zu verkünden, die unter den meisten Gläubigen auf so anödende und umfassende Art vorherrschten. Er empfand in vollem Ausmaß die Unbeholfenheit des Versuchs, die längst überholten Ängste und Mutmaßungen eines antiken Volkes, das dem Unbekannten gegenüberstand, als eindeutige Tatsachen am Leben zu erhalten. Es ermüdete Carter zu sehen, wie Menschen voll heiligen Ernstes versuchten, irdische Wirklichkeit aus alten Mythen herzuleiten, die doch von ihrer Wissenschaft, auf die sie so stolz waren, von Anfang bis Ende widerlegt wurden. Dieser fehlgeleitete Ernst tötete in ihm jede Hingabe, die er für den alten Glauben vielleicht noch bewahrt hätte, wären ihm die klangvollen Riten und Emotionen einfach in ihrer wahren Gestalt als selige Fantasien präsentiert worden.
Doch als er sich den Menschen zuwandte, die die alten Mythen verworfen hatten, da fand er sie noch hässlicher als diejenigen, die an ihnen festhielten. Sie wussten nicht, dass Schönheit allein in Harmonie begründet liegt und dass für den Liebreiz des Lebens in einem ziellosen Kosmos kein anderer Maßstab gilt als die Harmonie der vorangegangenen Träume und Empfindungen, aus denen unsere kleinen Sphären inmitten des restlichen Chaos blind geformt worden sind. Sie begriffen nicht, dass Gut und Böse, Schönheit und Hässlichkeit nur der Zierrat einer Sichtweise sind, deren einziger Wert in ihrer Verbindung zum zufälligen Denken und Fühlen unserer Vorväter liegt und deren zarte Einzelheiten sich bei jedem Volk und jeder Kultur unterscheiden. Entweder leugneten sie diese Dinge rundheraus, oder aber sie übertrugen sie auf die rohen, unklaren Instinkte, die sie mit den Tieren und den Spießbürgern gemein hatten. So schleppten sie sich auf abstoßende Weise durch ihr Leben in Schmerz, Hässlichkeit und Entstellung dahin, dennoch erfüllt vom lächerlichen Stolz, etwas entronnen zu sein, das nicht verdorbener war als das, was sie jetzt gepackt hält. Sie hatten bloß die falschen Götter der Angst und blinden Frömmigkeit mit denen der Freiheit und des Chaos vertauscht.
Carter kostete nicht viel von diesen modernen Freiheiten, denn ihre Nutzlosigkeit und Schäbigkeit machten jeden Geist krank, der die reine Schönheit liebt. Carters Verstand rebellierte gegen die fadenscheinige Logik, mit der die Verkünder dieser Freiheiten niedere Instinkte in die Robe der Heiligkeit kleiden wollten, die sie den von ihnen gestürzten Götzen geraubt hatten. Er erkannte, dass die meisten von ihnen – ganz so wie die listigen Pfaffen, die sie doch ablehnten – sich nicht dem Irrtum entziehen konnten, das Leben habe noch irgendeine tiefere Bedeutung außer der, die ihm von träumenden Menschen zugeschrieben wird. Abgesehen von ästhetischen Fragen konnten sie ihre primitiven Begriffe von Ethik und Verantwortung nicht aufgeben, selbst dann nicht, als die Natur im Lichte der wissenschaftlichen Aufklärung ihnen ihre Seelenlosigkeit und gewöhnliche Sittenlosigkeit nur so entgegenschrie. Erfüllt von bigotten, voreingenommenen Illusionen über Gerechtigkeit, Freiheit und Stabilität verwarfen sie die alten Lehren, die alten Bräuche und den alten Glauben; sie kamen nie auch nur auf den Gedanken, dass ebenjene Lehren und Bräuche die alleinige Wurzel ihrer momentanen Vorstellungen und Urteile waren und die einzigen Richtlinien und Maßstäbe in einem unbedeutenden Universum ohne klaren Sinn oder feste Grundsätze bildeten. Da sie diesen künstlichen Rahmen verloren hatten, fehlte es ihrem Leben zunehmend an Zielen und aktivem Interesse, bis sie schließlich ihre Langeweile nur noch in Hast und vorgeblich nützlichen Tätigkeiten, in Lärm und Erregung, gefühllosen Schauspielen und tierischen Lüsten zu ertränken vermochten. Verblasste der Reiz dieser Dinge und brachte Enttäuschung oder Überdruss mit sich, dann kultivierten diese Menschen Ironie und Verbitterung und suchten die Fehler in der gesellschaftlichen Ordnung. Niemals wurde ihnen bewusst, dass ihre primitiven Prinzipien ebenso wacklig und widersprüchlich waren wie die Götter ihrer Ahnen, und dass die Zufriedenheit des einen Moments bereits die Zerstörung des nächsten in sich trägt. Ruhige, beharrliche Schönheit gibt es nur im Traum, und diesen Trost hat die Welt verschmäht, als sie in ihrer Verehrung der Wirklichkeit die Geheimnisse der Kindheit und Unschuld von sich warf.
Inmitten dieses Chaos’ der Leere und Unrast versuchte Carter, so zu leben, wie es einem Mann von Intelligenz und guter Herkunft gebührt. Da seine Träume unter dem Spott des Zeitalters verwelkten, konnte er an gar nichts mehr glauben, doch ließ seine Liebe zur Harmonie ihn die Gebräuche seines Volkes und Ranges wahren.
Teilnahmslos wandelte er durch die Städte der Menschen und seufzte, weil kein Anblick ihm wirklich real erschien. Jedes Aufblitzen des goldenen Sonnenlichts oben auf den hohen Dächern und jeder Blick auf balustradenumsäumte Plätze im Lampenschein des Abends erinnerte ihn nur an seine früheren Träume und dann überkam ihn Heimweh nach den überirdischen Ländern, die er nicht mehr zu finden vermochte. Reisen war bloß noch eine Verhöhnung. Selbst der Erste Weltkrieg kümmerte ihn nur wenig, auch wenn er von Beginn an in der französischen Fremdenlegion diente. Eine Zeit lang versuchte er, Freunde zu finden, wurde ihrer rohen Gefühle jedoch bald müde, ihrer immer gleichen, selbstsüchtigen Visionen. Er war in gewisser Weise froh darüber, dass seine Verwandten alle fern von ihm lebten und in keinem Kontakt mit ihm standen, denn sie hätten sein Seelenleben nicht verstanden. Das hatten allein sein Großvater und sein Großonkel Christopher vermocht, und die waren seit Langem schon tot.
Dann ging er erneut daran, Bücher zu schreiben, denn er hatte damit aufgehört, als seine Träume ausgeblieben waren. Doch auch darin fand er keine Befriedigung oder Erfüllung, denn die Welt hielt seinen Geist fest im Griff, und er konnte nicht mehr an Liebliches denken, wie es ihm zuvor vergönnt gewesen war. Die Ironie riss all die Minarette wieder ein, die er im Dämmerlicht errichtete, und die irdische Angst vor dem Unwahrscheinlichen ließ all die zarten und wundersamen Blüten seiner Märchengärten vertrocknen. Konventionelles, hohles Mitleid übergoss seine Romanfiguren mit Rührseligkeit, während der Mythos von der Wichtigkeit der Realität und von der Bedeutung menschlicher Erlebnisse und Gefühle alle seine erhabenen Fantasien zu schlecht verhohlenen Sinnbildern und billiger Gesellschaftssatire verkommen ließ. Seine neuen Romane waren viel erfolgreicher als seine früheren; und weil er wusste, wie nichtig sie sein mussten, da sie einer nichtigen Herde gefielen, verbrannte er sie und gab das Schreiben auf. Es waren sehr kultivierte Romane gewesen, in denen er ganz weltmännisch die Träume bespöttelte, die er mit leichter Hand zu Papier brachte, doch ihm blieb nicht verborgen, dass ihre Aufgeblasenheit ihnen alle Lebenskraft entzog.
Danach gab er sich willentlich Illusionen hin und befasste sich mit dem Bizarren und Exzentrischen, als sei es ein Gegengift zum Gewöhnlichen. Das meiste davon erwies sich jedoch schnell als armselig und öde, und er erkannte, dass die populären Lehren des Okkultismus ebenso trocken und starr waren wie die der Wissenschaft, jedoch ohne den vagen Trost einer Wahrheit, um sie erträglich zu machen. Abstoßende Dummheit, Lügen und wirre Gedanken sind nicht dasselbe wie Träume und bieten einem Verstand, der sich an Höherem gebildet hat, keinen Ausweg aus dem Leben.
Doch Carter besorgte sich immer seltsamere Bücher und suchte immer tiefsinnigere und schrecklichere Männer von absonderlicher Belesenheit auf, tauchte tief ein in die Geheimlehren des Bewusstseins, die nur wenige je erforscht hatten. So erfuhr er mehr über die verborgenen Abgründe des Lebens, der Legenden und der uralten Vergangenheit, was ihn enorm verstörte. Er entschloss sich, ungewöhnlicher zu leben, und richtete sein Haus in Boston so ein, wie es seinen wechselnden Stimmungen entsprach – ein Zimmer für jede Laune, tapeziert in den entsprechenden Farben, mit den geeigneten Büchern und Kunstgegenständen eingerichtet, erfüllt mit passendem Licht, Temperaturen, Tönen, Speisen und Gerüchen.
Einmal hörte er von einem Mann, der im Süden lebte und den man mied und fürchtete wegen der gotteslästerlichen Dinge, die er in vorgeschichtlichen Schriften und auf Lehmtafeln gelesen hatte, die aus Indien und Arabien ins Land geschmuggelt worden waren.
Carter suchte ihn auf und blieb sieben Jahre bei ihm, um seine Studien gemeinsam mit ihm zu betreiben, bis sie eines Mitternachts das Grauen auf einem unbekannten und uralten Friedhof einholte und nur einer das Gelände verließ, obwohl beide es betreten hatten. Danach kehrte er nach Arkham zurück, der schrecklichen, von Hexerei heimgesuchten Stadt seiner Ahnen in Neuengland, und dort in der Dunkelheit inmitten der altersgrauen Weiden und schwankenden Walmdächer machte er Erfahrungen, die ihn dazu bewogen, bestimmte Seiten im Tagebuch eines verrückt gewordenen Vorfahren endgültig zu versiegeln. Doch diese Schrecken trugen ihn nur an die Grenze der Realität, sie führten nicht ins wahre Traumland, das er in seiner Jugend gekannt hatte. Als er fünfzig wurde, gab er alle Hoffnung auf, Ruhe und Zufriedenheit in einer Welt zu finden, die zu gehetzt für die Schönheit und zu scharfsinnig für Träume geworden war.
Da Carter nun endlich die Leere und Sinnlosigkeit aller wirklichen Dinge erkannt hatte, verbrachte er seine Tage in Abgeschiedenheit, voll von sehnsüchtigen und bruchstückhaften Erinnerungen an seine traumerfüllte Jugend. Er hielt es für albern, überhaupt noch am Leben zu bleiben, und beschaffte sich von einem südamerikanischen Bekannten eine sehr eigenartige Flüssigkeit, die ihm ohne Schmerzen das ewige Vergessen bringen sollte. Passivität und die Macht der Gewohnheit ließen ihn die Tat jedoch immer wieder aufschieben, und so verharrte er unentschlossen inmitten seiner Gedanken an die alten Zeiten, nahm die seltsamen Behänge von den Wänden seines Hauses und richtete es so ein, wie es in seiner frühen Kindheit ausgesehen hatte – mit purpurnen Fensterscheiben, viktorianischem Mobiliar und allem, was dazugehört.
Im Verlauf der Zeit war er nahezu froh darüber, gezögert zu haben, ließen doch die Relikte seiner Jugend und seine Absonderung von der Welt das Leben und alle aufgeblasene Kultiviertheit sehr fern und unwirklich erscheinen, so fern, dass sich in seinen nächtlichen Schlummer wieder so etwas wie ein Hauch von Magie und Erwartung schlich. Seit vielen Jahren waren im Schlaf nur die verzerrten Spiegelungen alltäglicher Dinge aufgetaucht, so wie es im gewöhnlichen Schlaf immer ist, doch nun flackerte darin wieder etwas Neues und Wilderes auf, etwas von unklarer, aber großer Bedeutung, das die Form von unruhigen, deutlichen Bildern aus den Tagen seiner Kindheit annahm und ihn an kleine, belanglose Dinge erinnerte, die er lang schon vergessen hatte. Oft wachte er auf, weil er nach seiner Mutter und seinem Großvater rief, die bereits seit einem Vierteljahrhundert in ihren Gräbern ruhten.
Eines Nachts jedoch erinnerte sein Großvater ihn an den Schlüssel. Der grauhaarige alte Gelehrte, so übermütig wie zu Lebzeiten, sprach lange und voller Ernst. Er erzählte Carter von ihrem uralten Stammbaum und den seltsamen Visionen der feinsinnigen und sensiblen Männer, die zu ihren Ahnen zählten. Er berichtete von dem Kreuzritter mit dem flammenden Blick, dem die Sarazenen, die ihn in Gefangenschaft hielten, ungeheuerliche Geheimnisse beibrachten, und vom ersten Sir Randolph Carter, der die Magie studierte, als Elisabeth über England herrschte. Er erzählte auch von Edmund Carter, der bei den Hexenprozessen von Salem nur ganz knapp dem Galgen entgangen war und der einen von seinen Urahnen geerbten großen Silberschlüssel in einem uralten Kästchen verwahrt hatte. Bevor Carter erwachte, verriet der freundliche Besucher ihm noch, wo er dieses Kästchen finden konnte – das eigenartige Kästchen aus geschnitztem Eichenholz, dessen grotesker Deckel seit zwei Jahrhunderten von keiner Menschenhand geöffnet worden war.
Im Staub und in den Schatten der großen Dachkammer fand er es, vergessen und ganz hinten in der Schublade einer hohen Kommode. Das viereckige Kästchen hatte einen Durchmesser von ungefähr dreißig Zentimetern, und die gotischen Schnitzereien darauf waren so grässlich, dass er sich nicht wunderte, weshalb seit Edmund Carter niemand mehr gewagt hatte, es zu öffnen. Als er es schüttelte, hörte er keinen Ton, doch es roch geheimnisvoll nach längst vergessenen Gewürzen. Dass dieses Kästchen einen Schlüssel enthielt, war sicher nur eine dunkle Legende, zumindest hatte Randolph Carters Vater von der Existenz dieses Kästchens nichts gewusst. Es war mit rostigem Eisen beschlagen und das robuste Schloss ließ sich nicht öffnen. Carter ahnte vage, dass er darin so etwas wie einen Schlüssel zur verlorenen Pforte der Träume finden würde, doch wo und wie er diesen anwenden solle, hatte sein Großvater ihm nicht offenbart.
Ein alter Diener brach den geschnitzten Deckel auf, und dabei erschauderte er wegen der scheußlichen Fratzen, die ihn von dem geschwärzten Holz unangenehm vertraut anstarrten. Im Innern lag, in ein vergilbtes Pergament eingewickelt, ein großer, mit rätselhaften Arabesken bedeckter Schlüssel aus angelaufenem Silber. Eine weitere Erklärung war jedoch nicht beigefügt. Das Pergament war umfangreich, enthielt aber nur sonderbare Hieroglyphen einer unbekannten Sprache, die wahrscheinlich mit einem uralten Schilfrohr geschrieben worden waren. Carter kannte diese Schriftzeichen von einer bestimmten Papyrusrolle, die er bei dem schrecklichen Gelehrten aus dem Süden gesehen hatte, der eines Nachts auf einem namenlosen Friedhof verschwunden war. Der Mann hatte immer gezittert, wenn er in dieser Schriftrolle gelesen hatte, und Carter zitterte jetzt ebenfalls.
Doch er reinigte den Schlüssel und hatte ihn nachts in dem duftenden Kästchen aus uraltem Eichenholz neben seinem Bett stehen. Seine Träume wurden jetzt zunehmend lebhafter, und obwohl er keine der sonderbaren Städte und unglaublichen Gärten von einst wiedersah, wiesen sie doch in eine gewisse Richtung, deren Ziel unmissverständlich war. Sie riefen ihn durch die Jahre zurück, zogen ihn mit dem vereinten Willen all seiner Vorväter zum verborgenen Ursprung seiner Ahnen. Da wusste er, dass er sich der Vergangenheit zuwenden und sich mit den alten Dingen beschäftigen musste, und jeden Tag dachte er an die Hügel im Norden, wo das gespenstische Arkham und der reißende Miskatonic und der einsame Landsitz seiner Familie lagen.
In der brütenden Hitze des Herbstes schlug Carter den alten Weg ein, an den er sich so gut erinnerte, vorbei an graziösen Hügelketten und von Steinmauern umsäumten Weiden, fernen Tälern und schroffen Wäldern, gewundenen Straßen, ruhigen Bauernhöfen und den kristallklaren Windungen des Miskatonic, den hier und da altmodische Holz- und Steinbrücken überspannten. An einer Biegung sah er die Gruppe gewaltiger Ulmen, zwischen denen vor anderthalb Jahrhunderten einer seiner Vorfahren auf ungeklärte Weise verschwunden war, und er erschauderte, als der Wind voller Andeutungen durch die Baumkronen strich. Und da stand noch das zerfallene Gutshaus der alten Hexe Goody Fowler mit den bösen kleinen Fenstern und dem großen Dach, das an seiner Nordseite fast bis auf den Boden hing. Er beschleunigte den Wagen, als er daran vorbeifuhr, und drosselte die Geschwindigkeit erst wieder, als er oben auf dem Hügel ankam. Hier waren seine Mutter und ihre Vorfahren geboren worden. Das alte weiße Haus überblickte noch immer stolz die Straße und das atemberaubend schöne Panorama von Felshängen und das grüne Tal mit den entlegenen Kirchtürmen von Kingsport am Horizont und einer Ahnung der uralten, traumerfüllten See in weiter Ferne.
Nun folgte der steile Hang, auf dem sich das alte Anwesen der Carters befand, das er seit über vierzig Jahren nicht mehr gesehen hatte. Der Nachmittag neigte sich dem Ende zu, als er den Fuß des Hügels erreichte. Auf halber Höhe hielt er in einer Kurve an, um die sich ausbreitende Landschaft zu betrachten, die von den schräg einfallenden, goldenen Lichtfluten der Abendsonne in Herrlichkeit und Magie getaucht wurde. Alles Seltsame und Erwartungsvolle seiner jüngsten Träume schien in dieser stillen und unirdischen Landschaft gegenwärtig zu sein, und er dachte an die unbekannte Einsamkeit anderer Planeten, während sein Blick über die weichen und verlassenen Wiesen strich, die zwischen verfallenen Mauern wogten, über die märchenhaften Baumgruppen, die sich von den fernen Umrissen violetter Hügel abhoben, und über das gespenstisch bewaldete Tal tief unten im Schatten, wo in feuchten Bodensenken unter angeschwollenen, knorrigen Wurzeln Gewässer leise gurgelten.
Ihm kam der Gedanke, sein Auto sei ein Fremdkörper in dem Reich, nach dem er suchte, und so ließ er den Wagen am Waldrand stehen, steckte den großen Schlüssel in seine Jackentasche und stieg zu Fuß den Hügel hinauf. Zu allen Seiten war er nun von Wald umgeben, doch er wusste, dass das Haus sich auf einer hohen Hügelkuppe befand, die zumindest im Norden frei von Bäumen war. Er fragte sich, wie das Haus jetzt wohl aussah, stand es doch seit dem Tod seines merkwürdigen Großonkels Christopher vor dreißig Jahren leer und niemand hatte sich seitdem darum gekümmert. Als kleiner Junge hatte er sich immer auf die langen Besuche hier gefreut und seltsame Abenteuer in den Wäldern jenseits des Obstgartens erlebt.
Die Schatten um ihn wurden immer dichter, die Nacht kündigte sich an. Einmal lichteten sich zu seiner Rechten die Bäume ein wenig und er sah über die im Dämmerlicht liegenden Wiesen hinweg den Turm der alten Gemeindekirche auf dem Central Hill in Kingsport, blassrot im letzten Sonnenlicht; die kleinen, runden Fensterscheiben reflektierten das Himmelsfeuer. Als er wieder in die Schatten trat, wurde ihm überraschend bewusst, dass dieser Ausblick nur eine Kindheitserinnerung sein konnte, denn die alte weiße Kirche war ja längst abgerissen worden, um dem Gemeindekrankenhaus Platz zu schaffen. Carter hatte mit Interesse davon gelesen, denn die Zeitungen hatten von einigen seltsamen Höhlen oder Durchgängen im Felsen unter der Kirche berichtet.
Zu seiner Verwirrung hörte er, wie jemand nach ihm rief, und erschrak über die nach so langen Jahren unerwartete Vertrautheit. Der alte Benijah Corey, der Diener seines Onkels Christopher, war schon damals, in den weit zurückliegenden Tagen seiner Kindheit, ein alter Mann gewesen. Er musste inzwischen schon über hundert sein, aber diese hohe Stimme konnte nur ihm gehören. Carter vermochte keine einzelnen Worte herauszuhören, doch der Ton war eindringlich und unverwechselbar. Unglaublich, dass der »alte Benijy« noch leben sollte!
»Mister Randy! Mister Randy! Wo biste denn? Willste deine Tante Marthy etwa zu Tode erschrecken? Hat se dir denn nich aufgetragen, nachmittags in der Näh vom Haus zu bleiben und heimzukommen, wenn’s dunkel wird? Randy! Ran … dee! Ich hab noch nie ’n Jungen gesehn, der so wild drauf is, innen Wald zu rennen, die halbe Zeit über streunt er bei der Schlangengrube im Hochwald rum! … He da, Ran … dee!«
Randolph Carter blieb in der pechschwarzen Finsternis stehen und rieb sich die Augen. Irgendetwas stimmte nicht. Er war irgendwo gewesen, wo er eigentlich nicht hätte hingedurft, war vom Weg abgekommen und an Orte gelangt, wo er nicht hingehörte, und jetzt hatte er sich unentschuldbar verspätet. Er hatte nicht nach der Uhrzeit auf dem Kirchturm von Kingsport gesehen, obwohl er sie mit seinem Taschenfernrohr hätte erkennen können, aber seine Verspätung, das wusste er, war etwas sehr Merkwürdiges, noch nie da gewesenes. Er war sich gar nicht sicher, ob er sein kleines Fernrohr überhaupt bei sich trug, und tastete mit der Hand in seiner Jackentasche. Nein, dort war es nicht, aber da war der große silberne Schlüssel, den er irgendwo in einem Kästchen gefunden hatte.
Onkel Chris hatte ihm einmal eine sonderbare Geschichte über ein altes, verschlossenes Kästchen mit einem Schlüssel darin erzählt, aber Tante Martha hatte ihn abrupt gestoppt und gesagt, das sei nun wirklich keine Geschichte für ein Kind, dessen Kopf ohnehin schon voller Grillen sei. Er versuchte, sich zu erinnern, wo genau er den Schlüssel entdeckt hatte, aber irgendetwas verwirrte ihn sehr. Er vermutete, dass er ihn in der Dachkammer daheim in Boston gefunden hatte, und dunkel erinnerte er sich daran, seinen Diener Parks mit der Hälfte eines Wochenlohns bestochen zu haben, das Kästchen für ihn zu öffnen und Stillschweigen darüber zu bewahren. Als ihm das jetzt einfiel, sah er plötzlich Parks’ Gesicht vor sich – es war voll tiefer Falten, als sei der forsche kleine Cockney rasch gealtert.
»Ran … dee! Ran … dee! He! He! Randy!«
Eine schwankende Laterne bog aus dem Dunkeln um die Ecke und der alte Benijah schimpfte auf den stummen und verwunderten Wanderer ein: »Verdammt Junge, hier biste ja! Haste denn keine Zunge im Mund, dass du mir keine Antwort geben kannst? Ich ruf schon ’ne halbe Stund nach dir, du musst das doch gehört ham! Weißte denn nich, dass deine Tante Marthy ganz aufgeregt is, weil du im Dunkeln noch unterwegs bist? Wart nur, wenn ich das deinem Onkel Chris erzähl, wenn er nach Haus kommt! Du weißt doch, dass der Wald hier kein Ort is, wo man zu dieser Stund noch rumläuft! Abseits vom Weg gibt’s Dinger, die nix Gutes mit einem vorham, das hat schon mein alter Herr gesagt. Komm, Mister Randy, die Hannah hält’s Abendessen nicht mehr lang warm!«
Auf diese Weise wurde Randolph Carter die Straße hinaufgeführt und durch die hohen, herbstlichen Äste leuchteten sonderbare Sterne. Als nach einer Wegbiegung das gelbe Licht kleiner Fenster aufstrahlte, schlugen die Hunde an und das Siebengestirn funkelte über der unbewaldeten Hügelkuppe, wo sich ein großes Walmdach schwarz vor dem dunkler werdenden Westhimmel abhob. Tante Martha stand in der Tür, doch sie schimpfte nicht zu sehr, als Benijah den Herumtreiber ins Haus schob. Sie kannte Onkel Chris lange genug, um so etwas von einem Carter zu erwarten.
Randolph zeigte niemandem seinen Schlüssel. Er aß schweigend sein Abendbrot, erst als es an der Zeit war, zu Bett zu gehen, murrte er. Manchmal fiel es ihm leichter, im Wachen zu träumen, und er wollte diesen Schlüssel benutzen.
Am nächsten Morgen stand Randolph schon früh auf und wäre in den Hochwald gelaufen, hätte Onkel Chris ihn nicht abgefangen und auf seinen Stuhl am Frühstückstisch kommandiert. Randolph blickte sich ungeduldig in dem niedrigen Zimmer mit dem Flickenteppich, den freiliegenden Deckenbalken und Eckpfeilern um und lächelte erst, als die Obstbäume im Hof mit ihren Ästen an den Bleiglasscheiben des rückwärtigen Fensters kratzten. Die Bäume und Hügel waren ganz nah und sie bildeten das Tor zu jenem zeitlosen Reich, das seine wahre Heimat war.
Als er endlich raus durfte, tastete er in seiner Jackentasche nach dem Schlüssel, und als er sich dessen vergewissert hatte, lief er durch den Obstgarten zu dem Hang dahinter, wo der bewaldete Hügel sich weit über die baumlose Kuppe erhob. Der Waldboden war von Moos bedeckt und voller Geheimnisse, und hier und da standen große, von Flechten bewachsene Felsen, die im Zwielicht wie druidische Monolithen inmitten der dicken, verdrehten Baumstämme eines heiligen Haines wirkten. Bei seinem Aufstieg überquerte Randolph einen rauschenden Bach, dessen Wasserfälle, ein wenig weiter abwärts, den lauernden Faunen, Ägipanen und Dryaden runische Beschwörungen zusangen.
Dann erreichte er die seltsame Höhle in dem waldreichen Abhang, die gefürchtete »Schlangengrube«, die von den Bauern gemieden wurde und vor der Benijah ihn wieder und wieder gewarnt hatte. Die Höhle war tief; wesentlich tiefer, als irgendjemand außer Randolph vermutet hätte, denn der Junge hatte einen Spalt im hintersten schwarzen Winkel entdeckt, der in eine noch eindrucksvollere Grotte führte – ein Ort wie eine gespenstische Grabkammer, deren Granitwände merkwürdigerweise den Eindruck erweckten, von Menschenhand geschaffen zu sein. Auch diesmal kroch er wie üblich hinein und leuchtete sich den Weg mit den Streichhölzern, die er aus dem Vorrat im Wohnzimmer entwendet hatte.
Durch die letzte Spalte zwängte er sich mit einem Eifer hindurch, den er sich selbst nur schwer zu erklären vermochte. Er wusste selbst nicht, weshalb er sich der hinteren Wand mit solcher Bestimmtheit näherte, oder warum er dabei instinktiv den großen silbernen Schlüssel zückte. Doch er ging immer weiter, und als er an diesem Abend nach Hause tänzelte, entschuldigte er sich nicht für seine Verspätung, schenkte auch den Vorwürfen keine Beachtung, die er dafür erhielt, dass er den Ruf zum Mittagessen völlig ignoriert hatte.
Mittlerweile stimmen alle entfernten Verwandten von Randolph Carter darin überein, dass sich, als er zehn Jahre alt war, etwas zugetragen haben muss, das seine Fantasie enorm entflammte. Sein Vetter Ernest B. Aspinwall, Esq., aus Chicago ist genau zehn Jahre älter als Randolph und er erinnert sich noch genau an eine Veränderung, die nach dem Herbst 1883 mit dem Jungen vorging. Randolph erlebte fantastische Visionen, die kaum ein anderer je geschaut haben wird, und noch merkwürdiger waren manche der Reaktionen, die er gegenüber ganz belanglosen Dingen zeigte. Um genauer zu sein: Er schien eine eigenartige hellseherische Gabe erlangt zu haben und reagierte ungewöhnlich auf Dinge, die im fraglichen Moment zwar völlig bedeutungslos erschienen, später jedoch sein befremdliches Verhalten berechtigt erscheinen ließen.
In den folgenden Jahrzehnten, als immer neue Erfindungen, neue Namen und neue Ereignisse die Seiten der Geschichtsbücher füllten, erinnerten die Menschen sich hin und wieder erstaunt daran, dass Randolph Carter schon vor Jahren beiläufige Andeutungen gemacht hatte, die unzweifelhaft mit etwas in Verbindung standen, das damals noch weit in der Zukunft lag. Er verstand diese Aussagen selbst nicht, wusste auch nicht, weshalb bestimmte Dinge in ihm gewisse Empfindungen weckten; er glaubte, dass Träume, an die er sich nicht mehr recht entsann, dafür verantwortlich seien. So erbleichte er schon 1897, als ein Reisender die französische Stadt Belloy-en-Santerre erwähnte – seine Freunde erinnerten sich daran, als er 1916 dort beinahe tödlich verwundet wurde, als er im Ersten Weltkrieg in der Fremdenlegion diente.
Carters Verwandte sprechen nun häufig von solchen Dingen, denn er ist vor Kurzem verschwunden. Sein kleinwüchsiger alter Diener Parks, der seit Jahren geduldig seine Verschrobenheiten hinnahm, sah ihn zum letzten Mal an dem Morgen, als er allein in seinem Wagen davonfuhr, bei sich den Schlüssel, den sie kürzlich gefunden hatten. Parks hatte ihm dabei geholfen, den Schlüssel aus einem Kästchen zu holen, dessen groteske Schnitzereien ihn merkwürdig betroffen gemacht hatten – neben einer anderen Ausstrahlung, über die er nicht sprechen wollte. Bei seiner Abreise hatte Carter gesagt, er wolle das Land seiner Ahnen in der Umgebung von Arkham aufsuchen.
Auf dem halben Weg den Elm Mountain hinauf, auf der Strecke zu den Ruinen des alten Anwesens der Carters, fand man das Auto, sorgfältig am Straßenrand geparkt. Im Wagen entdeckte man ein Kästchen aus duftendem Holz, dessen schmückende Schnitzereien den Bauern, die es fanden, fürchterliche Angst einjagten. In dem Kästchen befand sich nur ein sonderbares Pergament, dessen Schriftzeichen kein Linguist oder Altertumsforscher entziffern oder einordnen konnte. Der Regen hatte längst alle Fußspuren verwischt, doch die Untersuchungsbeamten aus Boston glauben, zwischen den herabgefallenen Holzbalken im Anwesen der Carters Spuren gefunden zu haben. Ihrer Meinung nach sei kürzlich jemand in den Ruinen herumgeschlichen. Zwischen den Felsen auf dem bewaldeten Hang fand man ein gewöhnliches weißes Taschentuch, doch ob es dem Vermissten gehört hat, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen.
Sie wollen Randolph Carters Eigentum unter seinen Erben aufteilen, doch dagegen werde ich mich entschieden zur Wehr setzen, denn ich bin nicht überzeugt, dass er tot ist.
Es gibt Verdrehungen in Zeit und Raum, Visionen und Wirklichkeiten, die nur ein Träumer zu erspüren vermag, und nach allem, was ich über Carter weiß, glaube ich, dass er einen Weg gefunden hat, diese Irrgänge zu durchqueren. Ob er je wieder daraus zurückkehren wird, vermag ich nicht zu sagen. Ihn zog es in die Länder der Träume, die er verloren hatte, und er sehnte sich nach den Tagen seiner Kindheit zurück. Dann entdeckte er den Schlüssel, und ich glaube, es ist ihm irgendwie gelungen, diesen Schlüssel zu einem sonderbaren Zweck zu benutzen.
Ich werde ihn danach fragen, sobald ich ihn sehe, denn ich erwarte, ihn bald in einer bestimmten Traumstadt zu treffen, die wir beide gerne besuchten. In Ulthar, jenseits des Flusses Skai, gehen Gerüchte um, ein neuer König regiere auf dem Opalthron von Ilek-Vad, jener sagenhaften Stadt der Türme auf den hohlen Klippen aus Glas, von wo man das Dämmermeer überblickt, in dem die bärtigen und mit Flossen versehenen Gnorri ihre einzigartigen Labyrinthe bauen, und ich glaube zu wissen, wie ich diese Gerüchte zu deuten habe. Ja, voller Freude aber auch Ungeduld warte ich darauf, den großen silbernen Schlüssel zu sehen, denn in seinen rätselhaften Arabesken sind vielleicht alle Ziele und Mysterien eines blinden, unpersönlichen Kosmos versinnbildlicht.
Durch die Tore des silbernen Schlüssels
(gemeinsam mit E. Hoffmann Price verfasst)
I
In einem ausgedehnten Raum, behangen mit sonderbar gestalteten Gobelins und ausgelegt mit Bucharateppichen von beeindruckendem Alter und handwerklichem Geschick, saßen vier Männer um einen Tisch, der mit Dokumenten übersät war. Aus den Winkeln des Zimmers, wo sonderliche Dreifüße aus Schmiedeeisen ab und zu von einem unglaublich alten Schwarzen in düsterer Livree wieder aufgefüllt wurden, drangen die hypnotischen Dämpfe von Weihrauch, während in einer tiefen Wandnische eine merkwürdige, sargförmige Standuhr tickte, deren Zifferblatt verwirrende Hieroglyphen trug und deren vier Zeiger sich nicht in Übereinstimmung mit irgendeinem auf diesem Planeten bekannten System der Zeitmessung bewegten. Dieser Raum wirkte einzigartig und verwirrend, doch bot er den passenden Rahmen für den bevorstehenden Anlass. Denn hier, in New Orleans, im Heim des größten amerikanischen Mystikers, Mathematikers und Orientalisten wurde endlich über den Nachlass eines kaum weniger bedeutenden Mystikers, Gelehrten, Schriftstellers und Träumers verhandelt, der bereits vier Jahre zuvor vom Angesicht der Erde verschwunden war.
Randolph Carter, der sein Leben dem Versuch geweiht hatte, der Langeweile und Beschränkung der realen Welt in die verlockenden Weiten der Traumreiche und auf die sagenumwobenen Pfade anderer Dimensionen zu entfliehen, war am 7. Oktober 1928 im Alter von vierundfünfzig Jahren aus der Welt der Menschen verschwunden. Seine Laufbahn war sonderbar und einsam gewesen, und es gab Leute, die aus seinen eigenartigen Romanen Erlebnisse ableiteten, die noch bizarrer waren als die seines bekannten Lebens.
Carter war eng mit Harley Warren befreundet gewesen, dem Mystiker aus South Carolina, dessen Arbeiten über die vorzeitliche Naacal-Sprache der Priester des Himalaja zu so schockierenden Schlussfolgerungen geführt hatten. Es war Carter, der in einer vom Wahnsinn umnebelten, schrecklichen Nacht auf einem alten Friedhof gesehen hat, wie Warren in eine feuchte, salpetrige Gruft hinabstieg, um nie wieder daraus hervorzukommen. Carter lebte in Boston, doch seine Vorfahren stammten allesamt aus den wilden, gespenstischen Hügeln hinter dem altersgrauen und von Hexen verfluchten Arkham. Und inmitten dieser urzeitlichen, rätselhaft drohenden Hügel war er für immer verschwunden.
Sein alter Diener Parks – er war Anfang 1930 verstorben – hatte von einer merkwürdig riechenden und mit scheußlichen Reliefs verzierten Schatulle erzählt, die Carter auf dem Dachboden entdeckt hatte, und von den unentzifferbaren Pergamenten und dem eigenartig gestalteten silbernen Schlüssel, die darin enthalten waren: Gegenstände, von denen Carter auch anderen in Briefen erzählt hatte. Carter, so der Diener, habe ihm gesagt, dieser Schlüssel sei ein Familienerbstück, das ihm dabei helfen werde, die Tore zu seiner verlorenen Kindheit wieder aufzuschließen, wie auch die Tore zu fremden Dimensionen und fantastischen Reichen, die er bislang nur in unklaren, kurzen und flüchtigen Träumen besucht habe. Dann hatte Carter eines Tages das Kästchen samt Inhalt genommen und war in seinem Wagen davongefahren, um nie wieder nach Hause zurückzukehren.
Der Wagen war später auf der Seite einer alten, von Gräsern überwucherten Straße in den Hügeln hinter dem verfallenen Arkham gefunden worden – die Hügel, wo Carters Vorfahren einst gelebt hatten und wo die Ruine des Kellergewölbes des großen Carter-Anwesens noch immer im Boden aufklafft. In einem Hain großer Ulmen ganz in der Nähe war 1781 ein weiterer Carter auf mysteriöse Weise verschwunden, und unweit stand die halb vermoderte Hütte, wo in noch fernerer Zeit die Hexe Goody Fowler ihre unheilvollen Tränke gebraut hatte. Diese Gegend ist 1692 von Menschen besiedelt worden, die vor den Salemer Hexenprozessen geflüchtet waren, und sie steht noch heute im Ruf, dass hier irgendwie Bedrohliches vor sich geht, das man sich kaum vorzustellen vermag. Edmund Carter war gerade noch rechtzeitig vor dem Galgen geflohen, und es kursierten sehr viele Geschichten über seine Hexerkünste. Und nun, so hatte es den Anschein, hatte sich sein einziger Nachkomme aufgemacht, um sich ihm anzuschließen!
Im Auto fand man das mit den scheußlichen Reliefs verzierte Kästchen aus duftendem Holz und das Pergament, das kein Mensch zu lesen vermochte. Der silberne Schlüssel war verschwunden – wahrscheinlich zusammen mit Carter. Darüber hinaus gab es keine sicheren Spuren. Ermittler aus Boston berichteten, die verfallenen Balken des alten Hauses der Carters seien in merkwürdige Unordnung gebracht worden, und einer von ihnen hatte auf dem felsigen, von dunklem Wald bedeckten Abhang hinter den Ruinen ein Taschentuch gefunden, ganz in der Nähe einer gefürchteten Höhle, die man die Schlangengrube nennt.
Zu diesem Zeitpunkt erwachten die ländlichen Sagen über die Schlangengrube zu neuem Leben. Die Bauern flüsterten über die sündhafte Verwendung, die der alte Hexenmeister Edmund Carter für diese schreckliche Grotte gefunden hatte, und fügten weitere Geschichten hinzu, da Randolph Carter schon als kleiner Junge von diesem Ort fasziniert gewesen war. In Carters Kindheit stand das ehrwürdige Anwesen mit seinem Walmdach noch, bewohnt von seinem Onkel Christopher. Der Junge war dort häufig zu Besuch gewesen und hatte Seltsames über die Schlangengrube erzählt. Die Menschen erinnerten sich, dass er über einen breiten Felsspalt gesprochen hatte, durch den man in eine unbekannte innere Höhle dahinter klettern könne, und sie machten sich Gedanken über die Veränderung, die mit ihm vorgegangen war, nachdem er im Alter von neun Jahren einen ganzen denkwürdigen Tag in der Höhle verbracht hatte. Auch dieses Ereignis trug sich im Oktober zu – und seit diesem Zeitpunkt schien er eine unheimliche Begabung erlangt zu haben, zukünftige Geschehnisse vorherzusagen.
Spät in der Nacht von Carters Verschwinden hatte es noch geregnet, und seine Fußspuren vom Wagen aus ließen sich nicht mehr eindeutig verfolgen und die Schlangengrube war wegen des starken Wassereinbruchs mit breiigem Morast gefüllt. Nur die ungebildeten Bauern tuschelten über Spuren, die sie erkannt zu haben glaubten: einige dort, wo sich die großen Ulmen über die Straße neigen, und weitere auf dem düsteren Abhang bei der Schlangengrube, wo man das Taschentuch gefunden hatte. Doch wer will sich schon ernsthaft mit Gerüchten befassen, die kurze kleine Abdrücke schildern, genauso wie jene, die Randolph Carter mit seinen ausgetretenen Stiefeln hinterließ, als er noch ein kleiner Junge war? Dies klang ebenso verrückt wie das Gerücht, dass die Spuren der merkwürdigen, absatzlosen Stiefel des alten Benijah Corey sich auf der Straße mit den kurzen kleinen Abdrücken gekreuzt hätten. Der alte Benijah war ein Aushilfsarbeiter der Carters gewesen, als Randolph noch sehr klein war, doch bereits seit dreißig Jahren tot.
Es waren wohl diese Gerüchte – dazu noch Carters eigene Behauptung gegenüber Parks und anderen, dass der merkwürdig gestaltete Silberschlüssel ihm dabei helfen werde, die Tore zu seiner verlorenen Kindheit wieder aufzuschließen –, die eine Reihe von Erforschern des Übernatürlichen zu der Aussage verleiteten, der Verschwundene sei vierundfünfzig Jahre zurück durch der Zeit gereist, zu jenem Oktobertag 1883, den er als kleiner Junge in der Schlangengrube verbracht hatte. Als er in jener Nacht wieder herauskam, so erläuterten sie, habe er eine Reise ins Jahr 1928 und wieder zurück unternommen – denn hatte er nach diesem Tag nicht von Dingen gewusst, die sich erst später zutragen sollten? Und dennoch habe er nie über etwas gesprochen, das nach 1928 passierte.
Einer dieser Amateurforscher – ein älterer Exzentriker aus Providence in Rhode Island, den eine langjährige, enge Brieffreundschaft mit Carter verband – vertrat eine noch schillerndere Theorie. Er glaubte, Carter sei nicht nur in seine Kindheit zurückgekehrt, sondern ihm sei eine weitergehende Befreiung zuteilgeworden – er streife nun nach Herzenslust durch die leuchtenden Träume seiner Jugend. Nach einer merkwürdigen Vision veröffentlichte dieser Mann eine Erzählung über Carters Verschwinden, in der er andeutete, der Vermisste herrsche nun als König auf dem Opalthron von Ilek-Vad, der sagenhaften Stadt der Türme auf den hohlen Glasklippen über dem Dämmermeer, worin die bärtigen und mit Flossen versehenen Gnorri ihre eigenartigen Labyrinthe bauen.
Es war dieser alte Mann, Ward Phillips, der am heftigsten Einspruch erhob gegen die Verteilung von Carters Nachlass unter seinen Erben – alles entfernte Vettern –, mit der Begründung, dass Carter in einer anderen Zeitdimension noch am Leben sei und durchaus eines Tages wieder zurückkehren könne. Einer der Vettern, Ernest K. Aspinwall aus Chicago, war juristisch versiert und ging gerichtlich gegen ihn vor. Obwohl er zehn Jahre älter als Carter war, ereiferte er sich bei den Auseinandersetzungen im Gerichtssaal wie ein Jüngling. Vier Jahre hatte dieser Streit nun schon gewütet, doch jetzt war der Zeitpunkt der Testamentsvollstreckung gekommen, und dieser große, seltsame Raum in New Orleans war der Ort, an dem alle Arrangements getroffen werden sollten.
Es war das Haus von Carters literarischem und finanziellem Nachlassverwalter – des kultivierten kreolischen Gelehrten der Geheimlehren und orientalischen Altertümer Etienne-Laurent de Marigny. Carter hatte de Marigny während des Krieges kennengelernt, als beide in der Französischen Fremdenlegion gedient hatten, und sich aufgrund ihrer ähnlichen Geschmäcker und Ansichten sogleich mit ihm angefreundet. Als der belesene junge Kreole den nachdenklichen Bostoner Träumer zu einem denkwürdigen gemeinsamen Urlaub mit ins südfranzösische Bayonne genommen und ihm dort in den nachtfinsteren und uralten Krypten unter der brütenden, von Zeitaltern gebeugten Stadt gewisse fürchterliche Geheimnisse enthüllt hatte, war diese Freundschaft für immer besiegelt worden. Carters letzter Wille hatte de Marigny als Nachlassverwalter bestimmt, und nun hatte der leidenschaftliche Gelehrte zögerlich den Vorsitz eingenommen, um über die Verteilung der Erbschaft zu befinden. Für ihn war es eine traurige Arbeit, denn ebenso wie der alte Mann aus Rhode Island glaubte er nicht, dass Carter tot war. Doch welches Gewicht haben schon die Träume von Mystikern gegen das derbe Wissen der Welt?
An dem Tisch in jenem seltsamen Raum im alten französischen Viertel saßen die Männer, die einen Anspruch auf das Erbe erhoben. Die üblichen Anzeigen mit Ankündigung der Testamentseröffnung waren in alle Zeitungen der Gegenden gesetzt worden, wo man glaubte, dass mögliche Erben von Carter lebten; doch nun saßen lediglich vier Männer beisammen und lauschten dem fremdartigen Ticken der sargförmigen Standuhr, die keine irdische Zeit anzeigte, und dem Sprudeln des Hofbrunnens hinter den halb zugezogenen Gardinen der offen stehenden Fenster. Die Stunden verstrichen, und die Gesichter der vier wurden mehr und mehr von dem sich kräuselnden Rauch verhüllt, der aus den Dreifüßen aufstieg, die so sehr mit Brennstoff gefüllt waren, dass der stumm durchs Zimmer gleitende und immer nervösere Schwarze sich nicht mehr um sie zu kümmern brauchte.
Da saß Etienne de Marigny selbst – schlank, dunkelhäutig, gut aussehend, schnurrbärtig und noch immer jung. Aspinwall, der die Partei der Erben vertrat, war weißhaarig, hatte ein gerötetes Gesicht, das eine Neigung zu Schlaganfällen verriet, einen Backenbart und eine korpulente Figur. Phillips, der Mystiker aus Providence, war mager, grau, langnasig, glatt rasiert und seine Schultern hingen herab. Der vierte Mann ließ sich hinsichtlich des Alters nicht einschätzen – er war mager und sein dunkles, bärtiges, merkwürdig regloses Gesicht von sehr ebenmäßigem Schnitt; er trug den Turban der Brahmanen der höchsten Kaste. Seine nachtschwarzen, stechenden, beinahe irislosen Augen schienen aus unermesslichen Weiten hinter seinem Gesicht herzublicken. Er hatte sich selbst als der Swami Chandraputra vorgestellt, ein Adept aus Benares, der über wichtige Informationen verfüge. Sowohl de Marigny als auch Phillips – die mit ihm korrespondierten – hatten rasch erkannt, dass das rätselhafte Auftreten des Inders keineswegs Fassade war. Er sprach mit merkwürdig gezwungener, hohler, metallener Stimme, als überlaste der Gebrauch der englischen Sprache seine Stimmbänder, aber seine Rede war so flüssig, korrekt und gewandt wie die eines Einheimischen. Er trug durchschnittliche, bürgerliche europäische Kleidung, die ihm jedoch auffallend schlecht stand, während ihm der buschige schwarze Bart, der orientalische Turban und die langen weißen Fausthandschuhe ein exotisch verschrobenes Aussehen verliehen.
De Marigny hielt das Pergament aus Carters Wagen in den Händen und sagte: »Nein, es ist mir nicht gelungen, irgendetwas mit dem Pergament anzufangen. Auch Mr. Phillips hier hat es aufgegeben. Oberst Churchward hat erklärt, dass es sich nicht um Naacal handelt, und die Zeichen weisen auch keinerlei Ähnlichkeit mit den Hieroglyphen auf der Kriegskeule der Osterinsel auf. Obwohl die Schnitzereien auf diesem Kasten allerdings deutlich an Bilder von der Osterinsel erinnern. Sehen Sie, wie all diese Schriftzeichen auf dem Pergament von horizontalen Wortstrichen herabzuhängen scheinen – das ähnelt sehr, falls ich mich richtig erinnere, der Schrift in einem Buch, das dem unglücklichen Harley Warren mal gehörte. Es traf gerade aus Indien ein, als Carter und ich 1919 bei ihm zu Besuch waren, und er wollte uns nie etwas darüber sagen – er meinte, es sei besser, wenn wir nichts darüber wüssten, und deutete an, es stamme womöglich von einem Ort, der nicht von dieser Welt sei. Er trug es im Dezember bei sich, als er auf diesem alten Friedhof in die Gruft hinabstieg – doch weder er noch das Buch kamen je wieder zurück an die Oberfläche. Vor einiger Zeit schickte ich an unseren Freund hier, den Swami Chandraputra, eine aus der Erinnerung gezeichnete Skizze einiger dieser Schriftzeichen und eine Fotokopie von Carters Pergamentrolle. Der Swami glaubt, er könne nach einigen Nachforschungen und Konsultationen etwas Licht in die Sache bringen.
Nun kommen wir zum Schlüssel – Carter schickte mir mal ein Foto davon. Die sonderbaren Arabesken stellen keine Schriftzeichen dar, scheinen aber aus demselben Kulturkreis wie die Pergamentrolle zu stammen. Carter redete dauernd davon, der Lösung des Rätsels ganz nahe zu sein, verriet jedoch nie Einzelheiten. Einmal geriet er über die ganze Angelegenheit geradezu in Verzückung. Er sagte, dieser antike silberne Schlüssel würde die aufeinanderfolgenden Tore aufschließen, die unser Voranschreiten auf den gewaltigen Korridoren von Raum und Zeit verhindern, bis hin zur Äußersten Grenze, die kein Mensch überschritten habe, seit Shaddad in seiner entsetzlichen Genialität im Sand von Arabia Petraea die ungeheueren Kuppeln und unzählbaren Minarette von Irem, der Stadt der tausend Säulen, erbaute und verbarg. Carter schrieb mir, halb verhungerte Derwische und vor Durst irregewordene Nomaden seien von dort zurückgekehrt und hätten von einem monumentalen Portal mit einer Hand, die in dem Schlussstein des Bogens eingemeißelt worden ist, berichtet. Doch noch nie sei ein Mensch hindurchgegangen und auf diesem Weg wieder zurückgekehrt, um zu erzählen, dass er auf dem mit Granaten durchsetzten Sand seine Fußspuren hinterließ. Der Schlüssel, so vermutete Carter, sei das, wonach die zyklopische Steinhand vergebens greife.
Warum er neben dem Schlüssel nicht auch die Pergamentrolle mitnahm, wissen wir nicht. Vielleicht vergaß er sie – oder vielleicht ließ er sie zurück, weil er an jemanden dachte, der ein Buch mit ähnlichen Schriftzeichen mit in eine Gruft nahm und nie daraus zurückgekehrt ist. Oder vielleicht war sie für das, was er vorhatte, einfach ohne Belang.«
Als de Marigny innehielt, sprach der alte Mr. Phillips mit barscher, schriller Stimme: »Von Randolph Carters Streifzügen können wir nur das wissen, was wir selbst träumen. In meinen Träumen habe ich schon viele merkwürdige Orte besucht, und in Ulthar jenseits des Flusses Skai habe ich viele merkwürdige und bedeutsame Dinge erfahren. Es scheint, dass das Pergament nicht notwendig gewesen ist, denn Carter ist gewiss in die Welt seiner Jugendträume zurückgekehrt und herrscht nun als König über Ilek-Vad.«