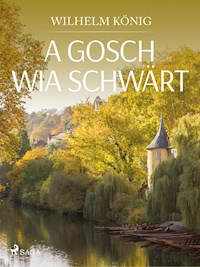Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Karl-Simpel-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Nachdem Karl Simpel am Ende seines ersten Abenteuers in eine Heil- und Pflegeanstalt eingewiesen wurde, schreibt er dort einen Bericht über seine Zeit in der Anstalt und seine Flucht aus dieser. Diese Zeit von 1948 bis 1955 ist eine abenteuerliche und beinhaltet Aufenthalte auf Bauernhöfen, weitere Fluchten und Gefängnisaufenthalte. Und all das, obwohl er noch ein Teenager ist. Wie Karl all dies geschafft hat? Nun, das steht in seinem Bericht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 554
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wilhelm König
Der Sonderling
Saga
Der SonderlingCopyright © 1986, 2019 Wilhelm König und SAGA EgmontAll rights reservedISBN: 9788711731390
1. Ebook-Auflage, 2019
Format: EPUB 2.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit Zustimmung von SAGA Egmont gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com und Lindhardt og Ringhof www.lrforlag.dk – a part of Egmont www.egmont.com
Drei Hirten berieten sich, denn die Herden waren ihnen in weite, dunkle Täler geflüchtet.
Da kamen am Abend drei Wanderer des Weges: Der Weise, der Narr und der Starke.
Der eine lobte den Himmel, der andere pries sein Fressen, und der letzte prahlte mit seinen Muskeln.
Als die Hirten sie fragten, was sie tun sollten, flüsterte der Weise: »Locke sie mit Salz herbei!« Der Narr rief: »Hetze ihnen die Hunde nach! Mach ein Geschrei!« Der Starke schrie: »Schlage das eine tot; dann folgen dir die andern willig!«
Nun, was taten sie? Welche Worte haben die drei Hirten wirklich gehört?
Gefundene-erfundene Fabel aus den »Notizen« des Karl Simpel
»Wir stecken seit einigen Tagen in feuchtem Herbstnebel. Wenn ich in der Früh in Königstein zum Omnibus gehe, ist um mich her ein Trippeln von lauter Vogelfußen. Es sind die fallenden Blätter. Manchmal schaue ich mich um, weil ich meine, jemanden hinter mir gehört zu haben. Es ist dann aber niemand da.«
Peter Suhrkamp, aus: Hermann Hesse / Peter Suhrkamp, »Briefwechsel«
Vorwort des Herausgebers
Als Schriftsteller und als Großneffe des verstorbenen Kriminalhauptkommissars Rudolf Maier mit der Verwaltung seines literarischen Nachlasses betraut, stieß ich bei der Sichtung seiner Unterlagen zum »Fall Karl Simpel« auf ein Manuskript, das uns in den weiteren Lebensweg jenes bemerkenswerten, inzwischen verschollenen schwäbischen Dorfdackels namens Karl Simpel führt, der 1948, im Alter von 14 Jahren, zwei ehemalige Nazis, den Bürgermeister und den Ortsgruppenleiter der NSDAP seines Heimatdorfes am Fuße der Schwäbischen Alb, erschossen hat und dann in eine Heil- und Pflegeanstalt (Zwiefalten auf der Schwäbischen Alb) eingewiesen wurde.
Der Verfasser des nachfolgenden Berichts ist Karl Simpel selbst. Er hat in Zwiefalten und später im Gefängnis lesen und schreiben gelernt. Das Manuskript ist durch Simpels Mutter in unsere Hände gelangt. Sie schickte alles, zusammen mit einem verteidigenden Begleitbrief – »zu Händen Herrn Kommissars Maier, hier« – an die Stuttgarter Kriminalpolizei, bei der Maier zuletzt tätig war und wo er den behinderten Buben verhörte. Die Polizei leitete das Päckchen schließlich an Herrn Maier weiter, der es aber nicht mehr beachtete.
Simpels Bericht umfaßt in etwa den Zeitraum von 1948 bis 1955, also die Zeit von seiner Einweisung nach Zwiefalten, über seine Flucht von dort durch die ganze Bundesrepublik bis zu seiner vorläufigen Heimkehr in das Dorf im Februar 1955. Dazwischen liegen weitere Fluchten und Aufenthalte auf Bauernhöfen, in Gefängnissen und Heimen.
Mit dem Niederschreiben seiner Erlebnisse geschieht auch Verarbeitung, Bewußtwerdung. Simpel zeichnet seine Entwicklung vom unzurechnungsfähigen geistig Behinderten zu einer bewußten Person nach, doch zugleich wird auch seine Auseinandersetzung mit Deutschland, mit dem Deutschland der fünfziger Jahre, mit dem Nachkrieg und der unbewältigt verdrängten Vergangenheit deutlich. Das macht dieses Buch wichtig für uns: Aufarbeitung des Nachkriegs, der Jahre, die unsere ganze Existenz als Bundesrepublik Deutschland (und als DDR) entscheidend prägten, tut uns allemal not. Hier sehen wir die heute oft nostalgisch verklärten und modisch vermarkteten fünfziger Jahre aus einem völlig anderen Blickwinkel. Es geht hier nicht um Wiederaufbau und Wirtschaftswunder, um Rock’n Roll und Petticoats, um Nylonhemden und Bikinis: Simpels Geschichte spielt sich gewissermaßen auf dem Hinterhof Deutschlands ab, in den Bereichen des Lebens, die die Mehrzahl der Nachkriegsdeutschen verdrängt hat. Er lebt auf der Schattenseite, ein Behinderter und Sonderling unter Aufstrebenden, Erfolgreichen; einer, der sich der Wahrheit stellen muß, wo andere vergessen wollen.
Das letzte Heim im Allgäu, in das er vom Gefängnis aus »zur Bewährung« eingewiesen wird, und aus dem er sich vorzeitig absetzt, stellt ein Panoptikum geschundener, verwaister und verkrüppelter Menschen aus dem ganzen großen, zerbrochenen Deutschen Reich dar. Hier treffen sie sich alle: Versehrte, Arm- und Beinamputierte; Epileptiker – im günstigsten Fall kommen sie zur Umschulung in einen neuen Beruf, weil der alte Beruf, eben aus gesundheitlichen Gründen, nicht mehr ausgeübt werden kann.
So wie zuvor schon in den verschiedenen Verwahranstalten findet Karl in dem Heim alle möglichen Muster früheren oder künftigen Lebens. Paul zum Beispiel, Kriegsteilnehmer wie die meisten, armamputiert, Heimat Ostpreußen, abgebrochenes Studium; die Familie bis auf Reste verschollen oder versprengt.
Oder der Doktor: Bürgermeister einer Gemeinde in Thüringen; im Krieg verschüttet, danach wieder ganz »Kind« – ein weiterer Sonderling!
Doch gerade diese beiden werden Simpels wichtigste Gesprächspartner, und es ist besonders Paul, der durch alle Wirren hindurch eine gewisse Haltung – wenn auch nicht gerade verbindlich – bewahrt hat, die Karl nicht entwickeln konnte und die er nun braucht. Doch die Annahme dieses Vorbilds, dieser Vorbilder – positiv wie negative –, geschieht nicht ohne Widerspruch.
Genauso anwesend und lebendig in Karl Simpels Bericht sind – wie in seinem bisherigen Leben – die Namen Maier und Hofer. Der letztere ist ein ehemaliger Lehrer in dem Dorf, der zuerst Berufsverbot erhielt, dann vermutlich von den Nazis beseitigt wurde — wie so viele Freunde, Lehrer und Vorbilder während der Naziherrschaft.
Zum »Fall Karl Simpel« habe ich nichts Neues beizutragen. Die Tat, der Mord an den beiden Nazis in einem Tal des württembergisch-schwäbischen Voralblands, wurde zwar nicht restlos aufgeklärt, ist aber abgeschlossen. Meiner Ansicht nach kann der Fall nie restlos aufgeklärt werden. Das liegt an der Person oder an der Persönlichkeit des Mörders – nehmen wir weiterhin an, daß es Simpel allein war. Er ist selber ein Opfer: ein Opfer der Zeit und der Umstände; ein Opfer aber auch der Unfähigkeit anderer, »normaler« Menschen, mit der Zeit, mit den wirklichen Massenmördern und ihren Helfershelfern abzurechnen – in Stadt und Land, Hauptstadt und schwäbischem Land.
Da wird diesem Kind eines Tages ein Gewehr in die Hand gedrückt — von irgendwoher. Von einem andern – von der Eingebung; von der Vorsehung; vom Schicksal! Wie friedlich hätte er doch dahinleben können; hätte seine harmlosen Streiche und Dummheiten weiter treiben können, und die Umwelt, die Dorfgemeinschaft hätte ihn gewähren lassen. Sie hätte seine Narreteien, seine nutzlosen und im Grunde niemand schadenden Spiele gebraucht als Gegenstück zu ihren, tatsächlich viel gefährlicheren, Normalitäten – zu ihrem wirklich nutzlosen Ernst.
Zum Dackel ist Karl Simpel durch einen Schlittenunfall geworden, der ihn für die Volksschule untauglich machte. So mußte er nicht gerade zum Feldschütz in die Schule gehen, aber beim Zufall. Und ist dieses neue Leben als Schreibender nicht irgendwie ebenfalls Unfall und Zufall? Karl Simpel muß anders als wir frei werden von seiner Vergangenheit. Doch oft hat man den Eindruck, als befände er sich weiterhin in der Kanalisationsröhre, von der er Maier erzählt. Er ist damals zwar selber hineingestiegen in seiner Dummheit — oder in einem Moment geistiger Klarheit, die ihn andern, normalen Kindern imponieren hieß? Und er kriecht immer weiter in der dunklen Höhle voran, bis es heller wird. Er steht unter einem Schacht. Aber darüber warten schon die Kinder, lachen und verspotten ihn – »scheißen und saichen« auf ihn herab, wie Karl berichtet.
Sein Schreiben ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg von der Dunkelheit und Dumpfheit – ist es nicht die Dunkelheit und Dumpfheit seiner Umwelt, die an ihm offenbar geworden ist? – zur wachsenden Bewußtwerdung. Auch Karls Sprache wird zunehmend klarer und politischer. Sein Schreiben ist ein Innehalten vor dem nächsten großen Schritt – einem Schritt hinaus aus der Heimat, einer politischen und geographischen Grenzüberschreitung.
I
Träume oder Der Blick zurück
Seit ich wieder zu Hause bin, seit Frühjahr 1955, träume ich sehr viel, und ich kann oft gar nicht genau unterscheiden zwischen dem, was ich wirklich erlebt habe und dem, was ich nur träume. Jedenfalls ist das meiste vergangen, was ich hier erzähle. Ich blicke zurück – blicke zurück auf Wahres und Geträumtes. Alles kommt nun von sehr weit hinten auf mich zu wie eine große Welle, und ich weiß, daß sie mich verschlingen könnte. Und die Welle rollt auf mich zu, reitet über das Meer, über die See, schwillt immer mehr an: kurz vor meinen Füßen bricht sie zusammen. Das hilft mir aber nicht viel. Die Welle kommt immer wieder, und ich stehe dieselbe Angst immer wieder von neuem aus. Es ist die Angst vor mir selber: die Angst vor meinem Leben, jetzt und zuvor; in Zwiefalten und nach Zwiefalten. Wie in dieser Angst bestehen, gar weiterleben und womöglich ohne Angst? Vielleicht durch Schreiben? Im Augenblick sehe ich keine andere Möglichkeit. Zu sehr bin ich auf mich allein gestellt.
Wenn ich das äußere Bild meines Schreibens beschreiben sollte, so würde ich sagen: Rückwärts gehend und gebückt komme ich aus meiner Geschichte heraus. Dabei schreibe ich auf den Boden, male Zeichen, die die Gespenster – die Geister, die Hexen – nicht überschreiten können.
Tragen oder ertragen muß ich schon wieder viel. Nicht daß man mich verspottet; daß mir die Kinder nachlaufen oder nachschreien – schwätzen werden sie über mich, vor allem die Erwachsenen. Aber das meine ich nicht mit Ertragen. Ich meine das Ganze – das Dorf an sich; die Zeit. Alles geht weiter, als ob nichts geschehen wäre. Keiner hat etwas gesehen und gehört – und etwas Unrechtes getan oder geduldet hat gleich gar keiner von denen. Und am wenigsten hatten unsere Gefangenen, die jetzt nach Hause kommen, mit den Nazis etwas zu tun. Das will ich ja noch glauben. Sie wurden in der Hauptsache eingezogen, und wenn sie da, im Ausland oder fern im Reich etwas Böses angestellt hätten, dann hätten sie die Russen oder Amerikaner noch länger behalten. Also, was will man?
Und die, die den Krieg in der Heimat verbracht haben? Auch nichts! Da hat keiner eine Uniform getragen, eine Fahne geschwenkt oder Heil Hitler gebrüllt – alle nur »Grüß Gott«, »Grüß Gott«: »Jo, wennen sieh«, soviel hat einer allenfalls noch riskiert.
Überhaupt: wo sind die vielen Uniformen und Fahnen alle hingekommen? Zerschnitten, umgearbeitet zu bunten Sommerkleidern und Säcken – so muß ich mir das vorstellen. Und ich muß mir weiter vorstellen, daß ich mit meiner »Tat« 1948 zwischen allen Stühlen sitze und zwischen allen Lagern stehe: zwischen denen, die vergessen wollen und denen, die nicht vergessen können sowie zwischen denen, die vergessen haben und denen, die sich wieder erinnern wollen. Ich will mich ja auch wieder erinnern – doch zugleich möchte ich vergessen, freilich möchte ich erst dann vergessen, wenn ich verstanden habe. Bei allen andern kommt das zum Leben oder zum Glück dazu: bei mir ist es aber das Leben – und das Glück!
Wörter oder Schreiben und lesen können
Ob das Schreiben-und-lesen-Können nun ein Fluch oder ein Segen ist, das wird sich weisen, hätte mein Ahne, der Vater meiner Mutter in dem kleinen Dorf über dem Tal gesagt – und das sage ich jetzt auch! Auch Xaver, der in der Hütte bei Zwiefalten wohnte und vielleicht noch wohnt, von dem ich viel gelernt habe, war dieser Meinung. Xaver hat mir vor allem viel erzählt: von der Welt draußen, vom Krieg und von Abenteuern. Xaver sagte: »Es hat Kulturen gegeben in der Menschheitsgeschichte, die haben keine Schrift gekannt – die Indianer zum Beispiel, und es hat hohe Kulturen gegeben, die haben eine sehr hochentwickelte und komplizierte Schrift gehabt – die Azteken und andere: Alle sind sie untergegangen oder können jederzeit untergehen.«
»Auch Deutschland?« fragte ich dann. »Deutschland?« fragte er zurück. »Das ist doch schon untergegangen; es schwimmt nur noch über Wasser. Und an diesem Untergang sind wir selber schuld. Wir hätten uns niemals mit den Italienern und so Feiglingen einlassen dürfen, dann wäre der Krieg anders ausgegangen!« Xaver war Soldat, und er hat damals den Duce, den Führer der Italiener, zusammen mit anderen aus seiner Gefangenschaft befreit. Das waren schon starke Stücke, die konnte nicht jeder vorweisen in Zwiefalten. »Aber egal, ob Deutschland untergegangen ist oder nicht«, fuhr er fort: »Solange du noch etwas von ihm auf dem Wasser schwimmen siehst, ist es besser, du lernst lesen und schreiben – damit du vom Untergang auch etwas mitbekommst.«
»So ist das?«
»Was?«
»Ha, das: Schreiben und lesen lernt man hauptsächlich, daß man vom Untergang der Welt –«
»– vom Untergang Deutschlands!«
»Daß man vom Untergang Deutschlands etwas mitbekommt?«
»So ist es!«
»Das werde ich mir merken.«
»Hoffentlich!«
Xaver hatte im ganzen zwei Bücher, mit denen er mich traktierte, sobald er gemerkt hatte, daß ich noch nicht lesen und schreiben konnte und damit in der Anstalt, wo sie es mir auch mit Gewalt beibringen wollten, nicht genügend Fortschritte machte. Das erste Buch hieß: »Die Geschäftspraxis in Handel und Gewerbe« und hatte ein Kapitel über Schönschreiben und Rechtschreibung und eine große Zinstabelle am Schluß. Das zweite Buch hieß: »Württembergisches Realienbuch. Große Ausgabe. Bearbeitet auf Grund des Lehrplans für die württembergischen Volksschulen, Stuttgart 1912.« Ich habe ihn nie gefragt, woher er die Bücher hatte. Er hatte sie halt, und mehr brauchte er scheints auch nicht.
Daß er ein Buch von Württemberg hatte, das wunderte mich schon: Denn er war ja nicht aus Württemberg, sondern von Bayern. Das sagte schon der Name Xaver. Xaver – so hat mein Ähne immer von einem gesagt, den er nicht leiden konnte oder der nicht gerade viel vorstellte in der Gesellschaft. Und dann war er sowieso katholisch – bei dem Namen kein Wunder!
Zwiefalten – ich bin ja da nicht in einem »grauen Omnibus« hingekommen, also in einem jener Fahrzeuge, in denen während des Krieges die Dackel und Geisteskranken dort eintrafen. Sondern im gleichen schwarzen Auto – oder auch nur in einem ähnlichen, ich kann das heute nicht mehr so genau sagen –, in dem ich mit dem Kommissar und seinen Polizisten zum Ortstermin in das Dorf fuhr.
Daran erinnere ich mich seltsamerweise heute noch genau. Wir fuhren durch ein großes Tor. Wir stiegen aus und kamen in ein großes Haus. Dort wurde ich von Männern und Frauen in weißen Kitteln in Empfang genommen. Sie waren alle sehr freundlich. Einer der weißbekittelten Männer zeigte mir mein Bett in dem Zimmer, in dem noch andere Better standen, und dann sagte er, ich solle mich ausziehen. Ich müßte oder dürfte zum Baden. Au ja, sagte ich: gegen das Baden hatte ich nichts. Ich hatte Wasser, warmes Wasser, gern. Vorher würden mir noch die Haare geschnitten, sagte der Mann; ich brauchte keine Angst zu haben. Nein, nein; ich hätte keine Angst, sagte ich. Und auch der Frisör war sehr freundlich; er fragte mich, woher ich komme und wie ich heiße. Und ich erzählte ihm alles, und der Frisör lachte und sagte immer nur ja, ja – ja, ja! Und ich sagte zuletzt auch nur ja, ja – ja, ja! In diesen Worten steckte viel und nichts.
Und man sagte mir noch, ich brauche keine Angst zu haben; meine Mutter wüßte, wo ich sei, und sie würde mich auch bald besuchen. Das beruhigte mich wirklich. Und so schlief ich auch sehr tief in dieser Nacht.
Am anderen Morgen wurde ich früh geweckt und in das Zimmer eines ebenfalls weißbekittelten Mannes gebracht. Aber der mußte etwas Höheres sein; denn die anderen verhielten sich ihm gegenüber sehr ehrerbietig. Auch dieser Mann war freundlich zu mir; fragte mich, wie es mir gehe und wie ich mir die Zukunft vorstelle.
»Ha?« fragte ich.
»Na, ja!« Der Mann wurde verlegen: »Ich meine, hast du schon mal einen Wunsch gehabt?«
»Ein Fliegerabzeichen«, rief ich.
»Nein, das meine ich nicht. Hast du dir schon mal einen Beruf gewünscht?«
»Schreiner!«
»Schreiner? Na bitte; das ist doch schon etwas. Und möchtest du alles lernen – rechnen, lesen, schreiben?«
»Alles!« schrie ich.
»Das ist fein. Dann werden wir dich in die Schreinerei geben und anschließend und zwischendurch kommst du immer wieder in die Schule.«
»Zu Herrn Hofer?« fragte ich.
»Wer ist Herr Hofer?«
»Ein Lehrer.«
»Nein, wir haben hier keinen Lehrer Hofer. Aber wir haben andere Lehrer, die dir das Nötige beibringen werden.«
»Fein; kann ich gleich hin?« erkundigte ich mich.
»Sofort«, rief der Mann. »Herr Schneider?«
Ein weiterer Weißbekittelter stürzte herein: »Bringen Sie den Buben zu Meister Kranz. Er soll ihn sich ansehen und sagen, ob er ihn in der Schreinerei gebrauchen kann.«
»Jawoll«, sagte der andere.
»Also, mein lieber Simpel ... ich hoffe, es gefallt dir hier?«
»Ja, das hoffe ich auch, Herr Professor.«
»Direktor bitte! Aber wenn du willst – auch Professor!«
»Jawoll, Herr Führer!«
»Führer?« Der Direktor drohte mir mit dem Finger – »ich habe deine Geschichte gelesen: komme mir nicht auf diese Tour!«
Der Meister Kranz war ebenfalls nicht ohne. Er war bis jetzt der einzige, der keinen weißen Kittel trug – vielmehr eine blaue Schürze, so wie es sich für einen Schreiner gehörte. Er fragte nicht viel, schaute mich nur an, wies auf eine Hobelbank und sagte: »Da!«
»Ha?« fragte ich wieder.
»Nimm den Hobel in die Hand.«
»Was für einen Hobel?«
»Der da über dir in dem Kasten hängt.«
»Aber da hängen mehrere ...«
»Dann nimm einen – Simpel!«
»Gut! Und jetzt?« fragte ich, sah mich auch um, wer mich da noch beobachtete.
»Nimm das Brett, spanne es ein und hoble.«
»Sie verlangen aber Sachen, Herr Kranz.«
»Willst du Schreiner werden oder nicht?«
»Ich will!«
»Na also! Dann spann ein und hoble.«
Einspannen – und hobeln! Au – Ich rutschte mit dem Hobel ab. Das Brett stürzte zu Boden. Herr Kranz und der andere lachten.
»Komm«, hatte der Meister schließlich Mitleid, »ich will dir das Brett einspannen. Aber hobeln und den Hobel halten mußt du allein.«
»So«, sagte der Meister wieder: »Und jetzt komm da rüber.«
»Was ist da?« fragte ich.
»Maul halten, ich erkläre es dir sofort! Das ist der Leimofen. Da sind die Leimhäfen und darunter hängen die Zylinder, die mußt du jeden Morgen mit Hobelspänen vollstopfen.«
»Mache ich glatt!« sagte ich.
»Und jetzt da rüber«, zog mich der Meister fort. Der andere folgte, als sei er an mich angebunden. Wir standen vor einer Maschine: »Was steht da?« fragte der Meister.
»Wo?« grinste ich.
Herr Kranz schaute den anderen an, antwortete dann, nachdem dieser mit den Schultern zuckte, sich selber: »Ach so, kann nicht lesen. Das gehört natürlich dazu, Herr Menk. Das ist Ihre Aufgabe. Schreiben natürlich auch.«
Herr Menk, so hieß er also, der andere, nickte eifrig mit dem Kopf. Der Meister fuhr fort: »Du mußt über alles einen Bericht führen: das ist Pflicht – für die Prüfung!«
»Pflicht? Prüfung?« fragte ich und schaute von einem zum andern.
»Das wär’s ja wohl für das erste«, erklärte Herr Kranz und drehte sich einfach weg. Ich war mit Herrn Menk allein. Er führte mich wieder in den Hof und sagte: »Geh ein wenig spazieren; um zwölf wird gegessen.«
»Jawoll«, sagte ich. War er mir nun böse? Was hatte ich gemacht? Ich wollte doch Schreiner werden. Und ich wollte alles lernen – lesen und schreiben.
Ich wurde dann auch untersucht, vorn und hinten abgeklopft, kam unter eine Maschine, die meine inneren Bewegungen registrierte, und ich traf nur auf zufriedene Gesichter. Ich war gesund, hieß es; das dauerte nur einige Jahre, bis ich völlig gesund war, war damit gemeint.
Dieser Meister Kranz kostete mich dann schon Kraft. Er war ein Dickkopf. Und ich auch. Wir waren nicht die einzigen in der Schreinerei. Außer uns waren noch andere von der Anstalt und Gesellen von draußen da.
Aber alle bleiben blaß. Bis auf den Meister. Er dirigierte mich an den Leimofen, wies mir die Hobelbank an und hieß mich zinken. Und ich zinkte zunächst ohne Sinn, dann aber Schubladen. Und er schaute sie sich an – zufällig vor dem Leimofen – und schüttelte den Kopf.
»Was ist das?« fragte er.
»Was?« fragte ich zurück.
»Das soll halten?« sagte er.
»Das hält«, sagte ich.
»Das hält nicht«, schrie der Meister, warf die Schublade, die ich einige Tage lang mühsam zusammengezinkt hatte, zu Boden und rannte weg.
Im gleichen Augenblick – Gesellen und andere Lehrlinge schauten zu – stürzte ich mich auf die Schublade, ergriff sie und warf sie dem Meister hintendrein. Dazu noch eine Schraubzwinge, die gerade daneben lag. Nichts traf. Zum Glück, sage ich heute. Trotzdem wurde ich von Wärtern ergriffen und in eine Zelle gebracht. »Es ist nichts«, wehrte ich mich.
»Es ist nichts«, sagte auch der Direktor. Ich wollte es nie mehr tun, versprach ich. Und das war mir ernst. So schnell wie möglich lernen, sagte ich mir; so schnell wie möglich gesund werden – und so schnell wie möglich raus, egal wie! Das hier war nicht meine Welt; vielleicht hatte ich mal dazugehört – nun aber nicht mehr. Nun wollte ich auch nicht mehr.
Und im Laufe der Zeit sind immer mehr Leute von draußen gekommen, und ich habe gelernt, zu unterscheiden zwischen Leuten von draußen und drinnen, und ich wollte raus, ich wollte aber auch von drinnen so viel wie möglich mit herausnehmen. Da kamen Leute zu Besuch, zur Besichtigung, starrten uns an, nahmen die Parade ab, und ich wurde immer ärgerlich. Warum bin ich hier? Warum starren die mich so an? Was habe ich getan? Warum wirft man mir das immer noch vor? Und ich wurde befragt und weiterhin abgetastet, und ich gab Auskunft und schwieg. Und ich lernte, das war es vor allem: ich suchte nach Leuten, die mir helfen konnten. Und weil ich mich so gut benahm, nicht auffiel, nicht störte, durfte ich raus – hatte freien Auslauf wie ein Schaf, wie eine Kuh, wie ein Pferd. Und ich wollte das nicht ausnützen – oder doch ausnützen: ich wollte zeigen, daß ich es verdiente.
Dann bekam ich auch Besuch von meiner Mutter. Sie hatte mir zu essen mitgebracht, gerauchte Schinkenwurst und Brot; Äpfel und Schokolade –
»Kriegst du auch genug zu essen, Bua«, fragte sie.
»Jo, Mamma«, anwortete ich.
»Läßt man dich auch raus?«
»Jo! Jeda Daag.«
»Ond wo gohscht noo?«
»Ich gang spaziera. Oder bsuach da Xaver.«
»Wen?«
»Xaver! Des ischt a Einsiedler em Wald. Der verzehlt mir sehr viel.«
»Glaub et älles, waanr sait, Bua. Du woischtjo, wia se schwätzet, dia verzehlat so viel: aber wenn de nooguggescht, no ischt ällas verstonka ond verloga.«
»Der hot a Hütte em Wald.«
»Wissat des dia Herra en dr Anstalt?«
»Dia wissat des.«
»Ond duldats?«
»Ond duldats – sagat sogar, des ischt guat.«
»No willi ao niggs saaga. Do, i hao dr äbbes mitbroocht. Des mogscht doch: grauchta Schenkawurscht ...«
»Ha jo! Nadierlich moge des. Danke, Mamma!«
Xaver oder Ich, du, er, sie, es
Bis ich dahinter kam, daß er auch einer von uns war und in die Anstalt gehörte, da verging einige Zeit. Mehrmals hatte ich ihn schon vor seiner Hütte im Wald am Ortsrand schaffen sehen: er beigte Holz, hängte Wäsche auf und reparierte grad ein Fahrrad, mit dem er scheints seine Ausflüge machte. Ich traute mich nicht sofort zu ihm hin, sondern verschlupfte hinter einer Holzbeige und beobachtete ihn. Das sah alles ganz normal aus; wenn er keinen Besuch bekam, dann war das auch nichts besonderes.
Vielleicht wollte er von den Leuten nichts wissen, so wie ich: ich verließ die Anstalt so oft es mir erlaubt war und streifte lieber durch die Wälder, als mir ständig die anderen Dackel anzusehen.
Dann aber faßte ich mir doch ein Herz und stellte mich vor ihn hin: »Ich heiße Karl, und wie heißt du?«
»Xaver!«
»Xaver? Woher kommst du?«
»Woher kommst du, das sollte ich dich erst fragen!«
»Ich frage aber dich, weil ich komme aus der Anstalt.«
»Ich komme aus Bayern.«
»Bayern?«
»Kennst du das nicht?«
»Nein. Woher soll ich das auch kennen? Was ist das?«
»Das ist ein Land, so wie Württemberg – aber viel schöner!«
»Viel schöner?«
»Ja – zum Donnerwetter!«
»Wie kommst du dann hierher?«
»Durch den Krieg, du Simpel!«
»Simpel? Woher kennst du meinen Nachnamen? Ich habe dir doch nur den Vornamen gesagt?«
»Simpel – so sagt man doch hier! Jetzt aber red nicht so viel; komm rein. Gleich beginnt die Vorstellung!«
»Was für eine Vorstellung? Hast du denn ein Kino in deiner Hütte?«
»Red nicht, sage ich – komm!« Xaver zog mich fast gewaltsam in seine Hütte. Mensch, hatte der einen Griff – ich wollte geschwind schreien, denn es tat mir weh. Ich unterdrückte den Schmerz aber nochmal. Denn was ich nun sah, das beschäftigte mich mehr: Die Hütte war innen eingerichtet wie ein kleines Wohnzimmer mit einem Bett, einem Tisch, einer Lampe unter der Decke und einem kleinen Ofen gleich neben der Tür.
»Da, setz dich hin«, sagte Xaver und deutete auf das Bett unter dem Fenster.
Ich hockte mich brav hin. Xaver ging zur gegenüberliegenden Wand und zog ein Leintuch mit einem Ruck auf die Seite. Dahinter kam nun eine Landschaft zum Vorschein: sie zeigte eine grüne Wiese mit einem blauen Himmel darüber, und in dem blauen Himmel schwammen zwei winzige weiße Wölkchen. Das Bild war auf die Bretterwand gemalt; vielleicht hatte Xaver das selber gemacht. Er band das Leintuch mit einer Schnur an einen Nagel, damit es nicht vorzeitig wieder über das schöne Bild fiel, und setzte sich neben mich.
»Und jetzt?« fragte ich.
»Staad! Halt dei Gosch; gleich geht’s los. Siehst?«
»Noi? Wo?«
»Da! Dort hinten; gleich kommt der erste Panzer über den Berg ... und da ist schon das erste Flugzeug!«
»Ja, ja – du hast recht, Xaver! Jetzt seh ich es auch. Dees kommt aber tief!«
»Tiefflieger!« stöhnte Xaver.
»Panzer! Ond do, die Häuser ... Wo kommet denn zmal die viele Leut her? Ond jetzt brennts! Om Gottas willa — dia Leit! Xaver, dia Leit – die send älle verlora!«
»Dadada! Peng! Huh! ... Sirenen! Geh in Deckung, Simpel!« Xaver hatte sich richtig in die wahre oder eingebildete Situation hineingesteigert. Er schnaufte wieder und sagte: »Jetzt kannst du wieder aufstehen! Sie sind alle weg.«
»Schad om die Wiesa ond Beem; älles hee vo dene verreckte Panzer ond Bomba«, sagte ich.
»Aber wir haben gewonnen!« entgegnete Xaver.
»Alle die Schoof; die viele Gäul – ond die Menscha: Sag mol, Xaver, goht dees jedes Mol von dem Bild weg?«
»Da siehst du nachher nichts mehr. So als wenn nichts gewesen wär: Schwamm drüber und weg, verstehst du, ganz wie im Leben. Aber ich will dich nicht anlügen: die Putzarbeit machen andere für mich.«
»Wer?« wollte ich ernsthaft wissen.
»Das sage ich dir ein andermal. Jetzt aber – Vorhang zu und die Frage: hast du Durst?«
»Ja, und wie! I han scho a ganz babbiga Zong!«
»I hob aber nur Moscht ...?«
»I mog Moscht! Brauchscht aber koine Gläser: i trenk ausem Krug, so wie mei Vadder!«
»Dei Vadder – wo ist der?«
»Gfalla!«
»Gefallen? Das ist doch eine Ehre, für das Vaterland – für Führer, Volk und –«
»– Vaterland zu fallen! Ich weiß, so hat es geheißen! Mei Mutter hot dees aber et so gsäha.«
»Es hat im Krieg oft mehr Feinde hinter der Front gegeben, an der sogenannten Heimatfront, wie davor.«
»So eine aber war meine Mutter nicht, ist sie auch heute noch nicht: Sie ist keine Verräterin!«
»So meine ich das nicht, Simpel! Mein Vater lebt noch. Aber mit dem kann i über so äbbes ao net schwätza.«
»Kannscht du ao schwäbisch?«
»A bißerl!«
»Aber net viel.«
»Vielleicht lerne ichs noch. Man kann alles lernen, wenn man nur will.«
»Auch lesen und schreiben?«
Xaver stellte sich direkt vor mich hin und schaute mich von oben herab an: »Willst du damit sagen, du kannst noch nicht lesen und schreiben?«
»Nein! Das heißt ja. Ich kann nicht lesen und nicht schreiben. Ich habe es nie gelernt ...«
»Das muß aber sofort aufhören.«
»Die en dr Anstalt moenet dees ao.«
»Anstalt?«
Xaver drehte sich herum, machte einen Schritt auf einen kleinen Kasten an der Wand zu, öffnete ihn und entnahm ihm einen offenbar vollen Mostkrug. Und in dieser Bewegung wiederholte er, fast spöttisch: »Anstalt? Kenne ich nicht. Also dann trinken wir erst einmal. Prost, Karl!«
Xaver setzte an, und der Adamsapfel hüpfte an seinem Hals auf und ab. »Jetzt du«, sagte er und streckte mir den Krug hin – er war nicht so schwer wie der damals vom Schäfer. Aber vielleicht täuschte ich mich. Vielleicht war ich inzwischen nur stärker geworden.
Und an den Schäfer mußte ich jetzt denken: der wohnte damals in seinem Karren nicht so bequem wie jetzt der Xaver. Und natürlich fiel mir auch der Hund ein: der tät zur Hütte und zum Wald passen.
»Prost, Xaver«, sagte ich.
»Also saufen kannst – vielleicht auch Bier?«
»Auch Bier, wenns sein muß. Aber nicht so viel.«
»Bevor ich da her kommen bin, habe ich ja nur Bier getrunken. Und ab und zu Zigorekaffee.«
»Zigorekaffee?« hakte ich ein: »Den hat meine Mutter auch gemacht. Der schmeckt aber nicht so gut. Sag mal, Xaver, habt ihr in Bayern denn keinen Most – dann brauchtet ihr nicht so viel Bier trinken?«
»Ich weiß nicht – vielleicht im schwäbischen Bayern. Im Allgäu und im Donauried.«
»Habt ihr auch keine Äpfel?«
»Freilich haben wir Äpfel. Wir haben doch Bäume – da werden wir doch auch Äpfel haben, Simpel!«
»Und was macht ihr dann mit den übrigen Äpfeln?«
»Essen, du Simpel! Apfelkuchen backen und Apfelbrei ...«
»Das machen wir auch – Apfelkuchen und Apfelbrei! Aber man kann doch nicht von allen Äpfeln Apfelkuchen backen – Apfelbrei vielleicht, wenn man genug Zucker hineintut. Aber da gibts Apfel- und Birnensorten bei uns, da kannst du nur Most machen!«
»Bei uns nicht! Oder – ach, ich weiß nicht! Jetzt aber bist ruhig von deinem Most, von deinen Äpfeln und Birnen, und trinkst! Gib her: ich bin wieder dran!« Xaver machte eine Pause; er schien zu überlegen. Dann fuhr er fort, immer noch hoch über mir, denn ich war beim Trinken sitzen geblieben:
»Wenn du brav bist, erzähle ich dir nachher auch noch etwas. Ich bin ja viel rumgekommen in meinem Leben –« Jetzt drehte er sich doch weg, schlurfte zur Filmwand hin und ließ das Leintuch drüberfallen. Das Bild war die ganze Zeit geblieben, doch keiner hatte mehr hingeschaut. Auch jetzt interessierte es mich nicht mehr. Ich lauschte gespannt dem, was Xaver mir jetzt weiter erzählen wollte.
Er lehnte sich gegen die Wand und schaute mit den Augen irgendwohin: » ... rumgekommen! Viel! Nicht nur in Bayern und Württemberg. Ich war in Italien – bei diesen Zigeunern! Ich war in Rußland, Österreich, Ungarn, der Tschechoslowakei ...«
»Tschechoslowakei?« murmelte ich ehrfürchtig. Xaver trat unruhig auf der Stelle, schien jemand anders zu sehen und zu hören. Das gab mir Gelegenheit, den Mann näher zu betrachten. Er war nicht jung und nicht alt – ehrlich gesagt, hatte ich bis dahin keine Vorstellung von Jugend und Alter, was wohl wiederum in meinem Fall normal ist.
Aber soviel nahm ich wahr: Er hatte graue Locken auf dem Kopf – Rollen, wie wir sagen! Er hatte sich nicht rasiert; er hatte aber auch keinen Bart: die Haare im Gesicht waren wohl schon immer so lang. Und nicht nur beim Trinken, auch beim Reden und Denken – so wie jetzt – sprang sein Gurgelknopf an ihm hinauf und hinunter: wie ein Hund – wie Harras ... Aber so groß ist er doch nicht. Xaver machte ein paar Schritte, blieb stehen, sah mich an, machte das Maul auf und wollte etwas sagen. Aber es kam nicht heraus. Dann fiel mir nichts anderes ein als ihn zu fragen:
»Sag mal, Xaver, bist du katholisch?«
»Ob ich katholisch bin?«
»Du hast so ein silbernes Kettchen mit einem Kreuz um den Hals.«
»Ach so, das? Ja, ja, ich bin katholisch. Warum fragst du?«
»Ich frag halt. Ich bin evangelisch, hat meine Mutter gesagt – und haben meine Ahna und mein Ahne gesagt, und so sagt der Pfarrer.«
»Dann wirds stimmen! So«, änderte Xaver seinen Ton, ergriff den nun leeren Mostkrug und stellte ihn wieder in das Kästchen hinein: »Dann haben wir das auch geklärt. Noch etwas?« fragte er.
»Nein! Oder doch – i muaß hoim! Sonscht suachat die mi. I komm aber wieder, gell?«
»Mit Bleistift und Papier«, grinste er. »Das ist wegen der Nachricht, die du mir an der Tür hinterlassen mußt, wenn ich nicht da bin. Und ich bin öfters nicht da; muß weg, muß raus – in den Wald!«
»Gut! Wenn du an dem einen Tag nicht da bist, dann komme ich am nächsten Tag.«
»Dann kommst am nächsten Tag. So machst es, Simpel!«
»Ade«, sagte ich.
»Servus«, hörte ich ihn noch antworten und setzte mich in großen Sprüngen Richtung Anstalt ab.
Die Grundrechte jedes Deutschen oder Schwierigkeiten beim Schreiben
Beim Schreibenlernen hatte ich natürlich meine Schwierigkeiten, vorher schon in Zwiefalten und nachher noch im Gefängnis, in der »Burg«. Die Lehrlinge mußten alle in die Berufsschule. Das waren zwei Räume neben der Verwaltung beim Tor. Zweimal in der Woche kamen wir hier zusammen: Die Schreiner, die Sattler, die Schlosser, die Schuhmacher. Und von draußen herein kamen die Lehrer und übten mit uns den Stoff. Eine Anstrengung war es auch für die Lehrer: die mußten auch. Aber wenn einer nur muß und nicht will, und der andere will nur, kann aber nicht – weil der andere nicht so richtig mitmacht –, dann ist es auch nichts!
Es war aber auch manchmal zum Verzweifeln. Es gibt Wörter und Buchstaben, die liegen mir wie Steine im Maul; sie kommen erst gar nicht in meinen Magen, wo sie ihr Gewicht nur vergrößern würden. Sie bleiben mir im Maul, aber ich kann sie nicht ausspucken oder beißen. Lange Zeit konnte ich nicht einmal richtig Württemberg mit »m« schreiben; ich habe immer Württenberg mit »n« geschrieben. Das konnte mir der Lehrer hundertmal ankreuzen – ich habs einfach nicht gefressen! Das Schlimme war, der Lehrer stammte nicht einmal von Württemberg – aber er wußte, wie man es richtig schreibt.
Und dann war da noch das Wort Alb wie Schwäbische Alb. Daß es auch Alpen gibt und daß die nicht mit einem weichen, sondern mit einem harten »p« geschrieben werden, das habe ich lange nicht gewußt. Dabei seien die noch viel höher wie die Schwäbische Alb, und Schnee hätte es da das ganze Jahr; vielleicht komme ich in meinem Leben noch da hin, dann werde ich es ja sehen.
Und dann mußten wir Aufsätze schreiben – also Aufsätze! Aufsätze über alles Mögliche und Unmögliche. Ich habe geschwitzt und nachts in der Zelle phantasiert, so daß mich die Mitgefangenen, solange ich noch in einer Gemeinschaftszelle untergebracht war, aufwecken mußten.
Einen Aufsatz habe ich doch von allen aufgehoben. Es ging da um unsere Rechte: als Deutsche und als Gefangene. Der Lehrer hat mit uns gesprochen, hat aus einem Gesetz vorgelesen, und dann sollten wir schreiben über das, was wir gehört hatten und was wir uns dabei dachten. Dann kam bei mir das heraus:
Die Grundrechte jedes Deutschen!
Jeder Deutsche hat das Recht, sich frei zu bewegen, sofern er nicht in Staatsgewalt ist. Er hat ferner das Recht, sich niederzulassen, wo er will, kann glauben, was er will (evangelisch oder katholisch).
Er hat Recht auf seine Freiheit. Die Person des einzelnen ist unverletzlich.
Vor dem Gesetz sind alle gleich, ob arm oder reich, ob angesehen oder verachtet. Er hat Einspruch zu erheben, wenn durch polizeiliche Gewalt, ohne richterlichen Befehl, seine Wohnung verletzt oder durchsucht wird.
Er hat Recht auf Arbeit, Unterkunft und staatlichen Schutz. Die Ehe steht unter dem besonderen Schutz des Staates. Jeder Deutsche kann Gesellschaften gründen, kann ein Geschäft eröffnen. Kein Deutscher darf einer fremden Macht ausgeliefert werden. Jeder Deutsche darf seine Meinung in Wort oder Schrift frei äußern. Er hat auch Recht auf Einhaltung des Briefgeheimnisses. Er darf an Beruf und Schaffen nicht gehindert werden.
Die Berufswahl steht ihm frei. Er hat auch Recht auf ärztliche Behandlung und, im Falle der Arbeitslosigkeit, Recht auf Arbeitslosenunterstützung. Keiner darf zu etwas gezwungen werden, was gegen seine Person geht.
Karl Simpel
Der Lehrer hat in Rot darunter geschrieben: befriedigend! Mehr konnte ich damals halt nicht bieten. Aber es war doch wenigstens etwas: es kann bei mir also immer nur noch besser und kaum schlechter kommen.
So habe ich dann auch meinen Lebenslauf geschrieben; zuerst in Zwiefalten und dann später noch in der Burg. Die habe ich alle weggeschmissen. Vielleicht war es ein Fehler. So setze ich mich jetzt hin und suche, suche und besinne mich. Und wenn man es genau nimmt, so ist das Ganze hier eigentlich ein langer Lebenslauf und Aufsatz in einem.
»Willst du heut nicht aufstehen, Karl?« Meine Mutter stand vor meinem Bett.
»Jao, jao«, fuhr ich erschreckt hoch: »Doch! Wie spät ist es denn?«
»Zehn. Wir müssen in den Wengert und grasen.«
»Ich zieh mich gleich an. Ich brauch heut kein Kaffee – als Strafe dafür, daß ich verschlafen hab. Denn ich wollt früher aufstehen. Ich muß doch schreiben.«
»Ja, ja, und wir müssen aufs Feld. Ich mach uns ein Vesper, das nehmen wir dann mit.« Mit diesen Worten verließ meine Mutter wieder das Zimmer. Ich sprang aus dem Bett und schlüpfte in die Hose, die über dem Stuhl neben der Bettlade hing. Mein Zimmer ist unter dem Dach des kleinen Hauses an der Straße. Vom einzigen Fenster aus überblicke ich die Gartenlandschaft, die sich hier im Rücken der Häuser ausbreitet. Da kann ich auch oft stundenlang stehen und träumen, kann nur lauschen. Oft ist es eine Flötenmelodie, die mich lockt; sie kommt aus einem der Häuser da hinten. Ich spiele ja kein Instrument. Vielleicht würde ich gern Klavier spielen. Aber das ist auch so ein Wunsch – und vielleicht gar nicht wahr. Ich möchte mir aller meiner Erinnerungen sicher sein: das ist wahr! Denn allein das macht mich glücklich: das genaue Erinnern, auch an Unangenehmes – nicht das Verschweigen.
Ich komme ins Wohnzimmer. Meine Mutter hat schon den Handwagen aus dem Schopf vor die Haustüre geschoben: zwei Hauen und ein Sack liegen drin. Jetzt lädt sie noch einen Henkelkorb ein, in dem das Vesper und zu trinken ist. Das heißt jetzt können wir gehen. Und damit ist dieser Tag auch herumgebracht: mit laufen, schaffen und wieder heimlaufen. Ich mache die Feldarbeit jetzt nicht mehr so gern. Aber ich begreife immer noch – oder immer mehr: Es muß sein, schließlich leben wir davon, und es lebt das Land von schönen, fruchtbaren Wiesen und Ackern.
Aber der nächste Tag gehört wieder ganz mir, mir und der kurzen Vergangenheit. Dem Xaver habe ich ja damals gesagt, mein Vater sei im Krieg gefallen, freilich habe ich mich dann verbessert.
Mein Vater lebt wirklich noch: im gleichen Dorf, in dem Haus, in dem ich aufgewachsen bin; im Haus seiner Eltern, in das meine Mutter hineingeheiratet hat. Er lebt jetzt da mit einer anderen Frau und anderen Kindern, die ich nicht kenne und von denen keiner genau weiß, ob sie von ihm sind oder ob sie die andere Frau von einem anderen mitgebracht hat. Die Ehe meiner Eltern wurde 1948 geschieden – aber das wissen Sie ja alles, Herr Kommissar. Aber ob Sie es wissen, Herr Hofer; ob Sie das alles mitbekommen haben, neben Ihren eigenen Sorgen, das ist die Frage. Freilich hätte es Sie interessieren können und interessieren müssen auf Grund der Beziehung – der guten Beziehung – zwischen unseren Familien.
Nun, das ist jetzt alles Geschichte: Wir leben alle nach wie vor hier, im gleichen uralten Dorf und alten Tal – aber wir kennen uns nicht mehr! Wir reden nicht mehr miteinander — wir gehen einander aus dem Weg. Vielleicht ist es ganz gut so, denn oft packt mich der Zorn, dann möchte ich meinen Vater erschlagen für alles, was er uns gegenüber versäumt hat und was er und seinesgleichen Ihnen, Herr Hofer, und anderen angetan haben. Aber dann überwältigt mich auch wieder ein unerklärlicher Wunsch, alles zu vergessen und zu vergeben.
Der Sonderling
Träumte ich schon wieder, oder war er es wirklich? Ich meine: Xaver? Er könnte es sein, der Mann da, so wie er durch die Straßen des Dorfes rennt: Turnschuhe, weißer Sportdreß und Sonnenschutz über den Augen. Nur etwas älter als der Einsiedler in Zwiefalten. Aber genauso knochig und vielleicht noch beweglicher.
So trabte er hinter dem »Löwen« hervor, wo er wohnte und ein Uhrgeschäft unterhielt; trabte fast täglich, ob Sonne oder Regen, da hervor, raus auf die Hauptstraße und ab in Richtung Sportplatz. Dort zieht er auf der Aschenbahn einige Runden und dreht wieder um in Richtung Dorf. Nein, es ist nicht Xaver! Der Mann stammt überhaupt nicht von hier: Er ist zugezogen; ein Flüchtling, ein Reingeschmeckter im besten Fall. Nein, Xaver war es nicht. Der Mann fiel natürlich auf, die Leute blieben stehen und schauten sich lachend nach ihm um.
Flüchtlinge, Reingeschmeckte: von der Sorte gibt es natürlich noch mehr hier im Tal. In Scharen sind sie einst nach dem Krieg eingefallen. Die meisten passen sich sehr schnell an und gehen auf in der neuen Gemeinschaft. Und wenn jemand auffällt, so wie der da – oder wie ich –, dann liegt es nicht daran, daß es ein Flüchtling oder ein Reingeschmeckter ist. Er ist eben ein Sonderling. So spricht man von mir inzwischen doch auch. Aber sie lachen und sie spotten nicht mehr. Sie schauen nur noch böse und ein wenig unsicher drein. Doch das kümmert mich nicht. Nur noch selten verlasse ich das Haus, halt zu Besorgungen, zu unerläßlichen Spaziergängen. Und dann treffe ich diesen Sportler, sehe ihn die nicht vorhandene Menge teilen wie ein Engel die Wolken – aber ein richtiger Engel, wenn der auf Erden landete, der brauchte auch keine Menge zu teilen: Wenn wir kommen, gehen die Leute von selber auf d’Seit, wollen nichts zu tun haben mit uns Spinnern, Sonderlingen. Sonderbar, wer ihnen das nur beigebracht hat, diese Scheu vor dem Andersartigen; diese Furcht vor dem Fremden?
Denn wir sind doch nun einander auf eine neue Weise fremd. Vorher war das scheints harmloser, weniger beängstigend: Jetzt wollen sie sich in ihrer Ruhe gestört fühlen! Aber ich tue ihnen doch gar nichts! Wer tut denen schon etwas? Doch sie selber. Manchmal hat es mich schon in den Beinen gejuckt, und ich wäre zu gern mit dem Mann durch den Flecken gerannt, wenigstens bis raus auf den Sportplatz. Aber das hätte er vielleicht falsch aufgefaßt, hätte gemeint, ich wollte ihn foppen. Denn Kinder taten das ab und zu; sie liefen ein Stück neben ihm her und schrien ihm etwas zu, feuerten ihn an. Nein, zum Kind wollte ich mich nicht mehr machen, und ich wollte ihn auch nicht verspotten. Ich könnte überhaupt nicht über ihn lachen, so wie die Leute, große und kleine. Nein, wir taten einander nichts und nützten einander auch nichts. Ich glaube nicht, daß er mich überhaupt kannte. Er kümmerte sich auf seine Weise nicht um die Menschen um sich herum; er sah sie nur in seinem Geschäft, und da lachten sie auch nicht über ihn, da waren sie ganz ernst und nahmen seine handwerklichen Fähigkeiten gern in Anspruch. Vielleicht dachte am Anfang der eine oder andere: der ist blöd, den können wir übers Ohr hauen. Der gibt uns die Sachen – oder repariert, flickt – auch mal billiger. Aber nichts wars. Der hat seine ganz normalen Preise.
Flüchtlinge
Wie habe ich gesagt – »Flüchtlinge?« Dabei bin ich doch selber ein Flüchtling: immer auf der Flucht; vor mir und vor den andern. Und dies hier ist nur eine Zwischenstation.
Herr Hofer: Sie müssen Geduld mit mir haben, so wie Sie früher immer Geduld mit mir hatten und so wie Kommissar Maier in den Verhören immer Geduld mit mir hatte.
Ich würde Ihnen jetzt gern das Heim und seine Bewohner vorstellen. Unter diesen Bewohnern ist besonders Paul wichtig — wegen seiner Kommentare, die er zu meinen Geschichten gab. Er ist auf der einen Seite einer wie Sie; auf der anderen Seite einer wie ich. Aber das geht noch nicht. Ich kann jetzt noch nicht in das Heim: ich bin noch nicht mal auf dem Hof in Niedersachsen. Ich bin noch nicht mal weg von hier. Und vom Hof gehts ja nicht direkt ins Heim. Da ist ja vorher noch die Burg, das Jugendgefängnis. Und dazwischen gibts weitere Fluchten: die Absetzungen vom Hof; die Wanderungen nach und durch Hessen und die kurzen Gastspiele auf zwei weiteren, freilich viel kleineren Bauernhöfen dort. Und es gibt die Motorradfahrt zur deutsch-französischen Grenze in der Pfalz. Von da erst zeigt der Pfeil geradewegs in die Burg, und von da ins Heim. Schon ersticke ich in meinen Erinnerungen, und vor meinen Augen beginnt alles zu flimmern. Namen und Jahre stürzen zusammen: ob ich das alles noch unter einen Hut, auf ein Blatt Papier bringe?
In meinem Gedächtnis gibt es so viele Lücken. Auf alle Fälle fehlen mir die drei Wochen – oder genauer 19 Tage –, die ich nach dem Schlittenunfall bewußtlos im Krankenhaus lag. Auch danach wird es immer wieder Nacht – und wenn plötzlich die Helle kommt, trifft sie mich wie ein Scheinwerfer, und ich sehe, höre und denke für Sekunden nichts.
Nichts! Alles das wollte ich mir zurückholen auf meinen verschiedenen Fluchten. Vielleicht habe ich das eine oder andere gefunden unterwegs auf den Straßen; in den einzelnen Häusern und Höfen – bei fremden Leuten!
Ja, der Schlittenunfall: das ist meine lebenslange Bedrohung. Denn in dieser Zeit, das sage ich mir immer wieder, hätte ich dies und das tun und etwas anderes lassen können – zum Beispiel zwei Menschen erschießen, wie mir vorgeworfen wird. Sollte das wahr sein, dann ist da in mir etwas außer Kontrolle geraten – ich bin außer Kontrolle geraten. Das könnte sich ja nun wiederholen – das ist das Beängstigende. Das ist es, was mich ständig beunruhigt.
Ich will ja niemand die Schuld geben – zum Beispiel meinem Vater oder der Zeit, dem Dorf oder seinen Bürgern: Ich allein war es, und ich allein muß es verantworten. Und ich will es auch verantworten – alles, was ich getan habe und alles, was ich noch tun werde. Gutes und Böses.
II
Auf der Flucht
So wie es mit einem Schlag laut werden kann, wird es plötzlich still, so still, daß man die berühmte Stecknadel zu Boden fallen hört. Und ich lausche, lausche dem Pferdegetrappel auf der Straße.
Ich springe auf, stürze in mein Zimmer unter dem Dach und öffne das Fenster. Von hier kann ich einen Teil des Dorfes samt der Hauptstraße übersehen. Ich muß mich nur etwas recken oder mich auf einen Stuhl oder Schemel stellen. Ich stehe aber nicht sehr oft da; ich bin kein Jäger, der dem Wild auflauert. Eher bin ich das Wild, das sich versteckt vor diesen Jägern. Und fliehen, das gehört doch auch zum sich verstekken – nicht nur vor Jägern, tatsächlichen oder eingebildeten! Da sehe ich die Gäule kommen: ein Bauer mit seinem Fuhrwerk. Ist das nicht der Räber-Schorsch, den meine Mutter schon zum Ackern geholt hat? Es gibt nicht zu viele Pferde und Pferdefuhrwerke im Ort. Es hat mehr Kühe – und ganz früher soll es auch Ochsen und Ochsengespanne gegeben haben. Das ist in manchen Familiennamen – besser Beinamen – überliefert. Weil es so viele mit dem Namen Haas gibt, nannte man diejenigen »Oggsahaasa«, die ihre Wagen von Ochsen anstatt Kühen oder Pferden ziehen ließen. Ochsen und Pferde sind natürlich teurer als Kühe; begnügen sich nicht nur mit Heu und Stroh.
Aber in Niedersachsen gab es sehr viele Pferde, Kühe nur auf der Weide und im Stall, aber keine zum Ziehen. Und in Niedersachsen, auf dem Hof bei Göttingen, begegnete ich im Grunde zum ersten Mal Pferden. Hier erhielt ich zwei zur Betreuung – war über Nacht Gespannführer geworden.
Ich war schon ein paar Tage und ein paar Nächte unterwegs – immer in Richtung Norden – und schon weit hinter Frankfurt und Kassel. Ich hatte Städte, große und kleine, durchwandert, war von der Landstraße auf die Autobahn und von der Autobahn auf die Landstraße gewechselt, so wie es sich ergab: Hauptsache, ich kam meinem Ziel, Hamburg, näher.
Bei mir trug ich eine Aktentasche, die enthielt einen Teppich und ein zweites Paar Schuhe. Der Regenmantel paßte nicht mehr hinein; den warf ich über die Schultern oder band ihn mit einem Gürtel über die Tasche. Wenn es regnete und nicht zu heiß war, konnte ich ihn anziehen: das war das Gute an Hitze und Regen im Freien.
Als ich vor einer Woche in aller Frühe das Haus meiner Mutter in dem Dorf verlassen hatte, war da auch noch ein Vesper drin. Doch das war bald gegessen. Das Vesper hatte meine Mutter am Abend zuvor gerichtet, denn wir wollten am anderen Tag alle drei — meine Mutter, meine Schwester und ich – einen Ausflug machen: nach St. Johann oder auf die Schwäbische Alb, so war es geplant.
Und die anderen Sachen, Aktentasche, Teppich, Regenmantel, Schuhe, die habe ich mir im Laufe der Zeit zusammengetragen, heimlich, nicht offen vor Mutter und Schwester. Ich habe alles auf der Bühne versteckt; in der Nacht noch habe ich alles heruntergeholt und aus dem Fenster hinter das Haus geworfen. Dort wollte ich die Sachen holen. Und wenn meine Mutter aufgewacht wäre und mich gefragt hätte, was ich machte, dann hätte ich gesagt: Ich habe wieder schlecht geträumt; ich brauche frische Luft. Du mit deinen schlechten Träumen, hätte sie vielleicht gesagt; daß das aber auch nicht aufhört!
So hätte ich nicht reden können mit der Aktentasche und mit allem andern in der Hand. Doch meine Mutter ist nicht aufgewacht. Niemand hat mich an jenem hellen Morgen aus dem Haus kommen und fortgehen sehen.
Natürlich hätte mich meine Mutter so fragen müssen. Denn sie hatte Verantwortung für mich. Ich hatte von Zwiefalten für vierzehn Tage mit ihr nach Hause fahren dürfen. Und ich lebte im Dorf schon wieder zehn Tage. Aber es war beinahe die Hölle! Deshalb freute ich mich einerseits, wenn die Vakanz herum war und ich in die Anstalt und zu Xaver zurückkam. Andererseits wollte ich nicht mehr. Ich wollte fort. Fort aus diesem Dorf und fort aus diesem Land. Fort von diesen Menschen.
Sicher hatten die Leute immer über mich gelacht. Aber damals, während des Krieges und kurz danach, hatte ich es nicht so gemerkt. Nun merkte ich es, und es tat weh! Klein und groß trieben das Michele mit mir – »Simpel ist wieder da! Der Simpel«, riefen die Kinder, und die Alten verzogen dazu spöttisch das Gesicht.
»Simpel, bischt jetzt gscheit?« fragten dann sie. Ich drehte mich wortlos um.
»Aber a Dackel bischt ond bleibscht«, hörte ich hinter mir sagen. Sowas mußte ich mir also anhören! Aber wartet nur, dachte ich: das geht nicht ewig so weiter. Und ich habe mich dann auch noch auf andere Weise auf diese Flucht vorbereitet. Mit einem Regenmantel, einem zweiten Paar Schuhe und einem Teppich – zum Übernachten im Freien – war es nicht getan!
Wenn ich mich unsichtbar machen könnte – wenigstens vorübergehend, bis der oder die vorbei sind! Aber was folgt dann? Nein, das hilft nichts. Sowieso gibts das nur im Märchen. Und dies hier ist kein Märchen. Die Leute und das Dorf sind kein Märchen – und ich bin kein Märchen.
Aber etwas muß geschehen – etwas muß weg und etwas muß dazu. Und da fiel mir nur mein Name ein: Wenn ich nicht mehr Karl Simpel hieße, sondern zum Beispiel ... Und ich könnte das beweisen: mit einem Papier; mit einem Ausweis. Bei denen hier war es doch gleich, wie ich mich nannte und was ich vorzeigte: für sie bin ich und bleibe ich der Karl – der Simpel und der Dackel! Aber die Leute draußen – die kennen mich dann gar nicht anders!
Ich habe mir die Strecke nach Hamburg vorher auf der Karte angeschaut und mir die größeren Ortschaften auf der Rückseite der Karte notiert, außerdem habe ich die Tage festgehalten, nach welchen ich sie erreichte. Es war der achte Tag, als ich in der berühmten Universitätsstadt Göttingen eintraf und durch die finsteren Gassen eines Außenbezirks trottete, daran erinnere ich mich noch sehr gut! Ich suchte nach einer Jugendherberge, so wie in allen Dörfern und Städten, fand aber keine. Also wollte ich heute noch weiter: näher zu Hamburg! Die Landkarte – DEUTSCHLAND, Germany, Allemagne – habe ich von dem Lehrer in Zwiefalten geschenkt bekommen. Ich habe ihm gesagt, ich möchte das selber nachschauen, was Sie mir da erzählen von Bergen, Landschaften, Flüssen und Seen. Er hat gesagt: Gut, schau es dir an. Deutschland ist schön; schade, daß immer wieder Leute aufkommen in der Geschichte, die es immer kleiner werden lassen und auch das wenige noch zerstören. Damals reifte in mir schon der Plan, mir dieses Deutschland anzuschauen und dort irgendwo zu bleiben, nur nicht hier in Württemberg, in dem Dorf – in der Anstalt!
Juni – das ist doch auch die Zeit, wo man die Vogelnester ausnimmt. Ein paar Junge fliegen von selber von den Bäumen – patsch! Liegen sie vor deinen Füßen! Vielleicht wird das eine oder andere auch von den Vogeleltern hinausgeworfen: ein Fresser zuviel, heißt es! Bei den Menschen ginge das nicht so einfach. Die meisten können gut noch eine Weile vom eigenen Fett leben. Die Menschen sterben auch nicht so schnell. Aber das da: so klein und blutt; ohne Haar – das bewegt sich noch kurz (zucken kann man dazu nicht sagen), dann ist es vertreten. Oder gefressen. Von einem anderen Tier – von einer Katze!
Zunächst mußte ich einmal rauskommen aus dem Dorf, möglichst ohne von jemand gesehen zu werden. Der Wald, überlegte ich mir! Und über Wiesen zwischen Bäumen; querdurch über Gräben, Böschungen hinauf und Böschungen hinunter. Und immer wieder die Bäume: sie waren mir willkommen; ich hätte mich jederzeit dahinter verstecken können, wenn Leute aufgetaucht wären. Doch ich war allein. Ich wanderte den Berg hinauf in das Dorf von meinem Ahne; aber ich lief dann nicht zwischen den Häusern durch, sondern außen herum. Und auf der anderen Seite ging es wieder hinab. Das brauchte seine Zeit. In der nächsten größeren Stadt wollte ich mit dem Zug weiter, nur um fürs erste wegzukommen: raus aus dem Land, weg, so weit wie möglich.
Ich hatte zwei Mark bei mir. Für fünfzig Pfennig kaufte ich mir eine Fahrkarte. Die reichte bis Plochingen. Da stieg ich aus und ging zu Fuß weiter. Ich sehe alles noch ganz deutlich vor mir: der Tag würde heiß werden, und ich hatte Durst. Ich suche nach einem Brunnen. Da gibt es aber keinen Brunnen. Dann schleiche ich mich in ein Hotel hinein und trinke vom Hahnen, aus der Hand. In diesem Hotel – Gasthaus, Gasthof, Wirtschaft – mußte ich auch auf den Abort. Und daran änderte sich von jetzt an nichts; wenn ich ein Dorf oder eine Stadt erreichte, suchte ich als erstes nach Wasser. Aber seltsamerweise gab es weniger Brunnen, als ich mir vom Tal und von dem Dorf auf der Höhe vorgestellt hatte. Besonders in dem kleinen Dorf von meinem Ahne gibt es viele kleine Brunnen. Alle paar hundert Meter einen: für das Vieh hauptsächlich, das an den Wagen hier vorbeikam. Und dann konnte man selber trinken, konnte sich Arme und Gesicht waschen. Das fehlte mir nun. Und mehr als Hunger litt ich immer Durst – natürlich auch Hunger! Die paar Brote von meiner Mutter waren bald weggeputzt, schon vor Plochingen. Kaufen wollte ich mir aber nichts: ich mußte mir das Geld sparen für Notfälle. Blieb mir nur noch das Betteln oder die Gutmütigkeit der Leute. Zum Beispiel der Lastwagenfahrer; er hatte mich an einer Autobahnauffahrt einsteigen lassen.
Er brachte mich ein gutes Stück voran. Und vor allem: er fragte nicht viel, woher ich komme und wohin ich gehe, war zufrieden mit dem, was ich ihm sagte. Darauf antwortete er nur: er habe Verständnis für so etwas. In meinem Alter hätte er das auch machen wollen. Aber es ging nicht, leider! Erstens hätten sie daheim ein Geschäft gehabt und zweitens sei der Krieg gekommen, verstehst?
Ja, ja, der Krieg, schrie ich in den Motorlärm hinein.
Und dann fragte er, ob ich Hunger hätte?
Das brauchen Sie nicht fragen; ich habe immer Hunger!
So? Dann lang mal da in meine Tasche; da ist mein zweites Frühstück drin. Du kannst dir die Hälfte nehmen.
Danke! Dann durfte ich auch Tee aus seiner Thermosflasche trinken.
Bevor er von der Autobahnabfahrt auf die Landstraße bog, ließ er mich aussteigen, und ich tippelte auf der Wiese neben der Autobahn so vor mich hin. Aber wenn ich mehr zu essen und zu trinken wollte, dann mußte ich von den großen Straßen herunter und in die Siedlungen hinein. Und da habe ich dann auch ganz ungeniert gebettelt: in Bäckereien, in Metzgereien. Ich bin auch auf Bauernhöfe gegangen, und ich habe meistens etwas bekommen. Auch mal einen Zehner oder zwei: das wollte ich mir alles aufheben für später.
Und geschlafen habe ich die erste Nacht in einem Weizenfeld – oder war es Haber? oder Roggen? — gleich neben der Autobahn. Wozu hatte ich schließlich den Teppich bei mir? Und mit dem Regenmantel konnte ich mich zudecken; die Aktentasche war mein Kissen. Ich schlief natürlich nicht richtig; die ganze Nacht hörte ich die Autos rauschen, und wenn mal nichts war, dann wartete ich auf das nächste Auto. Nie war es ganz still. Das hätte ich auch nicht vertragen können.
Dann bin ich in den Dörfern natürlich auch aufs Rathaus und hab um ein Bett für die Nacht gefragt. Der Bürgermeister hat mich selber in ein Gemeindehaus gebracht. Das kostete nichts. Ich bin auch zu den Pfarrern gegangen wegen einem Dach über dem Kopf bis morgen früh – und natürlich wegen Brot und einem zusätzlichen Zehner. Nur selten ging ich mit leeren Händen von einem Pfarrhaus weg. Die Pfarrer fragten auch nicht viel. Sie fragten nur: woher und wohin – und dann sagte ich: zu meiner Tante nach Hamburg! Das genügte ihnen. Diesen Bären – freilich, es war für mich keiner – habe ich auch dem Polizisten aufgebunden. Er kam mit dem Fahrrad aus dem Dorf an den Kirschbaum neben der Autobahn heran, auf dem ich gerade saß und die Kirschen in mich hineinstopfte. Ich sah seinen Pistol am Gürtel um den Ranzen, und auf dem Grind hockte die Kappe. Der Büttel stieg vom Fahrrad herunter, lehnte es an die Böschung und kam auf mich zu. Jetzt krebselte auch ich vom Baum. Das war kein großer Baum – halt so einer, wie die Bäume werden, wenn man sie nicht schneidet und wild wachsen läßt. Die Kirschen waren auch nicht mit unseren zu vergleichen. Aber es gab in dieser Landschaft keine anderen.
»Was machen Sie denn da?« fragte der Polizist.
»Kirschen essen«, sagte ich. »Ist das verboten?«
»Nein! Aber kommen Sie mal her und zeigen Sie Ihren Ausweis. Wo wollen Sie hin?«
»Nach Hamburg zu meiner Tante.«
»So, so, nach Hamburg zu Ihrer Tante?«
»Warum, darf ich das nicht?«
»Das habe ich nicht gesagt«, bruddelte der Beamte in seinen Bart hinein – ja, der hatte einen Bart: so einen kleinen, eine Rotzbremse unter der Nase. Und schwarz. Über den Ohren hingen ein paar graue Haare heraus, aber der Schnauzer war noch schwarz. Während ich nach meinem Ausweis kruschtelte, holte er ein Buch aus dem Schweiger heraus und schlug es auf. Dabei schaute er mich scharf an.
»Name?«
»Klein. Friedrich Klein: dadrin stehts.« Ich sagte es und reichte ihm den Ausweis. Der Polizist blätterte, blätterte in meinem Ausweis und blätterte in seinem Buch. Das ging lang, in dieser Zeit rauschten eine Menge Autos an uns vorbei. Und wenn man die auf der Gegenfahrbahn noch dazu rechnete, dann war es ein Haufen.
»In Ordnung«, sagte der Mann schließlich, gab mir den Ausweis zurück und schlug auch sein Buch zu. »Ich hab nichts dagegen, daß Sie sich die Kirschen nehmen, das ist Eigentum aller. Aber brechen Sie keine Äste ab.«
»Oh, nein! Ich bin Bäume gewohnt, besonders Kirschbäume«, antwortete ich.
Der Mann richtete nun stumm sein Fahrrad auf, schwang sich in den Sattel und treppelte davon. Weiter vorn über einer Auslose im Feldweg zum Graben wäre er fast umgekippt. Alles in allem war es mir jetzt wohler.
Wer sich in Gefahr begibt ...
Hallo, Herr Hofer – sind Sie noch da? Ich verlasse jetzt meinen Fensterplatz, schließe die Luke über mir, steige vom Hocker herunter, schiebe ihn zur Seite und setze mich auf den Stuhl vor den Tisch. Ich bleibe also in meinem Zimmer. Hier habe ich ja ebenfalls Papier und Schreibwerkzeug.