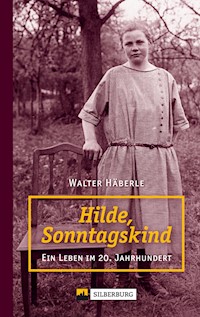Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Silberburg-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Kriminalrat Lutz, ein grüblerischer Schwabe mit Hang zur Philosophie, lässt sich nach einem traumatischen Einsatz ins scheinbar beschauliche Hohenlohe versetzen. Aber kaum hat er das Kommissariat in Künzelsau übernommen, wird er mit seinem jungen Assistenten Wieland zu einem Mordfall ins Jagsttal gerufen. Tatort ist der Ochsengarten in Jagstbach, wo die Hohenloher Mundartband "Annâweech" gerade ein Konzert gibt. Der Ochsenwirt, ein lokaler Platzhirsch, hängt dort mit einer Heugabel im Bauch tot im Gesträuch. Angeblich hat keiner der Besucher etwas mitbekommen. Die Suche nach der Nadel im Heuhaufen beginnt. Lutz befragt gehörnte Ehemänner, übervorteilte Geschäftspartner, missbrauchte Geliebte, einen linken Lehrer, einen korrupten Volksbank- Filialleiter, den verhassten Nachbarn, den Sohn des Opfers, die geschiedene Ehefrau – ein Stich ins Wespennest! "Sodom und Gomorra", stöhnt Lutz. Alle könnten es getan haben! Je mehr Lutz hinter die Fassaden schaut, desto undurchdringlicher wird der Fall. Da kommt eine junge Frau, der ein Verhältnis mit dem Opfer nachgesagt wird, durch einen Unfall ums Leben …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 257
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
WALTER HÄBERLE
Der Teufel von Jagstbach
Ein Baden-Württemberg-Krimi
Walter Häberle, 1941 in der Nähe von Köln geboren, im Rheinland und später in Unterweissach bei Backnang in Baden-Württemberg aufgewachsen. In einem kirchlichen Internat machte er 1962 das Abitur und wurde Lehrer, erst in Aalen, dann bei und in Schwäbisch Hall. Dort heiratete er und zog später mit Frau und zwei Kindern nach Brüssel, wo er fünf Jahre an der Deutschen Schule unterrichtete. Heute lebt er in Künzelsau im Ruhestand und hat alle Zeit der Welt zum Schreiben, wenn er nicht gerade Rennrad fährt.
1. Auflage 2017
© 2017 by Silberburg-Verlag GmbH,Schönbuchstraße 48, D-72074 Tübingen.Alle Rechte vorbehalten.Umschlaggestaltung:Christoph Wöhler, Tübingen.Coverfoto: © woyzzeck – iStockphoto.Druck: CPI books, Leck:Printed in Germany.
E-Book im EPUB-Format: ISBN 978-3-8425-1770-7E-Book im PDF-Format: ISBN 978-3-8425-1771-4Gedrucktes Buch: ISBN 978-3-8425-2028-8
Besuchen Sie uns im Internetund entdecken Sie die Vielfaltunseres Verlagsprogramms:www.silberburg.de
Inhalt
Der Teufel von Jagstbach
Nachwort
So hat Lutz sich das nicht vorgestellt.
Finster, öde, rückständig, stockkatholisch, hinterwäldlerisch oder, in seinem Schwäbisch, »hentedomme«. Solche Begriffe wären ihm bisher zum Stichwort Jagsttal eingefallen. Und nun, da er zum ersten Mal, von Künzelsau kommend, die Steige nach Oberregenbach hinunterfährt, taucht er ganz unvermittelt ein in ein lieblich weites, helles Tal mit akkurat bestellten Feldern links und rechts des Flüsschens. Die mit Klatschmohn, Salbei, Lichtnelken und Margeriten leuchtend bunten, sanft ansteigenden Wiesenhänge gehen auf halber Höhe in lichtes Buschwerk über und werden schließlich von dichten Laubwäldern in variierenden Grünschattierungen bekränzt. Darüber wölbt sich ein hoher, sattblauer Himmel, an dem watteweiße Wolkenschiffe majestätisch unter vollen Segeln stehen. Gestern waren nach einem schwülheißen Sommertag heftige Gewitter über Hohenlohe niedergegangen. Heute Vormittag hatten die Wälder noch lebhaft wabernd gedampft.
Unten, hinter einer langen steinernen Bogenbrücke, die so schmal ist, dass sie keinen Gegenverkehr zulässt, baden rechter Hand ausgelassene Kinder an einem Wehr in der Jagst, aus sicherem Abstand von einem majestätisch treibenden Schwanenpaar beäugt. Links die Sägemühle – Königsmühle genannt – ist jetzt, am Samstagabend, längst zur Ruhe gekommen. Zwischen smaragdgrünen Holunderbüschen leuchten frisch gesägte Bretterstapel und senden ihren harzigen Duft bis in den Innenraum des Dienstfahrzeugs.
Mit den oben am Waldrand träge grasenden schwarzbunten Rindern und der Schafherde, die eifrig vom Hütehund umkreist wird, fügt sich das Bild, das sich dem staunenden Kriminalhauptkommissar aus Künzelsau im frühen Abendsonnenlicht bietet, zu einer paradiesischen Idylle, wie sie sich kein Maler an seiner Staffelei romantischer hätte ausdenken können.
Der Wieland guckt da gar nicht hin, denkt Lutz. Aber der ist ja hier zu Hause. Die Einheimischen nehmen diese zauberhafte Landschaft wohl als etwas Selbstverständliches hin. Tausendmal gesehen macht das Auge blind, die Sinne taub, die Gefühle stumpf. Oft schon so erlebt. Schade, denkt Lutz, schade, dass die über ihre traumhaft schöne Heimat so gar nicht mehr staunen können.
Und in diesem Paradies soll das Böse hausen und sein Unwesen treiben, soll es Betrug, Verschlagenheit, Heimtücke, Gewalt bis hin zu Mord und Totschlag geben wie überall auf der Welt? Schließlich sind er und sein Assistent Wieland, der den Wagen fährt, zu einem Tatort gerufen worden, denn sie gehören der Mordkommission der Kripo Künzelsau an. Aber bitte, geht es Kommissar Lutz ernüchternd durch den Sinn, was hat er denn erwartet? Der erfahrene Polizist gibt sich längst keinen Illusionen mehr hin. Sein Beruf hat ihm in über dreißig Dienstjahren seine schwärmerischen Vorstellungen von einer redlichen, friedlichen und gerechten Gesellschaft gründlich ausgetrieben. Sie waren ihm bei seiner Berufswahl noch wichtig gewesen. Von wegen Paradies! Er weiß es längst: Wo Menschen leben, da gibt es kein Paradies, seit Adam und Eva nicht mehr.
Vor vier Wochen erst hat er seinen Dienst in der Kreisstadt des Hohenlohekreises angetreten. Er hatte sich nach einem schnell gefassten Entschluss als Chef der Kriminalpolizei nach Künzelsau beworben, dort hinten im beschaulichen Hohenloher Land. Vier Wochen der Einarbeitung liegen hinter ihm, zwei Wochen Vorstellungsgespräche auf Landratsamt, Rathäusern, Dekanaten, Behörden und Institutionen, beim Staatsanwalt und beim Amtsrichter, mit und ohne Sektglas in der Hand. Zwei Wochen Kennenlernen von Mitarbeitern, Abteilungen, Organisationsplan, Statistiken, Ausstattung und Räumlichkeiten seines neuen Wirkungskreises. Sein Chef, Polizeidirektor Dietz, hatte ihn gründlich eingewiesen. Es war an der Zeit, dass die vielen Gespräche der Anfangstage nun handfester polizeilicher Arbeit Platz machten.
Was hatte er gestern gehört? Bei einem Empfang war er dem Künzelsauer Unternehmer Reinhold Würth vorgestellt worden. Der hatte ihm nach einer kurzen, freundlichen Plauderei wohlwollend auf die Schulter geklopft und mit einem listigen Schmunzeln um die schmalen Lippen geraten: »Wisse Sie, Herr Kriminalhauptkommissar, bei mir heißt’s scho mei ganz Lebe lang: Schaffe, net schwätze. Mache Sie’s genauso!«
Nun also, schneller als gedacht, sein erster Fall, und noch dazu gleich ein Kapitalverbrechen, wie es in seinem Revier nur alle paar Jahre eines gibt. Chefsache also.
Lutz auf dem Beifahrersitz holt tief Luft, klatscht in die Hände und ruft: »Also, Wieland, an die Arbeit! Schaffe, net schwätze.«
»Ich hab doch gar nichts gesagt«, brummt der junge Kommissar.
In Jagstbach hat einige Stunden zuvor die Hohenloher Mundart-Band »Annâweech« ein Konzert gegeben. Am Rathaus in Weinsberg steht in Stein gemeißelt: »Dennoch – trotzdem – eineweg!« Und in Hohenlohe sagen sie »annâweech«. Die fünf Freizeit-Musiker haben vor Jahren nach einer Krise der Band trotzdem weitergemacht und heißen seither »Annâweech«. Solche Nachmittags-Konzerte im Freien nennen sie »Familienkonzert«. Kind und Kegel pilgern zu diesen beliebten Konzerten, meist an einem Samstagnachmittag. Man sieht den Opa mit dem Rollator und das Enkele im Buggy über die Festwiese holpern und nicht selten liegt auch der Hund im Schatten unter dem Biertisch.
Eingeleitet haben »Annâweech« ihr heutiges Konzert mit ihrem Lied »I bin a Hoheloher«.
Würddaberch hat uns kassiert,
Die Schwoobe hen z’erscht g’lacht.
Bis heit hen’s uns noch net dressiert,
Mir hen uns nix draus g’macht.
I bin kon Schwoob, i bin kon Frank’ –
I hob an Schlitz im Ohr
I wohn aa net im Bayernland – i bin a Hoheloh’r!
Mir sin a Land und hen a G’schicht – en eich’na Dialekt
Zwischa Kocher, Dauwer und dr Joogscht,
Hen mir uns guat versteckt.
I bin kon Schwoob, i bin kon Frank’ …
Und weil i doo gebora bin, und weil me’s doo sou g’fällt,
Verlass’ i Hohelohe net – um alles in dr Welt!
I bin kon Schwoob, i bin kon Frank’ …
Eine treue Fan-Gemeinde begleitet die fünf hauptsächlich in dem Viereck Schwäbisch Hall, Crailsheim, Mergentheim und Heilbronn bekannten Hohenloher Musiker zu allen ihren Auftritten. So auch heute in den Ochsengarten von Jagstbach.
Die Band stimmt die beliebte Hymne »Kocherdool« an, die nach der Beatles-Melodie »Penny Lane« geht.
Molle und Boudsch, die beiden Frontmen der Band, haben mit ihren lockeren Sprüchen die Stimmung auf Touren gebracht. Ein Teil der Gäste singt in verzückter Stimmung aus vollem Halse mit. Sie kennen die Texte längst auswendig. Manche schwenken zum Refrain ihren Bierhumpen oder das Glas Apfelsaftschorle.
»Kocherdool, wann i di heut asou ouseh,
Zubaut hens dei Wieslich und dei Höh’,
Und glaab mor, des duat weh.«
Da drängelt sich ein Bauer mit Schirmmütze, in dünner, blauer Jacke, grüner Baumwollhose und Gummistiefeln nach vorn, fuchtelt, hüpft, brüllt: »Ja, Kocherdool, Kocherdool!« Seltsam, denken die Umstehenden, etwas lächerlich, dieser Fan. Ganz und gar untypisch. Passt irgendwie nicht in diese fröhliche, ausgelassene Stimmung.
Bis sie merken, dass der gar nicht mitsingt, sondern stören will, dazwischen brüllt: »Kocherdool! Hör mer doch uff! Was geht uns ’s Kocherdool ou? Hent’r vergesse, dass mir dohanne im Jogschtdool san? Sell diebe left se, d’ Joogscht, seahnt ’r se ned? Höret mr doch uff mit ›Kocherdool‹! Hent’r kaa Lied iwwer d’ Joogscht?«
Molle Winkler, der Lead-Sänger von »Annâweech«, erfasst schnell die Situation, runzelt beim Singen die Stirn, blickt irritiert kurz zu Boudsch, dem Gitarristen, hinüber, der ratlos die Schultern hochzieht, aber doch weiterspielt. Molle wiederholt nach der letzten Strophe trotzig den Refrain »Kocherdool, wann i di heut asou ouseh …«, etwas lauter noch als vorher.
Der Landmann hält tapfer dagegen. Auch er wird lauter: »Höret doch uff!«, brüllt er ein ums andere Mal gegen die Lautsprecherboxen zur Bühne hinauf. Die Zuhörer neben ihm weichen ängstlich zurück, denn jetzt dreht der zornige Schreier seine Mistgabel, auf die er sich bisher gestützt hatte, um und fuchtelt mit den Zinken in der Luft herum.
Die Band hat das Kochertal-Lied zu Ende gespielt. Die Menge johlt und klatscht, einige lassen begeistert schrille Pfiffe ertönen. Der Bauer schreit gegen den Beifall an, wie er eben noch gegen die Musik angeschrien hat.
Molle in seiner blauen Latzhose tritt an die Bühnenkante vor und ruft zu dem Krakeeler hinunter: »Sooch emol, was regscht du di denn aso uff? Wer hat denn dir gschriee? Was willsch denn du dahanne mit deire dreckige Miischtgawel? Wenn dir unser Musich net gfallt, no geh doch haam in dein Kuhstall oder leech di uffs Kanapee und mach dei Glotze ou!«
»Wer mir gschriee hat? Wer euch gschriee hat, möcht i wisse! Wäret ihr doch in eierm Kocherdool bliewe, wenn’s do so schee isch!« Mit der Gabel am ausgestreckten Arm zeigt der Landmann zum Jagstufer hinüber: »Do guck niwwer, sell isch mei Wiesle. Do standet en Haufe Autos druff, e jeder fährt mit seim Karre driewer und mecht mr Laaser nei, und wenn die Kerlich bei euch dahanne gnueg gsoffe hent, no saichet se bei mir au no älles voll.«
»Ha, sei doch froh, no hasch glei ummesuunscht düngt.« Molle rückt sich grinsend die Schirmmütze zurecht. Er hat die Lacher auf seiner Seite.
»Nââ, sooch i dir, a Sauerei isch dees! Gestern hats gwittert und g’reechert, älles isch nass und waach. Die Autos machet mei Wiesle hii! Wer zohlt mir des? Du vielleicht?«
»Hör zu, Ökonom: Des isch net mei Sach. Veranstalter isch dr Ochsewirt. Der hätt do vielleicht absperre solle.«
»Dr Ochsewirt? Ha, des passt zu dem iewerzwercha Granateseckel, dem dappiche. Kannsch ihm sooche, wenn die Sauerei et uffhört, no ramm i ihm mei Miischtgawel in sein dicke Ranze nei, dass d’s Fett nor so raustropft, jawoll, mei Miischtgawel!«
»Au, au, au, nor amol langsam!« Molle greift zum Mikrophon. »Leit, höret amol her! Dort links isch für euch en großer Parkplatz reserviert. Da gibt’s no g’nug Platz. Wer sei heilix Blechle donebe auf dem Wiesle abg’stellt hat, soll bitte g’schwind umparke, damit der Bauer kaan Schode hat. Send so guet. Stellet eire Kärre uf de Parkplatz! Ende der Durchsage.« Und dann wendet er sich an den Kontrahenten vor der Bühne: »Z’friede, ha? Und du derfsch dir jetzt a Lied wünsche. Was solle mr spiele, extra für di?«
»Ihr kennet mi am Orsch lecke, alle mitnander!«, bellt der Bauer zur Bühne hinauf und stapft mit seiner schmutzigen Mistgabel davon.
Die Umstehenden lachen und sehen ihm kopfschüttelnd nach. Molle und seine Band Annâweech stimmen ihre Walzerparodie »An dr scheene, blaue Joogscht« an und singen sie dem zornigen Bauern schmunzelnd hinterher. Für sie ist damit die Sache erledigt.
Zwei Stunden später – »Annâweech« haben längst ihre letzte Zugabe gespielt und gerade die restlichen Utensilien in ihrem Busle verstaut – begibt sich ein Besucher zum Pinkeln hinüber ans Jagstufer.
Wenn ein Mann pinkelt, dringt erst ein leises, lustvolles Stöhnen aus seiner Kehle, dann bekommt er einen glasigen Blick, der versonnen ins Leere schweift, eher nach innen gekehrt. Doch dieser Blick des wackeren Zechers bleibt jetzt an einem dunklen Etwas im Gebüsch hängen. Es sieht aus wie eine vergessene Jacke. Nach Beendigung seines mit aller nötigen Sorgfalt und großem Bedacht ausgeführten Geschäfts tritt der erleichterte Festbesucher neugierig näher und glaubt jetzt keine vergessene Jacke, sondern eher einen Betrunkenen zu erkennen, der sich dort im Gestrüpp verheddert hat. Doch als er nach wenigen Schritten die wahre Situation erfasst, überfällt ihn schlagartig das kalte Grausen.
Ein fülliger Mann in Lodenweste und Cordhose hängt rückwärts in einem Erlenstrauch. Sein grüner Hut ist leicht verrutscht, die Augen sind weit aufgerissen. Ungläubiges Staunen liegt auf dem reglosen Gesicht. Aus einem Mundwinkel führt eine dünne, dunkelrote Spur über Kinn und Hals unter den Kragen seines karierten Flanellhemdes. Unterhalb der Brust des Mannes ragt der Stiel einer Bauerngabel steil ins Laub empor. Und das Entsetzliche ist, dass diese Gabel bis zum Schaft in dem Bauch des Mannes steckt.
Jetzt erst wird der Entdecker dieser grausigen Szene den Hund gewahr, der zu Füßen des Mannes im Gebüsch liegt und leise vor sich hin winselt. Als nämlich der junge Mann näher treten will, richtet sich das große Tier auf und fletscht knurrend die Zähne. Wie gehetzt eilt der fassungslose Gast zu seinen Kumpanen am Biertisch und berichtet.
»Kerle, bisch bsoffe oder was?«, ruft einer.
Ungläubig, ja widerwillig nur folgen sie feixend dem wirr daherredenden Freund zum Gebüsch an der Jagst und sehen voller ernüchterndem Entsetzen, was sie noch nie zuvor in ihrem Leben gesehen haben. Furchtsam bleiben sie in respektvollem Abstand stehen, nicht nur wegen des Hundes, und starren hinüber zu dem Mann im Gebüsch, der sie unverwandt ansieht. Jeden Augenblick, so scheint es ihnen, ja, so hoffen sie noch, könnte er sich lachend aufrichten, sich über ihre erschrockenen Gesichter lustig machen und seinen gelungenen Streich genießen. Aber schnell wird ihnen klar, dass der da im Gebüsch sich nie mehr aufrichten und lachen würde, dass sie hier nicht Opfer eines makabren Scherzes, sondern Zeugen eines abscheulichen Geschehens geworden sind.
Einer findet als Erster die Sprache wieder: »Scheiße, das ist ja der Ochsenwirt!«
Geistesgegenwärtig zückt er sein Handy und wählt 110: »Kommt schnell, da hängt ein Mann im Gebüsch … Der hat eine Gabel im Bauch … Nein, keine Kuchengabel … Ja, Notarzt und Krankenwagen … Vielleicht lebt er ja noch … In Jagstbach, hinter dem Ochsengarten, direkt an der Jagst. Schnell!«
Mit Blaulicht und Martinshorn trifft keine zehn Minuten später eine Polizeistreife am Ochsengarten ein, dicht gefolgt von Notarzt und Rettungswagen. Der Besucher, der den Notruf abgesetzt hat, geht gestikulierend auf die Beamten zu und führt sie ans Jagstufer, wo sich bereits eine große Gruppe Schaulustiger eingefunden hat. Wenige, meistens Frauen und Kinder, halten sich noch an den Biertischen im Ochsengarten auf. Die Mütter passen auf, dass ihre Kleinen dem schrecklichen Ort fernbleiben.
Der Jagdhund lässt weder Polizisten noch Helfer näher kommen. Einer der Umstehenden aber kennt das Tier offenbar gut.
»Aus, Rezzo, aus! Komm, Rezzo, ganz ruhig, Rezzo, keiner will dir oder Herrchen was tun. Komm, Rezzo, brav …«
Beruhigend auf den Hund einredend, gelingt es ihm schließlich, die Leine aufzunehmen, die im Gras liegt, und das winselnde Tier zu seiner Hundehütte im Hof des »Ochsen« zu führen, wo es sich einfach anketten lässt.
Die Polizeibeamten haben derweil ihre Kollegen von der Kriminalpolizei alarmiert. Umsichtig haben sie sogleich erste Fotos vom Fundort gemacht, das Gebüsch weiträumig mit rot-weißem Absperrband gesichert und die Umstehenden gebeten, in den Ochsengarten zurückzukehren, aber noch nicht nach Hause zu gehen.
Die Rettungssanitäter legen den Ochsenwirt vorsichtig ins Gras und ziehen ihm mit einem Ruck endlich diese grässliche Gabel aus der Brust.
Der Arzt stellt nach kurzer Untersuchung lakonisch fest: »Der Mann ist tot.« Er schiebt ihm ein Thermometer unter die Zunge und ergänzt kurz darauf: »Seit zwei Stunden – plus/minus etwa dreißig Minuten. Es ist sehr warm heute.« Die neben ihm stehenden Sanitäter weist er an: »Sie können zurückfahren. Für Sie gibt es hier nichts mehr zu tun.«
In diesem Augenblick treffen Kriminalhauptkommissar Lutz und Kommissar Wieland im Ochsengarten ein, fast gleichzeitig mit drei weiteren Beamten von der Spurensicherung, die sich sogleich ein Bild von der Situation machen, kurz mit den Streifenkollegen und dem Arzt reden, ihre weißen Schutzanzüge überstreifen und sich dann routiniert an ihre Arbeit machen. Nummerntäfelchen werden ins Gras gesteckt, alles wird fotografiert, vermessen, Skizzen angefertigt, jedes Detail unter die Lupe genommen, der Boden und das Gebüsch penibel abgesucht, jede Beobachtung ins Diktiergerät gesprochen.
Der Arzt veranlasst noch telefonisch den Abtransport der Leiche, bevor er sich von Lutz und Wieland verabschiedet.
»Brauchen Sie meinen Bericht heute Abend noch? Es ist Samstag.«
»Spätestens morgen um neun zur ersten Lagebesprechung«, meint Lutz. »Geht das?«
An vier weit auseinander stehenden Biertischen nehmen Lutz, Wieland und die beiden Streifenbeamten Platz und befragen einzeln die erwachsenen Biergartenbesucher. Zeugen werden notiert und vernommen. Wer hat den Mann gefunden? Wann? Wo? Wie? Kennen sie den Toten? Hat ihn jemand angefasst? Hat jemand etwas beobachtet? Hat jemand am Fundort etwas verändert, etwas aufgehoben oder weggeworfen? Wurde zwischen 16.30 Uhr und 17.30 Uhr jemand beobachtet, der zum Jagstufer gegangen oder von dort weggelaufen ist?
Die meisten Besucher sind von auswärts. Keiner will etwas von dem grausigen Geschehen mitbekommen haben, keinen Streit, keinen Schrei. Die Musik sei sehr laut gewesen. Dazwischen Beifall, Johlen, Pfiffe, Festtrubel, die vielen Kinder, alles zusammen eine sehr geräuschvolle Kulisse. Der Fundort des Toten liegt außerdem gut vierzig Meter vom Festplatz entfernt.
Bei der Kunde vom Tod durch eine Gabel fällt einigen Gästen der wütende Bauer mit der Mistgabel ein und seine Drohung, er würde dem Ochsenwirt die Gabel in seinen fetten Bauch rammen. Laut genug hatte er das gebrüllt.
Lutz hakt mehrmals nach: »Was genau hat sich da abgespielt? Sind Sie sicher, dass dieser Bauer eine solche Drohung ausgestoßen hat? Kennen Sie diesen Mann?«
Die Aussagen decken sich auch in diesem Punkt weitgehend. Die paar Einheimischen unter den Befragten sind sich einig: »Das war doch der Karle. Der wohnt dort drüben auf dem alten Bauernhof.«
Inzwischen trifft der Leichenwagen ein und bringt den Toten auf Lutz’ Anweisung in die Gerichtsmedizin nach Heilbronn.
Die Aufregung legt sich allmählich. Eine gedrückte Stimmung greift um sich im Ochsengarten von Jagstbach. Molle und Boudsch ist das Sprücheklopfen gründlich vergangen. Oh Gott, das fröhliche, ausgelassene Familienkonzert hat ein solch schreckliches Ende genommen. Der wütende Karle hat den Ochsenwirt umgebracht! Diese Gewissheit macht in Windeseile die Runde. Erst im Ochsengarten, dann im Dorf.
Der Karle! Sie haben ihn oft nicht ganz ernst genommen. Wer hätte dem so etwas zugetraut? Na ja, etwas komisch ist der ja schon manchmal. Ein Eigenbrötler. Regt sich immer so schnell auf. Bellt gleich los mit seiner hohen, heiseren Stimme. Und den Ochsenwirt, den hat er schon gar nicht leiden können. Ach was, gehasst hat er ihn. Und jetzt hat er ihn umgebracht. Abgestochen mit seiner Mistgabel. Wozu Menschen doch fähig sind!
Kriminalhauptkommissar Lutz und Kommissar Wieland machen sich nach Abschluss der Befragungen sogleich auf den Weg zu dem etwas heruntergekommenen Bauernhaus zwischen dem »Ochsen« und der Jagstaue.
Es klingelt.
Noch immer rumort der Ärger über die Falschparker in seinen Eingeweiden. Sie haben nach der Durchsage zwar ihre Autos aus seiner Wiese gefahren, aber die tiefen Reifenspuren, die »Laaser«, wie er sagt, wird er am Montag mit der Egge einebnen müssen. Als ob er nichts anderes zu tun hätte! Er schenkt sich aus dem Mostkrug nach und tut einen tiefen Zug.
Das hat er auch dem Ochsenwirt ganz deutlich gesagt, der ihm auf seinem Heimweg aus dem Biergarten über den Weg gelaufen war, dass er sein Gelände hätte absperren sollen.
»Wenn du scho a Feschdle veranstaltescht, no aber net auf ander Leut’s Koste!«
»Ach, die paar Autos, stell di net so an!«, hat der zurück gefaucht. »Machst aus jeder Muck en Elefant. Du bist und bleibst e kleinkarierter Kläffer. Was anderes ist von dir und deim Spatzehirn auch gar net zu erwarten.«
Spatzenhirn! Das hat der Ochsenwirt schon öfter gesagt, auch vor anderen Leuten. Das hat ihn richtig zornig gemacht. Innerlich hat er zu kochen begonnen. Wütend hat er mit beiden Händen seine Mistgabel umklammert …
Es klingelt erneut.
Jetzt erst registriert er die Türglocke, schaut auf die Uhr auf der Kredenz: schon neun durch! Wer will jetzt noch etwas von ihm? Er erwartet heute niemanden mehr. Er erwartet eigentlich nie jemanden. Einmal in der Woche kommt seine Tochter und kümmert sich um den Haushalt, macht etwas sauber bei ihm, räumt die Küche auf, lässt alle vierzehn Tage eine Waschmaschine laufen. Mit der Waschmaschine kommt er einfach nicht zurecht. Nach dem Tod seiner Frau vor zwei Jahren hatte er ein paar Mal versucht, das Ding zum Laufen zu bringen, war aber mit den drei Einfüllbehältern und den vielen Knöpfen nicht klargekommen und hatte resigniert. »Mach du das, du kennst dich damit aus.« Aber die Tochter kommt immer montags und heute ist Samstag.
Klingeln, dann auch lautes Klopfen an die Haustür.
Die Fischerchöre trällern gerade aufgesetzt fröhlich »Falleri, fallera, falleralalalala …« Bauer Karle schwenkt seine Beine vom Sofa, stellt die Füße auf den Boden, fährt in die Pantoffeln, stützt sich schwer auf die Tischplatte, stöhnt beim Aufstehen und brummt »Heilixdunnderwedder nochamol!«.
Vor der Tür stehen zwei Männer, einer ist geschätzte ein Meter achtzig groß, Ende vierzig, sportliche Figur, aber mit leichtem Bauchansatz unter seinem hellblauen Sommerhemd. Er hat einen offenen Blick, trägt eine randlose Brille, hat eine hohe Stirn mit starken Geheimratsecken und braunem Bürstenhaarschnitt. In seinen markanten Schnauzbart mischen sich deutlich graue Borsten. Der andere, ein Schlaks in blauen Sneakers, der Jeans trägt und seine blonden Haare mit Gel aufgestellt hat, ist kaum halb so alt. Der hält Karle seinen Polizeiausweis hin.
»Guten Abend!«, sagt er, »Kommissar Wieland«, und legt zwei Finger an die Stirn. »Sie brauchen aber lang. Wir haben Licht gesehen.«
»Polizei? Was wellet Sie denn nachts um halwer zehne noch? Kommet Sie wege dene Autos auf meim Wiesle? Do kennet Sie glei wieder hoamfoahra. Die Sach isch geklärt. Au ohne Polizei. I will den Ochsewirt net azeige, weil Dommheit isch net strafbar.«
»Autos? Nein. Ochsenwirt? Schon eher. Darf ich Sie nach Ihrem Namen fragen?«
»Karle.«
»Und Ihr Nachname?«
»Ha, Karle halt.«
»Sie heißen mit Nachnamen Karle?«
»Ja, höre Sie schlecht?«
»Und Ihr Vorname ist …?«
»Eugen.«
»Herr Karle, dürften wir bitte drinnen mit Ihnen weiterreden?«
»Wege was denn?«
»Bitte!«
»Herrschaftssechse – wenn’s sei muss!«
Gotthilf Fischer ist gerade beim Abmoderieren. Es herrscht Dämmerbeleuchtung in der Stube. Der mostgeschwängerte Mief verschlägt den Besuchern kurz den Atem und der Jüngere verdreht angewidert die Augen.
Bauer Karle, großgewachsen, hager, mit Stoppelbart, wirrem Schopf hinter der Halbglatze und aufgeknöpftem Flanellhemd dreht sich mit mürrischer Miene zu den beiden Beamten um und beäugt sie misstrauisch. Er deutet kurz auf die Stühle am Tisch.
»Sie kommet also net wege meim Wiesle? Wege was no, ha? Isch ebbes passiert? Isch – ebbes mit der Melanie?«
»Melanie?«
»Ha, mei Tochter.«
Jetzt ergreift zum ersten Mal der Ältere das Wort: »Herr Karle, mein Name ist Lutz. Ich bin der Leiter der Kripo Künzelsau. Sie waren heute Nachmittag im Biergarten drüben?«
Bauer Karle langt nach der Fernbedienung und schaltet den Fernseher aus. Ihm wird ganz beklommen zumute. Warum kommt die Polizei zu ihm und warum fragen sie das? Hat etwa jemand ihn angezeigt?
»Ja, i wor im Ochsegarte, aber net als Gast, sondern weil die Leut dort ihre Autos auf mei Wiesle g’stellt hent und Laaser neig’fahre hent. Des derfet die doch net ôfach, oder? O’gfrogt, sapperment! Aber i will deswege kaa Polizei im Haus howe. So klaakariert bin i doch net. I hob mit em Ochsewirt g’schwätzt und die Kärre sind weg und fertich.«
»Sie haben mit ihm gesprochen? Haben Sie sich gestritten?«
»G’stritte? Nââ, ougoscht hemmer uns halt. Mit dem Saidraiwer kousch ja net normal schwätze.«
»Hatten Sie bei der Auseinandersetzung eine Gabel dabei?«
Bauer Karle nickt unsicher.
»Warum hatten Sie die Gabel dabei?«
»Worum? Ha weil, wo i mei Mischte han welle uffsetze, do hob i g’seche, dass dia Autos uff mei Wiesle neig’foahre san und no bin i glei niwwerg’laafe zu dere Kapell.«
»Sie waren sehr wütend?«
»Ha, freile! Sie schwätzet vielleicht raus! I kann jetzt am Meendich mit meim Bulldog und der Eiiche niwwerfohre uff mei Wiesle und älles widder eewe mache, kreizsapperlot! Do kousch scho en Zoore kriache, oder? Derf dahanne afange a jeder mache, was er will?« Schon wieder gerät er in Rage.
»Meendich? Eiiche? Eewe? Zoore?« Lutz zieht ratlos die Schultern hoch und blickt Wieland hilfesuchend an.
»Herr Karle meint, er müsse jetzt am Montag mit der Egge alles wieder eben machen und darüber sei er zornig.«
»Hm. Den Ochsenwirt, den mochten Sie wohl nicht besonders?«
»Den? Nââ, den mooch i ganz gwieß net! Des isch dr greescht Seggl vom ganze Flecke und spielt sich uff wie der Graf Rotz. Send se mr net bees. I sooch’s grad, wie’s isch. Seit der mi bei dr Flurbereinichung b’schisse hot, bin i mit dem fertich. Jawoll, uff ewich und drei Dooch bin i mit dem fertich. Secht zu mir, i häb a Spatzehirn, grod der Hamballe mueß des sooche!«
»Wann hat er das gesagt?«
»Scho a paarmol, und heit Middooch aa wieder.«
»Und darüber haben Sie sich aufgeregt.«
»Ha freilich, findet Sie des vielleicht zom Lache?«
Lutz räuspert sich in seine Faust und vermeidet es, Wieland anzusehen.
»Und dann sind Sie mit der Gabel auf ihn losgegangen.«
»Was bin i? Saudomms Gschwätz! Secht des der Ochsewirt, der großgoschede Lugebeitel?«
»Nein, Herr Karle, der Ochsenwirt sagt das nicht, glauben Sie mir. Aber Sie haben damit gedroht, ihm die Gabel in den Leib zu stoßen. Dafür gibt es zahlreiche Zeugen.«
»Ha ja, des wor bei dere Kapell, wo die gsocht hewwe, der Ochsewirt sei schuld, dass die Autos uff meim Wiesle steahne. Awwer do wor der Ochsewirt, der Schlabbesaacher, gor net dabei.«
»Und wo sind Sie dem Ochsenwirt dann begegnet?«
»Unte an der Joogscht, wo i von dere Kapell wieder zu meim Houf z’rückg’laafe bin. Do isch er kumme, der Huedsimbl, mit seim Hund.«
»Wann genau war das?«
»Ja, heidanaei aber au, hätt i do vielleicht uff d’ Uhr gucke gsollt?«
»Kann das so gegen fünf gewesen sein?«
»Von mir aus. Worom wellet Sie des so gnau wisse?
»War da jemand in der Nähe?«
»Nââ, i hob neamerds gseeche.«
»Und die Gabel hatten Sie da auch dabei?«
»Ha, freilich, zum Dunderwetter noch emol! Was denn sonscht? Hätt i se bei dere Kapell liege lasse solle? I hob doch vor em Nachtesse no mei Mischte uffsetze miaße. Was froochet Se denn âdauernd nach dere Gawel?«
»Wie ist denn Ihre Begegnung mit dem Ochsenwirt abgelaufen? Erzählen Sie einmal der Reihe nach!«
»Ha, do geit’s net viel zum Verzähle. I hob en gstellt, wege meim Wiesle, dass er hätt solle absperre, der Kleiebeitel. Und er hot z’rückgoscht, i soll mi net asou oustelle. I sei kleinkariert und tät aus re Muck en Elefante mache. Ha ja, und no hot er no gsoocht, i häb a Spatzehirn. Des wor älles.«
»Und dann sind sie mit Ihrer Gabel auf ihn los.«
»Was? Bleedsinn! Wer soocht denn sou ebbes? I hob den Schoofseggel standa lasse, be haam und han mei Mischte uffg’setzt und fertich.«
»Und der Ochsenwirt?«
»Ha, was weiß denn i? Froochet en doch selber! Der isch den Weech an der Joogscht weiterg’laafe und hat no hinter mir her g’mault. Hat der Bachel mi azeigt oder warum wellet Sie des älles wisse?«
»Wo ist Ihre Gabel jetzt?«
»Allfort Gawwel, Gawwel, Gawwel! Loint dusse nebe der Mischte an dr Hauswand.«
»Sie wissen wirklich noch nicht, was passiert ist?«
»Ha, soochet Sie mir’s halt endlich, sapperlot! Hat der Ochsewirt mi jetzt a’zeigt, der alde Maadlesschlecker, oder isch doch ebbes mit meiner Melanie?«
Lutz holt tief Luft und wechselt einen schnellen Blick mit Kommissar Wieland.
»Nein, Herr Karle. Ihr Nachbar, der Ochsenwirt, hat Sie nicht angezeigt. Konnte er gar nicht mehr. Er ist tot. Er wurde am Jagstufer mit einer Gabel erstochen.«
Bauer Karle lässt die Kinnlade fallen und schaut von einem Besucher zum andern. Sehr intelligent sieht das nicht aus. Dann schluckt er, greift nach seinem Mostglas und trinkt es in einem Zug leer.
»Tot, hent Sie gsoocht? Der Ochsewirt? Verstoche? Ja, warum?« Er atmet tief durch. »Dem Laamesiedr hätt i ja nix Guets gwünscht, aber wer duet denn sou ebbes?«
»Sie vielleicht – aus lauter Zorn?«
»Was, i? Ja, san ihr denn vo älle guete Gaaschter verlasse? Ach, dorum die ganz Froocherei! Jawoll, mit dem Ochsewirt wor i fertich uff ewich und drei Tag, aber i mach den doch net hii! Sou ebbes duet mr doch net.«
»Aber es ist genau das passiert, Herr Karle, womit Sie laut gedroht haben. Sie haben gerufen, sie rammen dem Ochsenwirt ihre Gabel in den Leib. Und Sie waren sehr erregt. Wenig später wird der Mann mit einer Gabel erstochen aufgefunden. Da müssen Sie schon verstehen, dass wir jetzt Fragen stellen.«
»Ha, sou ebbes secht mer im Zorn, mer schwätzt halt manchsmol so hummeldumm raus, aber – ha komm, des mecht mer doch net.«
»Sie wären nicht der Erste, Herr Karle, der es eben doch tut.«
Man hört die Haustüre gehen. Die Stubentür wird aufgerissen. Eine junge Frau, vielleicht fünfundzwanzig, höchstens ein Meter sechzig groß, zierlich, ausgesprochen hübsch, das blonde Haar nach hinten hochgesteckt, bleibt in der offenen Tür stehen. Von den beiden Besuchern nimmt sie gar keine Notiz.
»Vadder, was schwätze die Leit im Dorf? Des isch doch net wohr! Sooch, dass es net wohr isch! Vadder, du hasch doch dem Ochsewirt nix due? Du doch net, Vadder!«
Auf dem Weg zu ihrem Dienstwagen ereifert sich Kommissar Wieland: »Sie verhaften den Karle nicht?« »Ach, Wieland, der läuft uns nicht davon.«
»Und die Gabel, das mögliche Corpus Delicti? Sie haben die Gabel an der Hauswand nur kurz angeschaut, nicht mitgenommen, nicht einmal näher in Augenschein genommen!«
»Wieland, jetzt enttäuschen Sie mich aber! Das Corpus Delicti, wie Sie das nennen, das hat doch noch in dem Toten gesteckt, vergessen? Diese Gabel haben wir längst als Tatwerkzeug gesichert. Was soll uns da die Mistgabel an der Hauswand des Bauern Karle nützen? Die macht uns höchstens unser Auto dreckig. – Und doch …«, murmelt Kommissar Lutz nachdenklich. »Um die Gabel werden wir uns tatsächlich noch kümmern müssen. Irgendetwas stimmt da nicht.«
Unten an der Jagst ziehen schon feine Nebel über den Talauen auf, als Kommissar Wieland seinen Chef Lutz die Steige von Oberregenbach hinauf Richtung Künzelsau chauffiert. Windungen des Flüsschens blinken mattsilbern durchs Ufergebüsch. Über dem weiten Tal thront Schloss Langenburg auf seinem Bergsporn, bildet vor dem türkisfarbenen Abendhimmel eine märchenhafte Silhouette wie ein romantischer Scherenschnitt. Welch eindrucksvolles Bild von hier oben, denkt Lutz, voller Beschaulichkeit, voll des Friedens und der Ruhe. Und der Wieland guckt gar nicht hin. Aber der muss ja fahren.
Genau in dieser beschaulichen Welt dort unten, geht es Lutz durch den Sinn, ist vor wenigen Stunden ein grausamer, brutaler Mord geschehen. Das Böse schickt seine Krakenarme bis in die idyllischsten Winkel dieser Erde. Es müssen nur Menschen dort wohnen, schon ist auch die Bosheit zur Stelle. Einer da unten in dem friedvollen Tal ist ein Mörder …
Für Sonntag um 9 Uhr hat Kriminalhauptkommissar Lutz eine erste Lagebesprechung im kleinen Kreis angesetzt. Anwesend sind außer ihm und Kommissar Wieland der Leiter der Abteilung Spurensicherung und die beiden Beamten, die heute Bereitschaftsdienst haben. Dem Gerichtsmediziner wollte Lutz ersparen, sich am Sonntagmorgen nach Künzelsau auf den Weg machen zu müssen. Es reicht schon, dass der gute Mann gestern Abend noch Überstunden geleistet hat. Er hat seinen Untersuchungsbericht per Fax übermittelt. Falls nötig, meint Lutz, kann man den Experten später noch persönlich hinzuziehen.
»Meine Herren, Sie wissen, was gestern in Jagstbach am Rande eines Freiluftkonzertes passiert ist. Wir haben gestern Abend noch keine entscheidenden Ermittlungsergebnisse erzielen können. Zeugen des stattgefundenen Tötungsdelikts konnten bislang keine ermittelt werden. Von den rund fünfzig Personen, die bei unseren Befragungen noch anwesend waren, hat niemand etwas Einschlägiges gehört oder gesehen. Zwischen dem Geschehen am Tatort und unserer Befragung lagen allerdings nach Aussage des hinzugezogenen Arztes eineinhalb bis zweieinhalb Stunden. In dieser Zeit hat sich wohl nicht nur der Täter, sondern auch eine unbestimmte Anzahl von Festbesuchern entfernt. Schließlich sind wir erst nach Beendigung des Konzertes zum Tatort gerufen worden.