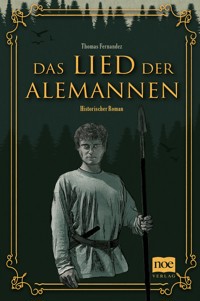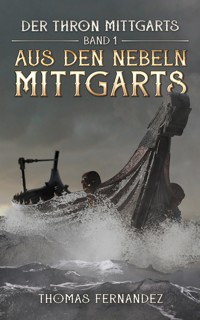
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Noe Verlag
- Kategorie: Poesie und Drama
- Serie: Der Thron Mittgarts
- Sprache: Deutsch
Drittes Jahrhundert nach Christus: Der Verbannte Sigi findet seinen Weg zum Stamm der Brukterer. Tatendurstig wirft er sich in die Ereignisse der Zeit und wird zu einem gefährlichen Feind des schwächer werdenden Römischen Imperiums. Der Götterspross formt den Stamm der Franken und gründet eine Linie, die bis zum Drachentöter Siegfried und mitten in die Wirren der Völkerwanderung führen wird. Er erlebt große Abenteuer, gewaltige Siege und vernichtende Niederlagen. Er sieht Kaiser kommen und gehen und muss sich dauerhaft mit der verfeindeten Sippe der Meroinger einen Kampf um die Vorherrschaft im Stamm der Franken liefern.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 610
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Francus ego cives
Thomas Fernandez
Der Thron Mittgarts
Aus den Nebeln Mittgarts
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation
in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
dnb.dnb.de abrufbar.
© Thomas Fernandez
© Noe Verlag
Herausgeber:
Holger Noe
Noe Media Solutions
Kruppstr. 1-3 · 51381 Leverkusen
Satz und Druck:
Noe Media Solutions
Gedruckt in Deutschland
ISBN: 978-3-96828-006-6
www.noe-verlag.de
Thomas Fernandez
Der Thron Mittgarts
Aus den Nebeln Mittgarts
I. Einführung
Ein Nibelungenroman, in dem Römer vorkommen? Der erste Teil einer Nibelungenreihe und man liest nichts von Siegfried und seinem Drachen? Was soll das?
Lange trug ich diese zwei Herzen in meiner Brust: Meine Leidenschaft für die Völkerwanderung und meine Liebe für den gesamten Nibelungenkosmos. Lange habe ich überlegt, welchen Stoff ich, nach meinem vor vielen Jahren geschriebenen Alamannenroman, angehen sollte. Soll ich in die Völkerwanderung tauchen? Soll ich über die Wälsungen, Siegfried und das Ende der Nibelungen schreiben? Was ist der Ursprung dieses Mythos – immerhin unser Nationalepos? Doch während die Griechen sich auf einen Schreiber – Homer (auch wenn man heute von mehreren Schreibern ausgeht) – ihres Nationalepos stützen, so haben wir (und die Schweden, Isländer, Norweger, Niederländer und Dänen) vielfältige Quellen des Stoffes. Wann spielt es? Wo? Was ist echt? Was Mythos? Eines ist auf jeden Fall klar: Der Stoff ist weder eine Rittergeschichte noch eine nordische Wikingergeschichte. Als ich überlegte, wo denn der Stoff wirklich greifbar wird, blieb nur eines übrig: Die Vernichtung des Burgunderreiches durch die Hunnen im Jahr 436. Und da hatte ich es! Ich brauchte nur alles in der Geschichte zurückrechnen. Und schon sind wir mitten in der Völkerwanderung! Dabei geht es mir sicher nicht um die Dekonstruktion unseres Nationalepos.
Ich wollte die Geschichte wieder dahin zurückverlegen, wo sie hingehört. Dabei soll mir bitte niemand unterstellen, ich behaupte: SO WAR‘S!
So war es eben nicht! Würde ich ein Nibelungenepos schreiben wollen, der den wahren historischen Hintergrund beleuchtet, so müsste diese Geschichte bald 800 Jahre lang sein. Sie würde sich von der Clades Varianna (Schlacht im Teutoburger Wald) bis in die Karolingerzeit ziehen. Die beteiligten Personen wären sich nie über den Weg gelaufen und somit wäre die Handlung Makulatur.
Ich verlegte die Geschichte in die Völkerwanderung, da die meisten Heldenepen der germanischen Welt vom „Heldenzeitalter“ (bis ins frühe 6. Jahrhundert) stammen.
Die Geschichte, die ich erzähle, soll über mehrere Bände gehen. Das erste Buch – dieses – beleuchtet die Geschichte der frühen Vorfahren Siegfrieds. In den verschiedenen Nibelungenliedfassungen völlig ignoriert, in der Wälsungasaga immerhin ein Kapitel, in den eddischen Liedern keine Erwähnung, in Tolkiens Bearbeitung des Stoffes einen Satz wert, wollte ich diese Charaktere, die den Ruhm der Wälsungen errungen haben, durchleuchten. Wenn ich die Fakten der Wälsungasaga mit dem Jahr des Unterganges des Burgunderreiches verbinde, so befinden wir uns im 3. Jahrhundert. Und die meisten Germanisten, die den Stoff kennen, und genug Hinweise in den eddischen Liedern zeigen, dass wir es mit einem fränkischen Stoff zu tun haben! Das passt! Denn die früheste Geschichte des Frankenstammes ist abenteuerlich genug um darüber ein Buch zu schreiben! So führte ich diese mit unserem Nationalepos zusammen. Die Ereignisse in diesem Buch, die römische Geschichte tangieren – auch die abenteuerlichsten! – sind so von römischen Chronisten überliefert.
Geneigter Leser: Wenn Sie auf unseren strahlenden Held warten, so müssen Sie sich ein paar Bücher gedulden! So lange tauchen Sie in die Welt von Mythos und Geschichte ein. Eine Welt von großen Abenteuern, einem taumelnden Imperium und von der Ethnogenese des heutigen Deutschlands und Europas! Eine Welt ohne Gut und Böse – jeder kämpfte für seine Sache. So wie es sich in allen Kriegen und historischen Umwälzungen der Weltgeschichte zugetragen hat!
Die Sprache der Germanen: die verschiedenen Stämme konnten im 3. Jahrhundert mehr oder weniger miteinander kommunizieren. Vergleichbar ist es mit heutigem Deutsch-Holländisch. Die Vertiefung der Unterschiede erfolgte wohl erst im Zuge der Völkerwanderung. Es gab (hypothetisch) wohl schon klar hörbare Unterschiede. Doch in einem Roman dieser Tatsache Rechnung zu tragen, ist illusorisch. Alle Germanen reden Neuhochdeutsch mit verschiedenen althochdeutschen oder gotischen Einsprengseln. Damit wollte ich die Geschichte authentischer, die Sprache lebendiger wirken lassen. Die Beinamen der Männer sind immer auf Althochdeutsch. Die Übersetzung ist im Glossar angehängt. So kann der Leser nachvollziehen, was Worte wie „Skafta“, „Maw“ oder „Buari“ bedeuten.
Die lateinische Sprache bzw. der gallo-romanische Dialekt: In direkter Verbindung mit den Germanen, bzw. bei Sätzen, die für den Erzählfluss nicht essentiell bzw. eindeutig sind, bin ich beim Lateinischen geblieben. Natürlich kultiviertes Hochlatein. In der römischen Wirklichkeit hätten wir es mit Vulgärlatein, lateinischen Dialekten und verschiedenen Kauderwelschen zu tun. Doch genau wie bei den germanischen Sprachen wollte ich den Erzählfluss nicht bremsen. So erscheint die direkte lateinische Rede – wenn sie ins Deutsche übersetzt ist – in Kursivschrift. Das bedeutet: Hier wird Latein gesprochen, aber für Sie – werter Leser – übersetzt.
Zu den mythologischen Aspekten: Der Glaube der Germanen im 3. und 4. Jahrhundert war weder der Glaube der Nordmänner im 10. Jahrhundert noch die Religion, die Tacitus beschrieb. Auch gab es regionale und stammesbedingte Unterschiede, ein großes Maß an niederer Mythologie, die verloren gegangen ist, und Götterbenennungen, die wir nicht mehr kennen. Wie groß der Pantheon war, wer beim nordischen Pantheon genuin nordisch oder „allgermanisch“ ist, können wir nur bei den Hauptgöttern rekonstruieren. Klar ist: Die Edda ist sehr christlich beeinflusst. Genauso wie die Religion der Germanen im Zuge der Völkerwanderung durch die klassische, antike Welt Einflüssen ausgesetzt war. Wie viel Jupiter, Mithras und Mercurius in Wotan stecken, können wir nur erahnen. Wann Donar als Kriegsgott von Wotan abgelöst wurde auch (wohl im späten Frühmittelalter). Doch um die Mythologie als realen Bestandteil der Welt darzustellen, musste ich eine religiöse Systematik erbauen. Dabei müssen die ewigen Götter (oder nicht ewig?) über dem Wandel stehen. Götter, die mit der Zeit gehen und plötzlich fremdländische Attribute annehmen, wären nicht glaubhaft. So habe ich versucht mit Hilfe von allen Quellen eine glaubhafte Götterwelt für die Völkerwanderung zu zeichnen.
Am Ende des Buches gibt es für alle Neueinsteiger ein Wörterglossar. Trotzdem habe ich versucht im Fluss des Buches alle Wörter zu erklären, oder dem Leser die Möglichkeit zu geben sich die Bedeutung zu erarbeiten. Für alle römischen und germanischen Bezeichnungen, die im Laufe des Buches benützt werden, gibt es trotzdem eine konzentrierte Erklärung am Ende. Auch eine – z.T. fiktive – Zeittabelle. Zum Teil fiktiv heißt: Der Bezug auf die agierenden Figuren ist fiktiv. Viele – oder fast alle – historischen Ereignisse, auf römischer und auf germanisch/fränkischer Seite sind durch Quellen belegt.
Kurzum: Ich hoffe, mein Versuch Mythos und Historie zu vermählen, quittiert der Leser mit Wohlwollen. Falls ich in der Beschreibung der brukterischen Heimat an Rhein und Ruhr gefehlt habe und mir dort heimische Geschichts- und Heimatkenner Fehler vorwerfen, so seid gnädig mit mir: Ich bin ein Schwarzwälder und schreibe aus der Ferne. Gerne können Sie mich anschreiben und mir meine Fehler aufzählen. Diese versuche ich in den nächsten Büchern – solange es keinen Bruch zum ersten bedeutet – gerade zu biegen. Genauso verhält es sich mit den römischen Angelegenheiten: Mein Metier ist die Kultur und Geschichte der Germanen. Sollte ich gefehlt haben, melden Sie sich bitte!
Nun wünsche ich viel Freude beim Eintauchen in die Welt von Göttern, Stämmen, Imperien, Helden, Kaiser und dem großen Umbruch Europas!
II. Über Germanen
Die Germanen bewohnten ursprünglich die Länder zwischen Rhein und Weichsel, Donau und den nördlichen Ländern, die man „Skandia“ nannte. Germanen nannten sie nur die Römer. Sie selber sahen sich als Angehörige der verschiedenen Stämme. Im Laufe des 3. Jahrhunderts nach Christus begannen sich kleinere Stämme langsam zu großen Stämmen oder Stammesbünden zu vereinen, zu wandern und auszubreiten. So wurden beispielsweise aus Semnonen und Sueben die Alamannen. Es gab noch die Stämme der Goten, Vandalen, Burgunder, Friesen, Brukterer, Chatten, Chauken, Chamaven, Markomannen und Quaden. Sie einte eine ähnliche Sprache, ähnliche Sitten und der gleiche Glaube.
Ihre Götter waren die Ansen oder Asen. Diese Götter stellten sich die Germanen so vor, wie sie selber waren. Voller Leidenschaften, Schwächen und Stärken. Der höchste Gott war Tuisto, Tiwaz oder Ziu. Er war der himmlische Vater. Der Gott des Richtspruches und der Gerechtigkeit, die auf dem Thing – dem Gericht – gesprochen wurde. Ihm folgte der mächtige, kräftige, aber etwas einfältige Gott der Eichen, der Schlachtenreihen, des Blitzes und Donners: Donar. Auch ehrten die bäuerlichen Menschen die Göttin Frija und ihren Bruder Ingweo. Diese brachten Mensch und Vieh Heil und Fruchtbarkeit. Ganz anders verhielt es sich mit den Todesgottheiten. Der Herr der Toten war der Wind- und Sturmgott Wotan. Er ritt das achtbeinige Ross Sleipianeri. Doch oft war er als alter Wanderer verkleidet zu Fuß zwischen den neun Welten unterwegs. Wotan war der Gefolgsherr – der Truchtin – der Toten. Die Toten saßen in der Totenhalle, im Totenberg Halja. Die Herrin dieser Halle war Frau Halja. Ihr wurden die Toten, die im Bett gestorben waren, durch die IIdisen – dunkle Ahnengeister – und die Toten des Schlachtfeldes von reitenden Mädchen – den Walküren – gebracht. Schließlich gab es noch Loge. Der listige Feuergott war für alle Götter undurchschaubar. Mal war er Feind; mal war er der Retter in der Not. Doch traute keiner der Ansen – außer dem etwas einfältigen Donar – dem rotschöpfigen Antipoden.
Doch allen Göttern war es gleich, dass auch sie dem Schicksal – den drei Nornen – unterworfen waren. Besonders Wotan und Loge versuchten immer wieder in die Speichen des Schicksals zu greifen und es zu verändern, indem sie in die Geschicke der Welten eingriffen. Besonders die mittlere Welt Mittgart wurde oft von ihnen heimgesucht.
In Mittgart war die größte Macht das Römische Reich. Im 3. Jahrhundert wankte seine Macht und viele Stämme wurden keck und unternahmen immer mehr kriegerische Züge gegen die Kaiser. Trotzdem überstrahlten die Macht, das Heil und die Pracht des Imperiums alles!
Im 3. Jahrhundert sollte eine Zeit der Helden beginnen, in der Männer gegen Männer, Schwerter gegen Schwerter, Reiche gegen Reiche um eines kämpften:
den Thron Mittgarts
III. Der Wanderer
Germanien, 209 n.Chr.Die acht Hufe seines Pferdes setzten bei der Heide auf. Der süße Duft von Besenheide drang ihm in die Nase und peitschte seine Sinne noch mehr auf. Er stieg vom Pferd ab. Er war alt, aber beweglich und flink wie ein junger Bursche. Sein Auge blickte zu den zwei Dünen. Da musste er durch. Hinter den Dünen war ein krüppeliger Eichenwald. Jahrelang hatten die Menschen des Dorfes hier Holz und Rinde gewonnen und ihre Schweine hinein getrieben.
Hinter dem kleinen Wald kam der Wanderer an Viehweiden vorbei. Hirtenbuben ließen sich die Altweibersommersonne auf den Bauch scheinen, während ihre Schützlinge – das Vieh der Herrschaft und der Bauern – Gras, Blätter und Vogelbeeren vertilgten.
Der Alte hörte schon das Dorf. Er roch es schon. Es roch nach Mist, glühendem Eisen und Ziegen. Er wusste, dass alle freien Männer nicht da waren. Der Truchtin – der Gefolgsherr – war mit ihnen auf Heerfahrt. Nun sah er die Ansammlung von Langhäusern. Sie waren strohgedeckt. Die Dachsparren ragten als Stütze bis in den Boden hinein. Vor den Häusern saßen Mägde und hechelten Lein. Der Schmied reparierte in seiner Schmiede einen Pflug. Alles ging sehr bedächtig. Selbst die Hunde lagen in der Sonne. Sie blickten den Fremden an und legten den Kopf wieder faul in den Sand. Die schaffenden Mägde wunderten sich: Sonst reagierten die Hunde auf Fremde sehr feindselig.
Der Alte mit dem blauen Mantel, den er auch über den Kopf als Kapuze tief über das Gesicht legte, begrüßte die Frauen und fragte kurz angebunden:
„He, ihr Weiber, wo ist die Frowe?“
Die Angesprochenen zeigten schweigend mit dem Finger hinter dem Wanderer. Er drehte sich um und sah, dass ein Dutzend Frauen mit Körben in den Händen lachend auf das Dorf zu kamen. Sie hatten Heidelbeeren gesammelt. Die Münder waren blaurot. Die Hände völlig verschmiert. Doch ihre Laune war blendend! Lachend kamen sie auf den Fremden zu.
„Alter Mann, was brauchst Du?“, fragte die Frowe.
„Hast Du Bettstatt und Bier für einen Wanderer?“
„Durchaus. Wenn Du mir Deinen Namen nennst!“
„Ganglari“
„Ganglari, Du sollst wissen, dass unsere Männer auf Heerfahrt sind. Doch sind wir nicht wehrlos!“
„Ich bitte nur um Bier und eine Bettstatt“, antwortete der Alte. Und um deinen Leib, dachte er.
„Gut! Gäste sind uns an diesen leisen Tagen sehr willkommen! Fehildis! Setz einen Kessel Wasser auf! Ich sollte unseren Gast sauber empfangen!“
Der Fremde wurde in das Haupthaus – das war der größte aller Höfe – hinein gebeten. Die Häuser waren lange Häuser, die aus einer Halle bestanden. In den zwei hinteren Dritteln war das Vieh untergebracht. Die Wände waren aus Fachwerk, welches mit weiß gestrichenem Lehm verputzt war. Der Dachfirst wurde von mächtigen Holzsäulen getragen. Sie waren oft bunt angemalt und mit Tierdarstellungen geschmückt. Das Herz eines Langhauses bildete das Herdfeuer. Es stand in der Mitte des Hauses und war eine gemauerte, offene Feuerstelle. Sie wärmte, sie leuchtete und sie wurde zum Kochen genutzt. Große Hallen hatten große Feuer, genannt Langfeuer. Der Rauch zog in die strohgedeckten Dächer. Dort wurden Balken und Schinken haltbar gemacht. Der Rauch zog dann über zwei kleine Lichtlöcher an den Giebelseiten oder oberhalb von den seitlichen Walmen ab. Das waren die Windaugen. In diesen Hallenhäusern lebten alle unter einem Dach und in einem Raum. Das Langhaus war Schlafplatz, Speisesaal, Stall und Wohnraum zugleich.
Die Mägde brachten einen hölzernen Zuber. Bald wurde er mit warmem Wasser gefüllt. Sie spannten einen Wollmantel zwischen Zuber und Gast. Dahinter zog sich die Hausherrin aus. Sie wollte Schweiß, Heidelbeerflecken und Sandstaub von ihrem schönen Leib abwaschen.
„Es heißt, die Römer hätten immer warmes Wasser. Überall. Und jeder. Selbst Unfreie. Stimmt das, Ganglari?“
„Wieso sollte ich das wissen?“, gab der Gefragte von sich.
„Weil Du wie ein weitgereister Wanderer aussiehst. Fehildis! Seife!“
„Ja. Sie haben große Hallen aus Stein. Dort haben sie warmes Wasser. Jeder kann dort ein Bad nehmen.“
„Ach, das müssen wirklich kalte Steinlanghäuser sein!“
Die Frowe wollte klug wirken.
„Nein. Sie haben manchmal sogar warme Böden“, erwiderte der Alte.
„Wirklich? Bei Donar! Das müssen aber gewaltige Langhäuser sein! Fehildis: Bereit‘ für heute Abend ein gutes Mahl vor. Bring unserem Gast vom frischeren Honigbier, Sahne und Schinken.“
Am Abend wurde ein einfaches, aber schmackhaftes Mahl geboten: Gekochter Schinken, Schmalzbrote, Bohnensuppe und Honigbier.
Das Langfeuer brannte und färbte die Halle in ein warmes rotes Licht. Die Frauen des Dorfes waren gekommen und die Mägde liefen von Tisch zu Tisch um Bier einzuschenken. Es waren kleine, längliche Tische, an denen höchstens vier Frauen saßen.
Ganglari saß bei der Hausherrin und Fürstin. Ihr schönes Gesicht leuchtete rot. Und je mehr Bier sie trank, desto mehr glühte sie den Fremden an. Etwas war wirr in ihrem Kopf. Hatte das Bier sie dumm gemacht? Hatte der Fremde sie verhext?
Nach und nach gingen die freien Frauen zu ihren Höfen. Bald saßen nur noch der Alte und die Frowe da. Sie schickte alle Unfreien ins Bett. Sie waren alleine. Das Feuer war nur noch rote Glut und ihr Antlitz gab diese Glut wieder. Prächtig hatte sie sich gekleidet: Einen grünen Peplos – ein röhrenförmiges Kleid ohne Ärmel, einen prächtigen Gürtel und an den Schultern hielten zwei mächtige elchförmige Fibelbroschen das Kleid zusammen.
Die Frowe glühte. Nun wirkte der Gast gar nicht mehr so alt. Zwei Wochen war ihr Gemahl fort. Immer war sie treu gewesen. Doch heute Abend war alles anders. Sie konnte keinen klaren Gedanken fassen. Dieser Fremde blickte sie geheimnisvoll mit seinem Auge an.
Sie öffnete die beiden Fibeln, sodass die obere Hälfte des Peplos auf ihren Schoß fiel. Nun lachten zwei wunderbare Brüste den Gast an. Rosenknospen richteten sich auf.
Der Wanderer stand auf. Er nahm die Willenlose auf seine Arme und brachte sie ins Bett. Nun lag sie in ihrer weiblichen Pracht da. Der Sturmgott fand, dass sie für eine vielfache Mutter einen prächtigen Körper hatte. Schweißtropfen perlten über Brust und Bauch. Mit vielsagendem und verruchtem Blick schaute sie den Fremden an. Er selber legte seinen blauen Mantel und alles, was er sonst trug, daneben.
Zwölf Kinder hatte ihr Schoß getragen, sechs auf die Welt gebracht. Nun wurde ein neues Kind gezeugt…
Mitten in der Nacht, die Frowe schlief tief und fest, verließ der fremde Wanderer das Haus. Sein Weg führte ihn zurück zu seinem Pferd, welches ruhig in der Heide zurückgeblieben war und die Pfeifengrashalme zwischen dem Heidekraut vertilgte.
„Das Schicksal wurde gesät…“, murmelte er.
Noch einmal wollte er das Haus sehen, in dem er ein Kind gezeugt hatte. Doch es war zu weit entfernt. Zwei Raben flogen über ihm. Mit Gedankenkraft schickte er sie zurück. Sie sahen alles: Das Dorf schlummerte friedlich in der Nacht. Rauch quoll aus den Windaugen heraus und das Vieh schlief genauso wie seine Herren.
All das sah der Wanderer über die Augen der Raben.
Er setzte sich auf sein Pferd.
„Hü! Bring mich weg von hier!“, murmelte er in seinen langen grauen Bart, „wollen wir den Anderen zeigen, wozu der Alte fähig ist!“
Sein Hengst setzte sich in Bewegung. Gen Himmel. Seine acht Beine galoppierten ruhig in die Nacht. Wotan führte sein Pferd über alle Hallen, alle Länder und alle Welten.
Er ritt über Donars Langhaus im mächtigen Eichenwald. Er ritt bis zu Tuistos Himmel. Der himmlische Gott des Things sollte es sehen! Er flog an seinem eigenen Totenberg vorbei. Halja, die Wächterin seines Totenreiches, die Walküren und die Gefallenen – die Wal – sollten sehen, was ihr Gefolgsherr getan hatte! Er hatte ein Kind gezeugt! Er ritt durch den heiligen Lindenhain der Frija und ihres Bruders Ingwe. Ja, bis zur Sonne flog er, um Sunna zu berichten. Nerthus, fest an die Erde gebunden, erfuhr es auch. Balder freute sich mit ihm und Sinthgunt grüßte den Windgott. Nur einer fehlte. Loge. Wo war der Rotschopf? Wo war der listige Feuergott?
Friesenland, 209 n.Chr. Der Mond schien auf das brandende Meer. Weit spritzte Ran – die Meergöttin – den weißen Schaum der Gischt an Land. Etwas regte sich im Wasser. Es waren nicht die Wellen. Es war kein Wal und keine Kegelrobbe. Etwas regte sich und näherte sich dem Strand. Es war schwarz. Schwärzer als die Nacht. Zwischen Wellen und Gischt sah man Hörner herausragen. Aus den Fluten schritt ein mächtiger Stier. Ein Urstier. Ein Auerochse. Geradewegs und willensstark trabte er ins Geestland. Friesenland. Doch die Wagenburg, die zwischen Marsch und Geest rastete, war keine friesische. Der Salier Inguomer, seine Frau Audgund und ihre mächtige Sippe rasteten. Sie hatten einen weiten Weg hinter sich und ihre alte Heimat verlassen müssen. Sie hatten bei den Friesen Vieh gekauft. Jetzt mussten sie ihren Reichtum gegen Banditen – meistens Chauken oder Brukterer – bewachen. Doch die Wachen waren eingeschlafen…
Der Urstier trabte. Er trabte der Wagenburg entgegen. Eine Langhauslänge entfernt hielt er an. Die winzigen Kühe der Salier scherten ihn nicht. Er wartete und flehmte. Sein Atem dampfte in dieser kühlen Nacht. Immer wieder brummte er in die Nacht hinein. Und wieder setzte sein Milchmaul an zum Flehmen.
Audgund wurde wach. Etwas hatte sie geweckt. Etwas rief sie. Etwas lockte sie. Nackt wie sie war, stieg sie aus dem Wagen. Die Nachtkälte ließ ihre Brüste hart werden. Sie sah den Stier. Sie sah seine mächtigen Hörner. Er blickte sie an.
Die Frowe schritt auf ihn zu.. Sie roch das Meer. Sie war dem Stier gefügig. Ihr Schoß hatte sieben Kinder empfangen und zweien das Leben geschenkt – nun hatte sie von dem Meeresungeheuer ein Kind empfangen. Es roch nach Gischt und Salz…
Das Tier trabte davon. Er suchte nicht das Meer auf. Das Meer war nicht sein Element. Loge konnte viele Gestalten annehmen. Er konnte im Wasser, im Himmel, unter der Erde verweilen. Doch Feuer war sein Element. Und Täuschung.
„Sturmgott, wenn du glaubst, du kannst in Mittgart Kinder zeugen, dann weißt du nicht, was Loge alles kann!“, sprach er zu sich.
Germanien. „Sigi!“, rief Inghild 17 Jahre später ihren Sohn, „Sigi! Kommst du sofort her! Wir haben Gäste und du treibst Dich im Schnee herum!“
Der Sohn Inghilds, Spross des semnonischen Fürsten Segimer, übte zwischen Langhaus und Grubenhaus. Er übte mit Speer und Schild. Winter war eine grässliche Zeit. Keine Heerzüge, kaum eine Möglichkeit mit den Waffen zu üben und die ganze Zeit die stickige, rauchige Luft des Langhauses. Sigi war 16 Sommer alt. Er hatte sein Aussehen von der Mutter geerbt. Er war groß, seine blauen Augen strahlten neugierig und lebenshungrig in die Welt, sein blondes Haar hing in Wellen über seine Schulter. Sigi war kühn, mutig und gütig. Dafür liebte ihn die Gefolgschaft seines Vaters. Schon vor der Speerweihe hatte er als Schildbube seinen Vater auf dessen Heerfahrten begleitet. Seit seiner Speerweihe kämpfte er in den Reihen der Männer. Schon an zwei Kriegszügen hatte er teilgenommen. Stolz blickte sein Vater Segimer auf den Sohn, wenn er ganz vorne im Eberkopf – in der keilförmigen Angriffsstellung der Semnonen – bei seinem Fürsten und Vater die Feinde mit Speer und Schwert durchstach, zertrennte oder aufschlitzte. Der Junge hatte in all den Kämpfen kaum Wunden mit heimgebracht. Segimer meinte, der Schlachtenvater selber, Donar, würde den Jungen beschützen. Er bedauerte es nur, dass Sigi nicht sein ältester Sohn war. Dass Sigi nicht Fürst von den Semnonen an der Havel werden würde, fuchste den alten Kämpen sehr.
Sigi kam mit Speer und Schild an die Tür des Langhauses. Seine Mutter blickte ihn kopfschüttelnd an.
„Wie siehst du denn aus!? Die Waffen legst du aber weg. Wenn dich unsere Gäste so sehen, werden sie einen Hinterhalt wittern! Du weißt: Vater hat lange eine Fehde mit Gisilo gehabt! Bitte komme ihm nicht dazwischen!“
Sigi blickte an sich herunter. Schnee klebte an der Hose, Schnee hing am Wollmantel und seine Tunika hatte ein Loch.
„Ja Mutter. Ich werde tun, was du verlangst.“
Es war ein gemütlicher Abend in Segimers Haus. Draußen wütete ein Schneesturm. Im Haus tranken und aßen 37 Männer. Alles Semnonen. Es war die Sippe des Segimer und die Sippe des Gisilo. Sie hatten ihre Fehde beendet. Nun erhoben sie die schwarzen Tonbecher auf Frieden und Freundschaft. Im Hintergrund hörte man das Vieh in seinen Ställen. Frauen kreisten von Tisch zu Tisch. Es waren die kleinen länglichen Tische. An jedem Tisch saßen zwei, drei oder vier Mannen. Sie würfelten, tranken, sangen und lachten. Immer wieder erhob Gisilo oder Segimer den Friedensbecher. Sie tranken auch auf die Götter, die Frauen und gemeinsame Heerfahrten.
„Gegen wen?“, fragte Bredi. Er war ein Gefolgsmann von Gisilo. Er trug den typischen Haarknoten an der linken Schläfe.
Segimer wischte sich den Bierschaum vom Bart: „Gegen die Burgunder? Gegen die Hermunduren? Oder wir machen es wie Hrodo: Wir ziehen nach Süden und Westen und heeren im römischen Land!“
„Kühn! Kühn mein Freund!“, entgegnete Gisilo, „Hrodo hat viele Mann verloren! Und Hrodo ist ein wirklich mächtiger Semnonenfürst! Glaubst du wirklich, wir könnten Römerland heimsuchen? Es heißt, sie haben einen großen Wall mit Türmen und vielen Gefolgsmannen des römischen Kaisers dort. Mit unseren Hundertschaften können wir da nichts holen, meine ich.“
„Warte nur. Diese Frucht muss nur reif werden – dann fällt sie in unseren Schoß.“
Als das Feuer nur noch rot glühte, schliefen alle. Alle bis auf Sigi. Er hatte die Worte seines Vaters wohl vernommen. Rom … ein Gefolgsmann Segimers hatte dort als Legionär gedient. Er war mit guten Waffen, Goldfibeln, Kettenhemden und Goldmünzen wieder heimgekehrt. Dieses Rom musste der Vorhof zu Ansgart sein – zur Welt der Götter. Wenn sein Vater nach Süden ziehen würde, so käme er, Sigi, mit!
Am nächsten Morgen wachten alle auf. Doch ein Mann fehlte. Ein Mann Gisilos.
„Er hat gestern dort geschlafen!“. Er zeigte auf einen verwaisten Mantel. Auch lagen dort Schwert und Speer des Mannes.
Segimer öffnete die Tür. Schnee fiel herein. Der Schneesturm hatte das Land unter einer sehr dicken weißen Decke verborgen. Fern klagte ein Gimpel.
„Spuren kann ich keine sehen. Männer, schaut, ob er im Stall ist!“
Doch keiner fand ihn.
Der zerbrechliche Friede zwischen den Fürsten wurde schon am ersten Tag auf die Probe gestellt. Alle zerbrachen sich den Kopf darüber, wo der Mann sein könnte.
„Ich gehe ihn suchen“, sagte Bredi. „Vielleicht ist er besoffen, außer Sinne hinaus getorkelt und im Schneesturm verschwunden.“
„Ja, Bredi, das ist wohl die einzige Möglichkeit“, antwortete Gisilo und blickte dabei misstrauisch auf Segimer. Dieser bemerkte es.
„Ich gebe Bredi meinen Sohn Sigi mit. Er kennt sich aus und zwei Mannen können mehr sehen als einer.“
Besänftigt nickte Gisilo.
Mit Schneebrettern stapften die zwei Männer durch den Winter. Immer weiter vom Hof, vom Dorf. Schwer hing der Schnee in den Eichen, Kiefern und Aspen. Sie ließen das Weideland, den Schweinewald und die hohe Heide hinter sich. Nun waren sie im Markland – jenseits der Allmunt, in der weiten Wildnis.
„Dein Vater nimmt sein Mund etwas voll, wenn er sagt, er will im Römerland heeren!“, meinte Bredi. Seine Stimme hatte keine Schärfe. Er klang sachlich und klug.
„Warum?“, antwortete Sigi gereizt.
„Weißt du, wie groß und mächtig das Römerland ist?“
„Sie wurden schon einmal besiegt.“
„Ja. Vor vielen Menschenleben! Aber ein kleiner, oder zwei kleine Semnonenfürsten können es nicht mit den römischen Legionen aufnehmen! Ich habe sie gesehen! Als junger Kerl – etwas jünger als du, war ich am Rhein. Ihre Dörfer sind riesig, aus Stein und voller Menschen. Ihre Krieger leben unter sich in befestigten Höfen. Sie üben den ganzen Tag das Kämpfen! Und der Kaiser kann innerhalb weniger Tage hunderte von ihnen von hier nach dort schieben! Glaubst du etwa, dein Vater kann da einfach heeren?“
„Rede kein dummes Zeug!“, maulte Sigi. „Wir müssen euren Mann suchen.“
„Ja, du hast recht. Trotzdem ist das tölpelhaft.“
„Was?“, bellte Sigi
„So hochmütig zu denken“, entgegnete Bredi kühl.
„Du nennst meinen Vater einen Tölpel? Du nennst ihn hochmütig?“
„Nein“, ich sagte nur, dass es hochm…“, er konnte den Satz nicht beenden.
Sigi hatte ihm das Messer in den Bauch gerammt. Bredi verzog das Gesicht zu einer schmerzerfüllten Fratze.
„Warum?“, brach es aus ihm heraus.
„Du hast meinen Vater lächerlich gemacht. Du hast meine Sippe verhöhnt. Ich fand es sowieso falsch mit euch den Frieden zu schließen!“
Der Schwerverletzte wollte seinen Speer kurz fassen, um den Jungen aus nächster Nähe zu durchbohren. Doch Sigi war schneller. Er stieß das Messer in den Hals des Mannes. Blut spritzte in Sigis Gesicht. Er stach noch drei Mal zu. Bredi brach zusammen und lag zuckend im roten Schnee.
Sigi putzte sich das Gesicht ab und deckte Leiche und Blut mit viel Schnee zu. Der Wind erledigte den Rest. Es blieb bald nur noch eine Schneewehe übrig.
Alleine kehrte Sigi zu seines Vaters Hof.
„Wo ist Bredi?“, fragte dieser.
„Wir haben uns verloren. Er verschwand im Wald. Ich rief und er hörte nicht! Er wird wohl bald kommen“, log der Bursche.
Doch Bredi kam nicht. Das Misstrauen zwischen den Sippen war wieder gesät.
Der Winter verging. Der Schnee schmolz. Und Bredis Leiche wurde gefunden. Fünf Stiche.
Gefolgsmannen des Gisilo ritten zu Segimers Hof. Sie waren komplett aufgerüstet. Große, runde Schilde, mit Rohhaut überzogen und bemalt, Speere in der Hand und über Schulter und Brust hing ein Gurt mit einem Schwert. Es waren 9 Reiter. Ein Knecht Segimers sah sie zuerst. Er rannte vom Pflug auf dem Acker in Windeseile zu seinem Herrn.
„Truchtin! Truchtin! Gisilos Mannen kommen! In Waffen!“
„Wie viele?“, fragte der Fürst aufgeregt.
Der Knecht zählte im Kopf nach.
„Wie viele?“, hakte der Mann ungeduldig nach.
„Neun.“
„Neun? Er wird doch keine neun Mann schicken, um mit uns zu kämpfen?“
Das hörte seine Frau und sagte darauf:
„Du hast auch nicht viel mehr Mannen hier. Deine Gefolgsmannen sind auf ihren Höfen und bestellen ihre Äcker!“
Segimer wusste, dass sie recht hatte. Er rief seine Söhne zusammen. Gab den Knechten Knüppel und Schilde und ließ Sigi ins Horn blasen.
Als die Reiter auf dem großen, schlammigen Platz in der Mitte des Dorfes angekommen waren, standen die Freien wie die Unfreien in Waffen zwischen Langhäusern, Speicherhäusern, Grubenhäusern und Handwerkerkaten.
Vom Pferd aus rief der Degen, der Führer der Zehnerschaft:
„Segimer, dein Sohn hat einen Mann Gisilos getötet. Wohl ermordet. Wir fordern seinen Tod. Oder wir zünden euch die Häuser an!“
„Versucht es doch!“, rief der Angesprochene zurück.
„Das tut nichts zur Sache: Mein Truchtin klagt deinen Sohn des Mordes an!“
„Ist das wahr?“, fragte Segimer zu seinem Sohn gerichtet. Dieser nickte zerknirscht. „Habt ihr gekämpft? Oder hast du ihn rücklings erschlagen?“
„Er hat dich verächtlich gemacht! Er hatte einen Speer in der Hand!“
„Du Tagdieb hast mich angelogen!“, zischte er seinen Sohn an. Zu den Reitern gerichtet rief er über den Platz:
„Wenn ihr unsere Häuser anzündet, so zünden wir eure an!“
„Dann liefert uns Sigi aus!“, forderte der Degen.
„Nein!“, bellte Segimer.
„Dann musst du mit den Folgen leben. Mein Truchtin wird diese Sache vor das Thing bringen. Es sei, wir klären es unter uns!“
„Es gibt nichts zu klären. Ich liefere euch meinen Sohn nicht aus. Und wenn ihr kämpfen wollt, so wird dieser Platz mit vielen tapferen, toten Männern gesäumt sein!“
Der Degen schüttelte den Kopf, sagte etwas zu seinen Mannen und sie drehten um und ritten fort.
„Wir sehen uns beim Thing!“, rief er der Gruppe zu.
Sigi hatte die ganze Zeit verkrampft den knöchernen Schwertstil gehalten. Es vergingen Augenblicke. Unendliche Augenblicke. Segimer schaute auf Hausrotschwänzchen, die auf dem Dach der Gerberei Hochzeitstanz hielten. Er blickte in den Himmel und sah Kraniche laut nach Norden ziehen.
„Du blöder Kerl! Du Dummkopf und Klotz! Du hast unseren Frieden zerstört! Und dein Leben auch!“, brüllte er seinen Sohn an. Ohne auf die Antwort zu warten, eilte er in sein Haus. Im Laufen rief er zu den Anderen:
„Jeder an seine Arbeit!“
Niemand bemerkte den Alten mit dem blauen Mantel. Er stand am Rand des Dorfes und hatte die gesamte Szene beobachtet. Zufrieden zog er den Mantel über das Gesicht und ging.
„Vater! Vater!“
Sigi rannte hinter seinem geliebten Vater her.
„Vater! Bitte! Ich will es wieder gut machen!“
„Nichts! Nichts kannst du gut machen! Lässt man euch Knaben einmal alleine, geht euer Blut mit euch durch!“
„Aber er hat dich beleidigt!“
„Mir schien dieser Bredi immer ein vernünftiger Mann zu sein! Was hat er denn gesagt?“
„Ich weiß es nicht mehr…“, Sigi wurde immer kleinlauter.
„Das wird dir am Thing aber nicht helfen! Gisilo klagt dich an. Und ich muss dich verteidigen! Glaubst du, es ist die rechte Zeit, dass sich Semnonen gegenseitig abschlachten? Wir müssen zusammenhalten! Irgendetwas ist im Wandel. Überall sieht man Jungvolk in Waffen. Und du…!“
Seine Wut war unermesslich.
„Geh mir aus den Augen!“
Inghild, seine Mutter, stand schweigend mit Tränen in den Augen dabei.
„Was hat er…?“
„Er hat Bredi erschlagen. Sie haben ihn im Wald gefunden.“
Inghild ging zu ihren Sohn: „Aber Kind! Was hast du getan?“
„Mutter, ich konnte nicht anders!“
„Hat er dir was tun wollen?“, fragte sie wohlwollend.
„Er hat Vater verächtlich gemacht!“
Sie drehte sich zu Segimer: „Siehst du, Mann, er hat deine Ehre hochgehalten. Deswegen hat er diesen Bredi töten müssen!“ Sie fuhr mit ihrer Hand über Sigis Kopf.
„Rede kein dummes Zeug, wovon ihr Weiber kein Wissen habt! Hüte deine Zunge und hilf den Leuten auf den Feldern! Auf!“
Unwillig ging sie aus dem Haus. In der Türschwelle drehte sie sich noch einmal um:
„Was wird geschehen?“
„Die Sache kommt vors Thing. Oder wir lösen es auf die gute alte Weise: mit Strömen von Blut!“
Ohne zu antworten ging die Frowe raus.
„Dich will ich heute nicht mehr sehen!“, fauchte er seinen Sohn an.
Sigi suchte einen der Gefolgsmänner seines Vaters auf: Haiduwalda. Sie hatten immer ein gutes Verhältnis. Und da Haiduwalda zu dem Zeitpunkt nur Töchter hatte, war Sigi sein Ersatzsohn. Haiduwalda hatte dem Jungen alle Tricks im Zweikampf beigebracht. Ebenso hatte er ihn den Umgang mit dem Schwert vom Boden aus gelehrt. Denn das Schwert nutzten die meisten nur vom Pferd aus.
„Vergeudetes Eisen“, meinte er immer, „diese Waffe kann mehr!“
Bei Haiduwalda kam Sigi unter. Bis zum Frühjahrsthing. Kurz vor dem Thing kehrte er zu seinem Vater zurück. Er wollte nicht zur Rats- und Gerichtsversammlung gehen und seinem Vater wie ein Fremder zur Seite treten.
Brütend saß Segimer auf seinem Klotzthron. Ein Goldring wechselte von einer Hand in die andere.
„Vater?“. Vorsichtig lief er auf seinen Vater zu.
„Du bist es. Wo warst du?“
Sorgen und Kummer lagen in der Stimme des Fürsten.
„Bei Haiduwalda.“
„Hast du ordentlich zu essen bekommen?“
„Du weißt, dass er mich verwöhnt.“
„Ja, zu sehr. Und er setzt dir auch solche Flöhe in den Kopf! Hast du das kämpfen geübt?“
„Ja.“
„Gut. Wollen wir hoffen, dass Gisilos Mannen ihre Zeit auf dem Acker verbringen müssen! Denn es könnte zu einem Götterurteil kommen. Tuisto entscheidet dann durch einen Zweikampf, wer recht hatte.“
„Ich kann das!“, versuchte Sigi seinen Vater aufzumuntern.
„Du dämlicher Waldschrat! Ich könnte dir den Hals umdrehen! Wir werden es trotzdem schaffen. Dann geht die Freundschaft mit Gisilo zur Halja!“
„Vater, wir brauchen ihn nicht. Haiduwalda hat Geschichten gehört, dass im Römerland die Legionäre abgezogen werden. Sie werden in einem anderen Krieg gebraucht. Viele Jungmannschaften machen sich auf den Weg!“
„Haiduwalda ist ein Narr! So wie du! Glaubst du, dein Vater weiß es nicht schon längst?“ Sigi strahlte seinen Vater mit hellen Augen an.
„Gisilo schickt auch seine Zweitgeborenen dahin. Ich hörte, einige seiner Hunnos hätten viele Wägen geladen und ihre Waffen geschärft. Sage mir Sohn: Wie sollen wir mit unseren Feinden zusammen einen Heerzug bestehen? Feinde, die Freunde waren, aber dank dir wieder zu Feinden wurden!“
Zorn brannte aus seinem Mund heraus.
Das Thing war die Versammlung aller freien Männer. Es wurde beraten, beschlossen, Gericht gehalten, Ankündigungen gemacht und gehandelt. Die Jungmannschaften holten sich, vor ihrem Aufbruch in Richtung Südwesten, auf dem Thing den Segen der freien Männer. Es gab kleine Things für die Hundertschaften der Truchtins und es gab zweimal im Jahr große Things für alle Semnonen zwischen Havel, Elbe und Rhein.
Das Hauptthing wurde immer beim heiligen Hain gehalten. Hinein durfte außer den Priestern kein Mensch. Im Hain lebte Nerthus – die Göttin der Erde. Ihr Antlitz wurde auf einem Schild durch die Menge der Männer getragen. Sie verschwand wieder im heiligen Hain. Dann beschworen die Priester den Himmelsgott Ziu.
„Ziu! Himmelsvater und Herr des Ratschlusses, Vater der Säule, die Gestirn und Himmel hält: Lass weise die Mannen sprechen. Lass Frieden im Kreis des Things walten. Du Ahnherr, Vater des Mannus; Mannus, du Vater des Hermnas; Hermnas, du Ahnherr unseres Volkes. Ihr Ahnen steht uns bei, auf dass wir ein kluges, weises und gerechtes Thing haben. Jedes Wort ist ab sofort heilig. Jede Waffe mit Blut ist Frevel. Solange der Thingfriede herrscht, wird kein Urteil vollstreckt, es wird keine Lüge geduldet und Ziu wird immer Wahrheit walten lassen. Das Thing ist eröffnet!“
Ein Thing dauerte mehrere Tage. Am ersten Tag wurden alle Themen und Anklagen gesammelt. Die Rechtsprecher verkündeten die ewigen Gesetze der Semnonen.
Segimer hatte am ersten Abend keine Freude. Alle anderen tranken, sangen und freuten sich, alte Bekannte zu treffen. Es wurden Felle, Waffen, Fibeln, Wollstoffe, Glas und Holzkistchen verkauft und getauscht. Überall brannten Feuer. Überall war Leben. Nur Segimer saß in seinem Zelt auf seinem Bett und brütete. Die Verhandlung sollte am dritten Tag stattfinden.
Am zweiten Tag traten viele junge Hunnos – Hundertschaftsführer – in die Mitte. Sie erbaten den Segen für ihre Unternehmung. Unternehmungen ins Römische Imperium. Die Semnonen hatten einen Kinderüberschuss, doch sie hatten mit ihrer Landwirtschaft den sandigen Boden ihrer Heimat so ausgelaugt, dass es überall Verwüstungen gab. Dünen versandeten die Äcker, Äcker verdorrten, Kinder verhungerten. So war es in Segimers Gauen, doch noch viel mehr in Gisilos Gauen. Gisilo hatte – entgegen seiner Rede an jenem Abend in Segimers Langhaus – seine Jungmannen aufgemuntert gen Rom zu ziehen. Sie sollten Ruhm, Sieg und Beute finden.
Als Gisilos Mannen da standen und von allen bejubelt wurden, fühlte Segimer, wie sich sein Herz verkrampfte. Die Schicksalsfrauen waren grausam zu ihm!
Wieder verging für Segimer ein Abend in Trübsal.
Verhandlungstag. Gisilos Klage wurde gleich als erste behandelt. Er war ein Fürst und ein fürstlicher Antrustio – ein Gefolgsmann – wurde immerhin vom Sohn eines anderen Fürsten getötet! Da drängten sich die Schaulustigen auf dem Thingplatz.
Der Rechtsprecher rief Gisilo auf.
„Ich klage Sigi, Sohn des Segimer, des Mordes an meinem Gefolgsmann Bredi an! Er hat ihn letzten Winter in Allmuntland erschlagen. Die Leiche hat er mit Schnee bedeckt. Unter der Schneewehe haben wir Bredis Leiche erst im Frühling finden können. Er hatte fünf Messerstiche: Einen im Bauch, zwei im Hals und zwei in der Schulter.“
Der Rechtsprecher richtete sich an Segimer:
„Willst du für deinen Sohn reden? Er hat aber die Speerweihe erhalten, er kann auch selber reden.“
„Ich werde für ihn reden.“
„Was entgegnest du Gisilo, Segimer?“
„Dein Mann Bredi hatte einen Speer dabei, damit wollte er meinen Sohn angreifen. Außerdem hat er ehrabschneidend über mich gesprochen. Mein Sohn hat überreagiert; aber er tat es nicht aus hinterhältigen Gründen, sondern um meine Ehre zu wahren und um sich vor dem Angriff Bredis zu verteidigen.“
„Ist das so?“, fragte der Rechtsprecher Sigi. Dieser nickte.
„Wir fordern seinen Tod“, rief Gisilo. Um ihn mit der Forderung zu unterstützen, klopften alle seine Mannen mit den Speeren gegen ihre Schilde.
„Das ist aber eine schwere Forderung“, hielt der Richter dagegen. „Hast du Beweise für deine Aussage?“
„All diese Männer haben die Leiche, die fünf Einstiche gesehen. Der letzte, der mit Bredi unterwegs war, ist Sigi. Außerdem hat es Segimer ja schon gestanden!“
„Ich sagte nur, dass Sigi Bredi getötet hat – nicht ermordet!“
„Jeder, der Bredi kannte, weiß, dass er bedächtig und klug war! Er hat ihn ermordet!“
Die Verhandlung ging noch lange hin und her. Es sprachen Männer für Bredi, es sprachen Männer für Sigi. Der Richter merkte, dass dies eine heikle Situation war. Er selber war auch Semnonenfürst, rechtskundig und vom Thing für diese Verhandlung gewählt worden. Er wusste, dass es keinen einfachen Ausweg gab.
„Götterurteil!“, riefen schon einige. Es waren die Schaulustigen. Die Männer, die für keinen der beiden eine Zuneigung hatten und nur einen Kampf sehen wollten.
Als die Stimmung am gefährlichsten wurde, stand der Richter von seinem aus einem ausgehöhlten Erlenstamm gefertigten Klotzstuhl auf:
„Mannen! Mannen! Hört!“ Alle schwiegen. „Ich finde es gut, dass Gisilo und Segimer diese Sache vor das Thing gebracht haben. Es hätten auch Balken brennen und Blut den Boden tränken können. Nein. Sie haben hier, vor euch diese Sache wie kluge Männer behandelt. So erscheint es mir das klügste so zu entscheiden:
Sigi, Sohn Segimers, ich erkläre dich zum Warg. Du wirst von der Gemeinschaft verstoßen, verbannt für die nächsten 20 Jahre. Solltest Du Semnonenland vorher betreten, so darf dich jeder töten. Das ist das Urteil. Ziu weihe es.“
Es gab ein großes Gemurmel. Gisilo und seine Leute waren nicht besonders zufrieden, aber auch Sigi traf dieses Urteil. Sein Lieblingssohn verbannt?!
Segimer befahl den sofortigen Aufbruch.
„Bleibst du nicht zum Thing?“, fragte der Rechtsprecher unter vier Augen.
„Nein. Ich muss meinen Sohn in Sicherheit bringen.“
„Dann tu es. Das Heil sei mit euch“, verabschiedeten sie sich.
Die Männer sattelten die Pferde, die Zelte wurden abgebaut und auf den Wagen gelegt. Bald war der Tross auf dem Weg. Es begann zu regnen. Nass hingen ihre Haare im Gesicht, nass waren ihre Hosen auf den Pferden, doch der Wollmantel hielt den Regen ab.
„Harjioari!“, rief Segimer seinen wichtigsten Gefolgsmann: „Wenn wir morgen Abend heimkommen, gehen alle Mannen in mein Haus. Wir halten dort Thing!“
„Ja, mein Truchtin!“, gab dieser knapp zur Antwort.
Es war eine schweigsame Heimfahrt. Der Regen, das Urteil; all dies trübte die Sinne der Männer. Als sie zwei Tage durch geritten waren, gaben sie den Knechten in Segimers Dorf die Pferde. Die armen Tiere wurden sofort versorgt. Die Unfreien gaben ihnen Futter, rieben sie mit Stroh trocken und schauten nach den Hufen.
Währenddessen saßen alle freien Männer des Gaues in der Halle von Segimer.
„Ihr habt es gehört. Mein Sohn Sigi wird verbannt.“
Inghild war nicht in Kenntnis gesetzt. Ihr Mann hatte nur geschwiegen. Laut schrie sie auf:
„Was? Was habt ihr Männer auf diesem Thing getan? Was seid ihr für Männer? Was bist du für ein Mann?“, keifte sie alle an.
„Schweig, Weib!“
„Nein! Du wirst schweigen! Du hattest diesen tölpelhaften Gedanken, mit Gisilo Frieden zu schließen! Und jetzt stehst du nicht einmal für unser Kind ein!? Lieber sollt ihr alle in eurem Blut liegen, als dass ich meinen Sohn in die Verbannung schicke! Geht! Kämpft! Schlagt Gisilo und seine Leute tot!“ Sie wurde hysterisch.
„Schweeeeiiiig!“, brüllte Segimer seine Frau an.
„Mein Sohn, euer Waffenbruder hat einen Mann getötet. Dafür hat das Thing ein Urteil gesprochen. Ich werde Tuistos Ratschluss nicht hintertreiben! Sigi, komm her.“
Der 16-jährige Kerl stand geknickt vor seinem Vater.
„Sigi, Sohn: Hiermit erkläre ich Dich zum Warg. Zum Ausgestoßenen. Du bist aus unserem Gau verbannt für 20 Jahre. Wage es nicht vorher zurückzukehren, denn ich kann deinen Schutz nicht gewähren. So spreche ich, Segimer, Sohn des Segigast.“
„Nein!“, schrie Inghild. „Du schickst mein Kind nicht fort wie einen Bettler!“
„Was soll ich tun? Was meinst du?“ Segimer blickte sein Eheweib ratlos an.
„Gib ihm Männer mit. Er ist ein Fürstenkind! Gib ihm Waffen, Wägen und Vieh mit!“
„So soll es sein. Ich gebe ihm Unfreie mit, er bekommt vier Wägen, Schwerter, Speere und zwölf Pferde und zwölf Rinder mit. Ist das gut, Sohn?“
Sigi nickte tief traurig. Er hatte von der Welt geträumt – aber nicht so. Verstoßen. Einsam.
„Knechte? Er soll nur Knechte bekommen?“, giftete die Frowe gegen ihre Mann.
„Ich kann keinen freien Männern befehlen, meinem Sohn in die Verbannung zu folgen.“
Da schritt Haiduwalda vor. Mit großer Geste, sich auf die Brust klopfend, sprach er zu allen in der Halle:
„Truchtin. Ich und meine Mannen werden mit ihm gehen. Wir lassen Sigi nicht alleine in die Fremde ziehen. Meine Mannen sehen es auch so. Egal wo dein Sohn hin geht, wir folgen ihm! Sigi“, er ging vor dem Jungen in die Knie und hielt ihm den Griff seines Schwertes entgegen, „ich gelobe dir Gefolgschaft.“
Unsicher blickte Sigi seinen Vater an. Dieser nickte und gab seinem Sohn einen silbernen Armring.
„Ein Ring die Treue zu halten“, rezitierte Sigi.
„Ich werde die Treue halten.“
„Mein Schwert soll deine Feinde zerschmettern.“
„Mein Schwert soll deine Feinde zerschmettern.“
„Ich werde Ehre mit Ehre löhnen.“
„Und Ehre werde ich in deinem Namen wahren.“
„So lange dieser Ring nicht bricht, sollst du an meiner Tafel speisen.“
„So lange dieser Ring nicht bricht, werde ich treu an deiner Seite streiten.“
Mit zitternder Hand berührte er den Griff des Schwertes, dann legte er die Hände Haiduwaldas zwischen seine.
„Ich danke dir, Haiduwalda. Stehe jetzt als mein treuer Gefolgsmann auf.“
Im Zwielicht des Langfeuers konnte man die Tränen in den Augen Sigis und Segimers nicht sehen.
Die Vorbereitungen mussten schnell gehen. Segimer gab seinem Sohn vier Wägen mit, acht Unfreie und zwei zusätzliche, römische Schwerter. Haiduwalda hatte 19 Wägen, viel Vieh, viele Pferde und vier seiner Gefolgsleute dabei: Thakattain, den dürren Breidasig und Antheri, den alle nur „Bauer“ nannten. Es war ein großer Treck. Gänse plärrten unter den Planen der Wägen hervor. Ziegen und Schafe waren an die Wägen gebunden. Hunde warteten ungeduldig. Auf den Wägen lugten Kinder und Frauen hinter den Planen hervor. Pflüge, Mahlsteine, Ambosse, Werkzeug, eine Drechselbank, Speere, Schilde, Becher, Töpfe, Kannen, Fässer und Daubengefäße waren auf all den Wägen verstaut. Männer saßen auf den Pferden. Sie hatten ihre prächtigsten Kleider an. Die Speere glitzerten in der Sonne. Die Schilde waren neu bemalt. Das Vieh graste geduldig um den Treck herum. Die Viehhirten, die mitkommen sollten, hatten genug Haselruten gebrochen. Damit wollten sie die Rinder bis an das Ende Mittgarts treiben!
Alle warteten auf ihren neuen Gefolgsherrn: Den 16 Jahre alten Sigi.
Dieser stand bei seinem Vater. Segimer saß auf seinem Klotzthron. Die Füße auf einem Fußschemel. Segimers Blick war leer und gebrochen.
„Vater.“
Aus den Gedanken gerissen schüttelte der alte Truchtin hektisch den Kopf.
„Ja, mein Sohn, du musst ziehen. Haiduwalda, achte auf mein Kind. Verlasse ihn nie und sei die Stimme der Vernunft!“
Der Angesprochene nickte.
„Wo wollt ihr hin?“, fragte Segimer weiter. „Nein, ich will es nicht wissen! Aber meidet Gisilos Leute – sie werden dich umbringen!“
Er stand auf. Er umarmte den alten Kämpen Haiduwalda. Dann ging er zu seinem Sohn.
„Das ist der Wille der Götter, so haben es die Nornen gewoben: Du wirst dein Glück in der Fremde suchen. Das Heil sei mit dir, mein Sohn! Das Heil sei mit dir, mein Sohn! Das Heil sei mit dir, mein Sohn!“
Er nahm eine Armbrustfibel von seinem Mantel. Sie war aus Silber, sehr fein gearbeitet und wertvoll. Er hatte sie von einem großen Mann erhalten. Sie war aus Rom.
„Hier, nimm sie mit. Sie soll dich schmücken als meinen Sohn. Geh.“
Sigi drehte sich weg. Er schritt zur Tür. Wo war seine Mutter?
Haiduwalda und er gingen aus dem Haus. Er verließ sein Vaterhaus. Hier war er geboren worden. Hier hatte er am Herdfeuer all die Geschichten von Göttern und Helden gehört. Hier hatte er mit seinen Geschwistern gespielt. Nun waren sie alle in anderen Höfen verheiratet oder Herren ihres eigenen Hofs. Außer seinem ältesten Bruder. Dieser drückte seinen Kleinsten und wünschte ihm auch Heil und Ruhm. Als er beim Treck angelangt war, drehte er sich noch einmal um. Sein elterlicher Hof, sein Dorf, der Brunnen, der Zaun aus Weideruten, an dem sie so oft Verstecken gespielt hatten. All das musste er verlassen. Jetzt, da ihn Schwermut und Trauer überfielen, wurde ihm klar, was er getan hatte.
Haiduwalda und er wollten auf ihre Pferde steigen, da kam Inghild herbei. Stolz, mit ihren besten Kleidern, ihrem besten Schmuck schritt sie durch den Staub. Sie hatte goldene Fibeln mit eingearbeiteten Almandinaugen, eine goldene Haarnadel und ein Stirnband mit wippmesserförmigen Anhängern an den Schläfen. Um den Hals trug sie eine Donarkeule aus Knochen geschnitzt und einen silbernen Anhänger, auch in Wippmesserform.
Erhaben stand sie auf dem Platz. Sigi eilte ihr entgegen. Er umarmte seine Mutter zum letzten Mal. Seine geliebte Mutter. Sie hatte ihn immer vor allem Übel der Welt beschützt. Jetzt sah er sie zum letzten Mal.
„Ich wünsche und schenke dir Heil! Denke immer daran, woher du kommst und wer du bist! Werde kein Neiding und erlange Ruhm und Ehre! Mein Kind!“, sie rief noch Haiduwalda zu sich.
„Achte mir auf ihn.“
„Ja Frowe, ich werde auf ihn achten.“
„Und noch was…“, sie wusste nicht, wie sie anfangen sollte. „Wenn jemals einer fragt, woher du kommst…“
„So sage ich: Ich bin der Sohn von Segimer und Inghild“, unterbrach Sigi.
„Nein. Mein Kind, Segimer ist nicht dein Vater. Er weiß es nicht und ich wollte nie, dass er es weiß, da ich Schande über mich gebracht habe. Aber ich konnte dich nicht töten. Und als dich Segimer hoch hielt – nach deiner Geburt – und deine Augen den Dachfirst erblickt hatten, sagte er, dass du ganz klar sein Sohn seist. Es brach mir immer wieder das Herz, da er dich am meisten geliebt hat! Auch wenn er streng zu dir war.“
„Mutter, wer ist mein Vater?“
„Ich weiß es nicht. In jener Nacht kam ein fremder, geheimnisvoller Wanderer. Er bat um Lager für die Nacht. Dein Vater war auf Heerzug.“
„Und?“ Auch Haiduwalda staunte über diese Geschichte.
„Er hat mich verhext. Er machte mich gefügig. Er war einerseits geheimnisvoll, anziehend, andererseits unheimlich. An ihm hing der Tod. Er hatte – ja! Er hatte einen blauen Mantel an, den er auch als Kapuze bis tief über das Gesicht trug, und einen langen grauen Bart. Er nannte sich Ganglari, doch weiß ich, dass er mich angelogen hat. Ich glaube, er hatte nur ein Auge.“
Bei diesen Worten blickten sich Sigi und Haiduwalda groß an.
„Du willst sagen, mein Vater ist…“
„Der Windvater und Totenwächter, Siegvater und Weltenwanderer Wotan“, unterbrach Haiduwalda.
„Ja, so ist es“, gab Inghild kleinlaut zu. „Aber du wirst mir schwören, Haiduwalda, dass du dieses Wissen niemals meinem Mann, deinem Truchtin, preisgeben wirst! Sonst schneide ich dir höchstpersönlich die Zunge raus.“
„Frowe, ich glaube, dass ich dazu keine Möglichkeit mehr haben werde. Doch schwöre ich es: ich werde es Segimer nie verraten.“
Doch sollte die Welt erfahren, dass Sigi ein Abkömmling Wotans ist!, dachte er.
„Nun fahrt. Das Schicksal und die Götter seien euch wohl gesonnen!“
Sie stiegen auf ihre Pferde. Der Treck setzte sich in Bewegung. Mehrmals drehte sich Sigi um. Seine Mutter stand da, bis er das Dorf nicht mehr sehen konnte.
„Ich werde sie nie mehr sehen…“, murmelte er. Und zu Haiduwalda gerichtet:
„Wo fahren wir hin? Südwesten? Wie alle?“
„Nein, mein Truchtin. Das wäre zu gefährlich. Wenn du Gisilos Leuten in der Fremde in die Hände fällst, sind wir tot.“
„Dann sage mir: Wohin?“
„Ich habe dir doch erzählt, dass ich als Junge mal am Rhein war.“
„Dort sahst du ein großes Dorf aus Stein, mit sehr hohen Häusern und einem Hafen am Rhein. Ja, die Geschichte kenne ich gut.“
„Dieses Dorf heißt Kolonia irgendwas. Dorthin fahren wir.“
Da Sigi an der Spitze des Trecks war und der Weg sich gabelte, fragte er mit ratloser Miene, wohin er sein Pferd lenken sollte.
„Nach Westen. Wir fahren nach Westen.“
IV. Eine neue Heimat
Vor ihnen lag das Elbland. Viele der Sueben und Semnonen, die hier lebten, hielten sie für einheimisches Jungvolk, welches Richtung Südwesten ziehen will. Tatsächlich war etwas in Bewegung. Es zogen Sänger von Halle zu Halle. Sie sangen von der Pracht Roms. Vom Land, in dem der Winter keine verhungerten Kinder hinterlässt, süße Früchte an Bäumen hängen und scharfe Schwerter in Massen produziert werden. Männer, die in den Legionen gedient hatten, bestätigten dies. All diese Geschichten weckten die Gier nach Ruhm, Gold und Ackerland. Doch Sigis Leute gingen nicht nach Südwesten.
Vor ihnen lag das Elbland. Im Barbaricum gab es keine Brücken, kaum Fähren und natürlich keine Häfen.
Vor ihnen lag die Elbe. Die Elbe in all ihrer Gewalt. Der Fluss teilte sich in mehreren Armen auf. Altarme lagen vergessen in den Auwäldern aus Linden, Pappeln, Erlen, Silberweiden und Korbweiden. Schotterbänke wurden vom Fluss hin und her geschoben. Hunderte von Inseln tauchten mal hier, mal dort auf. Geröll und umgestürzte Bäume wurden von der Gewalt der Elbe aufgetürmt. In den Auwäldern gab es tückische Sümpfe und wo der Boden fest war, grasten Auerochsen. Das waren jene Wildrinder, riesig, mit mächtigem Gehörn und von schwarzer Farbe, die eigentlich friedlich waren, doch auch so wild werden konnten, dass sie ganze Zehnerschaften tot trampelten.
Vor ihnen lag die Elbe. Unpassierbar.
Sigi war der Gefolgsherr, doch den Treck führte sein väterlicher Freund Haiduwalda an. Er wusste alles, wusste wohin, wusste, was er zu sagen hatte.
„Haiduwalda, da kommen wir nicht durch“, stellte Sigi fest.
„Bei Donars Keule, wir kommen durch! Irgendwo muss eine Furt sein! Wir können suchen oder fragen.“
„Fragen nicht“, entgegnete Sigi.
„Warum, Truchtin?“
„Auf der Furt sind wir ein sehr leichtes Ziel. Fragst du die Falschen, so locken wir nur Gesindel und Feinde an.“
„Sehr klar erkannt, Wotans Sohn!“ Der Mann lächelte den Jungen gönnerhaft an. „Dann lasst uns suchen!“
Eine Woche lang suchten sie. Sie hatten eine Wagenburg gebaut und jeden Tag ritten drei Männer in die Auen, um eine Furt zu finden. Antheri Buari fand sie. Er hatte den besten Sinn für alles in der Natur. Er hatte ein Auge für Vögel, für gefährliche Moore und fand den Weg aus jedem Wald heraus. Antheri entdeckte eine sandige Furt. Ein Teil davon bestand aus Schotterbänken, ein anderer Teil aus neuen Inseln. Doch die sandigen Zwischenstücke waren hoch gefährlich. Es gab keinen anderen Weg.
„Gut, Antheri Buari“, lobte Sigi. „Wir werden die Hirtenbuben vorschicken. Sie tasten den Boden mit ihren Stöcken ab, außerdem haben sie für das Erdreich ein besseres Gespür als wir Reiter!“
Er schaute die vier Hirtenbuben an. Er rief seinen zu sich:
„Bobo! Komm her! Du führst uns durch die Furt. Sobald du merkst, dass der Boden nachgibt, bläst du in mein Horn!“
„Nicht mein Hirtenhorn?“
„Zu leise. Nimm mein Horn.“
Voller Ehrfurcht empfing er das Kriegshorn seines Herren.
„Danke“, lachte er.
„Ich danke dir, Bub! Sei vorsichtig und denk an unsere Wägen. Antheri, komm! Wie würdest du den Treck für die Überfahrt aufstellen? Reiter-Wägen-Vieh?“
„Nein, Truchtin. Wägen-Vieh-Reiter.“
„Wieso?“, wollte Sigi wissen. Das schätzen seine Männer: Er hatte immer ein Ohr für die Ideen der Erfahrenen.
„Wenn Bobo alles gut macht, hält der Sand. Doch wir Reiter würden ihn aufweichen. Die Wägen kämen dann nicht mehr hinter her. Das Vieh erst recht nicht. Wenn die Wägen drüben sind und die Furt nachgibt, so kommen wir anders rüber. Im schlimmsten Fall schwimmen wir alle: Mensch, Pferd, Vieh. Aber die Wägen müssen rüber!“
„Du hast vollkommen recht! Es wird so gemacht, wie Antheri Buari sagt!“
So machten sie es auch. Langsam, sehr langsam tastete sich der Treck vor.
„Passt mir auf das Fohlen auf!“, rief Sigi zu seinen Knechten.
„Warum, Fro?“, fragten diese. „Es ist kein gutes Fohlen!“
„Ist mir egal! Ich will es mal reiten!“
Sie überquerten die Elbe.
Der Alte mit dem blauen Mantel und einem Auge stand auf einer Moräne und blickte an einer Eibe angelehnt ins Tal. Er sah den Treck. Der Windgott war nicht alleine. Eine seiner Töchter, die Walküre Brunhild, stand bei ihm.
„Schau, wie verständig dein Bruder ist!“, lobte er seinen Menschensohn.
„Nenn ihn nicht meinen Bruder, Vater! Er ist ein Sterblicher!“
„Ja, das ist er. Und ohne die Sterblichen würden wir sterben“, brummte er in seinen Bart.
Zufrieden blickte er auf die Semnonen. Sie hatten den Fluss erfolgreich überquert. Sein Sohn war ein guter Anführer.
„Er wird mir viele Gefolgsleute bescheren. Und dir viel Arbeit!“
Wotan drehte sich weg und ging. Die Walküre folgte ihm.
Ein Mond verging. Sie durchkreuzten die Länder der Cherusker, Chatten und Chasuaren. Sie handelten, wehrten Überfälle ab und schlossen Bekanntschaften. Jeder Fluss war eine Herausforderung. Immer fragte Sigi, ob das jetzt der Rhein wäre. Das Land wurde bergiger und Haiduwalda meinte, der Rhein könne nicht mehr weit sein. Die Ungeduld trieb Sigi an. Sie bauten eine Wagenburg. Sein Gefolgsmann und er ritten vor. Den Rhein suchen.
Sie mieden die Dörfer. Und erkannten, dass Römerland nicht mehr weit sein konnte. Dann sahen sie ihn: Den Rhein. Eingezwängt zwischen Hügeln lag der mächtige Strom vor ihnen. Sigi hatte geglaubt, die Elbe sei gewaltig gewesen; doch der Rhein war unbeschreiblich groß!
Nun standen sie auf einem Berg und blickten auf den Fluss. Vor ihnen lag eine Stadt. Sie war für römische Verhältnisse nicht besonders groß. Nördlich der Stadt hatten die Römer ein Legionslager errichtet. Auf der befestigten Straße vom Lager zur Stadt standen dutzende, nein hunderte von Handwerkerhütten. Im Umfeld der Stadt stand hier und da ein Vicus, und das Land, eingezwängt zwischen zwei Rheinarmen, erschien wohlbestellt. Es war Bonna.
„Ist das Rom? Nein!“, korrigierte Sigi sich selbst, „Das ist Kolonia!“
„Hmm“, brummte der alte Krieger, „ich habe Kolonia größer in Erinnerung.“
„Aber es ist ein riesiges Dorf!“, staunte Sigi.
„Kolonia hatte eine Brücke. Ich sehe hier keine. So, jetzt haben wir genug gesehen. Wir müssen zurück zur Wagenburg!“
Er gab seinem Pferd die Hacken. Sigi drehte sein Pferd noch ein paar Mal um seine Achse, dann galoppierte er hinterher. Doch die Wagenburg war schon belagert! Reiter und Fußkrieger umkreisten ihre Leute. Haiduwalda mahnte Sigi zum Anhalten und die Lage zu klären. Doch dieser galoppierte auf die Fremden zu! Erschrocken drehten sie sich um. Speere senkten die Spitze und Schwerter wurden gezogen.
„Wer seid ihr? Was wollt ihr?“, fragte er, als er die Belagerer in vollem Galopp umritt.
„Eine seltsame Frage für einen, der selber fremd ist!“, gab der Führer dieser Gruppe zurück.
Er war hochgewachsen, hatte kinnlange hellbraune Haare und ein kühnes Gesicht.
„Das stimmt! Aber ihr bedroht meine Leute!“, entgegnete Sigi.
„Wir bedrohen niemanden! Uns wurde zugerufen, dass ihr Truchtin fort sei und dass sie jedes Betreten ihrer Wagenburg als Angriff sehen würden! Das nenne ich mal Gastfreundschaft!“ Der fremde Führer klang nicht feindselig.
„So, haben sie das?“, fragte Sigi forsch. „Gute Mannen! Ich bin Sigi, Sohn des… Sohn des Wotans und der Inghild, vom Stamm der Semnonen. Und ihr, wer seid ihr? Wie Römer seht ihr nicht aus.“
„Weißt du waldblöder Kerl überhaupt, wie ein Römer aussieht?“ Der Mann hatte seine Worte als Scherz verstanden.
„Was? Wie nennst du mich? Waldblöd? Nenn mir deinen Namen und deinen Vater, dass ich weiß, wen ich gleich erschlage!“
Da musste Haiduwalda eingreifen.
„Mein Name ist Haiduwalda, Hairawaldas Sohn, und mein Truchtin ist tapfer, aber etwas jähzornig! Bitte sieh es ihm nach!“
Er bremste seinen Gefolgsherrn aus. Dieser schaute ihn unverständig und zornig an.
„Mein Name ist Biljamund, Trasamunds Sohn und Gefolgsmann des Hrodso Skafta. Wir sind Brukterer und uns gehört dieses Land. Und wenn ihr nicht als Feinde kommt, so zieht weiter. Aber wenn ihr in Rom heeren wollt, so könnt ihr hier gleich sterben. Es käme aufs Gleiche hinaus!“
„Biljamund“, jetzt übernahm Haiduwalda das Wort. „Wir sind Verbannte, Verstoßene. Wir haben keine Heimat mehr. Wir suchen hier am Rhein ein neues Dasein. Land. Äcker. Weiden für unser Vieh.“
Alle stiegen von den Pferden. Sigi lud die Brukterer in die Wagenburg ein. Er konnte nur etwas Schinken, Schmalz und Sahne anbieten.
„Ihr seid also Landsuchende?“, fragte Biljamund.
„Ja“, antwortete Sigi.
„Hier gibt es aber kein Land. Habt ihr gedacht, ihr kommt hierher und bekommt Äcker, Weiden und Allodland? Ihr seid aber sehr gutgläubig.“
Enttäuschung breitete sich bei den Semnonen aus.
„Wir hätten nach Südwesten gehen sollen. So wie alle.“ Die Vorwürfe kamen von Sigi und richteten sich an Haiduwalda. Dieser schien auch sehr betrübt. Die Gäste bedankten sich für das Essen und stiegen auf ihre Pferde:
„Ich bitte euch, verlasst unser Land. Hier gibt es nichts. Und kommt nicht auf den Gedanken, über den Fluss zu setzen! Die Römer fackeln nicht lange! Euer kleiner Haufen wäre Futter für die Löwen!“
„Für wen?“, fragte Sigi. Da raffte sich Haiduwalda noch einmal auf:
„Sage mir, Biljamund: Ist alles Land unter Pflug und Allodland? Gibt es keine Mark, kein Allmendland, welches unbewohnt ist?“
„Klar. Das Grenzland zu den Saliern. Dort ist ein großer, wilder Wald. Viele Hirsche und Wisente. Dort fließt die Ruhr. Aber Äcker gibt es da nicht; nur Urwald und Felsen!“
„Danke, Biljamund. Sage mir: Wir waren am Rhein und sahen eine Stadt ohne Brücke. Ein sehr langer Weg führte dadurch und sie war eingezwängt zwischen zwei Rheinarmen. Wie heißt diese Stadt?“
„Bonna. Willkommen im Grenzland, ihr Hinterwälder! Auf, Männer! Wir reiten!“
Die Brukterer ritten davon. Alle standen um Sigi. Was sollten sie machen?
„Wir haben Äxte dabei. Wir haben Ochsen dabei. Wir haben Pflüge. Wir werden Land urbar machen! Auf zur Ruhr!“
Der Treck machte sich wieder auf den Weg. Natürlich konnte man von Weg nicht sprechen. Hier und da gab es Erdpfade, Knüppelpfade, doch meistens führte Sigi seine Leute durch Wälder, Heiden und Weiden. Kamen sie an Dörfern vorbei, rannten die Kinder ihnen nach. Mal freundlich rufend, lachend und fragend; mal feindlich gesinnt und Steine werfend.
Das Land wurde wilder. Offenland gab es nur noch da, wo Moore waren, sonst kämpften sie sich mit Vieh, Wägen und Pferden durch einen Urwald aus riesenhaften Buchen, Eichen, Bergulmen und Bergahornen. Die Buchen waren so hoch, dass sie in der dichten Verjüngung unter den Waldriesen nicht den Wipfel des Baumes erkennen konnten. Die Eichen waren so mächtig, dass fünf Mann sie kaum umfassen konnten. Überall lagen tote Waldriesen. Diese waren die schlimmsten Hindernisse. Immer wenn sie lichtere, hallenartige Wälder entdeckten, lenkten sie den Tross über diese. Meistens waren diese Eichen- und Lindenwälder mit Gras bewachsen. Dort rasteten sie. Vieh, Pferde und Gänse durften vom sommerlichen Grün essen.
„Fro, wo wollen wir hin? Wo willst du unsere neue Heimat haben?“, fragte Rigilo, ein unfreier Knecht.
„Ich warte auf ein Zeichen, Rigilo“, gab der Gefragte von sich.
„Was für ein Zeichen?“, wollten alle wissen.
Mit vollem Mund antwortete er: „Ich weiß es nicht. Frag die Götter!“
Bald zog der Tross weiter. Der Wald blieb hier verhältnismäßig licht. Mal trocken mit Heidekraut, mal feucht mit vielen Wildschwein- und Rotwildsuhlen.
Es vergingen wieder Stunden. Haiduwalda sagte zu seinem Gefolgsherr: