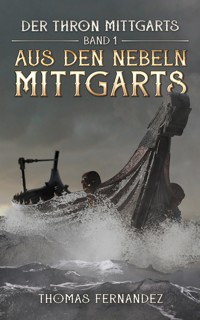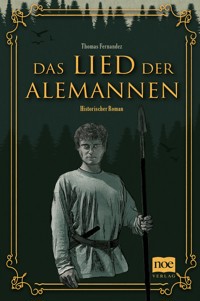
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Noe Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der freie Bauer Folkmar lebt im frühmittelalterlichen Alemannien. Seine Heimat ist von Franken besetzt und ein neuer Glaube breitet sich aus. Missionare führen mit Feuereifer einen Vernichtungskampf gegen die alte Religion, neue Gesetze ersetzen alte Bräuche und Folkmars Sippe zerbricht an der neuen Wirklichkeit. Nach und nach wird alles zerstört was Folkmar liebt. Sein Hass treibt ihn zum Kampf. Dann soll er das christliche Mädchen Ingrid heiraten. Kann er so seine Sippe retten?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 453
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Thomas Fernandez
Das Lied der Alemannen
VERLAG
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über dnb.dnb.de abrufbar.
© Thomas Fernandez © Noe Verlag
Herausgeber:
Holger Noe
Noe Media Solutions
Kruppstr. 1-3 · 51381 Leverkusen
ISBN: 978-3-96828-002-8
www.noe-verlag.de
Thomas Fernandez
Das Lied der Alemannen
VERLAG
Dramatis Personae
Ingrid
Folkmar
Sigmar, Folkmars Vater
Erntrud, Folkmars Mutter
Waltraud, Sigmars Mutter
Gertrud, Folkmars Schwester
Folkwart, Onkel von Folkmar und
Schmied
Vithimar, Folkmars Bruder
Frohild, Frau von Vithimar
Walmar und Frohilo, ihre Kinder
Diutini, Vetter von Folkmar
Walafried, Ingrids Vater Hildegund, dessen Frau
Theudevist, Ingrids Vormund und
Pfarrer
Gunda, seine Magd
Lucius, Missionar
Columban, irischer Missionar
Chariobercht, fränkischer Gaugraf
Wieland, Schmiedemeister aus dem
Wolftale
Rüdiger, Fürst des Albgaus
Fredechild, seine Frau
Notger, sein Sohn
Walaprecht, Edler aus dem Rheintale
Walahari, Sohn des Walaprecht
Thridi, einer von Walaprechts
Mannen
Luitfrid, Ettlinger Bauer
Sighelm, Ettlinger Bauer
Leubwin, Berchtingerbauer
Gunzo, Holchingerbauer
Sigwart, sein Bruder
Awa, seine Frau
Gundrich, sein Sohn
Walthari, Priester des Ziuberges Sigidrifa, Seherin von den Höhlen am Lófbach
Knittilo, Glasbläser
Der Bischof von Strassburgo
Der Bischof von Speyer
Maximilian, hoher Geistlicher aus
Aquae
Cuzzo, Knecht von Rüdiger
Der Gallier, Viehhändler aus
Ettlingen
Hillo, Pferd von Folkmar
Draupi, Folkwarts Ross
I. Der Albgau
Seit die Steine denken können, murmelt die Alb ihr uraltes Lied. Am Anfang lauschten ihr nur Auerochs, Wolf, Hirsch und Waldohreule. Es war menschenleer im Albgau und das Land war bedeckt mit Wald, Aue und Moor. Die Nachtigall sang nur für sich und das Knabenkraut wurde von niemandem bewundert. Nur der Ruf des Adlers und des Wanderfalken hallten über das Land, des Nachts erfüllten das warme Wimmern des Kauzes und die sehnsüchtigen Rufe der Wölfe die Dunkelheit. Der König des Schwarzwaldes war der Bär. Keiner wagte seine Stellung streitig zu machen.
So war es, bis ein ganz neues Wesen auftauchte. Es lief auf zwei Beinen und gab äußerst seltsame Töne von sich.
Die ersten Menschen im Albgau waren groß. Manch einer nannte sie später Hünen. Sie zogen umher und nahmen, was die Erde ihnen bot. Doch der Schwarzwald wurde von dieser Spezies möglichst gemieden. Lieber bearbeiteten sie den Boden in den umliegenden Landstrichen. So blieben Ur, Wolf, Hirsch, Luchs und Sau ungestört.
Doch diese Frauen und Männer wurden von anderen der gleichen Art verdrängt. Deren Waffen waren härter und ihr Wesen kämpferischer. Es waren die Kelten. Sie wagten es sogar, in manchen Gebieten des Schwarzwaldes zu siedeln. Auch Heiligtümer hatten sie hier und widmeten dem Schwarzwald eine Göttin: Abnoba.
Doch die Jahrhunderte vergingen und der gefräßige Römer schluckte das Land, welches er „Abnoba Montes“ nannte. Angst hatten diese tüchtigen Legionäre aus dem Süden vor dem Wald. Cäsar wagte es nicht, ihn zu betreten und Julian nannte ihn beeindruckend. Trotzdem bauten diese fleißigen Männer aus dem Land, in dem die Sonne so viel scheinen soll, im Umland viele Städte und Anwesen, welche sie „Villa Rustica“ nannten.
Der Sonne Antlitz verwöhnte ebenso die Gaue des Oberrheins. Doch oben in den bewaldeten Anhöhen, da herrschten die elementaren Kräfte des Sturmes, des Regens und des Eises. Wodan, der Gott des Sturms, raste des Nachts über die Wipfel der Tannen und Buchen. So fürchteten die Menschen, die in der kleinen Siedlung bei der Alb, an der Pforte des Schwarzwaldes, lebten, den dunklen, unheimlichen Wald. Seltsame Stimmen und gruselige Geschichten kamen aus dem Dickicht. Römische Kundschafter berichteten von furchtbaren Tieren und gefährlichen Schluchten.
Nicht nur den Wald hatten die Römer zu fürchten. Jenseits des Limes hatten sich verschiedene Stämme zusammengerafft und sie nannten sich Alemannen. Unter ihnen war einer, den man Reimar nannte. Groß war er und rotblond sein Haar. Die blauen Augen dieses Germanen streiften immer in die Ferne und so ging es nicht nur ihm. Die Sehnsucht und die Unruhe trieben das ganze Volk der Alemannen in das Reich der Römer.
Nun war es am Oberrhein gar nicht mehr ruhig. Schwerter klirrten, Äxte sirrten und Kehlen schrien laut, denn Feuer und Tod stürmten über den Limes. Kinder und Enkel Reimars fielen bei diesen Kämpfen. Immer in den ersten Reihen waren sie, wild und verbissen. In Friedenszeiten waren die Reimaringer Bauern, doch der Kampf um das Land, die Suche nach Acker und Weideland machte aus ihnen tapfere und geachtete Krieger. Diese Unruhe sollte noch viele Jahre andauern. Erst als der Kaiser fort war, seine Städte ohne Glanz und verwittert, das Straßennetz vergessen, sollte einer der Reimarsippe sesshaft werden und erbaute einen stattlichen Hof. Er floh von der übervölkerten Ebene in den Wald. So folgte er dem Lauf der Alb und der Moosalb und an dessen Ursprung rodete er die uralten Buchen, die von fünf Männern umschlungen werden konnten. Gripmar, Sohn der Iduana und des Ulfharti, nannte diesen Hof Reimarhof – nach ihrem großen Urahn. Es war ein stattliches Anwesen mit einem großen strohgedeckten Walmdach. Die Wände waren aus Lehm und den langen Tannen der Berge des Waldes gefertigt. Haus und Stall standen unter einem Dach und in den Wohnräumen glänzte der gestampfte Lehmboden. Für das Feuer baute Gripmar eine lange gemauerte Stelle.
Natürlich heiratete Gripmar auch. Mit Herda zeugte er fünf starke Kinder. Somit war das Überleben der Sippe gesichert. Doch der Wald blieb etwas Unheimliches, Heiliges. Voller Geister war er, dort lockten die Unterirdischen und wüteten die Riesen. Oft streifte er mit seinem ältesten Sohn Reimar durch die Berge und Täler. Auch im Frieden und in der Sesshaftigkeit trieb sie die Unruhe. Am liebsten bestiegen sie einen Felsen, der auf einer Bergkuppe im Halbschatten der riesengroßen Buchen, Ahorne und Tannen stand. Dort saßen sie und schauten ins Murgtal. Jedes Mal sahen sie nicht weit vom Felsen in einer kleinen Heide einen Bären sitzen. So nannten sie diesen Felsen Bärenstein. Die Jahre vergingen und Reimar heiratete und seine Tochter Algisa auch. Seinem Enkel Walmar, der Siglind ehelichte, war das Schicksal nicht so hold. Das Jahr 496 hatte schön begonnen, Ziu, Donar und Ingwe hatten ihnen ein sehr gutes Jahr geschenkt, sodass er mit seinen fünf Söhnen die Felder bearbeiten konnte und die Rinder die Winterdürre sehr gut überstanden. Seinem Sohn Theudmar wurde in diesem Sommer Walmars erstes Enkelkind geboren: Waltraud. Walmar war glücklich.
Doch da ging eine Botschaft durch die Gaue, die Walmar nicht gefiel. Der König rief zu den Waffen. Es ging um alles oder nichts. Der Franke musste aufgehalten werden. Es wurde eine mörderische Schlacht. Die Felder zu Zülpich wurden mit Blut getränkt und die fränkische Übermacht schlug das Heer. Nichts war nach dieser Schlacht, wie es mal war. Der König war gefallen, Walmars Söhne waren allesamt in die fränkischen Klingen gestürmt und Alemannien verlor seine Freiheit. Doch ein zunächst kleiner Schritt sollte die ganze Geschichte ändern. Chlodwig, der Frankenkönig, hatte seinen römischen Helfern und Gönnern versprochen, wenn er in dieser Schlacht siegen würde, so wäre er bereit ins Taufbecken zu steigen. Diesen Schritt vollzog er und sein Volk gleich mit. Dieser Schatten sollte für alle weiteren Generationen der Reimarsippe, die in der eben geborenen Waltraud weiterlebte, immer drückender werden.
II. Das Unheil
Das schallende Lachen des Eichelhähers schmetterte spottend vom Waldrand. Die Sonne lag wie eine schwere Bürde über dem Reimarhof, es war ungewöhnlich heiß für den Frühling. Sigmar war mit seinen zwei Söhnen auf dem Feld und schwitzte und keuchte. Die Äcker nach der Winterbrache zu pflügen war eine schweißtreibende Arbeit. Vithimar und sein jüngerer Bruder Folkmar halfen ihrem Vater, wo es nur ging. Schön waren die zwei Kinder. Ihre glühenden blauen Augen hatten sie von Sigmar, doch sonst glichen sie mehr ihrer Mutter Erntrud. Ihre dunkelblonden Haare, die lockig ins Gesicht hingen, die kräftige Nase und die zierlichen Ohren. Ihr Blick war immer tief und äußerst bedacht alles zu erfassen, was um sie herum geschah.
So standen sie beide und beobachteten ihren Vater. Folkmar hatte seine Hände hinter dem Rücken verschränkt.
„Vithimar!“, rief der im Gesicht erdbeerrote Sigmar, „Geh zum Hof und hole mir bitte ein neues Sech. Bringe bitte auch das andere Pferd. Folkmar, geh’ mit und hilf deinem Bruder!“ Am Abend kehrten sie müde und durchgeschwitzt zum Reimarhof zurück. Eine Amsel sang verträumt im alten Hollerbusch, der dem Hof den Segen von Frau Holla zusicherte. Die letzten Strahlen der in Wolken versunkenen Sonne kämpften sich durch die Buchen und Eichen des Donarberges, Erntrud hatte Gerstengrütze mit Zwiebeln und Schnittlauch gekocht. Nun saßen alle am Tisch: Sigmar, Erntrud, Vithimar, Folkmar, seine Schwester Gertrud und Großmutter Waltraud. Jeder aß schweigend, bis Sigmar die Ruhe brach:
„Im Wonnemond ist das nächste Thing. Rüdiger muss uns neue Gesetze verkünden. etwas Wichtiges sagen. Die Franken wollen sie wohl ändern.“
„Die werden uns schon nicht auffressen!“, bemerkte Waltraud. Folkmar liebte seine Großmutter sehr. Wie gerne lauschte er ihren Geschichten.
„Mir gefällt es auch nicht, dass wir jetzt von ihnen abhängig sind. Doch wir haben unseren eigenen Herzog!“
„Der Franke wird schon nichts anstellen. Immerhin hat er uns viele Freiheiten gelassen“, unterstrich Erntrud, die immer guten Mutes war.
Als alle schliefen, saß Waltraud noch am Feuer und wärmte sich. Da kam ein verstrubbelter Folkmar zu ihr. Er gähnte, rieb sich die Augen und fragte:
„Ähni, was machst Du hier?
„Ich wärme meine schwachen Glieder. Doch was machst du denn hier? Du müsstest schon längst schlafen.“
„Ich kann nicht. Ähni, erzähl mir eine Geschichte.
Waltraud räusperte sich und zog den Jungen zu sich, ihre ledrigen Hände fuhren durch seine Haare.
„Als dein Ahne Luitmar mit zahlreichen anderen Männern unseres Stammes in das Land, das die Römer besetzt hatten… … “ So erzählte sie, wie die Alemannen in die steinernen Städte der Römer kamen und verwundert all die neuartigen und fremden Dinge vorfanden. Die Stadt ward von den Römern Aquae genannt, da es dort ein großes Badehaus gab. Ein sonderbarer Anblick waren den Südländern die Ahnen des kleinen Folkmar. Sie badeten im eiskalten Wasser der Oos, während neben ihnen die beheizte Therme des Kaisers Caracalla stand. Nein, so etwas war nur für weiche Römer! Sie feierten die ganze Nacht durch und so manche Sache ging dabei zu Bruch.
Doch mieden die Männer die steinernen Häuser der Römer wie der Fuchs den Wolf. Dass die Römerstädte und Siedlungen später verfielen, hörte der Junge nicht mehr. Er schlief tief in Waltrauds Schoß und träumte von Kriegern und Römern.
Es verging der Ostermond und der Duft des Weißdornbusches lag schwer in der Luft. Die Sippeneiche trug ihr schönstes, hellgrünes Kleid. Unter den Vogelkirschen an der Moosalb regneten die Blütenblätter sanft herab.
Des Abends erklang der Gesang der Nachtigall und in den Zinnen der Buchen hörte man nachts das laute Verlangen der jungen Bussarde.
Sigmar hatte Hillo, ihr prächtigstes Pferd gesattelt und Erntrud packte für ihn Proviant, trockene Kleidung und eine Zeltplane ein.
„Hast du besondere Wünsche, die ich im Thing aussprechen soll?“, fragte Sigmar seine Frau, die nicht mitkommen wollte. „Ich bin wunschlos glücklich.“ Erntrud gab ihrem Gatten einen Kuss und die Kinder winkten stürmisch.
Es war ein herrlicher Tag. Wie mächtige Berge durchkreuzten Wolken den blauen Himmel. Der Wind kühlte Sigmars Stirn. Er ritt durch die lichten Buchenwälder am Rande des Albtales. Vermooste Baumriesen lagen, von Modes Wildem Heer umgerissen, auf dem schmalen Weg.
Je mehr er gen Ziusberg stieg, desto dunkler und dichter wurde der Wald. Uralte moos- und farnbewachsene Tannen wachten über ihn. An felsigen Lichtungen, die mit einem Heidelbeerteppich geschmückt waren, hielt er inne, um Frau Sonnes wohltuende Strahlen zu genießen. Dort tanzten die Birken im sanften Reigen des Windes und junge Kiefern drängten durch die Sandsteinfelsen in Richtung Sonne.
Am Ziusberg herrschte reges Leben. Dutzende von Pferden grasten zwischen den lichten Eichen und Birken. Laut dröhnten die Stimmen der versammelten Alemannen bis ins Murgtal. Es waren alle da: Rüdiger, der Häuptling des Albgaus, Luitini vom Vithinihof, Walaprecht, der einflussreiche Fürst des Rheintales, Walafried vom Walahof und seine Frau Hildegund und noch viele andere bekannte und unbekannte Gesichter. Sigmar hasste das Thing. Er mochte es nicht, so viele ungeliebte Menschen zu begrüßen. Er war ein Bergbauer, ein Waldbauer und somit für die Talbewohner von niederem Rang. Doch die wenigen, die er schätzte, zu denen hielt er treu bis in den Tod. Einer von ihnen war Walafried.
„Wie geht es deiner Tochter Ingrid?“, fragte er seinen Freund.
„Gut. Wie geht es deinen Kindern?“
„Auch gut. Es wird Zeit, dass sie sich mal wieder sehen. Es ist schon einige Jahre her, dass sie sich gesehen haben.“ Nach vielem Fragen und Erzählen kamen die Priester zu Rüdiger und Walaprecht. Diese eröffneten das Thing.
Doch bevor jemand etwas beantragen konnte, sprach Rüdiger: „Männer und Frauen des Albgaus: Ich begrüße euch und eröffne somit dieses Thing des Wonnemondes. Ich muss euch etwas sehr Wichtiges mitteilen” – in diesem Moment ritt eine Eskorte von fränkischen Kriegern auf den Thingplatz. Sie wurde von einem Edeling in Begleitung eines christlichen Geistlichen angeführt. Mit einer Handbewegung deutete er Rüdiger weiter zu sprechen.
„Auf Anordnung des Königs Childebert wird das Thing im nächsten Monat, also im Brachmond, nicht mehr wie gewohnt auf dem Ziusberg abgehalten, sondern in Ettlingen. Leider haben wir nicht das Recht hierüber abzustimmen. So ist es der
Wunsch des Gefolgsherren“
Mit zufriedener Miene lief der Christenpriester zum Rednerhügel. Wie gebannt folgten ihm alle mit den Augen. Einer rief:
„Das ist heiliges Gebiet, Priester! Deine Krieger dürfen keine
Waffen tragen!“
Lucius, der Missionar, sagte:
„Ein Teufelsberg ist dies, voller böser Geister! Nichts weiter. Doch will ich nicht über euren Götzendienst diskutieren, sondern das ergänzen, was Rudigerius gesagt hat.“ Er holte ein mit Siegel versehenes Pergament heraus.
„Ab sofort ist nicht mehr Rudigerius euer Gefolgsherr. Chariobercht, vom König von Austrasien eingesetzt, wird die Geschäfte des Skuldes führen. Er ist Graf und Hunno der Albgauhuntari. Er spricht das Recht. Er wiegt die Gesetze. Und die Gesetze sind die der ribuarischen Franken!
Ab jetzt soll der Sonntag ein heiliger Tag sein! Jedwede Arbeit an diesem Tage ist ab sofort verboten. Wer es trotzdem wagt, das Recht der heiligen Römischen Kirche zu brechen, der bekommt eine Verwarnung. Wagt es der Wilde noch einmal, so wird ihm ein Drittel seines Hab und Gutes genommen. Sollte der geistig Verwirrte es nochmal wagen, so soll er samt seiner Familie versklavt werden! So spricht das heiligste Recht von Gottes Vertreter auf Erden. Wenn einer von euch Heiden das Licht Gottes erfahren sollte und anschließend sein Hab und Gut der Ecclesia schenken will, so ist diese Schenkung nach Brief und Siegel rechtlich gesichert. Niemand, nicht Söhne oder Töchter, Häuptling oder Herzog kann dies rückgängig machen. Wer es wagen sollte, dagegen Einspruch zu erheben, dem droht eine von 50 Solidi Geldstrafe. So will es das Gesetz der Rheinfranken.
Die verlorene Seele, die es wagen sollte, die Kirche zu bestehlen, hat den dreifachen Wert zu bezahlen. Sollte er dies nicht können, so soll er samt seiner Sippe versklavt werden. Ab heute darf niemand, auch nicht der König selbst, einen in der Kirche Asylsuchenden herauszerren. Er genießt den absoluten Schutz der Ecclesia Catholica. Wer von euch es wagen sollte, gegen dieses Recht zu verstoßen, der zahle dann eine Strafe von achtundsiebzig Solidi; was ungefähr die gleiche
Da ertönten aus der Menge Rufe wie: „Aber ihr steht auch mit Waffen da!“ Wut entbrannte.
„Sollte es jemand wagen einen Presbyter zu ermorden, so soll er es mit sechshundert Solidi oder Skilling büßen. Einen Mönch zu meucheln, kostet euch vierhundert Solidi! Also überlegt es euch gut! Es sprach das Recht der des Regnum Francorum.“ Lucius blickte zum Edeling. Dieser nickte zustimmend. Das war Chariobercht, der neue, vom König eingesetzte Graf im Albgau. Er war Franke.
Rüdiger war entmachtet und es galt kein alemannisches Recht mehr.
Zufrieden kehrten sie der Versammlung den Rücken zu. Ratlosigkeit und Wut machten sich breit. Rüdiger beschwichtigte die erhitzen Gemüter. Er wollte einen sinnlosen Aufstand verhindern. Es hatte doch keinen Sinn!
Der Rest des Tages verlief in Sorge und Trübsal und als die goldrote Sonne hinter dem Steinkreis und Sternenaltar zur Ruhe ging, als der Abendwind die wütenden Trotzköpfe kühlte, legte sich Sigmar zum schlafen nieder.
Die morgendliche Kälte kroch in Sigmars Knochen. Ein prachtvolles Konzert von Vogelstimmen ertönte von den Zinnen der Tannen, Ahorne, Kiefern, von den blühenden Ebereschen und jugendlichen Birken. All diese kleinen Geschöpfe kannten nicht die Sorgen, die schwer auf dem Herzen des Albgauervolkes lagen.
Sigmar öffnete erst ein Auge, dann das andere und atmete tief die Morgenluft ein. Er weckte Walafried und verabschiedete sich von ihm. Der Wald schien ihm an jenem Wonsdig schöner als sonst. Die Strahlen Sunnas brachen durch das Dach des Waldes wie Geschenke der Götter. Drei Rehe ässten zwischen jungen Buchen und der fleißige Specht klopfte die Rinden nach Larven ab. All diese schönen Dinge munterten Sigmar etwas auf.
Folkmar saß alleine an der Moosalb an eine Erle gelehnt. Verklärt schaute der junge Mann in die Strudel des Baches. Oft sann er so vor sich hin. Sigmar gefiel es nicht, dass sein jüngster Sohn so oft alleine ging; dass er nie nach Ettlingen mit wollte, um andere Jungen zu sehen. War er doch gegenüber anderen grundverschieden.
In Folkmars Adern floss kein Kriegerblut. Zwar war Sigmar auch kein geborener Krieger, doch sein Sohn war ein Träumer, ein Schwärmer. Jedes Mal wenn Sigmar – ungern – ihm das Zuschlagen und Abwehren mit der Spatha beibringen wollte, erfand der Junge eine andere Ausrede, sodass der alte Herr nur Vithimar unterrichtete.
Leier wollte Folkmar spielen lernen, Geschichten erzählen und Lieder von Helden und Liebenden singen. So saß er da und atmete tief den Hollerduft ein. Als er zum Reimarhof kam, saß Waltraud auf der Bank unter der Sippeneiche. Gripmar hatte sie gepflanzt und solange sie gesund war, lebte die Reimarsippe weiter.
Waltraud lächelte den Jungen an.
„Warst du wieder unterwegs? Du wirst noch ein richtiger Waldschrat! Groß und grün, voller Warzen und Geschwüre!“ Die Großmutter verstellte ihre Stimme so, dass Folkmar lachen musste. Da kam der Igel, der im Hof wohnte, hinter der Eiche hervor.
„Herr Stichbickle, was machst du denn hier?“, fragte Folkmar den Igel vergnügt.
Dunkle Wolken türmten sich auf und vertrieben die Sonne. Donar raste durch den Himmel und der Wind wurde heftiger. Da kam Sigmar aus dem Wald geritten. Er machte ein ernstes Gesicht.
„Ich grüße dich, Sohn!“ Er küsste seine Mutter auf die Stirn und fuhr mit seiner Hand durch die Locken seines Sohnes.
Gleich darauf schickte er ihn rein.
„Du hattest nicht Recht, Waltraud. Der Franke wird uns fressen.“ Die kluge Alte änderte sofort ihre Miene.
„Was ist passiert?“ Da erzählte er ihr alles, während er sein Pferd Hillo versorgte.
„Vielleicht ist es die Bestimmung. Das Schicksal, das die Scepenthas gesponnen haben.“ „Was redest du da, Mutter!?“
„Die Götter werden irgendwann mal untergehen, um einem neuen Geschlecht Raum zu lassen. Die Götterdämmerung! Jeder Sommer endet. Doch der Winter ist nicht ewig.“
„Das kann doch nicht der Wille Donars sein!“
„Was sollen wir Bauern machen? Die Fürsten denken nur an ihren Vorteil. Viele stecken mit den Franken unter einer Decke.
Auf die kannst du nicht zählen!“
Verzweifelt schaute Sigmar aus der Stalltür.
„Geh Mutter, ich muss nachdenken.“
Sie ging. Aber auch er ging. Er stieg hinab ins Grubenhaus. Da kauerte er nieder und blickte grimmig und lang die geweißelte Wand an.
III. Sonnenwend
Der sommerliche Wind rauschte in der großen Krone der Eiche. Die Eidechsen ließen sich die Sonne auf den Rücken scheinen und auf den Feldern schoben die ersten Haferhalme Ähren. Es war Brachet und das große Fest des Mittsommers stand bevor. Erntrud braute viel Bier, um es den Göttern als Opfer dar zu bringen.
In den Hecken zwitscherte und sang es fröhlich, Spechte lachten laut und die Hunde tollten übermütig. Alle waren guter Dinge. Die Menschen des Albgaus hatten die bösen Worte des Christenvertreters vergessen. Dass sie sich nun in Ettlingen zum Thing treffen mussten, hatten die Sturköpfe murrend akzeptiert.
Vithimar und Folkmar holten vom Hutewald ein Schwein, das ihr Vater für das große Fest schlachten sollte. Auf dem Reimarhof herrschte Hochbetrieb. Alle hasteten, schufteten und schleppten. Die Männer der Höfe trugen Reisig, Äste und kleine Baumstämme auf den Donarsberg, um ein großes Feuer zu Ehren der Götter zu entzünden.
Erntrud holte die guten, geräucherten Schinken, welche die Römer schon immer geliebt hatten. Die Frau keuchte und schnaufte.
Da der Reimarhof die Hufe war, die am nächsten zum heiligen Berg lag, versammelten sich alle hier. Dutzende von Mädchen flochten große Räder aus Weiden, Haseln und Heu. Wie glücklich war das Land. Die Mädchen liefen mit Blumenkronen umher und die jungen Kerle wollten den Männern so behilflich wie nur möglich sein.Trotz des Gewimmels und der Aufregung ließ sich der Schwarzstorch nicht stören. Auch der alte Kauz in der Eiche schielte verschlafen nach den Alemannen des Albgaus.
Als der Abend nahte, eilten alle sich zu waschen und ein Dampfbad zu nehmen. Vithimar hatte das schwere Kuhhautzelt aufgestellt und Waltraud wendete die Steine im Feuer. Das Frauenvolk durfte mit der Reinigung beginnen, sodass der kleine Folkmar noch etwas herumschlendern konnte. Da hörte er Hufgetrappel. Neugierig spähte er zu den sonnigen Wiesen und zum Waldrand. Da erblickte er voller Freude: Onkel Folkmar kam! Wie froh war er immer, als dieser einsame Wolf von Folkwart kam. Raubeinig und ungehobelt sah er aus. Er sprang von seinem Fuchs ab und beugte sich zum Jungen herab.
„Na großer Mann, wie geht es dir?“
„Onkel Folkwart!“ Der Sigmarsohn umarmte seinen Onkel an der Hüfte.
„Ich hoffe, ich komme nicht zu spät.“
„Nein, erst Morgen ist Mittsommerfest.“
„Gut. Jetzt begleite deinen alten Onkel zum Hof. Ich habe Durst.“ Die Hände von Folkwart waren schwielig und seine Arme waren kräftig. Der Mann hatte einst bei einem bekannten Schmied gelernt, sehr schöne Fibeln und Schnallen, Ringe und Ohrenschmuck herzustellen. Doch Folkwart konnte nicht an einem Platz bleiben. Weit war er in die Welt gereist. Manchmal den Hammer schwingend, oft das Schwert schwingend. Er hatte sogar an großen Schlachten teilgenommen und man munkelte, er würde sogar den oströmischen Kaiser kennen!
Es kam der Abend und die Sonne schien immer noch über die Wälder des Schwarzwaldes. Als die Nacht hereinbrach und die glühende Scheibe sich langsam verabschiedete, als der Kuckuck unermüdlich rief und der Gelbspötter im Hollerbusch sich über Nachtigall und Amsel lustig machte, kehrte Ruhe in den Reimarhof ein. Stall, Scheune, Halle, Heuboden, Grubenhaus und Fruchtkammer waren voller schlafender Frauen und Männer. Um die Häuser standen Zelte und Wägen. Überall schlief jemand.
Waltraud huschte durch das Haus und da sah sie, dass Folkmar wach im Bett saß und in die Flamme des Feuers blickte.
„Junge, schlaf.“
„Großmutter, ich kann nicht. Ich bin zu aufgeregt. Ich habe es dir doch gesagt, dass Onkel Folkwart kommt!“ Sie setzte sich zu ihm.
„Ja, er ist gekommen. Doch jetzt musst du schlafen, oder ein
Alp wird dich holen!“
„Ich fürchte keinen Alp. Auch keine Maren und Elben.“ „Junger Mann, sei vorsichtig! Ich werde dir eine Geschichte erzählen; doch danach wird geschlafen, versprochen?“ Er nickte kurz und lächelte.
„Es lebte einst in einem Hof ein wohlhabender Bauer. Er hatte eine Frau und viele unfreie Mägde. So geschah es eines Tages, dass sich die Bäuerin mittags an einem Baum gelehnt ausruhte und so einschlief. Die Mägde saßen vor ihr und vesperten vergnügt. Da sah eine der Mägde, wie eine Maus aus dem Mund der Schlafenden kam. Diese huschte fort. Trotz der Warnungen der anderen Mägde stand die vorwitzigste von ihnen auf und schüttelte die Schlafende. Daraufhin, als sie sah, dass diese keine Antwort gab, zerrte sie diese fort, da sie dachte sie sei tot.
So kehrte die Maus zurück und fand natürlich keine Bäuerin mehr, sodass sie verschwand. Die Bäuerin wachte aber nie mehr auf. Sie war jetzt wirklich tot.“ Sie machte eine Pause. „So siehst du, die Seele kann die unterschiedlichsten Formen annehmen. Jetzt schlaf.“
Doch Folkmar konnte nicht schlafen. Noch Stunden lang drehte und wälzte er sich in seinem Bett.
Früh waren alle auf den Beinen. Jeder nahm etwas zum Tragen an sich und anschließend ging es los. Wie ein mächtiger Lindwurm kriechend, rollte die lange Menschen- und Wagenkette gen Donarsberg. Buben trieben die Schweine, Rinder und Pferde. Auf einem Wagen thronte der heilige Bierbottich und auf dem am prächtigsten geschmückten Wagen stand das Bild von Donar. Kinder huschten von Wagen zu Wagen. Frauen sangen und Männer schoben die Karren an.
Es war ein schöner Anblick. Nein, nicht schön. Es war großartig und majestätisch. Diese einfachen Menschen, die schon genug mit Hunger und Krankheit zu kämpfen hatten, zogen zu Dutzenden auf den heiligen Berg, um den Göttern von ihren ohnehin kargen Vorräten zu opfern. Die Hingabe, die diese Bauern ihren Göttern, Ahnen und Mitmenschen zeigten, stammte aus den Tiefen ihres Herzens.
Das Mannsvolk errichtete auf dem Berg bei der uralten Donareiche einen riesengroßen Holzstoß. An der Eiche hingen etliche Pferdeschädel aus den vergangenen Jahren und in diesem Jahr war wieder der Ewart in den Frijahain gegangen und hatte eines der heiligen Rösser eingefangen. Dieser würde dann von Rüdiger, Fürst vom Albgau, den Göttern geopfert werden. Außerdem hatten sie noch vier Ochsen, sieben Schweine sowie den großen und heiligen Bottich mit honiggesüßtem Bier.
Den ganzen Tag lang tanzten und spielten, sangen und intonisierten ihre vertrauten Kuhreihen. Die Männer rannten um die Wette und übten sich im Steinwurf. Der Gewinner aller Wettkämpfe durfte nach den Priestern und Priesterinnen, Rüdiger und Walaprecht, als erstes ein Stück des heiligen
Rosses auswählen. Das war sehr wichtig, da nicht in allen Teilen gleichviel göttliche Kraft steckte. Es kam der Nachmittag und ein Kuckuck rief unermüdlich durch die Tannen und Buchen.
Da erschallte es vom Nordwesthang: „Sie kommen!“ und ein paar aufgeregte Kinder rannten jauchzend vor Freude zur Menge. Es waren die Priester mit dem heiligen Ross. Wie auch die Rinder trug dieses eine Blumenkrone auf seinem Haupt. Glockenblumen, Trollblumen, Waldmeister, Sumpfhahnenfuß, Wiesenwucherblumen, Knabenkraut, Birkenlaub, Eichenlaub, Waldglöckchen, Lindenblüten, Holunderblüten, Blutweiderich und Mittsommerkraut krönten die Häupter der Opfertiere. Die schönsten Formen hatten diese Kronen. Manche waren noch zusätzlich mit geheimnisvollen Runen versehen.
Fröhliche Lieder begleiteten die aufsteigenden Priester. Als sich alle um den Holzstoß versammelt hatten und die Mittagshitze nachgelassen hatte, um dem sanften Nachmittag zu weichen, stellte sich Rüdiger auf einen kleinen Fels und rief: „Ich hoffe, ihr habt alle das Feuer daheim ausgemacht!“ Es war Brauch, nur zweimal im Jahr das Herdfeuer auszumachen. Dies geschah zu Mittsommer und zur Weihenacht. Das Sonnenwendfeuer hatte etwas zauberhaftes, etwas heilendes und göttliches.
Plötzlich stimmten Walaprecht und Walthari, der Ewart, ein rituelles Lied an. Es klang geheimnisvoll und stammte aus dunkelster Urzeit. Folkmar verstand nur wenige Wortfetzen.
Nautiz und Sigill, Sunna und Kenaz, Dagaz und Jera… Währenddessen nahm Rüdiger die Opferkeule und das Opfermesser und schritt im weißen Gewand mit einem Weißdornkranz auf dem Haupt salbungsvoll zum Ross. Da war alles still. Sogar die Vögel schienen zu schweigen, um den Worten des ehemaligen Gaugrafen zu lauschen.
„Ziu und Wodan, Donar und Nerthus, Ing und Holla, Frija und Sunna; wir haben uns hier vereint, um euch zu ehren, um uns bei euch zu bedanken und um euch um eine gute Ernte und um Gesundheit für uns und unser Vieh zu bitten! Große Götter der Erde und des Himmels, dieses heilige Feuer soll euch zu Ehren in die kürzeste Nacht lodern. Diese heiligste Stute soll euch allen geopfert werden – Ihr Ansen die sie und uns behütet.
Donar, wir haben uns auf diesem Berge versammelt, um dir für eine gute Ernte Opfer darzubringen. Soll der Segen der Götter uns durch diese Stute überkommen sein.“
Er schlug mit der Keule auf die Stirn des Tieres und schnitt der schneeweißen Stute die Kehle durch. Sie sank in sich zusammen, ihre Gelenke gaben nach und mit einem letzten Seufzer gab das Pferd auf. Rüdiger hatte schnell einen belaubten Eichenast zur Hand. Der Ewart Walthari hielt die bronzene Opferschüssel unter die Schnittstelle. Alle verfolgten gebannt das Geschehen. Als der Gaugraf das Eichenlaub ins Blut tunkte, gab es ein großes Gedränge. Jeder wollte ganz vorne stehen. „Segen für dich und dein Vieh“, sprach Rüdiger, während er das Volk des Albgaus mit Blut besprenkelte.
„Ja, auch du sollst von den Göttern gesegnet sein, Witu“, sprach er den Bauern an. Das Fieber hatte ihm seine Frau und drei Kinder fortgenommen. Als das Volk gesegnet war, wendete es sich wieder dem Feiern zu.
Da wurden von den Stärksten des Albgaus – der Ettlinger Luitfrid, der Kunzling Saxmut und der älteste Sohn von Walaprecht, Walahari – die Bier- und Metbottiche hergeschleppt. Während Rüdiger die Stute ausweidete und immer wieder Donar aufrufend die Rinder, die zum Opfermahl bestimmt waren, schlachtete, verteilten die Frauen Bier an die durstigen Mannen. Es verging einige Zeit, da bat Walaprecht erneuert um Ruhe. „Nun, ihr Frauen und Männer, Vetter und Schwestern, jetzt kommt der heiligste Moment.“
Wie eine Zauberformel wirkten seine beschwörenden Worte. Während er sie aussprach, verabschiedete sich die Sonne in wunderschöner Pracht von den Menschen. Nun war der längste Tag zu Ende, der Sommer begann und ihre Tage würden von Mond zu Mond kürzer werden.
„Die heilige Sonnenwende beginnt und wir werden zur Ehre Sunnas diesen Holzstoß anzünden, dass es in die heiligste Nacht hinaus brennt, um unseren Dank den Göttern zu überbringen, um unsere innere Flamme des Verlangens und des Willens erneut zu schüren. So wie der Sommer immer wieder stirbt, so wie die Sonne immer wieder neu geboren wird, so bestimmen wir unser Leben. Was bedeutet der Tod eines Menschen? Nichts, wenn ein Kind geboren wird. Wir sind ein fester Teil in einem Kreislauf von Geburt und Tod, denn das eine kann ohne das andere nicht sein. So wie uns Herr Wodan mit Kriegen und Stürmen den Tod bringt, so bringt er uns auch Leben und Gedeihen. Und unter diesem Zeichen steht das Feuer. Es ist eine Quelle des Lebens, doch auch ein Born des Verderbens und des Todes.
Und in diesem Moment, in dem die Sonne den Segen des Sommers einleitet, doch zur gleichen Zeit jeden Tag sterbend ihrem Schicksal entgegensteuert, wollen wir ihr zu Ehren uns um das heilige Feuer versammeln. Der Winter brachte viele freudige Dinge, aber auch weniger freudige. Doch hat einer es verdient, das Feuer zu zünden.“
Es war totenstill. Alle starrten mit offenen Mündern den Fürst Walabrecht an. Es war mehr als eine Ehre, das Feuer zu entfachen. Es hieß, denjenigen, denen diese Ehre zuteil wurde, wäre ein längeres Leben vergönnt. Gespannt wie Bogensehnen warteten sie auf die Entscheidung, welche die Priester Walaprecht und Rüdiger gefällt hatten. Walaprecht zeigte auf seinen Vetter Walafried.
„Walafried, du sollst es tun.“ Verwundert, ja erschrocken trat der Bergbauer zum dreimannshohen Scheit. Rüdiger übergab ihm Feuersteine, Zunder, Birkenrinde und Rohrkolbensamen. Bald brannte es hell in den Sternenhimmel und nachdem das Albgauvolk eine besinnliche Hymne gesungen hatte, begannen sie ausgiebig zu feiern. Es flossen Bier und Met in Strömen, es wurde geschmatzt, gerülpst und gestöhnt. So sahen die alten Götter ihr Volk am liebsten: glücklich.
Die Burschen und Mädchen zündeten die Heureifen an und ließen sie ins Tal rollen. Es war ein freudiges und übermütiges Singen und Lachen. Es donnerte das Johlen und Gelächter durch die Wälder der Moosalb.
Keuchend hasteten sie anschließend wieder gen Kuppe, um das Schauspiel zu wiederholen. Folkmar hatte das Ritual dreimal durchgeführt. Doch nun lag er erschöpft bei einer Buche am Fuß des Donarberges und schnaufte.
Da schleppte sich ein Mädchen in seine Richtung.
„Auch müde?“, fragte der junge Kerl.
„Nein! Ich bin doch kein Kind! Du bist doch der Jungreimaring, oder?“
„Ja, gehen wir hoch?“
So stiegen sie zusammen wieder auf den Berg. Folkmar riss sich zusammen und verbarg seine Erschöpfung und Müdigkeit. Er schätzte das Mädchen auf 12 Sommer und 12 Winter. Sie war sehr schön. Ein seltsames Gefühl schlich sich in sein Herz. Auf der Kuppe wurde noch kräftig gefeiert wurde. Dass sich ein Gewitter mit kräftigem Donnern ankündigte, störte sie nicht, im Gegenteil. Sie freuten sich, dass Donar mitfeiern wollte.
Es war schon spät in der Nacht und viele der Kleinsten schliefen bereits, als die Burschen und Mädels, Bäuerinnen und Bauern des Albgaus den Sprung wagten. Es war der Sprung über die Glut des Feuers. Wer vorhatte zu heiraten und wollte, dass es eine fruchtbare und glückliche Ehe werde, sprang gemeinsam mit der versprochenen Person. Vithimar sprang mit Frohild, Tochter von Reinswsind und Geiserich. Die Hochzeit sollte im Herbst stattfinden. Es sprangen auch verheiratete und ledige Menschen um des Glückes willen. Auch Folkmar sprang. Dabei kniff er die Augen fest zu und biss sich fest auf die Unterlippe.
Ärgerlich wurde es, als die ganzen Saufköpfe, die nicht einmal in der Lage waren zu laufen, springen wollten. Es war eine Mühe, sie vom Springen abzuhalten. Einer von ihnen war der Ettlinger Dietmar. Eigentlich ein wirklich toller Kerl, doch die Trunkenheit machte ihn zum Dorfdeppen. Er war auch ein guter Handwerker, doch treulos war sein Herz. Machte er doch seine Geschäfte gleichgültig mit Franken, Alemannen, Römlingen, Christen. Für Dietmar galt nur der Solidi.
Nun trieben die Sippen ihre Farren, Bullen und Kühe durch die Glut. Dies versprach ebenfalls Fruchtbarkeit und Gesundheit. Der Sonnenwendrauch war sehr heilsam. Wie warm und wohl wurde es jedem ums Herz. Die ungeduldige Freude auf den Sommer, der Stolz auf das Erschaffene und das Wissen, dass ihre Götter sie schützten, ließen sie zufrieden und zuversichtlich lächeln. Mit dieser Wärme in der Brust feierten die Frauen und Männer des Albgaus die ganze Nacht durch. Es wurde neun Tage und neun Nächte gefeiert. Wettkämpfe, Gelage, Tanz und Lieder erfüllten den Donarsberg mit Leben. In der zehnten Nacht legten sie sich erschöpft und zufrieden zum Schlaf nieder.
Als der kühle Morgen sie unfreundlich wach rüttelte, lag ein grauer Regenschleier über dem Schwarzwald. Jede Sippe sammelte ihre Mitglieder, ihr Vieh und einen Haufen Glut in einem Birkenrindeneimer und machte sich auf den Heimweg. Dabei zürnten und schimpften die Frauen mit ihren wehleidigen Gatten, die über Übelkeit, Müdigkeit oder Kopfweh klagten. Doch es half alles nichts, der Sommer hatte begonnen und die Arbeit rief.
IV. Folkwart
Es vergingen der Brachet und der Heuert, und so schnell, wie sie vergangen waren, verflogen Ernting und Scheiding. Die viele Arbeit im Hof wollte nicht aufhören. Trotzdem war die Aufregung groß. Eine Hochzeit stand bevor. Vithimar sollte die Frohild heiraten. Da er der Älteste war, erbte er den Hof nach alemannischem Recht nicht. Doch wollte er einen bauen, ganz nahe beim Reimarhof. Er plante seinen Hof nahe bei der heiligen Quelle der Moosalb. Vithimar verstand sich als Bewacher des Heiligtums, da Botschaften aus Norden und Süden sie erreichten, Christenpriester hätten heilige Weihestätten zerstört und entweiht.
Es rauschten die Blätter in den goldenen Aspen, die Luft war voller Mücken und federleichten Samen, mit denen der Wind seine Spiellust auslebte. Sobald er etwas rauer wurde, blies er die gelben und braunen Blätter von den Buchen herab. Die Schlehe und der Hag hingen schwer und täglich zogen laut polternd Enten und Wildgänse gen Süden. Spinnweben überzogen die Wiesen des Albgaus und der Frühnebel trennte sich nur noch ungern von den Niederungen. Das Vieh war feierlich in die Ställe getrieben worden und das Herbstopfer war schon erledigt.
Jetzt stand die Hochzeit bevor und unter dem Walmdach des Reimarhofes gab es viel Aufregung. Erntrud und Waltraud webten und nähten eine, für ihre Verhältnisse, recht prachtvolle Tracht. Sie steckten all ihren Fleiß und ihr Können hinein. Und diese wurden auch belohnt, es wurde eine sehr schöne Hochzeit. Folkwart war der Lader und erfüllte diese Aufgabe recht gut. Bewaffnet mit einem Heidekrautzweig zog er von Hof zu Hof.
Zur Hochzeit waren sie alle da. Rüdiger, Sigwart, die vom Holchingerhof, die vom Berchtingerhof und alle nahen und entfernten Reimaringer. Frohilds Verwandtschaft war auch ziemlich zahlreich. Es war Freitag und da es stürmte, wurde im Haus geheiratet. Eng war es, doch glückliche und frohe Menschen stört so etwas nicht. Sie aßen kräftig und jeder schenkte dem Paar etwas Nützliches. Nachdem jeder ihnen viel Segen und Fruchtbarkeit gewünscht hatte, feierte man noch drei Tage. Die Wache vor der Brautkammer hielt Onkel Theudo. Er war aus Überlingen gekommen, wo er Gefolgsmann des Herzogs war. Auf den eigenen Hof mussten Frohild und Vithimar noch warten. Es vergingen das Julfest und das Donarfest, und als der Lenz wieder den Winter verjagte und die Priester vom Steinkreis des Ziuberges an den Sternen den richtigen Zeitpunkt erkannten, begann Vithimar den Wald zu roden. All die Bauern des Tales und der Berge halfen ihm, seinen Hof zu bauen. Er wurde sehr schön und noch schöner wurde er, nachdem Vithimar die Wände und Balken bemalt und geschmückt hatte.
Wie schien doch die Sonne über der Reimarsippe. Doch der Schein trügte. Dunkle, bedrohliche Wolken zogen bereits herauf.
Einige Jahre später kam Folkwart. Er sah müde aus und auch sein Pferd Draupi wirkte erschöpft. Der Bruder Sigmars sprach nicht viel. Er sagte, er könne nicht lang bleiben, was Folkmar traurig stimmte. Dies entging natürlich dem Wolf von Folkwart nicht. So meinte er, etwas Zeit hätte man doch, und so beschloss er, den Erben des Hofes für einen Tag zu entführen. Dies war Sigmar nicht recht, da gerade Haferernte war, doch Folkwart ließ nicht mit sich verhandeln. Der Junge musste mit. So ritten sie an den Wäldern des Bärenbachtales gen Albtal herunter. Die Sonne strahlte und lahme Wolken wanderten durch Zius Reich.
„Wo führst du mich hin?“
„Dort ist es schön. Da sind wir den Göttern sehr nahe.“
Ein Schwarzspecht flog laut schmetternd aus einer alten Eibe und über ihnen flog ein Falke. Sehnsuchtsvoll sah ihn Folkmar an. Wie gern wäre er doch wie dieser Falke, frei und ungebunden, ohne Sorgen und dem Himmel so nahe. Seine Augen folgten den anmutigen Kreisen des Raubvogels. Wie glücklich war er doch gerade. Mit seinem Onkel einfach so fortreiten. „Da ist unser Ziel.“ Folkwarts raue Stimme riss den Jungen aus seinen Träumen. Es war der Falkenstein. Voller Ehrfurcht hatte er immer vom Tale hinauf gesehen. Ja, hier war der Thron der Götter. Die Felsen ragten mächtig aus dem Meer aus Buchen, Eichen, Ahorn und Ebereschen. Unbezwingbar sahen sie aus, von Riesenhand gebaut. Sie erschienen wie versteinerte, schlafende Riesen.
„Was stehst du wie angewurzelt da? Du bist doch kein Teil des Felsens! Komm und staune.“
Ja, staunen konnte man. Weit ins Tal über unendliche Wälder blickte man. Folkmar spürte den göttlichen Atem, der hier wehte.
„Es ist wunderbar.“ Vor lauter Glück kamen ihm diese Worte kaum über die Lippen. Sein Onkel antwortete gedankenversunken ins Land blickend:
„Ja, das ist es.“
Nachdem sie lange schweigend die Sonne genossen und viele Heidelbeeren gegessen hatten, bemerkte Folkmar staunend: „Wie viel du kennst!“
„Oh, Bub, das ist gar nichts! Ich war schon viel weiter! Ich war schon in Gegenden, die noch nie ein Mensch betreten hat. Unendlich tiefe Moore, gefährliche Wälder voller seltsamer Wesen.“
„Wie gern würde ich dich begleiten, Onkel. Doch Vater schilt schon, wenn ich nur die Wälder um den Hof und den Bärenstein erkunde. Er sieht es nicht gerne, wenn der Erbe des Reimarhofes zum Streuner und Lungerer wird.“ Der Mann klopfte dem Jungen auf den Rücken.
„Du kommst von der gleichen Seite wie Ich! Ich glaube, du hättest mein Sohn werden sollen!“ Da lächelte der Sigmarsohn.
„Dein Vater hat ein gutes Herz“, sprach sein Onkel weiter. „Er weiß nur nicht, wie er es zeigen soll.“
„Erzähle mir von den Orten, an denen du warst.“
Der Schmied holte tief Luft und begann, von weiten Ländern, tiefen Wäldern und sogar vom Meer zu erzählen, das so groß sein soll, dass man das andere Ufer nicht sehen kann! Große Städte nannte er, hohe Berge, ja sogar so hoch, dass der Schnee darauf liegen blieb. Folkmar träumte und flog so über viele Länder. Dann erzählte sein Onkel von Wäldern jenseits der Murg, die nach den Kelten nie wieder jemand betreten hatte. Sie seien unendlich tief, dunkel, voller tückischer Moore und weiter Heiden. Als er fertig war, flehte ihn der Junge an, er solle ihn mitnehmen, er wolle gar nicht den Hof übernehmen. Doch der gutmütige Onkel winkte ab.
Rot waren die von Sunna gesandten Strahlen, als sie wieder heimritten und als sie ankamen, blinkte der Abendstern hell. „Großer Mann, ich werde dich mal mitnehmen, das verspreche ich dir; doch du gehörst hier her. Heil dir!“
So ritt er von dannen. Lang blickte Folkmar ihm nach, obwohl es dunkel war.
Es kam der Altweibersommer und die Hagenhurste hingen schwer mit Früchten. Im Moor glühte die Preiselbeere und Tausende von Mücken schwirrten im Lichte der sanften Nachmittage. Gern hätte Folkmar diese wunderschöne Zeit genossen, doch es war eine arbeitsame Zeit. Das Heu musste für den Winter vorbereitet, Brennholz musste eingefahren und das Dach musste geflickt werden. Es waren die Tage, an denen das Heidekraut die Bienen mit seinem Duft nicht mehr betörte, als Folkwart wiederkam.
Als sie am Abend alle am Tisch saßen und die letzten Brombeeren des Jahres genossen und Folkwart wieder viel erzählt hatte, sagte dieser zu seinem Neffen:
„Ich halte mein Versprechen: Sobald das Dach fertig ist, gehen wir zusammen.“
„Wo geht ihr hin?“
„Ich zeige dem Kerle das Land, sonst sieht er ja gar nichts im
Leben!“
„Blödsinn! Verdreh’ mir dem Bub den Kopf nicht!“
„Du bist ein sturer Bock! Jetzt lass doch dem Kerle auch mal eine Freude.“
Sie stritten noch lange Zeit, doch schließlich griff Waltraud ein. Allein ihre sanfte Stimme kühlte die Gemüter der Brüder. Sigmar ging schlafen. Müde sah er aus. Nicht nur die Müdigkeit, die einen des Nachts befällt, nein, wirklich müde sah er aus. Sein Haar wurde von vielen grauen Büscheln durchkreuzt, seine Augen lagen über ledrigen Falten und seine Wangen strahlten nicht mehr so, wie sie es einst getan hatten. Doch immer als Erntrud im Ehelager leise fragte, was mit ihm los sei, winkte er grob ab. Es war nun mal seine Art. Oft saß er von Mane beleuchtet unter der Sippeneiche und fragte sich, ob er nicht zu hart mit seiner Familie umgehe. An diesem Abend ging er aber gleich schlafen.
Die Anderen saßen noch in der Halle und zur Verwunderung Aller nahm Folkwart die alte Leier, die am Balken über der Truhe hing und ließ seine schwieligen Schmiedhände darüber gleiten. Nachdem er sie gestimmt hatte, entlockte er ihr die schönesten Akkorde. Nun war Folkmar noch besessener von seinem Onkel. Er konnte Leier spielen! Bald begann Waltraud ein uraltes Lied zu singen. Wie geheimnisvoll und doch so warm wirkte das runzlige, ledrige Gesicht der Großmutter im Flackern des Feuers. Sie sang vom Erdenkind Ziu, welches weder Frau noch Mann war. Dieses gebar Mannus und der war der Vater von drei Menschengeschlechtern:
Die Ingweinger, Erminunger und Istaevinger. Wie oft hatten sie schon dieses Lied gehört, doch liebten sie es sehr. „Wo hast du Leier spielen gelernt?“, fragte Gertrud, die ältere Schwester von Folkmar.
„Oh, ich war mit einem jungen Mann unterwegs. Er kam aus einer weiten Stadt im Norden, die man Birka nennt. Er war ein sehr junger Schmied und wollte, dass ich ihm ein wenig beibringe. So gab ich meine Griffe und Geschicklichkeit preis, dafür zeigte er mir das Leierspiel. Jetzt ist er bestimmt ein wohlbekannter Schmied.“ Die Zeit schien für Folkmar nicht zu vergehen. Wie sehr wartete er auf den Tag, an dem das Dach endlich gedeckt war. Dieser Drang war es, der den Jungen so flink und geschickt arbeiten ließ, dass selbst sein Vater ihn lobte. Ja, das waren die Augenblicke, in denen sie sich am nächsten waren. Wenn sie mitten in der Arbeit steckten, kannten sie weder Sturheit noch Starrsinn. Nun war das Dach endlich neu gedeckt und die Halme strahlten, als ob sie Sunna selber gesendet hätte. Hastig packte der Sigmarsohn Schinken, Käse und Brot in einen Sack und lief zu seinem Onkel. Aber Folkwart war sehr müde und verschob die Abreise auf den nächsten Morgen. Traurig schlenderte Folkmar zum Stall. Dort saß er viele Stunden zwischen den zufriedenen Rindern und sann nach.
Es war soweit! Zwar war es ein grauer Morgen und Wolken verschluckten die Kuppen, doch dies ließ die Jungen nicht verzagen. Sein alter Onkel wollte ihn nicht enttäuschen und so ritt er zerknirscht mit. Es wurde kurz im Vithimarhof gegrüßt und man schlug sich nach Südwesten, ins Murgtal, durch. Zum Ärgernis des Schmieds fing es noch an zu regnen; er fluchte und schüttelte seine krausen Haare. Sie durchritten geheimnisvolle Auen am Rande der Murg und es waren einige Stunden vergangen, als Folkwart bei einer alten vermoosten Weide sein Pferd zügelte.
„Hier müssen wir über die Murg. Somit verlassen wir das fränkische Ufgau und betreten das alemannische Gau Mortenau. Hier herrscht der Franke nur in seinen Träumereien. Das
Volk ist noch wirklich frei!“
„Sind wir denn nicht frei?“, fragte der Junge.
„Nein. Nicht mehr.“ – enttäuscht klang die Stimme Folkwarts. „Wir waren es einst, bis der Franke kam. Ist dir nicht aufgefallen, daß ihr an bestimmte Tage nicht schaffen dürft?“
„Wir dürfen Sonntags nicht arbeiten.“
„Wieso?“
„Ich weiß nicht.“
„Siehst du? Es ist so, weil der Frankenpriester es so will. Weil sein Glaube es den Römern und Franken vorschreibt.“
„Was ist das für ein Glaube?“
„Dafür bist du noch zu jung. Doch etwas werde ich dir sagen:
Sie beten einen Toten an. Er soll für sein Volk irgendwo gestorben sein.“
„War er ein großer Held?“
„Ich weiß es nicht.“
„Wir verehren ja auch die Geister unserer toten Helden.“ Der Schmied seufzte.
„Komm, reiten wir über die Murg.“
Die großen Alemannenrösser durchquerten den wilden, steinigen Fluss ohne größere Anstrengung. Der Regen hatte nachgelassen. Nur noch die Bäume befreiten sich von der nassen Last.
„War der Christenpriester, dieser Lucius, noch nicht bei euch?“, fragte Folkwart, um das Gespräch wieder aufzunehmen.
„Nein, noch nicht.“
„Der versucht es erst mal im Tal, da ist es einfacher.“ Sein Onkel schien diese Worte eher für sich gemurmelt zu haben. Der Junge hatte noch viele Fragen, die Folkwart nur ungern beantwortete. Doch schließlich wurde er sehr still. Die Nachmittagssonne durchbrach die Wolken und sandte rote, gerade Strahlen in alle Himmelsrichtungen. Aber nicht dies ließ die Männer verstummen. Vor sich sahen sie, gleich einer dunklen, schweigenden Mauer, die Berge des Westschwarzwaldes. Wie ein unüberwindbares Hindernis ragten die felsigen Anhöhen in die Wolken.
Einige Wolkenfetzen zogen verwirrt durch die Wipfel der Tannen, Buchen und Fichten. Wie der Rücken eines uralten Riesen, der bis zur Götterdämmerung schlief, erschien dieses Gebirge. Die Hengste trotteten auf die Berge zu. Ehrfürchtig schwiegen die beiden. Große Felswände mit kleinen Wasserfällen ragten aus dem Waldmeer. Dem Jungen lief es eiskalt über den Rücken. Eine Mischung aus Furcht vor all den unbekannten Wesen, die da drin hausten, Ehrfurcht und Neugier packte ihn.
Mehr, noch mehr!, dachte er. In der Ferne heulte ein Wolf.
„Ja, hier ist er noch sicher.“
Aus seinen Gedanken herausgerissen fragte Folkmar:
„Wer?“
„Der Wolf.“
„Wieso?“
„Ich habe Franken gesehen, die haben Dutzende und noch mehr getötet, nur weil sie in ihm ein böses Tier sehen. Nur weil er Wodes Begleiter ist.“
„Nicht um des Pelzes willen? Oder um ihre Herden zu schützen?“
„Nein. Es waren Krieger, keine Hirten. Kein Jägerehrgeiz trieb sie. Es war nur der Hass.“
Der Wald schluckte sie und sie blickten tief in seine Eingeweide hinein. Entlang eines felsigen Flüsschens stiegen sie gen Anhöhe. Auerochsenfährten durchkreuzten ihren Weg. Ein tiefgrüner Teppich aus Moos, Frauenfarn, Rippenfarn, Heidelbeerstauden und Preiselbeerstauden vermummte den Boden. Graumeisen sangen laut und flatterten wild umher. In der Ferne rief der Habicht und ein Specht machte sich lautstark an sein Handwerk.
Die Sonne sandte ihre Strahlen durch die Nadeln der Bäume. Wie geheimnisvoll wirkte dieser Wald. Folkmar hatte ein mulmiges Gefühl im Bauch. Doch die Schönheit und Pracht raubten ihm schließlich alle Bedenken. Sein Onkel sammelte allerlei Beeren. Er meinte immer nur, das gäbe am Abend ein gutes Vesper.
Der Fluß wurde zum Bach und die letzten Erlen wichen den Birken und Ebereschen. Die Buchen hatten die seltsamsten, bizarrsten Formen. Manchmal glaubte der Junge, Waldschrate im Zwielicht zu erkennen, doch schließlich waren es nur knorrige Buchen und Tannen mit einem Bart aus Flechten und Moos. Als sie am Bach saßen und die Abendsonne, durch das Walddach scheinend, ihre Leiber etwas erwärmte, wurde Folkmar ganz schläfrig. Auch Folkwart schien in die Traumwelt zu entschwinden. Im Halbschlaf hörte Folkmar am Oberlauf des Baches ein Wimmern. Schlief er? Träumte er? Oder hörte er es wirklich? Folkmar wollte aufstehen und nachschauen, doch sein Onkel, der auch wach war, hielt ihn mit der Hand am Schwert zurück. Zu viele hinterlistige Wesen lockten auf diese Art und Weise.
Er schlich sich hinter eine dichte, junge Tanne und spähte. Da sah Folkmar, wie er sein Schwert einsteckte und zur Stelle lief. Natürlich lief der Junge ihm nach. Da wurden seine jungen Augen sehr groß.
Ein Zwerg saß am Bach und wimmerte. Er war gerade so groß wie ein Bein von Folkmar! Folkwart beugte sich zu ihm herab.
„Was hast du?“
Mit kleinen Tränchen in den Augen und einem kirschroten Gesicht antwortete der Zwerg:
„Meine Frau liegt im Kindsbett und wird wahrscheinlich sterben. Bitte helft mir!“
Die zwei Menschen blickten sich an. Leise fragte Folkmar:
„Kannst du das?“
„Ich war bei jeder eurer Geburten dabei. Ich hoffe, ich habe etwas von Waltraud gelernt.“
So führte der Wicht sie in seine Höhle. Folkmar holte mit einer goldenen Schale Wasser und sein kräftiger Onkel bereitete alles vor. Er musste auf dem Boden sitzen, da die Höhle nur eineinhalb Schritt hoch war.
Die Zwergenfrau war ganz blass und kalter Schweiß rann ihr die Stirn herab. Ihr Gatte hielt ihr die Hand und sprach beruhigende Worte. Folkwart mahnte seinen Neffen zur Eile. Als alles fertig war, drang ein Schrei durch alle Wälder. Die Vögel flogen erschrocken fort und die Hirsche flohen. Ein Kind war geboren.
„Ihr Kindlein.“ Der Mann überreichte den eingewickelten, furchtbar häßlichen Zwergenbalg der Frau, die es dankbar aufnahm und anstrahlte.
Das Gesicht des Zwerges errötete erneut; doch diesmal vor Freude. So wendete er sich lachend an die Menschen und sagte:
„Ihr kamt gerade zum rechten Zeitpunkt und meine Dankbarkeit kennt keine Grenzen. Ich möchte, dass ihr euch irgendetwas aussucht. Nehmt was ihr wollt und seid nicht bescheiden.“
Die Höhle war voll mit Gold. Alle Reichtümer der Welt hätten sie sich aussuchen können.
„Los, nimm dir was, Folkmar.“ Unsicher schaute dieser zu seinem Onkel auf. Der nickte nur.
Genau schaute er sich alles an. Gold, Edelsteine, Schmuck, Waffen und edle Fibeln. Sein wandernder Blick blieb aber bei einer einfachen Leier stehen. Die nahm er. Der Zwerg lächelte zufrieden ob der weisen Wahl:
„Du wirst viel Freude an diesem Instrument haben; die schönsten Töne gibt es von sich. Sie werden in kältesten Zeiten dein Herz erwärmen.“
So verabschiedeten sie sich beide und die Zwerge bedankten sich noch mal herzlich.
Es war dunkel, als Folkmar am Bach aufwachte. Hatte er geträumt? Waren sein Onkel und er gerade bei Zwergen gewesen und hatten bei einer Niederkunft geholfen? Folkwart war wach. Er machte Übungen mit seinem Schwert. Als er seinen Neffen bemerkte, sprach er zu ihm, während er immer wieder die gleichen Bewegungen mit dem Schwert machte: „Ah! Du bist wach! Komm, wir sollten uns ein Nachtlager machen!“
Folkmar wollte seinen Onkel fragen, ob all das wirklich geschehen war, doch traute er sich nicht. Was war, wenn er den Streichen eines Nachtalps zum Opfer gefallen und alles nicht im Lichte geschehen war, sondern nur in seiner Traumwelt? Folkwart würde ihn zu Recht auslachen?
Folkwart schlenderte zu seinem Ross und nahm Sattel und Trense herunter. Er richtete für beide ein Nachtlager. Seine Satteltaschen, Waffen und den Sattel legte er vorsichtig unter eine dichte Stechpalme.
„Was hast du in der einen langen Satteltasche?“, fragte Folkmar fröstelnd.
„Oh! Das ist nur eine Leier! Eine Leier aus Schwarzalbenheim! Ha, ha!“
Eine Zwergenleier? War also alles wahr?
„Willst du sie haben?“, fragte Folkwart. „Ich bin kein guter Sänger. Die Frouwen meinen immer, wenn ich singe, würden sie lieber in den Stall gehen und den Böcken zuhören! Ha, ha!“
Mit leuchtenden Augen nickte Folkmar.
„Hier, mein Bub!“ Der Mann übergab Leier samt Tasche seinem Neffen. Eine Leier! Eine Zwergenleier!
„Aber Vater wird schelten!“
„Ach! Lass deinen lieben Vater seinen Acker machen! Bruder hat nie was anderes außer Vieh und Feld im Sinn gehabt!“ Vorsichtig und voller Ehrfurcht legte er die Leier wieder an den geschützten Platz unter der Stechpalme.
Kurzerhand bereiteten beide ein Nachtlager aus Adlerfarn, Moos und Fellen. Durch die Tannenkronen über ihnen glommen die Sterne. Lange und still schauten beide in den Nachthimmel.
Plötzlich zeichnete der Onkel mit seinem Zeigefinger etwas in die Luft. Auf keine Frage wartend sagte er:
„Ansuz.“
Folkmar wurde sofort hellwach.
„Du kennst die Runen?!“
Wie selbstverständlich bekräftigte der Alte:
„Ja.“
Leise seinen Onkel musternd fragte der Junge, woher er sie kennen würde.
„Waltraud lehrte sie mich. Dein Vater hatte nie ein Sinn dafür. Und ich werde sie dich lehren, wenn es an der Zeit ist.“ „Bitte!“ Vor Aufregung konnte Folkmar keinen ganzen Satz hervorbringen.
„Dieses Wissen ist wie unsere Götter dem Untergang geweiht. Überall im Land machen die Franken die Runen zu Teufelszeichen oder rauben sie uns, indem sie mit ihnen gegen Wode, Donar, Frija und Ziu wettern.“
Redend stand er auf und fing an Holz zu sammeln. Er erzählte vom Ursprung der Runen, von Wotan, dem Gott der Runen, und von deren Zauberwirkung. Hastig befahl er dem müden Burschen, ein Feuer zu machen. Was hatte sein Onkel vor? fragte sich Folkmar. Folkwart verschwand in der Dunkelheit. Bald leuchtete Folkmars Gesicht warm und rötlich. Da erschien der Reimaring Folkwart. Er verbarg etwas in seiner Hand. Seine Züge flackerten unheimlich, seine Augen glühten stärker als das Feuer.
„Zieh dich aus.“
Folkmar reagierte nicht. Er schaute etwas verwirrt. Doch sein Onkel machte es ihm vor und sein muskulöser, behaarter und von Narben bedeckter Körper kam zum Vorschein. Eine große runde Narbe zierte seine linke Brust.
Zögernd zog sich auch der Junge aus. Etwas schämte er sich vor seinem Onkel. Dieser hatte einen heißen Stein auf seinen Sax genommen. Er nahm sein Horn, füllte es mit Wasser und warf den heißen Stein hinein. In das zischende, dampfende Wasser ließ er kleine rote Fetzen fallen.
„Deine Kraft, deinen Mut ziehst du aus Uruz.“ Er zeichnete die Rune „U“ in die Luft.
„Uruz ist die Erde, der Auerochse. Ihre Kraft brauchst du im Kampf.“
So trank er und gab sein Horn an seinen Neffen weiter. Dieser trank ganz gespannt, doch merkte er enttäuscht, dass es nur Wasser war. Aber da war noch ein anderer Geschmack. Es schmeckte ein bisschen süßlich. Und dann schluckte er einen dieser roten Krümel.
„Gebo – „G“ – ist Dank und Opfer. Alles was du nimmst, musst du geben. Heil dem Geber! Hagalaz – „H“ – zeichne auf kranke Brust, die soll sie heilen. Doch Hollas Rune bringt auch Tod und Zerstörung. Sie ist der vernichtende Hagel. Der
Tod der Sippe, des Viehs, das verhungert.“