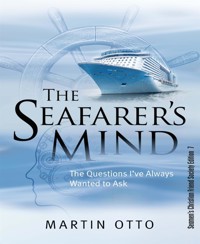Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Martin Otto hat einen Begleiter, er nennt ihn beinahe liebevoll seinen Tiger. Doch handelt es sich dabei nicht um ein Tier. Herzrasen, Atemnot, Schweißausbrüche und das Gefühl zu sterben, das alles ist Martins Tiger: eine Angststörung. "Der Tiger im Nacken" gibt romanhaft Einblick in das Leben mit einer Angststörung. Der Autor erzählt in einzelnen Episoden, wie sich die Angststörung in seiner Kindheit entwickelte, um ihn fortan zu begleiten. Dabei überspannt er einen Zeitraum von beinahe dreißig Jahren – von 1975 bis 2004. Eindrucksvoll, informativ, geistreich und mit jeder Menge Humor gewährt der Autor dieses autobiografischen Erfahrungsberichts Einblick in sein Leben mit Angst- und Panikattacken. Ein Thema, dass Millionen Menschen betrifft. Dabei nehmen Angststörungen ganz unterschiedliche Ausprägungen an: vom leicht erschwerten Alltag bis hin zur völligen Unfähigkeit sein Leben zu meistern und alles zu verlieren – Freunde, Familie und Beruf. Eine heimtückische Erkrankung, die auch nahestehende Menschen oft nicht erkennen.Martin Otto versteht sein Buch nicht als Ratgeber, sondern möchte vielmehr Angehörigen, Freunden und Interessierten helfen, ein besseres Verständnis für die Lebenswelt Betroffener zu entwickeln.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 264
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Martin Otto
Der Tiger im Nacken: Mein Leben mit Angst und Panik
Ein persönlicher Bericht
mit Annette Piechutta
Saga
Der Tiger im Nacken: Mein Leben mit Angst und Panik
Entstanden mit Unterstützung von: Ihre Ghostwriterin / Annette Piechutta, Petersberg, www.ghostwriterin.com
Um ein Nachwort des Autors erweiterte Auflage.
Coverbild/Illustration: Shutterstock
Copyright © 2008, 2022 Martin Otto und SAGA Egmont
Alle Rechte vorbehalten
ISBN: 9788728388105
1. E-Book-Ausgabe
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit der Zustimmung des Verlags gestattet.
www.sagaegmont.com
Saga ist Teil der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt.
Für Tanja, die ich bedingungslos liebe
Danke an Tanja, Maximilian, Sophia, Theresa, Andreas, Sabine, Kathrin, Elke, Sandra und Annette.
Entstanden mit Unterstützung von: Ihre Ghostwriterin
Annette Piechutta, Petersberg, www.ghostwriterin.com
Vorwort
von Prof. Dr. med. B. Bogerts
Beeinträchtigungen durch starke, nicht mehr kontrollierbare Angstzustände stellen weltweit die häufigsten psychischen Störungen überhaupt dar. Angstsymptome und die oft damit einhergehenden körperlichen Begleiterscheinungen wie Herzrasen, Atemnot, Schweißausbruch, Schwächegefühl im Körper, verbunden mit dem Gefühl zu sterben, sind Angehörigen, Freunden und Betroffenen selbst oft unerklärbar; Umstehende reagieren verständnislos. Selbst viele Psychologen und Ärzte sind unzureichend mit der Symptomatik vertraut, ordnen die mitunter dramatische Symptomatik solcher Patienten diagnostisch falsch ein.
Wie bei allen psychischen Störungen, so sind auch bei Angsterkrankungen die Betroffenen einer immer noch ausgeprägten Stigmatisierung ausgesetzt. Die Patienten werden auch heute noch nicht selten als »verrückt« ausgegrenzt, weshalb sie ihre Problematik verheimlichen. Dabei haben Angstkranke keinerlei Beeinträchtigungen von Intelligenz und Auffassungsgabe. Sie beobachten ihre Umwelt vielfach wacher und urteilssicherer als der Durchschnittsmensch.
Als Betroffener schildert Martin Otto in äußerst anschaulicher und geistreicher Form, wie sich die Angst aus frühen kindlichen Erlebnissen her entwickelte, bei einer ähnlichen Symptomatik seines Vaters und einer angstfördernden Mentalität von Großmutter und Mutter. Die Entwicklung von Angstanfällen, der Kampf gegen das im Innersten der Emotionen immer wieder angreifende Ungetüm der Angst, die vielfältigen Situationen, in denen dieser Tiger attackiert, Siege und Niederlagen wie auch Erfahrungen in Kliniken und Therapien werden vor dem Hintergrund der sozialen und politischen Gegebenheiten von dem 42-jährigen Autor in Form der biographischen Eigenanalyse brillant und äußerst informativ dargestellt.
Bei der Lektüre wird klar, was Angst für die Betroffenen bedeutet, wie sie erlebt wird, wie man mit ihr umgehen kann und dabei durchaus zu einer erfolgreichen Lebensführung fähig bleibt. Den Erkenntnissen, die den Betroffenen durch das Buch vermittelt werden, kann auch aus fachärztlicher Sicht eine erhebliche therapeutische Wirksamkeit zugesprochen werden, insofern sie das Krankheitsverständnis verbessern.
Prof. Dr. med. B. Bogerts
Direktor der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatische Medizin der Universität Magdeburg
Schon wieder so ein grauer Tag
War es überhaupt schon Tag? Ein heftiger Regen schlug gegen die Scheiben und hüllte wie ein undurchdringliches Spinngewebe das Zimmer ein.
Ich hörte Großmutter mit eiligen Schritten durch den Flur laufen. Es roch nach Kaffee, frischen Brötchen und dem abgestandenen Zigarrenrauch meines Großvaters.
Ich entschloss mich nur schwer, aufzustehen. Das Gewaltsame meines Traumes erdrückte noch immer meine Gedanken. Mit offenen Augen, suchend, lugte ich unter der Bettdecke hervor. Keine Ungeheuer, keine dunklen Gestalten in Sicht. Die Tür wurde aufgerissen. Erschrocken kniff ich meine Augen zusammen. Großmutter murmelte einen Morgengruß in ihrem besorgten Ton, dann riss sie mir die Bettdecke weg.
Ich war es gewohnt, bei Regen nicht draußen zu spielen, den Keller nicht alleine zu durchstöbern und mit dem Fahrrad nur bis zur nächsten Kreuzung fahren zu dürfen. Ich bekam keine Rollschuhe, weil ich fallen, und keine Schlittschuhe, weil ich mit Sicherheit stürzen würde. Ich durfte nicht in den Kindergarten, weil Jungs mich dort verprügeln und Autos mich auf dem Weg dorthin überfahren könnten. Der schreckliche Gedanke, dass ich auch diesen Tag zu Hause verbringen müsste, beschlich mich. »Oma, darf ich ...?«, fragte ich vorsichtig und schielte nach meiner Wollmütze, die an einem Haken hing.
Großmutter legte die Hand auf meine schmalen Schultern, neigte ihren Kopf mit dem ergrauten Haar ein wenig zur Seite und blickte mich scharf an. »Es wird bestimmt gleich wieder regnen.«
Ich setzte ein harmloses Lächeln auf und betrachtete durch die geöffnete Haustür mit einem mulmigen und gleichzeitig sehnsüchtigen Gefühl den sich verdunkelnden Himmel.
»Na gut«, seufzte sie, »aber geh nicht zu weit weg bei diesem Wetter. Nur bis zum ersten Feldweg. Und knöpf deine Jacke zu.« Sie blickte mich noch immer an, doch in ihren durchdringenden Blick hatte sich eine scheue Zärtlichkeit gelegt. Sie nahm meine Mütze und zog sie mir an. »Sonst ergeht es dir wie dem Rotkäppchen mit dem Wolf.«
Unbehaglich trat ich von einem Fuß auf den anderen. »Aber das Rotkäppchen ist doch in den Wald gegangen, ich will nur ...«
Großmutter zog ihre Augenbrauen in die Höhe. »Du weißt, was mit Kindern passiert, die nicht vorsichtig sind. Das Rotkäppchen wurde vom Wolf gefressen, weil es zu gutgläubig war.«
Einen Moment überlegte ich, ob ich nicht lieber zu Hause bleiben und mit Legosteinen spielen sollte. Dann knöpfte ich meine Jacke zu und ging steifbeinig hinaus.
Draußen im Garten wehte mir ein lebhafter Wind entgegen. Ich spürte deutlich, wie er zu kleinen Stößen ausholte und mich bald von hinten, bald von der Seite anfiel. Mir hätte das Spiel vielleicht gefallen, wenn ich nicht gewusst hätte, dass mich Großmutters besorgte Augen unverwandt durch das matte Glas der Sprossenfenster verfolgten.
Vor dem Nachbarhaus hörte ich eine schrille, hüpfende Musik. Hanna spielte Mundharmonika. Auf der Mauer saßen ihre beiden Brüder, trommelten den Takt auf den Knien und sangen mit falschen Tönen in den Wind.
Hanna setzte für einen Moment ihre Mundharmonika ab und winkte mir zu: »Endlich, wo steckst du denn?«
»Der darf doch nix«, rief einer ihrer Brüder. »Der ist doch ein verhätscheltes Oma-Kind.«
Der andere lachte und sprang von der Mauer. »Kommt, wir fahren an den Froschteich.« Leichtfüßig sprang er auf sein Rad.
Ich blieb wie angewurzelt stehen. Der Froschteich lag mindestens drei Kilometer entfernt.
Hanna sah zu mir hin. »Fürchtest du dich etwa? Wenn es gewittern würde, wäre das doch richtig doll!«
»Nein«, antwortete ich kleinlaut, »ich fürchte mich nicht.« Doch die Finsternis braute sich über mir zusammen, und ich war mir sicher, bereits ein entferntes Donnern zu hören.
Ich holte mein Kinderfahrrad aus dem Schuppen und fuhr Hanna und ihren Brüdern hinterher. Während ich immer wieder in den Himmel schaute, lauschte ich meinen eigenen quälenden Gedanken: Hatte mich Oma nicht vor dicken großen Wolken gewarnt? Hätte ich nicht schon vorne, am Feldweg, umdrehen und zurückfahren müssen?
»Komm, Oma-Kind, komm«, rief eine Jungenstimme, bereits im mannshohen Dickicht versteckt.
Hanna wartete am Ufer auf mich. »Hier, zum Fröschefangen.« Sie hielt mir ein schmutziges Einmachglas hin.
Ich ließ mein Rad fallen und nahm das Glas.
Die Jungs kämpften gegen den Wind, sie überschrien sich und fielen einander ins Wort. Hanna rannte ihnen hinterher. »Wer die meisten Frösche fängt, der bekommt ...« Ihre Worte gingen im Lachen der Brüder unter.
Ich stand unschlüssig da, das Glas in der Hand, konnte kaum einen Ton von mir geben, geschweige denn sprechen. Tränen ängstlichen Zorns traten in meine Augen. Ich schaute in den Himmel. Gleich würden sich die dunklen Regenwolken entladen. Und musste man bei Regen nicht zu Hause sein, an einem schützenden Ort?
Hanna wisperte mir zu, dass ich mich nicht so anstellen soll. Sie hatte einen Frosch gefangen, den sie mir vor die Nase hielt.
»Ich hab heute keine Lust«, zischte ich hitzig, ließ das Glas fallen und fuhr mit dem Fahrrad davon.
Auf halber Strecke begann es zu regnen, und die Angst würgte mich wie ein Schmerz. Gleich würde es blitzen und donnern, gleich würde die Wolke über mir ihre Arme nach mir ausstrecken. Gleich würde ... Der Wind wirbelte stoßweise um mich herum. Die Wolke, dachte ich panisch, die Wolke. Meine Augen stachen vor Tränen, und ich schrie laut vor Angst. Warum sah ich Omas Haus nicht? Warum war das Haus so weit entfernt? Der Regen wurde heftiger, und immer wieder war mir, als würde die Wolke nach mir greifen, als würden nur noch Millimeter fehlen, bis sie mich als ihre Beute fing.
Endlich das Haus. Tränennass, nach Luft ringend und panisch schreiend rettete ich mich in die Diele. Großmutter kam aus dem Wohnzimmer gestürzt: »Hab ich dir nicht gesagt, dass die Geister in der Wolke nach kleinen Jungs greifen, wenn sie bei so einem Wetter nicht zu Hause bleiben?«
Ich zitterte, schluchzte, ich konnte nichts sagen.
Tante Irmgard, die mit Onkel Walter zu Besuch war, kam lachend auf mich zu. Sie stellte sich in den Türrahmen, und ihr Lachen steigerte sich zu einer hysterischen Freude. »Walter«, rief sie nach hinten, »guck dir mal den Kleinen an.« Sie prustete, während sie das sagte, amüsierte sich über so viel Angst.
Ich geriet innerlich außer Rand und Band, meine Gefühle spielten verrückt. Die Angst noch immer in mir, und furchtbar wütend, rannte ich ins Wohnzimmer, schmiss mich auf einen Hocker.
»Gott sei Dank ist der Junge jetzt da«, hörte ich Großmutters Stimme, während ich mein Gesicht in das raue Polster grub. »Ich hab’s nicht gern, wenn er draußen ist, und dann noch bei so einem Wetter.«
Die Dunkelheit des nahenden Gewitters hatte sich wie eine dicke kratzige Decke über das kalte Wohnzimmer gelegt.
Noch immer weinerlich, setzte ich mich aufrecht hin, suchte nach einem Taschentuch und schnäuzte meine Nase. Ich schniefte noch ein-, zweimal, dann wurde ich ruhiger.
Plötzlich richteten sich Tante Irmgards Augen auf mich und bekamen einen gespielt aggressiven Ausdruck, als wäre sie ein reißendes Tier, das im finsteren Wald, im modrigen Keller oder in einer Gewitterwolke auf mich lauerte.
Ich konnte mich vor dem furchtbaren Gefühl, das diese Augen in mir auslösten, nur retten, indem ich weinend in den Schoß meiner Großmutter kroch. Dort hoffte ich auf eine tröstende Hand, ein Streicheln. Großmutter rückte steif und unbeholfen von mir ab, nahm meinen Kopf aus ihrem Schoß.
Tante Irmgard tat weiter so, als wäre sie ein reißendes Tier.
Ich starrte sie mit tränennassen Augen an.
»Oh, mein kleiner Martin«, säuselte sie. Nur das Zucken ihres blassen Mundes zeigte, wie amüsiert sie war.
Draußen regnete es noch immer, ein dichter, strammer Regen, der einen dunkelgrauen Vorhang vor das Fenster zog. Großvaters Zigarrenrauch schlängelte sich durchs Zimmer. Tante Irmgard erzählte flüsternd, was wie ein andauerndes Zischen klang. Nur manchmal warf Onkel Walter mit seiner tiefen Stimme etwas ein. Das Interesse an mir war versiegt.
Ich fühlte mich beschämt. Einsam. Alleingelassen.
Tante Irmgard und Onkel Walter diskutierten jetzt mit einer seltsamen Freude. Sie meinten, dass Willy Brandt bei der nächsten Wahl ganz sicher Kanzler werden würde, und Opa zählte akribisch die Punkte auf, die seiner Meinung nach gegen Brandt sprachen.
Großmutter zuckte zusammen. Sie war wohl kurz eingenickt.
Ich hatte mich wieder auf den kleinen Hocker gesetzt, nahm mein Märchenbuch auf die Knie und schlug die Seite vom Rotkäppchen auf. Ich konnte noch nicht lesen, aber ich erkannte Rotkäppchen mit einem Korb in der Hand und den Wolf, der dem Rotkäppchen hinter einem Baum auflauerte.
Der Wind war zu einem Sturm übergegangen und verfing sich irgendwo im Haus. Es klang wie ein trauriges Lachen.
»Ich mache mir immer Sorgen.« Großmutter wiederholte den Satz zum dritten Mal. »Solange Heide und Gerd im Werk arbeiten, habe ich doch gar keine andere Wahl, als mich wochentags um den kleinen Martin zu kümmern. Aber wenn er zur Schule muss, dann wird alles anders.«
Alle schwiegen einen Moment und beobachteten einen Blitz, der vor dem Fenster züngelte.
Ich blickte von meinem Märchenbuch auf und hin zum Fenster. Und wünschte mir nichts sehnlicher als einen Tag mit unbewölktem Himmel und unerbittlichem Sonnenschein. Einen Tag, an dem ich mich vor Licht nicht würde retten können.
»Licht ist gar nicht gut für dich, mein Kind«, sagte Großmutter besorgt und zupfte an den Gardinen. »Du weißt, was der Arzt gesagt hat: kein Fernsehen, kein Licht, nur Ruhe.«
Ich hatte die Röteln, aber vielleicht waren es auch die Masern. Jedenfalls war ich krank – und draußen schien die Sonne.
Mir war zum Heulen – so im Dunkeln. Gleich würde Großmutter mich in dem großen kalten Wohnzimmer alleine zurücklassen. Es lohnte ja nicht, wegen mir den Kachelofen anzumachen. Frierend verkroch ich mich unter der rauen Wolldecke.
Großmutter summte leise ein Lied, um mich zu beruhigen. Aber gleichzeitig drohte sie mir mit seltsamen dunklen Wesen, die auftauchen würden, falls ich nicht brav auf dem Sofa liegen bleiben würde.
Ich blieb auf dem Sofa liegen: brav, einsam, verängstigt.
Träume vom salzigen Meer
Die Wohnung war leer, und ich schlenderte durch die schmucklosen Zimmer. Vater stand wie jeden Tag im WERK am Fließband, und Mutter erledigte Einkäufe. Sie arbeitete nicht mehr, seit ich zur Schule ging. Oma und Opa besuchte ich nur noch in den Ferien, aber die Wohnung meiner Eltern war genauso kalt.
Mutter hatte meine Schwester Susa zum Einkaufen mitgenommen. Susa war dreieinhalb Jahre jünger als ich, doch in meiner Erinnerung taucht sie erst ab meiner Schulzeit auf. Vielleicht, weil sie mir gleichgültig war. Vielleicht auch, weil jeder von uns auf der Suche nach seiner eigenen heilen Welt war. Vater empfand uns als Last, wie er Menschen grundsätzlich als lästig empfand, und Mutter hielt uns für ein notwendiges Übel. Sie konnte sich kein Leben ohne uns vorstellen, aber mit uns schien sie auch nicht besonders glücklich zu sein.
Ich ging über den Flur, weil ich Mutter vor der Tür mit dem Schlüssel hantieren hörte. Sie kam herein, ihr Blick ging zum Küchentisch. »Ist Papa noch nicht da?«
Als ich verneinte, nahm ihr Gesicht einen entspannten Ausdruck an. »Heute abend gibt’s Spaghetti«, sagte sie, »war bei dir alles in Ordnung?«
Sie erwartete keine Antwort, es interessierte sie nicht, was ich machte und mit wem ich spielte. Ich hatte mich draußen herumgetrieben, wie immer, und nickte mit dem Kopf.
Bald zog der Geruch von Tomatensoße durch die Räume, und Mutter goss die Spaghetti ab.
Vater war mit einem flüchtigen Gruß nach Hause gekommen und hatte sich sofort an den Küchentisch gesetzt. Er hielt stumm die Zeitung vor sein Gesicht.
»Nachher gibt’s ’ne neue Sendung im Fernsehen. Dalli-Dalli mit einem Hans Rosenthal.« Mutter erwartete von Vater keine Antwort, und ich erwartete nicht, dass die Spaghetti locker und die Tomatensoße mit Hackfleisch zubereitet war, so wie Oma sie machte.
Susa lachte und patschte mit dem Löffel in ihrer Tomatensoße herum. Ich sah ihr dabei zu, als hätte ich sie noch nie essen sehen.
Mutter räumte ärgerlich den Tisch ab und warf den Rest meiner Spaghetti ins Klo. Vater verdrückte sich ins Wohnzimmer.
»Komm, ich bring dich ins Bett.« Mutter hob Susa aus ihrem Kindersitz.
Ich nahm den schmalen Rücken meiner Mutter wahr, das gleichgültige Klacken ihrer Riemchenschuhe und den monotonen Klang ihrer Stimme, während sie Susa das Rotkäppchen vorlas.
Ich blieb am Küchentisch sitzen, holte ein Heft aus meinem Ranzen und tat so, als wäre ich in meine Hausaufgaben vertieft. Aber es war Mutter egal, was ich in der Schule machte, und Vater meinte, das wäre Mutters Sache, sich um meine Hausaufgaben zu kümmern.
Mutters Augen waren sehr kühl und sehr grau, als sie zurück in die Küche kam. »Schaut er wieder fern? Hat er wieder die Wohnzimmertür verschlossen?«, fragte sie laut und sehr gereizt.
Ich rückte vorsichtig mit dem Stuhl an den Tisch heran. Ich atmete flach und leise, ich war eingeschüchtert, plötzlich. Selbst die Küche schien ihr diesen Ton übel zu nehmen, und ich war mir sicher, dass die helle Küchenfront noch etwas blasser wurde und das grelle Neonlicht sich in ein fades Lila verwandelte.
Ich hätte gerne gesagt: Mutti, das macht doch nichts. Dann bleiben wir in der Küche und spielen Halma. Oder: Mutti, ich bin doch da. Aber die Worte kamen einfach nicht heraus. Das Gefühl würgte mich.
»Auf, auf, morgen musst du wieder früh raus!«, rief sie scharf. Sie stellte ein Quelle-Paket auf den Tisch, das eine Nachbarin für sie angenommen hatte.
Mit gesenktem Kopf räumte ich meine Sachen zusammen, putzte die Zähne und legte mich in das mächtige Ehebett meiner Eltern. Susa schlief in einem Gitterbett vor dem Kleiderschrank.
»Gute Nacht«, sagte Mutter und streckte noch einmal den Kopf in die Schlafzimmertür. Und es klang, als hätte sie gerade eine schwere Last abgegeben.
Ich kletterte auf eine Mauer und stand triumphierend oben. »Feind in Sicht.« Ich schrie, als hätte ich ein Piratenschiff entdeckt. Die Jungs aus dem Nachbarhaus versteckten sich auf mein Kommando hin in Hausfluren und hinter Mülltonnen. Ich wollte nochmals schreien, da sah ich meinen Vater. Er schlängelte sich durch den schmalen Weg, seinen Hut tief in die Stirn gezogen und seinen Blick auf den grauen Asphalt gerichtet. Frau Klose, unsere Nachbarin, kam ihm mit ihrem Hund entgegen. Vater spielte umständlich an seiner Hutkrempe. Dann fasste er sich an die Stirn, als wäre ihm gerade etwas eingefallen, drehte sich abrupt um und lief eilig in entgegengesetzter Richtung davon.
Ich lief auch davon. Nur nicht Vater begegnen. Nur nicht von meinen Spielkameraden auf Vater aufmerksam gemacht werden, der sich immer so merkwürdig verhielt. Der mich nicht sehen, der keinem Nachbarn begegnen und von meinen Freunden nichts wissen wollte, der mit Mutter zu keiner Party, in kein Restaurant und niemals zu Freunden ging, der keine Freunde hatte, jedenfalls hatte uns noch nie jemand besucht.
Ich schlich mich noch eine Weile zwischen den Häuserblocks herum, dann trieb mich der Hunger nach Hause.
Bereits vor der Wohnungstür hörte ich Mutters beißende Stimme: »Was heißt hier, ich bestelle kiloweise Klamotten von Quelle. Das Konto ist leer, weil du alles versoffen hast.«
Ich lehnte mich gegen die Tür und hielt den Atem an, traute mich nicht zu klingeln. Du Feigling, stöhnte ich innerlich, sie streiten doch nur, wie immer. Nach endlosen Minuten drückte ich auf den Klingelknopf.
In der Wohnung roch es nach Bratfett und Haushaltsreiniger. Mutter holte Teller aus dem Schrank und schob dann so wortlos, wie sie mir die Tür geöffnet hatte, ein neues Quelle-Paket unter den Tisch.
Abgesehen von Susa beachtete mich niemand. Ohne mir die Hände zu waschen, setzte ich mich auf die Küchenbank. »Papa, warum hast du kehrtgemacht, vorhin, bei Frau Klose?«
Mutter warf einen prüfenden Blick zu mir und dann zum Kopfende des Tisches. Wahrscheinlich fand sie meine Frage merkwürdig, wir kannten Vater nur so – so zurückweisend, ablehnend.
Vater saß über eine Fernsehzeitung gebeugt und schob sich eine Gabel mit Bratkartoffeln nach der anderen in den Mund. Ich glaube, er wollte sich am liebsten unsichtbar machen.
Mutter rutschte auf ihrem Stuhl hin und her, musterte Vater genervt. Großer Gott, warum spricht er so wenig, warum interessiert er sich nur für das Fernsehprogramm. In ihrer stummen Wut abgesichert, starrte sie ihn jetzt direkt an.
»Dann werd ich mir mal Was bin ich mit dem Robert Lembke ansehen.« Vater legte, ohne zu antworten, die Fernsehzeitung auf den Tisch, ging ins Wohnzimmer und schloss die Tür hinter sich. Er wollte alleine sein, ohne uns.
Ich konnte sehen, wie Mutter ein Kartoffelklumpen im Hals stecken blieb, als sie gerade etwas sagen wollte. Mit panischen Schluckbewegungen bekam sie die Kartoffeln schließlich runter. »Jetzt müssen wir wieder den ganzen Abend hier hocken bleiben.« Ihre Stimme klang rau und kratzig.
Mutter wühlte im Schrank und holte eine Platte von Cliff Richard hervor. »Wir sollten den Plattenspieler in die Küche holen.« Durch ihre Tränen blickte sie aus dem Fenster auf die im Abendlicht verschwimmenden Wäscheleinen. Bald würde der Herbst kommen mit seinen langen, trostlosen Abenden.
Still senkte ich den Kopf über mein Schulheft. Die Kräche meiner Eltern waren leichter zu ertragen, wenn ich an etwas anderes dachte. Als ich kleiner war, hatte ich mir die Ohren zugehalten, aber jetzt hatte ich einen viel besseren Weg gefunden, um Mutters zornigen Worten und Vaters stummer Empörung zu entfliehen: Ich dachte mir Geschichten aus. Gerade phantasierte ich von einem Motorrad, mit dem ich an die See und am Strand entlangfahren würde. Ich konnte das salzige Meer förmlich riechen. Doch Mutters Ton war schneidend: »Glaubst du, ich halte das noch lange aus? Dein ewiges Fernsehen, deine Zurückgezogenheit, dein Desinteresse. Glaubst du, es fällt den Nachbarn nicht auf, dass du nichts mit ihnen zu tun haben willst, dass du keine Freunde hast, keine Kollegen?«
Vater antwortete mit einem Schweigen.
»Mein Gott, die Erbsensuppe.« Mutter eilte zum Herd. »Sie ist verbrannt«, sagte sie in gleichgültigem Ton.
Susa schnaufte unwillig. Mir war es egal.
Vater machte sich im Flur zu schaffen: Er maß und markierte ganz genau Bohrlöcher für Dübel und Winkel, bohrte Löcher, brachte Einlegeböden an Seitenteilen an, bestrich Anstoßflächen mit Leim und steckte die Böden hinein. Mit einem Gummihammer klopfte er alle Teile fest und ...
... es klingelte. Obwohl Vater direkt neben der Tür am neuen Regal werkelte, ließ er schlagartig den Hammer fallen und verschwand im Wohnzimmer.
Mutter warf den Topfkratzer, mit dem sie den Herd gereinigt hatte, in den Spülstein, trocknete sich die Hände an ihrem geblümten Hauskleid ab und öffnete die Tür.
Herr Klose hielt Mutter zwei Eier entgegen, die seine Frau vor ein paar Tagen ausgeliehen hatte.
Mutter nahm die Eier verstimmt entgegen, und als Herr Klose sich mehrfach bedankt und verabschiedet hatte, kam Vater aus dem Wohnzimmer heraus, als hätte er dort nur gerade mal nach dem Fernseher gesehen. Er nahm sich einen ersten Regalbodenwinkel, um ihn anzuschrauben, dann einen zweiten, einen dritten, glättete die Holzkanten mit Schmirgelpapier und imprägnierte zum Schluss alle Teile des Regals mit Naturöl.
Wir Kinder liebten es, auf den weitläufigen Rasenflächen zwischen den Siedlungshäusern zu spielen. Manchmal wurde der Rasen zu einem Fußballfeld mit Tribüne, manchmal zu einem fremden Kontinent, manchmal auch zu einem wüsten Kriegsschauplatz. Heute aber war er ein Zoo. Ulli aus der Wohnung unter uns spielte einen Schwarzbär, der ständig Hunger hatte und vor dem keine Mülltonne sicher war. Susi Klose hatte sich in einen herrlich schimmernden Eisvogel verwandelt, und ich war eine Giraffe, an die sich wegen ihrer Größe kein Raubtier wagte.
Ulli und Susi amüsierten sich über meine vergeblichen Versuche, mit meinem Maul das Gras – genauer das Wasser – zu erreichen, weil mein imaginärer Kopf in mehr als fünf Meter Höhe saß, mein Hals aber bloß zwei Meter fünfzig lang war. Wie ich das im Zoo einmal gesehen hatte, spreizte ich meine Beine weit auseinander und beugte dann den Kopf nach unten.
»Das ist die Gelegenheit zum Angriff«, schrie Ulli, der Schwarzbär, und rammte mich von hinten. »Giraffen können in dieser Stellung zwar trinken, aber, ha, sie sind unfähig zur Flucht.«
Susi, der Eisvogel, kam mir zur Hilfe. »Das ist nicht fair, Giraffen brauchen einige Sekunden, bis sie ihre Beine aus dem Spagat sortiert haben.«
Ulli, der Schwarzbär, versetzte auch ihr einen Schubs. »Das ist es ja gerade. Das ist ihr Pech.«
»Mein Vater hat gesagt, dass den Giraffen beim spontanen Heben des Kopfes sogar schwarz vor Augen wird.« Susi warf Ulli einen missbilligenden Blick zu.
»Ja, und? Das ist doch nicht mein Problem. Als Bär kann ich darauf doch keine Rücksicht nehmen.«
»Wo es Giraffen gibt, gibt es keine Schwarzbären, glaube ich.« Ich lag als gerammte Giraffe im Gras und betrachtete argwöhnisch die untergehende Sonne. Immer wenn es dunkel wurde, bekam ich so ein flaues Gefühl, aber Susi hatte gesagt, dass ihr im Dunkeln auch komisch würde. Nur Ulli ließ sich nichts anmerken.
»Redet dein Vater oft mit dir?«, fragte ich Susi, es sollte beiläufig klingen. Wir saßen gemeinsam im Gras, und Susi schaute mich an, als ob ich etwas sehr Komisches gefragt hätte.
»Na ja, ich meine, erzählt er dir oft von fremden Ländern, wilden Tieren und so.«
Susi betrachtete ihre erdigen Knie. »Vater erzählt mir viel – vorm Einschlafen, beim Abendessen, immer eigentlich.«
»Spricht er auch mit deiner Mutter?« Ich wollte nicht glauben, dass ich das gefragt hatte, aber jetzt war es heraus.
Susi schüttete sich aus vor Lachen. »Natürlich spricht er mit meiner Mutter, was glaubst du denn?«
Ich hätte gerne gefragt, über was sie redeten. Und ich hätte gerne gewusst, ob sich ihr Vater auch versteckte, wenn es an der Wohnungstür klingelte. Doch Ulli wollte noch mit Susi Fahrrad fahren, und ich musste meine kleine Schwester abholen, die mit den Mädchen aus dem ersten Block Gummitwist spielte.
Zu Fuß war es ein langer Weg in die Friedrich-von-Schiller-Schule. Ulli begleitete mich oder Susi oder Gabi oder Steffi oder ein anderes Kind aus dem kinderreichen Wohnblock. Ich galt als netter, hilfsbereiter Junge, besonders bei den Mädels.
Die Lehrer tadelten mich manchmal. Sie meinten, ich würde zwar Schulaufgaben machen, aber auch keinen Strich mehr. Ich könnte besser sein. Und meine Teilnahme am Unterricht, die sei miserabel. Sie erkannten mich als einen schüchternen Jungen. Ich erkannte das auch, doch ich erkannte meine ANGST nicht. Ich dachte, dass es normal sei, sich bei Dunkelheit nicht aus dem Haus zu trauen. Ich glaubte, dass ich kein Interesse hätte, Ski zu fahren, schwimmen zu gehen und mit Freunden nachts im Wald zu zelten. Ich redete mir ein, in einer normalen Familie zu leben: mit einer unsicheren, gleichgültigen Mutter und einem Vater, der sich vor Fremden versteckte. Ich wollte eine heile Welt.
An diesem Morgen begleitete mich Susi in die Schule. Als wir die Klasse betraten, malte Herr Lause, unser Erdkundelehrer, gerade die Umrisse einer Insel an die Tafel. Ich setzte mich auf meinen Platz. Und zwar so verstohlen, dass Ulli neben mir mich erst gar nicht bemerkte. Herr Lause war fertig mit seiner Malerei und drehte sich zu uns um. »Welche Stadt ist die nördlichste Hauptstadt der Welt?«
Ulli meldete sich wie verrückt. Seine Behauptung, dass es Oslo sei, war genauso falsch wie Susis Vermutung, es könnte sich um Stockholm handeln.
Reykjavik, dachte ich. Jedes Kind weiß, dass es Reykjavik ist. Und traute mich nicht, mich zu melden. Traute mich nicht, diesen Namen auszusprechen, womöglich falsch, und dann würden alle über mich lachen.
Herr Lause schaute über die Klasse hinweg, wurde ungeduldig. »Die Hauptstadt liegt auf einer Insel. Und wenn mir nicht bald jemand den Namen nennt, soll er in den dort brodelnden Vulkanen bis ans Ende seiner Tage schmoren.«
Ich versteckte mich hinter Susis Rücken. Ich wusste, dass es Island war, kannte sogar den Namen eines Vulkans: Gjálp. Und wenn er ausbrechen würde, dann ...
Herr Lause stand jetzt neben mir und fasste mir mit einer Hand an mein Kinn. »Martin, du bist doch ein intelligenter Bursche. Nur, wenn du nicht mündlich mitarbeitest, gibt das wieder eine Vier. Also, wie heißt die nördlichste Hauptstadt der Welt?«
Ich strich mir mit der Hand über die Stirn, wollte meine Gedanken ordnen, versuchte mich auf das Wort zu konzentrieren. Doch da war nichts außer der Unordnung und der Stimme des Lehrers, die mein Gehirn blockierte. Ich öffnete meinen Mund, doch kein Wort kam daraus hervor.
Herr Lause ließ von mir ab und zuckte mit den Schultern.
Später, in der Pause, erzähle ich Susi und Ulli von meinem Traum: einer Reise mit dem Motorrad über Island bis nach Reykjavik, unter Wolken hindurch, die alles in fließendes, helles Grau tauchen und die Grenze zwischen Himmel und Erde verwischen würden.
»Ich lasse mich scheiden«, sagte Mutter. Sie wirkte nervös und schwierig. Susa stieß ein kleines erstauntes Lachen aus.
Ich blickte auf den Fernsehapparat. Vater war nicht da, und wir saßen im Wohnzimmer auf der Couch.
»Die Weltwirtschaft leidet unter der schwersten Rezession seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges ...«, der Nachrichtensprecher formulierte seine Sätze so korrekt, wie er aussah, und im Anschluss wurden Bilder aus dem Weltraum gezeigt.
Ich wollte etwas über meinen schwermütigen, unnahbaren Vater sagen, doch ich sagte nur: »Mutti, das hättest du schon vor Jahren tun sollen.«
Sie schaute mich an, als hätte sie vergessen, von was wir gesprochen hatten. »Was?«
»Na, scheiden lassen.« Ich lehnte mich in das steife Polster zurück.
Susa blieb wie versteinert sitzen und sagte nichts. Sie schien sich an die Sofakante zu klammern.
Als Vater sich an der Wohnungstür bemerkbar machte, stand Mutter schnell auf und ging in die Küche.
Die Zeit dazwischen war grauenhaft. Ich meine die Zeit zwischen der Offenbarung meiner Mutter, die Scheidung zu wollen, und unserem Auszug aus der kleinen Arbeiterwohnung. Vater schien endgültig verstummt. Nur Mutter redete ständig: über neue Möbel, neue Kleider, neue Freiheiten. Und ich hörte ihr zu, ohne viel zu antworten. Sie wollte auch nichts von mir wissen.
Onkel Walter und Tante Irmgard halfen beim Umzug. Herr und Frau Klose verabschiedeten sich mit einer Flasche Schaumwein: für die neue Wohnung und auf ein neues Glück.
Damals wusste ich nicht, dass Vater unter einer Sozialphobie litt, heimlich trank, niemals einen Freund oder Kumpel haben würde und heiraten – heiraten würde er auch niemals mehr.
1980 fing ich im TV Jahn in Wolfsburg mit Karate an. Ich war sechzehn Jahre alt und war es leid, mich ängstlich vor Halbstarken zu verstecken, weil ich Angst vor Prügel hatte, und hinter den Rücken meiner Mitschüler, weil ich zu schüchtern war. Ich wollte mich wehren können, auch vor der Überheblichkeit der Lehrer, und wenn schon nicht mit frecher Schnauze, dann wenigstens in der Gewissheit, dass ich ihnen kämpferisch überlegen war.
Das kleine Dojo wurde von Franco, einem sympathischen Italiener, der tagsüber im WERK arbeitete, geführt. Als mein Sensei führte er mich in die Grundelemente des Karate ein, in die Bewegungsabläufe und die reinen Techniken zur Selbstverteidigung. »Karate ist ein zusammengesetztes Wort«, sagte er. »Kara heißt wörtlich leer, und Te steht für Hand. Karate bedeutet somit leere Hand und weist darauf hin, dass in dieser Kampfsportart keine Waffen verwendet werden.«
Ich begann mit dem 9. Kyu und würde meine »Schülerlaufbahn« mit dem 1. Kyu beenden. Im Laufe der Jahre würde ich es bis zum »Braungurt« bringen. Ich würde lernen, meinen Körper zu beherrschen, meine Koordinationsgabe und meinen Gleichgewichtssinn zu trainieren. Ich würde intensiv, konzentriert und regelmäßig üben. Ich würde (aus Angst vorm Versagen, aus Angst vor der Angst) keinen »Schwarzgurt« erreichen und schon gar keine der weiteren Grade innerhalb dieser Meisterstufe, aber ich würde ein disziplinierter Karateka werden, der die Strukturen respektiert und seinem Sensei respektvoll begegnet.
Wolfsburg war jetzt eine Stadt. Wir hatten eine Fußgängerzone, und durch diese Fußgängerzone, die eine Stadt ja erst zur Stadt macht, zogen samstags die Fans vom Vfl. Der Vfl war das VW-Werk, war die Stadt – 1938 gegründet. Aber zu einer richtigen Stadt wurde Wolfsburg erst mit dem Wirtschaftswunder. Die Menschen kamen zum Autobauen hierher, und wenn VW Betriebsferien hatte, konnte der Tante-Emma-Laden an der Ecke dichtmachen. War ja keiner mehr da. Schließlich arbeitet fast jeder im WERK. Und wer nicht im WERK arbeitete, war merkwürdig, fremd. Und wer in den Ferien nicht verreisen konnte, war ein LOOSER.
»Du hattest bestimmt schöne Ferien, Martin, nun erzähl mal«, forderte mich unser Klassenlehrer nach den Sommerferien auf.
Hinter mir tuschelten zwei Mädels. Von den Traumstränden Siziliens sprach die eine und vom blauen Himmel Griechenlands die andere.
Meine Handflächen schwitzten. Ich stand auf. Ich wurde rot. »Tja, Ferien«, wiederholte ich und dachte an endlos öde Nachmittage, dachte an meine Mutter, die keinen Führerschein und kein Auto hatte, und an meinen Vater, der von uns getrennt lebte, ebenfalls ohne Führerschein. Ich dachte an träge Wochenenden bei meinen Großeltern, an Großmutter, die mir die Ferien angenehm machen wollte, es aber nicht schaffte. Ich dachte daran, arm zu sein, ein armes Proletarierkind ohne Urlaub, ohne Regeln, ohne Verbote. Ein Proletarierkind, um das sich niemand kümmerte, das jeden Scheiß anstellen konnte, weil keine Sau auf es aufpasste, das sich so lange auf der Straße herumtreiben konnte, wie es wollte. »Tja«, sagte ich noch einmal, weil ich keine Erlebnisse hatte, nichts, worüber es sich zu erzählen lohnte.
Ich hielt nach Manni am Nebentisch Ausschau. Er war auf Mallorca gewesen, und der dicke Jochen hinter ihm wenigstens in Bayern. Ich zuckte mit den Schultern, als ob ich einen unsichtbaren Schal zurechtrücken wollte. Und ich wusste, das Wort Außenseiter würde auf meiner Stirn geschrieben sein.