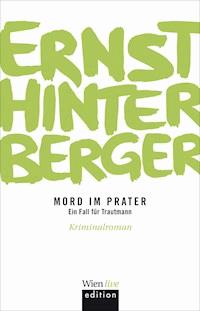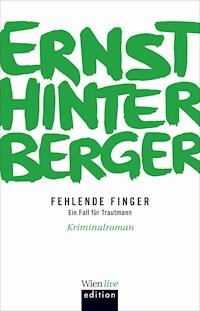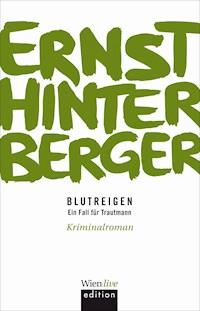9,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: echomedia buchverlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Im Lotto irrsinnig viel Geld zu gewinnen, ist nicht leicht. Noch schwerer ist nur, darüber Stillschweigen zu bewahren, wenn einem Fortuna einmal gnädig zugewinkt hat. Auch Verena Leinwarther kann ihr Glück nicht still und allein genie§en, sie erzählt davon einer Freundin, die das auch nicht für sich behalten kann. Eines Tages wird die nun nicht mehr glückliche Gewinnerin ermordet in der Badewanne aufgefunden. Ihr Geld ist genauso verschwunden wie ihre kleine Tochter Annemarie, wie der Wiener Paradekieberer Trautmann bei seinen Untersuchungen erfährt. War die Kleine zufällig Zeugin der Tat und ist aus Angst geflohen? Oder hat sie der Mörder gleichfalls getötet und dann beseitigt? Trautmann ermittelt im Wurstelprater und auf Flohmärkten - wie immer einige Meter neben dem vorgesehenen Dienstweg. Also: erfolgreich.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 260
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Inhalt
Titelseite
Impressum
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Glossar
DER TOD SPIELT MIT
Ein Fall für Trautmann
Ernst Hinterberger
Impressum:
eISBN: 978-3-902672-66-7
E-Book-Ausgabe: 2012
2008 echomedia buchverlag
A-1070 Wien, Schottenfeldgasse 24
Alle Rechte vorbehalten
Produktion: Ilse Helmreich, Helmut Schneider
Produktionsassistenz: Brigitte Lang
Gestaltung: Rosi Blecha
Layout: Elisabeth Waidhofer
Lektorat: Erich Demmer, Regina Moshammer
Herstellungsort: Wien
Besuchen Sie uns im Internet:
www.echomedia-buch.at
Handlung und Personal sind frei erfunden. Jede Übereinstimmung mit der Wirklichkeit wäre rein zufällig.
Wiener Dialektausdrücke, Begriffe aus dem Polizeijargon, spezielle Redewendungen und Wörter sind im Text bei der ersten Erwähnung kursiv gesetzt und werden am Ende des Buches in einem Glossar erläutert.
Das Glossar wurde von Erich Demmer erstellt.
1
Alle waren sich darüber einig, dass es in Wien seit Menschengedenken keinen so heißen Sommer wie in diesem Jahr, 2007, gegeben hatte.
Seit Mitte April war es bereits sommerlich und ab Anfang Mai gab es tagsüber dreißig Grad im Schatten, und auch nachts betrug die Temperatur noch immer vierundzwanzig Grad und mehr. Und es gab mit wenigen kurzen Ausnahmen keinen Tropfen Regen. Langsam verdorrten die Grasflächen, die Bäume und Blumen blühten früher als gewohnt. Die üblichen Sommergewitter gab es nur in den Bundesländern, und dort waren sie stärker als sonst, mauserten sich zu richtigen Unwettern mit Überschwemmungen und golfballgroßen Hagelschloßen, die große Teile der Ernte vernichteten und leichtere Hausdächer wie nichts durchschlugen. In einigen Staaten Europas wüteten der Hitze wegen weitläufige, riesige Waldbrände, die Menschenleben forderten und verbrannte Häuser und wüstenartige Landstriche zurückließen.
Die Meteorologen und anderen Klimaforscher konnten sich nicht darüber einig werden, ob dieser Katastrophensommer auf die rapid fortschreitende Klimaveränderung infolge übermäßiger CO2-Belastung der Atmosphäre oder darauf zurückzuführen war, dass es in der Erdgeschichte immer wieder Einbrüche großer Kälte- oder ebensolcher Hitzeperioden gegeben hatte. Das änderte aber nichts daran, dass viele Menschen ihr Hab und Gut verloren und dass die Lebensmittelpreise infolge der vernichteten Ernten maßlos stiegen und weiter steigen würden.
Auch Anfang August stöhnte Wien unter zu großer Hitze, und auch im sonst relativ kühlen grünen Prater war es schon am frühen Vormittag drückend heiß, als die junge Eva Pichler mit ihrer kleinen Tochter Renate entlang des Heustadelwassers, das sich von der Rustenschacherallee bis fast zum Handelskai hinzieht, einen Spaziergang machte.
Die kleine Renate war entzückt über die zahlreichen Enten im Heustadelwasser, fütterte sie mit alten Weißbrotstücken und lachte jedes Mal glücklich, wenn diese heranschwammen und nach den Brotstücken schnappten.
Außer den beiden war auf den sich zwischen Heustadelwasser, dem Gelände der Campagnereiter und den Bäumen bis fast zur Donau hinziehenden gewundenen Wegen niemand unterwegs. Sie erreichten schließlich die am Unteren Heustadelwasser liegende Kleingartensiedlung und gingen weiter in Richtung Wehlistraße, zur Endhaltestelle der Straßenbahnlinie 21, die in zirka einem Dreivierteljahr eingestellt werden sollte.
Als sie durch die schmale Stemmerallee kamen, sahen sie, dass bei einem der nicht großen, ganzjährig bewohnbaren Häuser Wasser aus der Haustür floss und es sowohl im Garten als auch auf der Allee bereits Wasserlachen gab.
„Da kann was nicht stimmen“, sagte die Pichler zu ihrer Tochter. „Es sollte doch nicht sein, dass aus dem Haus dort ununterbrochen Wasser rinnt.“
Sie ging zum betreffenden niederen Gittertor, drückte mehrmals lange auf den dort angebrachten Klingelknopf und begann, als sich im Haus nichts rührte, laut zu rufen. Erst nach mehrmaligem, immer lauterem Rufen öffnete sich die Tür des Nebenhauses. Eine ältere Frau in einem fleckigen Hausmantel schaute heraus und sagte wütend: „Was plärren S’ denn so? Glauben S’, Sie sind allein auf der Welt?!“
„Nein“, sagte die Pichler und erklärte: „In Ihrem Nebenhaus muss was sein. Da rinnt ja ununterbrochen Wasser heraus!“
„Was denn für ein Wasser, ich bitt Ihnen?“ Die ältere Frau schaute auf den nassen Rasen des Nachbargrundstücks. „Na ja, vielleicht hat die Leinwarther wieder einmal den Rasen gespritzt und vergessen, ’s Wasser abzudrehn.“
„Das Wasser kommt aber aus dem Haus heraus!“, sagte die Pichler. „So schauen S’ doch!“
Daraufhin machte die andere ein paar Schritte, schaute auf die Haustür der Nachbarin und meinte: „Na ja, die Leinwarther ist manchmal ein bissl gaga. Die … Voriges Jahr war ihre Waschmaschine hin. Da ist’s auch herausgeronnen. Damals war auch alles überschwemmt, weil sie einkaufen oder wo war und die Maschin hat rennen lassen.“ Und verächtlich: „Manche Weiber sind halt keine.“
Die Nachbarin trottete zu ihrem Haus zurück. „Und hören S’ mit der Schreierei auf. Niemand hört Ihnen zu. Die anderen Nachbarn von der Leinwarther sind nicht da. Die fahren mit irgendeinem Kreuzschiff umeinand, weil s’ zu viel Geld haben und es ihnen da nicht schön genug ist. Und Sie“, setzte sie bissig hinzu, „gehen mit Ihnerem Bankert weiter und lassen anständige Leut in Ruh.“
Dann raffte sie ihren Hausmantel noch mehr zusammen, ging in ihr Haus und knallte die Tür hinter sich zu.
„Warum ist denn diese Frau so böse, Mutti?“, fragte die kleine Renate. „Und was ist denn ein Bankert?!
„Vielleicht haben wir sie bei etwas gestört“, sagte Eva Pichler. „Und Bankert ist ein ordinäres, hässliches Wort.“
Sie schaute auf eine nahe Tafel mit der Aufschrift „Zum Schutzhaus Unteres Heustadelwasser“, dachte kurz daran, hinzugehen und dort den Wassereinbruch zu melden; überlegte es sich aber, weil dort vielleicht niemand war, zog ihr Handy heraus, wählte 122, die Feuerwehr, und meldete, dass aus einem Haus in der Stemmerallee Wasserströme herausflossen.
Der Beamte in der Feuerwehrzentrale nahm das zur Kenntnis, sagte, man werde kommen, fragte nach dem Namen der Anruferin, ersuchte sie, nicht wegzugehen, und legte auf.
Die Pichler steckte ihr Handy wieder ein und sagte zu ihrer Tochter: „Wir müssen jetzt ein bisschen warten, bis die Feuerwehr kommt. Es kann ja nicht lange dauern.“
„Fein! Ich möchte gerne sehen, was die Feuerwehrmänner machen, Mutti. Aber warum hast du deinen Namen sagen müssen?“
„Wenn jemand die Feuerwehr oder Rettung oder Polizei anruft, wollen die wissen, wie der Anrufer heißt.“
Das war zwar im Prinzip richtig, schützte aber doch nicht vor Falschmeldungen. Es kam immer wieder vor, dass sich jemand einen Jux machte und einen falschen Namen nannte, um dann auf die betreffende Einsatzgruppe zu warten und sich darüber zu amüsieren, dass es an der angegebenen Adresse keine Notwendigkeit eines Einsatzes gab. So hatte erst unlängst jemand die Polizei angerufen und gemeldet, dass am Flughafen Schwechat eine Bombe hinterlegt sei, die in einer Viertelstunde explodieren würde.
Daraufhin hatte es eine Großaktion mit Räumung des Flughafens und ein Tohuwabohu gegeben, aber weder die Polizisten noch deren Spürhunde hatten eine Bombe gefunden – sondern bloß eine Schachtel mit Abfällen und einen mit Papier gefüllten Koffer, aus dem einige Drähte heraushingen.
Während Eva und Renate auf die Feuerwehr warteten, kam die grantige Nachbarin wieder aus ihrem Haus. Sie hatte beobachtet, dass Eva Pichler ihr Handy benützt hatte und daraus messerscharf geschlossen, dass diese irgendwen alarmiert hatte. Sie wollte natürlich unbedingt sehen, was jetzt weiter passierte. Sie hatte jetzt allerdings ihren Hausmantel mit einem Kleid vertauscht und hielt sich abseits von Mutter und Tochter.
Es dauerte keine zehn Minuten, bis sich rasch nähernde Töne eines Feuerwehrhorns zu hören waren und kurz danach ein Einsatzwagen der Feuerwehr in die Stemmerallee einbog.
Die Nachbarin, die vorher nur ihre Ruhe hatte haben wollen, trat auf die Fahrbahn, winkte mit beiden Armen, ähnlich den Flügeln einer Windmühle, stürzte, als die Feuerwehrleute aus ihrem Wagen stiegen, auf diese zu und deckte sie mit einem Redeschwall ein.
Die Feuerwehrleute schauten zum Haus, aus dem noch immer Wasser rann. Versuchten das Gittertor des Gartens zu öffnen. Stiegen, weil es irgendwie klemmte und sowieso niedrig war, einfach drüber und näherten sich dem Haus.
2
Zur gleichen Zeit saß der Abteilungsinspektor Trautmann im Dienstzimmer seiner Gruppe im für die Wiener Bezirke 1, 2, 3, 11 und 20 zuständigen Kriminalkommissariat Zentrum Ost in der Leopoldsgasse kettenrauchend vor einem Computer und ärgerte sich grün und blau.
Seine Kollegen Burschi Dolezal und Franzi Lassinger waren wegen einer gestrigen Schlägerei im Prater, bei der ein achtzehnjähriger Türke einen lebensgefährlichen Bauchstich erlitten hatte, auf der Suche nach möglichen Zeugen, die sie wahrscheinlich nicht finden würden; oder wenn doch, hatten diese weder was gesehen noch wussten sie was und außerdem waren sie überhaupt nicht dabei gewesen.
Und Manuela Reisinger, das vierte Mitglied der Gruppe Gewalt, war ins Sozialmedizinische Zentrum Ost gefahren, um zu versuchen, von dem dort auf der Intensivstation liegenden Bauchstichopfer namens Bülent Sükürjoglu Angaben über den Täter zu bekommen – was aber nach Trautmanns Meinung ebenfalls außer leeren Kilometern kaum was bringen würde.
Trautmann drückte seine Zigarette aus und rollte sich sofort eine neue.
Sein Zigarettenkonsum betrug nach Meinung Burschis gut und gern an die fünfzig bis sechzig Selbstgerollte oder mehr am Tag und war eine Zumutung für die nicht rauchenden anderen in der Gruppe.
Burschi Dolezal, der ein begeisterter Fitnesscenter-Besucher war, hatte Trautmann mehrmals scherzhaft auf das Rauchverbot in öffentlichen Gebäuden hingewiesen, aber bloß die Antwort bekommen, sowohl er wie die für das Verbot zuständige Ministerin könnten ihn, bei allem Respekt, kreuzweise … Das fehlende „am Arsch lecken“ hatte er jedoch durch das „gern haben“ ersetzt. Denn unlängst hatte ihm der Stadthauptmann, als er einem Verhör beiwohnte, das Trautmann mit dem polizeibekannten Gewalttäter Schurli Tränkler, der wieder einmal einen aufgemacht hatte, führte, unter vier Augen gesagt, dass der Umgangston von Seiten des vernehmenden Beamten etwas weniger ordinär sein konnte, ohne dass das den Ermittlungen schadete.
Am liebsten hätte Trautmann, ältester Hund des Kommissariats, den Computer samt dessen Programm PAD aus dem Fenster geworfen. Denn dieses ins IPOS, Integrierte Polizeiliche Sicherheitssystem, eingebundene PAD, das für Protokollieren-Anzeigen-Daten stand, war von einem, wie sich Trautmann sicher war, Rauschkind eingeführt worden, das zwar jetzt ein Oberst, aber trotzdem durch und durch ein Gscherter war, der aus Linz in das Bundeskriminalamt nach Wien gekommen war, um den depperten Wienern zu zeigen, wo der Barthel den Most holt.
Natürlich wussten alle aus der Gruppe, dass sich Trautmann mit dem ganzen Computerzeug, nannte es sich nun IPOS, PAD, IKDA, ZDS, ViCLAS oder EKIS, nur schwer anfreunden konnte, weil er zwar mit seinen sechsundfünfzig Jahren immer noch zu den erfolgreichsten Kriminalisten Wiens zählte, aber trotzdem eine Art Saurier war. Denn seiner Meinung nach musste ein guter Kiberer erstens im Urin spüren, wer was gemacht hatte, und zweitens zuverlässige Zundgeber haben, um mit einer hohen Erfolgsquote brillieren zu können.
Gewiss, das gab er ja zu, konnten einen die Computerprogramme ab und zu unterstützen, aber das Handwerkliche war halt doch am wichtigsten. Stundenlanges Hocken vor dem Bildschirm brachte nichts, wenn man keine Intuition hatte. Wirklich sinnvoll waren nur die DNA-Datenbank und das AFIS, das Automated Fingerprint Identification System. Alle anderen Programme waren mehr oder weniger nur was für den Hugo.
Der Abteilungsinspektor Trautmann, ein immer massiger werdender Mann, war seit fünfunddreißig Jahren bei der Polizei. Er hatte nach fünf Jahren als Sicherheitswachebeamter in den Bezirken Leopoldstadt und Favoriten den Kriminalbeamtenkurs erfolgreich abgeschlossen und gehörte seither zum ehemaligen Polizeikommissariat Leopoldstadt, das jetzt – nach der seiner Meinung von geistigen Hammerzehen durchgeführten Polizeireform – Kriminalkommissariat Zentrum Ost hieß.
Trautmann war, wie er sagte, „irgendwann mal“ verheiratet gewesen, aber dann war ihm seine Frau wegen viel zu vieler Überstunden weggelaufen und er hatte die gemeinsame Tochter, so gut es eben ging, allein großgezogen. Natürlich hatte er, wie die meisten Väter einer Tochter, geglaubt, dass sie etwas Besonderes sei, sich aber infolge seiner Polizeiarbeit viel zu wenig wirklich um sie gekümmert. Dann war ihm die Rechnung präsentiert worden, hatte er seine Kunstgeschichte studierende Tochter nach einem Goldenen Schuss tot im WC einer miesen Vorstadtdisco aufgefunden.
Damals war seine Welt zusammengebrochen. Er hatte sich schwerste Vorwürfe gemacht, mit dem Schicksal gehadert und eine Zeit lang so übermäßig getrunken, dass er von seinen Vorgesetzten ermahnt worden war und von der Direktion sogar eine schriftliche dienstliche Rüge erhalten hatte. Er war danach praktisch durch einen, wie er glaubte, Zufall zum Buddhismus gekommen, hatte sich dem ihm am meisten zusagenden Zen zugewandt, studierte seither dessen Koans, war sehr viel ruhiger und gelassener geworden und zu der Überzeugung gelangt, zumindest ein paar Schritte „auf dem Weg“ zu sein.
Er aß und rauchte zwar immer noch viel zu viel, trank aber nicht mehr, weil er sein Bewusstsein nicht benebelt, sondern klar haben wollte. Er schlug sich seit Jahren mit der Lösung von Zen-Koans herum, was ihm allerdings schwerfiel, weil die keine leichte Kost und für einen kleinen Kriminalbeamten, einen Pflasterhirschen, um vieles zu hoch waren. Er hoffte aber doch, irgendwann den einen oder anderen zu knacken.
Mit Frauen hatte Trautmann nichts mehr im Sinn. Seine letzte Verbindung mit einer Frau aus Kaisermühlen lag schon länger zurück und er war, wie er sagte, seither zum sächlichen Geschlecht übergetreten. Seine Freundschaft mit der Besitzerin des kleinen Cafés am nahen Karmelitermarkt hatte mit Sex nichts zu tun, war rein platonisch und das Sich-einander-Öffnen zweier Menschen, denen das Leben übel mitgespielt hatte.
Im Grunde bestand sein Leben nur mehr daraus, Dienst zu schieben, zu ermitteln und im menschlichen Dreck zu wühlen. Und er dachte hin und wieder, in letzter Zeit aber immer öfter, daran, nach der Pensionierung seine Walther PPK 7,65 aus dem Kasten zu holen und sich mit ihr den Schädel wegzuschießen.
3
Während Trautmann vor seinem Computer saß und blicklos auf dessen Bildschirm stierte, waren die Feuerwehrleute bereits in dem Haus in der Stemmerallee, nachdem sie dessen nicht versperrte, sondern nur zugeworfene Haustür mit Hilfe einer Plastikkarte geöffnet hatten.
Sie tappten durch den überfluteten Vorraum, sahen auf dem Boden ein Kabel, dessen Ende in eine in Bodennähe befindliche Steckdose eingeführt war. Zogen zuerst das Kabel aus der Steckdose und gingen dann zur einen Spalt breit geöffneten Tür des Badezimmers, aus dem nach wie vor Wasser floss. Gingen ins überflutete Badezimmer, sahen, dass die Hähne der Badewanne geöffnet waren und beide einen dicken Strahl in die überlaufende Wanne fließen ließen sowie in der Wanne eine nackte Frau, auf deren Brust ein Föhn lag, dessen Kabel in den Vorraum führte.
Einer der Männer schloss die Hähne und sagte zu den anderen: „Wieder einmal eine, was es nicht mehr derpackt hat und sich ’s Leben genommen hat.“
Und, als ein anderer in die Wanne greifen wollte: „Greif nicht hinein, Mandi! Das soll die Polizei machen. Der Frau können wir eh nimmer helfen. Die muss, dem Wasser nach, schon seit Stunden in der Wanne liegen und sich den Föhn geben haben. Die ist längst tot.“
„Glaub ich auch“, sagte ein anderer. „Was mich wundert, ist, dass sie nicht die Wanne hat volllaufen lassen und dann das Wasser abgedreht hat, bevor sie den Föhn hineingeschmissen hat. Na wurscht. Nicht unser Problem. Jedenfalls verständigen wir jetzt die Polizei und pumpen vorläufig einmal das Wasser ab, damit die keine Schwimmflügerln braucht. In der Wanne rühren wir nichts an.“
Der Feuerwehrmann, der den Hahn zugedreht hatte, schaute auf die Tote in der Wanne und sagte mehr zu sich als zu den anderen: „Leut sind das, Leut … Die ist ja noch verhältnismäßig jung. Keine vierzig und schaut auch gut aus. Warum legt die sich in die Wanne, lasst das Wasser rinnen, gibt sich den Föhn und macht einen Abgang? Na, vielleicht war s’ geistig schon nimmer da oder unter Drogen und es war ihr wurscht, dass das Haus überschwemmt wird.“
Dann watete er zur Tür und sagte: „Ich geh jedenfalls anrufen.“
Die anderen folgten ihm nach draußen und machten, während er vom Einsatzwagen aus die Polizei verständigte, die Wasserpumpe und einen Schlauch mit Ansatzstutzen fertig.
Sofort bedrängte sie wieder die Nachbarin, die vor Neugier schlotternd fragte: „Was ist denn drinnen? Ist wieder die Waschmaschin ausgronnen?“
„Nein.“
„Na, was denn dann?“, bohrte die Nachbarin weiter. „Hat die Gurken irgendwo ’s Wasser rinnen lassen und ist einkaufen oder so was gangen?“
„Ja“, sagte der mit der Pumpe hantierende Feuerwehrmann. „Aber einkaufen ist sie nicht gegangen.“
„Dann ist s’ drinnen? Aber wieso rinnt dann das Wasser auße? Schlaft die einen Rausch aus oder was?“
Der Feuerwehrmann schob die zudringliche Nachbarin zur Seite. „Weil ... Sie ist drinnen und jetzt lassen S’ uns arbeiten, Frau. Gehen S’ aus dem Weg, sonst werden S’ auch aufpumpt.“
Der aus dem Einsatzwagen steigende Feuerwehrmann schaute auf die abseits stehende Eva Pichler und deren Tochter, ging zu ihnen hin und fragte: „Warum stehen Sie da herum? Sind Sie eine Nachbarin?“
„Nein“, sagte die Pichler. „Ich …“
„Wir sind spazieren gegangen!“, unterbrach sie die kleine Renate und schaute mit großen Augen auf den Feuerwehrmann. „Aber wir haben das viele Wasser gesehen und die Mutti hat Sie angerufen!“
„Aha. Dann warten S’, bitte, auf die Polizei. Die Beamten werden Ihnen was fragen wollen.“
„Wenn die wen fragen, dann müssen s’ das mich!“, mischte sich die herangekommene Nachbarin ein. „Weil ich kenn die Leinwarther, der was das Haus gehört, und weiß alles über sie! Die ist so hudriwudri und weiß mit der linken Hand nicht, was s’ mit der rechten macht!“
Und drängend: „Was ist denn überhaupt da drinnen? Wenn S’ sagen, die Leinwarther ist eh drinnen, warum kommt s’ denn dann net auße? Und wo ist denn derer ihre Kleine, die Annemarie? In den Kindergarten hab ich die heut nicht gehen gsehen!“
„Ich sag Ihnen noch einmal“, brummte der Feuerwehrmann an der Pumpe, „dass S’ noch früh genug erfahren werden, wer drinnen ist und wer nicht und was passiert ist.“
Und nachdenklich: „Ein kleines Mäderl, sagen S’, hat die Frau?“
„Ja! Logisch! Die Annemarie! Ein braves Kind und ganz anders als wie die Mutter! Zwischen fünf und sechs Jahre alt, nächstes Jahr soll’s in die Schul kommen. Ja, die Annemarie – ein liebes Mäderl, aber ohne Vater. Die hat die Leinwarther unehelich kriegt, weil sie überall herumhurt!“
„Geht mich nichts an“, sagte der Feuerwehrmann. Und ruppig: „Und jetzt gehen S’ uns aus dem Weg! Und gemma! Wenn S’ was zu sagen haben, dann sagen S’ es der Polizei, nicht uns!“
Dann ließ er die Nachbarin stehen und setzte die Pumpe in Betrieb.
4
Trautmann saß noch immer paffend vor dem Computer, als sein Oberst Sporrer, ein noch jüngerer, an die zwei Meter großer Mann mit dichtem, nach hinten zu einem Pferdeschwanz zusammengefasstem Haar, ins Zimmer kam und sagte: „Schalt den Computer aus und mach dich fertig. Wir haben zu tun.“
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!