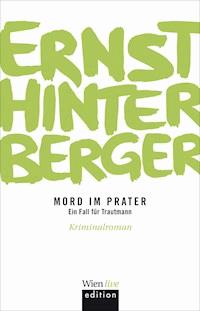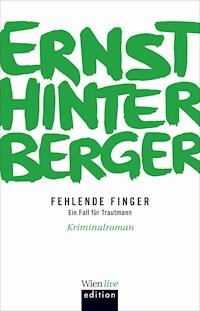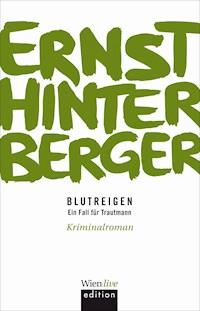9,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: echomedia buchverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Trautmanns AbschiedAm Faschingsdienstag gibt es im bekannten und beliebten Wiener Vorstadtgasthaus „Zum Krügerl“ einen Kostümball. Am Aschermittwoch wird der für seine Alleingänge bekannte Kriminalbeamte Alexander Glaubenkranz – ein alter Freund Trautmanns – im Hinterhof des Beisels ermordet aufgefunden. Für den Mord an einem Beamten sind zwar -andere Dienststellen zuständig, aber Trautmann will den gewaltsamen Tod seines Freundes unbedingt persönlich aufklären. Nach zunächst erfolglosen Ermittlungen führt ihn eine Spur ins Rotlichtmilieu und weiter in Richtung Kindesmissbrauch. Doch dann bringt Trautmann ausgerechnet seine Kenntnis des Wiener Dialekts ans Ziel …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 265
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Glossar
Der Tod hält Ernte
Ein Fall für Trautmann
Ernst Hinterberger
Impressum
eISBN: eISBN: 978-3-902900-42-5
E-Book-Ausgabe: 2014
2014 echomedia buchverlag ges.m.b.h.
Media Quarter Marx 3.2
A-1030 Wien, Maria-Jacobi-Gasse 1
Alle Rechte vorbehalten
Produktion: Ilse Helmreich
Covergestaltung: Elisabeth Waidhofer
Layout: Brigitte Lang
Lektorat: Erich Demmer, Regina Moshammer
Herstellungsort: Wien
E-Book-Produktion: Drusala, s.r.o., Frýdek-Místek
Besuchen Sie uns im Internet:
www.echomedia-buch.at
Handlung und handelnde Personen sind frei erfunden. Jede Übereinstimmung mit der Wirklichkeit und lebenden Personen ist nicht beabsichtigt und wäre rein zufällig.
Wiener Dialektausdrücke, Begriffe aus dem Polizeijargon, spezielle Redewendungen und Wörter sind im Text bei der ersten Erwähnung kursiv gesetzt und werden am Ende des Buches im Glossar erläutert.
Das Glossar wurde von Erich Demmer erstellt.
1
In der Nacht vom Rosenmontag auf den Faschingsdienstag war es in der Außenstelle Zentrum/Ost des Landeskriminalamts Wien, kurz Ast Zentrum/Ost, in der Leopoldsgasse überraschend ruhig und auch tagsüber hatte sich nicht viel getan. Denn halb Wien hatte sich daheim im Fernsehen die diversen prächtigen, aber auch schwachsinnigen und überlauten deutschen Rosenmontagsumzüge angesehen, deren Teilnehmer größtenteils an die Figuren des österreichischen Cartoonisten Manfred Deix erinnerten, sowie das dauernde „Kölle-Alaaf-“ und „Helau“-Geschrei angehört. Und am Abend des Faschingsdienstags würden sie sich gleichermaßen am „Lei-Lei“-Geplärr der heimischen Villacher Narren ergötzen.
Man hatte zwar auch in Wien, weil man ja alles Deutsche nachäffte, versucht, so etwas wie einen richtigen Faschingsumzug zustande zu bringen, man war aber immer wieder gescheitert und hatte, außer kümmerlichen Aufmärschen von Halbnarren, nichts annähernd Gleiches wie die Deutschen auf die Beine gestellt. Die Wiener waren und sind eben keine Marschierer wie die deutschen Jecken.
Die zum Nachtdienst eingeteilte Gewaltgruppe Trautmann war stark dezimiert. Denn Lassinger und Dolezal waren zu einer Faschingsfeier, die von russischen Milliardären und Millionären in den Redoutensälen veranstaltet wurde und an der auch österreichische Regierungsmitglieder teilnahmen, abkommandiert worden. Daher saßen nur der Chefinspektor Trautmann und die Bezirksinspektorin Reisinger in ihrem Dienstzimmer und versuchten, ihren Nachtdienst so gut wie möglich hinter sich zu bringen.
Trautmann schaute schläfrig ins Leere und rauchte wie üblich eine nach der anderen seiner selbst gedrehten Zigaretten; Reisinger blätterte lustlos in einer neu erschienenen Fibel über richtige und gesunde Ernährung, die sie zu Weihnachten von ihrer Lebenspartnerin geschenkt bekommen hatte. Sie war lesbisch, aber das interessierte schon lange keinen der Kollegen mehr. Das Thema Homosexualität war, außer für Idioten, schon seit Jahren keines mehr.
Trautmann war, wie er zu sagen pflegte, schon seit Ewigkeiten Single. Er war zwar irgendwann einmal verheiratet gewesen, aber wegen zu vieler Dienste bei der Kriminalpolizei von seiner Frau verlassen und in beiderseitigem Einvernehmen geschieden worden. Er hatte danach seine Tochter allein aufgezogen und geglaubt, sie würde einmal Medizin studieren, wozu es aber nicht gekommen war, weil sie sich kurz vor der Matura im WC einer Vorstadtdisco den Goldenen Schuss gegeben hatte. Ihm war, ebenfalls wegen zu vieler Nachtdienste, entgangen, dass seine hübsche, intelligente und brave „Einzige“ rauschgiftsüchtig geworden war. Damit hatte er sich in die Gruppe der vielen Eltern eingereiht, die auch keine Ahnung gehabt hatten, dass ihr Kind an der Nadel hing, bis es entweder von der Polizei erwischt worden war oder, wie Trautmanns Tochter, den letzten Schuss nicht überlebt hatte.
Trautmann war schwer übergewichtig, hatte es an den Bronchien und am Herzen und musste seit einiger Zeit eine Bifokalbrille tragen, weil auch seine Augen nicht mehr die besten waren. Er hasste diese Brille, die ihm seiner Meinung nach ein autobusähnliches Aussehen verlieh – und ebenso den Gedanken an seine bevorstehende Pensionierung in zweieinhalb Jahren. Er fürchtete diesen Tag, nach dem er nicht mehr Kriminalbeamter, sondern nur mehr einer der vielen alten Männer sein würde, die schon zu ihren Lebzeiten – und nicht erst, wenn sie abmarkierten – vergessen wurden.
Manuela Reisinger, nur wenig über dreißig, war Veganerin und interessierte sich außer für das Polizeiwesen immer noch für Literatur. Sie hatte eigentlich Germanistik studieren wollen, hatte aber bald eingesehen, dass dieses Studium überlaufen war und kaum Aufstiegschancen bot. Hatte sich dann bei der Polizei gemeldet und die Polizeischule als eine der Besten ihres Hauptkurses abgeschlossen. Nach ihrer Ausmusterung als Aspirantin war sie im 6. Bezirk, Mariahilf, eingeteilt und nach den üblichen Jahren als Uniformierte und einem erneut sehr guten Abschluss des Kriminalbeamtenkurses in der Ast Zentrum/Ost in der Leopoldstadt der Gewaltgruppe Trautmann zugeteilt worden. Deren Gruppenführer sah sie fast wie seine Tochter an und hielt bei immer wieder vorkommenden Blödeleien oder Anmachversuchen einiger Kollegen seine Hand schützend über sie.
Gegen 3.00 Uhr stand Trautmann auf und sagte zur Reisinger: „Ich geh auf einen Sprung in die Inspektion hinunter und tu ein bissl plaudern. Sollte was sein, rufst mich halt dort an. Es wird aber eh nichts sein. Um die Zeit schlaft ja ganz Wien oder liegt besoffen und bewegungsunfähig irgendwo herum. Also, bleib brav und lies nicht zu viel, sonst kriegst eines Tages auch so eine Scheißbrille wie ich.“
Als Trautmann fort war, klappte Reisinger die Ernährungsfibel zu und versuchte sich, wie sie von ihrem Qigong-Meister gelernt hatte, um absolute Entspannung und Harmonie von Geist und Körper zu erreichen, vorzustellen, dass eines ihrer Haare mit einem aus der kosmischen Dimension der Schwerelosigkeit herabhängenden Goldfaden verknüpft war. So wollte sie in einen Zustand von Freude und Harmonie mit dem Unnennbaren gelangen. Weil man aber, um das vollziehen zu können, Jahre brauchte und sie erst seit drei Monaten in des Meisters Studio in der Margaretenstraße ging, blieb es auch diesmal nur beim Versuch.
Als Trautmann in die Polizeiinspektion kam, war es auch dort ruhig. Zwei Inspektorinnen schliefen, drei Kollegen spielten Karten und der Wachkommandant, der alte Wiesinger Hansi, der seinerzeit mit Trautmann in der Polizeischule gewesen war, schaute sich die liegen gebliebenen Nummern des Magazins „Kriminalpolizei“ an. In einer Ausgabe lagen zwei Nacktfotos der bezirksbekannten Prostituierten Ingrid Pottensteiner, die wegen ihrer starken Brille auch „Glasscherben-Inge“ genannt wurde. Auf den Fotos hatte sie ihre Brille natürlich nicht auf, was ihrem Blick etwas Träumerisches und Laszives verlieh.
Was die Fotos in der „Kriminalpolizei“-Ausgabe zu suchen hatten, war Wiesinger schleierhaft. Wahrscheinlich hatte sie einer der jungen Inspektoren hineingelegt und dann auf sie vergessen. Wiesinger riss die Fotos in der Mitte durch und warf sie in den Papierkorb, weil sie in einer Polizeizeitschrift nichts verloren hatten und ihn, der seiner Aussage nach bereits zum sächlichen Geschlecht übergewechselt war, Fotos von nackten Frauen nicht mehr interessierten.
Er war froh, als Trautmann hereinkam, ließ sofort Kaffee kochen und bot Trautmann einen Schluck Himbeergeist von einem Waldviertler Bauern an. Dann begannen die zwei von alten und – wie sie meinten – besseren Zeiten und über Kollegen zu reden, die im Vorjahr verstorben waren. Zwar war außer einem Schluck Bier zum Essen die Einnahme alkoholischer Getränke im Dienst nicht erlaubt, aber andererseits war Faschingsdienstag, und an einem solchen Tag tranken nur Kinder oder Mitglieder der Abstinenzlervereinigung Wasser oder Alkoholfreies.
Um 3.56 Uhr brachte eine Streifenwagenbesatzung zwei randalierende betrunkene Männer in die Inspektion, die einige Fensterscheiben des nahen Kriminalmuseums in der Großen Sperlgasse eingeworfen und dann versucht hatten, gegen die Streifenbeamten gewalttätig zu werden. Das hätte, wenn die beiden nüchtern gewesen wären, einen 269er – Widerstand gegen die Staatsgewalt – ergeben, aber weil es sich bei diesen Tätern um hoffnungslos Betrunkene handelte, stand ihnen infolge absoluten Bewusstseinsverlustes Straffreiheit zu. Sie landeten vorläufig zur Ausnüchterung in einer Zelle. Erhielten aber vorher im Zellengang, wo es keiner sah, von dem sie abführenden Beamten zum Zwecke rascherer Ausnüchterung ein paar kräftige Watschen.
Um 4.08 Uhr war es allerdings mit der Ruhe vorbei. Denn da stürmte der allen bekannte unterstandslose, leicht hinkende Rudi in die Inspektion und schrie: „Tagwache! Tagwache! Abmarsch! Es ist was Schauerliches passiert, Leute. Und ich hab es direkt gesehen. Mit eigenen Augen!“
„Du bist uns passiert, Rudi“, sagte Trautmann gemütlich. „Kommst herein wie ein Wilder und schreist Mord und Totschlag. Aber alles, was du mit deinen Glasbatzen gesehen haben willst, sind Halluzinationen, weil dein Hirn vom vielen Saufen längst im Arsch ist. An einem Faschingsdienstag passiert nichts. Und wenn was passiert, nur was Lustiges. Also, setz dich her, trink mit uns einen Kaffee und spiel nicht mit Gewalt den Trottel.“
„Nein“, keuchte Rudi, „nein, Inspektor. Ich hab es ja direkt gesehen, wie die Leut aus dem Fenster gesprungen sind! Alle zwei. Jedenfalls müsst ihr sofort ausrücken und mit mir kommen, Burschen.“
„Momenterl“, sagte Wiesinger. „Eins nach dem andern, Rudi. Also, wer ist wo aus dem Fenster gesprungen?“
„Zwei junge Leut. Aus einem Fenster im 6. Stock! Von dem neuen Haus an der Ecke von Im Werd und der Krummbaumgasse. Die sind mir ja beinah auf den Kopf gefallen! Sie …“
Rudi kam nicht zum Weiterreden, denn es läutete das Telefon. Wiesinger hob ab und meldete sich. Horchte kurz und sagte: „Was? Wo denn?“ Horchte wieder, sagte: „Okay, wir sind schon unterwegs.“
Legte auf und meinte, bereits aufstehend, zu Rudi: „Ausnahmsweise hast du recht, Demolierter.“
Und zu Trautmann: „Wie der Rudi schon gesagt hat, sind zwei Leut aus dem Fenster gesprungen. Dort spielt es sich jetzt ab. Du und ich, wir müssen hin. Und zwei von meinen Leuten auch. Na, dieser Faschingsdienstag fangt ja schon gut an.“
Wiesinger griff nach seinem Dienstgürtel und rief zu den Kartenspielern im Aufenthaltsraum: „Pepi! Schurli! Ausrückung! Und du, Kurti, machst statt mir den Aufbleiber! Und die zwei Kolleginnen weckts auf. Mit dem Schlafen ist es für heute vorbei.“
Trautmann rief Manuela Reisinger an und erzählte ihr, was vorgefallen war. Sie sollte oben und beim Telefon bleiben und erst einmal den Chef anrufen.
Dann verließen Trautmann, der Wachkommandant und die zwei Uniformierten die Inspektion. Rudi hinkte ihnen nach und sagte aufgeregt: „Ich geh auch mit, meine Herren. Weil ich bin ja ein direkter Augenzeuge.“
Sie liefen über den um diese Zeit menschenleeren Karmelitermarkt zur angegebenen Straßenecke am Rande des Markts und Trautmann und Wiesinger, nicht mehr jung und übergewichtig, keuchten bereits.
Das Martinshorn eines rasch näherkommenden Rettungswagens gellte durch die Nacht.
2
Als die kleine Gruppe zur Ecke Im Werd/Krummbaumgasse kam, kümmerten sich die Rettungsleute bereits um zwei in einer Blutlache auf dem Boden Liegende.
Aus den Fenstern der umliegenden Häuser schauten Neugierige. Eine schwer betrunkene, nicht mehr junge Frau torkelte auf der anderen Straßenseite dahin und brabbelte dabei abgerissen das bekannte Lied der Deutschen Margit Sponheimer „Am Ro-hosenmo-hontag bin ich h-ich gebo-horen …“
Bei den beiden Personen handelte es sich um einen jungen Mann und eine junge Frau, beide voll bekleidet, die eng umschlungen mit zerschmetterten Schädeln auf dem Pflaster lagen. Die Rettungsleute hatten Mühe, sie voneinander zu lösen.
Der Rettungsarzt schaute die Polizisten an und sagte: „Exitus. Beide. Nichts mehr zu machen. Die sind jetzt Ihre Sache, meine Herren. Lassen Sie, bitte, die Namen der Toten unserer Zentrale zukommen. Wir müssen ja eine Meldung machen. Mein Name ist Dr. Gloibner, meine Dienstnummer ist 18.“
Dann machte er sich mit seinen Leuten zur Abfahrt bereit.
Trautmann zog sein neues, fototaugliches Handy aus einer seiner Jackentaschen und fotografierte, ehe jemand von der Tatortgruppe kam, die Liegenden aus verschiedenen Blickwinkeln. Fragte dann einen aus dem Eckhaus kommenden, nur notdürftig bekleideten Mann, ob er vielleicht der Hausbesorger sei. Wartete dessen Antwort nicht ab, sondern fragte weiter: „Kennen Sie die zwei?“
„Ja, ich der Hausmeister, Chefe“, sagte der Mann. Er schaute verstört auf die Liegenden. Wandte sich ab und setzte mit zitternder Stimme fort: „Ich Hausmeister und kennen, weil Mann wohnen im Haus. Garçonnière in 6. Stock. Heißen Ahmed Ali Ben Nami. Ist Student, wohnen allein im Haus. Eltern wohnen Hoher Markt, haben Juweliergeschäft. Frau auch kennen, aber nicht wissen, wie heißt. Kommen aber oft, sein Freundin von Herrn Ahmed.“
„Na dann“, sagte Trautmann zu den anderen. „Gehen wir es halt an.“
Er informierte die diensthabende, ebenfalls unterbesetzte Tatortgruppe in der Ast und rief, obgleich der ja von Manuela Reisinger bereits verständigt worden war, seinen Chef, Oberst Sporrer, sowie die zuständige Polizeiärztin, eine Dr. Stauffer, daheim an. Meinte dann zu den aus den Fenstern sehenden Leuten: „Ihr könnts von die Fenster weg und euch wieder niederlegen oder sonst was machen. Für euch gibt es nichts mehr zu sehen.“
Merkte dabei, dass ein Fenster im 6. Stock des Hauses offen stand und der Raum dahinter schwach erleuchtet war. Zu sehen war dort oben niemand, also nahm er an, dass die beiden jungen Leute aus diesem Fenster gesprungen waren. Die Fallrichtung stimmte jedenfalls. Gleichzeitig fragte er sich, ob die beiden freiwillig gesprungen oder doch von jemand hinuntergestoßen worden waren.
„Ich werd mal hinaufgehen und nachschauen“, sagte Trautmann zu seinen Leuten.
Und zum Hausbesorger: „Haben Sie einen Schlüssel für die Wohnung oben?“
„Ja, Chefe. Haben Schlüssel für alle Wohnung. Ist Vorschrift.“
Trautmann wechselte vom Sie ins Du und sagte: „Gut. Und sag nicht Chefe zu mir. Ich bin nur ein gewöhnlicher Inspektor und heiß Trautmann.“
„Ja, Chefe. Ich Gvozden Micic und haben Schlüssel für alle Wohnungen im Haus. Muss ich haben, weil wenn passiert, dass wo Wasserbruch oder anderes. Wenn Mensch allein in Wohnung ist und fallt nieder und ruft um Hilfe. Oder fallen Tür zu und Schlüssel in Wohnung. Dann ich oder mein Frau kommen und aufsperrt.“
„Na gut, Gvozden. Vielleicht ist oben eh offen, aber hol sicherheitshalber den Schlüssel für die Garçonnière und wir gehen hinauf. Meine Kollegen werden da herunten weitermachen.“
Trautmann und der Hausbesorger gingen in das Haus und fuhren, nachdem sie den Schlüssel hatten, mit dem Lift in den 6. Stock.
Die Tür der in Frage kommenden Garçonnière war geschlossen und versperrt. Wie Trautmann feststellte, steckte der Wohnungsschlüssel innen und konnte weder vom Hausbesorger noch von ihm aus dem Schloss gestoßen werden. Also zog Trautmann sein Handy und rief den nur zwei Gassen entfernten Aufsperrdienst an, der, wie er wusste, Tag und Nacht abrufbereit war.
Dann fuhren er und der Hausbesorger wieder nach unten. Trautmann schickte den Mann in seine Wohnung zurück und ging auf die Straße, wo die Tatortgruppe der Außenstelle bereits an der Arbeit war. Wenig später traf auch die Polizeiärztin ein und stellte wie der Rettungsarzt den Tod der beiden jungen Leute fest. Kurz nach ihr tauchte auch Oberst Sporrer auf.
Die Leute der Tatortgruppe schauten sich die Toten genauer an.
Der Mann hatte einen dicken Goldring mit eingravierten arabischen Schriftzeichen an einem Finger der linken Hand und am linken Handgelenk eine teure hauchdünne goldene Armbanduhr der Marke Glashütte. Er hatte eine gut gefüllte Brieftasche in einer der Hosentaschen, die auch einen Ausweis der Universität Wien und einen Führerschein enthielt, aus denen hervorging, dass es sich bei dem Toten um den vierundzwanzigjährigen österreichischen Staatsbürger Ahmed Ali Ben Nami, stud. pharm., handelte.
Die Frau trug eine goldene Halskette mit eingefügten hellen Steinen, wahrscheinlich Diamantsplitter, und an den Fingern drei teuer aussehende Ringe, mit verschiedenfarbigen Steinen besetzt. Auch sie hatte an ihrem linken Handgelenk eine teure Armbanduhr, eine der Marke IWC.
Als der Mann vom Aufsperrdienst kam, fuhr Trautmann mit ihm in den 6. Stock hoch. Das Schloss der Garçonnière erwies sich als kompliziert und außerdem saß der innen steckende Schlüssel fest. Das Schloss musste ausgebohrt werden, damit Trautmann in die Wohnung konnte.
Er unterschrieb dem Mann des Aufsperrdiensts einen Beleg über die geleistete Arbeit, streifte sich Latexhandschuhe über und betrat die Wohnung.
Es gab einen kleinen Vorraum, eine winzige Küche, eine Nasszelle mit Toilette, Dusche, Bidet, Waschbecken und einem verspiegelten kleinen Kasten für Toilettenartikel. An der Tür hingen mehrere saubere Hand- und Frottiertücher sowie zwei Bademäntel.
Im angrenzenden größeren Zimmer befanden sich ein Kleiderkasten, ein großes Doppelbett mit hübschem Überzug, ein Tisch mit zwei einfachen Sesseln, eine Kommode mit TV-Gerät, daneben der übliche Elektronikturm, und ein kleines Regal mit einigen Taschen- und wissenschaftlichen Büchern; darunter ein „Pschyrembel“, das klassische Nachschlagebuch für medizinische Begriffe, das überall dort verwendet wurde, wo es um Krankheiten und deren Behandlung ging. Weiters fanden sich einige Mappen mit ausgedruckten Papieren und Notizen für eine Magisterarbeit sowie ein kleiner Tintenstrahldrucker.
Auf dem Tisch standen zwei Sektgläser und eine halb volle Sektflasche sowie ein kleiner, eingeschalteter Laptop. Auf einem der Sessel lag eine Damenhandtasche aus Krokodilleder.
Trautmann durchsuchte die Tasche und fand darin einige kleinere Euronoten, ein Täschchen mit Schminksachen und eine Brieftasche mit Personalausweis, Führer- und Zulassungsschein sowie einer BankCard von Raiffeisen. Aus den Papieren ging hervor, dass es sich bei der Toten um die zwanzigjährige Leah Goldmann handelte.
Der Raum hatte ein einziges großes, einflügeliges Fenster, das weit offen stand. Trautmann schaute auf den Bildschirm des eingeschalteten Laptops, auf dem das heutige Datum und ein paar Zeilen in Kursivschrift zu lesen waren.
„Wir scheiden aus dieser Welt“, hieß es da, „weil es in ihr für unsere Liebe keine Erfüllung gibt. Leah und Ahmed.“ Um den Laptop und dessen Inhalt kann sich später jemand von den Tatortleuten kümmern, dachte Trautmann. Für ihn war klar, dass die beiden jungen Menschen Selbstmord begangen hatten.
Das lag auf der Hand. Denn es gab in dem Zimmer keine Spuren, die darauf schließen ließen, dass Leah und Ahmed von jemandem aus dem Fenster geworfen worden waren. Schließlich war die Wohnungstür von innen versperrt gewesen.
Außerdem hatten Leah und Ahmed einander umklammert gehalten, als sie aus dem Fenster gesprungen waren. Dass einer den anderen hatte aus dem Fenster werfen wollen und dabei selbst mitgezogen worden war, war unwahrscheinlich. Dagegen sprach der Text auf dem Laptop.
Dass die Liebe der beiden jungen Leute in dieser, unsrigen Welt keine Erfüllung finden konnte, hing vielleicht damit zusammen, dass die beiden infolge ihrer verschiedenen Religionen kein Paar sein durften, mutmaßte Trautmann. Das war zwar ein bisschen weit hergeholt, in Bezug auf die Namen aber immerhin denkbar. Leah Goldmann und Ahmed Ali Ben Nami. Eine Jüdin und ein Moslem.
Also vielleicht doch eine Art von Tötung in gegenseitigem Einverständnis? Ein von der Religion gespeister und unterstützter Irrsinn?
Wenn es um religiöse oder politische Doktrinen ging, waren Mord, Totschlag, Ehrabschneidung, selbst das Absurdeste möglich und wurden womöglich als heilige Handlung aufgefasst. Die Geschichte der Religionen und die der Politik waren ja im Grunde eine Aufzählung von Gräueltaten. Jeder, der sich als zugehörig zu einer Arschlochpartie von einigen Auserwählen fühlte, war wenn es drauf ankam zu allem bereit.
Trautmann verließ die Garçonnière, ohne das offene Fenster zu schließen, weil es an ihm mögliche Spuren für die Tatortleute geben konnte. Er lehnte die ja nicht mehr versperrbare Wohnungstür nur an, klebte zwischen Tür und Türstock die übliche Polizeibanderole, die er in den vollgestopften Taschen seiner Jacke immer mithatte, und ging, während er sich eine Zigarette rollte und anzündete, zum Aufzug. Rauchte im Aufzug trotz eines unübersehbaren Aufklebers, der eine durchgestrichene Zigarette zeigte, weiter, weil er bereits Entzugserscheinungen verspürte und ihm in diesem Moment alle Aufkleber der Welt wurscht waren. Auch die waren ja, Trautmanns Meinung nach, eine Angelegenheit von Fanatikern.
Als er auf die Straße kam, waren die Kollegen vom Tatort bereits mit ihrer Arbeit fertig, kümmerten sich die Männer des überraschend schnell eingetroffenen Leichentransports um den Abtransport der beiden Toten.
Trautmann zog sein Handy, informierte Reisinger über das bisher Geschehene und ging mit Oberst Sporrer und dem Inspektionskommandanten in die Leopoldsgasse zurück. Die uniformierten Kollegen blieben vorläufig noch vor Ort, um die bald eintreffenden Männer der Straßenreinigung, welche die Berge der von den Faschingsnarren weggeworfenen leeren Flaschen und anderen Müll wegzuräumen hatten, anzuweisen, das Blut der beiden Toten und die Kreidezeichnungen der Tatortleute wegzuwaschen.
3
Kurz nach 8.00 Uhr machten sich Trautmann und Oberst Sporrer auf den Weg zu den Eltern der beiden Selbstmörder, deren Adressen Manuela Reisinger ermittelt hatte, um diese über den Tod ihrer Kinder zu informieren.
Noah und Ruth Goldmann waren beide knapp über sechzig und brachen beinahe zusammen, als sie vom Tod ihres einzigen Kindes erfuhren.
Sie hatten sich in Israel kennengelernt und 1975 geheiratet, waren dann aber nach Wien gekommen und hatten sich dort ein gemeinsames Leben aufgebaut. Sie besaßen im 2. Bezirk ein großes, gut gehendes Damenkleidergeschäft. 1992 war dann Leah zur Welt gekommen und von da an war das Glück der Goldmanns groß gewesen. Sie waren geachtete und spendenfreudige Mitglieder der Israelitischen Kultusgemeinde und strenggläubig. Dass sich ihre Tochter mit einem Mann mit arabischem Hintergrund eingelassen hatte, hatten sie nicht gewusst. Sie wären, wenn sie das gewusst hätten, mit dieser Verbindung nicht glücklich gewesen, hätten sie aber doch geduldet, wenn der Mann zum mosaischen Glauben übergetreten wäre und eventuelle Kinder nach den Gesetzen dieser Religion erzogen worden wären.
Beide konnten nicht verstehen, dass ihnen Leah, die ihnen doch sonst alles gesagt hatte, diese Verbindung verschwiegen hatte. Aber jedenfalls war für sie durch den Freitod Leahs ihr Leben zerstört und sinnlos geworden und sie konnten sich nicht vorstellen, wie es jetzt weitergehen sollte.
Schlimmer war es bei den Eltern Ahmeds. Die waren zwar ebenfalls bereits österreichische Staatsbürger und seit Jahrzehnten in Wien, aber im Herzen waren sie doch Libyer und strenggläubige Muslime geblieben.
Sie bedauerten zwar den Tod ihres Sohnes, fühlten sich aber dadurch getröstet, dass Allah den ehrenhaften Tod Ahmeds gnadenhaft zur Kenntnis nehmen und diesem seine Liaison mit einer verfluchten Jüdin verzeihen würde, weil er ja sah, dass der Junge zwar gefrevelt, aber das mit seinem Tod von eigener Hand gebüßt hatte.
„Allah ist groß und allmächtig“, sagte der Vater. „Er weiß, was bis in alle Ewigkeit geschehen wird, weil das in seinem Buch festgeschrieben steht.“ Und mehr zu sich: „Jedenfalls hat mein Ahmed eine gebärfähige Jüdin mit in den Tod genommen und so verhindert, dass sie weitere Juden zur Welt bringt.“
Als Trautmann und Sporrer auf dem Weg in die Leopoldsgasse waren, wo die anderen sicher schon warteten, sagte Sporrer: „Nicht zu glauben, wie manche Menschen denken, die Eltern sein wollen. Dieser Mann hält den Selbstmord seines Sohnes für verdienstvoll, weil er dadurch eine gebärfähige Jüdin daran gehindert hat, Kinder in die Welt zu setzen. Das ist ja ärger als das, was die Scharia vorschreibt.“
Sporrer, der ja selbst Kinder hatte und diese liebte, fand die Aussage von Ahmeds Vater widernatürlich und grauenhaft.
„Gegen so was kannst nicht anrennen“, sagte Trautmann. „Vergiss das besser, was dieser alte Trottel gesagt hat, Karli.“ Das war einer der seltenen Fälle, in denen Trautmann Sporrer, den er in der Regel Chef oder Oberst nannte, mit dessen Vornamen ansprach.
Und er setzte fort: „Zum Glück sind ja nicht alle Mohammedaner so. Die meisten sind ja vernünftige Leute. Nur die, was sich auch bei uns nach der Scharia richten, nach der fast alles verboten ist und mit Prügelstrafe oder Handabhacken oder Steinigung bestraft werden soll, gehörten in die Würste oder ausgewiesen. Solche Leut haben bei uns in Österreich nichts verloren. Und überhaupt kannst die ganzen Religionen vergessen. Außer dem Buddhismus sind die ja alle jetzt noch oder waren es früher blutrünstig. Unsere Kreuzzüge waren ja auch kein Schmarrn. Und was sich jetzt die Sunniten und Schiiten und Kopten und Hindus und Sikhs einander antun, ist ja auch nicht schwach. Und auch wir Buddhisten haben allerhand Dreck am Stecken.“
„Das weiß ich, aber trotzdem versteh ich die Leut nicht“, sagte Sporrer, „was in denen ihren Schädeln vorgeht. Wurscht, welchem Glauben sie angehören. Die meisten Religionen haben nie was Gutes gebracht. Jede hält sich für die einzig wahre und möchte am liebsten alle anderen Menschen als Ungläubige oder Ketzer vernichten. Das war schon immer so und wird auch so bleiben. Wer sich für auserwählt hält, muss ja alle anderen für minderwertig oder, wie die Nazis gesagt haben, für lebensunwert halten. Jetzt sind es halt manche Muslime und Juden, und früher waren es die Nazis. Manchmal glaub ich, dass die Welt ohne uns Menschen schöner wär.“
Trautmann nickte bestätigend. „Das glaub ich schon lang, Karli. Aber wir sind halt einmal da, da kannst nichts machen. Der Buddha hat ja nicht umsonst gesagt, dass die Masse der Menschen von Gier, Hass und Wahn erfüllt und wie ein wirres Garnknäuel ist. Dass die, was ihm nicht glauben, weggehören, das hat er nicht gesagt. Darum lassen wir alle anderen glauben, was sie halt glauben, und wenn es der größte Blödsinn ist. Umbringen tun wir deswegen keinen. Solange einer nicht erleuchtet ist, ist er dem Ich-Wahn und der Welt der Erscheinungen verfallen und Gier, Hass und Wahn und damit dem Leiden ausgesetzt, weil er für wirklich hält, was nur täuschende Phänomene sind, die aus der großen Leere kommen.“
„Aha“, sagte Sporrer. „Aber wer von euch verhält sich denn schon danach. Das ist mir zu hoch, wie das ganze Religions- und Philosophiezeug. Ich bin Agnostiker und weder auf dem Weg ins Nirwana noch in irgendein Himmelreich. Ich leb jetzt und halte alles, mit was ich zu tun hab, für wirklich. Und von mir aus kann, wenn ich tot bin, die Sintflut kommen.“
„Sollst recht haben, Chef. Und wahrscheinlich ist überhaupt alles, was wir denken, nur ein Schas mit Quasteln. Und jetzt hören wir mit dieser Rederei auf, schließlich sind wir Polizisten und keine Dampfplauderer.“
„Richtig. Stimmt genau. Die Polizei hält sich an Gesetze und Regeln und befasst sich mit dem, was vorgefallen ist. Alles andere ist, wie der seinerzeitige Bundeskanzler Sinowatz gesagt hat, sehr kompliziert. Darüber sollen sich andere den Kopf zerbrechen.“
Damit endete der im Grunde sinnlose Diskurs der beiden über Angelegenheiten, die sie sowieso nicht lösen konnten.
Bevor sie in ihre Ast gingen, kaufte sich Trautmann auf dem Karmelitermarkt noch schnell zwei dick mit Pferdeleberkäse belegte Semmeln, weil er ja auch noch dem Ich-Wahn verfallen war und nagenden Hunger verspürte.
Viele der Standinhaber und auch einige Kunden waren wegen des Faschingsdienstags kostümiert, wozu Trautmann bemerkte: „Die meisten hätten sich gar nicht kostümieren brauchen, weil sie ja schon normal wie Trotteln ausschauen, was sie ja durch die Bank auch sind.“
Im Dienstzimmer der Gruppe warteten bereits der Stadthauptmann des 2. Bezirks, Manuela Reisinger sowie Dolezal und Lassinger, die zwar von ihrem außertourlichen Einsatz beim Russenball müde waren, aber doch zum Dienst erschienen waren.
Trautmann kochte sich Kaffee und aß seine Leberkässemmeln, während Sporrer berichtete, was er von den Eltern der Selbstmörder erfahren hatte.
„Alles in allem“, fasste der Stadthauptmann zusammen, „ist der ungute Vorfall ja geklärt. Wir wissen, woran wir sind, können unsere Meldung machen und haben mit der Geschichte nichts mehr zu tun.“
„Genau, Hofrat“, sagte Trautmann mit vollem Mund. „So was kommt halt immer wieder vor, wir werden das nicht ändern. Das ist alltäglich. Weil wenn einer nimmer will, dann will er nimmer und haut halt den Hut drauf.“
„Aber traurig ist es doch“, meinte Reisinger und sie erinnerte sich an das vor mehr als hundert Jahren geschriebene Theaterstück „Rosenmontag“ über zwei Liebende, die so verschiedenen sozialen Ursprungs waren, dass eine dauerhafte Verbindung infolge der damals starren Konventionen für sie nicht in Frage kam, und die deswegen an einem Rosenmontag gemeinsam in den Tod gingen.
„Das ist ja wie in dem mehr als hundert Jahre alten Stück ,Rosenmontag‘“, sagte sie zu den anderen. „Ganz genau so. Nur die Verhältnisse sind anders.“
„Da komm ich nicht mit“, sagte Dolezal. „Der Rosenmontag war gestern und was hat der Schmieranski vor hundert Jahren darüber geschrieben?“
„Der Schmieranski hat Otto Erich Hartleben geheißen und hat ein Stück über zwei Liebende geschrieben, die gemeinsam in den Tod gehen, weil sie …“
„Das ist ja jetzt wurscht“, unterbrach sie Trautmann. „Haben sie sich halt umgebracht, wie unsere zwei. Jeder tragt halt sein Binkerl, Mani. Und manchen wird das Binkerl halt irgendwann zu schwer und er macht ein Ende und markiert ab. Das werden du und ich nicht ändern. Außerdem haben wir jetzt keine Zeit, um über alte Theaterstückln zu reden.“
„Richtig“, sagte Sporrer. „Wir halten hier ja kein Literaturseminar ab.“
„Das meine ich auch“, sagte der Stadthauptmann, den es am heutigen Tag vor lauter Verpflichtungen hin und her riss. „Also bitte ich jetzt um Entschuldigung, denn ich habe noch eine Menge Verpflichtungen am Hals, denen ich leider nachkommen muss.“
„Das kann ich mir vorstellen“, sagte Sporrer. „Sie sind gerne entschuldigt, Herr Hofrat.“
Nachdem der Stadthauptmann weg war, teilte Sporrer die Leute der Gruppe Trautmann für den heutigen Tag ein.
„Also, Kinder – die Gruppe kann jetzt einmal nach Haus gehen und eine Handvoll schlafen. Aber um 14.00 Uhr sind alle wieder gestellt. Dann tun wir weiter.“
„Was heißt, wir tun weiter?“, maulte Dolezal. „Jetzt sind wir ja eh schon fast vierundzwanzig Stunden im Dienst. Sollen wir alle mit Magengeschwüren und einem Herzkasperl umfallen?!“
„Scheiß dich nicht an, Burschi“, sagte Trautmann. „Solche Typen wie du fallen nicht so leicht um. Die können hundert Stunden lang ununterbrochen Dienst machen.“
„Richtig“, setzte Sporrer hinzu. „Wenn dir, Burschi, unser Dienst nicht passt, hättest zu den Mistküblern gehen sollen. Die machen jeden Tag schon zu Mittag oder noch früher Schluss.“
„Ich sag ja eh nichts“, brummte Dolezal. „Okay, Chef. Und was machen wir dann um 14.00 Uhr? Aus dem Fenster gesprungen sind eh schon zwei und sonst wird sich für uns kaum was tun, weil heut keine Sau auf Gewalt aus ist, alles ist Liebe und Waschtrog und Dulliöhstimmung.“
„Das muss aber nicht so sein, Burschi. Keiner weiß, was in der nächsten Sekunde passiert. Also nochmals – nach 14.00 Uhr gehen Trautmann und du in den Wurstelprater, wo beim Riesenrad ein Faschingsremmidemmi stattfindet. Bei so was gibt es immer Typen, die unbedingt Bröseln machen wollen. Reisinger und Lassinger gehen auf den Karmelitermarkt, von dem aus sich ein Faschingszug in Richtung Augarten bewegen wird. Und ich halte da die Stellung und arbeite ein paar Akten auf, die schon wochenlang herumliegen. Also abtreten und ausgeruht und ohne Alkoholfahne wiederkommen.“
Als die Gruppe weg war und Sporrer anstatt Akten zu wälzen ebenfalls gehen wollte, kam ein Tatortmann ins Zimmer. Er hatte den Laptop und Drucker Ahmeds in den Händen und stellte beide auf einen Schreibtisch.
Als er zu reden beginnen wollte, hob Sporrer die Hand und sagte: „Geht das nicht am Nachmittag? So ab 14.00 Uhr? Ich wollte nämlich gerade in einer dringenden Sache weg.“
„Das kannst eh“, sagte der Tatortmann. „Was ich dir sagen will, dauert keine Sekunde. Es geht um den Laptop von diesem Selbstmörder. Der und der Drucker sind so gut wie neu. Der Laptop wurde erst vor vier Wochen in Betrieb genommen. Passwort hat er keines und Internet und andere Schmankerln auch nicht. Nur ein paar Dateien, in denen es um die Zusammensetzung von Medikamenten und deren Wirkungsweise auf gewisse Organe und so was geht. Anscheinend hat er das aus allen möglichen Büchern abgeschrieben, in den Fußnoten darauf hinweisend. Für uns im Zusammenhang mit dem Selbstmord uninteressant.“
Er schaute auf einen Notizzettel. „Oder interessiert dich, in welcher Menge sich Medikamente wie Monoket, Diltiazem oder Vasonit schädlich auf die Leber oder seltener auf die Nieren auswirken?“
„Nicht einmal am Rand“, sagte Sporrer. „Es gibt also nur die kursiv geschriebenen Zeilen, die auf dem Bildschirm waren. Die hast du doch gespeichert, oder?“
„Logisch, Sporrer. Abgespeichert wie nur was.“
„Dann danke ich für die prompte Arbeit und mach mich jetzt auf den Weg. Servus.“
„Servus“, brummte der Tatortmann und meinte, als Sporrer aus dem Zimmer war, zu sich: „Erst wollen s’ alles sofort und dann haben s’ keine Zeit und rennen weg. Wenn ich noch einmal auf die Welt komm, werd ich auch Oberst oder so was. Tatortler jedenfalls nicht mehr.“
4
Als Trautmann und Dolezal zum Riesenrad kamen, tat sich dort eigentlich nicht viel, obgleich die Praterunternehmer ein großes Event mit Showeinlagen angekündigt hatten, von dem sie sich einen riesigen Erfolg erwarteten.
Es gab zwar ein Bierzelt einer bekannten Brauerei, mehrere Würstelstände und jede Menge hochprozentige Sauferei; weiters einen Stand mit Riesenschaumrollen und anderen Süßigkeiten, die aber aussahen, als würden sie schon zum x-ten Mal ausgestellt, und einen Tisch mit Faschingsschnickschnack – es waren aber kaum mehr als fünfzig Besucher da.
Ein trübsinnig aussehender älterer Mann mit laufender Nase verkaufte Luftballons und unter der Hand Spielkarten, auf denen statt der üblichen Symbole pornografische Szenen abgebildet waren. Ein paar kostümierte Praterunternehmer mit großen roten Papiernasen versuchten krampfhaft, so etwas wie Stimmung aufkommen zu lassen, scheiterten aber damit. Einige Jugendliche waren dabei, sich ins Koma zu saufen, und eine heruntergekommene ehemalige Prostituierte offerierte keinen Sex mehr, sondern bettelte die wenigen Besucher um Geld an.