
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Insel Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Susan Ryeland ermittelt
- Sprache: Deutsch
Susan Ryeland, Lektorin außer Dienst, führt mit ihrem Lebensgefährten das zauberhafte kleine Hotel Polydoros auf Kreta. Aber ganz so idyllisch ist es dann doch nicht, denn der Alltag mit den ewig unzuverlässigen Lieferanten, unpünktlichen Angestellten und den nicht immer einfachen Gästen, macht das Inselleben anstrengender, als sie es sich vorgestellt hat. Auch ihre Beziehung leidet unter dem Stress, und Susan vermisst ihr altes Leben in London.
Da kommt das Ehepaar Treherne gerade recht. Sie erzählen eine bizarre Geschichte von einem Mord in ihrem Hotel Branlow Hall just am Hochzeitstag ihrer Tochter Cecily. Und als sie schildern, wie Cecily verschwunden ist, kurz nachdem sie Atticus unterwegs gelesen hat, den Roman, den Susan seinerzeit lektoriert hat, wird ihr klar, dass sie dringend nach England muss. Die 10.000 Pfund, die die Trehernes für Susans Hilfe anbieten, sind ein zusätzlicher Anreiz.
Aber bei dem Versuch das Rätsel zu lösen und Cecily zu finden, wird Susan in ein Labyrinth aus Lügen und Intrigen verstrickt und gerät selbst in tödliche Gefahr …Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 803
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Titel
Anthony Horowitz
Der Tote aus Zimmer 12
Roman
Aus dem Englischen von Lutz-W. Wolff
Insel Verlag
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
Die Originalausgabe erschien 2020 unter dem Titel Moonflower Murders bei Penguin Random House, UK, London
eBook Insel Verlag Berlin 2022
Der vorliegende Text folgt der deutschen Erstausgabe, 2022.
© der deutschsprachigen Ausgabe Insel Verlag Anton Kippenberg GmbH & Co. KG, Berlin, 2022Copyright © 2020 by Anthony Horowitz
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung von hißmann, heilmann, hamburg unter Verwendung des Originalumschlags von Penguin Random House UK, Illustration: Sinem Erkas
eISBN 978-3-458-77324-5
www.suhrkamp.de
Widmung
Für Eric Hamlish und Jan Salindar mit Dank für all die guten Zeiten
Der Tote aus Zimmer 12
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Widmung
Inhalt
Informationen zum Buch
Cover
Titel
Impressum
Widmung
Kreta, Agios Nikolaos
Abreise
Zeitungsausschnitte
Ankunft in Branlow Hall
Lisa Treherne
Der Nachtportier
FaceTime
Heath House, Westleton
Branlow Cottage
E-Mails etc.
Drei Schornsteine
Nightcaps
Framlingham
Martlesham Heath
Lawrence Treherne
Ladbroke Grove
Le Caprice, London
Cecily Treherne
Lionel Corby (Frühstück)
Michael Bealey (Lunch)
Craig Andrews (Dinner)
Seite eins
1 Clarence Keep
2 Algernon Marsh
3 Das Lösegeld der Königin
4 Schatten und Geheimnisse
5 Der Ludendorff-Diamant
6 Schuld und Sühne
7 Eine Frage der Zeit
8 Ein Opfer der Flut
9 Am Tatort
10 Komm, süßer Tod
11 Dunkelheit senkt sich herab
I
II
III
IV
V
VI
VII
12 Eine Verhaftung
13 Post mortem
14 Fahrerflucht
15 Das Mädchen auf der Brücke
16 Pünd sieht das Licht
17 Im Hotel Moonflower
18 Stelle frei
Das Buch
Zwei weitere Tage
Eloise Radmani
Wieder in Westleton
Katie
Die Eule
Die Moonflower Suite
Her Majesty’s Prison Wayland
Der Mörder
Checkout
Letzte Worte
Die Höhle des Zeus
Informationen zum Buch
Kreta, Agios Nikolaos
Das Polydoros ist ein charmantes, familiengeführtes Hotel, nur ein paar Schritte entfernt von der lebhaften kleinen Stadt Agios Nikolaos auf Kreta, eine Stunde östlich der Inselhauptstadt Heraklion. Die Apartments – viele mit Meerblick – sind klimatisiert, haben WLAN und werden täglich gereinigt. Auf unserer herrlichen Sonnenterrasse servieren wir Kaffee und einheimische Küche. Besuchen Sie uns auf unserer Webseite oder auf Booking.com.
Sie können sich gar nicht vorstellen, wie lange ich gebraucht habe, um die paar Zeilen zu schreiben. Ich habe mir Sorgen gemacht, dass sich zu viele Adjektive auftürmen könnten. War »lebhaft« das richtige Wort, um Agios Nikolaos zu beschreiben? Ich hatte erst »geschäftig« geschrieben, aber dann dachte ich, das klingt womöglich nach endlosen Autokolonnen und Lärm. Die gab es ja auch auf Kreta, und nicht zu knapp. Ins Stadtzentrum brauchte man eine Viertelstunde. Waren das »ein paar Schritte«? Hätte ich vielleicht erwähnen sollen, dass der Ammoudi Beach direkt nebenan liegt?
Das Komische ist, dass ich fast mein ganzes Arbeitsleben als Lektorin zugebracht und keinerlei Probleme gehabt habe, Manuskripte zu redigieren. Warum geriet ich jetzt plötzlich ins Schwitzen, als ich einen kleinen Text für eine Reklamepostkarte schreiben sollte? Am Ende gab ich ihn Andreas, der einen kurzen Blick darauf warf und zustimmend grunzte, was mich einerseits befriedigte, andererseits aber auch ärgerte, nach all der Mühe, die ich mir damit gegeben hatte. Die Griechen sind sehr emotional. Ihre Musik, ihre Gedichte und ihre Theaterstücke gehen direkt ins Herz. Aber es war mir schon länger aufgefallen, dass sie bei den kleinen Dingen des Alltags eher gleichgültig sind. Da heißt es schnell mal »siga, siga«, was so viel bedeutet wie: »Ist doch egal!« Das war so ein Satz, den ich jeden Tag hörte.
Während ich bei einer Zigarette und einer Tasse schwarzem Kaffee noch einmal durchlas, was ich geschrieben hatte, gingen mir zwei Dinge durch den Kopf: Wozu sollten die Karten eigentlich gut sein, wenn sie bloß an der Rezeption auf dem Tresen lagen? Dann waren die Leute doch schon im Hotel. Und außerdem: Was machte ich eigentlich hier? Wie hatte ich zulassen können, dass ich mich mit solchen Fragen beschäftigen musste?
Zwei Jahre vor meinem fünfzigsten Geburtstag, in einem Alter, in dem ich eigentlich die Früchte eines passablen Einkommens, eine hübsche kleine Eigentumswohnung in London und einen mit Einladungen prall gefüllten Kalender hätte genießen sollen, war ich plötzlich zur Miteigentümerin und Managerin eines Hotels auf Kreta geworden. Es war allerdings viel schöner, als ich es beschrieben hatte. Das Polydoros lag direkt am Wasser und hatte zwei Terrassen im Schatten von Tamarisken und Sonnenschirmen. Es gab nur sieben Zimmer, aber junges, engagiertes Personal aus der Gegend, das auch in den größten Krisen noch fröhlich blieb, und äußerst loyale Stammgäste. Wir boten traditionelle Küche, das gute Mythos-Bier, einen eigenen Musiker und einen fantastischen Ausblick aufs Meer. Unsere Gäste würden im Traum nicht daran denken, in solchen Monsterbussen zu reisen, wie ich sie täglich in den engen Gassen auf ihrem Weg zu den sechsstöckigen Bettenburgen auf der anderen Seite der Bucht beobachten konnte.
Bedauerlicherweise hatten wir auch ziemlich hinterlistige elektrische Leitungen, völlig indiskutable Abwasserrohre und stotterndes WLAN. Ich will hier nicht in klassische Vorurteile über die Griechen verfallen, und vielleicht hatten wir einfach Pech, aber ich hatte leider nicht das Gefühl, dass unsere Angestellten sehr zuverlässig waren. Panos war ein hervorragender Koch, aber wenn er Ärger mit seiner Frau, seinen Kindern oder seinem Motorrad hatte, erschien er einfach nicht zum Dienst und Andreas musste in die Küche. Ich durfte dann sowohl die Bar als auch das Restaurant übernehmen, die entweder völlig überfüllt, aber bedauerlicherweise ohne Bedienungen waren, oder halb leer – mit Kellnern, die sich auf den Füßen herumtraten. Ein vernünftiges Gleichgewicht schien sich nie herzustellen. Dass einer unserer Lieferanten mal pünktlich war, kam durchaus vor, aber dann hatte er bestimmt nicht die Waren dabei, die wir bestellt hatten. Wenn irgendwas kaputtging – und alles ging ständig kaputt – erlebten wir jedes Mal bange Stunden des Wartens, in denen wir uns fragten, ob der Klempner oder der Mechaniker tatsächlich kommen würde.
Unsere Gäste waren offenbar zufrieden. Aber Andreas und ich rannten herum wie die Schauspieler in einer französischen Komödie, die ununterbrochen irgendwelche Katastrophen verhindern mussten, und wenn ich morgens um eins oder zwei endlich ins Bett fiel, war ich so erschöpft, dass ich mich wie eine vertrocknete Mumie in einem Leichentuch fühlte. Das war dann immer der Tiefpunkt, denn ich wusste, sobald ich aufwachte, würde alles wieder von vorne anfangen.
Ich glaube, jetzt male ich alles zu schwarz. Natürlich gab es auch schöne Dinge. Ein Sonnenuntergang in der Ägäis ist unvergleichlich, und ich konnte ihn jeden Abend mit verzauberten Augen bestaunen. Kein Wunder, dass die Griechen an Götter glaubten: Helios braust mit seinem goldenen Wagen über den riesigen Himmel, die Berge von Lasithi verwandeln sich in schimmernde Schleier von Rosa und Violett, bis sie immer dunkler werden und schließlich verdämmern. Jeden Morgen um sieben schwamm ich im Meer und spülte im kristallklaren Wasser die Spuren des Weins und der Zigaretten ab. Dann gab es noch die intimen Abendessen auf den Terrassen der kleinen Tavernen in Fourni und Limnes, wo es nach Jasmin duftete, das laute Lachen und das Klingen der Gläser unter dem Sternenhimmel. Ich hatte sogar angefangen, Griechisch zu lernen, drei Stunden die Woche, mit einem jungen Mädchen, das meine Tochter hätte sein können, aber es irgendwie schaffte, die vertrackten Betonungen und die nicht nur unregelmäßigen, sondern geradezu unanständigen Verben zum echten Vergnügen zu machen.
Aber Ferien waren das alles nicht. Ich war nach einer Katastrophe nach Kreta gekommen, die mich fast umgebracht hätte. Das letzte Buch, an dem ich als Lektorin gearbeitet hatte, hatte den Autor das Leben gekostet, meine Karriere beendet und den Verlag ruiniert … in genau dieser Reihenfolge. Ich hatte gedacht, ich könnte noch jahrelang Atticus-Pünd-Romane herausbringen und mich an ihrem Erfolg freuen, aber es hatte nicht sein sollen. Stattdessen hatte ich ein »neues Leben« begonnen, und das bestand aus beinharter Arbeit.
Das hatte auch mein Verhältnis zu Andreas verändert. Wir stritten uns nicht etwa – das war nicht unsere Art. Aber unsere Beziehung war wortkarg und vorsichtig geworden, wir umkreisten uns wie zwei Boxer, die keine Lust auf den Kampf haben. Vielleicht wäre ein richtiger Schlagabtausch besser gewesen. Wir waren auf das fatale Gelände geraten, auf dem das Ungesagte schlimmer war als das, was man sagte. Wir waren aber kein altes Ehepaar. Andreas hatte mir zwar einen klassischen Heiratsantrag mit Diamantring und Kniefall gemacht, aber danach waren wir viel zu beschäftigt mit anderen Dingen gewesen, um die Sache zum Abschluss zu bringen. Außerdem war mein Griechisch noch nicht gut genug, um die Trauungszeremonie ordentlich zu absolvieren. Wir hatten beschlossen zu warten.
Die Zeit hatte nicht zu unseren Gunsten gearbeitet. In London war Andreas mein bester Freund gewesen. Schon deshalb, weil wir nicht zusammenlebten, hatte ich mich immer darauf gefreut, ihn zu sehen. Wir lasen dieselben Bücher. Wir liebten es, zu Hause zu essen, besonders wenn Andreas kochte. Wir hatten fabelhaften Sex. Aber in Kreta saßen wir in der Falle, und obwohl wir England erst vor ein paar Jahren verlassen hatten, suchte ich bereits nach einem Ausweg, allerdings nicht bewusst.
Das war auch nicht nötig. Der Ausweg trat eines Montagvormittags in Gestalt eines gutgekleideten englischen Ehepaars auf, das Arm in Arm die Treppe von der Hauptstraße zu uns herunterkam. Ich sah sofort, dass sie eine Menge Geld hatten und nicht im Urlaub waren. Er trug trotz der Hitze ein Jackett über seinem Polohemd, lange Hosen mit Bügelfalten und einen Strohhut. Ihr Kleid wiederum schien besser für eine Party im Tennisclub geeignet als für den Strand, und das galt auch für die feine Perlenkette und die Handtasche, die an ihrem Arm hing. Beide trugen sehr teure Sonnenbrillen. Ich schätzte, dass sie ungefähr sechzig waren.
Der Mann löste sich von seiner Frau und kam in die Bar. Ich sah, wie er mich musterte. »Entschuldigen Sie«, sagte er. »Sprechen Sie Englisch?«
»Ja.«
»Ich weiß nicht … Sind Sie zufällig Susan Ryeland?«
»Ja, die bin ich.«
»Hätten Sie vielleicht einen Augenblick Zeit, Miss Ryeland? Mein Name ist Lawrence Treherne. Das ist Pauline, meine Frau.«
»Guten Tag.« Pauline Treherne lächelte, aber durchaus nicht freundlich. Sie kannte mich nicht, misstraute mir aber gründlich.
»Darf ich Ihnen einen Kaffee bringen?« Ich formulierte meine Frage sehr vorsichtig. Ich hatte nicht die Absicht, sie einzuladen. Ich bin zwar nicht geizig, aber wir hatten Geldsorgen. Ich hatte meine Wohnung in London verkauft und den größten Teil meiner Ersparnisse in das Polydoros gesteckt, aber bisher hatte ich noch keinen Euro damit verdient. Ganz im Gegenteil: Es schien mir, als ob wir nichts falsch machten, aber wir steckten tief in den Miesen und schuldeten der Bank fast zehntausend Euro. Unser Kapital versickerte irgendwie, und manchmal hatte ich das Gefühl, dass der Abstand zwischen mir und einem Bankrott nicht größer war als der Schaum auf einem Gratis-Cappuccino.
»Nein, nein, danke. Wir haben alles, was wir brauchen.«
Ich führte sie zu einem Tisch im Innenraum der Bar. Die Terrasse war schon ziemlich voll, aber Vangelis schien gut damit zurechtzukommen, und drinnen war es auch kühler. »Was kann ich für Sie tun, Mr Treherne?«
»Nennen Sie mich Lawrence, bitte.« Er nahm den Hut ab und entblößte silbergraues Haar. Den Hut legte er vor sich auf den Tisch. »Entschuldigen Sie, dass wir Sie bis hierher verfolgen. Wir haben einen gemeinsamen Freund – Sajid Khan. Er lässt Sie übrigens grüßen.«
Sajid Khan? Ich brauchte einen Moment, um mich daran zu erinnern, dass er der Rechtsanwalt von Alan Conway, dem Verfasser der Atticus-Pünd-Romane, gewesen war. Er lebte genau wie Conway in Suffolk, und als Alan gestorben war, hatte Sajid Khan die Leiche gefunden. Ich hatte ihn ein paar Mal getroffen, hätte ihn aber nicht direkt als Freund bezeichnet.
»Sie leben also in Suffolk?«, sagte ich.
»Ja. Wir haben ein Hotel in Woodbridge. Mr Khan hat uns gelegentlich geholfen.« Treherne zögerte, als ob ihm plötzlich unbehaglich wäre. »Ich habe letzte Woche eine ziemlich heikle Frage mit ihm erörtert, und er hat angeregt, dass wir mit Ihnen sprechen.«
Ich fragte mich, woher Sajid Khan wusste, dass ich hier in Kreta war. Irgendjemand musste es ihm erzählt haben, und ich war das mit Sicherheit nicht gewesen. »Sie sind den ganzen weiten Weg gekommen, um mit mir zu reden?«, fragte ich.
»Nun ja, so weit ist es nun auch wieder nicht, und wir reisen ohnehin viel. Wir wohnen im Minos Beach.« Er zeigte über den Tennisplatz auf das Hotel direkt neben unserem. Das bestätigte meine Vermutung, dass die Trehernes reiche Leute sein mussten. Das Minos Beach ist ein Fünfsterne-Boutique-Hotel mit kleinen Villen, einem Privatstrand und einem Garten voller Skulpturen. Eine Übernachtung kostet so ungefähr 300 Pfund. »Ich hatte überlegt, ob ich Sie anrufen soll«, sagte er. »Aber diese Angelegenheit wollte ich nicht am Telefon besprechen.«
Die Sache wurde immer mysteriöser – und ehrlich gestanden auch ärgerlicher, wie ich fand. Ein Vier-Stunden-Flug von Stansted nach Kreta. Eine weitere Stunde mit dem Wagen von Heraklion nach Agios Nikolaos. Ein Spaziergang war das nun auch nicht gerade. »Worum geht es denn?«, fragte ich.
»Um einen Mord.«
Das Wort hing unheilvoll in der Luft. Auf der anderen Seite der Terrasse schien die Sonne. Ein paar Kinder plantschten lachend im flachen Wasser. An den Tischen drängten sich die Familien. Ich sah Vangelis mit einem Tablett voller Orangensaft und Eiskaffee zu ihnen hinausbalancieren.
»Was für einen Mord?«, fragte ich.
»Den Mord an einem gewissen Frank Parris. Der Name sagt Ihnen nichts, aber Sie kennen vielleicht das Hotel, wo er umgebracht wurde. Es heißt Branlow Hall.«
»Und das ist Ihr Hotel?«
»Ja, genau.« Jetzt antwortete zum ersten Mal seine Frau. Sie sprach wie ein weniger bekanntes Mitglied der königlichen Familie und schien jedes Wort mit der Nagelschere zurechtgeschnitten zu haben, ehe sie es ins Freie entließ. Ich hatte aber das Gefühl, dass sie genauso Mittelklasse war wie ich. »Er hatte drei Nächte gebucht. In der zweiten Nacht ist er umgebracht worden.«
Ein ganzer Schwarm von Fragen flatterte mir durch den Kopf. Wer war dieser Frank Parris? Wer hatte ihn umgebracht? Was ging mich das an? Aber ich sprach sie nicht aus. Ich fragte: »Und wann ist das passiert?«
»Vor acht Jahren«, sagte Treherne.
Seine Frau stellte ihre Handtasche auf den Tisch neben den Strohhut, als wollte sie damit signalisieren, dass sie die Sache jetzt in die Hand nehmen würde. Sie hatte etwas an sich – die Art, wie sie ihr Schweigen einsetzte, ebenso wie den Mangel an Emotion –, was mir den Eindruck vermittelte, dass sie diejenige war, die die Entscheidungen traf. Ihre Sonnenbrille war so schwarz, dass ich mich darin spiegelte, als sie das Wort an mich richtete. Ich konnte mir selbst beim Zuhören zusehen.
»Es wäre vielleicht ganz nützlich, wenn Sie die ganze Geschichte erfahren«, sagte sie mit ihrer schneidenden Stimme. »Dann verstehen Sie, warum wir hier sitzen. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen Zeit?«
Ich hatte ungefähr fünfzig dringende Dinge zu tun. »Aber ja!«, sagte ich.
»Danke.« Sie sammelte ihre Gedanken. »Frank Parris hatte eine Werbeagentur«, sagte sie. »Er war gerade aus Australien nach England zurückgekommen, wo er einige Jahre gelebt hatte. Am frühen Nachmittag des 14. Juni 2008 wurde er in seinem Hotelzimmer tot aufgefunden. Er war in der Nacht auf sehr brutale Weise ermordet worden. Das Datum weiß ich deshalb noch so genau, weil an diesem Tag unsere Tochter Cecily geheiratet hat.«
»Gehörte er zu den Hochzeitsgästen?«
»Nein. Wir kannten ihn überhaupt nicht. Wir hatten ungefähr ein Dutzend Zimmer frei gehalten, um die engere Familie und ein paar Freunde unterzubringen. Branlow Hall hat zweiunddreißig Zimmer, und wir hatten trotz meiner Bedenken auf Wunsch meines Mannes beschlossen, das Hotel offen zu halten. Mr Parris war in Suffolk, um Verwandte zu besuchen. Er hatte für drei Nächte gebucht und wurde in den frühen Morgenstunden des Samstags ermordet, die Leiche wurde aber erst am Nachmittag entdeckt.«
»Nach der Hochzeit«, murmelte ihr Mann.
»Wie ist er denn umgebracht worden?«
»Er wurde mit einem Hammer erschlagen. Sein Gesicht wurde völlig zertrümmert, und wenn die Polizei nicht seine Brieftasche mit dem Pass im Safe gefunden hätte, wäre seine Identität vielleicht gar nicht geklärt worden.«
»Cecily war völlig verstört«, sagte Treherne. »Das heißt, wir waren alle ganz durcheinander. Es war so ein schöner Tag gewesen. Die Trauung hatte im Garten stattgefunden, dann folgte das Mittagessen für hundert Gäste. Das Wetter war herrlich. Und die ganze Zeit lag da oben in seinem Zimmer, direkt über dem Festzelt, der Tote in einer riesigen Blutlache.«
»Cecily und Aiden mussten sogar ihre Flitterwochen verschieben«, fügte Pauline hinzu. In ihrer Stimme war nach all den Jahren immer noch die Empörung zu hören, die sie damals empfunden hatte. »Die Polizei hat sie nicht abreisen lassen. Sie haben gesagt, das käme gar nicht in Frage, obwohl offensichtlich war, dass der Mord nichts mit ihnen zu tun hatte.«
»Aiden ist der Ehemann Ihrer Tochter?«
»Aiden MacNeil ist unser Schwiegersohn, ja. Sie wollten am Sonntagmorgen nach Antigua aufbrechen, aber am Ende sind sie erst zwei Wochen später geflogen. Da hatte die Polizei den Mörder schon verhaftet. Es war völlig unnötig, sie so lange aufzuhalten.«
»Die Polizei hat also rausgekriegt, wer’s gewesen ist«, sagte ich.
»Ja, ja. Es war alles ganz klar«, erklärte Treherne. »Es war einer unserer Angestellten. Ein Rumäne namens Stefan Codrescu. Er war so eine Art Hausmeister und wohnte bei uns im Hotel. Er hatte etliche Vorstrafen – das wussten wir. Ich fürchte, das war sogar einer der Gründe, weshalb wir ihn eingestellt haben.« Er schlug für einen Sekundenbruchteil die Augen nieder. »Meine Frau und ich hatten damals so eine Art Resozialisierungsprogramm. Wir haben junge Strafgefangene nach ihrer Entlassung als Küchenhilfen, Reinigungspersonal oder Gärtner beschäftigt. Wir glaubten fest daran, dass man jungen Leuten eine zweite Chance geben und den Strafvollzug reformieren müsse. Ich nehme an, Sie wissen, dass die Zahl der Wiederholungstäter enorm ist. Das liegt daran, dass man diesen Leuten keine Chance gibt, sich wieder in die Gesellschaft zu integrieren. Wir haben eng mit den Bewährungshelfern zusammengearbeitet, und sie haben uns versichert, dass Stefan für unser Programm geeignet wäre.« Er seufzte tief. »Sie haben sich leider geirrt.«
»Cecily hat ihm vertraut«, sagte Pauline.
»Sie kannte ihn?«
»Wir haben zwei Töchter, die beide bei uns im Hotel arbeiten. Cecily war die Geschäftsführerin, als diese Geschichte passiert ist. Sie war diejenige, die Stefan zum Vorstellungsgespräch eingeladen und eingestellt hat.«
»Sie hat also in demselben Hotel geheiratet, in dem sie gearbeitet hat?«
»Ja, genau. Es ist ein Familienbetrieb. Die Angestellten gehören alle irgendwie zur Familie. Unsere Tochter wäre nie auf die Idee gekommen, ihre Hochzeit woanders zu feiern«, sagte Pauline.
»Und sie glaubte, dass Stefan unschuldig wäre.«
Am Anfang ja. Sie hat ihn verteidigt. Das ist das Problem bei Cecily. Sie ist zu vertrauensselig, sie glaubt an das Gute im Menschen. Aber die Beweislage war eindeutig. Auf dem Hammer waren keine Fingerabdrücke, aber Stefans Kleider waren genauso blutbespritzt, wie das Geld, das er unter seiner Matratze versteckt hatte. Das muss er dem Toten abgenommen haben. Es gab einen Zeugen, der gesehen hat, wie er in das Zimmer von Parris ging. Und letzten Endes hat er ja auch gestanden. Da musste dann auch Cecily zugeben, dass sie sich geirrt hatte, und damit war die Sache erledigt. Sie ist mit Aiden nach Antigua geflogen. Das Hotel hat sich allmählich wieder erholt, auch wenn niemand mehr in Zimmer zwölf schlafen wollte. Wir benutzen es nur noch als Lagerraum. Aber, wie gesagt, das ist alles schon lange her und wir dachten, es wäre vorbei. Aber wie es scheint, haben wir uns geirrt.«
»Was ist denn passiert?«, fragte ich. Gegen meinen Willen begann mich die Sache zu interessieren.
»Stefan wurde zu lebenslänglich verurteilt«, sagte Treherne. »Er sitzt immer noch hinter Gittern. Cecily hat ihm ein paar Mal geschrieben, aber er hat nie geantwortet. Ich dachte, sie hätte das alles vergessen. Sie schien völlig zufrieden damit, das Hotel zu führen und sich um ihre Ehe zu kümmern. Sie ist zwei Jahre älter als Aiden. Als sie geheiratet haben, war sie sechsundzwanzig, nächsten Monat wird sie vierunddreißig.«
»Haben sie Kinder?«
»Ja, ein kleines Mädchen. Das heißt, sie ist jetzt schon sieben … Roxana.«
»Unser erstes Enkelkind«, sagte Pauline sichtlich gerührt. »Ein süßes Kind, sie bedeutet uns alles.«
»Pauline und ich haben uns vom Tagesgeschäft ganz zurückgezogen«, sagte Treherne. »Wir haben ein Haus im Süden von Frankreich, in Hyères, und verbringen viel Zeit dort. Vor ein paar Tagen hat uns Cecily angerufen. Mittags um zwei, französischer Zeit. Ich habe den Anruf entgegengenommen. Ich habe gleich gemerkt, dass Cecily total aufgeregt war. Sie schien sogar Angst zu haben. Ich weiß nicht, von wo aus sie angerufen hat, aber es war ein Dienstag, da war sie bestimmt im Hotel. Normalerweise machen wir immer ein paar Scherze, aber sie kam direkt zur Sache. Sie hätte über alles noch einmal nachgedacht, hat sie gesagt –«
»Und damit meinte sie diese Mordgeschichte.«
»Ja, genau. Sie sagte, sie hätte vollkommen recht gehabt. Stefan Codrescu sei für die Tat nicht verantwortlich. Ich fragte, wieso sie gerade jetzt wieder daran gedacht hätte, und sie hat gesagt, es hätte mit einem Buch zu tun, das sie gerade gelesen hatte. Da stand genau drin, wer es gewesen ist. Das waren genau ihre Worte. Jedenfalls hätte sie das Buch jetzt zur Post gebracht, damit ich es auch lesen könnte. Es ist tatsächlich am nächsten Tag schon gekommen.«
Er griff in die Tasche seines Jacketts und zog ein schmales Paperback heraus. Ich erkannte es sofort: das Bild auf dem Umschlag, die Schrift und den Titel. Schlagartig begriff ich, was dieses Treffen hier sollte.
Das Buch war Atticus unterwegs, der dritte Band in der Atticus-Pünd-Serie von Alan Conway, die ich lektoriert hatte. Ich erinnerte mich sofort, dass es tatsächlich in einem Hotel spielte, allerdings in Devon, ganz im Westen von England, und nicht in Suffolk. Außerdem spielte es nicht in der Gegenwart, sondern 1953, also kurz nach dem Krieg. Ich erinnerte mich noch an die Buchpremiere, für die wir die Deutsche Botschaft in London hatten gewinnen können. Alan hatte ein paar Drinks zu viel gehabt, den Botschafter beleidigt und sich auch sonst ziemlich danebenbenommen.
»Alan wusste von dem Mord an diesem Frank Parris?«
»Oh, ja. Er kam sechs Wochen danach zu uns ins Hotel und blieb ein paar Tage. Er hat uns erzählt, er sei ein Freund des Toten gewesen, und hat eine Menge Fragen über den Mordfall gestellt. Dann hat er auch mit den Angestellten viel geredet. Wir hatten keine Ahnung, dass er die Angelegenheit zu einem Unterhaltungsroman machen wollte. Wenn er uns die Wahrheit gesagt hätte, wären wir viel vorsichtiger gewesen.«
Und das ist genau der Grund, warum euch Alan Conway die Wahrheit verschwiegen hat, dachte ich. Und sagte: »Sie haben das Buch nie gelesen?«
»Wir hatten Mr Conway völlig vergessen«, gab Treherne zu. »Und ein Exemplar seines Buches hat er uns auch nicht geschickt.« Er machte eine Pause. »Aber Cecily hat es gelesen, und sie hat etwas darin gefunden, was die Ereignisse in Branlow Hall in neuem Licht erscheinen ließ … zumindest glaubte sie das.« Er warf seiner Frau einen hilfesuchenden Blick zu. »Inzwischen haben Pauline und ich das Buch auch gelesen, aber wir können nichts finden, was einen Zusammenhang herstellt.«
»Es gibt Ähnlichkeiten«, sagte Pauline. »Man kann die Personen wiedererkennen. Es sind alles Leute, die Mr Conway in Woodbridge kennengelernt hat. Sie haben sogar dieselben oder sehr ähnliche Namen. Warum es ihm solches Vergnügen bereitet, die Menschen als scheußliche Karikaturen zu zeichnen, verstehe ich allerdings nicht. Die Besitzer des Moonflower Hotels sind zum Beispiel nach dem Vorbild von Lawrence und mir gestaltet. Aber sie sind beide Gauner. Warum? Warum macht er so was? Wir haben in unserem ganzen Leben nichts Kriminelles getan.« Sie schien weniger bestürzt als verärgert. Der Blick, mit dem sie mich musterte, schien mir die Schuld zu geben.
»Wir hatten keine Ahnung, dass es dieses Buch gab«, sagte sie. »Ich lese keine Krimis. Lawrence auch nicht. Sajid Khan hat uns gesagt, dass Mr Conway nicht mehr am Leben ist. Das ist vielleicht besser so. Denn wenn er noch lebte, würden wir ihn wahrscheinlich verklagen.«
»Nur, damit ich es richtig verstehe …«, sagte ich. Die Einzelheiten dieser ganzen Geschichte überschlugen sich geradezu, und doch wusste ich, dass sie mir etwas nicht erzählt hatten. »Sie glauben also, dass Stefan Codrescu trotz der Beweise und seines Geständnisses Frank Parris nicht getötet hat, dass Alan Conway zu Ihnen ins Hotel kam und innerhalb weniger Tage herausgefunden hat, wer der wirkliche Täter war, und diese Person in seinem Roman auch benannt oder deutlich bezeichnet hat.«
»Ja, genau.«
»Aber das ist doch sehr unwahrscheinlich, Pauline. Wenn er den Mörder kannte und wusste, dass im Gefängnis ein Unschuldiger saß, wäre er doch sofort zur Polizei gegangen! Warum hätte er einen Roman daraus machen sollen?«
»Das ist genau der Grund, warum wir hier sind, Susan. Sajid Khan hat uns gesagt, dass Sie Alan Conway besser kannten als jeder andere. Sie haben das Buch redigiert. Wenn die Antwort darin verborgen ist, dann sind Sie am besten geeignet, um sie zu finden.«
»Moment mal!« Plötzlich wusste ich, was nicht stimmte. »Die Sache hat damit angefangen, dass Ihre Tochter in Atticus unterwegs etwas entdeckt hat. War sie die Einzige, die das Buch gelesen hat, bevor sie Ihnen davon erzählte?«
»Das weiß ich nicht.«
»Aber was war es denn, was sie entdeckt hat? Warum haben Sie Cecily nicht einfach angerufen und gefragt, was sie meinte?«
Diesmal antwortete Lawrence Treherne. »Natürlich haben wir angerufen«, sagte er. »Wir haben beide das Buch gelesen, und dann haben wir sie mehrfach aus Frankreich angerufen. Irgendwann hatten wir schließlich Aiden am Apparat, und er hat uns gesagt, was passiert ist.« Er holte tief Luft. »Wie es scheint, ist unsere Tochter verschwunden.«
Abreise
An diesem Abend hatte ich Krach mit Andreas. Ich wollte das nicht, aber dieser Tag hatte so viele Misslichkeiten gebracht, dass ich entweder den Mond anschreien musste oder Andreas, und mein Liebster war nun mal näher.
Es fing an mit diesem netten Ehepaar Bruce und Brenda aus Macclesfield, die plötzlich gar nicht mehr nett waren, sondern auf ihre Rechnung einen Rabatt von 50 Prozent haben wollten. Sonst würden sie bei TripAdvisor eine Liste mit detaillierten Beschwerden hochladen, an der sie seit ihrer Ankunft gearbeitet hatten. Danach, sagten sie, würde wahrscheinlich kein Mensch mehr seinen Fuß über unsere Schwelle setzen. Was sie genau zu beklagen hatten? Eine Stunde ohne WLAN. Gitarrenklänge bei Nacht. Die Sichtung einer einsamen Schabe. Am meisten ärgerte mich, dass ich es hatte kommen sehen. Jeden Morgen waren Bruce und Brenda mit einem verkniffenen Lächeln bei mir erschienen und hatten sich über irgendwas anderes beschwert. Ich wusste, dass sie etwas planten. Ich hatte ein Gespür für Touristen entwickelt, bei denen Erpressung zum festen Bestandteil der Urlaubsplanung gehört. Sie würden sich wundern, wie viele es davon gibt.
Vangelis kam zu spät, Panos kam gar nicht. Der Computer hatte zwei Buchungsanfragen in den Spamordner geschoben, und als wir es merkten, hatten die Gäste bereits woanders gebucht. Ehe wir schlafen gingen, tranken wir noch ein Glas Metaxa, den berühmten griechischen Brandy, der nur in Griechenland schmeckt, aber ich hatte immer noch schlechte Laune, und als Andreas fragte, was los sei, kriegte ich einen Wutanfall.
»Was glaubst du, was los ist, Andreas? Alles ist eine verdammte Scheiße!«
Ich ärgerte mich über mich selbst, denn ich fluche normalerweise nur selten … und bei Leuten, die ich mag, schon gar nicht. Ich lag bereits im Bett und sah zu, wie Andreas sich auszog. Ein Teil von mir wollte ihm die Schuld an allem geben, was hier in Kreta nicht funktionierte, ein anderer schämte sich dafür, dass ich ihn enttäuschte. Am schlimmsten war die Hilflosigkeit – das Gefühl, dass die Ereignisse mich fest im Griff hatten, und nicht umgekehrt. Hatte ich wirklich ein Leben gewollt, wo mich wildfremde Menschen für ein paar Euros demütigen konnten und mein Wohlbefinden von einer Buchung abhing? Schlagartig wurde mir klar, dass ich nach England zurückmusste und dass ich das schon seit Monaten wusste, obwohl ich diese Erkenntnis ständig verdrängt hatte.
Andreas putzte sich die Zähne und kam nackt aus dem Badezimmer. Er schlief immer ohne was und sah aus wie eine dieser Gestalten, die man auf griechischen Vasen sieht – ein Satyr oder ein Ephebe. Er schien in den letzten Jahren griechischer geworden zu sein. Sein schwarzes Haar war wuscheliger, seine Augen dunkler und sein Gang herausfordernder als in London, als er noch an der Westminster School unterrichtet hatte. Er hatte auch zugenommen – oder sah das nur so aus, weil er keine Anzüge mehr trug? Er war ein gutaussehender Mann. Ich fühlte mich sehr zu ihm hingezogen. Aber plötzlich wollte ich weg von ihm.
Ich wartete, bis er ins Bett kam. Wir schliefen bei offenem Fenster, unter einem gemeinsamen großen Laken. Hier am Meer gab es kaum Mücken, und die frische Nachtluft war mir lieber als eine Klimaanlage.
»Andreas …«, sagte ich.
»Was?« Er wäre in Sekunden eingeschlafen, wenn ich es zugelassen hätte. Seine Stimme war schon sehr träge.
»Ich will zurück nach London.«
»Was?« Er fuhr hoch und stützte sich auf den Ellenbogen. »Was meinst du damit?«
»Ich muss da etwas erledigen.«
»In London?«
»Nein, in Suffolk.« Er starrte mich besorgt an. »Ich bleibe nicht lange«, sagte ich. »Bloß ein paar Wochen.«
»Aber Susan! Wir brauchen dich hier.«
»Wir brauchen Geld, Andreas. Wir können bald unsere Rechnungen nicht mehr zahlen. Man hat mir eine Menge Geld angeboten für einen Auftrag. Zehntausend Pfund in bar!«
*
Das war nicht gelogen.
Die Trehernes hatten mir von dem Mord in ihrem Hotel erzählt, und dann davon, wie ihre Tochter verschwunden war.
»Es ist sehr unwahrscheinlich, dass sie einfach weggerannt ist, ohne jemandem etwas zu sagen«, erklärte Treherne. »Und völlig undenkbar, dass sie ihre Tochter im Stich lässt.«
»Wer kümmert sich um das Kind?«, fragte ich.
»Aiden ist da. Und ein Kindermädchen haben sie auch.«
»Es ist nicht bloß unwahrscheinlich.« Pauline warf ihrem Mann einen vernichtenden Blick zu. »Cecily hat so etwas noch nie getan. Sie würde Roxana niemals allein lassen.« Sie wandte sich mir zu. »Wir machen uns schreckliche Sorgen, Susan. Glauben Sie mir, auch wenn es Lawrence nicht wahrhaben will: Es hat etwas mit diesem Buch zu tun.«
»Der Ansicht bin ich doch auch!«, sagte Treherne.
»Wusste jemand von Cecilys Überlegungen?«, fragte ich.
»Wie ich schon sagte: Sie hat aus Branlow Hall angerufen. Da konnten alle möglichen Leute mithören.«
»Ich meine, hat sie noch mit jemand anderem über ihren Verdacht gesprochen?«
Pauline Treherne schüttelte den Kopf. »Wir haben sie ja mehrfach aus Frankreich anzurufen versucht, und als sie nicht zu erreichen war, haben wir mit Aiden telefoniert. Er hatte uns nicht beunruhigen wollen, aber gleich am ersten Tag, als unsere Tochter verschwunden ist, hat er die Polizei eingeschaltet. Leider haben sie seine Anzeige zuerst nicht sehr ernst genommen. Sie waren wohl der Ansicht, er und Cecily hätten Eheprobleme.«
»Haben sie welche?«
»Überhaupt nicht«, sagte Treherne. »Sie sind sehr glücklich miteinander. Die Polizei hat auch das Kindermädchen befragt, aber die hat dasselbe gesagt. Sie hat noch nie gehört, dass sich die beiden gestritten hätten.«
»Aiden ist ein wunderbarer Schwiegersohn. Er ist so klug und fleißig. Ich wünschte nur, unsere Lisa würde auch so einen Mann finden. Er macht sich noch mehr Sorgen als wir.«
Ich hatte schon die ganze Zeit das Gefühl gehabt, dass Pauline gegen etwas ankämpfte, während sie mit mir sprach, und plötzlich zerrte sie ein Päckchen Zigaretten heraus, steckte sich eine an und inhalierte tief. Sie rauchte wie jemand, der nach langer Abstinenz gerade wieder angefangen hat.
»Als wir nach England zurückkamen, hatte auch die Polizei endlich mit ihren Ermittlungen angefangen. Viel gebracht hat es nicht. Cecily hat den Hund ausgeführt. Sie hat so einen zotteligen Golden Retriever. Er heißt Bear. Wir haben immer Hunde gehabt. Sie hat das Hotel gegen drei Uhr nachmittags verlassen und den Wagen am Bahnhof Woodbridge abgestellt. Dann hat sie wahrscheinlich den Uferweg am River Deben genommen. Den mochte sie sehr. Es ist ein Rundweg. Am Anfang ist es dort meist ziemlich belebt, aber dann wird es wilder und einsamer. Man kommt zum Martlesham Creek, und es geht durch den Wald. Auf der anderen Seite ist eine Straße, die zurückführt nach Woodbridge.«
»Wenn sie also jemand überfallen hat –«
»So etwas passiert in Suffolk eigentlich nie. Aber es stimmt schon: Es gibt einige Stellen auf dem Weg, wo sie allein war und niemand sie sehen konnte.« Pauline holte tief Luft. »Aiden hat sich Sorgen gemacht, als sie zum Abendessen noch nicht zu Hause war, und hat die Polizei angerufen. Es kamen auch zwei uniformierte Beamte und haben Fragen gestellt. Aber einen Alarm haben sie erst am nächsten Vormittag ausgelöst, und das war natürlich viel zu spät. Zu diesem Zeitpunkt war Bear bereits allein wieder aufgetaucht. Am Bahnhof, wo der Wagen stand. Danach haben sie Cecilys Verschwinden erst richtig ernst genommen. Sie haben die ganze Gegend zwischen Melton und Martlesham absuchen lassen. Auch mit Hunden. Es hat nichts gebracht. Da gibt es Felder, Wiesen, Waldstücke, schlammige Ufer und Schlick. Ein riesiges Gebiet. Sie haben nichts gefunden.«
»Wie lange ist sie denn schon verschwunden?«, fragte ich.
»Zuletzt gesehen worden ist sie am Mittwoch.«
Ich spürte, wie sich ein Schweigen über den Tisch senkte. Fünf Tage. Das war sehr lange. Ein Abgrund, in den Cecily gefallen war.
»Sie sind einen weiten Weg gekommen, um mit mir zu reden«, sagte ich schließlich. »Was genau soll ich tun?«
Pauline warf ihrem Mann einen Blick zu.
»Die Antwort muss in diesem Buch zu finden sein, Atticus unterwegs. Und Sie kennen es besser als jeder andere.«
»Ehrlich gesagt, ist es schon eine Weile her, dass ich es zuletzt gelesen habe.«
»Sie haben mit dem Autor, diesem Alan Conway, gearbeitet. Sie wissen, wie sein Verstand funktionierte. Ich bin sicher, wenn wir Sie bitten würden, den Roman noch einmal zu lesen, würden Ihnen Dinge auffallen, die wir gar nicht bemerkt haben. Und wenn Sie mit nach Branlow Hall kommen und das Buch gewissermaßen vor Ort lesen, finden Sie bestimmt heraus, was unsere Tochter entdeckt hat und weshalb sie uns in Frankreich angerufen hat. So erfahren wir vielleicht, wo sie ist oder was mit ihr geschehen ist.«
Seine Stimme zitterte, als er die letzten Worte sagte. Was mit ihr geschehen ist. Es gab vielleicht einen harmlosen Grund, warum sie verschwunden war, aber das war nicht wahrscheinlich. Sie wusste etwas. Sie war für irgendjemanden eine Gefahr. Aber das blieb besser ungesagt.
»Kann ich auch eine haben?«, fragte ich und nahm mir eine von Pauline Trehernes Zigaretten. Meine eigenen lagen hinter der Bar. Das Ritual – herausnehmen, anstecken, der erste Zug – verschaffte mir Zeit zum Nachdenken.
»Ich kann nicht nach England kommen«, sagte ich schließlich. »Ich habe hier zu viel zu tun. Aber wenn Sie mir das Exemplar hierlassen, kann ich es lesen. Ich kann nichts versprechen. Soweit ich mich erinnere, entspricht die Story nicht dem, was Sie mir erzählt haben. Aber ich kann Ihnen eine E-Mail schicken –«
»Nein, das genügt nicht.« Pauline hatte sich offenbar schon entschlossen. »Sie müssen mit Aiden und Lisa reden – und auch mit dem Kindermädchen. Und mit dem Hotelpersonal. Die kommen alle im Buch vor.« Ihre Stimme wurde beschwörend. »Es wird nicht lange dauern, das verspreche ich Ihnen.«
»Wir werden Sie auch für Ihre Mühe entschädigen«, fügte Treherne hinzu. »Wir haben genug Geld, und wir sparen bestimmt nicht, wenn es um unsere Tochter geht.« Er machte eine Pause und sagte dann: »Zehntausend Pfund?«
Seine Frau warf ihm einen scharfen Blick zu, und ich hatte den Eindruck, dass er in seinem Eifer den Betrag, den sie mir hatten anbieten wollen, erheblich erhöht, ja womöglich verdoppelt hatte. Das hatte wahrscheinlich mit meinem Zögern zu tun. Einen Augenblick dachte ich, dass Pauline etwas sagen würde, aber sie entspannte sich gleich wieder und nickte.
Zehntausend Pfund. Ich dachte an den Balkon, der neu verputzt werden musste, an einen neuen Computer für Andreas, an die Eistheke, die es nicht mehr lange machen würde, an Panos und Vangelis, die laut über höhere Löhne nachgedacht hatten.
*
»Ich konnte gar nicht ablehnen«, erklärte ich Andreas, als wir jetzt nebeneinander im Bett lagen. »Wir brauchen das Geld, und vielleicht gelingt es mir ja tatsächlich, eine Spur zu finden, die zu ihrer Tochter führt.«
»Glaubst du, dass sie noch lebt?«
»Denkbar wäre es. Aber wenn nicht, kann ich vielleicht herausfinden, wer sie ermordet hat.«
Andreas setzte sich auf. Er war hellwach, und er machte sich Sorgen um mich. Es tat mir leid, dass ich ihn so angeschnauzt hatte. »Als du letztes Mal einen Mörder gejagt hast, ging das gar nicht gut aus«, sagte er.
»Diesmal ist es ganz anders. Mit mir persönlich hat das überhaupt nichts zu tun.«
»Mir scheint, das wäre eher ein Grund, die Sache nicht anzufassen.«
»Vielleicht hast du recht. Aber …« Ich war längst fest entschlossen, und das wusste Andreas auch. »Ich brauche mal Urlaub«, sagte ich. »Seit zwei Jahren bin ich jetzt hier, und außer einem Wochenende in Santorini sind wir nie weggewesen. Ich bin einfach erschöpft, ich bin dauernd im Einsatz, versuche dauernd, den Laden am Laufen zu halten. Ich dachte, dass du das verstehst.«
»Brauchst du Urlaub vom Hotel oder Urlaub von mir?«
Ich wusste nicht recht, was ich darauf antworten sollte.
»Wo wirst du denn wohnen?«, fragte er.
»Bei meiner Schwester«, sagte ich. »Das wird nett.« Ich legte ihm die Hand auf den Arm und spürte die Wärme und die Muskeln. »Du kommst bestimmt sehr gut zurecht. Und wir können jeden Tag telefonieren.«
»Ich will nicht, dass du gehst, Susan.«
»Aber du wirst mich auch nicht daran hindern, Andreas.«
Er hielt inne, und ich sah, wie er mit sich kämpfte. Mein Andreas gegen Andreas den Griechen. »Nein«, sagte er schließlich. »Tu, was du tun musst.«
*
Zwei Tage später fuhr er mich zum Flughafen Heraklion. Die Straße führt durch ein paar sehr schöne Gegenden, die noch wild und unberührt sind. Die Berge erstrecken sich weit in die Ferne, und man hat das Gefühl, dass sich seit tausend Jahren nicht viel verändert hat. Selbst die neue Schnellstraße hinter Malia liegt in einer herrlichen Landschaft, und wenn man sich dem Meer nähert, sieht man einen schimmernden weißen Sandstrand. Vielleicht war es das, was mich traurig machte und daran erinnerte, was ich zurückließ. Plötzlich hatte ich all die Plackerei und die Probleme im Polydoros vergessen. Ich dachte an die Nächte am Strand, die Wellen und Pansélinos – den Vollmond. Den Wein. Das Gelächter. Mein Landleben.
Ich hatte bewusst meinen kleinsten Koffer ausgesucht, als ich gepackt hatte. Es sollte für Andreas und mich der Beweis sein, dass dies nur eine kurze Geschäftsreise war und ich bald wieder zu Hause sein würde. Aber als ich meine Garderobe durchging und Kleidungsstücke prüfte, die ich seit zwei Jahren nicht mehr getragen hatte, stapelte sich bald ein ganzer Berg auf meinem Bett. Ich flog nach England in einen englischen Sommer, und das hieß, es konnte ebenso heiß wie kalt sein, ebenso trocken wie nass, und das alles am selben Tag. Ich würde in einem schicken Landhotel wohnen. Da gab es womöglich einen Dresscode fürs Abendessen. Man bezahlte mir zehntausend Pfund. Ich musste professionell aussehen.
Also zog ich am Flughafen doch wieder meinen alten Rollkoffer hinter mir her, dessen Räder missmutig über den Boden quietschten. Andreas und ich standen einen Augenblick zusammen im eisigen Air-Conditioning der Abflughalle und dem noch kälteren Licht ihrer Neonröhren.
Er schloss mich in die Arme. »Versprich mir, dass du auf dich aufpasst. Ruf mich an, sobald du da ankommst. Wir reden dann über FaceTime.«
»Wenn das WLAN nicht ausfällt.«
»Versprich es mir, Susan.«
»Ich verspreche es.«
Er hielt mich an beiden Schultern und küsste mich. Ich lächelte ihn an, dann zog ich meinen Koffer zu der ebenso stämmigen wie übellaunigen jungen Griechin, die meinen Reisepass und mein Ticket prüfte, bevor sie meinen Koffer annahm und mir die Bordkarte aushändigte. Ich drehte mich um und winkte.
Aber Andreas war schon gegangen.
Zeitungsausschnitte
Wieder in London zu sein war ein ziemlicher Schock. Nach so langer Zeit in Agios Nikolaos, das nicht viel mehr als ein überdimensioniertes Fischerdorf ist, fühlte ich mich von der Stadt verschlungen. Ich war auf die Reizüberflutung, den Lärm, das Gedränge nicht vorbereitet. Es war alles viel grauer, als ich es in Erinnerung hatte, und von dem Benzindunst und dem Dreck in der Luft wurde mir übel. Die vielen neuen Gebäude erzeugten geradezu einen Schwindel. So viel von dem, was mir vertraut war, als ich hier noch gearbeitet hatte, war in aller Stille verschwunden. Die Londoner Bürgermeister mit ihrer Vorliebe für teure und spektakuläre Hochhäuser hatten den Architekten den Himmel über der Stadt ausgeliefert, und die vertraute Skyline war plötzlich gespickt mit Fremdkörpern. Ich saß in einem altmodischen schwarzen Taxi und fuhr auf dem Weg von Heathrow am Themseufer entlang. Die Baustelle der neuen Wohn- und Bürotürme rund um die Battersea Power Station erschien mir wie das Schlachtfeld nach einer Invasion. Monströse Kräne mit blinkenden roten Warnlampen rissen dem Gerippe der Stadt das Fleisch von den Knochen wie Geier.
Ich hatte beschlossen, die erste Nacht in einem Hotel zu verbringen, was ziemlich merkwürdig war. Ich war immer eine Londonerin gewesen und jetzt degenerierte ich zur Touristin. Außerdem hasste ich das Hotel. Das Premier Inn in Farringdon war völlig in Ordnung, sauber und komfortabel, aber dass ich gezwungen war, in einem Hotel zu übernachten, ging mir völlig gegen den Strich. Ich saß auf dem Bett mit den violetten Kissen und dem Schlafenden-Mond-Logo und fühlte mich total elend. Ich vermisste Andreas jetzt schon. Ich hatte ihm gleich nach der Ankunft in Heathrow eine SMS geschickt, aber wenn ich einen FaceTime-Termin mit ihm vereinbaren würde, musste ich davon ausgehen, dass ich am Ende losheulen würde, und das wäre für ihn der Beweis, dass er recht gehabt hätte: Ich hätte nie fliegen dürfen. Je schneller ich nach Suffolk kam, desto besser. Aber ich musste zuvor noch einiges erledigen.
Nach einem ziemlich unruhigen Schlaf und einem Hotelfrühstück englischer Art – Rührei, Würstchen, Bohnen und Bacon – ging ich zu einem Self-Storage in King’s Cross. Die Lagerboxen befanden sich in den Bögen unter der Eisenbahn. Als ich mit Andreas nach Kreta gegangen war, hatte ich meine Wohnung in Crouch End mit fast allem Inventar verkauft, aber im letzten Augenblick hatte ich beschlossen, meinen leuchtend roten MGB Roadster zu behalten, den ich mir an meinem vierzigsten Geburtstag in einem Anfall von Wahnsinn gekauft hatte. Es erschien unwahrscheinlich, dass ich ihn je wieder fahren würde, und es kostete mich jeden Monat ₤150, ihn unterzustellen. Aber ich konnte mich einfach nicht von ihm trennen, und als ihn jetzt zwei junge Männer ins Tageslicht rollten, war es wie ein Wiedersehen mit einem alten Freund. Ja, mehr noch: Mit dem kleinen Sportwagen hatte ich ein wichtiges Stück meines früheren Lebens zurückgelassen. Als ich in den Fahrersitz mit seinem brüchigen Leder sank, das absurde altmodische Radio vor meiner Kniescheibe sah und nach dem hölzernen Lenkrad griff, hatte ich das Gefühl, einen Teil meiner Persönlichkeit zurückzugewinnen. Falls ich nach Kreta zurückkehren sollte, würde ich mit meinem Flitzer fahren, egal, wie kompliziert die griechische Zulassung für einen Wagen mit Rechtslenkung war. Ich trat ein paar Mal aufs Gas, genoss das tiefe Knurren, mit dem der Motor mich begrüßte, und schoss die Euston Road hinunter.
Es war kurz nach zehn, und der Verkehr war nicht allzu schlimm: Die Autos bewegten sich wenigstens. Ich wollte nicht gleich wieder ins Hotel, deshalb fuhr ich einfach ein bisschen herum. Euston Station wurde immer noch renoviert. Die Gower Street war genauso schäbig wie eh und je. Es war kein Zufall, dass ich in Bloomsbury gelandet war, wo ich elf Jahre lang gearbeitet hatte. Das Verlagsgebäude war eine Ruine mit vernagelten Fenstern und verrußten Mauern. Anscheinend hatte die Feuerversicherung nicht gezahlt. Versuchter Mord und Brandstiftung waren im Vertrag wohl nicht vorgesehen.
Ich überlegte kurz, ob ich nach Crouch End hinauffahren sollte, um dem MG ein bisschen Auslauf zu verschaffen, aber das wäre dann doch zu deprimierend gewesen. Außerdem musste ich mit der Arbeit anfangen. Also stellte ich den Wagen im NCP-Parkhaus in Farringdon ab und ging zu Fuß ins Hotel zurück. Vor zwölf Uhr mittags brauchte ich das Zimmer nicht zu räumen. Ich hatte also eine Stunde Ruhe mit dem Internet, der Kaffeemaschine und zwei Päckchen Gratiskeksen. Ich klappte den Laptop auf und fing an zu googeln: Branlow Hall, Stefan Codrescu, Frank Parris, Mord.
Die vier Zeitungsartikel, die ich fand, waren die Kurzfassung eines Krimis – vier sachliche Kapitel ohne jedes Geheimnis.
East Anglian Daily Times, 18. Juni 2008
MORD IM PROMINENTEN-HOTEL
Die Polizei untersucht den Tod eines 53-Jährigen, dessen Leiche in seinem Zimmer in Branlow Hall, einem Fünf-Sterne-Hotel in der Nähe von Woodbridge/Suffolk, entdeckt wurde. Für eine Suite in Branlow Hall zahlt man ₤300 pro Nacht, und das Hotel ist auch ein beliebter Veranstaltungsort für Hochzeiten, Empfänge und Partys. Als Drehort für die Fernsehserien Der junge Inspector Morse, Top Gear und die Antiques Roadshow erlangte das Hotel internationale Bekanntheit.
Das Opfer wurde als Frank Parris identifiziert, eine bekannte Persönlichkeit aus der Werbebranche. Er wurde besonders mit seinen Kampagnen für Barclay’s Bank und die LGBT-Organisation Stonewall bekannt. Ehe er nach Australien auswanderte, um seine eigene Agentur zu gründen, war er Kreativdirektor bei McCann-Erickson, London. Frank Parris war nicht verheiratet.
Detective Superintendent Richard Locke, der die Ermittlungen leitet, erklärte: »Dieser besonders brutale Mord wurde von einem Einzeltäter aus Habgier verübt. Ein Geldbetrag, der Mr Parris gehört hat, wurde bei einem Verdächtigen entdeckt, und wir rechnen bald mit einer Verhaftung.« Der Mord fand am Vorabend der Hochzeit von Aiden MacNeil und Cecily Treherne statt, deren Eltern das Hotel gehört. Die Leiche wurde allerdings erst nach der Trauung gefunden, die im Garten des Hotels stattfand. Weder das Brautpaar noch die Hotelbesitzer waren bereit, den Vorfall zu kommentieren.
East Anglian Daily Times: 20. Juni 2008
VERHAFTUNG IM HOTELMORD
Im Zusammenhang mit dem brutalen Mord an einem Werbefachmann im Ruhestand, der in dem bekannten Hotel Branlow Hall in Woodbridge aufgefunden wurde, hat die Polizei jetzt einen 22-Jährigen verhaftet. Detective Superintendent Richard Locke, der die Ermittlungen leitet, erklärte dazu: »Das war ein scheußliches Verbrechen, das ohne jeden Skrupel begangen wurde. Mein Team hat schnell und gründlich gearbeitet, und ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass es zu einer Verhaftung gekommen ist. Mein Mitgefühl gilt auch dem jungen Brautpaar, dessen Hochzeit durch diese Tat ruiniert worden ist.« Der Verdächtige befindet sich in Untersuchungshaft und wird nächste Woche vor dem Crown Court in Ipswich erscheinen.
Daily Mail: 22. Oktober 2008
LEBENSLÄNGLICH FÜR HAMMERMÖRDER
Stefan Codrescu, ein Zuwanderer aus Rumänien, wurde gestern vom Crown Court in Ipswich zu einer lebenslänglichen Haftstrafe verurteilt. Er wurde für schuldig befunden, den 53-jährigen Frank Parris in dem Luxushotel Branlow Hall in der Nähe von Woodbridge ermordet zu haben. Parris, der als »brillanter schöpferischer Kopf« beschrieben wird, war kürzlich aus Australien zurückgekehrt und wollte sich in England zur Ruhe setzen.
Codrescu, der sich schuldig bekannte, kam mit zwölf Jahren ins Vereinigte Königreich und war bereits polizeibekannt. Die Polizei in London wurde im Zusammenhang mit bandenmäßigem Kreditkartenschwindel und gestohlenen Pässen auf ihn aufmerksam. Mit neunzehn wurde er wegen schweren Einbruchsdiebstahls und Körperverletzung verhaftet und zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt.
Lawrence Treherne, der Besitzer von Branlow Hall, war bei der Urteilsverkündung in Ipswich anwesend. Er hatte Codrescu vor fünf Monaten im Rahmen eines Resozialisierungsprogramms für junge Straftäter im Hotel angestellt. Er sagte, dass er diesen Schritt grundsätzlich noch immer für richtig halte. »Meine Frau und ich waren über den Tod von Parris schockiert«, sagte er nach der Verhandlung. »Aber wir sind immer noch überzeugt, dass es richtig ist, jungen Menschen eine zweite Chance zu geben und wenigstens den Versuch zu machen, sie wieder in die Gesellschaft zu integrieren.«
Eine Entlassung Codrescus komme frühestens in fünfundzwanzig Jahren in Frage, erklärte Richterin Azra Rashid. An den Angeklagten gewandt, sagte sie: »Trotz Ihrer Vergangenheit hat man Ihnen die einzigartige Chance eingeräumt, Ihrem Leben eine Wendung zum Guten zu geben. Aber Sie haben das Vertrauen und den guten Willen Ihrer Arbeitgeber schmählich missbraucht und wegen eines materiellen Vorteils ein brutales Verbrechen begangen.«
In der Verhandlung war bekannt geworden, dass der heute 22-jährige Codrescu mit Online-Poker und anderen Glücksspielen erhebliche Schulden angehäuft hatte. Sein Verteidiger, Jonathan Clarke, ist der Ansicht, der Verurteilte habe den Kontakt mit der realen Welt verloren. »Er lebte in einer Scheinwelt, und die Schulden gerieten außer Kontrolle. Was in der fraglichen Nacht geschah, war Wahnsinn … eine Art Nervenzusammenbruch.«
Parris wurde mit einem Hammer so fürchterlich zugerichtet, dass man ihn nicht mehr erkennen konnte. Detective Superintendent Richard Locke, der den Angeklagten verhaftet hatte, erklärte: »Es war der ekelerregendste Fall, der mir je begegnet ist.«
Ein Sprecher von Screen Counseling, einer in Norwich ansässigen Wohlfahrtseinrichtung, forderte die Glücksspielkommission auf, Online-Poker mit Kreditkarten unverzüglich zu verbieten.
Das also war die Geschichte: der Anfang, die Mitte und das Ende. Aber als ich noch länger im Internet fischte, stieß ich auf einen weiteren Artikel, der eine Art Schlusspunkt hätte sein können, wäre er nicht verfasst worden, bevor alles andere geschah:
Campaign: 12. Mai 2008
SUNDOWNER SYDNEY AM ENDE
Die Werbeagentur Sundowner in Sydney ist pleite. Die vom früheren McCann-Erickson-Impresario Frank Parris gegründete Firma musste nach nur drei Jahren ihre Geschäftstätigkeit einstellen. Die Australian Securities and Investments Commission – die offizielle Aufsichtsbehörde des Landes – bestätigte, dass Sundowner zahlungsunfähig ist.
Parris, der seine Karriere als Werbetexter begonnen hat, war jahrelang eine bekannte Persönlichkeit in der Londoner Szene und erhielt Preise für seine Anzeigenkampagnen für Barclay’s Bank und Domino’s Pizza. Er war der Schöpfer der umstrittenen Action-Fag-Kampagne für Stonewall im Jahre 1997, die sich für Schwulenrechte in den Streitkräften einsetzte. Aus seiner eigenen Sexualität machte Parris nie ein Geheimnis, er war bekannt für seine fantastischen Partys. Manche Beobachter waren der Ansicht, dass er sich nach Australien zurückgezogen hatte, um künftig weniger im Rampenlicht zu stehen.
In den ersten Monaten konnte die Sundowner-Agentur einige wichtige Accounts wie Zipper-Sonnenbrillen, Wagon Wheels und Kustom Footwear an Land ziehen, aber die nachfolgende Wirtschaftskrise, in der das Verbrauchervertrauen und die Werbeausgaben schrumpften, relativierten diese Erfolge sehr schnell. Heute sind Internetwerbung und Videos die Bereiche mit den höchsten Wachstumsraten in Australien. Sundowner mit seiner Spezialisierung auf traditionelle Printwerbung geriet gegenüber der digitalen Konkurrenz rasch ins Hintertreffen und endete bald im Last Chance Saloon.
Was sollte ich jetzt mit all diesen Informationen über einen Mord anfangen, der vor acht Jahren stattgefunden hatte? Ich vermute, es war die Redakteurin in mir, die daran Anstoß nahm, dass jeder der drei Berichte den Mord in Branlow Hall als »brutal« beschrieb, so als ob Morde sonst besonders zärtlich oder achtsam wären. Das Opfer hatten die Journalisten letztlich als einen Versager porträtiert, trotz der Hinweise darauf, dass er Preise gewonnen hatte, schwul und extrovertiert war. Die Mail hatte ihn sogar zum »brillanten schöpferischen Kopf« gemacht, aber da er von einem Rumänen umgebracht worden war, hätten sie ihm wohl alles verziehen, einschließlich seiner sexuellen Orientierung. War Stefan Codrescu tatsächlich Mitglied in einer Bande gewesen, die Kreditkarten fälschte und Pässe klaute? Oder war es bloß Zufall, weil die Polizei damals gerade rumänische Banden gejagt hatte? Seine Verhaftung war ja wegen Einbruchsdiebstahl erfolgt.
Dass der brillante Frank Parris ausgerechnet am Vorabend einer Hochzeit, zu der ihn niemand eingeladen hatte, in einem Hotel in Suffolk geschlafen hatte, war ziemlich bizarr. Pauline Treherne hatte mir erzählt, er habe Verwandte besuchen wollen, warum hatte er nicht bei denen übernachtet?
Was mich beunruhigte, war die Tatsache, dass Detective Superintendent Richard Locke der Ermittler gewesen war. Ich hatte ihn vor zwei Jahren im Zusammenhang mit dem Tod von Alan Conway kennengelernt, und wir waren ziemlich zusammengerasselt. Ich hatte ihn als großen, wütenden Muskelprotz in Erinnerung; denn er hatte mich in einem Coffeeshop in der Nähe des Bahnhofs von Ipswich zehn Minuten lang angeschnauzt und war dann wieder gegangen. Alan hatte ihn als Figur in einem seiner Romane benutzt, und er hatte wohl mir die Schuld daran gegeben. Locke hatte gerade mal eine Woche gebraucht, um Stefan Codrescu als Schuldigen zu identifizieren, zu verhaften und vor Gericht zu bringen. Hatte er sich geirrt? Nach Darstellung der Zeitungen und der Trehernes war die Sache glasklar.
Aber jetzt, acht Jahre danach, war Cecily Treherne plötzlich anderer Ansicht gewesen. Und dann war sie verschwunden.
In London konnte ich nicht mehr viel tun. Es erschien mir offensichtlich, dass ich Stefan Codrescu im Gefängnis besuchen und mit ihm reden musste, aber ich hatte keine Ahnung, wie ich das anstellen sollte. Ich wusste nicht einmal, in welcher Strafanstalt er sich befand. Ich suchte ein bisschen im Netz herum, aber das brachte nichts. Schließlich fiel mir ein Autor ein, mit dem ich vor ein paar Jahren gearbeitet hatte: Craig Andrews. Sein erster Roman spielte im Gefängnismilieu. Ich war von der Wucht und Authentizität seiner Darstellung beeindruckt gewesen. Er kannte sich offenbar aus.
Natürlich hatte er mittlerweile einen anderen Verlag. Cloverleaf war ja pleitegegangen, aber das Buch war trotzdem ein Erfolg geworden und er hatte weitergeschrieben. Ich hatte kürzlich eine Rezension seines neuen Romans gelesen. Zu verlieren hatte ich nichts, und deshalb schickte ich ihm eine E-Mail. Ich sei wieder in England, schrieb ich, und suchte einen verurteilten Mörder namens Stefan Codrescu. Ob er mir helfen könne? Ich war sehr zuversichtlich, dass er mir antworten würde.
Dann schnappte ich mir meinen Laptop und meinen Koffer, rettete den MG aus seiner finsteren Ecke im Parkhaus, wo ich bereits ein beträchtliches Lösegeld zahlen musste, und brauste hochvergnügt hinaus zur A12, die mich nach Suffolk bringen würde.
Ankunft in Branlow Hall
Ich hätte natürlich bei meiner Schwester wohnen können, solange ich in Woodbridge war, aber die Trehernes hatten angeboten, mich in ihrem Hotel unterzubringen, und das hatte ich gern angenommen. Um ganz ehrlich zu sein: Ich fühlte mich immer etwas unbehaglich, wenn ich zu lange bei Katie war. Sie war zwei Jahre jünger als ich, hatte zwei prächtige Kinder, ein gepflegtes Einfamilienhaus, einen erfolgreichen Ehemann und einen harmonischen Freundeskreis, aber all das führte dazu, dass ich mich in ihrer Gegenwart immer sehr unzulänglich fühlte, wenn ich an mein eigenes chaotisches, von Zufällen geprägtes Leben dachte. Nach allem, was vor zwei Jahren passiert war, hatte sie nichts dagegen gehabt, dass ich nach Kreta verschwunden war, sondern war hochzufrieden, dass ich jetzt mit Andreas in geordneten Verhältnissen lebte, wie sie glaubte. Ich hatte überhaupt keine Lust, ihr zu erklären, warum ich jetzt wieder hier war. Sie hätte mich wahrscheinlich gar nicht getadelt. Aber ich hätte ständig gedacht, dass sie es eigentlich tun müsste.
Außerdem war es natürlich sinnvoller, wenn ich mich dort einquartierte, wo das Verbrechen damals geschehen war und wo es noch Zeugen gab. Hinter Ipswich fuhr ich also an der Abzweigung nach Woodbridge vorbei und blieb weiter auf der A12, bis ich zu einem edlen, schwarz-goldenen Schild und einer schmalen Straße kam, die mich zwischen dichten Hecken und Wiesen voller roter Mohnblumen zu einer breiten Einfahrt mit zwei gemauerten Torpfosten brachte, hinter denen sich in gebührendem Abstand das ehemalige Schloss der Familie Branlow erhob.
So viel von dem, was ich hier erzähle, hat mit diesem Haus zu tun, dass ich es genauer beschreiben muss. Es war ein eindrucksvolles Gebäude, eine Mischung zwischen einem Landhaus, einem Herrensitz und einem Château im französischen Stil. Es war sehr groß, langgestreckt und kantig, von weiten Rasenflächen umgeben. Es gab einen gepflegten Garten und schmückende Baumgruppen, während sich im Hintergrund der Waldrand abzeichnete. Irgendwann im Verlauf seiner Geschichte war es offenbar umgebaut worden, denn die Zufahrt mündete verwirrenderweise an einer Fassade mit vielen Fenstern, die keinen Eingang aufwies. Dieser befand sich vielmehr um die Ecke und zeigte in eine andere Richtung.
Hier, an der Vorderfront des Schlosses, erkannte man erst seine ganze Großartigkeit: ein bogengeschmückter Portikus vor dem Haupteingang, die gotischen Türme und Zinnen, die Wappen und die vielen Schornsteine, die mit zahllosen Kaminen verbunden sein mussten. Die Fenster waren sehr hoch und an den Ecken lugten die Marmorköpfe längst vergessener Lords und Ladies hervor. Die vier Giebel des Hauses waren mit Adlern geschmückt, während über dem Eingang eine sehr schöne steinerne Eule die Flügel spreizte. Bei ihrem Anblick fiel mir wieder ein, dass auch das Schild, das mich hergeführt hatte, mit dieser Eule geschmückt war. Sie war das Logo von Branlow Hall und fand sich, wie ich bald feststellte, auch auf den Speisekarten und dem Briefpapier des Hotels wieder.
Eine niedrige Mauer und ein flacher Graben liefen um das ganze Gebäude herum, was ihm eine Aura von gelassener Unerschütterlichkeit gab – so als ob es sich von der realen Welt abzusondern beliebte. Auf der linken Seite öffneten sich einige diskrete, eher moderne Terrassentüren von der Bar zu einem herrlich gepflegten, ebenen Rasen. Dort hatte vor acht Jahren wohl das Hochzeitsessen stattgefunden. Zur Rechten waren in einigem Abstand zwei kleinere Versionen des Schlosses zu sehen. Das eine war eine Kapelle und das andere eine ehemalige Scheune, die mit einem Schwimmbecken und einem Wintergarten zu einem Wellness-Bereich ausgebaut worden war.
Während ich den MG auf den kiesbedeckten, hinter einer Hecke versteckten Parkplatz fuhr, wurde mir klar, dass jeder Schriftsteller, der einen Mord in einem klassischen Landhaus veranstalten wollte, hier alles finden würde, was er dazu brauchte. Und jeder Mörder, der eine Leiche beseitigen wollte, hatte ein riesiges Gelände zu seiner Verfügung, um sie zu vergraben. Ich fragte mich, ob die Polizei die vermisste Cecily Treherne wohl auch auf dem Grundstück gesucht hatte. Sie hatte gesagt, dass sie einen Spaziergang machen wolle, und ihr Wagen war am Bahnhof in Woodbridge gefunden worden, aber konnte man sicher sein, dass sie ihn auch selbst gefahren hatte?
Noch ehe ich den Motor ganz abgestellt hatte, erschien bereits ein junger Mann und hievte den Koffer aus meinem Kofferraum. Er führte mich in die Eingangshalle, die quadratisch war, aber mit Hilfe eines runden Tisches, eines runden Teppichs und einem Kreis von Marmorsäulen, der eine runde Stuckdecke trug, erfolgreich den Eindruck erweckte, selbst ebenfalls rund zu sein. Fünf Türen, darunter eine mit einem modernen Aufzug, zeigten in verschiedene Richtungen, aber der junge Mann führte mich weiter zu einer zweiten Halle, in der sich unter einer eindrucksvoll geschwungenen Treppe die Rezeption befand.
Die Treppe war in sich gedreht, und die Halle sehr hoch. Ich konnte bis ganz hinauf zur gewölbten und üppig geschmückten Stuckdecke sehen. Es war fast wie in einer Kathedrale. Vor mir erhob sich ein riesiges Fenster, einige Scheiben waren aus farbigem Glas, aber das hatte nichts Religiöses. Es erinnerte eher an eine alte Schule oder sogar eine Bahnhofshalle. Gegenüber befand sich ein Treppenaufgang, der weitgehend offen war, so dass man einen Gast, der da oben entlanglief, mit einiger Sicherheit sehr gut von unten sehen konnte. Dieser Treppenaufgang war die Verbindung zwischen den beiden langen Korridoren, an denen vermutlich die Zimmer lagen.
Eine junge Frau saß hinter der Empfangstheke aus dunklem polierten Holz, dessen Kanten verspiegelt waren. Die Theke schien irgendwie fehl am Platz. Ich wusste, dass der größte Teil von Branlow Hall zu Beginn des 18. Jahrhunderts erbaut worden war, und alle anderen Einrichtungsgegenstände waren bewusst altmodisch und traditionell. In einer Ecke stand sogar ein Schaukelpferd mit starren Augen und etwas abgeblättertem Lack. Es erinnerte mich sofort an die berühmte Horrorstory von D.H. Lawrence. Hinter dem Empfang waren auf jeder Seite zwei kleine Büros. Später erfuhr ich, dass Lisa Treherne das eine benutzte und ihre Schwester Cecily das andere. Die Türen standen offen, und ich sah zwei identische Schreibtische mit Telefonen. Ich fragte mich, ob Cecily von hier aus mit ihren Eltern in Frankreich telefoniert hatte.


![Der Tote aus Zimmer 12. Susan Ryeland ermittelt [Band 2] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/f29b5c5fba27049bb29f9e3f1876fde2/w200_u90.jpg)


![Mord in Highgate. Hawthorne ermittelt [Band 2] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/089fc19c4ec8b4ecb2d6573d5df1cc74/w200_u90.jpg)
![Alex Rider. Stormbreaker [Band 1] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/a50942d1747f6f8e55b49793c0526659/w200_u90.jpg)

![Alex Rider. Gemini-Project [Band 2] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/5c4cca9cd875693fa38bd1fe5643672c/w200_u90.jpg)
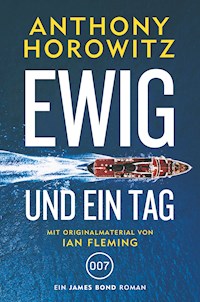

![Wenn Worte töten. Hawthorne ermittelt [Band 3] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/fd859681bbb599e306846498660819cf/w200_u90.jpg)
![Alex Rider. Skeleton Key [Band 3] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/320ebe043418750c249478304f43c699/w200_u90.jpg)

![Alex Rider. Ark Angel [Band 6] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/0edb9586d5f912fe388eb13780edd96f/w200_u90.jpg)
![Alex Rider. Scorpia [Band 5] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/8818b99503b4fee6aa78484cc0275aa9/w200_u90.jpg)
![Alex Rider. Eagle Strike [Band 4] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/e46a21054c8da2b3c0d46afe9bc7c865/w200_u90.jpg)
![Alex Rider. Scorpia Rising [Band 9] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/3c94c2aaec60d2997fb8da5488146852/w200_u90.jpg)
![Alex Rider. Crocodile Tears [Band 8] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/3d4c3c2ca6b7c5bf541a32fa57f1bbf3/w200_u90.jpg)
![Alex Rider. Snakehead [Band 7] - Anthony Horowitz - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/18daaba796e373f6fd5944e2f667ed7b/w200_u90.jpg)









