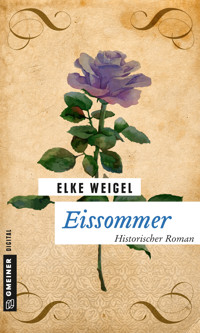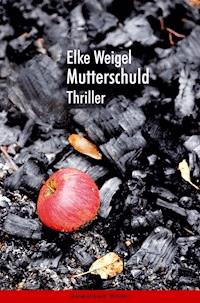Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Historische Romane im GMEINER-Verlag
- Sprache: Deutsch
Annette schreibt Verse, die gar nicht so bescheiden sind, wie von ihr erwartet wird. Im Sommer 1820 trifft sie auf Straube, den ersten Mann, der ihr literarisches Schaffen ernst nimmt. Aber auch der Schöne von Arnswaldt ist zu Besuch, dessen strenge Religiosität ihre schwelenden Schuldgefühle weckt, weil sie ihr dichterisches Leben nicht nach Gott ausrichtet. Sie lässt sich auf Vertraulichkeiten ein, die die Männer gründlich missverstehen. Und als ihre Freundin Male noch dazukommt, bahnt sich eine Katastrophe an.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 410
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Elke Weigel
Der Traum der Dichterin
Die Sehnsucht der Annette von Droste-Hülshoff
Impressum
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2015 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage 2015
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung: Benjamin Arnold
E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Bildes von Annette von Droste-Hülshoff; © AKG-Images
ISBN 978-3-8392-4728-0
1825
Die Doppelgängerin
Hoffnung trieb mich im Morgengrauen hinaus. Zum Weiher, zu seinem Wasserspiegel. Ich eilte über die Wiesen, hielt die Augen gesenkt und beachtete nicht, was mich umgab. Nur allmählich klärte die kalte Luft meinen Geist. Als ich das Ufer erreichte, hatte die Dämmerung den Tag noch nicht ganz freigegeben, feine Lichtstreifen ließen Nebel aufsteigen. Zwischen den Schilfstängeln beugte ich mich begierig über die dunkle Oberfläche des Weihers, von wo mir sofort vertraute Züge entgegen schimmerten: helle Augen, helles Haar – mein Ebenbild und doch nicht mein Spiegel. Da glitt eine dünne Eisscheibe über das Antlitz meiner Doppelgängerin und zerschnitt den Moment der Begegnung. Hastig tauchte ich die Hand mitsamt dem Handschuh in das kalte Wasser und schob das Eis beiseite. Nun hatte ich alles zerstört, Wellen schwappten, und noch mehr Eis in kleinen Stücken löste sich vom Ufer. Ich zog die Hand zurück, wartete darauf, dass sich das Wasser wieder glättete und sie noch einmal auftauchte. Aber der Frost zeigte mir unerbittlich seine Macht, erstarrte das Wasser und die Halme am Ufer, überzog alles mit seinem Weiß. Noch war die Eisdecke nicht geschlossen, und ich hoffte, die Doppelgängerin würde zwischen den Splittern erscheinen, mit ihrer Leidenschaft das Wasser erwärmen, dem Tod entkommen und mir zeigen, dass sie lebendig war, lebendig blieb. Vergeblich.
Später saß ich im Sommerzimmer von Rüschhaus am Schreibtisch. Die gespitzte Feder in der einen Hand, das glatt gestrichene Papier unter der anderen beobachtete ich, wie die Tinte erst herabtropfte und schließlich an der Spitze zu einem unförmigen Klumpen verdorrte. Ich lauschte auf die Geräusche des Hauses. Durch die Ritzen der Tür klangen die Stimmen von Auguste und Katharina aus der Küche herüber. Sie tratschten, während sie gemächlich das Feuer schürten und die Kartoffeln schälten. Die Tür ging, und ich erkannte am schweren Schritt, dass Lütke Torfbrocken brachte. Die Stimmen verschwammen mir zu einem Gemurmel.
Male hatte beim Abschied gesagt, ich solle dichten und niemals damit aufhören. Aber ich konnte nicht mehr. So blieb mir nichts anderes übrig, als zu schreiben, um mich von dem Schmerz abzulenken, der mich überkam, sobald ich mein Gehirn unbewacht ließ. Schreiben, nur nicht aufhören. Keine Poesie, nur der Versuch, ohne Doppelgängerin und ohne Male weiterzuleben.
Das Winterlicht, kalt und weißgelb, drang kaum zum Fenster herein. Die Sträucher vor dem Haus standen kahl, die Wiesen lagen erfroren, und der Horizont bildete einen Strich, den ich nicht erreichen konnte.
Wann habe ich meine Doppelgängerin das erste Mal gesehen? Seit wann weiß ich, dass sie blonde Locken hat, Augen, in denen der Himmel leuchtet, und einen blassen kleinen Mund?
Ich kenne ihr Springen, Laufen und Tanzen schon immer, so vertraut ist mir die wirbelnde Gestalt, die niemand aufhalten kann.
Als ein Lachen aus der Küche herüberklang, hielt ich den Atem an. Male? Nein.
Ich hatte nur das fein gezeichnete Porträt von ihr. Mehr nicht. Aber ich konnte mir einbilden, sie würde mir zusehen. Und so kratzte ich mit dem Fingernagel die getrocknete Tinte von der Federspitze und schrieb über den Sommer, in dem ich Male kennenlernte.
1818
Nette, mach ein nettes Gedicht
Jeden Sommer besuchten wir die Großeltern in Bökendorf. In diesem Jahr waren Papa und meine Schwester Jenny dabei. Das Haus schwirrte von den vielen Stimmen und Schritten der Verwandten und Gäste. Den Abend verbrachte man mit Spielen, Rätseln und Gelächter. Es ging wilder und ungezügelter zu als auf Burg Hülshoff. Durch die Späße wurde ich aufgeheizt und übermütig. Onkel August, der nur ein paar Jahre älter war als ich, reizte und piesackte mich bei jeder Gelegenheit. In einem ständigen Wettstreit mit ihm konnte ich mich kaum bremsen und verfasste aus dem Stegreif Verse, die ich zum Besten gab. Je neckischer und dümmer die Sprüche waren, desto mehr wurde gelacht.
August forderte mich heraus: »Nette, mach ein nettes Gedicht!« Und in meinem Kopf überschlugen sich die Reime. Es gab niemanden, der das so gut konnte wie ich.
Der Spaß war zwiespältig für mich. Es reizte mich einerseits, zu beweisen, dass ich originell und flink meinen Kopf benutzen konnte, doch andererseits stillten die Ergebnisse weder mein Form- noch mein Schönheitsgefühl. Ich wollte andere Zeilen verfassen, andere Inhalte ergreifen.
Alle lachten, und ich stand mit heißen Wangen mitten im Zimmer, hatte gerade einen weiteren Spruch zum Besten gegeben, da bemerkte ich meine Doppelgängerin am Rande des Gesichtsfeldes. Als ich den Kopf drehte, versteckte sie sich hinter einer Samtgardine, ich sah den Stoff aufbauschen, erblickte einen Schimmer ihres Kleides hinter dem Klavier. Zuletzt hörte ich die Tür leise knarzen, durch die sie verschwand.
Später, im Bett, glaubte ich, bei jedem Windhauch ihren Atem zu hören. Ich lauschte mit angespannter Ungeduld.
»Wo bist du?«, flüsterte ich. Ein Streifen Mondlicht an den Bettvorhängen täuschte helles Haar vor. Ich hielt die Augen offen, bis sie brannten, und merkte nicht, wann ich einnickte, weil die Doppelgängerin durch meine Träume tanzte wie ein Nebelfräulein.
»Wach auf!«
Ich schreckte hoch. Ja, sie erwartete mich.
Längst schliefen alle im Schloss. Ich tapste durch die vom Mondlicht erhellte Stube, setzte mich an den kleinen Tisch und öffnete das Tintenfass, noch bevor ich eine Kerze entzündet hatte. Bei flackerndem Schein flog meine Feder über das Papier, erst zögernd, aber dann immer schneller. Es war nicht der Verstand, der mir diktierte, weder das Versmaß wurde mir bewusst, noch plante ich einen Inhalt; dennoch blieb mein Geist klar, ich verfiel in keinen Traumzustand oder in Visionen, ich schrieb, das war alles. Nein, ich schrieb nicht – die Doppelgängerin in mir schrieb.
Taumelnd erhob ich mich nach ein, zwei Stunden, versteckte das vollgekritzelte Papier unter einem Stapel Noten auf der Kommode, löschte die Kerze und öffnete das Fenster. Endlich senkte sich Friede in mein Gemüt, denn meine Doppelgängerin war ganz und gar um mich herum. Sie und ich waren eins. Glücklich ging ich zu Bett und schlief sofort ein.
Nach wenigen Stunden hämmerte die Magd an meine Tür und rief, dass die Kutsche nach Kassel bereit wäre. Ich wollte die Augen nicht öffnen, denn noch immer summte es in mir. Das war keine Musik, das war die Melodie meiner Sprache, der Rhythmus meiner Worte und Reime. So lange wie möglich dehnte ich das Erlebnis aus. Mit geschlossenen Augen bewahrte ich das Glücksgefühl, das mir das Dichten in der Nacht bereitet hatte. Erst als meine Schwester schimpfte, weil ich noch in den Federn lag, riss ich mich aus der Verbindung mit der Doppelgängerin und zeigte mein einfaches Annette-Gesicht. Während ich mich ankleidete, sah ich im Augenwinkel ein Blatt unter dem Notenstapel im Luftzug aufwehen.
Der Algeriersklave
Seit sechs Uhr saßen wir in der Kutsche, und ich sehnte mich nach der ersten Poststation. Zwar reisten wir mit dem eigenen Wagen, aber es empfahl sich doch, die üblichen Haltestellen anzufahren. Dort konnte Papa den Kutscher losschicken, damit er sich erkundigte, was eventuell auf der weiteren Wegstrecke zu erwarten war. Die Straßen von Bökendorf nach Kassel waren viel befahren und galten als gut ausgebaut, dennoch litt mein Rücken. Um mich von meinen Schmerzen abzulenken, betrachtete ich die Familienmitglieder, die alle vor sich hindösten. Zehn Stunden Fahrt zogen sich wie eine Ewigkeit.
Papa lehnte neben dem Fenster und hielt die Augen geschlossen. Sicher hatte er die halbe Nacht in einem Geschichtsbuch gelesen und holte nun den fehlenden Schlaf nach. Wir glichen uns in so vielem: Auch ich hatte eine Kerze verschwendet, meine Haut schimmerte so hell und durchscheinend wie seine, und wir trugen beide einen Rubinring am Mittelfinger. Seiner viereckig, meiner rund. Er hatte ihn mir zu meinem 14. Geburtstag geschenkt, und seitdem glaubte ich, dass er mich in besonderer Weise beschützte.
Ein Knirschen, gefolgt von einem Ruck – die Kutsche schwankte, und ich hüpfte auf dem Sitz in die Höhe. Meine über den Ohren aufgesteckten Locken schlugen gegen meine Wangen, und eine Haarsträhne kitzelte meinen Hals. Wie das Gekrause auf dem Kopf meines Vaters war es hell wie Lämmerfell. Und würde er jetzt die Augen aufgeschlagen, dann sähe ich in die gleiche Iris. Ein Hellblau verdünnt mit zu viel Wasser.
Beim nächsten Gerumpel der Kutsche rutschte Jennys Kopf von meiner Schulter, wo sie geschlafen hatte. Sie schreckte hoch, fuhr sich automatisch an den Hals und testete, ob ihr Kragen korrekt saß. Als sei es das Wichtigste auf der Welt.
»Wo sind wir?«, fragte sie.
»Ich weiß es nicht. Ich sehe nur Staub vor dem Fenster.«
Jenny gähnte verhalten hinter der Hand. So war sie: Selbst unbeobachtet vergaß sie nie ihre Manieren. Sie war dunkelhaarig, robuster als ich und geordneter im Kopf. Nur heute nicht, denn sie sah dem Aufenthalt in Kassel nervös entgegen. Ich lächelte sie aufmunternd an und drückte kurz ihre Hand.
August, neben Papa auf dem Sitz, brummte im Schlaf. Es klang wie ein kurzer Schnarcher. Caroline auf meiner anderen Seite kicherte. Sie war Augusts Schwester und durfte mitkommen, weil niemand so recht wusste, was man mit ihr anfangen sollte.
Caroline war zwar die Schwester von Mama, aber nur sieben Jahre älter als ich. August hatte mir nur fünf Jahre voraus. Die Geschwister hatten alle die typische Hakennase der Haxthausens, das dunkle dicke Haar und den kleinen schmalen Mund. Obwohl Caroline und August nur die Halbgeschwister von Mama waren, staunte ich immer wieder über die Ähnlichkeit.
Als August wieder aufschnarchte, kam das Malteserkreuz, das er an einer dicken Kette um den Hals trug, in Bewegung. Er schmückte sich mit dem Zeichen des aufgelösten Ordens, was nicht seinem Stand entsprach, er legte die Perücke nicht ab und trug immer noch altdeutsche Kragen. Mit 26 Jahren war er schon reichlich wunderlich. Vermutlich passte das alles zu seiner vorrevolutionären Gesinnung.
»Seit unser Vater ihm die Verwaltung des Bökerhofes übertragen hat, leidet er unter schlechter Laune«, flüsterte Caroline mir zu.
Auch jetzt runzelte er die Augenbrauen und schob das Kinn vor, was ihn schmollend aussehen ließ. Ich bemerkte, dass ich selbst das Kinn vorgeschoben hatte und eine Schnute zog. Carolin kicherte und steckte Jenny und mich damit an.
Papa und August wachten gleichzeitig auf, und das verschlafene Glotzen der beiden Männer bot einen köstlichen Anblick.
»Ist euch langweilig?« August streckte den Rücken.
»Wir müssten doch bald die Poststation erreichen.« Papa lehnte sich aus dem Fenster und rief dem Kutscher diese Frage zu. Der erwiderte irgendetwas und knallte mit der Peitsche.
»Es dauert noch«, verkündete Papa.
Eine Weile herrschte Schweigen. Ich begann die Sekunden zu zählen und schloss innerlich Wetten ab, wer als Erstes sprechen würde. August kratzte sich unter der Perücke. Ich ahnte, dass er nicht das Gespräch eröffnen würde, denn mit schlechter Laune fand er keine unverfänglichen Themen, und da Papa anwesend war, konnte er die gesellschaftlichen Regeln nicht einfach übergehen und über sein Schicksal schimpfen. Jenny zupfte am Korken der Wasserflasche herum, die sie auf dem Schoß hielt. Die Arme war eindeutig zu aufgeregt für oberflächliches Geplauder.
Caroline wandte sich zu mir. »Erzähle uns doch eine Gespenstergeschichte.«
»Am helllichten Morgen?«
»Ist doch egal. Wir können ja die Vorhänge zuziehen.«
Meine Tante wurde wirklich immer kindischer.
Vater lachte seine junge Schwägerin freundlich an und wandte sich an August: »So, da du nun die Studien aufgegeben hast, fehlt dir Göttingen sehr?«
Er hatte gewonnen! Auch wenn Caroline zuerst losgeplappert hatte, konnte ihre Bitte zum Geschichtenerzählen nicht gewertet werden. Zu einem Gesprächsauftakt gehörte eine Frage oder eine Aussage, die zu weiteren Äußerungen aufforderte. Papa bescheinigte ich außerordentlichen Mut, da er Augusts sensibelstes Thema anschnitt. Dieser schwelgte eine Weile in Erinnerungen an seine Studentenzeit und schwenkte dann aber über zu seinem Lieblingsprojekt: Die Wünschelrute.
»Ist deine Erzählung vom Algeriersklaven schon erschienen?«, fragte Papa.
»Ja, im Frühjahr. Ich muss dir ein Exemplar der betreffenden Ausgabe zeigen, sobald wir zurück sind.«
»Erzähle die Geschichte, bitte!«, rief Caroline.
»Aber du kennst sie doch schon.« August schüttelte den Kopf.
»Die von Herrmann, der einen Mord beging und 20 Jahre verschwunden blieb, bis er wieder zurückkam?«
»25 Jahre. 1807 kam er aus Algier zurück.«
»Das ist ja noch gar nicht lange her«, sagte Jenny. »Was haben sie mit ihm gemacht? Hingerichtet?«
Ich kannte Augusts Veröffentlichung und verfolgte gespannt, wie er darüber sprechen würde.
»Nein …«, begann August, aber Caroline fiel ihm ins Wort.
»17 Schläge mit einer Keule hat er bekommen. Es war noch Haut daran!«
August lachte auf. »Du bringst alles durcheinander.«
»Wie war es denn nun?«, fragte Papa. Sicher wollte er es genau wissen, immerhin war es eine Gräueltat, die in direktem Zusammenhang mit der Familie stand.
»Ja erzähle bitte.« Auch Jenny sah August neugierig an.
Er befingerte sein Malteserkreuz. »Es war 1782, da bekam Herrmann Winckelhan vom jüdischen Händler Pinnes Stoff für ein Camisol.«
»Konnte Herrmann sich selbst ein Hemd nähen?«, fragte Caroline.
Alle lachten auf. Ich empfand Mitgefühl mit ihr, weil sie fast zu weinen begann, sie hatte kein Talent dafür, das Wesentliche an einer Geschichte zu erkennen.
»Nein«, sagte ich schnell, damit August sie nicht ausschimpfte. »Hör zu.«
»Er hat den Stoff nicht bezahlt, und der Pinnes hat ihn vor Gericht geschleppt«, fuhr August fort.
Ich bemerkte, wie Papas Augenbrauen in die Höhe schossen. »Vor den Drosten von Haxthausen?«
August nickte. »Ein gerechter Prozess folgte, Herrmann musste die Rechnung bezahlen.«
»Hat er aber nicht!«, rief Caroline. »Jetzt weiß ich es wieder. Er hat einen Knüppel gemacht und den Pinnes erschlagen. Siebzehn mal. Die Haut war noch dran!«
August erklärte bedächtig: »Herrmann sagte nach dem Prozess: Dich mach ich kalt. Aber keiner dachte sich was dabei. Erst als die Frau des Juden ihren Mann tot aufgefunden hatte, da fiel es den Leuten wieder ein. Herrmann war aber bereits verschwunden.«
»Er hat als Matrose angeheuert, da ist es ihm übel ergangen, er wurde gefangen genommen«, rief Caroline.
»Warum ist er zurückgekommen?«, fragte Jenny.
August zuckte mit den Schultern. »Vielleicht wusste er nicht, wohin sonst. Er hatte aus der Gefangenschaft einen Brief geschrieben und darum gebeten, man möge für seine Freilassung aufkommen. Der Droste beriet sich mit dem Landesherrn, aber sie beschlossen, nichts zu unternehmen.«
»Sie dachten, er stirbt in der Gefangenschaft.« Ich sah in Papas Miene, dass er das für eine gerechte Strafe hielt.
»Als er wieder auftauchte, sprach er keine christliche Sprache mehr. Es war ein Kauderwelsch aus mehreren Dialekten. Es dauerte Monate, bis er sich wieder verständlich machen konnte, und er beteuerte dann, dass er den Juden nur verprügeln wollte«, erzählte August weiter.
»Und keiner hat ihn erkannt«, ergänzte Caroline mit unheilschwangerer Stimme.
»Er war verkrüppelt, krumm und arg alt geworden vom Steineschleppen und den Misshandlungen. Keiner wollte ihn einstellen, denn alle erinnerten sich daran, dass er doch ein Mörder war.«
»Was wurde aus ihm?«, fragte Jenny.
»Er hat sich erhängt«, sagte August, und alle zuckten zusammen. Obwohl Caroline die Geschichte schon kannte, schreckte sie am stärksten hoch.
»Hat man ihn bestattet?« Ich sah Jenny schon für die arme Seele beten, denn Selbstmörder bekommen kein christliches Begräbnis. August nickte, und sie atmete erleichtert auf.
»Du hast den Baum vergessen, du musst noch das von dem Baum erzählen.« Caroline drehte sich zu mir. »Das ist nämlich richtig gruselig.«
»Ach ja, die Buche. Sie wurde zwei Jahre später gefällt.« August kratzte sich unter der Perücke.
»Die Buche, an der er sich erhängte?«, fragte Papa. »Was ist daran unheimlich?«
Caroline ergriff wieder das Wort. »Die Juden haben den Baum vom Drosten gekauft und etwas hineingeschnitzt, einen Spruch. Und deswegen hat er sich dort erhängt.«
»Was für einen Spruch?«, fragte Papa.
Caroline nickte ihrem Bruder auffordernd zu. »Es war Hebräisch, und das konnte ja keiner lesen.«
»Der Mörder soll keines natürlichen Todes sterben«, sagte ich und bekam eine Gänsehaut.
»Du kennst die Geschichte?« August sah mich erstaunt an.
»Die Gräfin Thielemann hat mir die Ausgabe der Wünschelrute gezeigt, als ich sie kürzlich besuchte.«
August nickte nur, und wieder breitete sich Schweigen aus.
Bis zur Poststation dachte ich über den unseligen Herrmann nach. Ich hatte mich beim Lesen schon gefragt, was das Wesentliche an der Geschichte war. Wirkte der Spruch der Juden wie ein Fluch, der sich erfüllen musste? Wie würde ich die Geschichte erzählen, wenn ich in der Wünschelrute veröffentlichen dürfte? Undenkbar! Mama würde es niemals erlauben.
Es blieb nicht viel Zeit zum Verweilen, als die Kutsche an der Poststation anhielt. August holte aus der Schankstube mehrere Gläser Milch, ich suchte den Abort auf, und schon scheuchte Papa alle wieder in die Kutsche. Zu meinem Verdruss verkündete er, dass er den nächsten Streckenabschnitt beim Kutscher sitzen wolle, und kletterte auf den Bock.
Auch August zog ein langes Gesicht. Aber ich fand, dass ihm das nicht zustand, denn er hatte zumindest die Aussicht, später eine Weile oben sitzen zu können, ich konnte nur davon träumen.
»Wie schön, jetzt haben wir mehr Platz!« Caroline ließ sich neben August in Fahrtrichtung nieder.
Jenny breitete ihre Röcke aus und lugte aus dem Fenster. »Wie lange ist es noch?«
»Acht Stunden.« August rieb an seinem Malteserkreuz herum.
Als die Pferde sich ins Geschirr legten und anzogen, staubte es vor unseren Fensterscheiben auf, und ich beobachtete die winzigen Körner im Sonnenlicht. Es wurde warm und stickig in der Kutsche, weil die Fenster wegen des Staubes geschlossen bleiben mussten. Von der tagelangen Hitze waren die Straßen ausgedörrt, und die Sonne warf blendende Lichtkringel gegen die Scheiben.
Ich wartete darauf, wann August beginnen würde, seine schlechte Laune an mir auszulassen, jetzt, da sein Schwager als Wächter von Sitte und Moral nicht mehr anwesend war. Innerlich bereitete ich mich darauf vor, ihm nichts durchgehen zu lassen, schließlich durfte er später oben sitzen, das war Privileg genug für heute.
Schließlich ergriff ich das Wort. »Dein Bericht ist mir aufgefallen, weil er sich von den anderen Beiträgen in der Wünschelrute unterscheidet.«
»Höre ich da etwa einen nörgelnden Unterton heraus?«
»Nein, nein«, fuhr Jenny eilig dazwischen. »Nette schätzt alles sehr, was du schreibst. Nicht wahr? Die Wünschelrute ist voller entzückender Gedichte und Geschichten.«
August sah mich finster an, als wollte er mich einschüchtern und dadurch abhalten, weiterzusprechen.
Aber das ließ ich nicht auf mich wirken. »Es ist ein guter Bericht, wie gesagt, ich wundere mich daher, dass er aufgenommen wurde, schließlich erwartet man Berichte über Kriminalfälle in einer Tageszeitung.«
»So denkst du dir das also aus.« August klopfte mit dem Fingernagel auf sein Malteserkreuz.
»Es ist nichts, was ich mir ausdenke. Verschiedene Gattungen gehören in verschiedene Journale«, sagte ich, wohl wissend, dass ich mich auf heikles Terrain begab. Nicht etwa, weil ich mich in der Materie nicht genügend auskannte, sondern weil ich mir anmaßte, eine männliche Domäne zu betreten. Und genau darauf reagierte August.
»Hast du deinen Stickrahmen verlegt?«
»Ach je!«, rief Caroline. »Hättest du etwas gesagt, ich kann dir meinen alten ausleihen.«
»Er will mich nur ärgern, Caroline.« Zu August gewandt, sagte ich: »Das Material vom Algeriersklaven eignet sich hervorragend für eine Erzählung.«
»Es ist eine Erzählung! Sieht es etwa in deinen Augen wie ein Gedicht aus?«
»Du hast über kriminelle Taten berichtet und was darauf folgte, insofern ist es ein Bericht über ein Verbrechen und seine Auflösung. Eine Erzählung ist etwas anderes.«
»Aha, du glaubst also, du kannst das?«
»Ja, sicher kann sie das«, sagte Jenny. Um sie am Weitersprechen zu hindern, hob ich schnell meine Hand, aber es war zu spät. »Sie hat einen Roman begonnen.«
Er lachte. »Das passt auch zu dir, schreibe du romantische Romane und …«
»Ich rede nicht von einem Roman, dafür gibt das Ausgangsmaterial nicht genug her. Eine Erzählung. Ich habe mir das überlegt. Die kriminelle Tat könnte unter einem bestimmten Aspekt betrachtet werden.«
»Was du dir so alles denkst!«
Carolines Kopf flog geradezu von mir zu August. Sie versuchte, zu begreifen, um was wir stritten.
»Was haben wir?« Ich zählte es an den Fingern ab. »Armut, zerrüttete Familienverhältnisse, einen Streit um eine unbeglichene Rechnung. Das kann man in realistisch erzählten Szenen darstellen.«
»Willst du etwa Liberalismus betreiben? Das würde ich dir in der heutigen Zeit nicht empfehlen. Du hättest sofort einen Spitzel im Haus. Angenommen, du könntest überhaupt etwas veröffentlichen.«
»Ich will keinesfalls ein politisches Pamphlet verfassen, das wäre in der Wünschelrute auch fehlplatziert. Nein, überleg doch mal. Herrmann kommt aus einem elendigen Milieu, das ihn prägt, vielleicht kommt eine ungünstige Vererbung hinzu, und dadurch reagiert er auf Not zwingend in einer bestimmten Weise. Frühe Verhängnisse entfalten sich im Laufe des Dramas. Damit würde man die Leser nicht nur in Atem halten und ihnen etwas vorfabulieren, sondern dem Ganzen eine Gestalt geben, die eine Aussage macht.«
»Also doch politisch.«
»Vielleicht, aber das ist doch nicht das Wesentliche. Vielleicht ist die Aussage auch universell oder religiös. Die Leser werden das herausgreifen, was ihrem Wesen entspricht.«
»Du machst einen Denkfehler, liebes Nettchen, du wirst fabulieren müssen bei dem, was dir vorschwebt. Denn du weißt nicht, wie sich die kriminellen Taten zugetragen haben. Es gibt verschiedene Aussagen, die sich widersprechen, und es gibt Dinge, die du nicht mehr in Erfahrung bringen kannst, weil die Betreffenden tot sind.«
»Die Widersprüche sind kein Problem, im Gegenteil, sie machen die Erzählung spannend. Sie können nebeneinanderstehen, und die Leser müssen selbst rätseln, welche Version wohl stimmen mag.«
August sah aus, als sei er beeindruckt von dem, was ich sagte. Übermütig fuhr ich deshalb fort, meine Ideen preiszugeben.
»Ein Gruseln könnte man dadurch erzeugen, dass man die Morde nicht beschreibt, sondern nur die darauf folgenden Reaktionen naher Personen, der Frau des Juden, zum Beispiel, oder Herrmanns Mutter.«
»Du würdest das Wichtigste einfach weglassen?« August sah sie spöttisch an. »Das ist nun absolut falsch.«
»Auslassungen erzeugen Fantasie, und nichts ist so spannend wie die eigenen Vorstellungen.«
»Und der Spruch am Baum? Würdest du den auch weglassen? Das wäre doch schade«, fragte Caroline.
Alle drei sahen mich gespannt an. Ich ließ mir nicht anmerken, dass ich mir darüber noch keine Gedanken gemacht hatte, sondern antwortete, einer spontanen Eingebung folgend: »Erst ganz zum Schluss würde ich die Übersetzung des Hebräischen preisgeben.«
»Warum?«
»Weil das auf die ganze ausgeklügelte Logik in der Darstellung ein neues Licht wirft und die Leser am Ende noch mal alles durchdenken wollen, am liebsten wieder von vorne zu lesen beginnen möchten.« Begeistert von meiner Idee strahlte ich in die Runde.
»Gott sei Dank schreibst du nicht für die Wünschelrute«, sagte August.
»Du bist nur neidisch auf meine Idee.«
»Neidisch? Auf dich? Weißt du, im Verstand der Frau bleibt immer eine gewisse Schwäche zurück. Das ist allgemein bekannt.« Er holte Pfeife und Tabakbeutel hervor und zeigte damit an, dass das Gespräch für ihn beendet war.
Ich merkte Carolines Blick. August bekam Bewunderung und Achtung, mir schenkte sie Mitgefühl. Doch einerlei, sie konnte es nicht beurteilen.
Jenny schob die Gardine beiseite und rieb an der Scheibe, als würde das etwas nützen, um durch den Dreck und den Staub von draußen sehen zu können. Wenn sie nicht schlichten konnte, hielt sie Schweigen für die beste Methode, Frieden einkehren zu lassen.
Ich sah auf den matt leuchtenden Rubin in meinem Ring und spürte mein Herz wild klopfen. Die Doppelgängerin lebte in mir, und das wappnete mich gegen das Unverständnis meiner Familie. Vielleicht müsste Herrmann einen Doppelgänger haben so wie ich. Eine zweite Gestalt mit anderen Eigenschaften. Und schon begann ich mir die Geschichte auszumalen.
Male Hassenpflug
»Heute gehe ich keinen Schritt mehr!« Jenny warf sich quer auf das Bett. Caroline legte sich neben sie.
Das Zimmer im Hotel Zum deutschen Kaiser war prächtig, aber altmodisch eingerichtet. Ein mittelalterlich anmutendes Bettgestell mit Samtvorhängen und Baldachin füllte fast den Raum aus und würde für uns drei genug Platz bieten.
Ich wusch Gesicht und Hände mit Lavendelseife, benetzte mit dem Schwamm meinen Nacken und ließ mich anschließend auf die dicke Matratze plumpsen. Das Gefühl, immer noch von der Reisekutsche durchgerüttelt zu werden, hielt an. Caroline war eingeschlafen, deshalb beugte ich mich vorsichtig, um sie nicht zu wecken, zu Jenny und tupfte ihr die schweißnasse Stirn ab. Genussvoll schloss sie die Augen. Ich fuhr sachte über ihre Augenbrauen, die wie schwarze Flügel eines Vogels am Horizont geschwungen waren. Alles an Jenny wirkte südländisch, ganz das Ebenbild unserer Mutter.
Es klopfte, und Papa rief nach uns.
Erstaunt setzte ich mich auf
»Wollt ihr in die Oper gehen?« Er sah munter aus, dabei war er vor ein paar Minuten ebenfalls erschöpft aus der Kutsche gestiegen.
»Heute Abend?« Caroline setzte sich auf und rieb sich die Augen.
»Ein Bote von Ludwig Hassenpflug hat die Einladung gerade gebracht. Wir können uns ihnen noch anschließen. Was meint ihr?« Er wedelte mit einem Blatt Papier.
»Ich weiß nicht. Ich bin so müde.« Jenny gähnte hinter vorgehaltener Hand.
»Wer kommt noch?«, fragte ich und nahm das Schreiben an mich. »Regierungsrat Hassenpflug mit Schwester Amalie würden sich freuen, wenn wir uns ihnen anschließen«, las ich laut, »anschließen wird sich Lotte und …«, ich machte eine Pause und sah Jenny an.
»Und?« Sie fuhr aus dem Bett.
Ich hielt den Brief außer ihrer Reichweite. »Sonst niemand von Bedeutung. Ach, und es wird Don Giovanni gespielt.«
»Zeig her!« Jenny versuchte, mir das Blatt zu entwinden, doch ich reichte Papa den Brief. »Du kannst die Kutsche einspannen lassen«, sagte ich.
»Eine Oper lohnt sich immer.« Papa schüttelte den Kopf. Er ahnte nicht, warum Jenny so aufgeregt war.
Kaum hatte er die Tür geschlossen, begann Jenny ihr Kleid aufzuschnüren und Befehle zu erteilen.
»Caroline! Steh endlich auf! Geh und ruf die Bedienung, sie soll warmes Wasser bringen. Nette schüttle das weiße Kleid aus, nein, das blaue … Nette! Steh nicht herum, du musst dich umziehen.«
»Wenn du dich so erhitzt, dann bekommst du rote Wangen wie ein Bauerntrampel. Ob er dich dann noch ansehen mag?« Gemächlich zog ich die Haarnadeln aus meiner Frisur.
»Ich weiß gar nicht, von wem du sprichst.« Jenny riss ihre Kleider aus der Reisetasche.
»Aber du kannst sicher sein, der Herr Dichter und Märchensammler mag auch die Landpomeranzen.«
»Wir sind keine Landpomeranzen. Das wird er schon sehen!«
Jenny stieg in das blaue Kleid und zerrte es über die Schultern. »Es passt mir nicht mehr! Ich hätte es zu Hause anprobieren sollen! Was mache ich denn jetzt?«
Noch nie hatte ich sie so außer sich erlebt. Sie, die sich der Tugend verschrieben hatte, führte sich auf wie ein Backfisch vor dem ersten Ball, dabei war sie schon 25.
»Du siehst auch in dem weißen Kleid wunderhübsch aus, zieh es an, komm, ich helfe dir«, sagte ich.
Endlich trugen Caroline und eine Magd Wasserkrüge herein, und wir begannen, uns gegenseitig neu zu frisieren. Jenny war als Erste fertig, und während Caroline und ich uns umzogen, suchte sie in der Schmuckschatulle nach einem Ring, den sie über den Handschuhen tragen konnte. Feierlich drehte sie sich um.
»Was sagst du …« Sie stockte, als ihr Blick auf mich fiel. »Dieses Kleid kannst du nicht anziehen. Du siehst so … so … Es geht nicht, basta.« Sie sah sich suchend um. »Da, das blaue, das wird dich besser kleiden.«
Ich sah an meinem Ballkleid hinunter. Es passte gut, ich trug es schon seit Jahren, außerdem konnte ich damit bequem sitzen, das war wichtig in einer Oper, die drei Stunden dauerte. Manche Kleider sind zum Stehen und Tanzen, manche zum Sitzen und Musikhören, wollte ich ihr gerade erklären, da brach meine Schwester in Tränen aus.
»Du hast selbst gesagt, dass wir Landpomeranzen sind, aber wir müssen doch nicht auch noch so aussehen.«
Caroline streichelte betroffen Jennys Arm und warf mir vorwurfsvolle Blicke zu.
»Es ist doch nur wichtig, dass du hübsch aussiehst. An mich verschwendet Grimm keinen Gedanken«, sagte ich.
Jenny schluchzte auf, als sie den Namen ihres Angebeteten hörte.
»Wir sind eine Familie und … und … ich will doch … ach … verstehst du das nicht? Ich bleibe hier, ich kann das alles nicht.« Sie schlug die Hände vors Gesicht.
Wilhelm Grimm war ein aufgeblasener Besserwisser, der sich furchtbar viel darauf einbildete, dass er mit seinem Bruder die Kinder- und Hausmärchen veröffentlicht hatte. Ständig gab er an damit, dass sie die deutsche Geschichtenkultur retten würden und diese ganze geniale Idee natürlich auf ihn zurückging. Ich hatte ihn schon ein paar Mal genießen müssen, wenn er bei Großmutter zu Besuch gewesen war. Dort ging er ein und aus als Augusts Gast, den er von der Universität Göttingen kannte. Jenny hatte ihn auch kennengelernt und hing an seinen Lippen. Und sie bildete sich ein, dass er Interesse an ihr gezeigt hätte. Davon hatte ich nichts bemerkt, zweifelte sogar daran, dass Grimm überhaupt in der Lage wäre, Interesse an irgendjemand anderem als an seiner eigenen Person zu haben.
Doch meine Schwester tat mir leid. Sie schwärmte, und ich wusste, Schwärmerei war eine gefährliche Sache, besonders da Grimm bürgerlich war und damit außerhalb jeglicher ernsthaften Erwägungen stand.
»Wenn du es unbedingt willst.«
Jenny wischte die Tränen weg und lächelte erleichtert.
»Du bist ein Schatz!«, bestätigte Caroline.
Ich schlüpfte in das blaue Kleid und bereute es augenblicklich.
Das Dekolleté war ungeheuer tief geschnitten, so konnte ich auf gar keinen Fall in die Öffentlichkeit gehen. So nicht!
Jenny sah meinen Gesichtsausdruck, und sofort rannen wieder Tränen über ihre Wangen. »Es ist nur so tief ausgeschnitten, weil du kleiner bist als ich und so schmal.«
»Warte, ich gebe dir ein Brusttuch.« Carolin zog ein seidiges Gespinst zwischen ihren Hemden hervor und stopfte es unter die Träger meines Kleides.
»Ich sehe aus, als trüge ich eine Serviette!«
Es klopfte. »Seid ihr fertig? Schnell, wir sind spät dran«, rief Papa.
»Jetzt kannst du dich nicht mehr umziehen. Bitte komm.« Jenny legte mir einen Umhang über die Schultern und öffnete die Tür.
Ich warf das Seidentuch beiseite und zupfte am Ausschnitt herum, aber da war nichts zu machen: Ich präsentierte meine Brüste, wie ich es nie zuvor getan hatte.
Wir erreichten das Schauspielhaus nach dem ersten Läuten. Das Foyer war schon fast leer, als wir hineinstürmten, und August winkte jemandem an der Tür zum Saal zu. Ludwig Hassenpflug und seine Schwester nahm ich an, die beiden kannte ich nicht. Daneben erahnte ich Grimm, seine große Gestalt mit der Löwenmähne, seine arrogante Kopfhaltung – er hielt ihn immer ein wenig schief.
Jenny packte mich am Handgelenk. »Da ist er.«
Ich wollte das Lorgnon aus dem Beutel holen, um Augusts Bekannte zu betrachten, da zog mich Jenny zur Seite. »Steck das Ding weg. Musst du immer so auffallen?«
Das kam mir zupass, für Grimm war es in der Pause noch früh genug. Außerdem machte mich das Lorgnon zu einer alten Jungfer.
»Wir müssen ihm unauffällig begegnen«, zischte Jenny und packte meine Hand.
»Du kannst unauffällig vorbeischleichen oder ihm begegnen. Beides zusammen widerspricht sich vom Wortsinn her«, erklärte ich ihr.
»Da entlang.«
»Nette, Jenny!«, rief Papa. »Wo wollt ihr denn hin?«
Er leitete uns zu Grimm und Augusts anderen Freunden. Ich entriss Jenny meine Hand, und weil sie mich im gleichen Augenblick losließ, stolperte ich und prallte gegen eine Frau, die einen erschrockenen Laut ausstieß. Ich hielt mich an ihren Oberarmen fest, sie packte mit beiden Händen meine Taille und wir tänzelten ungeschickt herum, bis wir das Gleichgewicht wiedergefunden hatten.
Später erinnerten wir uns mit Vergnügen an diesen Tanz, den sie »Kennenlerntanz« und ich »Freundschaftswalzer« nannte. Atemlos lachten wir und standen viel zu dicht beieinander.
Eine Fülle an sinnlichen Wahrnehmungen durchflutete mich in Sekundenschnelle. Ihr Atem streifte meine Wange, ihr Duft nach Maiglöckchen hüllte mich ein, und ich bin sicher, dass er es war, der mich so blöde werden ließ. Obwohl wir uns kaum berührten, spürte ich ihren Körper.
»Das ist aber lieb«, sagte ich. Irritiert sah ich von einem Auge zum anderen, bis mir klar wurde, dass sie einen Silberblick hatte und ich deswegen nicht sicher sein konnte, wohin sie sah.
Males Erscheinung war so imposant, dass niemand es wagte, sie wegen ihres Schielens zu necken. Das wusste ich damals noch nicht, ich verhielt mich unwillkürlich so, wie ich es später bei vielen anderen, mit denen sie in Kontakt kam, auch beobachtete: Man nahm Haltung an. Eigentlich würde ich so ein Verhalten nur einem Mann oder einer Königin gegenüber erwarten. Male war beides nicht, strahlte es dennoch aus. Die hohen Ämter ihres Vaters und ihres Bruders hatten wohl auf sie abgefärbt. Sie trug die stolze Haltung eines Ministers, der gleich die Anweisung gibt, ein Versäumnis schleunigst zu beheben.
So erging es auch mir in diesem Moment. Ich suchte nach einer Entschuldigung dafür, dass ich in sie hineingestolpert war. Meine Kurzsichtigkeit konnte als Argument nicht gelten, Jennys Schusseligkeit aus Verliebtheit konnte ich auch nicht anbringen. Also blieb mir nichts anderes übrig, als schuldbewusst auf Gnade zu hoffen.
Sie wurde mir zuteil, augenblicklich, im buchstäblichen Wortsinn. In ihren dunklen Pupillen blitzte etwas auf, das mich durchfuhr wie ein sanfter Strahl aus Wärme.
»Für einen Walzer ist es nicht der rechte Ort«, sagte sie lächelnd.
»Schade«, entfuhr es mir.
»Ja, schade.«
Meine Wangen brannten und ich wusste, dass ich ein glutrotes Gesicht zur Schau stellte. Ihre Augenlider flatterten, und ich staunte über die Länge ihrer Wimpern, als sie nach unten sah. Sie konnte nicht zu Boden sehen, wie sie es vermutlich tun wollte, denn ich stand viel zu dicht vor ihr, und ihr Blick wurde von meinem Dekolleté aufgefangen. Ja, er musste dort landen!
Ruckartig hob sie den Kopf, und nun verfärbte sich auch ihre Gesichtshaut.
Wie zwei reife Tomaten mussten wir gewirkt haben, das behauptete ich danach, nur um zu hören, wie sie widersprach: »Rosenhauch auf deinen Wangen.« Sie schmeichelte mir, und ich ließ es mir gefallen, auch wenn ich wusste, dass nur sie einer Rose gleichen konnte.
Aber das geschah alles erst später. Ich weiß nicht mehr, wie wir uns aus der ungeschickten Umklammerung lösten, ich erinnere mich nur noch daran, dass ich danach den ganzen Abend wie betäubt und gleichzeitig unglaublich wach war. Ich erfuhr, dass dies Amalie Hassenpflug sei, Male.
Nun musste ich doch ein paar Knickse machen, vor ihrem Bruder Ludwig und vor Wilhelm Grimm, auch seine Schwester Lotte musste ich begrüßen, für mehr blieb keine Zeit, die Glocke ertönte zum zweiten Mal.
Male nahm meinen Arm und führte mich ganz selbstverständlich zu einer Logentür.
»Sie steht uns zu allen Aufführungen zur Verfügung«, erklärte sie.
»Ich wäre jeden Abend hier!«
»Oder im Ballhaus?«
Wir lachten.
Ich drängte an Caroline und Jenny vorbei, weil ich neben Male sitzen wollte.
»Du benimmst dich skandalös«, zischte Jenny und zeigte auf den Hut, den ich in der Hand hielt. Ich hatte ihn abgenommen, damit ich mich näher zu Male hinüberbeugen konnte. Ich stellte ihr tausend Fragen, alles, alles wollte ich von diesem wundervollen Geschöpf wissen.
Sie war drei Jahre jünger als ich, hatte drei Schwestern und einen Bruder, ihre Familie stammte von Hugenotten ab und sie sprachen zu Hause nur französisch, was mich besonders entzückte. Als ich dann noch erfuhr, dass sie Unterricht in Geschichte, Geografie und Englisch erhalten hatte, bekam ich eine Gänsehaut. Sie war gebildet!
In der Pause wollte ich ihr am liebsten den Arm reichen, wie ein Mann es getan hätte, sie ins Foyer führen und ihr den Vortritt lassen. Ich fühlte mich stark und hielt Ausschau nach Gefahren, vor denen ich sie gerettet hätte – vor allem und jedem. Da war es wieder, mein wildes Herz.
Noch einmal grüßte ich ihren Bruder Ludwig, Wilhelm Grimm und dessen Schwester Lotte mit dem Knicks, der von mir erwartet wurde, der mir aber in diesem Moment seltsam verkehrt vorkam. Galant wie ein Herr führte ich Male zu Papa und Jenny. Jenny bemerkte meinen Übermut nicht, sie schaute unentwegt zu Grimm, und Papa blinzelte nur irritiert. Ich sah ihm an, dass er noch ganz eingenommen war von der Musik.
Der zweite Teil der Oper ging vorüber, ohne dass ich ihr eine Minute ernsthaft Aufmerksamkeit geschenkt hätte. Im letzten Akt erfuhr ich von Male, dass für den nächsten Tag ein Spaziergang geplant war, und ich schwebte zurück ins Hotelzimmer.
Ich tanzte von der Waschschüssel zum Bett und zurück und summte dabei eine Melodie, die von meinem inneren Orchester gespielt wurde.
»An dieses Musikstück kann ich mich nicht erinnern. Im Übrigen fand ich die Oper nicht so ergreifend wie du.« Jenny sah mich an wie Mama.
Ich warf mich lachend aufs Bett. Lachte, weil Mama nichts mitbekam von meiner Aufruhr, die ich nicht begründen konnte, lachte, weil sie mich nicht bremsen konnte mit dem Argument, es sei schädlich für mich.
»War das nicht ein wundervoller Abend?«
Caroline pflichtete mir nickend bei, aber sie war so müde, dass sie sich nicht mehr an unserem Gespräch beteiligte.
Jenny zuckte mit den Schultern. »Ich weiß nicht.«
»Oh, war er nicht nett zu dir?«
»Er hat mir zugenickt. Doch, das war nett. Und einmal hat er mich angesehen, als er mit Papa geredet hat.«
»Du armer Tropf. Aber du siehst ihn ja morgen, da wird er sicher mit dir sprechen.«
»Mit mir sprechen?« Jenny zog die Bettdecke ans Kinn. Ich tätschelte ihre Wange.
»Na, du kannst ihm von einem Märchen erzählen, das du gehört hast.«
Jenny seufzte und blies die Kerze aus.
Ich legte die Arme hinter den Kopf und genoss die Erregung, die mich wachhielt. Mein inneres Orchester ließ mich beben. Mein Herz schlug einen wilden Takt, mein Blut rauschte wie tausend Geigen, und vor Hitze warf ich mich im Bett herum.
»Lieg still. Was hast du nur?«
»Mir ist so merkwürdig zumute«, sagte ich und fand meinen Zustand so vollkommen, dass er nicht seziert werden musste.
Der Spaziergang
Ein Spaziergang mit nicht miteinander verheirateten Menschen ist eine delikate Angelegenheit. Allerlei muss beachtet werden, um den Anstand zu wahren, denn die persönlichen Strebungen der Beteiligten gehen oft nicht einher mit dem, was die Sitte erlaubt. Gewisse Abweichungen sind unter Umständen zu tolerieren, solange sie kein Aufsehen und schon gar keinen Skandal auslösen.
Vater war mit uns nach Kassel gereist, um mit Ludwig Hassenpflug, dem jungen Regierungsrat, zu sprechen. Er wollte meinem Bruder Werner eine Praktikumsstelle verschaffen und nutzte dazu den Studienkontakt Augusts. Das bedeutete langwierige Gespräche darüber, wer mit wem bekannt war und wie man am besten vorgehen könnte. Mama war eigentlich versierter darin, so eine heikle Unterredung zu führen, als mein scheuer Vater, aber es gab mehrere Gründe, warum sie nicht mitgereist war. Zum einen schickte es sich nicht, dass sie mit einem jungen Mann über eine Anstellung ihres Sohnes sprach, das war Männersache, zum anderen fand sie es entwürdigend, dass die jungen Aristokraten heutzutage gezwungen waren, wie Bürgerliche ein Studium zu absolvieren, damit sie das elterliche Gut verwalten konnten. Ludwig Hassenpflug kam nur deshalb überhaupt für ein Gespräch infrage, weil er eine monarchistische Überzeugung vertrat, die er sogar religiös begründete (der Landesherr sollte zugleich auch religiöses Oberhaupt des Landes sein). Eine Haltung, die Mama zutiefst befürwortete. Papa jedoch hatte schon während des Frühstücks davon gesprochen, dass er sich darauf freute, die vielen exotischen Bäume zu sehen, die auf der Wilhelmshöhe gepflanzt worden waren. Er wollte sich darüber mit August austauschen, der agrarische Studien betrieben hatte. Aber August nickte nur und schien mit den Gedanken woanders zu sein, während er sein Ei köpfte. Ich vermutete, dass er auf dem Spaziergang ganz eigene Absichten verfolgte.
Im Bergpark Wilhelmshöhe stieg ich erwartungsvoll aus der Kutsche. Wir Mädchen schüttelten die zerknautschten Röcke zurecht, die Männer zupften an den Manschetten und räusperten sich. Wer würde nun mit wem die Wege entlang flanieren?
»So, na dann also«, sagte Vater, der als Ältester in der Runde die Moral zu beaufsichtigen hatte. Er sah über unsere Köpfe hinweg zu den Bäumen. Ein Vogel trällerte, und da hellte sich sein Gesicht auf. »Dann wollen wir mal.« Er nickte Ludwig zu (denn er war der Gastgeber), der sich sofort an seine Seite begab und ihn natürlich nicht danach fragte, was die Studien seines Sohnes machten, sondern die Konversation mit einem Hinweis auf die Gartenbauarchitektur begann. Das war für Vater das Stichwort, August in das Gespräch mit einzubeziehen.
»Diese langsam wachsenden Wellingtonien, wie ist deren Holz einzuschätzen?«
August, der gerade im Begriff war, sich Grimm zuzuwenden, hängte sein Herz gerne an fesselnde Projekte, wie er es nannte, denn ganz Aristokrat, der er war, stand ein Beruf, bei dem man Geld verdiente, für ihn nicht an erster Stelle. Er hatte die Grimms bei der Märchensammlung unterstützt, nicht nur mit Beiträgen, wie wir alle, sondern auch finanziell.
»Du musst mir nachher unbedingt von deinen Plänen erzählen.« Er schlug Grimm auf die Schulter, bevor er sich pflichtschuldigst zu seinem Schwager begab.
Grimms Halsbinde saß etwas locker, und die Endzipfel standen wie die Zeiger einer Uhr auf fünf nach sieben. Auch sein Gesichtsausdruck wirkte zerzaust. An diesem Morgen musste er sich vierteilen. Er brauchte Augusts Unterstützung, vor allem in finanzieller Hinsicht, und sah sich gezwungen, meinen Onkel bei Laune zu halten. Im Moment konnte er nur abwarten, und so lächelte er Jenny zu. Die beiden liebäugelten seit Jahren miteinander. Wobei Jenny sich meiner Meinung nach entsetzlich zierte, ständig die Augen niederschlug und kaum den Mund aufmachte. Aber irgendwie schaffte sie es doch immer wieder, ihn anzulocken. Ich verstand nichts von dezentem Flirt, das wurde mir klar, als ich beobachtete, wie sie, ohne Grimms Lächeln zu erwidern, Anstalten machte, hinter unserem Vater herzugehen, dabei zerrte sie am Öffnungsmechanismus ihres Sonnenschirms. Grimm eilte prompt zu ihr, um ihr zu helfen. Der Schirm öffnete sich mühelos und Jenny schenkte ihm endlich ein Lächeln.
Jedoch musste er auch ein Auge auf seine Schwester Lotte haben, die mit Hassenpflug verlobt war. Da Lotte ihm und seinen vielen Brüdern den Haushalt führte, war er an einer schnellen Heirat der beiden nicht interessiert und wünschte nicht, dass sie mit Hassenpflug flanierte.
Lotte machte ein langes Gesicht. Wir mochten uns nicht besonders, das hatte ich gestern Abend schon gemerkt, und so kam es für sie nur infrage, sich bei Caroline einzuhängen. Sie registrierte dabei mit befriedigtem Gesichtsausdruck, dass Jenny ihren Bruder ablenkte, denn jetzt stiegen ihre Chancen, wenigstens ein paar Minuten mit ihrem Verlobten allein zu sein.
»Komm, meine Liebe, folgen wir den Männern, ich finde es überaus interessant, über was sie sprechen«, sagte sie zu Caroline.
»Sie reden über Bäume.« Caroline verzog das Gesicht. Aber sie trippelte gern neben Lotte her, weil sie die Schwester der Grimms für eine elegante Städterin hielt, bei der sie sich modische Anregungen holen konnte.
Grimm atmete auf, vorerst musste er seine Schwester nicht überwachen, sah von Jenny zu mir, und in seinen Augen sah ich eine kleine Bosheit aufblitzen.
Ich hob vorsichtshalber den Kopf an und schob das Kinn vor. Aber bevor er den Mund aufmachen konnte, rief Vater, dem eingefallen war, dass er eine Schar unverheirateter Fräuleins beaufsichtigen musste: »Wo bleibt ihr denn?«, und Grimm zuckte nur mit den Augenbrauen und wandte sich Jenny zu. Solange ich mit Male hinter den beiden ging, war das noch tolerierbar.
Ich hörte nicht, was er zu ihr sagte, aber ich sah, wie ihr Kopf ein kleines bisschen zur Seite ruckte, und wusste, dass er ihr geschmeichelt hatte.
Übrig blieben Male und ich, zwei Jungfern, über die sich keiner der anderen Gedanken machte. Es schien klar, dass wir miteinander genug zu plaudern hätten. Doch eine eigenartige Blödigkeit ließ meine Worte versiegen. Das kannte ich nicht von mir, ich bildete mir etwas darauf ein, dass ich sehr gewandt Konversation betreiben konnte.
»Das Wasser wird in einer geraden Linie vom Berg hinunter geleitet«, erklärte Male mir, »dazwischen gibt es reizende Wasserspiele. Wir nennen sie auch Wasserkunst, weil es so schön ist.«
Ich sah auf Males Mund, während sie sprach, beobachtete ihre Bewegungen, wenn sie mich auf eine Sehenswürdigkeit hinwies, und spürte einen eigenartigen Hunger in mir. Sie trug ein hochgeschlossenes fliederfarbenes Sommerkleid, und unter dem Hütchen ringelte sich ihr dunkles Haar hervor.
Wir schritten nebeneinander her, und ich war völlig eingenommen von ihrer Gegenwart. Sie beeindruckte mich durch ihre Schlichtheit: ihre Bewegungen, ihre Kleidung, ja sogar ihre Ausdrucksweise. Damit unterschied sie sich von der kapriziösen Art, die viele junge Frauen an den Tag legten, um die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken.
Male hatte alles, was eine Frau nicht haben sollte: Sie war groß, kräftig, sie schielte und bewegte sich mit raumgreifenden Bewegungen. Dennoch nahm niemand Anstoß daran. Warum? Das wollte ich herausfinden. Denn obwohl ich alles hatte, was von einer Frau erwartet wurde – ich stammte aus gutem Haus, war klein und bewegte mich graziös – erregte ich ständig Anstoß.
Wir erreichten eine Brücke, unter der ich einen Bach rauschen hörte. Immer noch hing mein Blick an Male, das Rauschen übertönte ihre Stimme, und ich beobachtete mit Genuss die Bewegungen ihres Mundes.
Sie zeigte mit dem Finger. »Schau.«
Ich zwang mich, hinzusehen, und erschrak. Das Wasser raste über Felsen den Berg hinunter, ein Anblick, der mir den Boden unter den Füßen wegriss. Ich griff nach dem Brückengeländer. Aber das war ein Fehler, denn nun spürte ich feine Tropfen der Gischt in meinem Gesicht, und ich lehnte mich weit zurück. Das muss ein eigenartiger Anblick gewesen sein, wie ich mich am Geländer festklammerte, die Arme gerade gestreckt hielt und mit dem Blick umherirrte, um einen festen Anker zu finden.
Male nahm meinen Arm. »Lass los, wir gehen einfach weiter. Sieh auf die Bäume da vorne. Da ist fester Boden.«
Ich rührte mich nicht, schnappte nach Luft, denn in meiner Lunge schien kein Platz zu sein. Fest an meine Seite gedrückt, streichelte Male meine Hände, bis langsam das Gefühl wieder in mich zurückkam und ich das Geländer loslassen konnte.
»Jetzt hast du es gleich geschafft. Noch zwei Schritte.«
Wir erreichten einen Pfad, und ich war froh, dass niemand meine Blamage beobachtet hatte, denn die anderen waren bereits weitergegangen. Vom festen Boden aus konnte ich angstfrei zu den herabstürzenden Wassermassen hinunterblicken.
»Geht es wieder?«, fragte Male besorgt.
»Ich hatte das Gefühl, die Brücke würde schwanken, dabei ist sie aus dicken Balken gebaut. Du musst mich für albern halten.«
»Ich werde niemandem etwas davon sagen. Und auf dem Rückweg gehen wir woanders entlang.«
Ich lachte auf. Male hatte erkannt, dass der Schreck selbst weniger schlimm für mich war als die Gefahr, vor den anderen schwach zu erscheinen.
»Jetzt kenne ich eines deiner Geheimnisse.« Male lächelte. »Das macht uns zu Verschworenen. Nein, das stimmt nicht. Erst muss ich dir eines meiner Geheimnisse verraten, dann können wir einen Pakt schließen.«
Einen Pakt schließen? Verschworene sein? Nun gut, sie wollte spielen.
»Du siehst nicht aus wie jemand, der dunkle Geheimnisse zu verbergen hat«, neckte ich sie. »Ich stelle mir vor, dass du dann mit einem verspannten Gesicht herumschlichest, eine übertriebene Freundlichkeit an den Tag legtest, und die Last des Geheimnisses müsste dich bitter machen.«
»Oh, es gibt auch lichte Geheimnisse.« Male reckte das Kinn in die Höhe, und ich hätte sie am liebsten für diesen süßen Stolz geküsst, der aus ihrer ganzen Haltung sprach.
»Jetzt bin ich ausgesprochen neugierig.«
Male ging weiter und schüttelte den Kopf. »Es braucht die richtige Umgebung und die passende Gelegenheit.«
»Du willst mich narren!«
»Das würde ich nie tun! Wir sind gleich da.« Male deutete auf eine Gebäudeansammlung vor uns. Der Rest unserer Spaziergesellschaft trat soeben durch einen gemauerten Bogen in das Innere einer Burganlage.
Türme, von denen bunte Wimpel wehten, Zinnen, schmale Fenster und Schießscharten – sofort fühlte ich mich in die Vergangenheit zurückversetzt.
»Das ist die Löwenburg«, erklärte Male feierlich, während wir den Innenhof betraten. »Sie ist die Nachahmung einer mittelalterlichen englischen Ritterburg. Schau, es gibt sogar einen Teil, der als Ruine erbaut wurde.«
»Wundervoll! Es ist, als würde die Kulisse von Lady of the Lake lebendig werden!«
Wir verloren die anderen immer wieder aus den Augen, weil jeder woanders hinlief und sich ansah, was ihn am meisten interessierte: die Rüstungskammer, die Kanonen oder die Schatzkammer.
Male führte mich durch die Innenräume, deren Ausstattung das Mittelalter aufleben ließ. Voller Eifer wies sie mich auf Kleinigkeiten hin, als sei es ihr Heim, das sie liebevoll eingerichtet hatte. Tapisserien, bestickt mit Fabeltieren, geschnitzte Wappen an Stuhlrücken und die lange Tafel im Rittersaal, alles entzückte sie und ich freute mich an ihrer Begeisterung.
Ich drängte sie, sich auf dem Thronsessel niederzulassen, damit sie sich wie eine Königin fühlen könne, aber sie wollte nicht.
»Dann setz dich auf das Brokatkissen in der Fensternische. Hier kannst du sticken und nach deinem Schatz Ausschau halten.« Ich wollte sie reizen, damit sie preisgab, was sie sich ersehnte. »Soll es ein Ritter sein? Ein fahrender Sänger?«
Male schüttelte den Kopf.
»Dann ein armer Müllersohn, der nicht weiß, dass er ein Findelkind ist und …«
»Nein, lass gut sein. Du hast eine blühende Fantasie.«
Ihre aufgeregte Fröhlichkeit schien zu verebben. Hatte ich etwas Falsches gesagt? Male schlenderte weiter, und ich folgte ihr, immer unruhiger werdend. Hatte sie sich heimlich einem Mann versprochen? Wollte sie mit einem Studenten davonlaufen und damit eine Heirat erzwingen, zu der ihr Vater nie die Erlaubnis geben würde?
Oh, mein Gott, flehte ich, lass sie nicht verliebt sein!
In einem Gang – wir waren allein dort – blieb Male an einem Fenster stehen. Sie strich mit der Hand über die Mittelstrebe des Fensterkreuzes, sah hinaus und seufzte. Ich folgte ihrem Blick und konnte den Turm einer kleinen Kapelle erkennen. Dachte sie an eine Hochzeit ohne Segen? Schon hörte ich Kirchenglocken, die wie Todesglocken ihr Schicksal einläuteten. Denn sie würde in der Ferne nicht glücklich werden. Ohne Familie würde sie verzweifeln und sterben, ein Kind zurücklassen, bei einem Mann, der …
»Ich will Nonne werden.«
Ich starrte sie an.
Die Glocken hörten auf zu läuten, stattdessen erklang das Bimmeln der Glöckchen, die das Kommen des Priesters ankündigten. Vom Weihrauch wurde mir schwindelig, doch dann fasste ich mich.
»Male, du bist Protestantin!«
»Das ist mein Geheimnis«, sagte sie. »Ich werde konvertieren.«
»Aber warum?«