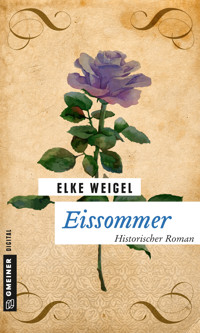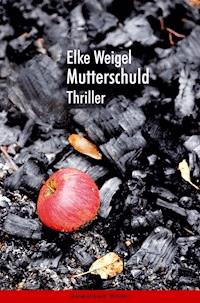
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: konkursbuch
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Psychologin Carolin Baittinger erkennt schnell, dass an ihrem neuen Arbeits-platz etwas nicht stimmt. Ihr Chef, Leiter einer Psychiatrie, benutzt junge Patienten für seine Idee einer neuen Gesellschaft. Als sie die Missstände anspricht, schweigen die Kollegen, der Psychiater reagiert gewalttätig – und am nächsten Tag ist er tot. Carolin findet heraus, dass er die Umerziehung von Homosexuellen zu seinem Programm machte. Johanna Schach, Kommissarin und Carolins Freundin – doch sie möchte sich nicht outen – machen die unlogischen Verhaltensweisen der Jugendlichen Probleme.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 288
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Elke Weigel
Mutterschuld
Krimi
Konkursbuch Verlag Claudia Gehrke
Inhaltsverzeichnis
Titelseite
Zum Buch
Der Junge, Elsass 1951
Nichts ist, wie es scheint, Gegenwart
Françoise, Elsass, 1944
Johanna
Das Knabenheim, Schwarzwald 1959
Dubiose Behandlungsmethoden
Kriminelle Energien
Das Böse suchen, 1960
Monster
Gefährliche Männer
Tod des Siegers
Muttergottes hilf
Die Familie als gesunde Urzelle, 1970
Die Muttergottes
Sigmundis, 1980
Märchentherapie
Karaoke-Bar
Carolins Spürsinn
Homosexualität ist eine Krankheit, 1990
Johannas Coming-out
Schneewittchens Vater
Melanie
Schwarz wie Ebenholz, rot wie Blut
Epilog. Der vergiftete Apfel
Die Autorin
Impressum
Zum Buch
Mord in der Klinik.
Die Psychologin Carolin Baittinger tritt voller Enthusiasmus ihre Stelle in der Kinder- und Jugendpsychiatrie an.
Sie erkennt schnell, dass an ihrem neuen Arbeitsplatz etwas nicht stimmt – die Jugendlichen ihrer Station legen bizarre Verhaltensweisen an den Tag. Zwangsernährung und unnötig starke Medikationen sind Alltag. Nach und nach kommt sie dunklen Machenschaften, schweren Behandlungsfehlern und einem finsteren Menschenbild auf die Spur. Als sie die Missstände anspricht, schweigen die Kollegen – und am nächsten Tag ist Professor Augenstein, Leiter der Psychiatrie, tot. Unfall? Oder Mord? Die Hintergründe der Tat führen weit in die Vergangenheit. Schauplätze der Handlung: Elsass, Schwarzwald und StuttgartKommissarin Johanna Schach – Carolins Freundin, die sich aber nicht outen will – ermittelt.
Der Junge, Elsass 1951
Seine Mutter kniete vor dem Altar der kleinen Kapelle, das Gesicht zur Statue erhoben.
»Maria Muttergottes, nimm die deutschen Augen weg.«
Jeden Tag hockte der Fünfjährige mit angezogenen Beinen auf dem Steinboden neben dem Eingang. Während er beobachtete, wie der Schatten des Fensterkreuzes über die Bankreihen wanderte, zupfte er das Loch am Knie seiner Hose größer. Es roch nach Staub und Weihrauch. Die Madonna auf dem Altar hielt ihren blauen Mantel einladend geöffnet, unzählige Kinder in weißen Kleidchen, mit rosig schimmernden Wangen, waren darunter versammelt.
»Maria Muttergottes, nimm die deutschen Augen weg. Nimm sie weg, weg«, flehte seine Mutter.
Der Junge holte zwischen den Mauerritzen eine Spiegelscherbe heraus, hob sie vor sein Gesicht und kniff die Augen zusammen.
»Braun, braun«, flüsterte er. Dann riss er die Augen auf.
Sie waren immer noch blau.
Die Mutter erhob sich und ging langsam zur Pforte. Ein paar Schritte lief er ihr entgegen, doch dann drückte er sich an eine Kirchenbank.
»Mama?«
»Lass mich.« Strähniges Haar fiel ihr ins Gesicht, als sie den Kopf wegdrehte und mit den Fingern über die kleine Marienfigur rieb, die sie in der Hand hielt.
»Wie heiße ich, Mama?«
Sie zuckte zusammen und ging etwas schneller. Eilig steckte er die Scherbe zurück in die Mauerritze und rannte hinter ihr her, aber sie war schon auf dem Feldweg angekommen, ihr geblümtes Kleid schimmerte zwischen den Blättern der Hecken auf und verschwand.
»Da ist ja das Deutschenkind!«
Jetzt hatten sie ihn wieder erwischt, die Kinder aus dem Dorf. Sie umringten ihn, lachten, schubsten, und der größte Junge versetzte ihm eine Kopfnuss. Einer spuckte ihm vor die Füße. Der Junge wich vor den kleinen Bläschen zurück, die auf der festgetretenen Erde zerflossen und einen dunklen Fleck neben seinen nackten Zehen hinterließen.
»Los, schnappt ihn!«, rief der Große.
Er wand sich und strampelte, doch sie lachten nur und schleiften ihn in die Kapelle.
»Strafe muss sein!«
Vor dem Marienaltar drückten sie ihn auf die Knie nieder.
»Siehst du den Fleck? Das ist das Blut von deiner Mutter.« Der Große hielt ihn im Nacken fest.
Seine Nase berührte fast den Boden, ihm wurde schwindelig, und nur verschwommen sah er die dunkel verfärbte Stelle auf den Steinfliesen.
»Die Schreie der Hure hat man bis ins Dorf gehört.«
»Deutschenhure«, flüsterten die anderen Jungen.
»Sag deinen Namen.« Der Große schüttelte ihn. »Los, sag ihn!«
»Ich weiß ihn doch nicht.«
»Doch, du weißt ihn. Los, sag ihn.«
»Nein.«
Roch er den Stein oder das Blut? Hatte es auch in Blasen geschäumt wie die Spucke?
»Alle Deutschen heißen Hans. Los, sag es!«
Ein Tritt in die Seite warf ihn um, er verbarg sein Gesicht in den Armen und zog die Beine an. Sie machten weiter, bis er mit dem Kopf gegen den Sockel des Altars knallte.
»Hans«, rief er, »ich heiße Hans.«
Als die Kinder schon längst davongelaufen waren, lag er immer noch auf dem Boden und weinte, nicht wegen der Schmerzen, die konnte er aushalten, er heulte vor Wut. Seine Mutter war schuld daran, dass er die deutschen Augen bekommen hatte.
Die alte Hebamme verband die Wunde an seinem Hinterkopf.
Zur Nachbarin sagte sie: »Françoise sieht überall den Soldaten.«
Madame Rougette flüsterte: »Das haben wir alle durchgemacht, es muss weitergehen.«
Hans wohnte mit seiner Mutter in einer Hütte am Ortsrand, wo auch die Bütten abgestellt wurden. Während Françoise die langen Reihen zwischen den Rebstöcken abging und die dünnen Zweige festband, summte sie Maria meine Gnade. Hans folgte ihr in großem Abstand. Er fürchtete sich davor, dass sie zu lange wegbleiben könnte. Vielleicht würde sie ihn vergessen und nicht mehr zurückkommen? Er kannte die Schulterknochen seiner Mutter, die spitz unter dem Kleid hervorstachen, besser als ihr Gesicht. Wenn er vor ihr stand, drehte sie den Kopf weg, wollte ihn nicht ansehen. Abends schob sie ihm wortlos das Essen hin.
Eines Nachts wurde Hans von lautem Schreien geweckt.
»Geh weg!« Mit weit aufgerissenen Augen saß seine Mutter im Bett und schrie in die Dunkelheit. »Geh weg! Nein!«
Der Mond warf ein schwaches Licht in den einzigen Raum, den sie zusammen bewohnten. Aus den bauchigen Bütten stieg der faulig-gärige Geruch, der alles in der Hütte durchtränkte. Drohend hob der eiserne Ofen sein Kaminrohr, und der Schrank war nur ein schwarzes Viereck, an dem unförmig ein paar Jacken hingen. Zitternd kroch Hans unter die Decke.
Lange schrie sie weiter. Er hielt sich die Ohren zu und weinte leise. Seine Mutter wähnte den Mann in den dunklen Ecken. Dabei waren sie ganz allein.
Am Morgen saß Hans vor der Hütte und stocherte mit einem Stock im Dreck herum. Ein Rascheln ließ ihn auffahren. Er bemerkte in einiger Entfernung einen kleinen Jungen, der zu ihm herüberstarrte. Als er drohend den Stock hob, rannte der Kleine los, stolperte und fiel hin. Mit einem Satz war Hans über ihm und versetzte ihm einen Tritt. Der Junge krümmte sich zusammen und heulte auf.
»Hau ab. Los!« Hans sagte es leise, wie zur Probe.
Der Kleine rappelte sich auf und rannte davon. Hans warf seinen Stock hinterher und sprang in die Luft.
»Hau ab!«, jubelte er. Er wollte stark werden, keine Furcht mehr haben. Er wollte prügeln lernen.
Und wie er es lernte. Vier Jahre später verlor Hans nur noch selten einen Boxkampf. Er stieg in der Achtung der Jungen, und das bedeutete, dass er zu ihnen gehörte. Sie sahen ihm in die Augen, und wenn sie auch spuckten, bissen und ihn verletzten, Hans konnte nicht genug davon bekommen. Er war jemand geworden. Er war nicht mehr nur der Junge, er war »Hans«.
Übermütig stieß er eines Abends die Tür der Hütte auf und polterte hinein. »Ich habe Hunger.«
Seine Mutter saß mit strähnigem Haar und Augenringen auf dem Bett.
»Du musst Essen machen, los!«, herrschte er sie an.
Sie zuckte zusammen und nestelte an der Marienstatue in ihrer Hand. Im Schrank fand er nur trockenes Brot. Da zerrte er seine Mutter an den Haaren und zog an ihrem Arm.
»Geh, hol was zum Essen!«
Françoise stolperte hinaus.
»Selber schuld, du bist so jämmerlich«, schrie er hinter ihr her, und seine Augen füllten sich mit Tränen.
Während sie weg war, warf er die Stühle um.
Mit dreizehn Jahren überragte er seine Mutter ein ganzes Stück. An einem schwülen Sommerabend stand Hans in der offenen Tür der Hütte und beobachtete das nahende Gewitter. Donner grollte über den Himmel, graue Wolken ballten sich über dem Weinberg, und mit ihnen brach die Dunkelheit herein. Dicke Tropfen klatschten auf die Erde. Bald strömte eine Wand aus Wasser nieder und spülte Steine und Schlamm den Berg herunter.
»Mit dem Unwetter kommt der Schmerz«, jammerte seine Mutter. »Das Kind wird geboren. Die deutschen Augen gehen nicht weg.«
»Hättest du einen Mann geheiratet, hätte ich einen Vater. Ich wäre Bäckersohn oder Schuhmachersohn geworden. Oder sogar Winzersohn. Aber du … du …«, schrie er in die Hütte, wo seine Mutter hin und her rannte. »Ich habe einen Namen. Sag ihn.«
Sie schaute ängstlich an ihm vorbei in die Nacht.
»Ich heiße Hans! Hans! Hans!«
Sie hielt sich am Türrahmen fest, sah in den Regen hinaus und bewegte die Lippen. Als wäre er gar nicht da. Dabei stand sie so dicht neben ihm, dass er ihren Schweiß riechen und das Muttermal neben ihrem Ohrläppchen erkennen konnte. Ein kleiner brauner Punkt.
Er schlug zu, auf ihre Wange, auf den braunen Punkt neben dem Ohr.
Endlich drehte sie ihm das Gesicht zu. Die Augen weit aufgerissen, blass, ihr Mund stand offen, doch sie sah ihn immer noch nicht. Steif ging sie an ihm vorbei, hinaus in den Regen, den Berg hinauf. Nach wenigen Schritten konnte Hans sie nicht mehr sehen. Ein starker Wind kam auf, blies Blätter von allen Seiten herbei, zerrte an seinen Kleidern und fuhr durch sein Haar. Er verschränkte die Arme vor der Brust.
»Geh doch«, schrie er, »ich renn dir nicht mehr hinterher. Ich bin kein kleiner Junge mehr.«
Aber dann lief er doch los, so wie er immer hinter ihr hergelaufen war. Die alte Angst, sie könnte ihn vergessen, stieg wieder in ihm hoch. Er stolperte über Steine, Schlammklumpen bildeten sich unter seinen Schuhen, und Blitze rissen Zacken in die schwarze Luft. Er meinte, Françoises Kleid zwischen den Rebstöcken aufblitzen zu sehen. Er stieg höher und rutschte bei jedem Schritt. Er klammerte sich an die Weinstöcke. Sein Atem ging schwer, die Lungen stachen.
Seine Mutter umrundete den Berg und erreichte die vom Dorf abgewandte Seite, wo kein Wein angebaut wurde. Beim nächsten Blitz sah Hans sie in die Schutzhütte flüchten. Er hetzte hinterher. Sie bemühte sich, die schiefe Tür zuzudrücken, aber der Sturm jagte durch alle Ritzen und das offene Fenster herein und riss sie ihr immer wieder aus der Hand.
»Sieh mich an! Sieh mich einmal an!«, schrie er.
Dann bebte die Erde, ein gewaltiges Krachen folgte, und grelles Licht blendete Hans. Er wurde zu Boden gerissen und rollte ein Stück den Hang hinunter. Steine polterten an seinem Kopf vorbei und trafen ihn an der Schulter. Es regnete so stark, dass er meinte, unter Wasser zu sein. Auf dem Bauch kroch er wieder höher. Die Hütte war nur noch ein Trümmerhaufen. Er roch Rauch. Zwischen den Steinen glomm Feuer wie glühende Augen.
Fassungslos starrte er auf den Schutthaufen. Schweiß brach ihm aus allen Poren, Panik durchjagte ihn, und er rannte davon. Den Hang hinunter. Seine Arme wurden zerkratzt, seine Beine schmerzten, er rannte und rannte. In der Hütte warf er sich auf sein Bett und blieb schwer atmend liegen. Der Regen trommelte aufs Dach.
Es schüttete die ganze Nacht und den folgenden Tag. Hans rührte sich nicht aus dem Haus. Innerlich kalt und leer hockte er auf dem Stuhl und starrte vor sich hin. Immer wieder sah er die eingestürzte Hütte vor sich. Hatte sie um Hilfe gerufen? Sollte er sie suchen? Doch danach würde sie weiter jammern und beten. Er ballte die Finger zur Faust, presste die Hand zusammen, so fest er konnte.
»Vielleicht ist es besser, wenn sie nicht mehr kommt«, flüsterte er und hielt erschrocken die Luft an. Nur der Regen rauschte auf das Dach. Immer wieder zog er den Unterarm und die Faust zu sich her, beobachtete das Muskelspiel unter der Haut seines Oberarmes. Kraft, das war das Einzige, was ihn mit der Welt verband. Durch seine Stärke hatte er Freunde gewonnen.
»Es ist besser, wenn sie nicht mehr kommt.« Er lauschte dem Klang dieser Worte, wiederholte sie mit lauter Stimme und stapfte mit den Füßen auf.
Als der Regen nachließ, gingen die Dorfbewohner an der Hütte vorbei den Berg hinauf. Sie begutachteten den Schaden an ihren Weinstöcken und machten sich sofort daran zu retten, was zu retten war. Hans half, das Geröll und den Dreck wegzuschaufeln, das vom Regenguss heruntergeschwemmt worden war. Er schob die schwersten Schubkarren, schleppte Holzstangen, die zur Befestigung benötigt wurden, und mied die Hangseite, wo die Schutzhütte gestanden hatte. Sie sei alt und baufällig gewesen, sagten die Winzer und fanden es wichtiger, sich zuerst um ihre Rebstöcke zu kümmern. Später würden sie eine neue bauen. Keiner fragte nach Françoise. Sie waren es gewöhnt, dass die Frau sich tagelang verkroch. Abends fiel Hans erschöpft ins Bett und verbat sich jeden Gedanken an seine Mutter. Seine Hände bekamen Blasen von der Arbeit und rissen auf. Er begrüßte den Schmerz, der alles ausfüllte.
Es dauerte eine Woche, bis die schlimmsten Schäden im Weinberg behoben waren. Alle halfen mit, auch die Frauen und die Kinder. Erst danach fragte Madame Rougette, die Bäckersfrau, nach Françoise.
»Sie ist zur Kapelle gegangen«, log Hans.
Wenige Tage später waren alle Vorräte aufgebraucht. In allen Dosen, Taschen, unter der Matratze suchte er nach Geld, schließlich kippte er den gesamten Inhalt des Schrankes auf den Boden. Er hockte zwischen den kläglichen Dingen, die seiner Mutter gehört hatten.
»Du Deutschenhure.« Tränen rannen seine Wangen hinunter. Er wischte sie mit den Fäusten weg. Sie hatte ihn einfach allein gelassen. »Ich hasse dich.«
Nichts ist, wie es scheint, Gegenwart
Carolin war überzeugt davon, dass man genau hinschauen musste. Menschen und Orte verbargen oft ihre wahre Schönheit, ihre Geheimnisse und auch ihre Abgründe.
Auf dem Weg zu ihrer neuen Arbeitsstelle durchquerte sie den weitläufigen Garten, der die verschiedenen Gebäude der Sigmundis-Klinik in Stuttgart miteinander verband. Weit weg vom allgemeinmedizinischen Krankenhaus lag die Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie.
Sie stieg, dem Pfeil folgend, den Hügel hinauf. Haselnussbüsche schirmten den Garten von der Straße ab, Blumeninseln mit roten Tulpen und Vergissmeinnicht tupften die Wiese. Es roch nach frisch gemähtem Gras. Aus einem Brunnen sprudelte das Wasser über Steinstufen in eine Rinne, die den Garten durchzog. Geschwungene Kieswege, Bänke und vereinzelte Kunstwerke aus Stein schufen eine friedliche Oase.
Vor dem hellgrün gestrichenen Neubau blieb sie stehen. Zwei Stockwerke aus Glas und Holz, darüber ein Flachdach. Alles wirkte frisch und freundlich. Vor dem Eingang funkelte im Sonnenlicht ein Bodenmosaik aus bunten Scherben. Es bildete ein Labyrinth. Carolin ging mit schnellem Schritt die Windungen entlang, bevor sie die Eingangshalle betrat. Am Empfangstresen saß eine junge Sekretärin und feilte ihre Nägel.
»Carolin Baittinger, Professor Augenstein erwartet mich.«
Die Sekretärin wies Kaugummi kauend auf eine Sitzgruppe und griff zum Telefonhörer.
»Professor Augenstein, die neue Psychologin ist da«, sagte sie und betrachtete ihre Fingernägel.
Während Carolin wartete, blickte sie zu den Kinderzeichnungen an den Wänden. Keine fröhlichen Strichmännchen oder bunte Kleckse, nein. Sieben Variationen der Sonnenblumen von van Gogh. Offenbar hatte jemand den Kindern das Original vorgelegt und sie aufgefordert, es abzumalen. Von derart kontrollierter Kreativität hielt sie wenig und nichts davon, dass man sie so lange warten ließ. Ungeduldig wippte sie mit dem Fuß und zupfte am Saum ihrer indischen Bluse. War das Kleidungsstück vielleicht doch zu auffällig gewählt? Wurde von einer Psychologin hier erwartet, sich dezenter zu kleiden?
Es sind Kinder, die werden sich über Farbe freuen, beruhigte sie sich.
Endlich erschien ihr neuer Chef, Professor Augenstein. Ein drahtiger älterer Mann mit Halbglatze und leuchtend blauen Augen.
»Wunderbar, dass Sie da sind! Kommen Sie mit.«
Er öffnete ihr die Tür zu einem hellen Treppenhaus, und während sie in die zweite Etage gingen, fragte er, ob sie den Weg leicht gefunden habe und von wo sie gekommen sei. Als er hörte, dass sie nicht Auto fuhr, sondern nur Fahrrad, lobte er ihre Sportlichkeit. In seinem Büro räumte er ihr einen Stuhl frei, auf dem ein Stapel Zeitschriften lag.
Ringsum herrschte ein einziges Chaos. Die Regale vollgestopft mit Büchern, Akten und Papierstapeln. Selbst auf dem Boden türmten sich Berge von Papier. Psychiatrie lautete der Titel der obersten Schrift neben ihrem Stuhl. Professor Augenstein lehnte in seinem Schreibtischsessel, die Beine gemütlich übereinandergeschlagen. Zwischen hohen Papierbergen auf seinem Tisch stand eine Marienstatue. Es war eine Schutzmantelmadonna, alt und abgegriffen und so groß wie eine Handfläche. Unter ihrem geöffneten Mantel versammelte sich eine Horde Kinder.
Ein Wissenschaftler mit religiösem Hintergrund?
Er plauderte über das Wetter, kommentierte die neusten Beschlüsse der Stadtverwaltung mit humorvollen Bemerkungen und bedauerte, dass der Beratungsstelle, bei der Carolin zuvor beschäftigt war, die Zuschüsse gestrichen worden waren.
»Für uns ist es ja ein Glück, dass Ihre befristete Stelle nicht verlängert wurde. Sie werden sich bald bei uns eingewöhnen, da bin ich sicher«, sagte er. »Beschäftigen Sie sich zunächst auf Ihre Art mit den Kindern. Für die Haupttherapie bin ich verantwortlich, sie findet alle vierzehn Tage mit der gesamten Gruppe statt.«
»Nach welchem Konzept wird hier gearbeitet?«
»Das hat noch Zeit, darüber können wir später ausführlich sprechen, jetzt machen Sie sich erst mal mit den Abläufen und den Jugendlichen vertraut, und wenn Sie Fragen haben, kommen Sie zu mir.«
Seine ungezwungene Art war charmant. Carolin konnte sich gut vorstellen, dass er schnell das Vertrauen der Patienten gewann.
An der Tür ließ er sie wieder vorangehen, und sie bemerkte seine breiten Schultern, die sich unter dem Jackett abzeichneten. In jungen Jahren musste er durchtrainiert gewesen sein.
»Die Formalitäten erledigt die Personalabteilung umgehend«, sagte er. »Und Sie bekommen die nächsten Tage Ihren Vertrag. Aber jetzt sind Sie sicher neugierig auf die Jugendlichen.«
Im ersten Stock angekommen, erklärte er, auf drei Türen weisend: »Ihr Büro und das der Stationsärztin befinden sich hier. Daneben liegt der große Therapieraum. Das wird Ihnen später ein Mitarbeiter zeigen.«
Carolin warf einen Blick auf die kleine Warteecke vor ihrem neuen Büro. Dort standen zwei Stühle neben einem Garderobenständer, und eine kümmerliche Topfpflanze gierte nach Wasser.
»Die Kinder sind in diesem separaten Trakt untergebracht.«
Sie näherten sich einem Glaseingang auf der rechten Flurseite. Er war mit einer Art Alarmanlage gesichert. Die Tür wurde mit einem Schlüssel an einem Kasten, der auf Augenhöhe neben dem Türrahmen angebracht war, geöffnet. Ein Summton ertönte, und ein Lämpchen wechselte von rot zu gelb, als die Tür aufgedrückt wurde.
Kaum hatte Carolin den großen Gemeinschaftsraum betreten, drückte der Professor die Tür wieder zu.
»Die Station ist zurzeit geschlossen. Wir hatten eine Krisensituation«, erklärte er. »Ah, da ist ja Herr Landeck, er wird Ihnen alles zeigen. Ich muss mich nun verabschieden, im Institut wartet ein Kollege. Auf gute Zusammenarbeit, Frau Baittinger.« Er nickte ihnen zu und schloss die Tür wieder auf. Durch das Glas sah sie, wie er die Treppe hinuntereilte, als wäre das Teil seines Fitnesstrainings.
Der Mitarbeiter schüttelte ihr die Hand. »Wir duzen uns hier alle, außer mit dem Chef. Ich bin Oliver.«
Er mochte Anfang dreißig sein, trug einen Pferdeschwanz und Dreitagebart.
Wie aus dem Nichts aufgetaucht standen plötzlich fünf Jugendliche um sie herum. Mit eigenartig starrem Blick fixierten sie Carolin. Sie hielten die Köpfe schief und schaukelten mit dem Oberkörper vor und zurück. Ein größerer Junge schmatzte. Ein Mädchen zuckte mit einer Schulter. Ein rothaariges Mädchen begann die Luft einzuziehen, sodass ein scharrendes Geräusch ertönte.
Oliver lachte. »Das sind also unsere Idioten. Sagt schön Guten Tag, na los.«
Carolin zuckte zusammen.
»Guuutän Taaach«, stammelte ein blasser Junge, dessen Gesicht mit Aknepusteln übersät war.
Plötzlich brachen alle in kreischendes Gelächter aus, rannten davon und verschwanden in ihren Zimmern. Die Rothaarige zog auffällig das Bein hinter sich her.
»Das ist der Idiotentest, den machen sie mit allen Neuen.«
»Und habe ich die Prüfung nun bestanden?«
»Das kann man jetzt noch nicht sagen.« Oliver lächelte. Irgendwo klingelte das Telefon. »Sieh dich schon mal um, ich bin gleich wieder da«, rief er und verschwand in einem Raum, neben dem das Schild Betreuerzimmer hing.
Carolin sah sich im Gemeinschaftsraum um. Beim Vorstellungsgespräch hatte es geheißen, die Kinder seien auf einem Ausflug, und man hatte ihr eine andere Station gezeigt, die dieser hier glich. Professor Augenstein hatte die Bewerbung der Personalabteilung überlassen, weil er auf einem Kongress gewesen war.
Das große Zimmer schien sich über die gesamte Breite der Etage zu erstrecken und war spärlich möbliert. Der senfgelbe Linoleumboden quietschte unter Carolins Gummisohlen. Es roch nach Putzmittel und Pfefferminztee. Eine rote Sofalandschaft bot ausreichend Sitzfläche für Kinder und Betreuer. Computerzeitschriften lagen auf dem Tisch, der davor stand. Blaue Fische zogen in einem Aquarium ihre Runden. Daneben stand ein Fernseher, und ein Schrank mit Schlössern an den Türen füllte die ganze Wand aus. Carolin vermutete darin Spiele und Beschäftigungsmaterial.
Staunend blieb sie vor einem großen Bild stehen. Mit Pastellkreide gemalt, zeigte es eine Collage aus Märchenmotiven. Sieben Zwerge mit Zipfelmützen und großen Nasen trugen Schneewittchen in einem gläsernen Sarg. Eine Hexe mit Warze am Kinn und ein Wolf mit gefletschten Zähnen lauerten im Gebüsch auf Rotkäppchen. Es schien eine Gemeinschaftsarbeit zu sein.
Carolin wunderte sich über die kindlichen Motive. Sie konnte sich nicht vorstellen, dass die Jugendlichen das freiwillig gemalt hatten.
Vor der breiten Fensterfront zog sich ein vergitterter Balkon entlang. Der Architekt hatte sich viel Mühe gegeben, die Stäbe in geometrischen Mustern anzuordnen, aber das konnte den Käfigeindruck nicht abschwächen.
An der Wand, gegenüber der Fensterfront, lagen die Zimmer der Patienten. Alle Türen waren geschlossen. Carolin ging daran vorbei und las die Namen.
Arleen, Carolin hob die Hand. Sie schrak zurück, denn die nächste Zimmertür wurde aufgerissen, und ein Stuhl flog mit lautem Krachen an Carolin vorbei.
»Du blöde Tunte! Hau ab! Piss woanders hin!«, kreischte eine Jungenstimme durch alle Tonlagen des Stimmbruchs.
Wie ein Geist tauchte ein Mädchen neben Carolin auf. Ihre Wangen schimmerten zart wie Porzellan, und mit einem feinen Lächeln erklärte sie: »Simon kann Kim nicht ausstehen. Deshalb pisst er ins Waschbecken. Das klappt immer. Kim hat einen Sauberkeitstick.«
Das Mädchen zupfte die Ärmel ihres hellgrünen Sweatshirts über die Fingerspitzen. Sie war sehr dünn, und ihr blondes Haar leuchtete im Gegenlicht wie eine Aura um ihren Kopf.
Carolin näherte sich dem Zimmer, in dem die Jungen laut miteinander stritten. Hörte Oliver, der Betreuer, den Krawall nicht? An der Tür blieb sie stehen. Der Junge mit den Aknepusteln hielt einen Stuhl mit den Beinen auf den anderen gerichtet.
»Simon, du Sau, mach dich vom Acker!«, rief er.
Simon zerrte an den Stuhlbeinen und brüllte: »Das ist genauso mein Zimmer. Ich schlag dich tot, wenn du noch einmal das Maul aufmachst.« Er stieß Kim samt Stuhl nach hinten und begann, alles auf den Boden zu fegen, was er greifen konnte. Bettdecke, Bücher, Kleidungsstücke. Kim hielt den Stuhl nun weniger wie eine Waffe. Es wirkte, als wollte er sich damit, wie mit einem Schild, vor Simons Wüten schützen.
»Fass mich nicht an, fass mich nicht an«, kreischte er, und seine Stimme kippte.
»He, Jungs, beruhigt euch.« Carolin versuchte, so viel Autorität wie möglich in ihre Stimme zu legen.
Simon fuhr herum. Er hielt ein dickes Buch gepackt. Seine Augen leuchteten in einem erstaunlichen Grün, er überragte sie ein ganzes Stück.
Carolin stemmte die Hände in die Seiten und deutete mit dem Kinn an, er solle das Buch weglegen. Einen Moment erstarrten alle in gespannter Stille. Dann bewegte sich Simon mit dem Buch in Richtung Kim, als wollte er es ihm ins Gesicht werfen. Kim schrie auf und hob den Stuhl hoch. Doch Simon warf das Buch gegen die Wand und stürmte aus dem Raum. Carolin fiel auf, dass er die Schulter wegdrehte, um sie nicht anzurempeln.
Er wusste also durchaus, was er tat.
Kim stand immer noch zitternd mit erhobenem Stuhl am Fenster. »Diese Sau. Er muss Ordnung machen. Ich räum das nicht auf. Ich nicht.«
»Stell erst mal den Stuhl hin«, sagte Carolin in beschwichtigendem Ton.
Zögernd folgte Kim. Er schlotterte am ganzen Körper – er hatte wirklich Angst, das konnte man nicht spielen. Seine Aknepusteln leuchteten rot auf der blassen Haut. Die Hose, die er trug, schien ihm zwei Nummern zu groß zu sein, das T-Shirt ebenso. Seine Haare standen wild nach allen Seiten ab.
Als Carolin einen Schritt auf ihn zuging, riss Kim die Arme vors Gesicht. »Nicht anfassen. Nicht anfassen.«
»Ist gut. Ich fass dich nicht an. Okay?«
Kim drängte sich mit dem Rücken gegen das Fenstersims und verschränkte die Arme vor der Brust. Sein Blick flatterte nervös zur Tür.
Ein Kichern ließ Carolin herumfahren. Die Rothaarige hopste neben dem blonden Mädchen auf und ab und hielt sich den Mund zu. Ein Junge mit abrasiertem Haar lehnte grinsend am Türrahmen. Er trug eine Tarnhose und ein olivfarbenes T-Shirt. Bunte Tätowierungen überzogen seine muskulösen Oberarme.
Die Kinder tauchten lautlos auf, wie Gespenster.
Der Muskelprotz sagte: »Die Show machen sie jeden Tag dreimal, mindestens. Können sich nicht ab.«
»Vielleicht sollte dann einer das Zimmer wechseln«, sagte Carolin.
»Das gehört zur Therapie. Sie sollen lernen, miteinander auszukommen«, erklärte der Junge.
Sympathie lässt sich nicht einüben, dachte Carolin, aber sie schwieg. Kim setzte sich aufs Bett und wirkte ruhiger, nachdem Simon gegangen war.
Carolin musterte die Jugendlichen. Sie trugen Filzpantoffeln. Eine ungewöhnliche Bekleidung für Teenies, besonders für den Jungen in Tarnkleidung. In der Stadt liefen die Gleichaltrigen nur in Springerstiefeln oder Chucks herum.
»Vorschrift. Nennt sich Hausschuhe«, sagte die Blonde.
Die drei begannen wieder brüllend zu lachen.
Carolin staunte, wie aufmerksam die Kinder jede ihrer Regungen verfolgten. Sie wirkten äußerst wach. Vielleicht ein wenig überdreht.
»Du bist Kim, das weiß ich schon. Und wie heißt ihr?«, fragte sie.
»Das ist Till, der Drescher«, sagte die Blonde. Sie wirkte besonders durchsichtig neben dem tätowierten Jungen, zeigte aber keine Angst vor ihm. Er zwinkerte ihr gutmütig zu.
»Arleen, die Fee«, sagte er und zupfte an ihren Haaren. »Und Betty, die rote Maus.«
Betty hielt wieder kichernd die Hand vor den Mund. Rote Haare ringelten sich um ihr rundes Gesicht. Sie drückte sich an Arleen, die ihre Hand nahm. Betty schien die jüngste der Jugendlichen zu sein. Vermutlich hatte sie deshalb den Spitznamen Maus bekommen und rot wegen der Tizianlocken.
»Ich bin Carolin Baittinger.« Sie sah von einem zum anderen. »Mal sehen, welchen Spitznamen ich bekomme.«
Als ihr Blick auf Kim fiel, schrie er los. »Nicht anschauen. Nicht anschauen.«
Carolin hob die Hände und drehte sich zu den anderen Jugendlichen.
»Wer räumt das jetzt auf? Habt ihr Regeln für so was?«
»Die Regel heißt, Simon muss es aufräumen, weil er es veranstaltet hat. Und Kim wird es machen, weil er ein Putzi ist«, erklärte Arleen.
Kim bückte sich bereits nach den Büchern und stellte sie zurück in ein Regal zwischen den beiden Betten.
Die Möbel im Raum waren aus Naturholz, die Wände hellgrün gestrichen und die Bettwäsche bunt gemustert. Der Raum glich eher einem Jugend- als einem Patientenzimmer.
»Geht raus, verdammt!«, schrie Kim, und Carolin beschloss, dass das wirklich das Beste wäre. Er sollte sich nicht schon wieder aufregen müssen. Bevor sie die Tür schloss, sah sie, wie er ans Waschbecken eilte, nach einem Kamm griff, seine Haare scheitelte und glatt kämmte. Dann begann er, das Waschbecken zu putzen.
»Was macht ihr normalerweise um diese Zeit?«, fragte Carolin die anderen.
»Normal ist bei uns gar nichts.«
»Wir sind doch in der Klapse.«
»Rumsitzen.«
»Na, gut, was gibt es noch außer Rumsitzen?«, fragte Carolin weiter.
»Kickern.« Betty hinkte den Flur hinunter in Richtung des Tischkickers. Nach ein paar Schritten stellte ihr Till ein Bein, aber sie sprang elegant darüber und lief dann völlig normal weiter.
Simon saß mit übereinandergeschlagenen Beinen auf dem Sofa und blätterte in einer Computerzeitschrift. Auch er schien sich wieder beruhigt zu haben.
»Spielen wir eine Runde?«, fragte Till und strich sich über den kahlen Schädel.
Carolin nickte zögernd. Tischfußball!
»Arleen spielt gut. Wie isses mit Ihnen?« Er guckte an Carolin herunter.
»Ich habe das vor ewigen Zeiten mal gespielt.«
»Dann spielt Betty mit mir. Los, komm her, Betty.«
Arleen schob die Ärmel zurück, damit sie die Griffe fassen konnte. Ein Gittermuster aus feuerroten Strichen überzog ihre Unterarme. Ohne den Kopf zu wenden, musste sie Carolins Blick bemerkt haben, denn sie sagte: »Ist alt. Halb so wild.«
Till legte seine rechte Hand auf den Rücken und spielte nur mit der linken.
»Sonst haben wir keine Chance«, erläuterte Arleen.
Sie konnte offenbar Gedanken lesen. Das Spiel verlief mit viel Getöse und Gelächter, aber erstaunlich friedlich und absolut fair.
Oliver schlenderte einmal vorbei und nickte Carolin anerkennend zu. Er sah kurz nach Kim, dann verschwand er wieder im Betreuerzimmer.
Um zwanzig nach elf wurde Arleen nervös, drehte wiederholt den Kopf zum Flur, dorthin, wo das Esszimmer lag. Schließlich ließ sie die Fußballmännchen an den Stangen einem mehrfachen Salto schlagen und zog die Ärmel ihres Sweatshirts wieder bis über die Fingerspitzen. Das Spiel war damit beendetet. Auf einer Strähne ihrer roten Locken kauend legte Betty den Arm um Arleen, und gemeinsam gingen sie Richtung Betreuerzimmer.
Till schlich sich an Simon heran, der vor dem Aquarium hockte und mit dem Finger auf der Glasscheibe einen Fisch verfolgte.
»Auf zum Pillenschlucken, Süße«, sagte Till und schlug ihm auf die Schulter.
Simon drehte sich lachend um und boxte wild in die Luft. Blitzschnell drehte ihm Till einen Arm auf den Rücken, ließ ihn aber sofort wieder los. Simon revanchierte sich mit einem Stoß in Tills Rippen, bevor er mit Riesensprüngen hinter Arleen und Betty herrannte. Die Daumen lässig in die Gürtelschlaufen seiner Tarnhose gehängt, grinste Till Carolin an. Sie lächelte zurück.
Vor dem Betreuerzimmer hatten sich die Jugendlichen versammelt, auch Kim kam herbeigeschlichen. Vorsichtig musterte Carolin ihn von der Seite, damit er nicht merkte, dass sie ihn ansah. Er wirkte entspannter, also war es richtig gewesen, ihm eine Weile Ruhe zu gönnen.
Oliver öffnete die Tür zum Treppenhaus.
»Wer ist dran mit Essenholen?« Stirnrunzelnd rieb er sich den Dreitagebart.
Simon ging mit einem Laufstegschritt durch die Tür und flötete: »Tatata.«
Die anderen begleiteten seinen Auftritt mit Pfiffen und Gejohle. Danach nahmen sie schubsend und kichernd die Medikamente entgegen, die Oliver austeilte. Der Betreuer kontrollierte, ob jeder die Tabletten mit genügend Wasser schluckte, und schickte anschließend Till zum Tischdecken. Carolin winkte er ins Betreuerzimmer und zeigte ihr, wo die Medikamente aufbewahrt wurden.
Ein breiter Schrank nahm die Hälfte der Wand ein. Die Dosen standen in Fächern, in denen von hinten neue Packungen nachrutschen konnten, wenn man vorne eine entnahm. Die Tagesportionen wurden in Schiebern abgefüllt, die mit den Namen der Jugendlichen beschriftet waren. Oliver zog den Rollladen herunter. Carolin stand hinter ihm und sah, dass die Haare in seinem Pferdeschwanz länger waren als ihre eigenen.
»Dieser Schrank muss unbedingt immer verschlossen sein. Es ist ein wahrer Giftschrank. Viele der Kinder klauen wie die Raben, wenn du nicht aufpasst. Sie sind zum Teil drogenabhängig. Entweder schlucken sie, was sie kriegen können, oder sie tauschen es gegen anderen Stoff ein.«
»Wer von ihnen?«
»Simon und Betty. Vor allem Betty, die Rothaarige. Sie sieht so harmlos aus, hat es aber faustdick hinter den Ohren.«
Die Türglocke schellte, und Oliver öffnete Simon, damit er den Essenswagen hereinschieben konnte.
»Das ist heute wieder ein Fraß«, verkündete er, und die anderen murrten.
Auf Plastiktabletts lagen vorbereitete Portionen von verkochtem Fleisch und Kartoffelbrei, Lauchgemüse und Fruchtjoghurt. Scheppernd verteilten die Jugendlichen das Essen. Oliver und Carolin setzten sich zu ihnen an den Tisch.
Keiner aß mit Appetit. Arleen sah besonders unglücklich aus. Sie stocherte mit der Gabel auf ihrem Teller herum.
»Geh ruhig in die Mittagspause«, sagte Oliver zu Carolin. »Doris, unsere Stationsleitung, müsste gleich hier sein, sie kann dich herumführen und dir auch dein Büro zeigen.«
»Hier bin ich scho-on«, flötete eine weibliche Stimme hinter Carolin.
»Nur zehn Minuten zu spä-ät«, äffte Betty im gleichen Singsang nach.
Eine kleine Frau mit kurzen, braunen Haaren streckte Carolin die Hand hin. »Ich bin Doris Ott, die Stationsleiterin.« Gleichzeitig drohte sie Betty mit dem erhobenen Zeigefinger der anderen Hand: »Du bist verhaftet.«
Betty warf ihr eine Kusshand zu.
Carolin stellte sich vor. Sie fand den Namen der Stationsleiterin sehr treffend. Doris erinnerte sie an einen Otter: klein, braun, inklusive spitzer Nase.
»Komm, ich zeige dir dein Büro«, sagte Doris.
Außerhalb der Station, ein paar Schritte den Gang entlang, öffnete sie eine der Türen, die Professor Augenstein ihr morgens gezeigt hatte.
»Nebenan ist das Büro der Stationsärztin. Die lernst du morgen bei der Übergabe kennen und einen weiteren Mitarbeiter.« Doris schob Carolin in den Raum. »Sieh dich um, ich hole deine Schlüssel, dann gehen wir was essen.«
Ein muffiger Geruch hing zwischen den beigefarbenen Wänden und den weißen Möbeln. Carolin versuchte das Fenster zu öffnen, aber es war ebenfalls mit einem Schloss versehen. Sie arbeitete nun in einem Hochsicherheitstrakt.
Dem Raum fehlt Farbe, dachte sie und beschloss, Pflanzen und Bilder mitzubringen. Über dem Tisch mit den drei Stühlen, an dem wohl die Therapiegespräche stattfinden sollten, ragte ein Nagel aus der Wand. Graue Schatten zeigten, dass hier ein Bild gehangen hatte. Doris kam zurück und drückte ihr einen Schlüsselbund in die Hand.
»Damit hast du Zugang zu allen Räumen.«
Sie verließen das Haus und durchquerten die gepflegte Gartenanlage bis zu einer kleinen Pforte, die auf eine Seitenstraße hinausführte. Gleich gegenüber befand sich ein Bistro. An einem Tisch auf dem Gehsteig fanden sie Platz und bestellten das Mittagsmenü, das prompt serviert wurde.
»Also, der Tagesablauf«, begann Doris. »Die Kinder gehen vormittags zwei bis drei Stunden in die Klinikschule, je nachdem, ob sie psychisch dazu in der Lage sind. Die Schule befindet sich im Hauptgebäude. Nachmittags finden die Therapien statt. Du übernimmst die Gruppentherapie und die Einzeltherapie von drei Jugendlichen. Till, das ist der mit dem kahl rasierten Schädel. Simon, der Kleine mit dem Pony, und Betty, die Rothaarige.« Doris kicherte. »Charakterisierung über die Haare. Das gelingt bei uns ganz gut. Melanie, die Stationsärztin, hat zwei Patienten: Kim und Arleen.«
Carolin ergänzte: »Kim ist der mit dem akkuraten Scheitel. Und Arleen hat blonde Haare.«
Doris nickte. »Arleen ist unsere Krise, wegen ihr muss die Tür vorerst geschlossen bleiben.«
Doris sprach schnell und bewegte sich schnell. Wie ein Otter eben, dachte Carolin.
»Die beiden Männer und ich, wir kümmern uns um den alltäglichen Ablauf und die Freizeitgestaltung«, erklärte sie. Ihre Nase zuckte. »Außer der Chef funkt dazwischen.«
Carolin horchte auf. »Auf mich hat er äußerst charmant gewirkt.«
»Er muss einfach das Kommando führen, das wirst du schon noch merken.«
»Aber als Stationsleitung hast du doch eine Menge Kompetenzen.«
»Sag das mal dem Professor!« Doris fuchtelte mit der Gabel. »Manchmal komme ich mir vor wie eine Krankenschwester im ersten Ausbildungsjahr. Alles, ich sag dir, alles wird von ihm vorgegeben.«
Carolin schmeckte das Essen plötzlich nicht mehr. Dass Doris sich ihr so schnell anvertraute, hieß, dass sie sehr unzufrieden war. Steckte hinter Professor Augensteins Freundlichkeit ein Patriarch? Sie sehnte sich nach ihrer alten Stelle zurück.
Sie aßen schweigend weiter.
Nach einer Weile sagte Doris: »Ach, was du noch wissen musst: Die Psychologen haben Bereitschaftsdienst. Sie werden angerufen, wenn eine Krise kommt.«
Carolin kannte den Jargon. In allen Kliniken wurden die Patienten mit ihren Diagnosen benannt. Wie sahen Krisen bei Jugendlichen aus? Suizidversuche? Nervenzusammenbrüche? Was noch?
Doris sprach schon weiter.