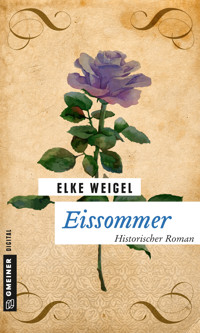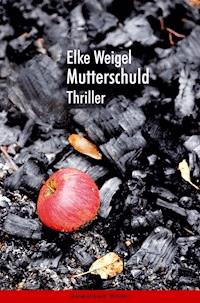8,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: konkursbuch
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Robin ist nicht wie die meisten Mädchen. Sie will frei wie ein Mann leben, aber im konservativen Cannstatt um 1900 hat ihre strenge Tante für sie vorgesehen, zu heiraten und Mutter zu werden. Als das Mädchen eine starke Zuneigung zu Paula entwickelt, hält die Tante sie für abartig und will sie in eine Irrenanstalt stecken. Ein Familiendrama passiert, Robin erstickt in Schuldgefühlen und wird schließlich von ihrem Bruder in die Künstlerkolonie nach Ascona mitgenommen. Jennifer kommt aus einer ganz anderen Welt, doch auch sie musste fliehen. Zwei Welten und zwei gegensätzliche Charaktere prallen aufeinander, als sich Robin und Jennifer auf dem Monte Veritá kennenlernen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 381
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Elke Weigel
Robin & Jennifer
Historischer Roman
konkursbuch Verlag Claudia Gehrke
Inhaltsverzeichnis
Titelseite
Zum Buch
1899
Robin
1900
Jennifer
Paula
1901
Sophie
Heiraten und Kinderkriegen
1902
Cinematografie
Frauenrechte
Verführung
1903
Das Korsett
Der Neue Tanz
Radlerkleidung
Clothilde
1904-1905
Mummenschanz
1905
Zilla
Aufbruch
Arier
1906
Fragen
Hexentanz
1906-1910
Tübingen
Der letzte Tanz
Die Generälin
Man darf eben nicht reizen
Auf der Straße
Abartig
Valentine
Unwetter
Ascona
1911
Monte Verità
Tanz auf dem Berg
Die Begegnung
Barfuß
Zeitung
1912
Verliebt
Arische Frauen
McLinn
Eine Frau im Haus
Spielerei
Fehltritt
Eifersucht
Sophies Abschied
1913
Langeweile
Herausforderungen
Locarno
Entscheidungen
Impressum
Zum Buch
1900: Der Aufbruch in ein neues Jahrhundert.Robin möchte frei und selbstbestimmt leben wie ein Mann – und das im konservativen Bad Cannstadt. Man hält sie für verrückt. Jennifer kommt aus einer ganz anderen Welt, wächst in der Pariser Boheme auf, in einer mondänen Welt aus Kunst, Literatur und Musik. Beide müssen eines Tages ihren Lebensumständen entfliehen und begegnen sich auf dem Monte Verità – einem Ort, an dem sich Menschen zu einem freien Leben zusammenfinden.
Erst Mädchengymnasium, dann Studium in Tübingen, Kurzhaarfrisur und Hosen – Tante Erna findet, dass Robin den falschen Weg einschlägt. Ihre Liebe zu Paula versteckt Robin, weil „Homosexualismus“ und „conträres Sexualempfinden“ als schwere nervöse Leiden diagnostiziert und in Anstalten behandelt werden. Mit Disziplin und Fleiß schließt Robin ihr Studium ab und freut sich auf einen Sommer mit Paula, fern von Cannstatt und Tante Ernas Überwachung. Doch dann kommt alles anders und nur die Flucht kann sie noch retten. Jennifer genießt in Paris die Aufmerksamkeit von Sophie, einer begabten Pianistin. Mit ihr kann sie sich den Träumen von einer Karriere als Tänzerin hingeben und auch ihren gewalttätigen Stiefvater aus ihren Gedanken verdrängen. Doch Sophie, ganz Bohemien und Dandy, spielt nur mit ihr und Jennifer verliert ihre Träume. Ihr Stiefvater betrachtet sie als ideale Frau für die Idee arischer Familienplanung. Sie muss sich vor ihm verstecken. Auf dem Monte Verità lernen die beiden Frauen sich kennen. Sie kommen sich näher. Doch auch an diesem Ort ist ihre sich anbahnende Liebe gefährdet.
1899
Robin
Wenn es wehtat, verschwand die Traurigkeit. Zwölf Stufen. Robin saß auf der obersten, rutschte ein wenig hin und her und spürte durch den Stoff ihres Matrosenkleides hindurch das glatte Eichenholz. Gestern hatte sie die Trittflächen mit Wachs polieren müssen, wie jeden Samstag. Ihre Arme und Knie schmerzten heute noch.
»Roberta! Wo bleibst du schon wieder?« Tante Erna rief nach ihr.
Robin ließ ihre Absätze über die Kante der elften Stufe rutschen. Fast reichten ihre ausgestreckten Beine bis zur achten. Sie schlug die Spitzen ihrer geknöpften Stiefel aneinander, trotz der schwarzen Wichse sah man, wie alt und verknittert das Leder bereits war. Mit den Zehen wackeln konnte sie darin nicht. Unten in der Küche hantierte Tante Erna mit dem Backblech. Scheppernd wurde es in den Ofen geschoben. Mit ihrem Geburtstagskuchen. Der Robin egal war, denn sie hasste ihre Geburtstage. Auch den zwölften.
Sie lehnte sich zurück, sie wusste genau, in welchem Winkel die Abfahrt am schnellsten sein würde – und am schmerzhaftesten.
»Roberta! Herrschaftnochmal!«
Schritte kamen näher. Tapp, tapptapp. Tante Erna stapfte. Jetzt erschienen die grauen Haare über dem Treppengeländer. Robin drückte die Handkanten gegen die zwölfte Stufe, wartete, bis sie den strammen Knoten am Hinterkopf der Tante erblickte, aber noch nicht das Gesicht. Sie stieß sich ab, hob die Fersen an und rutschte über die Kanten. Das Rumsen ihrer Talfahrt dröhnte durch die Diele. Ihr Ellenbogen schlug gegen die Wand, das Steißbein begann zu brennen. Auf den kalten Fliesen am Fuß der Treppe blieb sie liegen, den Kopf auf den Armen.
»Eine Schande bist du. Steh auf, los.«
»Was ist denn passiert?« Vater. Er musste den Lärm gehört haben, denn seine Apotheke lag gleich neben der Diele.
Tante Erna zerrte an ihr, bis sie stand. »Deine Mutter muss sich ja im Grab rumdrehen. Gott hab sie selig.«
Robin wehrte die Hände ab. »Rede nicht so von meiner Mutter!«
»Da siehst du mal«, sagte Tante Erna zu Vater, »warum ich genug von ihr habe!« Sie klopfte mit den Händen auf ihre Schürze, die voller Mehlstaub war.
Vater nahm die Brille ab und begann sie mit einem Taschentuch zu reiben. Er trug über dem Sonntagsanzug, mit dem er in der Kirche gewesen war, einen weißen Kittel. Egal ob Feiertag oder Sonntag, er verbrachte die meiste Zeit in der Offizin, deswegen roch er auch immer nach herben Kräutern.
Robin strich ihren Matrosenkragen glatt und stellte sich ein Stück näher zu ihrem Vater.
Tante Erna redete auf ihren Schwager ein: »Sie schafft nichts, liest nur, und ich sag dir, Anton, sie ist zu oft allein hier im Haus. Ich habe meine eigene Familie zu versorgen, ich kann nicht dauernd hinter ihr herrennen.«
»Mhm, mhm.« Er nickte.
Tante Erna gab einen grunzenden Laut von sich. »Meine Schwester in Schorndorf braucht Hilfe mit den Zwillingen, da hätte sie keine Zeit für Faxen.«
Robin hob die Hände. »Ich will nicht weg! Vater, bitte!«
Er setzte die Brille wieder auf, legte das Taschentuch umständlich zusammen und drückte es anschließend zwischen den Handflächen glatt. Und schwieg.
»Es ist keiner da, der sie erzieht. Nur mit dir und ihren Brüdern, das kann ja nichts werden.«
»Ich geh doch zur Schule. Und nachmittags muss ich Aufgaben machen.«
»Aufgaben machen! Nicht mal stopfen hast du gelernt. Außerdem ist die Schule ja bald beendet.«
»Bitte Vater, ich will weiter zur Schule gehen.«
Endlich steckte er das Taschentuch weg.
»Ins Gymnasium!«
»Du willst aufs Gymnasium gehen?« Vater beugte sich ein wenig zu ihr.
»Das wirst du ihr aber nicht erlauben! Für meine Mädle hat die höhere Töchterschule gereicht.« Tante Erna drehte sich brüsk um und ging in Richtung Küche.
»Nicht die höheren Töchter!« Robin sah ihren Vater flehentlich an. »Dort lernt man nur kochen.«
Tante Erna war schon im dunkleren Teil der Diele angekommen, doch ihre Stimme dröhnte deutlich genug. »Das kommt davon, wenn ein Kind ohne Mutter aufwächst, deswegen hat sie Flausen im Kopf. Ich mache das nicht mit!«
Vater zuckte zusammen, und Robin hätte am liebsten die Arme um ihn gelegt.
»Wird’s bald? Oder muss ich alles allein machen?« Tante Erna brüllte aus der Küche.
»Jetzt geh und hilf ihr.« Vater wandte sich zur Apotheke.
»Darf ich? Bitte, Vater!« Robin hielt die Klinke fest, damit er die Tür nicht schließen konnte.
»Wir werden sehen. Ärgere deine Tante nicht, sie ist uns eine große Hilfe.«
Am langen Holztisch in der Mitte der Küche putzte Tante Erna Karotten, Erde und Schale flogen in hohem Bogen. Alles an ihr war rund, und ihr Mund stand immer offen, auch wenn sie nichts sagte. Ohne das Schaben zu unterbrechen, sah sie Robin finster entgegen. »Bilde dir nur nichts ein auf deine feine Herkunft. Deine Mutter lebt nicht mehr.«
Robin drückte ihren verletzten Ellenbogen und zuckte zusammen, als der Schmerz hineinschoss. Sie spürte Feuchtigkeit unter ihren Fingern und versuchte, einen Blick darauf zu werfen.
Tante Erna hatte sie nicht aus den Augen gelassen. »Blutest du etwa? Kremple den Ärmel hoch!«
Übelkeit stieg in Robin auf, sie hockte sich auf die Kante eines Stuhls und krampfte die Hände ineinander.
»Du wirst doch nicht umkippen? Reiß dich zusammen. Immer das Gleiche mit dir. Geh zu deinem Bruder, der soll dich verarzten.«
Mit weichen Knien ging Robin durch die Diele. Als sie die gute Stube, die neben dem Eingang gegenüber der Apotheke lag, erreicht hatte, hörte sie Tante Erna rufen: »Beeil dich gefälligst!«
Bruno lag auf dem Sofa und las Zeitung.
»Na?«, sagte er freundlich, ohne die Augen von der Seite zu nehmen.
Robin schob seine Füße beiseite, die er samt Schuhen auf einem Kissen abgelegt hatte. Auch dieses Leder hatte sie gestern blankgerieben. Sie atmete tief durch und beschloss, drei Dinge im Raum anzusehen, oder besser vier. Meist verging dann die Übelkeit.
Der ovale Tisch, schon ausgezogen, mit Damasttüchern bedeckt – eins. Die Palme in der Zimmerecke – zwei. Auf der wuchtigen Anrichte tickte eine Pendeluhr – drei. Im Silberrahmen die Fotografie ihrer Mutter. Robin schluckte.
»Sag mal, du hast es heute aber schwer, dabei ist doch dein Geburtstag.« Bruno faltete die Zeitung zusammen und richtete sich auf. Er war genauso zierlich wie Vater und hatte die gleichen traurigen Augen.
»Wieso schwer?« Robin rieb sich die Nase.
»Erst veranstaltest du Rabatz, dass Tante Erna brüllt wie der Oberfeldwebel der Armee«, Bruno brachte Robin zum Lachen, als er die Arme steif an die Seiten presste und die Stirn in Falten zog, »und dann seufzt du wie das Leiden Christi.« Er machte ein klägliches Gesicht. »Was ist los?«
»Ich blute«, flüsterte Robin.
Sofort wurde Bruno ernst. »Wo?«
Sie hielt ihm den Ellenbogen hin.
»Ich schaue mir das gleich an. Aber zuerst musst du dein Geschenk auspacken.« Er holte unter dem Kissen hinter seinem Rücken ein Päckchen hervor, das ungeschickt in Packpapier gewickelt war. Robin lächelte und öffnete es.
»Winnetou II. Das ist famos! Danke!« Sie betrachtete den Stich auf dem Einband, während Bruno ihre Manschette aufknöpfte und den Stoff nach oben rollte.
»Ist es arg schlimm?« Sie kniff die Augen zusammen.
»Nein. Ich hole Jod und Pflaster, und du denkst daran, ein Indianer hat keine Angst vor Blut.«
Robin öffnete die Augen und lachte. »Ein Indianer kennt keinen Schmerz, so muss es heißen.«
»Du bist ein schlaues Köpfchen. Ich bin gleich wieder da.«
Bevor er aufstehen konnte, legte Robin eine Hand auf seinen Arm. »Kannst du bitte mit Vater sprechen?« Er sah sie erstaunt an. »Nicht wegen der Verletzung«, fuhr Robin fort, »wegen Tante Erna. Sie will mich loswerden. Ich soll nach Schorndorf, aber ich möchte hier bleiben, bei euch.«
Bruno strich mit der Hand über sein dunkles, mit Pomade geglättetes Haar. »Du willst doch wohl keine Apothekerlehre machen?«
»Natürlich nicht! Ich will aufs Gymnasium gehen!«
Er verzog anerkennend den Mund. »Eine Frauenrechtlerin also.«
»Was meinst du? Was ist eine Frauenrechtlerin?«
»Das sind Frauen, die doch tatsächlich einfordern, dass man ihnen die gleichen Rechte zugesteht wie den Männern.«
Robin hörte an seinem Tonfall, wie interessant er das fand. »Sie wollen sein wie Männer? Dann werde ich auch eine Frauenrechtlerin!«
»Lass das bloß die Tante nicht hören.«
»Hast du von ihnen in der Zeitung gelesen?«, fragte Robin.
»Ja, schau nach, irgendwo in der Mitte.« Er reichte ihr die Zeitung und erhob sich.
»Sprichst du mit Vater?«
»Wenn du mir nachher erklären kannst, was in dem Artikel über die Frauenrechtlerinnen steht.«
»Ich gebe dir auch mein Kuchenstück«, rief Robin.
»Ich denke darüber nach!«
Als sie wenig später mit einem Pflaster auf dem Ellenbogen in die Küche zurückging, hantierte Tante Erna neben ihrer Tochter Martha am Herd.
»Du lebst ja noch!« Martha öffnete die Ofenklappe und schob zwei Briketts nach. Die Arme ins Kreuz gestützt, richtete sie sich wieder auf. »Komm, hilf mir beim Tischdecken.«
»Du bleibst schön hier und schälst Kartoffeln«, fuhr Tante Erna dazwischen. »Das gute Porzellan mach ich lieber selber. Roberta, rühr den Spätzleteig an.« Sie stapfte hinaus.
»Auch gut«, sagte Martha und nahm ein Messer und eine Kartoffel zur Hand. Laut flüsterte sie: »Ich muss dir vom Referendar erzählen. Er will mich heiraten!«
Robin schüttete Mehl in eine Schüssel und sagte nichts. Martha war siebzehn und kannte seit Wochen nur ein Thema: Wilhelm.
»Er ist ja so mutig. Stell dir vor, er will Missionar werden, bei den Heiden.«
»Dann ist er ja in Afrika, und du kannst ihn nicht heiraten.«
»Natürlich nimmt er mich mit!«
Vermutlich hatte sie auch heute nach dem Gottesdienst wieder in der Sakristei »geholfen«, um mit dem blassen jungen Mann ein paar Worte zu wechseln. Robin glaubte nicht, dass er ihr einen Heiratsantrag gemacht hatte. Nicht bevor er eine Anstellung vorweisen konnte. Martha malte sich das nur aus.
Robin holte vier Eier und Milch aus dem Kasten, einem Schrank an der Außenmauer des Hauses, gefüllt mit Butterfässchen, Käse und Milchflaschen. Es roch ranzig, und sie beeilte sich, die Tür schnell wieder zu schließen. Über einer Schüssel schlug sie die Eier auf und trennte das Eiweiß vom Dotter. Während Robin die Milch einrührte, versuchte sie mit den Fersen in ihren Stiefeln weiter nach hinten zu rutschen, um mehr Platz für die Zehen zu haben.
Martha, die Wasser vom Schüttstein holte, ging mit dem Topf an ihr vorbei. »Was zappelst du denn so?«
»Sie sind zu klein.«
»Das kann nicht sein. Die habe ich letztes Jahr noch getragen.«
»Sie sind trotzdem zu klein.«
»Du kriegst Quadratlatschen.« Martha schnitt geschälte Kartoffeln in den Topf.
Robin kicherte. »Groß, das ist doch famos.«
»Es wird schwer sein, einen Mann für dich zu finden.«
»Ich heirate sowieso nicht.«
»Vielleicht ist das auch besser so. Ich weiß ja nicht, ob Männer eine Frau wollen, die zur Hälfte Ausländerin ist. Ich meine, Engländerinnen sind doch nicht beliebt, oder?«
»Ich werde Indianer«, sagte Robin.
»Jetzt sei mal ernsthaft. Dein Vater hat einen Fehler gemacht, als er deine Mutter geheiratet hat. Das sieht man schon daran, dass sie bei deiner Geburt gestorben ist.«
Robin zuckte zusammen, und ein Batzen Teig flog aus der Schüssel auf den Tisch.
»Pass doch auf! Ich meine es ja nur gut, wenn ich dir das sage. Meine Mutter hat mir erzählt, dass du aufs Gymnasium gehen willst.« Martha sah sie mitleidig an. »Wenn du schon weiter zur Schule gehen willst, dann musst du danach Lehrerin in einem christlichen Pensionat werden.«
»Lehrerin?«
»Ja, die heiraten nicht. Und wenn doch, dann dürfen sie nicht mehr unterrichten.«
»Ich glaube, ich tauge nicht zum Kinderhüten.«
»Papperlapapp, alle Frauen können Kinder erziehen. Aber jetzt musst du erst mal viel beten. Wilhelm hat mir nämlich gesagt, dass unsere Seele dadurch geläutert wird. Und weil heute der Todestag deiner Mutter ist …«
Robin ließ den Kochlöffel in die pappige Teigmasse fallen und rannte aus der Küche.
»Wo willst du denn hin?«, rief Martha.
Robin riss ihren Mantel in der Diele vom Haken, verließ das Haus durch die Seitentür und ging die Marktstraße entlang. Ein kalter Wind wehte über ihre erhitzten Wangen, und sie hielt mit einer Hand den Kragen zusammen.
Nur Lise, Mutters Hausmädchen aus England, sollte von Mutter sprechen! Doch »Laisa«, so hatte Mutter sie genannt, hielt sich an Sonn- und Feiertagen bei einer englischen Freundin auf. Tante Erna wollte es so.
Uralt und düster ragte der Turm der Uff-Kirche in den grauen Himmel. Niemand in Cannstatt wusste, warum Kirche und Friedhof diesen Namen trugen. Robin öffnete das schmiedeeiserne Tor und trat ein. Über den Kies ging sie die Reihen ab, hohe Eiben mit knallroten Beeren und Eichen mit braunen Blättern säumten die Wege. Nach dem Mittagessen würde die ganze Familie mit Blumen hierher kommen, doch jetzt wollte sie allein sein.
Neben dem Grab ihrer Mutter kniete sie nieder und berührte das Bronzebild, das in die Oberfläche des grauen Sandsteins eingelassen war. Sie wischte sich die Tränen von ihren eigenen Wangen.
Nelly Korber, geborene Vaughan
14. April 1868 – 1. November 1887
Von Lise wusste sie, dass Mutter rotes Haar gehabt hatte, eine zarte Gestalt und ein liebevolles Wesen. Mit ihrer Mutter hatte sie nichts gemeinsam. Haar und Augen dunkelbraun, ihre Gestalt jetzt schon groß und grob. Als liebevoll hatte sie auch noch niemand bezeichnet. Nur dieses eine Datum hatte sie mit ihrer Mutter gemeinsam. Der erste November. Allerheiligen. Ihr Geburtstag war Mutters Todestag.
»Wenn du da wärst«, flüsterte sie, »dann wäre alles nicht so schlimm.« Sie zog die Nase hoch und schluckte. »Ich möchte so gerne aufs Gymnasium gehen. Das wollte ich dir sagen, bevor die anderen kommen.«
Robin stand auf, rieb sich die kalten Hände und trat zum nächsten Grabstein. Hedwig Beierle. Sie war die erste Frau ihres Vaters, die Mutter ihrer beiden Brüder. Von ihr gab es kein Bild auf dem Stein. Tante Erna sprach über ihre Schwester in anerkennendem Tonfall und ließ kein Zweifel darüber aufkommen, dass sie die richtige Gattin gewesen war. »Ein Segen, dass sie nicht weiß, was die Engländerin aus ihrem Haushalt gemacht hat!«
Unter dem eingravierten Namen der ersten Ehefrau stand Vaters Name, Anton Korber, und sein Geburtsdatum 1840. Der freie Platz darunter zeigte an, dass Vater im Tod zu seiner ersten Frau zurückkehren würde. Die zweite Heirat sei ein Fehler gewesen, betonte Tante Erna genau wie Martha. Am Grab ihrer Mutter zupfte sie von den letzten Astern trockene Blätter, die herangeweht worden waren.
»Ich bin doch kein Fehler, oder?«
Sie war sich nicht sicher, ob die Mutter nickte oder den Kopf schüttelte. Hastig erhob sie sich und verließ den Friedhof. So schnell wie sie konnte, rannte sie die Anhöhe hinunter Richtung Altstadt. Der kalte Wind sauste in ihren Ohren und biss eisig in ihre Wangen, ihre Zehen schmerzten in den engen Stiefeln. Am Wilhelmsplatz angekommen, verlangsamte sie das Tempo. Es herrschte nicht viel Verkehr, nur eine Kutsche rumpelte über das Pflaster, und neben einem Automobil rannte eine Horde Kinder in Sonntagskleidung her. Robin erreichte das Apothekerhaus am Ende der Marktstraße. Es war eines der größten Gebäude in Cannstatt, vier Stockwerke hoch, mit dunklem Fachwerk, weißen Kassetten und blau-schwarz gestreiften Fensterläden.
Gerade als sie die Seitentür öffnen wollte, kam Bruno heraus. »Hoppla. Wo hast du denn gesteckt? Sie haben ein ordentliches Geschrei wegen dir gemacht.«
»Ich halte es nicht aus in der Küche«, stieß Robin hervor.
Bruno legte den Arm um ihre Schultern. »Dann komm schnell mit zu Gustav, bevor sie dich entdecken.«
Über den Hinterhof gelangten sie zum Lagerhaus, wo ihr ältester Bruder sich eine Werkstatt eingerichtet hatte. Robin spähte durch die schmutzige Scheibe. Drinnen beugte sich Gustav an der Werkbank über den Schraubstock und feilte an einem Metallstück. Allein traute sie sich nicht mehr zu ihm hinein. Früher hatte Robin Schnitzen und Radfahren von ihm gelernt, doch nun war er Ingenieur und hatte keine Zeit mehr für sie. Streng war er geworden, mit sich und mit der Welt. Den ganzen Tag montierte er Automobilteile, glaubte daran, dass bald niemand mehr in einer Kutsche fahren würde, und träumte von einem eigenen Wagen mit Benzinmotor. Er betonte gerne, dass er sich als Mechaniker in den Daimlerwerken hochgearbeitet hatte, seit er fünfzehn Jahre alt gewesen war. Die hohe Geschwindigkeit, mit der die Automobile fuhren, und der Lärm, den sie verursachten, waren Vater nicht geheuer, er befürchtete Schäden für die Gesundheit, aber Robin bemerkte keine Veränderungen an Gustav, er war so geschäftig wie immer.
Er nickte seinen eintretenden Geschwistern zu und feilte weiter an einem Metallstück, dessen Funktion Robin schleierhaft war.
»Ich bin gleich so weit«, sagte er.
»Hast du die Zeitung schon gelesen?«, fragte Bruno, die Hände auf dem Rücken zusammengelegt. »Es wird immer noch ordentlich gestritten.«
»Sie sollen sich endlich mal einigen! Der Zusammenschluss mit Stuttgart bringt eine Menge Vorteile für alle, es macht uns zu einer Großstadt.« Gustav pustete Eisenspäne weg und musterte das Werkstück mit schräg gelegtem Kopf. »Wir sind die zweite Stadt in Deutschland, in der eine elektrische Straßenbahn fährt, und wir haben eine elektrische Straßenbeleuchtung. Das ist der Fortschritt, er lässt sich nicht mehr aufhalten.« Er öffnete den Schraubstock und zeigte seinem Bruder das Eisenteil. Der nahm es entgegen, kniff ein Auge zusammen und sah daran entlang. Dann nickte er und legte es vorsichtig auf die Werkbank.
Robin baute auf dem Fenstersims einen Turm aus Muttern. Sie erinnerte sich noch an die Gaslaternen, die früher die Straßen von Cannstatt beleuchtet hatten. Das elektrische Licht war heller, flackerte nicht, und alle sagten, es sei nun sicherer, abends durch die Straßen zu gehen.
»Die Armen profitieren allerdings nicht vom Fortschritt. Da ist noch viel im Argen«, entgegnete Bruno. Er reichte seinem Bruder einen Lappen. »Manche Arbeiter leben unter fürchterlichen Bedingungen. Zum Beispiel in der Geißstraße. Dort hausen sie zu zehnt in einem Raum, die Wände sind schwarz vom Schimmel, und sie haben keinen Abort im Haus. Tuberkulose und Rachitis überall.«
Gustav rieb seine ölverschmierten Finger ab. »Die Häuser gehören abgerissen, und man sollte überall luftige Wohnsiedlungen bauen, wie die Pfeiffer’sche Arbeitersiedlung in Ostheim.«
Gustav schien immer zu wissen, was richtig war. Robin schubste den Turm um.
»Wie wird die Stadt nach dem Zusammenschluss heißen?«, fragte sie ihn. »Cannstatt oder Stuttgart?«
»Denk nach«, sagte Gustav und verließ als Erster die Werkstatt. »Cannstatt ist älter.«
»Warten wir es ab«, sagte Bruno und ließ Robin den Vortritt.
Tante Ernas Mann erschien, ein vierschrötiger Weinbauer mit roter Nase und gelben Zähnen. Und weil er auf das Essen nicht warten wollte, sah Tante Erna sie nur böse an, aber verzichtete auf ihr Geschrei. Robin und Martha servierten Braten, Spätzle, Kartoffelsalat und braune Soße. Die Männer unterhielten sich, und Robin bekam nur Bruchstücke davon mit, während sie die Schüsseln aus der Küche hereintrug und sich drauf konzentrierte, nichts zu verschütten. Das Gespräch drehte sich wieder um den Fortschritt.
»… und unsere Marine dürft ihr nicht vergessen«, rief Tante Ernas Mann, als sie sich endlich zu ihnen setzen konnte. »Die Engländer werden noch blass, das sage ich euch!«
Vater beugte sich über seinen Teller, und Robin sah schnell von ihm zur Anrichte, auf der die silbergerahmte Fotografie ihrer Mutter stand.
Abends konnte sie nicht einschlafen. Eine halbe Engländerin zu sein, war ein Makel in dieser Familie. Sie stieß die Decke mit den Füßen weg und stand auf. Im Nachthemd schlich sie die Treppe hinunter zur Küche, dort spülte Lise in einer Wanne auf dem Schüttstein das Geschirr. Gleich nach dem Gottesdienst kamen Tante Erna und Martha ins Apothekerhaus und sorgten dafür, dass ein ordentliches schwäbisches Essen gekocht wurde. Sie hielten es für ausgeschlossen, dass eine Ausländerin dies konnte, egal wie lange sie im Land lebte. Aber abends erschien Lise wieder.
Lise war schon immer alt und war schon immer da gewesen und mit ihr der Geruch nach Zwiebeln und Rauch. Robin kannte ihre weichen Hände, die von Runzeln überzogenen Fingerkuppen und die Sommersprossen auf ihrem Handrücken.
»Hallo Schätzle.« Robin mochte den Akzent, mit dem sie »Schätzle« sagte.
»Hello, Laaisa.« Robin hockte sich auf einen Stuhl neben dem Ofen und kaute auf dem Ende ihres geflochtenen Zopfes. Aus den Schlitzen an der Ofenklappe glühte es, eine Leine mit Handtüchern hing über dem Herd.
»Ich war heute allein am Grab.«
Lise nickte und trocknete ihre Hände an der Schürze ab. Tante Erna fand, dass es sich nicht gehörte, mit einer Bediensteten so vertraulich zu sprechen.
»Glaubst du, im Himmel hat man keine Sorgen?«, fragte Robin.
»Bestimmt nicht«, antwortete Lise.
»Warum musste Mama sterben?«
»Das weiß ich nicht.« Lise schüttelte nachdrücklich den Kopf.
»Wollte Gott mich ärgern?«
Lise antwortete nicht. Sie drehte den Hahn auf. Ratternd und schnaufend kündigte das Wasser sein Kommen durch die Leitung an. Dann plätscherte es in den Topf.
»Tante Erna sagt immer lieber Gott, ich finde ihn nicht lieb.«
»Schätzle, mit Gott kenne ich mich nicht aus. Das müssen wir Tante Erna überlassen.«
Robin lachte. »Ja, überlassen wir es ihr. Die beiden passen besser zusammen.«
Lise stellte den Topf auf den Herd und gab eine Handvoll Kamillenblüten hinein. Dann holte sie einen großen Weidenkorb aus der Ecke und zog einen Stuhl für sich heran. Früher, wenn Robin traurig gewesen war, war sie auf Lises Schoß gekrabbelt und hatte die Sommersprossen auf ihrem Handrücken gezählt, bis ihr Schmerz vergangen war. Als der Duft des Kamillentees die Küche erfüllte, wich die Traurigkeit ein wenig von ihr.
Lise lächelte sie an. Über ihre Knie breitete sie ein Küchentuch und nahm einen Apfel aus dem Korb. In ihrem Schoß lag ein kleines Messer bereit. Es sah nicht aus wie ein normales Küchenwerkzeug, eher wie ein Indianermesser – oder so, wie Robin sich eines vorstellte, das Winnetou benutzte.
»Nimm.« Lise drückte es ihr in die Hand. »Schneide den Apfel quer durch.« Sie bemerkte Robins Zögern. »Auf!«
Robin drehte den Messergriff. Weiß, glatt und rund schimmerte er im spärlichen Licht des Herdfeuers. Sie tippte mit dem Daumen gegen die Spitze.
»Sei vorsichtig«, sagte Lise.
Aber schon quoll ein Blutstropfen aus ihrer Haut. Sie steckte den Finger in den Mund. Lise lachte leise und kurz.
»Was ist das für ein Holz? Es ist so hell.« Robin drehte wieder den Griff zwischen den Fingern.
»Knochen.«
Sofort ließ Robin das Messer fallen, klimpernd schlug es auf den Steinfliesen auf. »Du machst schlechte Witze!« Sie getraute sich nicht, das Messer aufzuheben.
»Glaub’s oder glaub’s nicht.«
Robin berührte mit ihren nackten Zehen das Knochenweiß und schauderte.
»Und die Schneide ist aus Zwergenstahl?«, fragte sie forscher, als ihr zumute war.
»Stein.«
»Stein und Knochen! Ein Messer aus Stein und Knochen. Ha, ha.« Robin warf ihren Zopf nach hinten und verschränkte die Arme vor der Brust.
Lise war abergläubisch. Sie fegte jeden Morgen die Schwelle der Eingangstür und noch einmal extra die der Küchentür, um bösen Geistern den Eintritt zu verwehren. »Es gibt viele Wirklichkeiten«, sagte sie häufig.
Und Robin wusste das.
In Lises Wirklichkeit gab es Märchen und böse Geister. In Vaters Gerechtigkeit und Bildung. Diese beiden Wirklichkeiten überschnitten sich nie, aber in Robin fanden beide Platz. Vater sprach nicht viel mit Lise, er gab ihr selten Anweisungen, meist übernahm das Tante Erna. Und deren Wirklichkeit bestand aus Selbstkontrolle und Tugend.
»Nun, willst du deine Zukunft erfahren?« Lise holte Robin aus ihren Gedanken.
»Meine Zukunft?«
»Schneide den Apfel quer durch.«
Robin hob das Messer auf. Es fühlte sich lebendig an in ihrer Hand. Sie schnitt den Apfel auseinander und legte die Hälften in den Schoß der alten Frau. Lise sog scharf die Luft ein, nahm die Apfelhälften und hob sie näher ans Ofenlicht. Sie runzelte die Stirn und schüttelte den Kopf.
»Was siehst du?« Robins spürte eine Anspannung in Lise, die ihr fremd war.
»Das habe ich nicht erwartet. Aber gut. Du sollst es wissen.« Lise zeigte auf das Fruchtfleisch. »Siehst du den Fünfzackstern? In diesem Apfel gibt es zwei.«
Tatsächlich, im Inneren des Apfels lagen zwei Sterne dicht nebeneinander. Lise schnitt einen weiteren Apfel auf und zeigte Robin die Innenfläche.
»In dem Apfel ist nur ein Stern. Und er hat Kerne in den kleinen Kammern«, sagte Robin. Sie holte drei weitere Äpfel aus dem Korb und schnitt sie auseinander.
Lise nickte unablässig. »Siehst du, nur ein Fünfzackstern, überall. Und Kerne darin. Mindestens einen.«
»Was hat es zu bedeuten, wenn zwei Sterne darin sind?«
»Zwei Frauen, keine Kinder.«
»Zwei Frauen, keine Kinder«, wiederholte Robin. Sie schwieg eine Weile und dachte über diese Information nach. »Klingt schön. Obwohl ich nichts verstehe.«
»Jetzt schneide die Apfelhälften in dünne Scheiben. Wir werden sie trocknen.«
Robin machte sich an die Arbeit.
Lise legte die Scheiben auf ein Blech, das sie neben den Ofen auf einen Hocker stellte. »Hier ist es gerade richtig warm.«
Bald gähnte Robin, es musste bereits spät in der Nacht sein. Lise schöpfte Kamillentee in eine Tasse mit abgebrochenem Henkel und reichte sie ihr. Während Robin trank, schnitt Lise die restlichen halbierten Äpfel in Scheiben, danach füllte sie eine Zinkwärmflasche mit heißem Wasser und umwickelte sie mit einem Handtuch.
»Nun geh schlafen und vertraue in das, was kommt«, sagte sie.
Robin küsste Lises Wange. Im Bett drückte sie die Fußsohlen gegen das raue, warme Handtuch.
»Und wenn mir nicht gefällt, was kommt?«
1900
Jennifer
Silvester. Das Fest ins neue Jahrhundert fand ohne sie statt. Jennifer hockte auf dem Treppenabsatz in der Pariser Villa ihrer Mutter und spähte zwischen rankenverzierten Geländerstäben hindurch, die kalten Knie unter das Rüschennachthemd gesteckt. Dort unten wollte sie sein, doch ihr Stiefvater hatte zu Maman gesagt: »Es ist mir egal, ob sie vierzehn geworden ist. Sie hat da nichts verloren, basta.«
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!