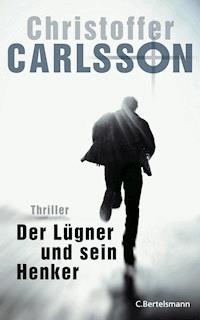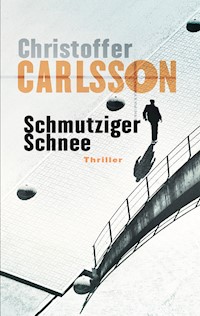7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bertelsmann, C.
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Finster, packend und hochaktuell - Leo Junker ermittelt
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Leo Junker, Anfang 30, ist als Polizist vom Dienst suspendiert, nachdem er versehentlich einen Kollegen erschossen hat. Seitdem kämpft er mit Angstattacken. Als in seinem Wohnblock ein Mord geschieht, fühlt er sich instinktiv zum Tatort hingezogen. Leo beginnt unerlaubt zu ermitteln, denn ein ungewöhnliches Detail an der Leiche erinnert ihn an seine eigene von Gewalt geprägte Jugend. Und an John Grimberg, damals Leos bester Schulfreund, der durch ein tragisches Ereignis zu seinem schlimmsten Feind wurde.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 473
Ähnliche
Christoffer Carlsson
DER TURM DER TOTEN SEELEN
Thriller
Aus dem Schwedischen von Susanne Dahmann
C. Bertelsmann
Die Originalausgabe erschien 2013unter dem Titel Den osynlige mannen från Salembei Piratförlaget, Stockholm.
1. AuflageCopyright © 2013 by Christoffer CarlssonBy Agreement with Pontas Literary & Film AgencyCopyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2015beim C. Bertelsmann Verlag, München,in der Verlagsgruppe Random House GmbHUmschlag: buxdesign|München unter Verwendung einer Collage von © buxdesign|MünchenSatz: Uhl + Massopust, AalenISBN 978-3-641-14784-6www.cbertelsmann.de
Für Karl, Martin & Tobias
Strange highs and strange lows,
Strangelove,
That’s how my love goes
DEPECHE MODE
Ich streiche um dein Haus herum, genau wie früher. Aber es ist nicht mehr dein Haus, du bist nicht hier. Warst lange nicht hier. Ich weiß das, denn ich verfolge dich. Nur ich bin hier. Und eigentlich nicht einmal ich. Du kennst mich nicht. Keiner kennt mich mehr. Es gibt niemanden, der weiß, wer ich bin.
Du spürst, dass etwas nicht stimmt, dass irgendetwas heraufzieht. Du erinnerst dich an die Zeit damals, an den Grund für diesen Text, verdrängst ihn aber lieber. Nicht wahr? Ich weiß das, denn ich bin genau wie du. Die wenigen Male, in denen sich das Vergangene in deinem Alltag in Erinnerung bringt, erkennst du es. Bist aber unsicher, was wahr ist und was nicht, weil die Zeit alles verwischt.
Ich schreibe dies hier, um dir zu sagen, dass alles, was du glaubst, wahr ist und dabei keineswegs so, wie du glaubst. Ich schreibe, um alles zu erzählen.
1SCHWEDEN MUSS STERBEN. In schwarzen, dicken Lettern sind die Worte an die Tunnelwand gepinselt, und aus einem Laden in der Nähe dringt Musik, jemand singt Don’t make me bring you back to the start. Draußen vor dem Tunnel scheint die Sonne heiß und gleißend, doch hier drinnen ist es kühl und still. Eine Frau mit Kopfhörern und Pferdeschwanz joggt vorbei. Ich sehe ihr nach, bis sie verschwunden ist.
Von irgendwoher kommt ein Kind mit einem Ballon an der Hand angelaufen. Der Ballon zappelt ruckartig und störrisch hinter ihm her, bis er an etwas Scharfkantiges an der Tunneldecke stößt und zerplatzt. Der Junge erschrickt und beginnt zu weinen, vielleicht wegen des lauten Knalls. Er sieht sich nach jemandem um, aber da ist keiner.
Ich bin in Salem zu Besuch, zum ersten Mal seit langer Zeit. Der Sommer geht bald zu Ende. Ich stehe von der Bank in dem Tunnel auf und gehe an dem Kind vorbei aus dem Dunkel in den gleißenden Sonnenschein.
2 Als ich aufwache, ist es dunkel, und ich weiß, es ist etwas passiert. Im Augenwinkel sehe ich ein Blinken. Auf der anderen Straßenseite wird ein starkes, zuckendes blaues Licht an der Hauswand reflektiert. Ich verlasse das Bett und gehe zur Küchenzeile, trinke ein Glas Wasser und lege mir eine Tablette Sobril auf die Zunge. Ich habe von Viktor und Sam geträumt.
Mit dem leeren Glas in der Hand gehe ich zum Balkon und öffne die Tür. Der Wind ist warm und feucht, er lässt mich schaudern, und ich sehe auf die Welt hinab, die dort unten wartet. Ein Krankenwagen und zwei Polizeiautos stehen in einem Halbkreis geparkt vor dem Eingang. Jemand spannt ein blau-weißes Absperrband zwischen zwei Laternen. Ich höre dumpfe Stimmen, das Knistern eines Polizeifunkgeräts und sehe das stumme Blinken des Blaulichts der Streifenwagen. Und hinter ihnen: das Rauschen von einer Million Menschen, das Geräusch einer großen Stadt in vorübergehendem Ruhezustand.
Ich gehe wieder hinein und ziehe mir eine Jeans an, knöpfe mein Hemd zu und fahre mir mit der Hand durch die Haare. Im Treppenhaus: eine Dunstabzugshaube, die irgendwo hinter einer Wand schnurrt, das diskrete Rascheln von Kleidern, eine murmelnde, leise Stimme. Jemand hat den alten Fahrstuhl angefordert, er setzt sich mit einem mechanischen Quietschen in Gang und lässt die Wände des Fahrstuhlschachts vibrieren.
»Kann nicht mal einer den verdammten Aufzug abschalten?«, zischt jemand.
Der Fahrstuhl übertönt das Geräusch meiner Schritte, als ich die Treppe hinuntergehe, die sich spiralförmig um seinen Schacht windet. Im ersten Stock bleibe ich stehen und horche. Unter mir, im Hochparterre, ist etwas geschehen. Und das nicht zum ersten Mal.
Vor einigen Jahren hat ein gemeinnütziger Verein mithilfe einer Spende von jemandem, der mehr Geld hatte, als er brauchte, die große Wohnung gekauft. Der Verein baute die Räume zu einer Herberge für die Ausgestoßenen und Verirrten um und nannte das Ganze »Chapmansgården«. Mindestens einmal in der Woche haben sie Besuch, meist von erschöpften Sozialamtsbürokraten, aber nicht selten auch von der Polizei. Die Unterkunft wird von einer ehemaligen Sozialarbeiterin betrieben, Matilda oder Martina, ich erinnere mich nicht genau an den Namen. Sie ist alt, aber viel respekteinflößender als die meisten Polizisten.
Als ich mich über das Treppengeländer beuge, sehe ich, dass die schwere Holztür zur Unterkunft offen steht. Drinnen brennt Licht. Die verärgerte Männerstimme wird von einer ruhigeren Frauenstimme besänftigt. Der Fahrstuhl fährt auf seinem Weg nach unten an mir vorbei, und ich folge ihm, gehe hinter der Fahrstuhlkabine verborgen zum Hochparterre. Die beiden Polizisten, die dort stehen, ein Mann und eine Frau, erstarren, als sie mich sehen. Sie sind jung, viel jünger als ich. Der Fahrstuhl hält unten am Ausgang an, und mit einem Mal wird es sehr still.
»Seien Sie vorsichtig, wenn Sie hier herumlaufen«, sagt die Frau.
»Spann du mal das Absperrband«, sagt der Mann und hält ihr die blau-weiße Rolle hin, woraufhin sie ihn anstarrt.
»Mach das selbst, ich kümmere mich um ihn.«
Sie hat ihre Mütze abgesetzt, hält sie in der Hand, ihre Haare sind zu einem strammen Pferdeschwanz gebunden, der ihr Gesicht verzerrt aussehen lässt. Der Mann hat einen kantigen Kiefer und freundliche Augen, aber ich glaube, die beiden sind ziemlich nervös, denn sie sehen andauernd auf ihre Armbanduhren. Auf den Schulterklappen der Uniformen sitzen nur goldene Kronen, keine Striche. Assistenten.
Er geht mit der Rolle in der Hand zur Treppe. Ich versuche zu lächeln.
»Es ist hier nämlich was passiert«, sagt sie. »Es wäre schön, wenn Sie im Haus blieben.«
»Ich werde nicht rausgehen.«
»Und was machen Sie dann hier unten?«
Ich schaue durch das große Fenster im Treppenhaus, durch das man das Haus auf der anderen Straßenseite sieht. Es wird immer noch von blauem Licht überspült.
»Ich bin aufgewacht.«
»Sie sind vom Blaulicht aufgewacht?«
Ich nicke, keine Ahnung, was sie denkt. Sie sieht erstaunt aus. Ich vernehme einen scharfen Geruch, und erst jetzt bemerke ich, wie bleich sie ist. Ihre Augen sind blutunterlaufen. Sie hat sich eben erst übergeben.
Leicht, fast unmerklich, legt sie den Kopf schief und runzelte die Augenbrauen.
»Kennen wir uns?«
»Das glaube ich nicht.«
»Sind Sie sicher?«
»Ich bin bei der Polizei«, gebe ich zu, »aber nicht … nein, ich glaube nicht, dass wir uns kennen.«
Sie sieht mich eingehend an, dann nimmt sie den Notizblock aus der Brusttasche und blättert ein paar Seiten vor, klickt mit dem Stift, schreibt etwas auf. Hinter meinem Rücken raschelt ihr Kollege auf eine Weise, die mich nervt, linkisch mit dem Absperrband. Ich betrachte die Tür hinter der Frau. Es gibt keinerlei Anzeichen, dass sie aufgebrochen wurde.
»Ich habe keine Information darüber bekommen, dass hier ein Polizist wohnt. Wie heißen Sie?«
»Leo«, sage ich, »Leo Junker. Was ist passiert?«
»Zu welcher Abteilung gehören Sie, Leo?«, fährt sie in einem Ton fort, der verrät, dass sie alles andere als überzeugt ist, dass ich die Wahrheit sage.
»D.I.E.«
»D.I.E.?«
»Dezernat Interne …«
»Ich weiß, wofür das steht. Darf ich Ihre Polizeimarke sehen?«
»Die liegt in meiner Jacke oben in der Wohnung«, sage ich, und ihr Blick wandert über meine Schulter, als würde sie Augenkontakt zu ihrem Kollegen suchen. »Wisst ihr, wer sie ist?«, frage ich. »Die Tote?«
»Ich …«, beginnt sie. »Sie wissen also, was geschehen ist?«
Ich bin kein guter Beobachter, doch es kommen nur selten Männer in diese Herberge. Für sie gibt es andere Orte, wo sie unterkommen können. Die Frauen hingegen haben nicht so viele Möglichkeiten, zwischen denen sie wählen können, denn die meisten Heime dieser Art weisen Drogenabhängige und Prostituierte ab. Die Frauen dürfen eines von beiden sein, aber nicht beides. Das Problem ist nur, dass die meisten eben genau beides sind. Der Chapmansgården ist eine Ausnahme, und deshalb kommen viele Frauen hierher. Hier muss man nur eine Regel befolgen, um reingelassen zu werden: Man darf keine Waffe haben. Eine sympathische Einstellung.
Deshalb handelt es sich hier also sehr wahrscheinlich um eine Frau, und nach dem ganzen Theater zu schließen, lebt sie nicht mehr.
»Darf ich …?«, frage ich und mache einen Schritt auf die Polizistin zu.
»Wir warten auf die Techniker«, höre ich die Stimme ihres Kollegen hinter mir.
»Ist Martina da drinnen?«
»Wer?«, fragt die Frau verwirrt und schaut auf ihren Block.
»Die, die das hier betreibt«, sage ich. »Wir sind befreundet.«
Sie sieht skeptisch aus. »Sie meinen Matilda?«
»Ja. Genau.«
Ich steige aus meinen Schuhen, hebe sie auf und gehe an ihr vorbei in die Herberge.
»Hallo«, sagt sie scharf und packt mich fest am Arm. »Sie bleiben hier.«
»Ich will nur sehen, wie es meiner Freundin geht«, erkläre ich.
»Sie wissen ja nicht einmal, wie sie heißt.«
»Ich weiß, wie man sich an einem Tatort bewegt. Ich will nur sehen, ob Matilda okay ist.«
»Das spielt keine Rolle. Sie kommen hier nicht rein.«
»Zwei Minuten.«
Die Polizistin starrt mich lange an, ehe sie meinen Arm loslässt und wieder auf ihre Armbanduhr schaut. Unten schlägt jemand laut und fest an die Tür. Sie sucht nach ihrem Kollegen, der nicht mehr zu sehen ist, weil er die Treppe hinaufgegangen ist.
»Warten Sie hier«, sagt sie, und ich nicke, lächle und versuche, aufrichtig zu wirken.
Im Chapmansgården ist die Welt gespenstisch still. Die Decke hängt tief über meinem Kopf, der Fußboden ist aus hässlichem abgenutzten Parkett. Die Unterkunft besteht aus einer großen Diele, einer Küche mit Tisch, einer Toilette und Dusche, einem Büro und etwas, wovon ich annehme, dass es der Schlafraum ist, ganz hinten in der Wohnung. Der Geruch erinnert an die strenge Duftnote im Kleiderschrank eines alten Mannes. Gleich hinter der Tür steht ein großer Korb auf dem Boden, und davor liegt ein handgeschriebener Zettel. WARME KLEIDUNG. Unter einem Kapuzenpullover schauen ein Paar Handschuhe hervor, die ich herausziehe.
Auf der rechten Seite geht es von der großen Diele in eine ordentliche und saubere Küche mit einem quadratischen Holztisch und ein paar Stühlen. Am Küchentisch sitzt Matilda, dieser alte Vogel mit spitzem Profil und wuscheligem silberlockigen Haar, ihr gegenüber ein Mann in Polizeiuniform. Sie blicken auf, als ich an ihnen vorbeigehe, und ich nicke Matilda zu.
»Von der Kripo?«, fragt er.
»Klar.«
Er schielt auf die Handschuhe in meiner Hand, und ich senke den Blick auf den Boden, wo man deutliche Schuhabdrücke erkennen kann. Es sind keine Stiefel, sondern eher irgendwelche Sportschuhe. Ich platziere meinen eigenen Schuh neben den Abdruck und stelle fest, dass ich ebenso große Füße habe wie der, der eben hier gewesen ist.
»Wo sind die anderen Frauen?«
»Es war nur sie hier«, erwidert Matilda.
»Ist sie Ihnen bekannt?«
»Sie war in diesem Sommer mehrere Male hier. Ich glaube, sie heißt Rebekka.«
»Mit zwei k?«
»Ich weiß es nicht, aber ich glaube mit Doppel-c.«
»Und ihr Nachname?«
Sie schüttelt den Kopf.
»Wie gesagt, ich weiß nicht mal, wie sie ihren Vornamen schreibt.«
Ich gehe weiter durch die Diele und in den Schlafraum. Die Wände sind blass und mit Bildern behängt. Ein Fenster steht einen Spaltbreit offen. Die Augustnacht dringt herein und kühlt den Raum unnatürlich ab. Acht Betten stehen an den Längsseiten des Raums. Die Decken sind nicht einheitlich, einige sind geblümt wie die Wände in einer Siebzigerjahre-Wohnung, andere in starken Farben einfarbig blau, grün oder orange, wieder andere haben hässliche, nichtssagende Muster. Jedes Bett ist mit einer schlampig auf das Holz gemalten Zahl gekennzeichnet. In Bett Nummer sieben, ganz hinten im Raum, liegt mit dem Rücken zu mir ein Körper in hellen Jeans und Strickpullover auf der Seite. Ungepflegtes dunkles Haar ist zu sehen. Ich lege meine Schuhe auf eines der Betten und ziehe die Handschuhe an.
Die Menschen erschießen, erstechen, erschlagen, treten, zerstückeln, ertränken, verätzen, ersticken und überfahren einander, und das optische Ergebnis pendelt zwischen diskret und effizient wie bei einem chirurgischen Eingriff und schmutzig wie bei einer mittelalterlichen Hinrichtung. Dieses Mal hat das Leben plötzlich und sauber geendet, fast unmerklich.
Wäre da nicht die kleine rotbraune Blume, die ihre Schläfe ziert, könnte sie genauso gut schlafen. Sie ist jung, zwischen zwanzig und fünfundzwanzig, aber ein hartes Leben hinterlässt einen Abdruck im Gesicht der Menschen. Ich beuge mich über sie, um ein besseres Bild von dem Einschussloch zu erhalten. Etwas größer als eine Reißzwecke ist es, und die spärlichen Spuren von Blut und schwarzem Schmauch von der Waffe sprenkeln ihre Stirn. Jemand hat mit einer kleinkalibrigen Pistole hinter ihr gestanden.
Ich betrachte ihre Hosentaschen. Sie scheinen leer zu sein. Ihre Kleider wirken unberührt, unter dem Strickpullover schaut ein Stück Hemd heraus, doch es deutet nichts darauf hin, dass ihr Körper abgesucht worden wäre, jemand etwas hätte finden wollen. Vorsichtig lege ich die Hände auf den Körper und befühle ihre Seite, die Schultern und den Rücken, in der Hoffnung, etwas zu entdecken, was nicht dorthin gehört. Als ich den Pulloverärmel hochschiebe, erkenne ich die Folgen der Drogenabhängigkeit in der Armbeuge, doch auch die Einstichnarben sehen ordentlicher aus als bei anderen, als hätte sie sich einen Sport daraus gemacht, sich so präzise wie möglich zu spritzen.
Hinter mir höre ich Matildas Schritte. Sie bleibt in der Tür stehen, als hätte sie Angst hereinzukommen.
»Das Fenster«, sage ich, »ist das immer offen?«
»Nein, wir halten es sonst geschlossen. Es war auch zu, als ich kam.«
»Hat sie gedealt?«
»Glaube schon. Sie kam vor einer Stunde hierher und sagte, sie brauche einen Platz zum Schlafen. Die meisten Frauen kommen erst später am Abend her.«
»Hatte sie etwas dabei? Kleider, eine Tasche?«
»Nichts außer dem, was sie am Leib trägt.«
»Sind das ihre eigenen Kleider?«
»Ich denke schon.« Sie schnieft. »Zumindest sind sie nicht von uns.«
»Hatte sie Schuhe?«
»Vorm Bett.«
Schwarze Converse-Turnschuhe mit weißen Schnürsenkeln, die viel zu dick sind. Die hat sie extra gekauft und gegen die Originalschnürsenkel ausgetauscht. Die Schuhbänder sind brüchig und sehen aus wie das Bleiband in einer Gardine. Sie hat Kapseln darin aufbewahrt. Ich halte einen der Schuhe hoch und betrachte die Sohle, nichtssagend und dunkelgrau, dann stelle ich den Schuh vorsichtig wieder zurück. Ich hole mein Handy heraus und richte es auf ihr Gesicht, mache ein Foto, und einen Moment lang lässt der kleine Blitz ihre Haut schmerzhaft weiß erscheinen.
»Wie war sie drauf, als sie heute Abend kam?«
»High und erschöpft, wie alle anderen auch, die hierherkommen. Sie sagte, sie habe einen miesen Abend gehabt und wolle einfach nur schlafen.«
»Wo warst du, als es passiert ist?«, frage ich.
»Ich habe mit dem Rücken zur Tür in der Küche gestanden und das Geschirr gespült, habe also weder etwas gesehen noch gehört. Das mache ich immer um diese Uhrzeit, vorher kommt man überhaupt nicht dazu.«
»Wie hast du gemerkt, dass sie tot war?«
»Ich bin reingegangen, um nachzusehen, ob sie eingeschlafen ist. Als ich hinging, um das Fenster zu schließen, sah ich, dass sie …«
Sie lässt den Satz unvollendet.
Ich gehe in einem weiten Bogen um die Leiche herum zum Fenster. Es ist etwas erhöht, und von dort ist es ein ganz schön tiefer Sprung auf die Chapmansgatan hinunter. Ich schaue wieder zur Leiche, und im Licht der Straßenlaterne sehe ich eine dünne Kette in ihrer Hand blitzen.
»Sie hat etwas in der Hand«, sage ich zu Matilda, die mich fragend ansieht.
Aus der Diele höre ich eine bekannte Stimme. Ein letztes Mal betrachte ich die Frau, dann nehme ich meine Schuhe und gehe hinter Matilda aus dem Schlafraum und treffe auf Gabriel Birck. Es ist lange her, dass ich ihn gesehen habe, aber er hat sich nicht verändert: sonnengebräuntes Gesicht und dunkle, kurz geschnittene volle Haare, bei deren Anblick man sofort das Shampoo wechseln möchte. Und er trägt einen diskreten schwarzen Anzug, so als sei er gerade von einem Fest geholt worden.
»Leo«, sagt er erstaunt. »Was zum Teufel machst du denn hier?«
»Ich … bin aufgewacht.«
»Bist du nicht suspendiert?«
»Beurlaubt.«
»Die Marke, Leo«, sagt er und verzieht den Mund zu einem blassen Strich. »Wenn du deine Marke nicht dabeihast, dann musst du hier raus.«
»Sie liegt in meiner Brieftasche in meiner Wohnung.«
»Hol sie.«
»Ich wollte gerade gehen«, sage ich und halte meine Schuhe hoch.
Birck betrachtet mich mit stummem, grauem Blick, und ich lege die Handschuhe zurück und gehe zur Tür und wieder ins Treppenhaus hinaus, vorbei an der Polizistin, die erstaunt aussieht.
»Wie zum Teufel ist der da reingekommen?«, ist das Letzte, was ich höre.
Ich gehe nicht in meine Wohnung, sondern die Treppe hinunter und um den Fahrstuhl im Erdgeschoss herum, dann hinaus auf den leeren dunklen Innenhof. Erst dort, als ich den kalten Boden an den Fußsohlen spüre, merke ich, dass ich immer noch die Schuhe in der Hand halte. Ich schlüpfe hinein und zünde mir eine Zigarette an. Die Wände der hohen Häuser rahmen den Himmel ein, und ich stehe ein Weilchen da, rauche und kaue abwechselnd auf meinem Daumennagel. Ich gehe über den Innenhof und schließe eine Tür auf, die mich wieder ins Haus lässt, wenn auch in einen anderen Teil davon. Hier ist das Treppenhaus kleiner und älter, wärmer. Ich gehe zur Eingangstür und hinaus auf die Pontonjärgatan.
Wir befinden uns in einer Zeit, in der man sich unter Fremden unsicher fühlt. Irgendwo in der Nähe pulsiert schwere Clubmusik. Vor mir liegt stumm und düster der Pontonjärs-Park, und in einiger Entfernung kreischen ein paar Autobremsen, dann ein Motor, der heruntergeschaltet wird. An der T-Kreuzung stehen ein Mann und eine Frau, die streiten, und das Letzte, was ich sehe, ehe ich losgehe, ist, wie einer der beiden die Hand gegen den anderen erhebt. Ich denke daran, wie sie einander wehtun werden, denke an die tote Frau in Bett Nummer sieben, an den kleinen Gegenstand, der in ihrer Hand zu sehen war, an die Worte, die ich heute an der Tunnelwand gesehen habe, Schweden muss sterben, und ich denke, wer auch immer das geschrieben hat, vielleicht hat er recht.
Ich biege wieder in die Chapmansgatan ein und zünde mir eine neue Zigarette an, ich brauche etwas, um die Hände zu beschäftigen. Das stumme Blaulicht flackert immer noch über die Fassaden, wieder und wieder. Jetzt sind noch mehr uniformierte Polizisten um das Haus unterwegs, sie sind dabei, Teile der Straße abzusperren, den Verkehr und die Menschen auf dem Bürgersteig umzudirigieren. Sie winken, heftig und wütend. Starke, weiße Suchscheinwerfer erleuchten den Asphalt. Aus einem Auto wird ein großes Zelt gehievt, um auf möglichen Regen vorbereitet zu sein.
Die geöffneten Fenster des Chapmansgården schlagen leicht im Wind. Drinnen sehe ich Köpfe vorbeihuschen. Gabriel Birck, ein Kriminaltechniker und Matilda. Unterhalb des Fensters liegt der Bürgersteig, den ich gern näher betrachten würde, doch der ganze Tumult um das Haus herum macht das unmöglich.
Stattdessen sehe ich auf mein Handy. Vor einer halben Stunde hat ein neuer Tag begonnen. In der Nähe höre ich die summenden Geräusche einer Bar mit offen stehendem Fenster und Musik, jemand singt Every time I see your face I get all choked up inside, ich trete die Zigarette aus und wende der Chapmansgatan den Rücken zu.
Ein kurzer Streifen blassen Asphalts verbindet zwei der größeren Straßen auf Kungsholmen miteinander. Ich weiß nicht, wie er heißt, aber er ist so kurz, dass man vom einen Ende der Straße zum anderen einen Ball kicken könnte. In einem der wenigen Häuser, die hier stehen, gibt es eine weinrote Tür, auf der nur ein Wort steht: BAR, in blassgelber Farbe. Ich öffne sie und sehe einen blonden, zerzausten Kopf auf dem Tresen ruhen. Als die Tür hinter mir zuschlägt, hebt sich der Kopf langsam, das wellige Haar fällt zu einem Mittelscheitel, und Anna sieht mit halb geschlossenen Augen auf.
»Endlich«, murmelt sie und fährt sich mit der Hand durch die Haare. »Ein Gast.«
»Bist du betrunken?«
»Zu Tode gelangweilt.«
»Ein bisschen Werbung auf der Tür würde mehr Leute anlocken.«
»Peter will keine Werbung. Er will den Laden einfach nur loswerden.«
Der Besitzer der BAR ist ein desinteressierter Unternehmer in den Dreißigern, dessen Vater das Lokal Anfang der Achtziger gekauft, eine Bar daraus gemacht und sie bis zu seinem Tod betrieben hat. Danach ging die BAR per Testament an Peter, der sie nach dem Wunsch des Vaters erst nach fünf Jahren verkaufen darf. Das war vor viereinhalb Jahren, wenn also die Welt nicht untergeht, dann hat Anna noch sechs Monate hinter dem Tresen.
Die BAR ist so ein Ort, den man nur findet, wenn man danach sucht. Hier drinnen ist alles aus Holz: der Tresen, der Fußboden, die Decke, die leeren Tische und Stühle, die wie zufällig verteilt sind. Die Beleuchtung ist gelblich und warm und lässt Annas Haut gebräunter wirken, als sie ist. Sie macht vorsichtig ein Eselsohr in das dicke Buch vor ihr und klappt es zu, nimmt eine Flasche Absinth aus einem Schrank, stellt ein Glas hin und gießt ein, wahrscheinlich sollen es zwei Zentiliter sein, es ist aber viel mehr. Absinth zu verkaufen verstößt gegen das Gesetz, aber Bars machen vieles, was nicht ganz gesetzlich ist.
»Ziemlich still hier«, sage ich.
»Soll ich die Musik anmachen? Ich habe sie ausgemacht, weil sie mich gestört hat.«
Ich weiß nicht, was ich will. Also setze ich mich auf einen der Barhocker und trinke aus dem Glas. Absinth ist der einzige Alkohol, den ich vertrage. Ich trinke selten, aber wenn, dann nur so etwas. Zu Beginn des Sommers habe ich die BAR eines Abends auf dem Heimweg entdeckt. Ich war high und blieb stehen, um mir eine Zigarette anzuzünden. Ich musste mich an die Wand lehnen, um die Balance zu halten. Alles in mir driftete zur Seite, was es mir unmöglich machte, meinen Blick zu fokussieren. Als ich es schließlich schaffte und die weinrote schwere Tür auf der anderen Straßenseite anstarrte, da sah ich das Wort BAR. Ich war ganz sicher, dass es sich um eine Halluzination handelte, stolperte aber trotzdem über die Straße und fing an, fest an die Tür zu schlagen. Nach einer Weile öffnete Anna mit einem Baseballschläger in der Hand.
Ich weiß nicht, wie alt sie ist. Sie könnte zwanzig sein. Ihre Eltern besitzen einen Herrensitz in Uppland, nördlich von Norrtälje. Vor fünfzehn Jahren startete Annas Vater zur richtigen Zeit ein Internetgeschäft und verkaufte es, kurz bevor die Blase platzte. Das Geld investierte er in neue Geschäfte, die er wachsen ließ. Auf diese Weise werden die Leute heutzutage reich. Anna verachtet ihren Vater, hat aber gleichzeitig das große Bedürfnis, von ihm akzeptiert zu werden. Sie studiert Psychologie und arbeitet nebenher hier als Barkeeperin, aber ich sehe sie niemals Seminarliteratur lesen. Das Einzige, was sie liest, sind dicke Bücher mit merkwürdigen Umschlägen. Das ist alles, was ich von ihr weiß, und es ist fast genug, um unsere Bekanntschaft als Freundschaft durchgehen lassen zu können.
Ich erkenne mich selbst im Spiegel, der hinter dem Tresen hängt. Meine Kleider sehen ausgeliehen aus. Ich habe abgenommen. Für die Jahreszeit bin ich blass, ein Hinweis darauf, dass ein Mensch sich versteckt. Anna stützt die Ellenbogen auf den Tresen, legt den Kopf in die Hände und betrachtet mich mit kühlem Blick aus den blauen Augen.
»Du siehst düster aus«, sagt sie.
»Du hast einen guten Blick für so was.«
»Ich habe einen superschlechten Blick für so was. Du strahlst das aus.«
Ich trinke von dem Absinth.
»In meinem Haus ist eine Frau erschossen worden«, sage ich und stelle das Glas ab. »Und es gibt Details daran, die … mich stören.«
Anna zieht die Augenbrauen hoch. »In deinem Haus?«
»In einer Unterkunft für Obdachlose im unteren Stockwerk. Sie ist gestorben.«
»Aber jemand hat sie ermordet?«
»Wenn es Leute in dieser Stadt gibt, die eine Tendenz zum Sterben haben, dann sind es Drogenabhängige und Huren.« Ich sehe das Glas vor mir an. »Aber meistens ist es eine Überdosis oder Selbstmord. Die wenigen, die von anderen ermordet werden, sind fast immer Männer. Das hier war eine Frau. Das ist ungewöhnlich.« Ich kratze mich an der Wange und höre ein schrappendes Geräusch. Ich sollte mich rasieren. »Es sah … einfach aus. Diskret und sauber. Das ist noch ungewöhnlicher, und diese Tatsache stört mich am meisten.«
Im Innenhof meines Hauses machen ein paar Kinder, ich glaube, es sind Geschwister, oft tagsüber einen Wettlauf über den Hof, von der einen Seite zur anderen. Laut und lachend, sodass die Geräusche zwischen den Wänden widerhallen. Ich weiß nicht, warum ich jetzt daran denken muss, doch an dem Bild und den Geräuschen ist irgendetwas für mich von Bedeutung, etwas, das verloren gegangen ist.
»Das ist nicht deine Abteilung«, sagt Anna, »Ermittlung in Gewaltverbrechen. Oder?«
Ich schüttele den Kopf.
»Was ist denn deine Abteilung?«
»Habe ich das nicht schon erzählt?«
Sie lacht. Annas Mund ist symmetrisch.
»Du sagst nicht sonderlich viel, wenn du hier bist. Aber«, fügt sie hinzu, »das ist in Ordnung. Es gefällt mir.«
»Ich bearbeite Amtsdelikte, Dezernat für Interne Ermittlungen.«
Ich nehme noch einen Schluck und merke, dass ich wieder rauchen möchte.
»Du ermittelst gegen andere Polizisten?«
»Ja.«
»Ich dachte, nur sechzigjährigen Herren würde diese Ehre zuteil. Wie alt bist du? Dreißig?«
»Dreiunddreißig.«
Sie betrachtet den Tresen, dunkel und sauber, runzelt die Augenbrauen und holt ein Tuch raus, um ihn noch sauberer zu wischen.
»Es ist ungewöhnlich, dass Dreiunddreißigjährige beim D.I.E. sind. Aber es kommt vor.«
»Du musst ein ziemlich guter Polizist sein«, meint sie, legt den Lappen zurück und lehnt sich an den Tresen.
Anna trägt ein schwarzes Hemd mit hochgekrempelten Ärmeln, das über dem Brustkorb aufgeknöpft ist. Ein schwarzes Schmuckstück hängt an einer dünnen Kette um ihren Hals. Ich sehe von dem Schmuck zum Glas, und die Beleuchtung blinkt. Hier gibt es keine Fenster.
»Nicht wirklich. Ich habe gewisse Defizite.«
»Die haben wir alle«, sagt sie. »Bist du echt dreiunddreißig?«
»Ja.«
»Ich dachte, du wärst jünger.«
»Du lügst.«
Sie lächelt. »Ja. Betrachte es als Kompliment.«
Ich mustere mich wieder im Spiegel, und einen kurzen Moment lang erlebe ich, wie mein Abbild sich auflöst und transparent wird. Ich war zu lange zivil. Eigentlich bin ich nicht hier.
»Warum bist du Polizist geworden?«
»Warum bist du Barkeeperin geworden?«
Sie scheint über eine Antwort nachzugrübeln. Ich denke an die kleine Kette, die ich in der Hand der toten Frau gesehen habe, und frage mich, was das wohl war. Ein Amulett, das sie brauchte, um schlafen zu können? Vielleicht, aber unwahrscheinlich. Es sah platziert aus. Ich hole mein Handy heraus, rufe das Bild von dem Gesicht der Frau auf und starre es an, so als würden sich ihre Augen jeden Moment öffnen.
»Ich nehme mal an, dass sich alle mit irgendwas beschäftigen müssen, während sie versuchen, das zu finden, was sie eigentlich tun wollen«, sagt Anna schließlich.
»Genau.« Ich leere mein Glas, sehe das Bild auf dem Handy an und zeige es ihr. »Kennst du sie?«
Anna betrachtet das Bild.
»Nein, ich kenne sie nicht.«
»Möglicherweise hieß sie Rebecca.«
»Mit zwei k oder mit Doppel-c?«
»Wieso?«
»Ich frage mich nur.«
»Unklar, aber momentan glaube ich, Doppel-c.«
Sie schüttelt den Kopf. »Ich kenne sie nicht.«
»Einen Versuch war’s wert.«
Ich verlasse Anna, als sie die ersten Stühle auf die Tische stellt. Der tickenden alten Wanduhr zufolge ist es kurz vor drei, doch angesichts der Atmosphäre in der BAR deutet nichts darauf hin, dass das auch stimmen muss.
»Ich finde, du solltest mich mal anrufen«, sagt sie, als ich die Hand auf die Türklinke lege. Ich drehe mich um.
»Ich habe deine Nummer nicht.«
»Die kriegst du schon raus.« Sie stellt einen weiteren Stuhl hoch und erzeugt ein hartes, klapperndes Geräusch von Holz auf Holz. »Ansonsten sehen wir uns bestimmt bald wieder.«
Die Beleuchtung flackert erneut, ich drücke die Türklinke herunter und verlasse die BAR. In meinem Kopf schaukelt es leicht und angenehm.
Die Stockholmer Nacht ist auf eine neue Weise rau. Wenn die Wanduhr hinter Anna richtig ging, dann wird es noch ein paar Stunden dunkel sein. In meinem Augenwinkel flimmert etwas, ein Schatten. Ich erstarre und drehe mich um. Jemand folgt mir, da bin ich mir sicher, doch als ich den Blick über die Straße schweifen lasse, ist niemand dort zu sehen, nur eine Ampel, die von Rot auf Grün springt, ein Auto, das ein paar Kreuzungen entfernt abbiegt, und das Rauschen einer großen Stadt, die mit der Dunkelheit wächst und die Einsamen verschlingt.
Als ich in die Chapmansgatan zurückkehre, parken noch mehr Autos beim Absperrband: noch ein Polizeiauto, Wagen von der Nachrichtenagentur TT, vom Schwedischen Fernsehen und dem Aftonbladet, und ein Van mit getönten Scheiben und dem schwarzen Text AUDACIA AB auf dem silbernen Lack. Die Straße ist abgesperrt, und hinter dem Band stehen Menschen, die im Gegenlicht der eingeschalteten Scheinwerfer des Streifenwagens zu dunklen Silhouetten werden. Einzelne Blitzlichter flackern auf. Jemand breitet auf der Höhe des Vans ein Tuch aus, und die Fotoblitze gehen in ein intensives, ratterndes Flimmern über. Ich kann eine Bahre erkennen, eine Hand, die ihren Griff umklammert, aber nicht mehr.
Kein Blaulicht mehr. Die Signale des Todes sind ausgeschaltet, und übrig bleiben nur die Blitzlichter der Fotografen. Ein Seufzen geht durch die Reihe derer, die entlang des Absperrbandes stehen, vielleicht vor Aufregung, aber wahrscheinlich aus Enttäuschung. Das Tuch, das von zwei uniformierten Polizisten hochgehalten wird, verbirgt alles, was die Menge herangelockt hatte. Zwei Männer, die Bestatter, steigen in den silbernen Van, und er wird vorsichtig durch die Absperrung gelenkt.
Ich betrete die Chapmansgatan Nummer 6 durch den Hintereingang. Als ich an der Wohnung im Hochparterre vorbeikomme, steht die Tür offen, und drinnen kann ich Gabriel Bircks Stimme hören. Das Absperrband ist noch da, und das wird es auch noch ein paar Tage bleiben, vielleicht sogar länger. Aber ich bin von all dem ausgeschlossen und gehe in meine Wohnung hinauf und lege mich ins Bett, als wäre es nur ein paar Minuten her, seit ich aufgewacht bin.
Seltsam, wie, kurz bevor der Morgen anbricht, ein Schauer durch den Raum zu gehen scheint.
3 Wie es war, in Salem aufzuwachsen?
An das hier erinnere ich mich: Der erste Polizist, den ich jemals sah, hatte sich lange nicht rasiert. Der zweite hatte mehrere Tage nicht geschlafen. Der dritte stand an einer der Kreuzungen in Salem und dirigierte den Verkehr nach einem Unfall. Eine Zigarette hing ihm im Mundwinkel. Der vierte Polizist, den ich sah, platzierte einem meiner Freunde ungerührt und ohne provoziert worden zu sein mit einem schnellen Schlag einen Schlagstock zwischen die Beine, während seine zwei Kollegen ebenso ungerührt dabeistanden und wegschauten.
Ich war fünfzehn. Ich wusste nicht, ob das, was ich sah, gut oder schlecht war. Es war einfach so.
Ich wohnte dort, bis ich zwanzig war. In Salem wuchsen die Häuser acht, neun, zehn Stockwerke in den Himmel, aber doch niemals so nahe an Gott heran, dass er sich die Mühe gemacht hätte, seine Hand herabzustrecken und sie zu berühren. In Salem schienen die Menschen sich selbst überlassen zu sein, und wir wuchsen schnell auf, wurden vorzeitig erwachsen, weil das verlangt wurde.
Es war Nachmittag, und ich nahm die Treppe vom achten in den siebten Stock und forderte dort den Fahrstuhl an. Mit dem konnte man nur bis zum siebten Stock fahren, nicht höher. Niemand wusste, warum. Wenn ich an Salem denke, dann erinnere ich mich daran, dass ich jeden Morgen die Treppe ein Stockwerk hinunterging und jeden Nachmittag für das letzte Stück nach Hause die Treppe hinauf nehmen musste. Und ich erinnere mich, dass ich niemals darüber nachdachte, warum das so war oder warum überhaupt irgendetwas so war, wie es war. Wir wuchsen nicht mit dem Bedürfnis auf, den Zustand der Dinge infrage zu stellen. Wir wuchsen in dem Wissen auf, dass niemand uns etwas geben würde, wenn wir nicht bereit waren, es ihm wegzunehmen.
Im siebten Stock wartete ich, während der Fahrstuhl den Schacht hinaufrumpelte. Ich war nun sechzehn und nirgendwohin unterwegs, wollte nur raus. Hinter einer der Wohnungstüren hörte ich schweren, gedämpften Hip-Hop, und als ich die Fahrstuhltür öffnete, roch es darin stark nach Zigarettenrauch. Draußen auf der Straße hing der weiße kalte Himmel tief. Die Straßenlaternen flammten auf, als ich gerade am Haus der Jugend vorbeiging. Ein Nebel breitete sich aus. Daran erinnere ich mich auch: Wenn der Nebel nach Salem kam, dann verschluckte er alles. Er spülte über uns hinweg, umschloss Häuser, Bäume und Menschen.
In der Entfernung konnte ich zwischen den Bäumen Salems hohen pilzförmigen Wasserturm aufragen sehen. Der dunkle Beton hob sich gegen den kalten Himmel in einer schwarzen Silhouette ab, und ich fragte mich, ob die Absperrungen wohl weggeräumt worden waren. Ein paar Tage zuvor war jemand dort heruntergefallen. Ich kannte seinen Namen nicht und wusste nur, dass wir dieselbe Schule besuchten und dass es hieß, er habe am letzten Tag NICHTS ZU VERLIEREN an seinen Spind geschrieben, wie eine letzte Nachricht. Am Tag nach seinem Tod, als alle schon zu Hause waren und die Flure ganz leer, ging ich, begleitet vom Klang eines CD-Spielers, den jemand vergessen hatte auszuschalten, ehe er ihn in den Spind warf, lange an allen Schränken entlang und suchte nach der Nachricht, ohne sie zu finden.
Der Wasserturm war so ein Platz, den die Erwachsenen von Salem am liebsten konstant unter Polizeibewachung gesehen hätten, wenn es die Ressourcen der öffentlichen Hand zugelassen hätten. Tagsüber gingen die Kinder dorthin und spielten, abends und nachts wurden Feste und Versammlungen dort abgehalten. Die Kinder blieben am Boden und die Partygänger meistens auch, aber manchmal kletterten wir auf den Turm. Und nachts geschah es bisweilen, dass jemand herunterfiel, aus Versehen oder auch nicht, und der Wasserturm war hoch. Wer fiel, überlebte nicht.
Nachdem ich mich durch das Walddickicht, das den Turm umgab, gearbeitet hatte, stand ich an seinem Fuß. Der Boden bestand aus fest geschichtetem Kies, und ich suchte nach Spuren von jemandem, der vor mir hier gewesen war, fand aber keine. Keine Dosen, keine Kondome, gar nichts. Vielleicht hatte jemand sauber gemacht, nachdem der Typ heruntergefallen war. Ich fragte mich, wo er wohl aufgeprallt war.
Irgendwo über mir knallte es, und dann raschelte es in den Baumkronen dort oben, und ich sah im Augenwinkel, wie etwas auf die Erde plumpste. Unsicher, was mich erwarten würde, schaute ich zum Himmel. Als nichts weiter geschah, ging ich zu dem, was da runtergefallen war. Ein Vogel, schwarz-weiß mit halb geöffnetem Schnabel, die Flügel ausgebreitet und verdreht. Auf den weißen Federn konnte ich dunkelrote Spritzer sehen. Das eine Auge des Vogels war zerschossen, eine einzige orangerote offene Wunde, als hätte jemand einen Teelöffel genommen und ein Stück aus seinem Kopf herausgegraben. Ich stand da und betrachtete das Tier, zündete mir eine Zigarette an und hatte gerade ein paar Züge genommen, als es in einem der Flügel zuckte und eines der Beine zappelte.
Ich fing an, nach etwas Schwerem zu suchen, womit ich das Tier erschlagen könnte. Als ich nichts fand, hob ich den Blick zur runden Kuppel des Turms, dann sah ich wieder zu dem Vogel. Er bewegte sich nicht mehr.
Ich ließ die Zigarette zu Boden fallen, trat sie mit dem Schuh aus und lief zu der schmalen Treppe, die außen an dem Turm nach oben führte. Die Treppe bebte unter meinen Schritten, und ich hielt mich am Geländer fest. Die Anstrengung ließ meinen Arm schmerzen. Auf halbem Weg nach oben hörte ich erneut einen Schuss.
Der Wasserturm hatte einen Absatz, und von diesem aus führte eine kurze Leiter noch ein paar Meter weiter nach oben auf eine Plattform direkt unter dem pilzförmigen Dach des Turms. Über mir hörte ich Stoff an Stoff rascheln, und ich zündete mir geräuschvoll eine neue Zigarette an. Das Rascheln verstummte abrupt mit dem Klacken des Feuerzeugs, und ich sah mit zusammengekniffenen Augen zum Himmel hoch, der mir unnatürlich hell und intensiv vorkam.
»Wer ist da?«, hörte ich eine Stimme.
»Niemand«, erwiderte ich. »Schießt du hier?«
»Wieso?«
Die Stimme klang abwartend, aber nicht drohend.
»Hab mich nur gefragt.«
»Komm rauf. Du verjagst die Vögel.«
Ich versuchte, ihn da oben auf der Plattform zu sehen, doch das war nicht möglich. Die Plattform war aus massivem Holz und nicht wie der untere Absatz nur aus Planken gezimmert, durch die man hindurchsehen konnte.
»Kannst du mal meine Kippe halten?«
Ich stieg die Leiter hinauf, hielt die Zigarette über den Boden der Plattform und spürte eine Hand, die sie mir abnahm. Ich packte einen der Balken, an denen die Leiter befestigt war, und hievte mich hinauf. Mich streifte der Gedanke: Wenn ich fiele, würde ich nicht überleben.
Die Plattform war breit genug, um mit dem Rücken an der Turmwand zu lehnen und die Beine zu der zaunähnlichen Balustrade auszustrecken, ohne von unten gesehen zu werden. Die Balustrade reichte bis zum Oberschenkel. Hier oben war der Wind stärker, und vor mir breitete sich Salem dort unten aus, die klobigen Klötze mit ihren kleinen Fenstern, die geduckten Villen mit den schrägen Dächern und warmen Farben, das sporadische Grün und der dunkelgraue schwere Beton. Von hier aus wirkte die Landschaft noch seltsamer als vom Boden aus betrachtet.
Ich sah die Hand, die mir die Zigarette entgegenstreckte. Er hielt sie nicht so, wie ein Raucher es tut, sondern unsicher, mit drei Fingerspitzen am Ende des Filters.
»Du bist das also, der hier schießt«, sagte ich.
»Wie kommst du denn darauf?«
Ich erkannte ihn. Er ging aufs Rönninge-Gymnasium, aber in eine andere Klasse als ich. Er hatte kurze blonde Haare und ein schmales, kantiges Gesicht, trug Baggy-Jeans und rote Converse. Dazu einen grauen Pullover mit über den Kopf gezogener Kapuze. Seine Augen waren tiefgrün und klar. In den Händen hielt er ein schweres dunkelbraunes Luftgewehr, und neben ihm lag eine offene Packung mit Munition. Er legte den Kopf in den Nacken und schloss die Augen.
»Was machst du?«
»Schsch. Man muss horchen.«
»Auf was?«
»Auf die Vögel.«
»Ich hör nichts.«
»Du lauschst nicht.«
Ich rauchte die Zigarette zu Ende und hörte immer noch nichts außer dem Rascheln der Baumkronen und jemandem, der sich in der Nähe auf die Hupe eines Autos lehnte.
»Ich heiße John«, sagte er schließlich.
»Leo«, erwiderte ich.
»Sitz still.«
Er öffnete die Augen, hob die Waffe und legte das Auge an das schwarze Visier des Gewehrs. Ich folgte dem Lauf mit dem Blick, versuchte zu sehen, worauf er zielte. In den Bäumen um uns herum schien alles still zu sein. John atmete tief ein und hielt die Luft an, während ich mich instinktiv an die Wand drückte. Auf den Knall folgte ein neuerliches Rascheln in einem der Bäume. Ich konnte ihn nicht sehen, doch es fiel ein Vogel zu Boden.
»Warum erschießt du sie?«
Er legte das Gewehr weg.
»Ich weiß nicht. Weil ich es kann? Weil ich gut darin bin?« Er sah auf meinen rechten Arm. »Hast du Schmerzen?«
Das Klettern hatte dem Arm nicht gutgetan, und ich massierte ihn. Er erinnerte mich an Vlad und Fred, zwei der älteren Jungs in Salem, die hatten harte Fäuste. Sie schlugen immer auf denselben Punkt direkt am Nerv, was den Arm erst taub werden ließ und dann, wenn das Gefühl zurückkehrte, wehtat. Sie hatten schon lange damit aufgehört, doch wenn ich den Arm anstrengte, dann kam der Schmerz manchmal zurück, und das erinnerte mich für alle Zeiten an sie.
»Bin heute in ein Treppengeländer geflogen.«
»Treppengeländer«, meinte John.
»Ja. Kommst du oft hierher?«
»Wenn ich meine Ruhe haben will«, sagte er. »Man braucht irgendeinen Ort, wo man hingehen kann, wenn man nicht nach Hause gehen kann.«