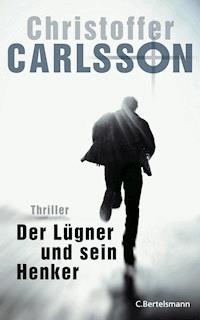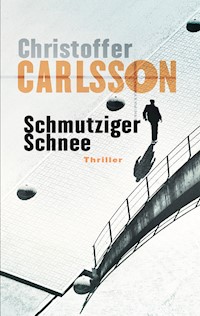7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. Bertelsmann Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Finster, packend und hochaktuell - Leo Junker ermittelt
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Terrorangst in Stockholm und ein cold case, der Leo Junker hart auf die Probe stellt
Leo Junker hat seine Lebenskrise überwunden: Er darf wieder als Polizist arbeiten, lebt mit seiner Freundin Sam zusammen und hat sich von seiner Tablettensucht befreit. Eines Tages meldet sich sein lange abgetauchter Jugendfreund Grim wieder und drängt ihn, einen fünf Jahre zurückliegenden Mordfall unbedingt wieder aufzunehmen. Leo, irritiert über Grims Besessenheit, möchte lieber Abstand wahren. Doch dann entdeckt er, dass die damaligen Ermittlungen verdächtig schnell ad acta gelegt wurden, und ihm kommt ein ungeheuerlicher Verdacht. Aber Leo hat kaum Zeit für diesen brisanten Fall, denn in Paris geschieht gerade der Anschlag auf das Bataclan. Ganz Stockholm wird in höchste Alarmbereitschaft versetzt ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 457
Ähnliche
Das fulminante Finale der Leo-Junker-Serie!
Leo Junker darf nach seiner Lebenskrise endlich wieder offiziell als Polizist arbeiten. Kurz darauf drängt ihn ausgerechnet sein Jugendfreund Grim, der seit Jahren polizeilich gesucht wird, einen cold case wieder aufzunehmen. Damit macht sich Leo bei seinen Kollegen mehr als unbeliebt. Als es dann noch eine akute Terrorwarnung in Stockholm gibt und die Polizei in ständiger Bereitschaft sein muss, wird der Spielraum für Leo immer enger …
Christoffer Carlsson
ZEIT DER ANGST
Thriller
Aus dem Schwedischen von Susanne Dahmann
C. Bertelsmann
Die Originalausgabe erschien 2017 unter dem Titel Den tunna blå linjenbei Piratförlaget, StockholmDer Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
1. AuflageCopyright © 2017 by Christoffer CarlssonPublished by agreement with Ahlander AgencyCopyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2018beim C. Bertelsmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH,Neumarkter Str. 28, 81673 MünchenUmschlagmotiv: Arcangel/Stephen MulcaheyUmschlag: www.buerosued.de, MünchenSatz: Uhl + Massopust, AalenISBN 978-3-641-22652-7V002www.cbertelsmann.de
Für meine Eltern
love is a spark
lost in the dark
too soon
PEGGY LEE
Teil I
Der Freund, der sich in Luft auflöste
Stockholmim November 2015
1 Mit der Post kommt ein Brief.
Das Kuvert ist weiß, klein wie eine Ansichtskarte und in Stockholm abgestempelt. Mein Name und meine Adresse sind mit unpersönlichen Großbuchstaben in blauer Tinte daraufgeschrieben.
Es ist Mittagszeit und eher Zufall, dass ich zu Hause bin, als das Kuvert zusammen mit der restlichen Tagespost durch den Briefschlitz geschoben wird. Ich will gerade wieder zur Arbeit aufbrechen, also stecke ich den Brief ungeöffnet in die Tasche und verlasse das Haus.
Dann vergesse ich ihn.
Während ich neben Birck im Wagen sitze, fällt er mir wieder ein, und ich schiebe die Hand in die Innentasche meiner Jacke. Da liegt er, spürbar verknittert, nachdem er einige Stunden dort verbracht hat.
Birck lehnt sich nach vorn und kneift die Augen zusammen.
»Da kommt noch eine.«
Ich ziehe die Hand aus der Jacke und greife nach der Kamera, halte den Sucher ans Auge und knipse zwei Bilder von der Frau, die vor der Haustür stehen bleibt. Um uns herum brummt Stockholm, aber im Wageninneren ist es leise, abgesehen von dem sporadischen Knistern des Polizeifunks.
»Können wir nicht das normale Radio anmachen?«, frage ich.
»So ist es gemütlicher«
»Aber …«
»Nein. Das ist mein Auto.« Er sieht sauer aus. »Verdammt, ist das alles sinnlos. Vermutlich hat es sich noch nie so gelohnt, Verbrechen zu begehen wie heutzutage.«
Da hat er wohl recht.
Seit einem knappen Jahr läuft die Umstrukturierung des schwedischen Polizeiwesens. Es geht um Effizienz, doch da die eine Hand nicht weiß, was die andere tut, sprechen alle, abgesehen von den Verantwortlichen, nur noch von einer Krise. Immer noch werden Angestellte wahllos in die verschiedensten Dezernate geschickt, weshalb sie nicht einmal das Wichtigste erledigen können. Die Chefs kämpfen zwar darum, ihre Teams zusammenzuhalten, aber dem Hörensagen nach sind die Direktiven der Polizeileitung derart vage, dass die Dezernatsleiter nicht wissen, wie viel Geld ihnen überhaupt zur Verfügung steht.
So schlimm war es noch nie, sagen die Leute. Die Aufklärungsquoten sinken, die Unzufriedenheit wächst, und die gesamten Mittel, die für die Umstrukturierung verwendet werden sollten, scheinen verschwunden zu sein.
»Es kommt einem täglich so vor, als wäre Weihnachten und man der Einzige, der Dienst schiebt«, fährt Birck fort, und damit hat er recht.
Deshalb wurden wir an die Personenüberwachung ausgeliehen, der für heute Nacht Leute fehlen, und sitzen hier in der Nähe des Odenplan. Unsere Aufgabe ist es, zwischen acht Uhr abends und drei Uhr früh zu dokumentieren, welche Leute das Haus Västmannagatan 66 betreten oder verlassen. Laut Schichtleiter Melander, der vor ein paar Jahren die Nachfolge des alten Haudegens Jarnebring übernommen hat, ist dieses Haus ein Hehlernest, doch die Kollegen vom Dezernat für Eigentumsdelikte haben das bisher noch nicht beweisen können.
Birck legt die Hand auf den Türgriff.
»Ich muss pissen. Ruf an, wenn was passiert.«
Es ist fünf vor halb neun, November und kalt. Während Birck die Straße überquert, um die Toilette im Hotel Oden zu benutzen, steht sein Atem in kleinen Rauchwölkchen vor ihm. Er stemmt sich gegen den Wind und schlägt den Mantelkragen hoch. Die Straßen glänzen noch vom Regen, der vor einigen Stunden fiel. In der Ferne schimmern die Neonschilder um den Odenplan, helle Farbpfützen in all dem Schwarz. Ein Bus rauscht über den Karlbergsvägen, aber hinter den Scheiben sind keine Gesichter zu erkennen.
Es war ein hartes Jahr, nicht nur für die Behörden, sondern auch für mich. Ich habe mich gezwungen, mit den Tabletten aufzuhören, obwohl ich das lange für unmöglich gehalten hatte.
Heute ist Tag dreihunderteinundsiebzig danach. Es fühlt sich nach mehr an.
Ich habe mich Minute für Minute, Stunde für Stunde durchgebissen. Die Tage waren lang wie Wochen, die sich wie Monate dehnten, und ich fing an, mich älter zu fühlen, als ich bin. Man altert rascher, wenn man nichts hat, in das man sich fliehen kann.
Wieder hole ich den Brief aus der Innentasche, drehe und wende ihn und schlitze schließlich das Kuvert mit meinem Schlüssel auf.
Darin liegt eine Fotografie auf dünnem Papier, zweimal gefaltet. Mehr nicht.
Das Bild zeigt eine Frau mit dunklem Haar, schmalem Gesicht und großen, mandelförmigen Augen. Sie trägt eine dunkelgrüne Jacke, die ihr bis zur Taille reicht, ein schwarzes Hemd und schwarze Röhrenjeans, dazu grobe Stiefel. Sie steht an einer Straßenecke, es ist aber nicht zu erkennen wo, und hat den Blick auf die Straße gerichtet, als würde sie auf jemanden warten.
Auf der Rückseite des Fotos befinden sich eine handgeschriebene Telefonnummer und zwei Wörter:
– hilf mir
Ich hole mein Handy raus, wähle die Nummer und halte das Telefon ans Ohr. Es meldet sich niemand. Also suche ich im Internet nach irgendwelchen Informationen über die Nummer, finde aber nichts.
Es geschieht manchmal, dass sich die Leute, fast immer aus unerfindlichen Gründen, einen Spaß mit der Polizei erlauben, das bin ich also gewohnt. Trotzdem, etwas verwirrt mich. Ich kenne die Frau.
Als Birck vom Hotel zurückkommt, falte ich das Bild zusammen, stecke es wieder ins Kuvert und schiebe beides in die Innentasche meiner Jacke.
In dem Moment keucht der Polizeifunk. Jemand hat in einer Wohnung auf dem Karlbergsvägen, ungefähr einen Kilometer von hier entfernt, die Leiche eines Mannes gefunden. Mein erster Gedanke ist hinzufahren, um diesem Überwachungsauftrag zu entkommen. Aber dafür müssten wir uns erst die Erlaubnis der Personenüberwachung holen, und wenn wir dann endlich bei der Leiche ankämen, würden wir bestimmt wieder hierhergeschickt werden, weil uns schon jemand anders zuvorgekommen wäre.
Ein Mann bleibt an der Västmannagatan 66 stehen, dann geht er ins Haus. Pflichtschuldigst machen wir unsere Fotos. Dieser Montag, der 2. November, wird als ein ereignisloser Tag in die Geschichte eingehen.
Mein Telefon meldet eine SMS. Sie wurde von der Nummer geschickt, die ich eben angerufen habe, die Nummer auf der Rückseite des Fotos.
– morgen, 22.00
Dazu eine Adresse auf Södermalm, das ist alles.
– wer schreibt hier?, frage ich. Und warum gehen Sie nicht ran, wenn man anruft?
»Was ist los?«, fragt Birck.
»Wieso?«
»Du siehst seltsam aus.«
»Es ist nichts.«
Im Auto kriechen die Stunden dahin.
Ich denke an den toten Mann in der Wohnung am Karlbergsvägen. Die Stadt ist soeben um eine Seele ärmer geworden, aber Stockholm hat schon lange aufgehört, sich darum zu scheren.
2 Vor anderthalb Jahren ist Charles Levin, mein ehemaliger Chef, gestorben. Meine Tabletten sind mir weggenommen worden. John Grimberg, der vor langer Zeit mein bester Freund war, ist verschwunden.
In mir wächst die Leere. Ich bin immer noch Kriminalbeamter im Morddezernat in der City, aber es fällt mir schwer, an demselben Ort und in derselben Rolle zu verharren, wenn alles andere sich verändert. Etwas muss die Tabletten ersetzen, ich weiß, dass eine Abhängigkeit nicht einfach so verschwindet, normalerweise verändert sie nur ihr Erscheinungsbild: trockene Säufer werden Workaholics, ehemalige Junkies werden spielsüchtig, bankrotte Spieler wenden sich dem Alkohol zu. Wer einmal frei ist, kann sich leicht verlaufen.
Freiheit. Genauer betrachtet ein seltsames Wort.
Als die Dunkelheit sich über die Stadt gelegt hat und es auf halb zehn zugeht, nehme ich Mantel und Schal. Im Laufe des Tages habe ich einige Male die Fotografie betrachtet, das Kuvert, in dem sie geschickt wurde, und die Handschrift.
Ich gehe zu Fuß zum Kungsholmstorg. Der Bus in Richtung Süden kommt durch die Kälte angeschnaubt, und ich steige ein. Ich sitze allein in der hintersten Reihe und spüre die Wärme und die Vibrationen des Motors. Als wir am Wasser entlang nach Södermalm rauschen, erahne ich auf der anderen Seite die steif gefrorene Silhouette des Vergnügungsparks Gröna Lund.
Am Tjärhovsplan steige ich aus und vergewissere mich noch einmal der Adresse in der SMS, biege in die Tjärhovsgatan ein und finde den Hauseingang. Aber die Tür ist verschlossen, und dahinter ist es schwarz wie im Bauch eines Tieres, das Einzige, was ich erkennen kann, ist eine Wendeltreppe, die sich schief und krumm nach oben windet.
Da tritt ein Mann aus dem Schatten. Er ist dunkel gekleidet und hat eine Kappe auf dem Kopf, als er aus dem Hauseingang kommt.
»Leo.« Der Mann packt mich unaufgeregt am Arm. »Ich werde dir nicht wehtun. Komm.«
Für einen Moment blitzt es in seiner anderen Hand auf, das kleine Taschenmesser, die Schneide gegen mich gerichtet.
»Grim«, antworte ich.
3 Es war ein unerklärliches Verschwinden. Darüber waren sich alle einig.
Ich lag in einem Krankenhausbett, von heftigen Schmerzen in der Brust gequält, nachdem ich bei einer Festnahme angeschossen worden war. Das war in der Endphase einer Ermittlung passiert, die sich weit in die Vergangenheit hinein erstreckt hatte. Ich bin noch nicht einmal heute sicher, ob ich alle Verästelungen durchschaue. Die Festnahme wurde erst dadurch möglich, dass ausgerechnet er, John Grimberg, uns entscheidende Informationen gab.
Gab ist das falsche Wort. Es handelte sich nicht um ein Geschenk, sondern um einen Deal.
Grim saß in der Forensischen Psychiatrie im St. Görans ein und erzwang sich im Austausch gegen eine Information einen Freigang. Er behauptete, er wolle mich sehen, und deshalb kam er ins Krankenhaus. So beschrieb zumindest das Personal der Psychiatrie den Vorgang: Die Verantwortlichen hatten ihr gutes Herz gezeigt. Der Freund des Einsitzenden (so wurde ich bezeichnet, als sein Freund, das fühlte sich seltsam an) war ernsthaft verletzt. Grimberg fürchtete, dieser Leo Junker würde sterben, und wollte ihn besuchen. Sie nahmen es genau mit der Bewachung, aber wenn man in gutem Glauben agiert, lässt man immer auch einen kleinen Spaltbreit für den Fluchtwilligen offen. Das Personal konnte für das, was geschah, nicht zur Rechenschaft gezogen werden.
Als Grim zu mir kam, sagte er, wenn ich mich recht entsinne, er sei besorgt und habe etwas zu erzählen. Das muss eine Ausrede gewesen sein, ein Scheinmanöver. Denn eine Armlänge von denjenigen entfernt, die ihn bewachen sollten, löste er sich in Luft auf.
Wie genau das vor sich ging und wohin er verschwand, das weiß niemand.
Wir wuchsen beide in Salem auf und verbrachten viel Zeit miteinander. Grim war fast ein Spiegelbild meiner selbst. Dann zerbrach unsere Freundschaft, und er wurde zu einem Kind oder einem Geschöpf der Unterwelt. Er verdiente seinen Lebensunterhalt damit, andere Menschen verschwinden zu lassen, indem er ihnen neue Identitäten verschaffte. Darin war er sehr geschickt, das hätte ich schon damals ahnen können.
In jenem Sommer vor anderthalb Jahren entkam er irgendwie im Krankenhaus. Solange er sich verborgen halten wollte, würde niemand ihn finden.
Ich grübelte darüber nach, wohin er verschwunden sein konnte, und versuchte, mich in seine Situation zu versetzen, doch es gelang mir nicht. Mit der Zeit war ich gezwungen, über andere Dinge nachzudenken, aber ich vergaß ihn nicht, das war unmöglich. Grim war mein bester Freund gewesen. Dann versuchte er, mich und Sam zu töten. Ich glaube, er wollte mich bestrafen. Sam zeichnete er für immer, ihr fehlt nun an einer Hand ein Finger.
Aber er zeichnete auch mich.
So etwas schafft eine Bindung, ganz gleich, ob man das will oder nicht.
Ich muss für einen Moment den Schritt auf die andere Seite hinüber getan haben. Als er mich berührt, ist das ein unwirkliches Gefühl. Ein Gespenst.
»Na?«, fragt Grim. »Was sagst du?«
»Wenn ich deine Stimme nicht gehört hätte, dann hätte ich dich nicht erkannt.«
Die Haare, die unter der Kappe herausschauen, sind nicht mehr blond, sondern dunkelbraun, die blauen Augen jetzt braun. Ja, das ist er, aber er hat zugenommen, das kantige Gesicht ist fülliger geworden, und die Wangenknochen sind weniger markant als früher. Er sieht aufgedunsen, fast krank aus.
Grim trägt eine sackartige Jeans und eine dicke dunkelbraune Jacke über einem Strickpullover, also jene Sorte Kleidung, von der man glaubt, dass Hafenarbeiter sie trügen. Sie sitzt schlecht, als würde sie nicht ihm gehören.
»Willst du mir etwas antun?«
»Ich werde dir nicht wehtun, das habe ich doch schon gesagt.«
»Kann ich darauf vertrauen?«
»Was glaubst denn du?«
»Ich habe keine Ahnung.«
Er muss lachen.
»Da kann ich dir nicht einmal einen Vorwurf machen.«
»Wohin gehen wir?«, will ich wissen.
»Nirgendwohin genau. Aber es ist sicherer, in Bewegung zu bleiben.«
»Sicherer?«
»Wir können hier rechts gehen.«
Wir biegen von der Tjärhovsgatan ab und gehen hinauf zur Katarina-Kirche. Sie ist erleuchtet und weiß, scheint in den Novemberabend.
»Ich brauche deine Hilfe«, sagt Grim.
»Wobei?«
»Du hast meinen Brief gekriegt, oder?«
»Sonst wäre ich ja nicht hier.«
Ein älterer Mann kommt auf einen Stock gestützt die Straße herunter. Sein Bauch ist groß wie ein Wasserball und spannt unter dem Mantel. Ächzend humpelt er an uns vorbei.
»Du hast die Frau auf dem Bild erkannt«, fährt er leise fort, als der Mann vorüber ist.
»Ja.«
»Ich muss wissen, wer es getan hat.«
»Warum?«
»Das zu erklären dauert zu lange.«
»Fang halt an.«
»Nicht heute Abend. Das schaffen wir nicht.«
In einiger Entfernung, vielleicht unten am Medborgarplatsen, schießt jemand Feuerwerksraketen ab. Sie explodieren dumpf und behaglich am Himmel.
Jetzt sind wir oben an der Kirche. Vom nahe gelegenen Lokal am Mosebacke torg ist Gejohle und Getöse zu hören.
»Ich weiß nicht, wer es getan hat«, sage ich. »Keiner weiß das. Warum ist es so wichtig?«
Doch Grim bleibt beharrlich und fragt erneut, jetzt ungeduldiger: »Willst du mir nun helfen oder nicht?«
»Das kannst du nicht bringen, nach anderthalb Jahren einfach wieder aufzutauchen und dann um so etwas zu bitten, ohne mir den Grund zu erklären.« Plötzlich flammt der Zorn in mir auf. Ich weiß nicht, woher er kommt. »Du benutzt mich.«
»Ich werde es dir ja erklären, aber bis dahin kannst du doch die Ermittlungsunterlagen noch einmal durchsehen. Das ist alles, was ich von dir verlange.«
»Du verlangst zu viel.«
Er bleibt stehen.
»Ich melde mich bald wieder bei dir.«
»Grim«, sage ich, in härterem Ton als beabsichtigt. »Was ist hier los? Wie lange bist du schon zurück?«
»Ungefähr eine Woche. Ich kann dir bald mehr sagen. Und, du …«
»Ja?«
»Danke, dass du gekommen bist. Es ist schön, dich zu sehen.«
Da, für einen Augenblick, fällt die Maske herab, und ich erkenne ihn.
Wieder schießt eine Feuerwerksrakete in den Himmel hinauf und explodiert irgendwo über der Götgatan. Ich betrachte die sprühenden Funken einen Moment, dann wende ich mich wieder zu Grim um. Doch er ist verschwunden, vom Erdboden verschluckt, als wäre er niemals hier gewesen.
4 Ich streiche an den alten Steinfassaden entlang, lege die Hand auf eine Hauswand und bilde mir ein, das Alter der Steine spüren zu können. Die Stadt okkupiert meinen Blick. Noch eine Feuerwerksrakete.
Anderthalb Jahre lang war Grim verschwunden. Ich habe gelernt, ohne ihn zu leben, ihn nicht zu brauchen und das Gefühl von Bedrohung zu vergessen, das ich doch immer in seiner Nähe empfand.
Und dann kehrt er zurück.
Wieder stehe ich vor dem Hauseingang auf der Tjärhovsgatan. Von hier, aus der Dunkelheit, ist er gekommen. Wohnt er in diesem Haus? Ich überquere die Straße und sehe zur Fassade hoch, betrachte die Fenster. In einigen wenigen leuchten Lampen, in den allermeisten ist es dunkel.
Ich warte, doch er kommt nicht. Vielleicht ist er schon durch die Tür, oder dieser Ort ist völlig ohne Bedeutung. Er könnte ihn aus genau dem Grund ausgewählt haben, damit ich keine Adresse habe, mit der ich ihn verknüpfen kann, falls ich mich entscheide, nicht zu tun, was er sagt.
Falls ich mich entscheide, ihn zu verraten. So fühlt es sich an, seltsamerweise.
Wenig später sinke ich auf einem Sitz in der U-Bahn zusammen.
Die Frau auf dem Foto. Deshalb hat er Kontakt zu mir aufgenommen, nicht um mich wissen zu lassen, dass er lebt und es ihm gut geht, nicht weil er mich treffen möchte. Er hat Kontakt zu mir aufgenommen, weil er mich braucht. Genau das sind andere Menschen für Grim, Werkzeuge.
Ich hole das Foto aus der Tasche. Der Frau ist nicht bewusst, dass sie fotografiert wird, sie wirkt ganz natürlich. Die Kamera hat sie in einem Augenblick eingefangen, in dem sie aussieht, als wäre sie eins mit ihrer Welt und ganz bei sich. Sie ist sehr schön.
Ich weiß, wer sie ist. Das, was geschah, war schrecklich, das fanden alle. Und traurig.
Sie ist seit etwas mehr als fünf Jahren tot, und ich hätte mir nie vorstellen können, dass es zwischen ihr und Grim eine Verbindung gibt.
Gibt es denn eine Verbindung? Was hat er eigentlich gesagt?
Erst als ich am Fridhemsplan aussteige, denke ich daran. Strafvereitelung im Amt. Das ist es, dessen ich mich von diesem Moment an schuldig mache, wenn ich Grims Auftauchen für mich behalte, eine Straftat, wenn auch in den Reihen der Polizei nicht ungewöhnlich. Sehr oft kann man es wegerklären, aber fast ebenso häufig hat es schon zu Verurteilungen geführt – und zum Ende der Karriere. Was zum Teufel soll ich Birck sagen, was Morovi?
Und Sam? Ja … was soll ich Sam sagen?
Ich gehe kurz in den Seven Eleven und kaufe Eis und Zigaretten. Dann mache ich mich auf nach Hause in die Alströmergatan, wo ich mit dem Fahrstuhl in die dritte Etage fahre.
Wie man es auch immer betrachten will, die kahle Wohnung in der Chapmansgatan war nur ein Aufenthaltsort für einen einsamen Menschen. Ich war froh, als ich sie los war. Die Dreizimmerwohnung in der Alströmergatan haben Sam und ich vor einem halben Jahr gefunden. Sie hat große hohe Fenster, die ein warmes Licht hereinlassen. Das Parkett knarrt unter den Füßen, und aus dem offenen Kamin im Wohnzimmer duftet es zart nach Holz. Manchmal, wenn Sam und ich frei haben, gehen wir auf Auktionen und kaufen antike Gegenstände. Allmählich richten wir unser erstes gemeinsames Zuhause ein. Es fühlt sich gut an. So, wie es sein sollte.
Doch heute kehre ich mit einem Gefühl in der Brust nach Hause zurück, das an Scham erinnert.
»Du bist ja noch nicht im Bett«, sage ich. »Es ist schon nach elf.«
»Hm«, murmelt Sam, die unter einer Decke ausgestreckt auf dem Sofa liegt. »Ich bin aus Versehen eingeschlafen.« Sie rückt die Sofakissen unter ihrem Kopf zurecht. »Was hast du draußen gemacht?«
Die Lüge fällt mir weniger schwer, als sie sollte, und ich habe, ohne darüber nachzudenken, einen Entschluss gefasst.
»Ein spätes Verhör, das länger gedauert hat.«
Am liebsten will ich nicht daran denken.
Kit, unsere zweijährige Katze, bewegt sich an der Wand entlang und legt den Kopf schief, dann kommt sie an und streicht um meine Waden.
»Aber ich habe Eis gekauft.«
Sam lächelt schläfrig, fährt sich mit der Hand durchs Haar, reibt sich die Augen und setzt sich auf.
»Hol zwei Löffel.«
5 Die folgenden Tage sind anders und auch wieder nicht. Der Alltag bewegt sich in einem Takt, an den ich mich gewöhnt habe, und gleichzeitig hat sich doch alles verändert.
Ich schlafe schlechter als sonst und bin zerstreuter. Bei der Arbeit und in Sams Gegenwart vermeide ich es, das Handy hervorzuholen, obwohl die Wahrscheinlichkeit, dass er so kurz nach unserem Treffen wieder von sich hören lässt, klein ist. Ich weiß nicht, warum ich so sicher bin, aber ich bin überzeugt davon: Grim wird keinen Kontakt zu mir aufnehmen. Zwischen uns ist jetzt ein unsichtbares Band gespannt, ich kann es fast in den Händen spüren.
Gesprächsthemen, bei denen die Rede auf Grim kommen könnte, vermeide ich. Im Job fragen sie manchmal nach ihm, danach, was passiert ist. Ob ich etwas gehört hätte. Ich möchte nicht lügen müssen, das habe ich in den letzten Jahren schon so oft getan.
Und doch weiß ich, dass ich lügen werde, sollte mich jemand fragen. Grim hat einen unsichtbaren Keil zwischen Sam und mich getrieben, aber vielleicht war ich das auch selbst. Ich kann nicht begründen, weshalb ich ihn schütze, weshalb ich uns schütze. Aber er ist der Einzige, der mich je verstanden hat, glaube ich. Daran könnte es liegen. Er ist der Einzige, der mich wirklich kennt. Nun teilen wir wieder einmal ein Geheimnis.
Im Radio die Nachrichten: Eine Flüchtlingsunterkunft hat heute Nacht gebrannt, keine Tatverdächtigen. Kein Ende in Sicht im Syrienkrieg, eher im Gegenteil. Die Zahl der Flüchtlinge, die aus Kriegsgebieten nach Schweden kommen, steigt mit jeder Woche. Die Situation ist angespannt und die schwedische Grenzpolizei überfordert, sie hat um Verstärkung gebeten.
Hinterher werde ich mich an ebendas erinnern. War das ein Omen? Möglich.
Die Frau auf dem Foto. Ich kann nicht aufhören, an sie zu denken – und an Grim. Ob sich die Sache nur wegen Grim in meinem Kopf festgesetzt hat oder ob ich doch auch neugierig auf den Fall bin, das weiß ich nicht. Sie sind selten, diese Augenblicke, in denen man nicht genau erfassen kann, wessen Auftrag man gerade erledigt.
Eine einfache Suche kann eine Methode sein, die Gedanken zum Schweigen zu bringen. So begründe ich meine Entscheidung vor mir selbst, aber ich habe doch lange gezögert.
Am Morgen des dritten Tages suche ich im Register nach ihrem Namen.
Es geht um einen Mord in der Nacht zum 13. Oktober 2010, eine ergebnislose Ermittlung, die im Jahr darauf versandet ist und seither im Dornröschenschlaf ruht. Kurz nach dem kommenden Jahreswechsel, so stelle ich fest, soll die Angelegenheit nun einer Abteilung übertragen werden, die bisher bei der Landeskripo angesiedelt war und das schwedische Pendant zu den Cold-Case-Abteilungen der amerikanischen Polizei ist. In knapp zwei Monaten wird der Fall also nicht mehr bei uns sein.
Anja Morovi ist meine Chefin. Sie ist eine der besten Schützinnen der Stockholmer Polizei, hat einen Magister in Kriminologie und weiß, wie man ein Morddezernat leitet. Ihr Büro ist kleiner, als man erwarten würde, aber hübsch möbliert und hell. Vor einem großen Fenster erwacht der Stockholmer Morgen allmählich zum Leben, während sie auf einem Stuhl mit hoher Rückenlehne hinter dem Schreibtisch sitzt und eine Meldung auf dem Bildschirm betrachtet, die gerade mit einem kurzen Geräusch aufblinkt.
»Überfall in der Barnhusgatan«, murmelt sie. »An einem Freitagmorgen. Haben die Leute nichts Besseres zu tun?«
Ich setze mich und blicke auf den Plastikbecher mit Kaffee in meinen Händen. Bei der Sache hier gibt es nichts, was sich gut anfühlt.
Sie schaltet den Bildschirm aus und dreht sich zu mir.
»Sie wollten mit mir sprechen.«
»Ja …«
Ich zögere doch. Eine letzte Chance bleibt mir noch, die Aktion sein zu lassen. Das Büro zu verlassen und mir einzubilden, dass alles so wäre wie früher.
»Erinnern Sie sich an Angelica Reyes?«
»Ja.«
»Ich habe gesehen, dass der Fall bald übergeben wird.«
»Ja, da werden sich die Archiv-Heinis freuen.«
Morovi spielt auf die Leute an, die in dem großen Archiv für Ordnung sorgen, wo das Morddezernat und andere im Haus ihre ungelösten Fälle hinschicken. Seit mehreren Jahren liegt der Mord an Angelica Reyes da in einem ihrer Aktenschränke und setzt Staub an.
»Das ist schon in Ordnung, finde ich«, fuhr Morovi fort. »Zuletzt hat sich 2011 einer von uns mit dem Fall beschäftigt, wenn ich mich nicht täusche.«
»Ich dachte, dass ich vielleicht mal reinsehen könnte.«
»Sie? Haben Sie denn nichts anderes zu tun?«
»Ich würde vielleicht eine Woche brauchen.«
»Sie haben aber doch gar nicht an dem Fall mitgearbeitet, oder?«
»Im Großen und Ganzen nein.« Ich winde mich ein wenig auf dem Stuhl und trinke von dem Kaffee. »Aber das ist vielleicht grade gut.«
Morovi lehnt sich zurück und verschränkt die Arme vor der Brust.
»Dieses ganze Dezernat geht auf dem Zahnfleisch vor Überlastung, wir haben nicht einmal Zeit, die aktuellen Fälle vernünftig zu bearbeiten, und da wollen Sie sich einen vornehmen, der fünf Jahre alt ist?«
»Ja.«
»Aber warum? Warum Angelica Reyes?«
»Der Fall ist ungelöst. Es würde gut aussehen, wenn wir ihn endlich aufklären. So lange nichts Größeres passiert, könnte ich mich damit beschäftigen, und dann können Sie mich ja versetzen.«
Morovi zeigt ein schwaches Lächeln.
»Sie sind ein viel schlechterer Lügner, als Sie glauben. In einer Woche dürfen Sie mir erzählen, worum es hierbei wirklich geht.«
»Sie geben also Ihr Plazet?«
»Sie werden Hilfe brauchen, das Material ist zu umfangreich für zwei Augen. Nehmen Sie Gabriel. Aber Sie reden mit niemand anderem als mit mir darüber, offiziell setze ich Sie beide auf eines der Gewaltdelikte der letzten Nacht an. Es würde gut aussehen, wenn wir den Fall lösten, das kaufe ich, aber ich will nicht, dass Gerüchte entstehen, die Mordkommission würde versuchen, in letzter Sekunde ihr Gesicht zu retten. Auch wenn das die Wahrheit ist.«
Morovis Rechner macht wieder ein Geräusch. Sie verdreht die Augen und schaltet den Schirm ein.
»Räuberische Erpressung im Vanadislunden. Mein Gott, dass die Leute sich überhaupt die Mühe für so etwas machen.«
Ich erhebe mich von dem Stuhl und gehe zur Tür.
»Leo, hören Sie«, sagt Morovis Stimme hinter mir.
Ich drehe mich um.
»Ja?«
»Seien Sie vorsichtig. Ungelöste Morde sind Labyrinthe.«
6 Das gesammelte Material zum Fall Angelica Reyes ist in Kartons verpackt. Sie bedecken eine ganze Wand in dem großen Archiv, und auf jede Kiste hat jemand mit schwarzem oder rotem Filzstift die Ermittlungsnummer geschrieben. Ich streiche mit dem Finger über die Pappe, während ich im kalten Licht der Leuchtstoffröhren davorstehe.
Vielleicht versucht Grim, mich reinzulegen. Das wäre nicht verwunderlich. Dann würde ich in einen fünf Jahre alten Mordfall ohne Möglichkeit zur Aufklärung hineingezogen, in ein Labyrinth ohne Ausgang.
Ich finde die Kartons, die das früheste Ermittlungsmaterial enthalten, und lade sie auf eine Sackkarre, die ich zu einem der Arbeitszimmer im Archiv rolle. Es ist einer der moderneren Räume, und mit seinen Glastüren und den großen Fenstern wirkt er eher wie ein durchsichtiger Kubus. Da niemand wissen darf, dass wir uns nun mit dem Fall beschäftigen, ist es wahrscheinlich klug, sich vorerst hier unten aufzuhalten.
Der Arbeitskubus ist kalt und nur mit einem einfachen Holztisch und ein paar Stühlen möbliert. Ich setze mich auf einen und betrachte die Kartons. Das Vergangene kehrt in Fragmenten wieder.
Denn ich habe durchaus Erinnerungen an Angelica Reyes, auch wenn ich im Großen und Ganzen nicht mit dem Fall befasst war. Ich verhörte lediglich irgendeinen Zeugen und überprüfte hin und wieder ein Alibi. Das taten viele von uns, und wir waren alle froh, dass uns ein tieferes Einsinken in den Fall erspart blieb.
Es ist kurz vor zehn Uhr morgens an diesem Freitag, dem 7. November. Ich will auf Birck warten, aber irgendetwas an den Kartons zieht mich an. Eine plötzliche Ungeduld, ein Wunsch, mit der Arbeit zu beginnen.
Der Täter ist in der Ermittlung zu finden, darüber waren sich alle einig, das erinnere ich, obwohl die Kollegen nicht vom Fleck kamen. Einer der hundert, vielleicht tausend Namen gehört demjenigen, der Angelica Reyes tötete.
Vielleicht ist auch Grim dort vermerkt. Welche Verbindung hat er zu dem Angelica-Mord? Kannten sie einander? Vermutlich nicht, denn das hätte ich inzwischen herausgefunden. Warum muss er wissen, wer der Täter war?
Birck betritt den Glaskubus.
»Angelica Reyes?«, fragt er knapp. »Warum denn das? Und dann noch an einem Freitag.«
»Der Fall wird bald abgegeben. Morovi will, dass er gelöst wird.«
»Sie hat gesagt, es sei deine Idee.«
»Ich will auch, dass er aufgeklärt wird.«
»Warum denn?«
»Also … Ich bin Polizist. Reicht das nicht?«
»Aber warum ausgerechnet der Angelica-Mord?«
»Habe ich doch gesagt. Er wird bald übergeben. Fangen wir an?«
»Können wir das nicht auf Montag verschieben?«
»Nein.«
Und so beginnen wir mit der Arbeit.
7 Es fängt fast immer auf dieselbe Weise an, mit einer Leiche irgendwo, in diesem Fall in einem Haus. Eine nichts Böses ahnende Nachtstreife wird zum Ort des Geschehens gerufen und steigt aus dem Auto aus. Eben hat ein fieser Herbstregen eingesetzt, und sie beeilen sich, zum Haus zu kommen, für einen Besuch, den sie nie vergessen werden.
Binnen weniger Minuten, länger dauert es nicht, klingelt das Telefon in der Mordkommission, und in ebendieser Nacht auf den 13. Oktober 2010 steht jenes Telefon auf dem Tisch des Kriminalkommissars Charles Levin, meinem damaligen Chef.
Dem Einsatzbericht zufolge, den die erste Streife angelegt und ausgefüllt hat, kommt Levin fünfunddreißig Minuten nach Mitternacht an der Adresse John Ericssonsgatan 16 an. Weitere fünf Minuten vergehen, bis noch ein Beamter der Mordkommission, ein Kriminalinspektor, vor Ort ist.
Es ist ein kleines Glück, dass gerade Levin die ersten Maßnahmen einleitete. Alles verlief genau so, wie es sein sollte: Eine Absperrung wurde errichtet, die forensische Untersuchung der Wohnung von Angelica Reyes inklusive Videodokumentation sofort eingeleitet, und eine Abordnung Streifenpolizisten ging von Tür zu Tür und sprach mit potenziellen Zeugen in der Gegend. Verschiedene Ermittlungseinheiten wurden hinzugezogen, um Register zu prüfen und Bilder aus Überwachungskameras zu sichten, außerdem wurde ein Staatsanwalt mit dem Fall betraut, und – vor allem – es wurde alles aufs Sorgfältigste dokumentiert.
Birck und ich sind fünf Jahre und damit fast zweitausend Tage vom Kern der Ereignisse entfernt. Das ist für eine Mordermittlung ein enorm großer Abstand, und dennoch … sich in den Fall zu stürzen, ist ein Gefühl, als würde man auf ein Stück geschlitzten Stoff blicken. Jemand hat einen Spalt in die Zeit gerissen, und wenn man einen Finger hindurchsteckt und die Ränder dehnt, dann erhält man einen Blick auf eine andere Welt.
Die John Ericssonsgatan ist eine breite Straße im südlichen Teil von Kungsholmen. Sie ist so abschüssig, als wollte sie sich ins Wasser stürzen. Im unteren Teil sind die Fassaden renoviert, da gibt es Bars, Bäckereien und Balkone. Weiter oben sehen die Häuser nur von Weitem schön aus, die Treppenhäuser sind klobig und alt und viele der Wohnungen versifft und muffig. Hier sind die Mieten niedriger, und das nicht nur, weil man weiter vom Wasser entfernt ist. Viele der Häuser beherbergen Sozialamtsklientel.
In einem dieser Häuser lebt Angelica Reyes. Ihre Wohnung liegt im dritten Stock, ein Zimmer, Toilette und Küchenecke. Die Tür steht offen. Ein Polizist wartet auf der Schwelle, und ein anderer steht weiter auf Höhe des Bettes im Raum.
Da liegt sie.
Die Fotos der Forensiker zeigen sie auf dem Rücken liegend, die Arme und Beine seltsam abgewinkelt. Insgesamt dreiundzwanzig Verletzungen hat der Täter ihr zugefügt, dazu einzelne Stiche und Abschürfungen auf Oberarmen und Beinen und zahlreiche Abwehrverletzungen an den Händen. Getötet wurde sie durch vier tiefe Stiche in den Brustkorb und den Bauch, wo das Messer die Leber und eine Niere verletzt und ihren rechten Lungenflügel punktiert hat.
In dem Moment, in dem Levin die Wohnung betritt, ist Angelica erst seit einer knappen Stunde tot, und wenn man das Ermittlungsmaterial durchblättert, kann man fast spüren, wie er und nach und nach auch die anderen vor Ort mit ihm begreifen, dass der Tod noch ganz nahe ist. Es ist eine intime Szene.
Die Videodokumentation des Tatortes wird ein paar Minuten vor ein Uhr begonnen und von einem Techniker durchgeführt. Birck und ich sitzen da, jeder von uns eine Tasse Kaffee in der Hand, und starten den Film.
»Seltsam«, sage ich, »das fühlt sich anders an.«
»Du meinst, verglichen mit den Fotos?«
Ja. Die unbewegten Bilder von einem Tatort frieren die Zeit ein. Bewegliche Bilder hingegen ziehen sie unnatürlich in die Länge. Es fühlt sich merkwürdig an, eine fünf Jahre alte Wirklichkeit zu betrachten, so als würde man den Traum eines Fremden miterleben.
»Einstiche in den Armen«, hört man Levin aus dem Inneren der Wohnung sagen.
Wir stehen auf der Schwelle. Die Kamera ist soeben eingeschaltet worden und wackelt, ehe sie fest steht. Im Hintergrund telefoniert jemand, eine Frauenstimme gibt die Personennummer von Angelica Reyes durch. Irgendwo in der Wohnung wurde ein Radio eingeschaltet und spielt Be my baby von den Ronettes. Schemenhaft ist das Fenster zu sehen, eine Straßenlaterne zu erahnen, der Regen draußen.
»Aber die Stiche sind sehr alt«, fährt Levin fort. »Ich werde den Gerichtsmediziner bitten, sich die Kniekehlen und die Leiste der Leiche anzusehen. Vielleicht hat sie aufgehört zu fixen. Seht hier, Abwehrverletzungen an Händen und Armen. Massenhaft.«
Der Flur ist schmal und kurz, links eine Hutablage mit Haken für Jacken und Mäntel, darauf ein Durcheinander von Schals und Handschuhen. Auf dem Fußboden davor liegt ein schmutziger Teppich mit stark abgenutzten Stiefeln, hellen Sneakers und drei oder vier Paar Schuhen mit Absätzen, eines davon mit schweren Keilabsätzen aus Holz.
Direkt rechts ist das Badezimmer und am Ende des Flurs das einzige Zimmer. Einen Teil der linken Wand nimmt eine Küchenecke mit Kochplatten und Mikrowelle ein. Der Rest der Wand ist von einem schwarzen Bücherregal mit einzelnen Büchern, Fotografien und einer verwelkenden Topfpflanze bedeckt. Mitten im Zimmer steht eine kleine Sitzgruppe aus grauem Stoff, doch momentan schert sich niemand darum. Entlang der rechten Wand steht nämlich das Bett, und auf dem liegt Angelica Reyes, genau wie auf den Fotos, und doch irgendwie anders.
»Entschuldigung«, hört man Levin außerhalb des Bildes sagen, er macht der Kamera des Technikers Platz, »können wir das Radio ausschalten?«
»Noch nicht«, antwortet jemand. »Bis dahin sind wir noch nicht gekommen.«
Neben dem Bett steht ein Nachttisch mit einer Lampe. Auf dem Tisch liegen eine Ausgabe der Vogue, der Film Easy Cash, ein rotes Päckchen Marlboro, ein Feuerzeug und etwas, das aussieht wie um die zweitausend Kronen in Hundertern und Fünfhundertern.
Die Kamera betrachtet Angelica Reyes’ Leiche aus so großer Nähe, dass man den Blick senken möchte. Jetzt klingelt ein Handy im Hintergrund. Der Gerichtsmediziner kommt. Es ist fünf nach eins in der Nacht des 13. Oktober.
Das einzige Fenster der Wohnung geht zur John Ericssonsgatan hinaus, und dadurch ist das Haus zu erahnen, darüber ein dunkler, bewölkter Streifen Himmel. Kein Mond.
Ich betrachte die Blutspritzer auf dem Bett, auf dem Fußboden, auf der Haut des Opfers. Was zum Teufel sollte Grim mit all dem zu tun haben?
Vor uns, auf dem Tisch neben dem Computer, liegen Unterlagen des einleitenden Materials, und mein Kollege studiert mit müdem Blick die Ordner, Mappen und Reports und fragt, wie wir uns denn dieser Sache annehmen sollen und wo wir anfangen.
So weit habe ich irgendwie nicht gedacht.
»Wir folgen wohl am besten dem Weg, den die Ermittlung genommen hat, damit wir wissen, was die Kollegen gemacht haben und was nicht. Wenn der Weg uns auch ins Nichts führt, dann müssen wir zurückgehen und überprüfen, was sie übersehen haben.«
Birck nickt mutlos.
»Was ist?«, frage ich.
»Wie sollen die etwas übersehen haben? Schließlich hat Levin die Ermittlung geleitet.«
»Wenn nicht, dann hätten sie den Täter festgenommen.«
»Schon, aber …«
»Ich weiß, was du meinst.«
»Okay. Mehr begehr ich nicht.« Er lacht müde. »Levin trifft also in der Nacht des 13. Oktober um fünf nach halb eins vor Ort ein. Wann kriegen sie raus, wer sie ist?«
»Das wissen sie sofort. Angelica war uns von früher bekannt.«
»Es muss in den Akten eine Biografie oder Ähnliches geben«, meint Birck. »Kannst du die mal raussuchen?«
Ich erhebe mich und wühle mich durch den Rest des ersten Kartons. Birck hebt die andere Kiste auf den Tisch und öffnet sie, und da, unter einer Sammlung Ordner, in denen die Verhöre mit den Angehörigen gesammelt sind, liegt sie und wartet: die Geschichte von Angelica Reyes.
8 Wer war sie? Das ist das Seltsame mit den Toten, dass sie nicht für sich selbst sprechen können. Die Geschichte ihres Lebens muss von Registereinträgen, Berichten und durch die Zeugenaussagen der Menschen, mit denen sie in der einen oder anderen Weise in Beziehung standen, erzählt werden.
»Geboren 1986«, liest Birck aus der Biografie vor, »in Santiago, Chile. Einziges Kind. Im Alter von drei Jahren kommt sie mit der Familie nach Stockholm in eines der Hochhäuser draußen in Hallunda. Der Vater wird Mechaniker in einer Firma in Farsta, die Mutter Putzfrau im Krankenhaus Huddinge.«
Hallunda kann eine harte Umgebung für ein kleines Kind sein, aber Angelica Reyes kommt gut zurecht. Sie hat früh lesen und schreiben gelernt, die Lehrer berichten von ihren schulischen Leistungen, ihrer Begabung, der Freude am Unterricht. In der Unter- und Mittelstufe war sie sehr fleißig. Außerdem war sie großzügig mit ihrem Wissen, das erwähnen mehrere Lehrer.
»Hör dir das an«, sagt Birck und klopft mit der Fingerspitze auf das Papier. »Sie schreiben: ›Die Kinder mussten regelmäßig die Plätze wechseln, und man konnte erkennen, wie der Banknachbar, den Angelica Reyes jeweils hatte, von ihr bestärkt wurde. Die schulischen Leistungen eines Kindes verbesserten sich in der Zeit, in der es neben Angelica saß.‹«
Birck sieht von dem Papier auf.
»Schön«, erwidere ich. »Und ein bisschen traurig.«
Sie trainierte Gymnastik im örtlichen Verein und wurde auch einmal Dritte in einem Wettkampf. Angelica träumte davon, Stewardess zu werden. Ein seltsamer Traum für ein Mädchen aus den Hochhäusern von Hallunda, mag man meinen, doch vielleicht war es gar nicht so seltsam. Angelica Reyes wollte die Welt sehen. Außerdem entwickelte sie als Teenager eine Abenteuerlust, die sie nie wieder verließ.
Es ist schwer, nach so langer Zeit die schrittweise Veränderung nachzuverfolgen, eigentlich kann man sie nur erahnen. Die Abenteuerlust bleibt stark, scheint sich aber im Lauf der Jahre anders auszudrücken. Ein Freund erzählt, Angelica habe schon als Fünfzehnjährige gern Marihuana geraucht. Ist das wahr? Vielleicht. Man muss es annehmen.
Etwas später hören Birck und ich die Audioaufnahmen an, die den Kern der Ermittlungsprotokolle darstellen. Offenbar hielt man sie für wichtig. Die Verhöre sind als digitale Audiodateien auf einem Stick gespeichert, und Birck klickt sich mit verwirrter Miene hindurch.
»Hier herrscht Unordnung«, murmelt er. »Verdammt, ich finde gar nichts. Das kann nicht das Werk von Levin sein.«
»Ist es auch sicher nicht«, erwidere ich. »Er mochte keine Computer. Vermutlich hat sich darum irgendein Assistent gekümmert.«
Auf den Audiodateien sprechen Menschen über Angelica Reyes, und sie schildern, wie sich Angelica, als sie ins Teenageralter kam, verändert hat, wenngleich diese Veränderung anscheinend nur schwer zu präzisieren war:
»Sie wurde, also, wissen Sie«, sagt einer ihrer Klassenkameraden aus der Mittel- und Oberstufe aus, »ja, irgendwann lief sie aus dem Ruder. Bis zur sechsten Klasse war alles gut. Aber dann fing sie an zu rauchen, also Zigaretten, meine ich, und zu trinken. Ging mit älteren Typen auf Feste und so. Sie hat wie blöd geschwänzt, wissen Sie, und schon bald stand sie jeden Tag auf dem Raucherhof, wenn sie überhaupt in der Schule war. Dann, so in der Siebten oder Achten, passierte etwas. Sie behauptete, sie wäre auf einem Fest gewesen und dort von zwei Typen vergewaltigt worden. Das war wahrscheinlich die Sache, die das Fass zum Überlaufen brachte, oder wie man das sagen soll, weil ihr nämlich keiner glaubte. Zu der Zeit waren schon so viele Gerüchte über sie im Umlauf. Sie sei eine Hure, eine Schlampe, sie sei dieses und jenes. Möglicherweise hatte sie Sex mit denen gehabt, aber eine Vergewaltigung? Da lachten alle bloß. Sie zeigte die Typen nicht an, schließlich stand Aussage gegen Aussage, und als ein paar Monate später herauskam, dass sie immer noch mit ihnen rumhing, also den Typen, die sie vergewaltigt haben sollten, dass sie mit denen Zeug rauchte und sogar manchmal bei einem von ihnen übernachtete, da war das für uns die Bestätigung, dass es nie eine Vergewaltigung gegeben hat. Wer zum Teufel hängt denn mit Leuten ab, die einen vergewaltigt haben? Aber wenn sie nicht vergewaltigt wurde, wer zum Teufel beschuldigt denn zwei unschuldige Personen eines solchen Verbrechens? Sie musste krank im Kopf sein, dachten wir. Und sie suchte Aufmerksamkeit, die war ihr am wichtigsten.«
Der Klassenkamerad auf dem Band verstummt, doch dann fügt er hinzu: »Ich habe damals nicht so viel darüber nachgedacht. Aber heute wird mir klar, dass sie in der Situation wahrscheinlich außer diesen Typen nicht so viele andere Leute hatte, an die sie sich wenden konnte.«
Birck betrachtet den Computerbildschirm.
»Pfui Teufel.« Er wendet sich dem übrigen Material zu. »Ist die Vergewaltigung dokumentiert?«
Ist sie nicht. Es gibt keine Anzeige und auch keine Zeugenaussagen dazu, lediglich die Gerüchte. Ein Verbrechen, das versickert, wie so viele andere.
Die Eltern waren bald mit Angelica überfordert und bekamen umfassende Unterstützung vom Jugendamt, jedoch ohne Erfolg. Das Mädchen entwickelte eine Tablettensucht und wurde im September 2003 zu einer Zwangseinweisung nach Jugendrecht verurteilt. Als sie ein paar Monate später rauskam, schien ihr Leben genauso weiterzugehen wie bisher.
Laut Informationen der Sitte in Stockholm begann sie, immer mehr Alkohol und Tabletten zu konsumieren.
»Herbst 2007«, lese ich vor. »Sie kommt in die Ausnüchterung, und danach kontaktiert man die Sozialfürsorge, die schreibt: ›Reyes gibt an, seit einiger Zeit keinen festen Wohnsitz zu haben, sondern bei Freunden und Bekannten zu wohnen. Die betreffenden Personen sind der Sitte als Prostituierte und der Zuhälterei Verdächtige bekannt.‹«
»So eine Überraschung«, ätzt Birck.
Die weiteren Runden in Angelica Reyes Leben kann man sich fast ausrechnen: Sie wird wegen Drogenbesitzes verurteilt, dann in einer Wohnung angetroffen, die der Sitte seit Langem als Bordell bekannt ist, und wieder eingewiesen. Sie macht eine Therapie wegen ihres Tablettenmissbrauchs, kombiniert aber bald Kokain mit Heroin, laut Behandlungsbericht ein sogenanntes Speedballing. Irgendwo auf diesem Weg gelingt es ihr durch ihren Sozialbetreuer, der unzählige Male im Zusammenhang mit dem Mord gehört wird, eine Wohnung in der John Ericssonsgatan 16 zu ergattern, eine Anschrift, unter der sie am 1. März 2009 gemeldet wird.
An dieser Anschrift, in ihrem Bett in der Wohnung, wird sie in der Nacht zum 13. Oktober 2010 erstochen aufgefunden.
Hallunda, Norsborg, Salem. Unterschiedlich, und auch wieder nicht, und ich erkenne mich in Angelica Reyes’ Biografie wieder. Ich kann uns da erkennen, sehe, wie Grim und ich uns sozusagen in den Kulissen der Ereignisse bewegen. Wir sind ein wenig älter, aber nicht viel.
Ich denke an Angelica Reyes, wie sie dreizehn oder vierzehn ist und vergewaltigt wird. Das waren genau die Geschichten, die man draußen bei uns über Leute hörte, denen es übel erging. Und schlechte Witze. Etwa wenn jemand sagte, der Wappenvogel des Landes Norsborg sei ein fucking Polizeihelikopter. Die Leute lachten. Ein anderer, etwas gebildeter als seine Kumpels, verstand den Scherz nicht und meinte: »Norsborg ist doch kein Land, du Idiot.«
»Okay«, sagt Birck abschließend. »Sie kapieren also umgehend, dass sie es mit einer toten Prostituierten zu tun haben. Und das Geld auf ihrem Nachttisch, zweitausend Kronen, deutet darauf hin, dass sie kürzlich einen Kunden hatte. Deshalb glauben sie, nach einem Freier suchen zu müssen.«
»Oder nach einem Zuhälter.«
»Der Täter ist fast nie der Zuhälter. Für den sind die Frauen viel zu wertvoll. Ich wette auf einen Freier. Er bezahlt, und Reyes legt das Geld auf den Nachttisch. Dann geht es los, bis etwas passiert, weswegen der Freier durchdreht.«
»Zum Beispiel?«
»Nun, was kann man sich denn denken? Dass er lange braucht, um ihn hochzukriegen, und Reyes ihn darauf hinweist? Vielleicht fasst er das als höhnisch auf, mehr braucht es nicht. So was geschieht ziemlich oft, denke ich mir, dass sie es nicht bringen, wenn sie mal die Chance kriegen. An diesem Abend hat Angelica aber das Pech, auf einen Freier zu treffen, der zu Gewalttätigkeit neigt und sich einbildet, dass der Beweis seiner Männlichkeit von dem Wurm zwischen seinen Beinen abhängt.«
»Das war wohl in etwa die Arbeitshypothese der Kollegen«, bestätige ich und blättere in dem vor uns liegenden Material, auf der Suche nach der Aktennotiz der Personenüberwachung, die vor der ersten Zusammenkunft der Ermittlergruppe verfasst wurde.
»Vermutlich, weil sie recht hatten. Das ist in solchen Fällen fast immer so. Es ist ihnen nur einfach nicht gelungen, den richtigen Freier zu finden. Das hier ist, und es ist zwar politisch nicht korrekt, sich so auszudrücken, aber darauf scheiße ich, ein typischer Hurenmord, den sie unglücklicherweise zufällig nicht lösen konnten …« Er sieht mich an. »Aber du glaubst das nicht…«
»Ich weiß nicht.« Ich höre auf zu suchen und sehe auf die Uhr. »Mittagspause.«
»Genau, ich werde mit einem Bekannten aus der Rechtsmedizin zu Mittag essen. Er ist ein Teufel in Sachen DNA, vielleicht kann er uns in dieser Sache helfen.« Er stößt ein sarkastisches Lachen aus. »Ich meine, wir brauchen schließlich jede Hilfe, die wir kriegen können. Was wirst du tun?«
Ich werde mich mit Sam treffen.
9 Man muss lernen zusammenzuleben, denke ich, als ich ihr gegenüber an einem der Fenstertische im Mäster Anders sitze und die Mittagspause zur Hälfte verstrichen ist. Wenn man das hinbekommt, dann kann man alles bewältigen, glaube ich.
Wenn man lernt, mit jemand anderem zu leben. Das ist das eigentlich Schwierige.
»Ich meine nicht, dass wir jetzt sofort Kinder haben müssen«, sage ich, »aber wir sollten vielleicht darüber sprechen.«
»Wir haben bereits darüber gesprochen.«
»Willst du nicht?«
Sam schiebt sich ein Stück Schnitzel in den Mund und kaut langsam.
»Ich war es ja, die das Thema zur Sprache gebracht hat.«
»Genau. Und was hat sich verändert?«
»Ich …« Sie trinkt von ihrem Leichtbier. »Ich weiß nicht.«
»Hat es mit mir zu tun?«
»Deine Schuhe mochte ich einfach noch nie.«
»Meine Schuhe?«
Sie lacht auf.
»Das war ein Witz.«
»Wahnsinnig lustig.«
»Tut mir leid.« Sie greift nach meiner Hand. Ihre Handfläche ist warm und weich. »Ich mache Witze, wenn ich nervös werde.«
»Ich weiß.«
Tatsächlich war sie es, die Kinder zur Sprache brachte. Deshalb haben wir uns schließlich Kit angeschafft, die Katze, die im Grunde genommen nur zu einem gut ist, nämlich rumzuwandern und teilnahmslos auszusehen. Der Gedanke dahinter war, so glaube ich, zu testen, ob wir gemeinsam Verantwortung für ein lebendigeres Wesen als Zimmerpflanzen übernehmen können. Am Anfang hat mich sogar diese Idee erschreckt, aber seit einiger Zeit, warum auch immer, hat sich irgendwas verändert. Irgendwas in mir.
Ende des Sommers haben wir eine Woche in Athen verbracht. Wir wollten in der Sonne liegen, baden und die antiken Stätten der Stadt besuchen, die Kunst und die Architektur bewundern. Aber dann havarierte die griechische Wirtschaft, und kurz darauf kamen die Berichte über die Flüchtlingskatastrophen im Mittelmeer. Wir konnten die Reise nicht stornieren, also beschlossen wir, trotzdem zu fahren und zu sehen, ob wir irgendwie helfen könnten. Wir verteilten Spielzeug und Wasserflaschen an die wenigen Flüchtlingsfamilien, die wir sahen, doch genau das war das eigentlich Unangenehmste: dass wir fast keine Flüchtlinge sahen. Man bemerkte sie nicht. Sie waren auf dem Festland angekommen und plötzlichweg.
Eine Stadt zu besichtigen, in der Menschen auf diese Weise verschwanden, war nicht gerade erhebend, weshalb wir den größten Teil der Zeit im Hotelzimmer blieben und Sex hatten. Nach einer Runde kam Sam mit besorgter Miene von der Toilette, der schlanke, tätowierte Körper nackt und glänzend von Schweiß.
»Ich glaube, ich habe einen Eisprung«, sagte sie.
Den Rest der Zeit in Athen lief ich mit einem unnennbaren Gefühl herum, das sich in meiner Brust regte. Aber sie wurde nicht schwanger, was sie erleichtert aufnahm, während ich … nun ja, was empfand ich? Nicht Enttäuschung, das wäre das falsche Wort. Ich weiß …
»Was machst du eigentlich gerade?«, fragt Sam und schneidet meinen Gedankenfluss ab. »In der Arbeit, meine ich.«
»Haben wir jetzt genug über Kinder geredet?«
»Leo. Gib mir ein bisschen Zeit. Was ist bei dir gerade los?«
»Ich sitze an einem alten Fall. Der soll bald in die Cold-Case-Abteilung verschoben werden, und wenn das geschieht, wird Morovi es als persönliche Niederlage betrachten. Eine Woche haben wir, um ihn zu lösen.«
»Und wer hatte ihn ursprünglich?«
»Levin.«
Sams Mund formt sich zu einem kleinen O. »Verstehe«, sagt sie.
Wir essen weiter und sprechen weder von Kindern noch von der Arbeit. Das ist schön, aber ich bin trotzdem etwas deprimiert. So lange Zeit habe ich in Levins Nähe gearbeitet, erst im Morddezernat und danach, während er kurz Leiter der Abteilung Interne Ermittlungen war, und trotzdem gibt es so viel, das er nie erzählt hat.
Und dann ist er gestorben.
Nachdem Charles Levin voriges Jahr in Pension ging, verließ er Stockholm ohne ein Wort, und niemand wusste, wo er sich aufhielt, bis er in einem Haus unten in dem kleinen Ort Bruket, von einem Schuss in die Schläfe getroffen, tot aufgefunden wurde. Alte Geheimnisse hatten ihn eingeholt, und ich wurde in das alles verwickelt, obwohl ich streng genommen nichts damit zu tun hatte. Ein Haufen Lügen und Verbrechen wurden um meinen alten Chef herum sichtbar, und ich wusste nicht mehr, was Wahrheit war und was nicht. Im Zusammenhang mit der Ergreifung des Täters landete ich im Krankenhaus, und dort verschwand dann Grim.
In jenen Sommertagen füllten Aftonbladet, Expressen und Dagens Nyheter ihre Seiten mit der groß angelegten Jagd auf den entwichenen John Grimberg. Mehrmals hörte ich das Knattern von Rotorblättern vor dem Fenster meines Krankenhauszimmers, bildete mir ein, dass es mit dem Tönen eines Martinshorns vermischt sei, und jedes Mal musste ich doch einsehen, dass die Rotorblätter wirklich waren, das Martinshorn aber doch nur in meinem Kopf ertönte. Eine fieberhafte Suche begann, Hunderte von Polizisten im Großraum Stockholm hatten den Auftrag, Grim zu finden. Sie überwachten den Hauptbahnhof, die Flughäfen Arlanda und Bromma und setzten alles von Hunden bis Telegrafenmasten ein, doch ohne Erfolg.
Ich selbst lag in meinem Krankenhausbett und lächelte, wenn niemand mich sah. Und Grim blieb verschwunden, keinen Laut hörte ich von ihm.
Mein Gott, ich muss es ihr erzählen.
»Es gibt da eine Sache, die ich dir, glaube ich …«
»Ich habe gar nicht so viel Hunger«, unterbricht sie mich.
»Öh. Nein, ich auch nicht.«
»Außerdem wohnen wir ganz in der Nähe«, fährt sie fort. »Und ich muss erst in einer halben Stunde wieder in die Galerie.«
»Ja?«, frage ich, verwirrt und mit den Gedanken woanders.
»Leo.« Sie beugt sich über den Tisch. »Ich würde jetzt gern zu uns nach Hause gehen, damit du mich ficken kannst.«
Als ich hinterher ins Haus zurückkehre, sieht Birck mich fragend an.
»Was ist denn mit dir passiert? Du siehst fast high aus.«
»Wie war das Mittagessen mit der Rechtsmedizin?«
»Offenbar nicht so gut wie deines.«
10 Das Arbeitszimmer unten im Archiv kommt uns bald wie eine andere Welt vor. Über der Erde ist es November, und man schreibt das Jahr 2015, aber hier unten innerhalb der Glaswände ist es Oktober 2010: Der Serienvergewaltiger in Örebro ist festgenommen, und überall hört man Robyns Dancing on my own, Eminem und Rihannas Love the way you lie. Die Wahlen zum Schwedischen Reichstag sind erst einige Wochen her. Und die Finanzkrise liegt wie eine nasse Decke auf dem Globus.
In diese Welt trifft die Nachricht von dem Mord an der Prostituierten Angelica Reyes, und sie berührt sie nur vorsichtig, unscheinbar. Am ersten Tag eine halbe Seite in der Zeitung, am nächsten eine Kolumne. Am Tag drei gibt es eine Notiz, am vierten Tag nichts. Angelica Reyes ist vergessen.
Nach dem Wochenende arbeiten Birck und ich vom frühen Morgen bis in den späten Abend an dem Fall, tagein, tagaus. In der Ermittlung sind keine Fehler oder falschen Entscheidungen auszumachen. Und doch genügt das nicht.
Was den Tatort angeht, so offenbart er weniger, als man gehofft hatte. Das hätte die Ermittler nervös machen sollen, doch ihr Verhalten weist keinerlei Anzeichen von Nervosität auf, jedenfalls nicht zu Anfang.
Auf dem Teppich, im Bett und auf Angelica Reyes’ Bauch in Höhe des Bauchnabels finden sich einige Textilfasern. Sie stammen wahrscheinlich vom Täter, können aber nicht mit einer Person oder einem Kleidungsstück verknüpft werden. Des Weiteren gibt es eine Ansammlung von Blutspritzern, die von jemand anderem als dem Opfer stammen. Auch sie werden dem Täter zugeschrieben, doch wiederholte Durchläufe durch das DNA-Register ergeben nur Schweigen.
Was sie voranbringen sollte, ist das Handy. Es gehört Angelica Reyes und wird in den frühen Morgenstunden des 13. Oktober im Kronobergsparken, nicht weit von Angelicas Wohnung entfernt, gefunden. Eine Mutter und ihre fünfjährige Tochter durchqueren auf dem Weg zur Kindertagesstätte den Park, als die Tochter stehen bleibt und ein Handy von der Erde aufhebt. Schon bald wird es bei der Polizei abgegeben, abgeschaltet und schmutzig, vom nächtlichen Regen zerstört. Keine Fingerabdrücke, aber Spuren von Blut. Es ist das von Angelica.
Der Puls steigt. Der Kronobergsparken wird auf der Suche nach technischen Beweisen abgesperrt, doch man findet nichts. Der Regen hat zusammen mit den Hunderten, vielleicht Tausenden von Leuten, die seit dem Tag des Mordes in der Gegend unterwegs waren, die wenigen Spuren, die man vielleicht hätte finden können, zerstört.
Ein ungewöhnliches Detail in der Wohnung zieht jedoch die Aufmerksamkeit auf sich, und zwar handelt es sich um einen kleinen USB-Stick, schwarz, matt und ohne Deckel. Er enthält zweiundsiebzig Kinderbilder, von 1986 bis 2001, viele von ihnen eingescannt. Angelica Reyes, mit Wurzeln von Santiago bis Hallunda: Fotos aus einem sonnigen Chile, eine lächelnde Familie irgendwo in einem Innenhof, auf einem anderen Bild ist man im Haus und ein knubbeliges kleines Kind krabbelt über den Boden, Bilder von einer ersten Fahrradfahrt mit Stützrädern, ein Familienessen, dann – plötzlich – ist man in Schweden. Man erkennt es an dem Licht, es ist kälter und weniger drückend. Es folgen Momente aus einer Jugend in Betonlandschaften, Hochhäuser in Reihen, ein Schulabschlussfest, bei dem Angelica Reyes lacht und weiße Zähne zeigt. Sie hat eine leichte Akne. Es ist das Jahr 1998. Nur selten ist sie allein auf den Bildern, man kann nur schwer erahnen, was geschehen wird. Vielleicht im Blick, eine Sehnsucht in die Ferne?
Die Gespräche mit der Familie ergeben nicht mehr als das: 2006 ist Angelica in der Wohnung der Eltern das Fotoalbum durchgegangen, hat dann ein paar Bilder herausgenommen und sie digitalisieren lassen. Sie sagte, sie wolle sie bei sich tragen können. Nachforschungen bestätigen das, sie hat den USB-Stick in ihrer Handtasche aufbewahrt.