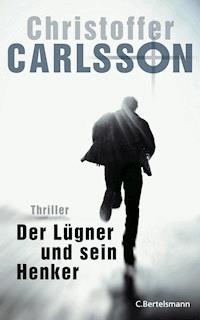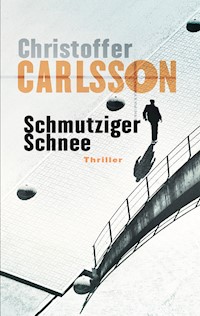9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Halland-Krimis
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Im Februar 1986 erhält die Polizei einen Anruf von einem Mann, der behauptet, eine Frau außerhalb der Kleinstadt Tiarp vergewaltigt zu haben. Ich werde es wieder tun, sagt er, bevor die Leitung unterbrochen wird. Schweden steht nach dem Mord an Ministerpräsident Olof Palme in der gleichen Nacht unter Schock. Für den Polizisten Sven Jörgensson und seinen Sohn Vidar wird dies eine entscheidende Zeit in ihrem Leben sein. Während Vidar versucht, seinen Weg durch die Pubertät und in den Beruf seines Vaters zu finden, ist Sven von dem Fall besessen, der ihn für den Rest seiner Karriere verfolgen wird. Zwei weitere junge Frauen fallen dem Tiarp-Mann zum Opfer, ohne dass die Polizei ihn aufhalten kann. Dann wird Sven krank und stirbt, der Fall bleibt ungelöst. Jahrzehnte später taucht die Geschichte über die brutalen Morde unerwartet wieder auf, als dem ehemaligen Polizisten Vidar Jörgensson zugeschrieben wird, den Fall des gefürchteten Tiarp-Mannes endlich aufgeklärt zu haben. Doch bald wird klar, dass nicht alles so ist, wie es scheint. Es braucht den unerbittlichen Verstand eines heimgekehrten Schriftstellers, um die komplizierten Familienbande zurückzuverfolgen, die Teile des Puzzles zusammenzusetzen. Dabei deckt er langsam Schichten der Wahrheit über ein Verbrechen auf, auf das es keine einfachen Antworten gibt. «Was ans Licht kommt» ist ein elegant konstruierter Kriminalroman über Schuld und Verantwortlichkeit, in dem eine Besessenheit vom Vater an den Sohn weitergegeben wird. Der meisterhafte Stilist und angesehene schwedische Kriminologe Christoffer Carlsson spielt mit dem Genre, als wäre der Roman ein fiktionalisiertes True-Crime-Drama, das seinem namenlosen Autor erlaubt, die Ereignisse der Vergangenheit neu zu erfinden. Die Jagd nach der Wahrheit dient als Motor in dieser umfangreichen und komplexen Erzählung über Verzweiflung und Selbstbetrug und letztlich den Willen, in einer Welt voller Dunkelheit nach Licht zu suchen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 549
Ähnliche
Christoffer Carlsson
Was ans Licht kommt
Kriminalroman
Über dieses Buch
Im Februar 1986 erhält die Polizei einen Anruf von einem Mann, der behauptet, eine Frau außerhalb der Kleinstadt Tiarp vergewaltigt zu haben. Ich werde es wieder tun, sagt er, bevor die Leitung unterbrochen wird. Schweden steht nach dem Mord an Ministerpräsident Olof Palme in der gleichen Nacht unter Schock.
Für den Polizisten Sven Jörgensson und seinen Sohn Vidar wird dies eine entscheidende Zeit in ihrem Leben sein. Während Vidar versucht, seinen Weg durch die Pubertät und in den Beruf seines Vaters zu finden, ist Sven von dem Fall besessen, der ihn für den Rest seiner Karriere verfolgen wird. Zwei weitere junge Frauen fallen dem Tiarp-Mann zum Opfer, ohne dass die Polizei ihn aufhalten kann. Dann wird Sven krank und stirbt, der Fall bleibt ungelöst.
Jahrzehnte später taucht die Geschichte über die brutalen Morde unerwartet wieder auf, als dem ehemaligen Polizisten Vidar Jörgensson zugeschrieben wird, den Fall des gefürchteten Tiarp-Mannes endlich aufgeklärt zu haben. Doch bald wird klar, dass nicht alles so ist, wie es scheint. Es braucht den unerbittlichen Verstand eines heimgekehrten Schriftstellers, um die komplizierten Familienbande zurückzuverfolgen, die Teile des Puzzles zusammenzusetzen. Dabei deckt er langsam Schichten der Wahrheit über ein Verbrechen auf, auf das es keine einfachen Antworten gibt.
«Was ans Licht kommt» ist ein elegant konstruierter Kriminalroman über Schuld und Verantwortlichkeit, in dem eine Besessenheit vom Vater an den Sohn weitergegeben wird. Der meisterhafte Stilist und angesehene schwedische Kriminologe Christoffer Carlsson spielt mit dem Genre, als wäre der Roman ein fiktionalisiertes True-Crime-Drama, das seinem namenlosen Autor erlaubt, die Ereignisse der Vergangenheit neu zu erfinden. Die Jagd nach der Wahrheit dient als Motor in dieser umfangreichen und komplexen Erzählung über Verzweiflung und Selbstbetrug und letztlich den Willen, in einer Welt voller Dunkelheit nach Licht zu suchen.
Vita
Christoffer Carlsson, geboren 1986, wuchs an der Westküste Schwedens auf und promovierte an der Universität Stockholm in Kriminologie. 2012 wurde er mit dem Young Criminologist Award ausgezeichnet. Carlsson arbeitet als Professor für Kriminologie in Stockholm. Für seinen Debütroman «Der Turm der toten Seelen» erhielt er 2013 als jüngster Preisträger mit 27 Jahren den Schwedischen Krimipreis. Sein Roman «Unter dem Sturm» war 2019 für den Schwedischen Krimipreis nominiert und stand auf Platz 1 der schwedischen Bestsellerliste, ebenso sein aktueller Roman «Was ans Licht kommt».
Ulla Ackermann studierte Skandinavistik, Germanistik und Anglistik in Münster/Westfalen und Lund. Nach dem Studium lebte sie mehrere Jahre in Stockholm. Seit 2015 arbeitet sie als freie Übersetzerin in Kiel und übersetzt vorwiegend Belletristik aus dem Schwedischen und Norwegischen. Unter anderem gehören die Kriminalromane von Anna Tell, Bo Svernström und Anders Roslund zu den von ihr übertragenen Titeln.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 2021 unter dem Titel «Brinn mig en sol» bei Albert Bonniers Förlag, Stockholm.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, August 2022
Copyright © 2022 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
«Brinn mig en sol» Copyright © 2021 by Christoffer Carlsson
Redaktion Justus Carl
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Covergestaltung und -abbildung Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
ISBN 978-3-644-00623-2
www.rowohlt.de
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Für Ida
Ein jegliches hat seinen Platz.
Ein jegliches hat seine Zeit.
Das Leben hat seine Zeit und das Sterben.
Der Sommer und der Winter.
Anpflanzen, Ernten.
Träumen, Wachen,
Aufbrechen und Heimkehren.
Der kälteste aller Winter hat seine Zeit,
der Sommer und die Wärme,
und die stürmischste aller Verliebtheiten
und die Liebe haben ihre Zeit.
Entfache mir eine Sonne bei Nacht,
du, welcher mir Dunkelheit schenken soll.
Elsa Grave
IRückkehr
Halland, 2019
1.
Es war der Sommer, in dem Evy Carlén schwer erkrankte und verstand, dass sie bald sterben würde, als sie mir anvertraute, dass sie wusste, was Sven Jörgensson und seinem Sohn Vidar oben in Tiarp widerfahren war.
Wir kannten uns erst einige Wochen. Ich wusste, dass Evy Polizistin gewesen und ein paar Jahre nach ihrer Pensionierung in das Haus nahe Tofta gezogen war. Ihr Mann Ronnie lebte nicht mehr, und als Witwe widmete sie ihre freie Zeit dem hübschen Garten rings um ihr Haus. Es lag etwas weiter oben im Wald. So begegneten wir uns.
Seit meiner Rückkehr lebe ich sehr zurückgezogen. So möchte ich es haben. Ich habe die vierzig überschritten, und meine Tage beinhalten weder Kinder, Frauen noch andere ablenkende Dinge. Ich verbringe meine Zeit mit Lesen oder Schreiben. Einmal in der Woche setze ich mich ins Auto, erledige Besorgungen, gehe in die Buchhandlung oder besuche meine Eltern. Sie sind inzwischen über siebzig. Hin und wieder fahre ich nach Lund, wo mein Bruder arbeitet und mein Verleger halbtags anzutreffen ist. Viel mehr unternehme ich nicht. Wenn ich Lust habe, laufe ich zur Haltestelle am Växjövägen und nehme den Bus in die Stadt, um mich mit einem alten Bekannten auf eine Tasse Kaffee oder ein Bier zu treffen. Doch das kommt immer seltener vor.
Die einzige Regelmäßigkeit in meinem Leben, abgesehen vom Lesen und Schreiben, ist das Spazierengehen. Während meiner Jahre in Stockholm bin ich – außer, wenn ich irgendwohin unterwegs war – so gut wie nie zu Fuß gegangen. Hier laufe ich fast jeden Tag mehrere Kilometer. Ich weiß nicht genau, warum, aber ich brauche das. Neben dem Glas Whisky, das ich mir einmal in der Woche nach einem besonders produktiven Arbeitstag gönne, sind Spaziergänge eine der wenigen Belohnungen, die ich mir herausnehme.
Das erste Mal begegnete ich Evy Ende Juni. Die alte Dame stand mit einem Sack Pflanzerde vor sich im Garten. Die Stille der Umgebung machte es ihr leicht, mich zu bemerken, als ich den Weg entlangkam. Sie hob den Kopf, sah mich, nickte und lächelte.
«Wohnen Sie nicht seit kurzem in dem Haus am Ende der Straße, in dem gelben?»
«Ja, ich bin vor ein paar Wochen hergezogen», bestätigte ich.
«Wo haben Sie vorher gewohnt?»
«In Stockholm. Aber ich bin hier aufgewachsen.»
«Ich habe Sie schon öfter hier vorbeigehen sehen.»
«Es ist eine schöne Strecke.»
«Ja, vielleicht. Man selbst sieht es gar nicht mehr.» Sie trat an den Gartenzaun und streckte mir die Hand entgegen. «Ich heiße Evy.»
Nachdem ich mich vorgestellt hatte, sagte sie: «Ach ja, richtig. Sie schreiben Bücher, nicht wahr?»
«Ja», sagte ich, obwohl ich, seit ich hier war, kein einziges Wort zu Papier gebracht hatte. «So ist es wohl.»
«Ich muss gestehen, ich habe nichts von Ihnen gelesen.»
«Das muss man auch nicht. Wohnen Sie schon lange hier?»
«Bald fünfzehn Jahre. Mein Mann und ich haben das Haus für uns gekauft. Jetzt bin nur noch ich übrig. Ich habe natürlich darüber nachgedacht, es zu verkaufen», fuhr sie fort, als wäre das eine Frage, die sie oft zu hören bekam. «Aber wohin sollte ich schon gehen mit meinen achtzig Jahren? Ich werde wohl einfach weiterleben, schätze ich.»
Bei unserer nächsten Begegnung, etwa eine Woche später, lud sie mich auf eine Tasse Kaffee ein, und wir tauschten unsere Telefonnummern aus. Wir saßen in Evys Küche. Sie hatte von einem ihrer Enkel ein neues Handy geschenkt bekommen, und ich zeigte ihr, wie man die Weckfunktion einstellte.
Gelegentlich besuchte sie auch mich. Wir tranken Wein, plauderten, spielten Karten und leisteten einander Gesellschaft. Sie erzählte mir Episoden aus ihrem Leben als Polizistin, urkomische und tragische Geschichten von Verbrechern, Junkies, Opfern und Angehörigen. Wie ungewöhnlich es damals war, als Frau bei der Polizei zu arbeiten, und andererseits auch nicht. Sie kramte ein Album hervor und zeigte mir Fotos von ihrem verstorbenen Mann Ronnie, von ihren Kindern und Enkeln, von ihrem Bruder Einar. Ich erzählte ihr, dass ich in mein Elternhaus gezogen war, dass ich versuchte, es zu renovieren, aber nicht recht wusste, wie. Ich erwähnte meine Schreibblockade und dass mir der Stoff zum Schreiben schon lange ausgegangen war.
«Das klingt einsam. Ich meine, Sie. Sie kommen mir einsam vor.»
«Sie mir auch», erwiderte ich.
Evy kicherte vergnügt.
«Das ist nicht dasselbe.»
Ihre Augen waren aufgeweckt und auf eine verblüffende Art entwaffnend, als wäre ihr Blick eine Kunst, die sie kultiviert und die ihr wertvolle Dienste geleistet hatte bei all ihren Aufeinandertreffen mit jenen, die in die Fänge der Ordnungsmacht geraten waren. Es sollte noch eine Weile dauern, bis ich dahinterkam, dass sie trotz ihres souveränen Hintergrunds jahrelang geraucht und ihre Nerven nachts mit Gin beruhigt hatte, um durchzuhalten.
Dann, eines Tages Anfang August, geriet etwas durcheinander. Evy wachte zeitig auf und fühlte sich seltsam. Mit ihrem Gleichgewicht stimmte etwas nicht. Beim Kaffeekochen wurde ihr schwindelig, und als sie in die Diele hinauswankte, musste sie sich an der Wand abstützen, weil sich die Dinge ringsum sonderbar neigten. Übelkeit stieg in ihr auf. Sie stellte sich vor den Garderobenspiegel, streckte sich und lächelte, obwohl ihr nicht danach zumute war. Ein Mundwinkel blieb starr. Ihr Gesicht wirkte schief. Sie hob die Arme und wollte bis zehn zählen. Als sie jedoch einen Arm wieder herabsinken sah, brach sie ab, wankte zu einem Sessel und wählte die 112.
«Mein Name ist Evy Carlén. Es ist ein schöner Morgen. Rede ich klar und deutlich?»
«Entschuldigung», sagte die Telefonistin am anderen Ende der Leitung. «Was haben Sie gesagt? Ich habe Sie nicht verstanden. Wie heißen Sie?»
«Mein Name ist Evy Carlén, und ich sagte: Es ist ein schöner Morgen. Rede ich klar und deutlich?»
«Ich sehe, dass Sie aus Norteforsen bei Tofta anrufen. Norteforsen 195, ist das korrekt? Wie heißen Sie? Ich verstehe Sie kaum.»
«Wenn das so ist.» Evy seufzte. «Dann kommen Sie wohl besser her.»
Mit dem Handy in der Hand schleppte sie sich zur Haustür und schloss sie auf, damit die Sanitäter hereinkommen konnten, dann sank sie zu Boden, der Weg zurück war zu weit. Als der Rettungswagen eintraf, war sie nicht mehr bei Bewusstsein.
Ich erfuhr, dass Evy einen Schlaganfall gehabt hatte. Und als sie im Krankenhaus wieder zu sich kam, konnte sie weder sprechen noch sich an irgendetwas erinnern. Alles, was sie tat, war zu weinen. Es vergingen Tage, bis sie etwas sagte, und als sie es schließlich tat, nannte sie einen Namen. Aber nicht etwa den ihres verstorbenen Ehemanns oder den ihrer Freundin, mit der sie sich hin und wieder im Kupan traf, es war auch nicht der Name ihres Bruders Einar oder der eines ihrer Kinder oder Enkelkinder. Sie sagte: «Sven Jörgensson.»
Und dann brach sie abermals in Tränen aus.
Zu diesem Zeitpunkt musste sie verstanden haben, dass ich nicht ganz ehrlich zu ihr gewesen war, dass ich sie im Grunde getäuscht hatte. Aber was hätte ich tun sollen. Als Evy den Schlaganfall erlitt, hatte mein Leben begonnen, um das zu kreisen, was in jenem lange zurückliegenden Frühlingswinter in Tiarp geschehen war. Moralisches Leid ist von besonderer Art. Es kann die Starken genauso treffen wie die Schwachen, und weder Operationen, Schmerzmittel noch künstliche Beatmung bringen Linderung. Moralischer Schmerz ist anders beschaffen. Dagegen gibt es nur zwei Mittel: sich langsam aufzehren zu lassen oder mit drastischen Maßnahmen einen Befreiungsversuch zu unternehmen.
Das sollte ich von Evy lernen.
2.
Als Kind sah ich Sven Jörgensson mehrmals in der Woche. Wenn man in einem Ort wie Tofta aufwächst, ergibt sich das von selbst. Man erfährt so einiges über alle und jeden, ohne großartige Anstrengungen unternehmen zu müssen.
Ich, mein Bruder Rasmus und unsere Eltern wohnten in der Nähe des Toftasjön an der Landstraße in Richtung Simlångsdalen. Ab meinem zehnten Geburtstag, im Jahr 1986, fuhr ich mit dem Schulbus in die Snöstorpsskolan. Jeden Morgen stellte ich mich unten an die Straße vor die Briefkästen und wartete darauf, dass der alte orange-weiße Bus in der Kurve nach Skedala auftauchte. Der Name des Busfahrers fällt mir nicht mehr ein, aber es war immer derselbe schütterhaarige und schweigsame Mann. Er kam mit dem Bus aus dem Stadtzentrum angefahren, hielt bei uns an und setzte seinen Weg dann Richtung Marbäck fort, bis er an Toftas Hofatelier wendete, die Landstraße in entgegengesetzter Richtung zurückfuhr und die Abzweigung nach Snöstorp nahm.
Mein Bruder ist drei Jahre jünger als ich, und nach seiner Einschulung warteten wir zu zweit vor den Briefkästen unten an der Straße. Nie habe ich mich so erwachsen gefühlt, wie wenn ich frühmorgens neben ihm stand, die Straße im Auge behielt und aufpasste, dass er nicht zu weit auf die Fahrbahn hinaustrat, dass an dunklen Herbst- und Wintermorgen die reflektierenden Streifen an seinem Anorak zu sehen waren und dass er alle Schulsachen eingepackt hatte. Bei kleinen Siebenjährigen konnte man schließlich nie wissen.
Bei diesen Gelegenheiten sahen wir Sven Jörgensson. Er kam mit dem Auto oben aus Marbäck, in Uniform und ein müdes Gesicht gekleidet, eine Zigarette im Mundwinkel und das Seitenfenster ein Stück heruntergekurbelt, dem Morgen entgegenblinzelnd, als stünde ihm eine harte Prüfung bevor, von der wir Kinder noch nichts wussten. Manchmal saß er in einem Streifenwagen, aber meistens fuhr er sein eigenes Auto, einen roten Volvo-Kombi. Dann war es schwieriger, ihn von weitem zu erkennen, aber es ging.
Eines Morgens, als Svens Volvo an uns vorüberfuhr, schnappten wir nach Luft. Eine klebrige rote Masse war vom Autodach geflossen, an Scheiben und Kotflügel hinuntergetropft, und erstarrt. Mein Bruder und ich gerieten vor Aufregung völlig aus dem Häuschen. Den ganzen Schulweg über rätselten wir, was vorgefallen sein könnte, wisperten uns Geschehnisse ins Ohr und diskutierten Szenarien, eines abenteuerlicher als das andere. Vielleicht hatte Sven einen Dieb geschnappt und ihn verwundet. Oder ihn erschossen. Wir wussten, dass Sven eine Pistole trug, das taten alle Polizisten. Oder er hatte auf dem Autodach mit jemandem gekämpft, der ganz offensichtlich verloren hatte, vielleicht einem Dieb, der versucht hatte, mit der wertvollen Beute zu fliehen. Möglicherweise hatte Sven den Kerl mit seinem Schlagstock halb totgeprügelt.
Als wir abends unserem Vater davon erzählten, der schon damals ein Mann mit Humor war, reagierte er genauso elektrisiert wie wir.
«Ein Kriminalfall, in unserer Nähe! Vielleicht war es das, was ich heute Nacht gehört habe. Den Schuss also.»
«Schuss?» Ich sah meinen Bruder an. «Welchen Schuss?»
«Ich bin heute Nacht so gegen drei Uhr aufgewacht. Ihr wisst doch, dass man manchmal träumt und Traum und Wirklichkeit sich vermischen?»
«Ja», sagte mein Bruder mit kugelrunden Augen.
«Ich weiß noch, dass ich von einer Tür geträumt habe, die mit einem lauten Knall zuschlug.» Vater zwinkerte und senkte die Stimme. «Vielleicht war das Türknallen in Wirklichkeit Sven, der auf den Dieb geschossen hat.»
Gebannt hingen wir an Vaters Lippen, bis unsere Mutter demonstrativ den Kopf zur Seite neigte und müde lächelte. Da lachte er auf, und mit einer Stimme, in der plötzlich kein bisschen Phantasterei und Sensationslust mehr mitschwang, sondern der schnöden väterlichen Realität Platz machte, sagte er, ja, es sei natürlich nicht ausgeschlossen, dass Sven einen Dieb gefasst habe, dass auf dem Autodach ein Handgemenge aus dem Ruder gelaufen sei oder ein anderes unserer Szenarien zutreffe. Aber, fuhr er fort, Sven sei früher Jäger gewesen. Heute jage er nicht mehr, er hatte seine Waffen und seine Ausrüstung abgegeben, aber er hielt noch immer Kontakt zu Lennart Börjesson, Göran Lundgren und anderen Jägern oben im Dorf. Manchmal half er ihnen mit erlegten Tieren. Vor zwei Tagen hatten sie einen Elch geschossen, und Sven hatte das tote Tier auf seinem Autodach transportiert, weil es auf keinen anderen Wagen gepasst hatte, und die Plane, in die sie den Elch eingehüllt hatten, war undicht gewesen.
Natürlich waren wir enttäuscht. Aber es wäre, wenn man es recht bedenkt, vollkommen untypisch für Sven gewesen, auf einen Menschen zu schießen oder ihn auch nur zu schlagen, selbst dann, wenn dieser Mensch ein Dieb war. Sven war schließlich Sven. Wir winkten ihm immer zu, sobald er morgens angefahren kam. Manchmal winkte er zurück. Dann konnte man ein Lächeln um seine Lippen spielen sehen, kein breites, dann hätte er seine Zigarette verloren, aber unverkennbar ein Lächeln.
Im Umkreis von Marbäck und Tofta gab es damals zwei Kfz-Mechaniker. Der eine war Peter Nyqvist im Svanådvägen, oben im Dorf, der andere mein Vater. Er arbeitete bei Rejmes in Halmstad, hinter Sannarp direkt gegenüber der Feuerwache. Ging ein Wagen in der Umgebung kaputt, wandte man sich an ihn oder Peter, um eine erste Einschätzung vom Ernst der Lage zu erhalten, besonders im Sommer und am Wochenende. Das Auto in eine Werkstatt zu bringen, war ein Unterfangen für sich, da war es gescheiter – und billiger –, mein Vater oder Peter begutachteten den Schaden zuerst. Ich weiß nicht, wie oft ich frühmorgens aufwachte, weil das Telefon schellte, Vater aufstand und mit schlaftrunkener Stimme sagte Hallo, Göran und Oh, verdammt, das klingt übel und Ja, ich bin zu Hause, kein Problem, kannst du den Wagen herbringen?
Wir gewöhnten uns daran, dass in unserer Einfahrt Autos standen, die nicht uns gehörten, aufgebockt und mit geöffneter Motorhaube, unser Vater rücklings auf einer abgenutzten Schaumgummiplatte, die ursprünglich einmal gelb gewesen war, mittlerweile aber eine dunkelbraune Patina aus Öl und Dreck angenommen hatte. Zweimal, erinnere ich mich, gehörte das Auto Sven Jörgensson. Ich weiß nicht mehr, wie das Wetter an jenen Tagen war, was an dem Auto kaputt war, ob mein Vater es reparieren konnte oder ob er Kenneths Abschleppdienst rufen musste. Das, was mir in Erinnerung geblieben ist, ist Sven.
Svens Kinn war kantig und breit wie ein Schaufellader. Er hatte Hände so groß wie Vorschlaghämmer, muskulöse Schultern und schütteres Haar, und von der unausgewogenen Ernährung im Dienst und dem Bier, das er abends gerne trank, wölbte sich sein Bauch leicht über den Hosenbund. Von seiner äußeren Erscheinung glich er eher einem Bauern als einem Polizisten. Aber alle wussten, dass er Polizist war. Das machte ihn aus. Mein Bruder und ich standen am Fenster oder hockten auf der Vordertreppe und beobachteten genau, wie er sich bewegte, wie er redete, wie er in einer Hand eine Zigarette hielt und die andere auf dem Gürtel seiner Jeans ruhen ließ, als vermisse er das Holster, das dort sitzen musste, damit alles an Ort und Stelle war. Während Vater das Auto in Augenschein nahm, redeten sie über ihre Häuser, anstehende und abgeschlossene Renovierungen, über Autos, Urlaubsreisen, Fußball, Breared gegen Snöstorp, die Partie war 1:2 ausgegangen, was es in Marbäck Neues gab und in Tofta, und über uns. Die Kinder.
Sven und seine Frau Bibbi hatten einen Sohn, Vidar. Vidar war genau wie sein Vater, groß und kräftig und hilfsbereit. Er ging aufs Gymnasium, spielte als Stürmer beim FC Breared, hackte Holz, als sei er schon ein ganzer Kerl, und war bei allen beliebt. Wir sahen ihn manchmal im Dorf und hörten die Leute oft von ihm reden. Der konnte nicht mal Vidar Jörgensson beikommen, weißt du, wir mussten eine Firma aus der Stadt beauftragen, sagte Bauer Andersson und nickte mit dem Kopf in Richtung einer außergewöhnlich großen Fichte, die am Rand seiner Kuhweide lag. Teufel noch eins, seht ihr, jetzt seid ihr in der Nähe von Vidar Jörgenssons altem Rekord, platzte es aus unserem Sportlehrer heraus, als er beim Hochsprung die Latte andächtig auf die schwindelerregende Höhe von einem Meter und sechsundsiebzig Zentimeter legte. Vidar half gelegentlich bei den Bauern aus, einfach weil die Arbeit ihm Spaß machte. Schon damals, erinnere ich mich, schien er mit sich im Einklang zu sein, mit seinem Platz in der Welt und seinen Träumen, wie auch immer sie ausgesehen haben mochten.
Sagt Bescheid, wenn ihr etwas braucht oder ich sonst wie helfen kann, pflegte Sven zu sagen, und wenn er mich mit seinen klaren grünen Augen ansah, mir eine große, schwere Hand auf die Schulter legte und Pass auf dich auf, Junge, und hör auf deine Eltern sagte, waren es Worte, die sich mir einprägten und die ich sehr ernst nahm, gerade weil sie von ihm kamen. Er nannte mich Junge, behandelte mich aber fast, als wäre ich erwachsen.
Es war nicht so, dass wir wie Sven sein wollten. Es war die Welt, die in seiner Nähe spürbar wurde, die Illusion, die in den Bereich des Möglichen rückte, über uns, über Marbäck und Tofta, die Menschen und das Leben, die so starke Anziehungskraft auf uns ausübte. Dass die Welt ein verlässlicher und sicherer Ort war, an dem auch unsere kleinen Schritte von Sinn und Bedeutung erfüllt waren, dass wir einen Unterschied bewirkten und darauf vertrauen konnten, nie übergangen zu werden. Dass uns immer jemand sah.
Sven muss schon damals krank gewesen sein. Es fiel nur nicht auf. Oder vermutlich tat es das, wir wollten es wohl eher nicht sehen. Vieles, was sichtbar ist, sieht man nicht, weil es zu schmerzhaft wäre.
3.
Dass ich jetzt, so viele Jahre später, über Sven und Vidar schreibe, hat etwas Unwirkliches. Manchmal haben wir uns in direkter Nähe voneinander bewegt, mitunter sogar Seite an Seite, wie Lebenslinien, die für die Dauer einer Sekunde aufeinandertreffen, im Begriff sind, sich zu verflechten, und im letzten Moment aus irgendeinem Grund doch einen anderen Verlauf nehmen.
Es hätte anders kommen können. Ich habe viel an sie gedacht, an diese beiden Männer und den Zahn der Zeit, an all das, was ringsum geschah, ohne dass man es mitbekam.
An einem Abend im Mai 2019, ein paar Monate nach meiner Rückkehr, hielt ich mich in Halmstad auf. Um genau zu sein, ich hockte in einer Bar. Meine Ehe mit Sara war gescheitert, die Papiere waren unterzeichnet, die Gütertrennung war vollzogen, Kapitel abgeschlossen, das Blatt leer und unbeschrieben. Ich war geschieden und ohne Antrieb, irgendetwas zu tun, am allerwenigsten Schreiben. Ungefähr so.
Ich hatte extra eine abseits gelegene Bar gewählt, unweit des Lilla torg. Die meisten Gäste saßen draußen in der Abendsonne, also entschied ich mich für einen Ecktisch in der Bar, direkt neben der Theke, in der Hoffnung, nicht aufstehen zu müssen, wenn ich Nachschub orderte. Der Barkeeper schien in diesem Punkt kooperationsbereit zu sein.
Nach Hause zu kommen, war nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Es rührte mich, wie wenig sich in fast dreißig Jahren verändert hatte. Es rührte und, so stellte ich fest, enttäuschte mich. Über die Gründe war ich mir nicht recht im Klaren. Wollte ich eine Veränderung sehen? Obwohl ich zurückgekehrt war, gerade um in der Vergangenheit zu leben?
Genau darin besteht das Dilemma des Rückkehrers. Zurückzukehren ist eigentlich unmöglich, und wer es trotzdem versucht, wird nur verwirrt. Vielleicht findet die wahre Veränderung nicht am Ort der Heimkehr statt, sondern beim Heimkehrer selbst.
Trübsinnig hockte ich da, nippte an meinem Bier, lauschte dem anonymen Geplätscher der Loungemusik und starrte aus dem Fenster. Ab und zu liefen Passanten vorüber. Die Frauen sahen schön aus, die Männer irgendwie verhärmt.
In jenem Frühjahr erfüllten mich alte Gedanken, Gedanken an die Vergangenheit, an Dinge, die vor vielen Jahren geschehen waren und gerade eben, Erinnerungen an meine Kindheit und die Vorbilder, die ich gehabt hatte, meine Träume. An Männer und Frauen, die einander mehr versprochen hatten, als sie zu halten imstande gewesen waren.
Ein großer, erschöpft aussehender Mann kam zur Tür herein, hielt zielstrebig auf den Tresen zu, lehnte sich dagegen, als benötigte er Halt, ließ sich ein Bier geben und sah sich dann mit der Flasche in der Hand in der Bar um.
Als sein Blick auf mir hängenblieb, erkannte ich ihn.
«Vidar?»
Der große Mann machte ein paar Schritte nach vorn und musterte mich aus zusammengekniffenen Augen.
«Wurm? Sag bloß, bist du das?»
Ich stand auf und streckte ihm die Hand entgegen. Vidars Hand war feucht und klamm von der Bierflasche. Seine Hände waren dreckig, und er hatte schwarze Ränder unter den Fingernägeln, als käme er geradewegs vom Kartoffelacker.
«Dich habe ich nicht mehr gesehen, seit wie vielen Jahren? Dreißig? Bist du zu Besuch?»
«Genau genommen wohne ich wieder hier», sagte ich.
«Seit wann?»
«Seit Februar. Was macht das? Drei Monate?»
«Sag bloß. Was hast du hier vor?»
«Gute Frage.» Ich lachte. «Schreiben, nehme ich an. Arbeiten. Leben.»
Vidar öffnete den Mund, als wollte er etwas erwidern. Doch dann fiel ihm vielleicht der eigentliche Grund seines Kommens ein, denn sein Blick schweifte erneut über die vielen freien Stühle.
«Ist schon in Ordnung», sagte ich. «Ich bin auch nicht hier, um Gesellschaft zu haben.» Vidar musterte mein halbleeres Bierglas. Er hob seine Flasche an den Mund, und die Hälfte ihres Inhalts verschwand. Seine tiefe Stimme dröhnte aus der Brust.
«Das erste Bier reden wir. Das zweite trinken wir schweigend.»
Vidar zog einen Stuhl unter dem Tisch hervor und setzte sich.
Wurm. Diesen Spitznamen hatte ich lange nicht gehört, aber so war ich genannt worden. In meiner Klasse hieß noch ein zweiter Junge wie ich, und ich liebte Bücher. Das tat mein Namensvetter nicht, seine größte Leidenschaft galt dem Hockey. Die Phantasie macht nicht immer große Sprünge, aber das muss sie auch nicht. Ich weiß nicht mehr, wer auf die Idee kam, aber zu Beginn meiner Schulzeit lautete mein voller Spitzname Bücherwurm. Mit der Zeit wurde Wurm daraus. Ich kam recht glimpflich davon, ein Mitschüler erhielt den Rufnamen Bohne verpasst, weil irgendwer meinte, er sähe aus wie Mr. Bean, doch am schlimmsten traf es den armen Kerl, den alle nur Wichsfrosch nannten. Man braucht kein Schriftsteller sein, um sich auszumalen, was ihm diesen Namen eingetragen hat.
Es war merkwürdig, meinen alten Spitznamen wieder zu hören. Es wunderte mich, dass Vidar sich überhaupt daran erinnerte.
Erst jetzt fiel mir auf, dass auch seine Kleidung voller Erd- und Grasflecken war und die dunklen Schatten in seinem Gesicht nicht nur Bartstoppeln waren, sondern ebenfalls Dreck. Er roch stark nach Natur und Schweiß und war dramatisch gealtert.
Für mich, der ihn einmal bewundert hatte, war sein Anblick unerwartet schwer zu ertragen. In meiner Erinnerung sah ich ihn vor mir, wie er über den Fußballplatz stürmte, im Begriff, Breared in einem entscheidenden Match den Siegtreffer zu bescheren, und uns alle dazu brachte, jubelnd die Arme hochzureißen. Ich sah ihn tanzen mit einer sehr schönen jungen Frau, die in uns Halbwüchsigen den Wunsch weckte, Manns genug zu sein, sie berühren zu dürfen, und ich erinnerte mich, wie verblüfft wir als Fünfzehnjährige darüber waren, dass es möglich war, sich so geschmeidig und souverän zu bewegen, und mit welch spielerischer Leichtigkeit die komplexe Kunst gemeistert werden konnte, die Frau beim Tanzen zu führen, ohne sie zu leiten. Wie in sich ruhend Vidar gewirkt hatte, wenn er durchs Dorf schlenderte. In meiner Erinnerung umgab ihn ein Glanz, den ich hier in der Bar nur schwer erkennen konnte.
«Du kommst von der Arbeit?»
Vidar blickte mich verwirrt an.
«Was?»
Ich deutete mit dem Kopf auf seine Kleidung.
«Ach so. Nein. Ich habe zu Hause im Garten gearbeitet, danach musste ich mal raus und konnte mich nicht aufraffen, vorher unter die Dusche zu springen. Aber erzähl, was führt dich zurück in die Heimat?»
«Ich bin nicht mehr verheiratet, das ist wohl der Hauptgrund.»
«Du warst verheiratet?»
«Siebenundvierzig Monate.» Mein Blick fiel auf Vidars linken Ringfinger. «Du auch, sehe ich. Oder, du bist verheiratet, meine ich.»
«Dreiundzwanzig Jahre im August. Ich weiß nicht mal, wie viele Monate das sind.»
Wir tranken. Vidar rieb mit dem Finger über seinen Ehering, als wollte er einen Fleck entfernen.
«Wo wohnst du jetzt?», fragte er.
«Wo ich früher gewohnt habe.» Ich lächelte. «Am Toftasjön. In dem gelben Haus, du weißt.»
«Wie, im selben Haus? Bist du in dein Elternhaus gezogen?»
Meine Eltern hatten das Haus verkaufen wollen, und ich hatte wohl den Gedanken nicht ertragen, es in fremde Hände übergehen zu sehen. Die großen Entscheidungen trifft man oft aus diesem Grund heraus: weil einem sonst etwas aus den Händen gleitet.
Zu Vidar sagte ich: «Ich habe es quasi übernommen. Meine Eltern wollten es verkaufen. Sie sind in eine Dreizimmerwohnung in Tegelbruket gezogen.»
«In einen dieser Neubauten oben auf Slottsmöllan? In die Hochhaussiedlung?»
Ich nickte.
«Zurzeit mache ich also nichts anderes, als zu fluchen, zu grübeln, Handwerkern hinterherzutelefonieren, Kostenvoranschläge einzuholen und zu vergleichen und Möbel zu kaufen. Das ist nicht unbedingt meine Welt.»
«Kann ich verstehen.»
«Meine Eltern hatten ihre Gründe.»
Das Haus musste neu isoliert werden, Fußböden mussten eingezogen oder ausgebessert werden, das Fundament wies Feuchtigkeitsschäden auf. Das Dach musste erneuert werden, die Badezimmerleitungen waren marode, die meisten Haushaltsgeräte hatten ihre besten Tage schon lange hinter sich, und das über zweitausend Quadratmeter große Grundstück mit sattgrüner, feucht-wuchernder Marbäck-Vegetation war verwildert. Diese Probleme waren nun die meinen und führten dazu, dass ich mich mit Dingen befassen musste, von denen ich nicht recht wusste, wie ich sie angehen sollte.
Bisher hatte ich mein Leben eine Armlänge entfernt von der täglichen körperlichen Arbeit verbracht, welche die Welt am Laufen hält. Ich komme aus einer Handwerker-Familie und bin mit dem Bild von Arbeit als einer Tätigkeit aufgewachsen, die man mit den Händen ausführt, nicht mit dem Kopf. Zuweilen geschah es, dass ich, in stehender oder liegender Position mit irgendeiner Arbeit am Haus beschäftigt, plötzlich Freude und Stolz angesichts dieser physischen Tätigkeit empfand, darüber, die körperliche Anstrengung, den Schweiß auf meinem Rücken zu spüren.
Ich will nicht übertreiben. Diese Momente waren rar.
So rar, dass ich begonnen hatte, meine Entscheidung zu bereuen, und mich einsamer fühlte als in der schlimmsten Phase meiner Scheidung. Das war auch der Grund, warum ich an diesem Abend in der Bar hockte.
«Wie gefällt es ihnen da oben in Slottsmöllan?», fragte Vidar.
«Sie lieben es, erstaunlicherweise. Sie gehen jede Woche in irgendwelche Museen, testen neue Cafés. Mein Vater liest jetzt Bücher. Er liest mehr als ich.»
Vidar lachte.
«Das ist doch gut.»
«Du bist nicht mehr bei der Polizei, oder?»
«Seit fünfzehn Jahren nicht mehr. Ich arbeite draußen auf dem Flugplatz.»
«Fühlst du dich wohl da?»
«Vor einiger Zeit haben sie gefragt, ob ich nicht zurückkommen will, aber ich habe abgelehnt.» Vidar lächelte blass. «Also schätze ich, dass ich mich wohlfühle, da, wo ich bin.»
Natürlich tat er das. Wie könnte er, der nie ein anderer gewesen war als er selbst, etwas anderes tun, als sich dort, wo er war, wohlzufühlen? Doch er sagte es, als wäre es gar nicht so selbstverständlich. Mit düsterem Blick hob er seine Bierflasche. Sie war fast leer. Widerstrebend nahm ich einen Schluck aus meinem Glas, mit einem Mal wollte ich nicht, dass unsere Unterhaltung endete.
Vidar trank seine Flasche aus, drehte sich zum Barkeeper, bestellte eine zweite. Die Anziehungskraft, die ich als Kind ihm gegenüber empfunden hatte, war noch da. Aber nun sollte Schweigen eintreten. Sollten wir uns stumm gegenübersitzen und trinken? Einer von uns musste an einen anderen Tisch wechseln. Alles andere sähe zu merkwürdig aus.
Doch unser Gespräch verstummte nicht. Es war, als hätte Vidar seinen Vorsatz vergessen oder seine Meinung geändert. Stattdessen saßen wir da und redeten – Was ist eigentlich aus dem geworden? Sag bloß? Die zwei haben geheiratet? Das hätte ich nie gedacht. Nein, der arme Teufel hat sein ganzes Hab und Gut versoffen, traurige Geschichte. Hast du von dem alten Hof gehört, den sie in Frösakull abgerissen haben? Sie haben im Stall drei tote Pferde und in der Scheune einen roten MG Baujahr 1960 gefunden. Mint condition. Manchmal fragt man sich, was in den Köpfen der Leute vorgeht. Ja, die habe ich vor ein paar Jahren mit ihrem Mann bei einer Signierstunde in Falkenberg getroffen –, zwei Menschen, die einander einerseits fremd waren, andererseits nicht. Wir teilten ein Fleckchen Erde. Manchmal braucht es nicht mehr.
Vidar lachte viel, ich ebenfalls. Es war schön. Doch die dunklen Wolken um ihn herum lösten sich nicht vollständig auf. Als ich von einem Toilettengang zurückkam, starrte er tief in Gedanken versunken auf die Tischplatte.
«Es ist sicher herrlich, Schriftsteller zu sein», sagte er. «Als Schriftsteller irrt man nie.»
Diese unvermittelte Feststellung verblüffte mich. Es war ein Gedanke, der nicht von ihm zu kommen schien.
«Als Schriftsteller irrt man immer», entgegnete ich.
«Aha, ja klar, vielleicht.» Er verstand nicht, was ich meinte. «Darf ich dich was fragen?»
«Ich denke schon.» Ich lachte. Eine leichte Bierseligkeit hatte sich meiner bemächtigt, und ich wusste nicht richtig, was ich antworten sollte. «Das hängt von der Frage ab.»
«Warum habt ihr euch scheiden lassen? Du und …?»
«Sara.» Ich dachte nach. «Sie fand, ich sei leer.»
Vidar hob eine eindrucksvolle Augenbraue.
«Was heißt das?»
«Ich weiß es nicht genau. Aber es fühlte sich an, als hätte sie recht.»
«Also wollte sie die Scheidung?»
«Nicht nur.»
Vidar sah aus, als versuche er, auch diese Worte zu entschlüsseln, ohne dass es ihm gelang.
«Ich glaube …», begann ich und trank einen Schluck von meinem Bier. «Also, ich weiß nicht, aber ich glaube, das ist einer der Gründe, warum ich hier sitze. Es gibt verschiedene Dinge, die dem Leben Sinn verleihen, wie zum Beispiel die Verantwortung, die man gegenüber seinem Kind fühlt. Ich habe keine Kinder, aber ich kann mir vorstellen, dass das Elternsein Sinn stiftet, man hat eine Aufgabe. Einen Zweck. Oder nicht?»
«Doch, sicher.»
«Oder ein Haus. Man schafft sich das Zuhause, das man sich wünscht, oder man versucht, sein Elternhaus zu erhalten und zu bewahren. Aber den einzigen wirklichen Sinn empfinde ich beim Schreiben, wenn ich mir vorstelle, die Leben von anderen zu leben. Das ist es, was man als Schriftsteller tut. Wenn ich spüre, dass ich das tue, wozu ich geboren wurde, kann ich eine Art Sinn darin erkennen. Das hat mich wohl über weite Strecken abwesend gemacht, und das, was übrig blieb, genügte Sara nicht. Sie wollte, dass wir den Lebenssinn in uns selbst finden. Wir beide. Dazu war ich nicht fähig.»
Vidar nickte nachdenklich.
«Das klingt leer. Und ein bisschen traurig. Aber vielleicht stimmt es, dass man als Schriftsteller das Leben von anderen lebt. So habe ich es noch nie betrachtet. Andererseits habe ich auch nicht groß darüber nachgedacht. Apropos.» Er schob seine Bierflasche beiseite. «Es war nett, Wurm. Aber ich muss nach Hause. Ich muss nachdenken.»
«Worüber?»
«Über meinen Vater.»
«Sven? Was ist mit ihm?»
Als hätte er sich verplappert, sah Vidar mich mit ausdruckslosem Blick und halbgeöffnetem Mund an. Auf einmal wirkte er verlegen.
«Nichts, aber … sei froh, dass deine Eltern noch leben. Wenn sie tot sind, kann man ihnen keine Fragen mehr stellen, sosehr man es auch will. Man glaubt, seine Eltern zu kennen, aber das tut man nicht.»
«Wohl wahr», pflichtete ich ihm bei, nicht sicher, was er damit meinte.
Da erst fiel es mir auf. Vidars Gesicht war eingefallen wie das Gesicht eines Menschen, der inmitten einer großen Tragödie steckt und keinen Ausweg findet. Und er hatte mich angelogen. Wo auch immer die Erde in seinem Gesicht und auf seiner Kleidung und seinen Händen herkam, ich ahnte, dass sie nicht von heimischer Gartenarbeit herrührte. Ich machte ihm keinen Vorwurf, aber an diesem Frühlingsabend konnte ich seinen Gesichtsausdruck mühelos deuten, weil ich ihn unzählige Male gesehen hatte, in meinem eigenen Spiegelbild, in Saras Gesicht, wenn sie mir bei unseren unerträglichen Diskussionen und Auseinandersetzungen gegenübersaß. Etwas Fundamentales in Vidar Jörgenssons Leben war aus dem Gleichgewicht geraten.
«Es war schön, dich zu sehen, Wurm.»
«Gleichfalls.»
Als Vidar die Bar verließ, blieb ich sitzen und sah ihm nach. Ich dachte daran, wie Sven einmal in unserer Einfahrt neben seinem Auto stand, während mein Vater sich über die Motorhaube beugte, wie freundlich und stabil der große Mann gewirkt hatte, wie besonnen und klug. Wie Vidar durchs Dorf geschlendert war, mit der kleinen Welt, seiner kleinen Welt, sicher auf den Schultern, voller Gewissheit, dass sie niemals herunterfallen und zerbrechen würde.
Doch Risse gibt es überall. Das ist kein Geheimnis. Dieses Detail verstand ich in jenem Frühjahr besser als so manches andere. Trotzdem hatte ich Schwierigkeiten, die Risse bei Vidar zu entdecken. Ich konnte mir nicht vorstellen, was ihm und seinen Nächsten widerfahren sein könnte.
4.
Etwa zwei Wochen später, am zwölften Juni 2019, explodierte die Nachricht in den Medien.
33 JAHRE SPÄTER:
DIESER MANN IST DER TIARP-MÖRDER
Es ging um drei Morde und einen Mordversuch, die sich vor über dreißig Jahren in der Gegend ereignet hatten und die erst jetzt aufgeklärt worden waren. Es war eine fesselnde Lektüre, und es dauerte lange, bis ich die Zeitung zur Seite legte, nur um sie gleich darauf wieder aufzuschlagen. Ich begriff, dass der Artikel eine Art Hinweis war.
In den folgenden Tagen war der Tiarp-Mörder das Einzige, worüber geschrieben und geredet wurde, fast, so schien es, war er das Einzige, das die Leute umtrieb. Ich versuchte, am Haus zu arbeiten und meinen täglichen Verrichtungen nachzugehen, aber meine Gedanken kehrten unaufhörlich zu ihnen zurück, zu Vidar und seinem Vater und den Tiarp-Morden.
Der erste Mord hatte sich im März 1986 ereignet, als man Stina Franzén in einem Auto unweit von Gut Tiarp fand. Sven Jörgensson war der zuständige Ermittler gewesen, und erst jetzt, dreißig Jahre nach seinem Tod, war die Lösung des Falls ans Licht gekommen. Svens Sohn hatte das Bild zusammengefügt und die Wahrheit an den Tag gebracht. Doch wie sah dieses Bild aus?
Das Wiedersehen mit Vidar hatte mich enttäuscht. Aber warum? Vielleicht weil etwas in dem Mann zerbrochen zu sein schien, den ich immer für unerschütterlich gehalten hatte.
Sechzig Minuten, nicht länger, aber auch nicht kürzer. Wenn man ein Problem nicht innerhalb einer Stunde löst, soll man sich anderen Dingen zuwenden. Das habe ich mal irgendwo gelesen. Ich weiß nicht mehr, ob es in einem Buch oder in einem Zeitungsartikel stand, aber Tag für Tag saß ich genau sechzig Minuten vor meinem Computer, als sei es eine Pflicht, an der ich standhaft festhielt, in der Hoffnung, es würde etwas passieren, das mich veranlasste, einen Satz zu schreiben, den ich nicht gleich wieder löschte.
Als Kind sah ich Sven Jörgensson mehrmals in der Woche.
Vor meinem Fenster schimmerte ein Streifen Himmel über den Baumkronen wie ein schmaler hellblauer Hals. Ich dachte an Sven und Vidar, lehnte mich zurück und schloss die Augen. Als ich sie wieder öffnete, waren dreiundfünfzig Minuten vergangen. Sieben weitere blieb ich noch sitzen, dann löschte ich den Satz und ging aus dem Zimmer, spürbar verwirrt, ohne dass ich hätte sagen können, warum.
Jedes Mal, wenn ich ein Buch beendet habe, fühle ich mich seltsam befreit, irgendwie losgelöst. Als hätte es mich in seinem Bann gehabt und mich nun endlich freigegeben. Inzwischen währte meine Freiheit schon sehr lange. Ob es sich so anfühlt? Frei zu sein. Worte wie frei sind zerbrechlich und fragil, dünn wie Papier. Sie vertragen keine Erschwernisse.
Am nächsten Morgen passierte es wieder.
Als Kind sah ich Sven Jörgensson mehrmals in der Woche.
Ich starrte auf den Satz. Unweigerlich kehrte ich zurück. Nach einer Weile fiel mir der Schulbus ein, die Herbstkälte, wenn ich morgens mit meinem Bruder an der Landstraße stand, die Pendler, die stadteinwärts zur Arbeit fuhren. Sven, der dann manchmal an uns vorbeifuhr. Ich schrieb die erstaunlich wenigen Erinnerungen auf, die ich an ihn und Vidar hatte. Ich erinnerte mich an ein Fußballspiel im März 1986. Breared gegen irgendeinen Großstadtverein. HBK? Nein, HBK konnte es nicht gewesen sein. Die gegnerische Mannschaft fiel mir nicht mehr ein, aber ich weiß noch, dass wir gewannen und es ein wichtiger Sieg war. Das entscheidende Tor hatte nicht Vidar geschossen, da war ich mir sicher, aber wie hieß der doch gleich, der …?
Ich kramte in meinem Gedächtnis. Alles, was mir einfiel, notierte ich. Nach ein paar Tagen begriff ich, dass ich nach Wegen suchte, meine Erinnerungen an diese beiden Männer mit dem zu verknüpfen, was danach geschah. Nachdem ich Tofta verlassen hatte. Nachdem ich nach Stockholm gezogen war und ein Studium begonnen hatte, nachdem ich Schriftsteller und fast ein anderer geworden war und sie ihre Leben hier fortgesetzt hatten.
Am Ende steckte ich in einer Sackgasse, doch da war es längst zu spät. Etwas war in mir erwacht. In dem gelben Haus am Toftasjön hatte ich begonnen, immer fieberhafter nach etwas oder möglicherweise jemandem zu suchen, in das oder den ich mich hineinversetzen konnte.
5.
Schon bald saß ich bei anderen Leuten zu Hause, blätterte in ihren Fotoalben, stellte Fragen und dokumentierte ihre Erzählungen mit einem kleinen Aufnahmegerät. Ich durchstreifte die Gegend um Vapnö und durchforstete in der Stadtbibliothek alte Zeitungen. Ich sammelte Artikel über die Tiarp-Morde, machte mir Notizen und trug Fakten zusammen, trat den Facebook-Gruppen Das alte Halmstad und Halmstad im Wandel der Zeit bei. Einstweilen drückte ich mich davor, mit Vidar zu reden. Der Gedanke an ein Gespräch mit ihm machte mich beklommen, vielleicht weil ich ahnte, welche Konsequenzen es haben würde.
Ich hatte noch keine rechte Vorstellung davon, nach welcher Geschichte ich mich auf die Suche gemacht hatte, doch das weiß man am Anfang selten; erst wenn die Geschichte zusammengestellt und abgeschlossen ist, kann man zurückblicken und sie verstehen. Ich hatte noch nie über ein Verbrechen geschrieben, doch irgendetwas am Tiarp-Mörder fesselte mich. Ich glaube, ich wollte verstehen, was er den Menschen angetan hatte, die ihm und seinen Untaten auf die eine oder andere Weise zum Opfer gefallen waren. Zumindest war das die Erklärung, die ich den Leuten in der Gegend gab, und jedes Mal, wenn ich mit ihnen über Vidar und Sven sprach, tauchte früher oder später ein Name auf: Evy Carlén.
Evy hatte viele Jahre mit Sven zusammengearbeitet. Ich erfuhr, dass sie in der Nähe von Söndrum und dann in Kärleken gewohnt hatte, bis sie im hohen Alter noch einmal umgezogen war. Wohin, wusste ich nicht. Als ich ihre aktuelle Anschrift googelte, lachte ich auf. Norteforsen 195 lag nur wenige Kilometer von meinem Aufenthaltsort am Küchentisch meines halbrenovierten Elternhauses entfernt.
Noch am selben Tag beschloss ich, dort vorbeizugehen, mir ihr Haus anzusehen, wie sie wohnte, möglicherweise einen Blick auf sie zu erhaschen. Etwas anderes hatte ich nicht im Sinn, das möchte ich ausdrücklich betonen. Als ich sie draußen im Garten antraf und wir miteinander ins Gespräch kamen, war ich erstaunt, wie leicht es war, Vertrauen zu ihr zu fassen. Schon während unserer ersten Treffen ließ ich sie an meinem Leben teilhaben, vertraute ihr Dinge an, die nur wenige wissen: warum ich so früh von zu Hause weggegangen war, wie es sich anfühlte, zurückzukommen, sogar von meiner Scheidung erzählte ich ihr.
Es war schön, mit jemandem zu reden, doch das war nicht der Grund. Der Grund war, dass der Schriftsteller in mir Evys Vertrauen gewinnen wollte. Ich ahnte, dass es etwas gab, das sie mir verschwieg, über Sven und Vidar. Kleine Zeichen verrieten es, eine Handbewegung, ein Blick oder ein Schweigen, das einen Bruchteil zu lange andauerte, wenn ich die beiden zur Sprache brachte. Ich wartete darauf, dass sie ihr Wissen mit mir teilte.
«Wie gut kennen Sie Vidar?», fragte ich sie eines Abends.
«Flüchtig, würde ich sagen. Wir sind nur Bekannte. Aber ich kannte seinen Vater. Sven Jörgensson. Das war ein grundanständiger Kerl. Ein Jammer, dass er krank wurde und so früh gestorben ist.»
Wenn wir über Sven sprachen, kam Evy häufig auf seinen Tod zurück.
«Ja», fuhr sie fort. «Ein jegliches hat seine Zeit. Das Leben hat seine Zeit und das Sterben hat seine Zeit.»
Ein jegliches hat seine Zeit. Das sagte sie oft. «Aber», setzte sie neu an, «Sie müssen einem müden alten Mädel zu dieser späten Stunde verzeihen, aber was wollen Sie eigentlich?»
«Was ich will?»
«Warum fragen Sie nach Sven und Vidar?»
«Ich glaube, ich versuche das alles zu verstehen», sagte ich. «All das, was im Sommer in der Zeitung gestanden hat, über Tiarp und den Tiarp-Mörder, und wie das zu meinem Bild von Sven und Vidar passt. Ich kriege es nicht zusammen. Vor allem Vidar. Ich meine, er … es war etwas Besonderes an ihm. Jedenfalls habe ich ihn so in Erinnerung. Als könnte ihn nichts und niemand aus der Ruhe bringen.»
Evy neigte den Kopf zur Seite und lächelte leicht.
«Lügen Sie mich an?»
Meine Handflächen wurden feucht. Ich räusperte mich.
«Warum sollte ich das tun?»
Evy antwortete nicht. Stattdessen sah sie mich mit diesem sonderbaren Blick an, der in mir den Verdacht aufkeimen ließ, dass sie mein wahres Anliegen durchschaute; und ich begriff, dass nie ein Wort über ihre Lippen kommen würde.
Dann erlitt sie den Schlaganfall.
6.
In der ersten Zeit konnte sie nur ja sagen. Das war ihre Antwort auf alles, während ihr Gehirn versuchte, den Raum wiederzufinden, in dem die restlichen Wörter warteten: Ja, ja, ja. Evy bekam viel Besuch, von Leuten aus der Gegend, alten Bekannten, ihren Kindern und Enkelkindern. Auch ich besuchte sie gelegentlich, um mich zu vergewissern, dass sie sich auf dem Weg der Besserung befand.
«Wie geht es Ihnen?», fragte ich sie eines Tages.
«Ja.»
Evy war eine robuste Frau, mit breiten Schultern und kräftigen Handgelenken, doch der Schlaganfall und der Krankenhausaufenthalt hatten sie unnatürlich blass und hager werden lassen. Ihre Wangenknochen zeichneten sich ab. Sie saß am Tisch, ein Radio murmelte leise Nachrichten vor sich hin. Bei meinem letzten Besuch hatte ich ihr Papier und Stift dagelassen, aber sie konnte nicht mehr schreiben. Block und Stift lagen unverändert auf dem Tisch, unangetastet.
«Wollen wir einen kurzen Spaziergang machen?», schlug ich vor.
«Ja.»
Evy stand mühsam auf und packte die Griffe ihres Rollators. Ich wollte ihr mit den Schuhen helfen, aber sie wedelte abwehrend mit der Hand und zog sie allein an.
Am Vormittag war ein leichter Nieselregen gefallen, in der Luft lag der Geruch von nassem Asphalt. Es war Ende August. Alles schlummerte noch im Urlaubsmodus, und uns begegneten nur wenige Autos. Eine umfassende schwedische Stille umgab uns.
Plötzlich erstarrte Evy.
«Sven.»
«Wie bitte?»
«Sven Jörgensson.»
«Haben Sie gerade an ihn gedacht?»
«Singing in the rain.»
«Was haben Sie gesagt?»
Sie wiederholte die Worte, ich begriff rein gar nichts. Den Rest des Spaziergangs schwiegen wir.
Danach kehrte Evys Sprache allmählich zurück, und als sie wieder auf der Höhe war, hatte sich etwas verändert. Sie begann zu erzählen, vielleicht weil sie wusste, dass ihr nicht mehr viel Zeit blieb.
«Ich glaube, ich werde bald sterben», sagte sie eines Nachmittags, als der Sommer in den Herbst übergegangen war. «Das ist ja kein Leben mehr.»
«Ich glaube, Sie werden noch mindestens zwanzig Jahre leben.»
«Das ist Svens Verdienst», sagte sie. «Ohne ihn wäre es nie dazu gekommen.»
«Was meinen Sie?»
«Ja, Tiarp.»
«Die Aufklärung der Mordfälle? War das Svens Verdienst?»
«Ja, ja.»
Ich verstand nicht. Sven Jörgensson war seit fast dreißig Jahren tot. Die Tiarp-Morde waren erst vor wenigen Monaten aufgeklärt worden.
«Ein jegliches hat seine Zeit.»
Ich wartete.
«Ja. Ein jegliches hat seine Zeit.»
«Das Erinnern hat seine Zeit. Ebenso wie das Vergessen. Ich habe immer gedacht, früher oder später werde ich es vergessen. Aber das konnte ich nicht vergessen.»
«Was konnten Sie nicht vergessen?»
«Die Nacht oben im Wald.»
«Welche Nacht?»
Ich musste lange warten, bis sie antwortete.
Ich hatte geglaubt, dass Evy sich erholte, doch nach einer Weile begriff ich, dass das Gegenteil der Fall war. Im Verlauf des Herbstes und Winters wurde ihr Kopf klarer und ihre Gedanken wurden ein wenig zusammenhängender, aber ihr körperlicher Verfall schritt immer weiter voran, ein langsamer, aber unerbittlicher Prozess. Überall in ihrem Haus standen Medikamente, die ihr beim Aufstehen helfen sollten, beim Einschlafen, dabei, keine Blutgerinnsel zu bekommen, keinen erneuten Schlaganfall zu erleiden. Kurz darauf konnte sie keine Spaziergänge mehr machen. Ihr Gedächtnis ließ nach, ihr Appetit schwand, und ihre Nächte wurden lang und schlaflos. Jedes Mal, wenn ich sie traf, hob sie die Hände, lächelte versonnen und sagte: «Noch bin ich nicht tot. Noch bin ich hier. Aber bald ist es so weit.»
Ich ahnte, dass sie recht hatte.
Eines Abends holte sie wieder ihre Fotoalben hervor und zeigte mir Bilder von Menschen, die ich inzwischen aus ihren Erzählungen kannte.
«Hier ist ein Foto von Sven», sagte sie und deutete auf eine körnige Aufnahme. «Ich glaube, das war im Frühjahr 1986.»
Ich bin mir nicht sicher, was Evy damit bezweckte. Ob sie mir die Bilder zeigen wollte oder ob sie Teil ihrer Vorbereitung waren und sie sie ein letztes Mal sehen wollte. Die Menschen, die sie im Leben umgeben und die ihr am Herzen gelegen hatten, bevor ihre Zeit zu Ende ging. Der Gedanke stimmte mich traurig.
«Wo wurde das Bild aufgenommen? Ist das draußen vor dem Polizeirevier?»
«Ich weiß es nicht», sagte sie. «Ich erinnere mich nicht. Möchten Sie es haben?»
Die Frage überrumpelte mich.
«Wollen Sie es mir schenken?»
Evy nahm das Foto aus der Einstecktasche des Albums, und ich studierte es eingehend. Sven lehnte an einer Hauswand und hielt eine Zigarette in der Hand. Er sah erschöpft aus. Ich drehte das Foto um.
«Es wurde im Herbst fünfundachtzig gemacht», sagte ich. «Jedenfalls dem Datum auf der Rückseite nach. Ist das Ihre Handschrift?»
«Ja, das wird sie wohl sein. Ich habe es ja gesagt, auf mein Gedächtnis ist kein Verlass mehr.»
Während ich diese Sätze schreibe, liegt Svens Foto neben einem zweiten zuoberst auf meinem Stapel mit Arbeitsmaterialien.
«Dieses hier können Sie auch haben», sagte Evy. «Ich habe so viele davon.»
Sie hatte weitergeblättert und ein anderes Bild aus dem Album genommen. Ein Familienfoto. Im Hintergrund stand ein stattlicher und bunt geschmückter Weihnachtsbaum.
«Das bin ich», sagte sie. «Das ist mein Bruder Einar. Das sind Ronnie und seine Mutter, damals lebte sie noch. Und vor mir und Ronnie sitzen unsere Kinder. Ich weiß nicht, welches Weihnachten das ist.» Evy kniff die Augen zusammen. «Damals konnte ich mich sehenlassen. Schauen Sie. Jung und hübsch. Heute bin ich nur noch und.»
«Sind Sie nicht.»
Evy kicherte. Ich nahm das Foto zögernd entgegen.
«Weihnachten 1987», las ich von der Rückseite ab. «Möchten Sie wirklich, dass ich das Foto behalte?»
Evy nickte.
«Damit Sie eine Erinnerung an mich haben, wenn ich nicht mehr bin.»
Ich wusste nicht, was ich darauf erwidern sollte, also schob ich die beiden Fotos in meine Tasche, entschuldigte mich und flüchtete mit einem Kloß im Hals auf die Toilette.
Sven und Vidar Jörgensson hatten in mir, genau wie in vielen anderen Kindern der Umgebung, die lebhafteste Phantasie geweckt, die man sich vorstellen kann: sich an dem Ort, an dem man lebt, vollständig zu Hause und glücklich zu fühlen. Aber das allein macht noch keine Geschichte. Es ist nur ein Bild, schön aus der Ferne betrachtet.
Ich begann über die Fragen nachzudenken, die Sven, und vielleicht auch Vidar, bis ans Ende gequält haben mussten: Warum musste er, ausgerechnet er, ein derart von Gerechtigkeitssinn erfüllter Mann, auf einen Täter treffen, der allem zuwiderlief, was er kannte? Warum wurde ausgerechnet er, der stets für andere nach der Wahrheit suchte, in ein Ereignis hineingeworfen, dessen Lösung keinerlei Antworten lieferte. Und sein Sohn? Wie kam sein Sohn damit zurecht?
Ich weiß, mein Porträt von ihnen kann nicht vollständig sein. Es gibt noch so vieles, was ich nicht über Sven, Vidar, Evy und all die anderen weiß.
Wir unterstellen Menschen unentwegt Absichten, Motive, Beweggründe. Aber wie sicher können wir uns sein? Was kann man über einen anderen Menschen eigentlich wissen?
Die Macht des Schriftstellers besteht darin, Menschen eine Bühne betreten zu lassen, auf der er selbst Regie führt, Lücken und Leerstellen füllt, um zu ergründen, was geschehen sein könnte. Ich habe Menschen auf die Bühne geschickt, die nicht nur in Schweden gelebt und gewirkt haben, sondern die Schweden gewissermaßen waren, so wie es uns Kindern 1986 erschien, in jenem Jahr, das mehr als jedes andere das Jahr der Angst werden sollte.
Jetzt beginnt es.
IITod auf dem Nyårsåsen
1986
7.
Von allen Vogelarten war uns die Bachstelze die liebste. Die Wintermonate waren so lang gewesen und die Tage so kurz, dass es schwerfiel, sich zu entsinnen, wenn der kleine Vogel endlich erschien.
Mit dem Frühling erwachte das Dorf zum Leben. Alles war von einem Glanz umgeben, und die Farben leuchteten satt und kräftig. Lichte Zeiten standen bevor.
Doch der Anblick einer Bachstelze ist auch ein Moment der Ungewissheit. Wir lernten, sehr vorsichtig zu sein. Sah man die Bachstelze von hinten, was so gut wie immer der Fall war, verhieß sie Freude und Glück. Doch bei den seltenen Gelegenheiten, bei denen man sie von vorn erblickte, den schwarzen Fleck klar und deutlich auf der Brust, verkündete sie Unglück und Leid.
So ist das Leben: licht. Aber ungewiss.
Vermutlich ist nichts Wahres daran, trotzdem nahm man es sehr ernst. Vielleicht aus gutem Grund. Nachdem der alte Nilsson oben am Torvsjön einen Blick auf den schwarzen Brustfleck einer Bachstelze erhascht hatte, ging es mit seiner Firma bergab, und nur eine Woche später stürzte seine Frau auf der Treppe und brach sich die Hüfte. Sie wurde medikamentenabhängig. Am Ende ging die Geschichte glimpflich aus, die Frau erholte sich, es sprach wohl nichts dagegen, dass sie die Medikamente nahm, und ihr Mann konnte die Firma verkaufen. Aber es war ein Unglück, und ein Unglück kommt bekanntlich selten allein. Die Bachstelze war der Anfang.
Carl Jörgensson, Sohn eines Jörgen, kam im Mai 1860 in Marbäck zur Welt. Er zeugte sieben Kinder, das jüngste erhielt den Namen Ludvig. Besagter Ludvig erblickte an einem Märzmorgen im Jahr 1902 das Licht der Welt, ein gesunder und kräftiger Säugling, dessen Geburt seiner Mutter Elfrid unglücklicherweise mehr abverlangte, als sie verkraftete. Ihr Zustand verschlechterte sich, und sie verstarb am folgenden Tag noch vor Sonnenaufgang im Kindbett. Eine Woche später wäre sie achtunddreißig geworden. Von Bachstelzen berichtet die Überlieferung nichts, obgleich es Frühling war.
Ludvig begegnete seiner zukünftigen Frau Märta bereits in der Schule. Sie führten ein bescheidenes Leben. Es bestand aus der Arbeit auf dem Hof, Ludvigs Dienst als Landgendarm, der Instandhaltung des Hauses, dem Bestellen der Felder, der Teilnahme an den Sitzungen des Dorfvereins und den Machtkämpfen in der unlängst gegründeten Gewerkschaft. Was auf sich warten ließ, war der Nachwuchs. Sie sollten fünfunddreißig werden, ehe Märtas Bauch sich zu runden begann und ihr das Schlafen Mühe bereitete. Da dämmerte ihnen beiden, was los war. Es war Herbst. Am zwanzigsten Mai 1937 kam Sven Jörgensson zur Welt.
Er wuchs heran, lernte Bibbi kennen, heiratete, wurde Polizist und hatte über fünfundzwanzig Jahre für Recht und Ordnung in der Kleinstadt gesorgt, als das Geschehen seinen Lauf nahm. Der Mann aus Marbäck, den wir morgens mit dem Auto stadteinwärts fahren sahen, war ein Arbeitstier, erzogen im Geist und der Moral des Landstrichs. Er war schweigsam und in sich gekehrt, aber warmherzig und freundlich. Er verhielt sich wie jemand, der versuchte, all das zu sein, was das Leben von einem verlangt: ein treusorgender Ehemann, ein guter Vater, ein hilfsbereiter Nachbar und zuverlässiger Kollege. Auch Sven hatte als Kind die Bachstelze gemocht. Als er sie im Winter 1986 wiedererblickte, wurde ihm eiskalt. Angst packte ihn. Seine Erinnerung trog ihn doch nicht? Er hatte die Bachstelze doch gemocht?
Wenn ich die Augen schließe und mir Sven auf meiner Bühne vorstelle, sehe ich ihn dort vor mir. An jenem Morgen, an dem er sich wie jeden Tag für die Arbeit fertig machte, sein Sohn, der fast erwachsene Vidar, am Küchentisch sitzend, ein Glas Milch und die Musterungspapiere vor sich, und Bibbi, die im Bademantel am Herd stand und den Tee umrührte.
Alles war wie immer. Sven trug seine Jacke, das kleine schwarze Notizbuch steckte in der Brusttasche seines Hemds, ein Stift in seiner Gesäßtasche, die Autoschlüssel hielt er in der Hand. Er verabschiedete sich, kam jedoch kurz darauf noch einmal ins Haus zurück.
«Was ist?», fragte Bibbi, die ihm den Rücken zuwandte. «Springt das Auto nicht an?»
«Nein, nein.» Sven räusperte sich. «Draußen war eine Bachstelze.»
Bibbi war ein Mensch, der es vorzog, nur wenige Dinge zu tun. Aber das, was sie tat, machte sie gründlich: ihren Job verrichtete sie tadellos, Essen kochte sie wie für ein Festmahl, wenn sie putzte, schritt sie ans Werk, als stünde ein Schwiegermutterbesuch bevor, und ihren gemeinsamen Sohn erzog sie mit Überzeugung und Beharrlichkeit, als sei er eine Chance, etwas Wichtiges zu korrigieren, das einst schiefgelaufen war. Und ihre Liebe zu Sven war wie die letzte Liebe auf Erden. Jetzt drehte sie sich zu ihm um.
«Was hast du gesagt?»
«Ich habe eine Bachstelze gesehen.»
«Im Februar? Du hast dich bestimmt verguckt.»
«Es war eine Bachstelze. Sie saß auf dem Zaun zu Janssons Grundstück.»
«Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Frühling dieses Jahr so früh kommt.»
«Von vorn. Der Brustfleck … Ich habe sie von vorn gesehen.»
Bibbi schwieg, mit dem ganzen Gewicht, das eine Frau wie sie in die simple Handlung, nicht zu reden, hineinlegen konnte. Vidar stand auf und trat ans Fenster. Mit zusammengekniffenen Augen blickte er zu Janssons hinüber. Keine Bachstelze.
Er seufzte resigniert, aus einer Enttäuschung heraus, die Sven am liebsten nicht gesehen hätte.
«Es kann keine Bachstelze gewesen sein, Sven. Du musst dich irren. Es ist noch viel zu kalt.» Bibbi schaute ihn an. «Ist sonst noch was?»
«Nein.»
Ihre Lippen streiften seine Wange.
«Wir sehen uns heute Abend.»
«Es war eine Bachstelze.» Er öffnete die Tür. «Ich bin ganz sicher.»
8.
Im Revier fragte ein Kollege, ob Sven heute seine Schicht übernehmen könnte. Der Kollege hatte drei Kinder, und zwei hatten in der Nacht die Windpocken bekommen. Er musste seine Frau zu Hause unterstützen.
Es war normal, dass sie Dienste tauschten, um den Alltag zu bewältigen. Man half sich gegenseitig. Sven rief im Scandic an und erkundigte sich, ob seine Frau schon da sei. Das war sie.
«Hallo, Bibbi. Ich bin’s. Ich wollte nur sagen, dass es heute später wird. Vermutlich Mitternacht.»
«Okay», erwiderte sie unbekümmert, in Gedanken schon mit irgendeiner Hotelangelegenheit beschäftigt. «In Ordnung. Und du?»
«Ja?»
«Entschuldige wegen vorhin. War es wirklich eine Bachstelze?»
Ja. Er war sich sicher. Laut sagte er:
«Vielleicht habe ich mich geirrt. Wir sehen uns heute Abend.»
Die Personalakte der Polizei Halmstad dokumentiert den Tag: Um zehn Uhr vormittags fuhr Sven zu einem Verkehrsunfall, nach der Mittagspause verhängte er eine Geldbuße wegen Geschwindigkeitsübertretung, am Nachmittag wurde er zu einem Fall von häuslicher Gewalt gerufen, dann ruhte er sich einige Stunden aus, bevor er um zwanzig Uhr abermals den Dienst antrat. Um zwanzig Uhr dreißig fuhr er zu einem Einbruch in ein Ferienhaus in Tylösand. Die Angelegenheit zog sich hin, erst um zweiundzwanzig Uhr dreißig war er wieder im Revier, um den Papierkram zu erledigen. Er würde später als gedacht nach Hause kommen. Kurz erwog er, Bibbi noch einmal anzurufen, doch dann hämmerte er weiter auf die Tasten der Schreibmaschine ein und versuchte, seine Notizen zum Einbruchshergang zu entziffern.
Sven mochte die Nacht. Nachts war die Welt ruhig und geräuschlos. Die Büros waren dunkel und still, und er hatte Zeit, die Dinge zu erledigen, die tagsüber liegengeblieben waren. Vor seinem Fenster breitete sich die Kleinstadt wie ein Lichterteppich aus. Es war friedlich.
Und er arbeitete mit Evy Carlén zusammen. Mehr konnte er sich nicht wünschen. Evys Mädchenname war Bengtsson gewesen, aber nach der Hochzeit hatte sie den Namen ihres Mannes angenommen. Sie war sechsundvierzig Jahre alt, besaß die Statur einer Kugelstoßerin und den scharfen Verstand einer wahren Detektivin; sie war klug und sympathisch, und wenn sie einen schlechten Witz hörte, platzte ein herbes Männerlachen aus ihr heraus.
Es war kurz vor halb eins, als die Meldung kam. Sie blickten von ihren Schreibmaschinen auf. Sven legte seine Zigarette auf den Rand des Aschenbechers und lauschte der Stimme im Funk, während die Nachricht sämtliche Polizeieinheiten des Landes erreichte.
Sven und Evy sahen sich an. Sie wirkte verblüfft, fast verärgert. Als die Funkstimme verstummte, folgte sekundenlanges statisches Rauschen, dann meldete sich eine Streife.
«Dreiundsechzig, bitte kommen. Das war ein Witz, oder?»
Es knackte und knisterte. Die Stimme des Leitstellenmitarbeiters erklang.
«Nein, es stimmt.»
Sven starrte das Funkgerät an. Das war unmöglich. Nicht hier. Nicht in Schweden.
Er wandte sich wieder dem Blatt in seiner Schreibmaschine zu, dem halbfertigen Einbruchsprotokoll, nahm die Zigarette aus dem Aschenbecher, zog ein letztes Mal daran und hustete. Ein warmer, stechender Schmerz saß in seiner Brust.
Telefone begannen zu schrillen. Sven und Evy taten, was sie konnten, die Gedanken vor Schock erstarrt. Die Leute waren verängstigt, und wenn sie Angst hatten, wandten sie sich an die Polizei, und aus irgendeinem Grund stellte die Telefonzentrale sämtliche Anrufe zu ihnen durch. Die Warteschleifenlämpchen leuchteten rot. Evy zuckte ihre breiten Schultern und schüttelte den Kopf, dass ihr Kraushaar nur so flog.
Wenn sie keine Anrufe entgegennahmen, saßen sie vor dem Funkgerät und warteten auf weitere Informationen, wie alle anderen. Sven ging in ein angrenzendes Büro, nahm den Telefonhörer von der Gabel, bekam ein Freizeichen und rief zu Hause an.
«Hallo?»
«Ich bin es», sagte er. «Hast du es schon gehört?»
«Was soll ich gehört haben?» Bibbi gähnte. «Ich habe geschlafen. Wie spät ist es?»
«Auf Palme ist geschossen worden.»
«Was?»
«Auf Palme ist geschossen worden.»
«Warte, was? Was hast du gesagt?»
Er wiederholte es abermals.
«Großer Gott. Aber er lebt, oder?»