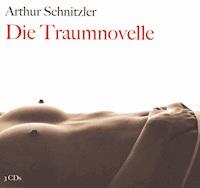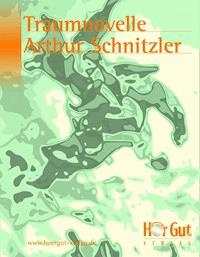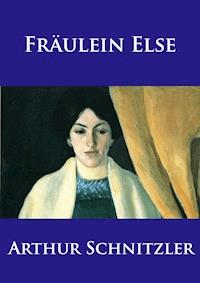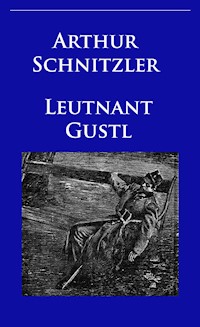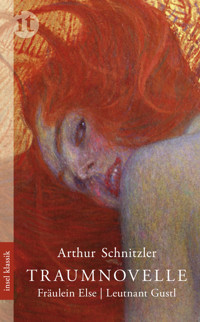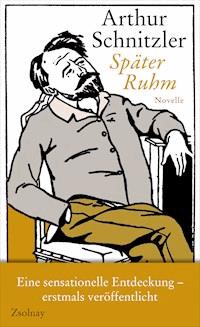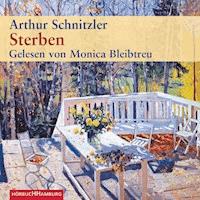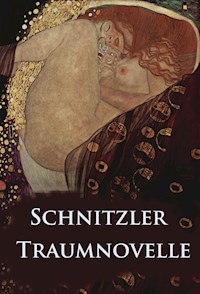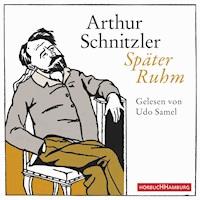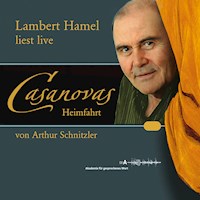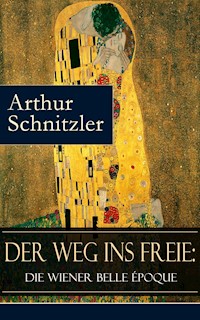
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: e-artnow
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dieses eBook: "Der Weg ins Freie: Die Wiener Belle Époque" ist mit einem detaillierten und dynamischen Inhaltsverzeichnis versehen und wurde sorgfältig korrekturgelesen. Zum Inhalt: Baron Georg geht zögerliche Schritte auf seinem Weg als frei schaffender Komponist. Zudem malt Schnitzler ein Bild der Belle Époque. Die Intellektuellen führen im Salon des Bankiers Ehrenberg konträre Gespräche über die Zukunft. Die Liebe des Barons Georg von Wergenthin zu der katholischen Kleinbürgerin Anna Rosner ist unglücklich. Der 27-jährige Georg, "ein schöner, schlanker, blonder Mann, Germane, Christ", lebt mit dem Bruder in der elterlichen Wohnung in Wien. Mutter und Vater sind verstorben. Georg komponiert. Die Wienerin Anna, das "gütige, sanfte, kluge Wesen" mit der schönen Stimme, singt seine Lieder. Georg begleitet die 23-jährige auf dem Pianino. Ihre Bühnenkarriere hat das talentierte Mädchen aufgegeben. Im Salon Ehrenberg trifft Georg nicht nur auf Else, die Tochter des Hauses, sondern auch auf die junge Jüdin Therese Golowski, eine führende Sozialdemokratin. Man tuschelt, diese Frau sei bereits wegen Majestätsbeleidigung inhaftiert gewesen. Therese ist Annas Freundin. Anna verdient sich ihren Unterhalt mit Musikunterricht. So musiziert sie unter anderem gelegentlich auch mit der Bankierstochter Else Arthur Schnitzler (1862-1931) war ein österreichischer Erzähler und Dramatiker. Er gilt als einer der bedeutendsten Vertreter der Wiener Moderne. Schnitzler schrieb Dramen und Prosa, in denen er das Augenmerk vor allem auf die psychischen Vorgänge seiner Figuren lenkt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 591
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Weg ins Freie: Die Wiener Belle Époque
Inhaltsverzeichnis
Erstes Kapitel
Inhaltsverzeichnis
Georg von Wergenthin saß heute ganz allein bei Tische. Felician, sein älterer Bruder, hatte es vorgezogen, nach längerer Zeit wieder einmal mit Freunden zu speisen. Aber Georg verspürte noch keine besondere Neigung, Ralph Skelton, den Grafen Schönstein, oder andere von den jungen Leuten wiederzusehen, mit denen er sonst gern plauderte; er fühlte sich vorläufig zu keiner Art von Geselligkeit aufgelegt.
Der Diener räumte ab und verschwand. Georg zündete sich eine Zigarette an, dann ging er nach seiner Gewohnheit in dem großen, dreifenstrigen, nicht sehr hohen Zimmer hin und her und wunderte sich, wie dieser Raum, der ihm durch viele Wochen wie verdüstert erschienen war, allmählich doch das frühere freundliche Aussehen wiederzugewinnen begann. Unwillkürlich ließ er seinen Blick auf dem leeren Sessel am oberen Tischende ruhen, über den durch das offene Mittelfenster die Septembersonne hinfloß, und es war ihm, als hätte er seinen Vater, der seit zwei Monaten tot war, noch vor einer Stunde dort sitzen gesehen; so deutlich stand ihm jede, selbst die kleinste Gebärde des Verstorbenen vor Augen, bis zu seiner Art die Kaffeetasse fortzurücken, den Zwicker aufzusetzen, in einer Broschüre zu blättern.
Georg dachte an eines der letzten Gespräche mit dem Vater, das im Spätfrühling stattgefunden hatte, kurz vor der Übersiedlung in die Villa am Veldeser See. Georg war damals eben aus Sizilien heimgekommen, wo er den April mit Grace verbracht hatte, auf einer melancholischen und ein wenig langweiligen Abschiedsreise, vor der endgültigen Rückkehr der Geliebten nach Amerika. Er hatte wieder ein halbes Jahr oder länger nichts Rechtes gearbeitet; nicht einmal das schwermütige Adagio war niedergeschrieben, das er in Palermo, an einem bewegten Morgen am Ufer spazierengehend, aus dem Rauschen der Wellen herausgehört hatte. Nun spielte er das Thema seinem Vater vor, phantasierte darüber mit einem übertriebenen Reichtum an Harmonien, der die einfache Melodie beinahe verschlang; und als er eben in eine wild modulierende Variation geraten war, hatte der Vater, vom anderen Ende des Flügels her, lächelnd gefragt: Wohin, wohin? Georg, wie beschämt, ließ den Schwall der Töne verklingen, und nun, herzlich wie immer, doch nicht in so leichtem Ton wie sonst, hatte der Vater mit dem Sohn ein Gespräch über dessen Zukunft zu führen begonnen, das diesem heute durch den Sinn zog, als wäre es von mancher Ahnung schwer gewesen.
Er stand am Fenster und blickte hinaus. Drüben der Park war ziemlich leer. Auf einer Bank saß eine alte Frau, die eine altmodische Mantille mit schwarzen Glasperlen um hatte. Ein Kindermädchen spazierte vorbei, einen Knaben an der Hand, ein anderer, ganz kleiner, in Husarenuniform, mit angeschnalltem Säbel, eine Pistole im Gürtel, lief voran, blickte stolz um sich und salutierte einem Invaliden, der rauchend des Weges kam. Tiefer im Garten, um den Kiosk, saßen wenige Leute, die Kaffee tranken und Zeitung lasen. Das Laub war noch ziemlich dicht, und der Park sah bedrückt, verstaubt und im ganzen viel sommerlicher aus, als sonst in späten Septembertagen. Georg stützte die Arme aufs Fensterbrett, beugte sich vor und betrachtete den Himmel. Seit dem Tode seines Vaters hatte er Wien nicht verlassen, trotz vieler Möglichkeiten, die ihm offen standen. Er hätte mit Felician auf das Schönsteinsche Gut fahren können; Frau Ehrenberg hatte ihn in einem liebenswürdigen Brief in den Auhof eingeladen; und zu einer Radtour durch Kärnten und Tirol, wie er sie längst plante, und zu der er sich allein nicht entschließen konnte, hätte er leicht einen Gefährten gefunden. Aber er blieb lieber in Wien und vertrieb sich die Zeit mit dem Durchblättern und dem Ordnen von alten Familienpapieren. Er fand Erinnerungen bis zu seinem Urgroßvater, Anastasius von Wergenthin, der aus der Rheingegend stammte und durch Heirat mit einem Fräulein Recco in den Besitz eines alten längst unbewohnbaren Schlößchens bei Bozen gekommen war. Auch Dokumente zur Geschichte von Georgs Großvater waren vorhanden, der im Jahre 1866 als Artillerieoberst vor Chlum gefallen war. Dessen Sohn, Felicians und Georgs Vater, hatte sich wissenschaftlichen, hauptsächlich botanischen Studien gewidmet und in Innsbruck das Doktorat der Philosophie abgelegt. Als Vierundzwanzigjähriger lernte er ein junges Mädchen kennen aus alter österreichischer Beamtenfamilie, das sich, vielleicht mehr um den engen und beinahe ärmlichen Zuständen ihres Hauses zu entfliehen, als aus innerstem Beruf, zur Sängerin ausgebildet hatte. Der Freiherr von Wergenthin sah und hörte sie zum ersten Male im Winter in einer Konzertaufführung der Missa solemnis, und schon im Mai darauf wurde sie seine Frau. Im zweiten Jahre der Ehe kam Felician, im dritten Georg zur Welt. Drei Jahre später begann die Baronin zu kränkeln und wurde von den Ärzten nach dem Süden geschickt. Da die Heilung auf sich warten ließ, wurde der Haushalt in Wien aufgelöst, und so fügte es sich, daß der Freiherr mit den Seinen durch viele Jahre eine Art von Hotel-und Wanderleben führen mußte. Ihn selbst führten Geschäfte und Studien manchmal nach Wien, die Söhne aber verließen ihre Mutter beinahe niemals. Man lebte in Sizilien, in Rom, in Tunis, in Korfu, in Athen, in Malta, in Meran, an der Riviera, zuletzt in Florenz; keineswegs auf großem Fuß, aber doch standesgemäß; und nicht so sparsam, daß nicht ein guter Teil des freiherrlichen Vermögens allmählich aufgezehrt worden wäre.
Georg war achtzehn Jahre alt, als seine Mutter starb. Neun Jahre waren seither verflossen, aber unverblaßt war ihm die Erinnerung an jenen Frühlingsabend, da Vater und Bruder zufällig nicht daheim gewesen waren, und er allein und ratlos am Bett der sterbenden Mutter gestanden hatte, während durch die eilig aufgerissenen Fenster, mit der Luft des Frühlings, das Reden und Lachen von Spaziergängern verletzend laut hereinklang.
Die Hinterbliebenen kehrten mit dem Leichnam der Mutter nach Wien zurück. Der Freiherr widmete sich seinen Studien mit einem neuen, wie verzweifelten Eifer. Früher hatte man ihn nur als vornehmen Liebhaber gelten lassen, jetzt begann man ihn auch in akademischen Kreisen durchaus ernst zu nehmen, und als er zum Ehrenpräsidenten der botanischen Gesellschaft gewählt wurde, hatte er diese Auszeichnung nicht allein dem Zufall eines adeligen Namens zu danken. Felician und Georg ließen sich als Hörer an der juridischen Fakultät einschreiben. Aber der Vater selbst war es, der es dem Jüngern nach einiger Zeit freistellte, die Universitätsstudien aufzugeben und sich seinen musikalischen Neigungen entsprechend weiter zu bilden, was dieser dankbar und erlöst annahm. Doch auch auf diesem selbstgewählten Gebiete war seine Ausdauer nicht bedeutend, und oft wochenlang hintereinander konnte er sich mit allerlei Dingen beschäftigen, die von seinem Wege weit ablagen. Diese spielerische Anlage war es auch, die ihn jene alten Familienpapiere mit einem Ernst durchblättern ließ, als gälte es wichtigen Geheimnissen der Vergangenheit nachzuforschen. Manche Stunde verbrachte er bewegt über Briefen, die seine Eltern in früheren Jahren miteinander gewechselt hatten, über sehnsüchtigen und flüchtigen, schwermütigen und beruhigten, aus denen ihm nicht nur die Hingeschiedenen selbst, sondern auch andere halbvergessene Menschen neu lebendig wurden. Da erschien ihm der deutsche Lehrer wieder, mit der traurigen blassen Stirn, der ihm auf langen Spaziergängen den Horaz vorzudeklamieren pflegte; das braune, wilde Kindergesicht des Prinzen Alexander von Mazedonien tauchte auf, in dessen Gesellschaft Georg in Rom die ersten Reitstunden genommen hatte; und in einer traumhaften Weise, wie mit schwarzen Linien an einen blaßblauen Horizont gezeichnet, ragte die Pyramide des Cestius auf, so wie Georg sie, von seinem ersten Ritt aus der Campagna heimkehrend, in der Abenddämmerung erblickt hatte. Und wenn er ins Weiterträumen geriet, zeigten sich Meeresufer, Gärten, Straßen, von denen er gar nicht wußte, aus welcher Landschaft, welcher Stadt sein Gedächtnis sie bewahrt hatte; Gestalten schwebten vorbei, manche vollkommen deutlich, die ihm einmal nur in gleichgültiger Stunde begegnet waren, andere wieder, mit denen er zu irgend einer Zeit viele Tage zusammen gewesen sein mochte, schattenhaft und fern. Als Georg nach Sichtung jener alten Briefe auch seine eigenen Papiere in Ordnung brachte, fand er in einer alten, grünen Mappe musikalische Entwürfe aus der Knabenzeit, die ihm bis auf die Tatsache ihres Vorhandenseins so vollkommen entschwunden waren, daß man sie ihm ohne weiteres als die Aufzeichnungen eines anderen hätte vorlegen können. Von manchen war er angenehm schmerzlich überrascht, denn sie schienen ihm Versprechungen zu enthalten, die er vielleicht niemals erfüllen sollte. Und doch spürte er gerade in der letzten Zeit, daß sich irgend etwas in ihm vorbereitete. Er sah es wie eine geheimnisvolle aber sichere Linie, die von jenen ersten hoffnungsvollen Niederschriften in der grünen Mappe zu neuen Einfällen wies; und das wußte er: die zwei Lieder aus dem west-östlichen Divan, die er heuer im Sommer komponiert hatte, an einem schwülen Nachmittag, während Felician in der Hängematte lag und der Vater auf der kühlen Terrasse im Lehnstuhl arbeitete, hätte nicht der erstbeste ersinnen können.
Wie von einem gänzlich unerwarteten Gedanken überrascht wich Georg einen Schritt vom Fenster zurück. Mit solcher Deutlichkeit war er noch nie inne geworden, daß seine Existenz seit dem Tode des Vaters bis zum heutigen Tage gleichsam unterbrochen gewesen war. An Anna Rosner, der er jene Lieder im Manuskript zugesandt, hatte er die ganze Zeit über nicht gedacht. Und wie ihm nun einfiel, daß er ihre wohllautende, dunkle Stimme wieder hören und sie auf dem etwas dumpfen Pianino zum Gesang begleiten durfte, sobald er nur wollte, war er angenehm bewegt. Und er erinnerte sich des alten Hauses in der Paulanergasse, des niederen Tors, der schlecht beleuchteten Stiege, die er bisher nicht öfter als drei-oder viermal hinaufgegangen war, wie man an Liebgewordenes und längst Bekanntes denkt.
Im Park drüben ging ein leichtes Wehen durch die Blätter. Über der Stephansturmspitze, die dem Fenster, durch den Park und einen beträchtlichen Teil der Stadt getrennt, gerade gegenüberlag, erschienen dünne Wolken. Ein langer Nachmittag, völlig ohne Verpflichtungen dehnte sich vor Georg aus. Im Laufe der zwei Trauermonate, so wollte es ihm scheinen, hatten sich alle Beziehungen früherer Zeit gelockert oder gelöst. Er dachte an den verflossenen Winter und Frühling, mit ihrem vielfach verschlungenen und wirren Treiben, und allerlei Erinnerungen tauchten bildhaft vor ihm auf: Die Fahrt mit Frau Mariannen im geschlossenen Fiaker durch den verschneiten Wald. Der maskierte Abend bei Ehrenbergs, mit Elses tiefsinnig-kindlichen Bemerkungen über die »Hedda Gabler«, der sie sich verwandt zu fühlen behauptete, und mit Sissys raschem Kuß unter den schwarzen Spitzen der Larve. Eine Bergtour im Schnee, von Edlach aus auf die Rax, mit dem Grafen Schönstein und Oskar Ehrenberg, der – ohne angeborene alpine Neigungen – gern die Gelegenheit ergriffen hatte, sich zwei hochgeborenen Herren anzuschließen. Der Abend bei Ronacher mit Grace und dem jungen Labinski, der sich vier Tage darauf erschossen, man hatte nie recht erfahren, ob wegen Grace, wegen Schulden, aus Lebensüberdruß, oder ausschließlich aus Affektation. Das seltsame glühend-kalte Gespräch mit Grace auf dem Friedhof im schmelzenden Feberschnee, zwei Tage nach Labinskis Begräbnis. Der Abend im heißen, hochgewölbten Fechtsaal, wo Felicians Degen die gefährliche Waffe des italienischen Meisters kreuzte. Der nächtliche Spaziergang nach dem Paderewski-Konzert, auf dem der Vater ihm so vertraut wie nie zuvor von jenem fernen Abend sprach, da die verstorbene Mutter in dem gleichen Saal, aus dem sie eben kamen, in der Missa solemnis gesungen hatte. Und endlich erschien ihm Anna Rosners hohe, ruhige Gestalt, am Klaviere lehnend, das Notenblatt in der Hand, die blauen, lächelnden Augen auf die Tasten gerichtet; und er hörte sogar ihre Stimme in seiner Seele klingen.
Während er so am Fenster stand und in den Park hinunterschaute, der sich allmählich belebte, empfand er es wie beruhigend, daß er zu keinem menschlichen Wesen in engerer Beziehung stand, und daß es doch manche gab, mit denen er wieder anknüpfen, in deren Kreis er wieder eintreten durfte, sobald es ihm nur beliebte. Zugleich fühlte er sich wunderbar ausgeruht, für Arbeit und Glück bereit wie niemals zuvor. Er war voll guter und kühner Vorsätze, seiner Jugend und Unabhängigkeit sich mit Freuden bewußt. Zwar fühlte er mit einiger Beschämung, daß, in diesem Augenblick wenigstens, seine Trauer um den hingeschiedenen Vater sehr gemildert war; doch fand er für diese Gleichgültigkeit einen Trost in sich, da er des quallosen Endes gedachte, das dem teuren Mann beschieden war. Im Garten, heiter mit den beiden Söhnen plaudernd, war er auf und abgegangen, hatte mit einem Mal um sich geschaut, als hörte er ferne Stimmen, hatte dann aufgeblickt, zum Himmel empor, und war plötzlich tot auf die Wiese hingesunken, ohne Schmerzenslaut, ja ohne Zucken der Lippen.
Georg trat ins Zimmer zurück, machte sich zum Fortgehen fertig und verließ das Haus. Seine Absicht war es, ein paar Stunden herumzuspazieren, wohin der Zufall ihn führen mochte, und abends endlich wieder an seinem Quintett weiterzuarbeiten, wofür ihm nun die rechte Stimmung gekommen schien. Er überschritt die Straße und betrat den Park. Die Schwüle hatte nachgelassen. Noch immer saß die alte Frau mit der Mantille auf der Bank und starrte vor sich hin. Auf dem sandigen Rund um die Bäume spielten Kinder. Um den Kiosk waren alle Stühle besetzt. Im Wetterhäuschen saß ein glattrasierter Herr, den Georg vom Sehen kannte, und der ihm durch seine Ähnlichkeit mit dem alten Grillparzer aufgefallen war. Am Teich kam Georg eine Gouvernante entgegen, mit zwei schön gekleideten Kindern und betrachtete ihn mit leuchtendem Blick. Als er aus dem Park auf die Ringstraße trat, begegnete ihm Willy Eißler in langem dunkelgestreiften Herbstpaletot und sprach ihn an:
»Guten Tag, Baron, sind Sie auch schon wieder in Wien eingerückt?«
»Ich bin schon lange zurück«, erwiderte Georg. »Nach dem Begräbnis meines Vaters hab’ ich Wien nicht mehr verlassen.«
»Ja, ja, natürlich… Gestatten Sie, daß ich Ihnen nochmals…« Und Willy drückte Georg die Hand.
»Und was haben Sie denn heuer im Sommer getrieben?« fragte Georg.
»Allerlei. Tennis gespielt, gemalt, Zeit vertrödelt, einige amüsante und noch mehr langweilige Stunden verlebt…« Willy sprach äußerst rasch, wie mit einer absichtlichen leisen Heiserkeit, scharf, salopp, mit ungarischen, französischen, wienerischen, jüdischen Akzenten. »Übrigens, wie Sie mich da sehen«, fuhr er fort, »bin ich heute früh aus Przemysl gekommen.«
»Waffenübung?«
»Jawohl, letzte. Ich sag’s mit Wehmut. So sehr ich mich dem Greisenalter nähere, es hat mir doch noch immer Spaß gemacht, so mit den gelben Aufschlägen umherzuwandeln, Sporen klirrend, Säbel scheppernd, eine Ahnung drohender Gefahr verbreitend, und von mangelhaften Lavaters für einen bessern Grafen gehalten zu werden.« Sie spazierten weiter, dem Gitter des Stadtparks entlang.
»Gehen Sie vielleicht zu Ehrenbergs?« fragte Willy.
»Nein, ich denke gar nicht daran.«
»Weil’s der Weg ist. Haben Sie übrigens gehört, Fräulein Else soll verlobt sein.«
»So?« fragte Georg gedehnt. »Mit wem denn?«
»Raten S’ Baron.«
»Am Ende Hofrat Wilt?«
»O fröhlich!« rief Willy. »Der denkt wohl nicht daran! Die Verschwägerung mit S. Ehrenberg könnte ihm doch am Ende die Ministerkarriere erschweren – heutzutage«
»Rittmeister Ladisc?« riet Georg weiter.
»Ah dazu ist Fräulein Else doch zu gescheit, daß sie dem hineinfällt.«
Jetzt erinnerte sich Georg, daß sich Willy vor ein paar Jahren mit Ladisc geschlagen hatte. Willy fühlte Georgs Blick, zwirbelte den blonden, in polnischer Art herabhängenden Schnurrbart mit etwas nervösen Fingern hin und her und sprach rasch und beiläufig: »Der Umstand, daß ich mit dem Rittmeister Ladisc einmal eine Differenz gehabt hab’, kann mich nicht hindern, in loyaler Weise anzuerkennen, daß er immer ein versoffenes Schwein gewesen ist. Ich hab’ nämlich eine unüberwindliche, auch durch Blut nicht abzuwaschende Abneigung gegen die Leute, die sich bei den Juden anfressen und schon auf der Treppe über sie zu schimpfen anfangen. Bis ins Kaffeehaus kann man doch warten. Aber strengen Sie sich nicht weiter mit dem Raten an, Heinrich Bermann soll der Glückliche sein.«
»Nicht möglich«, rief Georg.
»Warum?« fragte Eißler. »Einer wird’s ja doch schließlich werden. Bermann ist zwar kein Adonis, aber er ist auf dem Wege zum Ruhm; und das Gemisch von Herrenreiter und Athleten in höchster Vollendung, das sich Else offenbar erträumt hat, wird sie ja doch kaum finden. Vierundzwanzig Jahre ist sie indessen alt geworden, vor Salomons Taktlosigkeiten und Witzen dürfte ihr auch schon genügend grausen… also…«
»Salomon?… ach ja… Ehrenberg«.
»Sie kennen ihn auch nur unter dem Namen ›S‹?… S. heißt natürlich Salomon, und daß nur S. auf der Tafel an der Tür steht, ist eine Konzession, die er den Seinen gemacht hat. Wenn es nach ihm ginge, möchte er am liebsten zu den Gesellschaften, die Madame Ehrenberg gibt, im Kaftan und mit den gewissen Löckchen erscheinen.«
»Sie glauben…? Er ist doch nicht so fromm?«
»Fromm… o fröhlich! Mit der Frömmigkeit hat das allerdings nichts zu tun. Es ist nur Bosheit, hauptsächlich gegen seinen Sohn Oskar mit den feudalen Bestrebungen.«
»Ach so«, sagte Georg lächelnd. »Ist denn Oskar nicht schon längst getauft? Er ist ja Reserveoffizier bei den Dragonern.«
»Ach darum… Nun, ich bin auch nicht getauft und trotzdem… Ja, es gibt immer ein paar Ausnahmen… Mit einigem guten Willen…« Er lachte und fuhr fort: »Was übrigens Oskar anbelangt, so möchte er gewiß lieber katholisch sein. Aber das Vergnügen beichten gehen zu dürfen, käme ihm vorläufig doch noch zu teuer zu stehen. Es wird wohl auch im Testament vorgesehen sein, daß Oskar nicht überhüpft.«
Sie waren vor dem Café Imperial angelangt. Willy blieb stehen. »Ich habe da ein Rendezvous mit Demeter Stanzides.«
»Grüßen Sie ihn, bitte.«
»Danke bestens. Kommen Sie nicht mit hinein, auf ein Eis?«
»Danke, ich bummle noch ein bißchen.«
»Sie lieben die Einsamkeit?«
»Auf so allgemeine Fragen läßt sich schwer antworten«, erwiderte Georg.
»Allerdings«, sagte Willy, wurde plötzlich ernst und lüftete den Hut. »Habe die Ehre, Herr Baron.«
Georg reichte ihm die Hand. Er fühlte, daß Willy ein Mensch war, der ununterbrochen eine Stellung verteidigte, wenn auch ohne dringende Notwendigkeit. »Auf Wiedersehen«, sagte er mit unvermittelter Herzlichkeit. Er empfand es, wie schon öfters, als beinahe sonderbar, daß Willy Jude war. Schon der alte Eißler, Willys Vater, der anmutige Wiener Walzer und Lieder komponierte, sich kunst-und altertumsverständig mit dem Sammeln, zuweilen auch mit dem Verkauf von Antiquitäten befaßte und seinerzeit als der berühmteste Boxer von Wien gegolten hatte, mit seiner Riesengestalt, dem langen, grauen Vollbart und dem Monokel, sah eher einem ungarischen Magnaten ähnlich, als einem jüdischen Patriarchen; aus Willy aber hatten Anlage, Liebhaberei und eiserner Wille das täuschende Ebenbild eines geborenen Kavaliers gebildet. Was ihn jedoch vor andern jungen Leuten seines Stammes und seines Strebens auszeichnete, war der Umstand, daß er gewohnt war, seine Abstammung nie zu verleugnen, für jedes zweideutige Lächeln Aufklärung oder Rechenschaft zu fordern und sich gelegentlich über alle Vorurteile und Eitelkeiten, in denen er oft befangen schien, selber lustig zu machen.
Georg schlenderte weiter. Die letzte Frage Willys klang ihm nach. Ob er die Einsamkeit liebte?… Er erinnerte sich daran, wie er in Palermo ganze Vormittage allein herumspaziert war, während Grace ihrer Gewohnheit gemäß bis Mittag im Bette lag. Grace… Wo mochte sie jetzt sein…? Seit sie in Neapel von ihm Abschied genommen, hatte sie nichts mehr von sich hören lassen, wie es übrigens verabredet gewesen war. Er dachte an die tiefblaue Nacht, die über den Wassern schwebte, als er nach jenem Abschied allein nach Genua gefahren war, und an den seltsamen, leisen, wie märchenhaften Gesang zweier Kinder, die dicht aneinandergeschmiegt, gemeinsam in einen Plaid gehüllt, an der Seite ihrer schlafenden Mutter auf dem Verdeck gesessen waren.
Mit wachsendem Behagen spazierte er unter den Leuten weiter, die in sonntäglicher Lässigkeit an ihm vorübergingen. Mancher freundliche Frauenblick begegnete dem seinen und schien ihn darüber trösten zu wollen, daß er an diesem schönen Feiernachmittag einsam und mit allen äußern Abzeichen der Trauer umherwandelte. Und wieder tauchte ein Bild in ihm auf. Er sah sich auf einer hügeligen Wiese liegen, spät abends, nach einem heißen Junitag. Dunkelheit ringsum. Tief unter ihm Gewirr von Menschen, Lachen und Lärm, glitzernde Lampions. Ganz nah aus dem Dunkel Mädchenstimmen… Er zündet die kleine Pfeife an, die er nur auf dem Land zu rauchen pflegt; beim Schein des Zündhölzchens sieht er zwei hübsche, ganz junge Bauerndirnen, beinah noch Kinder. Er plaudert mit ihnen. Sie haben Angst, weil es so finster ist; sie schmiegen sich an ihn. Plötzlich Geknatter, Raketen in der Luft. Von unten ein lautes »Ah«. Bengalisches Licht, violett und rot, über dem unsichtbaren See in der Tiefe. Die Mädchen den Hügel hinab, verschwinden. Dann wird es wieder dunkel, und er liegt allein, schaut in die Finsternis hinauf, die schwül auf ihn herabsinken will. Dies war die Nacht vor dem Tage gewesen, da sein Vater sterben mußte. Und auch ihrer dachte er heute zum erstenmal.
Er hatte die Ringstraße verlassen, nahm die Richtung der Wieden zu. Ob die Rosners an diesem schönen Tage zu Hause waren? Immerhin lohnte es den kurzen Weg, und jedenfalls zog es ihn mehr dorthin, als zu Ehrenbergs. Nach Else sehnte er sich gar nicht, und ob sie wirklich Heinrich Bermanns Braut sein mochte oder nicht, war ihm beinahe gleichgültig. Er kannte sie schon lange. Sie war elf, er vierzehn Jahre alt gewesen, als sie an der Riviera miteinander Tennis gespielt hatten. Damals glich sie einem Zigeunermädel. Blauschwarze Locken umwirbelten ihr Stirn und Wangen, und ausgelassen war sie wie ein Bub. Ihr Bruder spielte schon damals den Lord, und Georg mußte noch heute lächeln, wenn er sich erinnerte, wie der Fünfzehnjährige eines Tages im lichtgrauen Schlußrock, mit weißen, schwarztamburierten Handschuhen und einem Monokel im Aug, auf der Promenade erschienen war. Frau Ehrenberg war damals vierunddreißig Jahre alt, hoheitsvoll, von übergroßer Gestalt, dabei noch schön, hatte verschleierte Augen und war meistens sehr müde. Es blieb unvergeßlich für Georg, wie eines Tages ihr Gemahl, der millionenreiche Patronenfabrikant, die Seinen überraschte und einfach durch sein Erscheinen der ganzen Ehrenbergischen Vornehmheit ein rasches Ende bereitet hatte. Georg sah ihn noch vor sich, so wie er während des Frühstücks auf der Hotelterrasse aufgetaucht war; ein kleiner, magerer Herr mit graumeliertem Vollbart und japanischen Augen, in weißem schlecht gebügelten Flanellanzug, einen dunklen Strohhut mit rotweiß gestreiftem Band auf dem runden Kopf, und mit schwarzen, bestaubten Schuhen. Er redete sehr gedehnt, immer wie höhnisch, selbst über die gleichgültigsten Dinge; und so oft er den Mund auftat, lag es unter dem Schein der Ruhe wie eine geheime Angst auf dem Antlitz der Gattin. Sie versuchte sich zu rächen, indem sie ihn mit Spott behandelte; aber gegen seine Rücksichtslosigkeit kam sie nicht auf. Oskar benahm sich, wenn es irgend möglich war, als gehörte er nicht dazu. In seinen Zügen spielte eine etwas unsichere Verachtung für den seiner nicht ganz würdigen Erzeuger, und Verständnis suchend lächelte er zu den jungen Baronen hinüber. Nur Else war zu jener Zeit sehr nett mit dem Vater. Auf der Promenade hing sie sich gern in seinen Arm, und manchmal fiel sie ihm vor allen Leuten um den Hals.
In Florenz, ein Jahr vor seiner Mutter Tod, hatte Georg Else wiedergesehen. Sie nahm damals Zeichenstunden bei einem alten, grau-und wirrhaarigen Deutschen, von dem die Sage ging, daß er einmal berühmt gewesen wäre. Er selbst verbreitete das Gerücht über sich, daß er seinen frühern, sehr bekannten Namen, als er sein Genie schwinden fühlte, abgelegt und die Stätte seines Wirkens, die er niemals nannte, verlassen hätte. Schuld an seinem Niedergang trug, wenn man seinen Berichten glauben durfte, ein dämonisches Frauenzimmer, das er geheiratet, das in einem Eifersuchtsanfall sein bedeutendstes Bild zerstört und durch einen Sprung vom Fenster ihr Leben geendet hatte. Dieser Mensch, den sogar der siebzehnjährige Georg als eine Art von schwindelhaftem Narren erkannte, war der Gegenstand von Elses erster Schwärmerei. Sie war damals vierzehn Jahre alt, die Wildheit und Unbefangenheit der Kindheit war dahin. Vor der Tizianschen Venus in den Uffizien glühten ihr die Wangen in Neugier, Sehnsucht und Bewunderung, und in ihren Augen spielten dunkle Träume von künftigen Erlebnissen. Öfters kam sie mit ihrer Mutter in das Haus, das die Wergenthins am Lungano gemietet hatten; und während Frau Ehrenberg die leidende Baronin in ihrer müd-geistreichen Weise zu unterhalten suchte, stand Else mit Georg am Fenster, führte altkluge Gespräche über die Kunst der Präraffaeliten und lächelte der vergangenen kindischen Spiele. Auch Felician erschien zuweilen, schlank und schön, blickte mit seinen kalten, grauen Augen an Dingen und Menschen vorbei, sprach ein paar höfliche Worte, halblaut, beinahe wegwerfend, und setzte sich ans Bett seiner Mutter, der er zärtlich die Hand streichelte und küßte. Gewöhnlich ging er bald wieder fort, nicht ohne für Else einen herben Duft von uralter Vornehmheit, kaltblütiger Verführung und eleganter Todesverachtung zurückzulassen. Stets hatte sie den Eindruck, als begebe er sich an einen Spieltisch, an dem es um Hunderttausende herging, zu einem Duell auf Tod und Leben, oder zu einer Fürstin mit rotem Haar und einem Dolch auf dem Nachttisch. Georg erinnerte sich, daß er sowohl auf den schwindelhaften Zeichenlehrer, als auf seinen Bruder ein wenig eifersüchtig gewesen war. Der Lehrer, aus Gründen, über die niemals etwas verlautete, wurde plötzlich entlassen, und kurz darauf fuhr Felician mit dem Freiherrn von Wergenthin nach Wien. Nun spielte Georg noch öfter als früher den Damen auf dem Klaviere vor, Fremdes und Eigenes, und Else sang mit ihrer kleinen, etwas schrillen Stimme leichtere Schubertsche und Schumannsche Lieder vom Blatt. Sie besuchte mit ihrer Mutter und Georg die Galerien und Kirchen; als das Frühjahr wiederkam, gab es gemeinschaftliche Spazierfahrten auf dem Hügelweg oder nach Fiesole, und lächelnde Blicke gingen zwischen Georg und Else hin und her, die von einem tieferen Einverständnis erzählten, als tatsächlich vorhanden war. In dieser etwas unaufrichtigen Art spielten die Beziehungen weiter, als der Verkehr in Wien aufgenommen und fortgesetzt wurde. Immer von neuem schien Else von dem gleichmäßig freundlichen Wesen wohltätig berührt, mit dem Georg ihr auch dann entgegentrat, wenn sie einander monatelang nicht gesehen hatten. Sie selbst aber war von Jahr zu Jahr äußerlich sicherer und innerlich unruhiger geworden. Ihre künstlerischen Bestrebungen hatte sie früh genug alle fallen lassen, und im Laufe der Zeit erschien sie sich zu den verschiedensten Lebensläufen ausersehen. Manchmal sah sie sich in der Zukunft als Weltdame, Veranstalterin von Blumenfesten, Patronesse von großen Bällen, Mitwirkende an aristokratischen Wohltätigkeitsvorstellungen; öfters noch glaubte sie sich berufen in einem künstlerischen Salon unter Malern, Musikern und Dichtern als große Versteherin zu thronen. Dann träumte sie wieder von einem mehr ins Abenteuerliche gerichteten Leben: sensationelle Heirat mit einem amerikanischen Millionär, Flucht mit einem Violinvirtuosen oder spanischen Offizier, dämonisches Zugrunderichten aller Männer, die sich ihr näherten. Zuweilen schien ihr aber ein stilles Dasein auf dem Land, an der Seite eines tüchtigen Gutsbesitzers, das erstrebenswerteste Ziel; und dann erblickte sie sich im Kreise von vielen Kindern, womöglich mit früh ergrautem Haar, ein mild resigniertes Lächeln auf den Lippen, an einfach gedecktem Tisch sitzen und ihrem ernsten Manne die Falten von der Stirne streichen. Georg aber fühlte immer, daß ihre Neigung zur Bequemlichkeit, die tiefer war, als sie selbst ahnte, sie vor jedem unbedachten Schritt schützen würde. Sie vertraute Georg mancherlei an, ohne jemals ganz ehrlich mit ihm zu sein; denn am öftesten und ernstesten hegte sie den Wunsch, seine Frau zu werden. Georg wußte das wohl, aber nicht allein darum erschien ihm das neueste Gerücht von ihrer Verlobung mit Heinrich Bermann ziemlich unglaubwürdig. Dieser Bermann war ein hagerer, bartloser Mensch mit düstern Augen und etwas zu langem schlichten Haar, der sich in der letzten Zeit als Schriftsteller bekannt gemacht hatte, und dessen Gebaren und Aussehen Georg, er wußte selbst nicht warum, an einen fanatischen jüdischen Lehrer aus der Provinz erinnerten. Das war nichts, was Else besonders fesseln, oder nur angenehm berühren konnte. Allerdings, wenn man länger mit ihm sprach, änderte sich jener Eindruck. Eines Abends im vergangenen Frühjahr war Georg mit ihm zusammen von Ehrenbergs fortgegangen, und sie waren in eine so anregende Unterhaltung über musikalische Dinge geraten, daß sie bis drei Uhr früh auf einer Ringstraßenbank weitergeplaudert hatten.
Es ist sonderbar, dachte Georg, wie vieles mir heute durch den Kopf geht, woran ich kaum mehr gedacht hatte. Und ihm war, als wenn er in dieser Herbstabendstunde allmählich aus der schmerzlich-dumpfen Versonnenheit vieler Wochen zum Tage emporgetaucht käme.
Nun stand er vor dem Hause in der Paulanergasse, wo die Rosners wohnten. Er sah zum zweiten Stockwerk auf. Ein Fenster war offen, weiße Tüllvorhänge in der Mitte zusammengesteckt, bewegten sich im leichten Zuge des Windes.
Rosners waren zu Hause. Das Stubenmädchen ließ Georg eintreten. Anna saß der Türe gegenüber, hielt die Kaffeetasse in der Hand und hatte die Augen auf den Eintretenden gerichtet. Der Vater, zu ihrer Rechten, las Zeitung und rauchte aus einer Pfeife. Er war glatt rasiert, nur an den Wangen liefen zwei schmale, ergraute Bartstreifen. Sein dünnes Haar von seltsam grünlichgrauer Färbung war an den Schläfen nach vorn gestrichen und sah aus wie eine schlecht gemachte Perücke. Seine Augen waren wasserhell und rot gerändert.
Die beleibte Mutter, mit der wie von einer Erinnerung schönerer Jahre umwobenen Stirn, blickte vor sich hin; ihre Hände, beschaulich ineinander verschlungen, ruhten auf dem Tisch. Anna stellte die Tasse langsam nieder, nickte und lächelte still. Die beiden Alten machten Miene aufzustehen, als Georg eintrat.
»Aber bitte, sich doch nicht stören zu lassen, bitte sehr«, sagte Georg.
Da krachte etwas an der Seitenwand. Josef, der Sohn des Hauses, erhob sich vom Diwan, auf dem er gelegen hatte.
»Habe die Ehre, Herr Baron«, sagte er mit einer sehr tiefen Stimme und strich sein über den Hals hinaufgeschlagenes, gelbkariertes, etwas fleckiges Sacco zurecht.
»Wie befinden sich immer, Herr Baron?« fragte der Alte, stand hager und etwas gebückt da und wollte nicht wieder Platz nehmen, eh sich Georg niedergelassen hatte. Josef rückte einen Stuhl zwischen Vater und Schwester. Anna reichte dem Besucher die Hand.
»Wir haben uns lange nicht gesehen«, sagte sie und trank einen Schluck aus ihrer Tasse.
»Sie haben traurige Zeiten durchgemacht, Herr Baron«, bemerkte Frau Rosner teilnahmsvoll.
»Jawohl«, fügte Herr Rosner hinzu. »Wir haben mit großem Bedauern von dem schweren Verluste gelesen… Und der Herr Vater haben sich doch immer der besten Gesundheit erfreut, so viel uns bekannt war.« Er sprach sehr langsam, immer, als wenn noch etwas kommen sollte, strich sich manchmal mit der linken Hand über den Kopf und nickte, während er zuhörte.
»Ja, es ist sehr unerwartet gekommen«, sagte Georg leise und blickte auf den dunkelroten, verschossenen Teppich zu seinen Füßen.
»Also ein plötzlicher Tod, sozusagen«, bemerkte Herr Rosner, und alles ringsum schwieg.
Georg nahm eine Zigarette aus seinem Etui und bot Josef eine an.
»Küß die Hand«, sagte Josef, nahm die Zigarette und verbeugte sich, indem er ohne ersichtlichen Grund die Hacken aneinander schlug. Während er dem Baron Feuer gab, glaubte er dessen Blicke auf sein Sacco gerichtet und bemerkte entschuldigend und mit noch tieferer Stimme als gewöhnlich: »Bureaujanker.«
»Bureaujanker kommt von Bureau«, sagte Anna einfach, ohne ihren Bruder anzusehen.
»Fräulein belieben die ironische Walze eingehängt zu haben«, erwiderte Josef heiter; doch war es dem gehaltenen Ton seiner Rede anzumerken, daß er sich unter andern Verhältnissen minder angenehm ausgedrückt hätte.
»Die Teilnahme war ja eine allgemeine«, begann der alte Rosner wieder. »Ich habe den Nachruf in der Neuen Freien Presse gelesen über den Herrn Papa… von Herrn Hofrat Kerner, wenn ich mich recht erinnere; er war ja höchst ehrenvoll. Auch die Wissenschaft hat einen herben Verlust erlitten.«
Georg nickte verlegen und blickte auf seine Hände nieder.
Anna sprach von ihrem verflossenen Sommeraufenthalt. »In Weißenfeld war’s wunderschön«, sagte sie. »Gleich hinter unserm Haus war der Wald, mit sehr guten ebenen Wegen… nicht wahr, Papa? Da hat man stundenlang spazierengehen können, ohne einem Menschen zu begegnen.«
»Und haben Sie denn ein Klavier draußen gehabt?« fragte Georg.
»Auch das.«
»Ein greulicher Klimperkasten«, bemerkte Herr Rosner. »So ein Ding, das Stein erweichen, Menschen rasend machen kann.«
»Es war nicht so arg«, sagte Anna.
»Für die kleine Graubinger gut genug«, fügte Frau Rosner hinzu.
»Die kleine Graubinger ist nämlich die Tochter vom Kaufmann im Ort«, erklärte Anna, »und ich hab ihr die Anfangsgründe des Klavierspiels beigebracht. Ein hübsches, kleines Mäderl mit langen, blonden Zöpfen.«
»Es war eine Gefälligkeit für den Kaufmann«, sagte Frau Rosner.
»Ja, aber es muß bemerkt werden«, ergänzte Anna, »daß ich außerdem eine wirkliche, das heißt bezahlte Stunde gegeben habe.«
»Wie, auch in Weißenfeld?« fragte Georg.
»Kinder, von einer Sommerpartie. Es ist übrigens schade, Herr Baron, daß Sie kein einziges Mal bei uns auf dem Lande waren. Es hätte Ihnen gewiß gut gefallen.«
Georg erinnerte sich nun erst, daß er sich zu Anna beiläufig geäußert hatte, er würde sie im Sommer gelegentlich einer Radpartie vielleicht einmal besuchen.
»Der Herr Baron hätte wohl in dieser Sommerfrische nicht alles zu seiner Zufriedenheit vorgefunden«, begann Herr Rosner.
»Warum denn?« fragte Georg.
»Es ist dort nicht eben den Bedürfnissen verwöhnter Großstädter Rechnung getragen.«
»O ich bin nicht verwöhnt«, sagte Georg.
»… Waren Sie auch nicht auf dem Auhof?« wandte sich Anna an Georg.
»O nein«, erwiderte dieser rasch. »Nein, ich war nicht dort«, setzte er minder lebhaft hinzu. »Man hat mich allerdings aufgefordert… Frau Ehrenberg war so liebenswürdig…. ich habe verschiedene Einladungen gehabt für den Sommer. Aber ich habe es vorgezogen, für mich allein in Wien zu bleiben.«
»Es tut mir eigentlich leid«, sagte Anna, »daß ich Else beinah gar nicht mehr sehe. Sie wissen ja, daß wir im selben Institut waren. Es ist freilich schon lang her. Ich hab sie wirklich gern gehabt. Schade, daß man sich im Lauf der Zeit so voneinander entfernt.«
»Wie kommt das nur?« sagte Georg.
»Ja, es liegt wohl daran, daß mir der ganze Kreis nicht besonders sympathisch ist.«
»Mir auch nicht«, sagte Josef, der Ringe in die Luft blies. »Ich gehe seit Jahren nicht hin. Offen gestanden… ich weiß ja nicht, wie Herr Baron zu dieser Frage Stellung nehmen… ich bin den Israeliten nicht zugetan.«
Herr Rosner blickte zu seinem Sohne auf. »Der Herr Baron verkehrt in diesem Haus, und es wird ihm ziemlich sonderbar erscheinen, lieber Josef…«
»Mir?« sagte Georg verbindlich. »Ich stehe ja in keinerlei näheren Verbindungen mit dem Hause Ehrenberg, so gern ich mit den beiden Damen zu plaudern pflege.« Und fragend setzte er hinzu: »Aber haben Sie Else nicht im vorigen Jahr Singstunden gegeben, Fräulein Anna?«
»Ja. Vielmehr… ich habe nur mit ihr korrepetiert.«
»Das werden Sie heuer wohl wieder tun?«
»Ich weiß nicht. Sie hat bisher noch nichts von sich hören lassen. Vielleicht gibt sie’s ganz auf.«
»Sie glauben?«
»Es wäre beinah zu wünschen«, versetzte Anna sanft, »denn eigentlich hat sie immer mehr gepiepst, als gesungen. Übrigens«, und jetzt warf sie Georg einen Blick zu, der ihn gleichsam von neuem begrüßte, »die Lieder, die Sie mir geschickt haben, sind sehr hübsch. Soll ich sie Ihnen vorsingen?«
»Sie haben sich die Sachen schon angeschaut? Das ist nett.«
Anna hatte sich erhoben. Sie führte beide Hände an ihre Schläfen und strich wie ordnend, leicht über ihr gewolltes Haar. Sie trug es ziemlich hoch frisiert, wodurch ihre Gestalt noch größer erschien, als sie war. Eine schmale, goldene Uhrkette war zweimal um den freien Hals geschlungen, fiel über die Brust herab und verlor sich in dem grauledernen Gürtel. Durch eine fast unmerkliche Kopfbewegung forderte sie Georg auf, ihr zu folgen.
Er stand auf und sagte: »Wenn’s erlaubt ist…«
»Bitte sehr, bitte sehr, natürlich«, sagte Herr Rosner. »Herr Baron wollen so freundlich sein, mit meiner Tochter ein wenig zu musizieren. Sehr schön, sehr schön.« Anna war in das Nebenzimmer getreten. Georg folgte ihr und ließ die Tür offen stehen. Die weißen Tüllvorhänge vor dem geöffneten Fenster waren zusammengesteckt und bewegten sich leise.
Georg setzte sich an das Pianino und griff ein paar Akkorde. Indes kniete Anna vor einer alten, schwarzen, teilweise vergoldeten Etagere und holte die Noten hervor.
Georg modulierte in die Anfangsakkorde seines Liedes.
Anna fiel ein, und zu Georgs Melodie sang sie die Goetheschen Worte.
»Deinem Blick mich zu bequemen, Deinem Munde, deiner Brust, Deine Stimme zu vernehmen, War mir erst’ und letzte Lust.«
Sie stand hinter ihm und schaute über seine Schulter in die Noten. Zuweilen beugte sie sich ein wenig vor, und dann fühlte er an der Schläfe den Hauch ihrer Lippen. Ihre Stimme war viel schöner, als seine Erinnerung sie bewahrt hatte.
Im Nebenzimmer wurde etwas zu laut gesprochen. Ohne den Gesang zu unterbrechen, lehnte Anna die Türe zu.
Josef war es gewesen, der sein Organ nicht länger hatte bändigen können. »Ich werde noch einen Sprung ins Kaffeehaus hinüber schauen«, sagte er.
Man erwiderte nichts. Herr Rosner trommelte leise auf den Tisch, und seine Gattin nickte scheinbar gleichgültig.
»Also adieu.« Bei der Tür wandte sich Josef wieder um und bemerkte mit mäßiger Festigkeit. »Mama, wenn du vielleicht einen Moment Zeit hast…«
»Ich hör schon«, sagte Frau Rosner, »es wird ja kein Geheimnis sein.«
»Nein. Es ist ja nur, weil ich mit dir ja ohnedies in Verrechnung bin.«
»Muß man ins Kaffeehaus gehen?« fragte der alte Rosner einfach, ohne aufzublicken.
»Also es handelt sich nicht ums Kaffeehaus. Es ist überhaupt… Ihr könnt mir’s glauben, daß es mir selber lieber wär, wenn ich euch nicht anpumpen müßt’. Aber was soll der Mensch tun?«
»Arbeiten soll der Mensch«, sagte der alte Rosner leise und schmerzlich, und seine Augen röteten sich. Die Frau warf einen traurigen und strafenden Blick auf den Sohn.
»Also«, sagte Josef, knöpfte den Bureaujanker auf und wieder zu, »das ist doch wirklich… wegen jedem Guldenzettel…«
»Pst«, sagte Frau Rosner mit einem Blick gegen die angelehnte Tür, durch die jetzt, nachdem der Gesang Annas geendet, nur das gedämpfte Klavierspiel Georgs hereinklang.
Josef beantwortete den Blick der Mutter mit einer wegwerfenden Handbewegung: »Arbeiten soll ich, sagt der Papa. Als ob ich’s nicht schon bewiesen hätte, daß ich’s kann.« Er sah zwei fragende Augenpaare auf sich gerichtet. »Jawohl hab ich’s bewiesen, und wenn es nur auf meinen guten Willen ankäm, hätt’ ich überall mein Auskommen gehabt. Aber ich hab halt nicht das Temperament, mir was gefallen zu lassen, ich laß mich nicht ausschreien von meine Chefs, wenn ich mich einmal eine Viertelstunde verspäten tu… oder so was.«
»Die Geschichte kennen wir«, unterbrach ihn Herr Rosner müde. »Aber schließlich, weil wir schon davon sprechen, du wirst dich ja doch wieder um irgendwas umschauen müssen.«
»Umschauen… gut…«,erwiderte Josef. »Aber zu einem Juden bringt mich keiner mehr ins Geschäft. Das würde mich bei meinen Bekannten… jawohl in meinem ganzen Kreis würde mich das lächerlich machen.«
»Dein Kreis…«, sagte Frau Rosner, »wer ist denn dein Kreis? Kaffeehausfreunderln.«
»Also bitte, weil wir schon davon reden«, sagte Josef, »es hängt auch wieder mit dem Guldenzettel zusammen. Ich habe jetzt ein Rendezvous im Kaffeehaus mit dem jungen Jalaudek. Ich hätt’s euch lieber erst gesagt, wenn die Sache perfekt wird… aber ich seh schon, ich muß früher mit der Farb heraus. Also der Jalaudek, das is der Sohn von dem Stadtrat Jalaudek, von dem berühmten Papierhändler. Und der alte Jalaudek ist bekanntlich eine sehr einflußreiche Persönlichkeit in der Partei… sehr intim mit dem Herausgeber vom »Christlichen Tagesboten«, Zelltinkel heißt er. Und beim»Tagesboten« da suchen sie jetzt junge Leute von gefälligen Umgangsformen, – Christen natürlich, für das Inseratengeschäft. Und da hab ich heute mit dem Jalaudek Rendezvous im Kaffeehaus, weil er mir versprochen hat, sein Alter wird mich beim Zelltinkel empfehlen. Das wär etwas Ausgezeichnetes… da bin ich aus’m Wasser. Da kann ich in der kürzesten Zeit hundert oder auch hundertfünfzig Gulden im Monat verdienen.«
»Ach Gott«, seufzte der alte Rosner.
Draußen ging die Glocke. Rosner blickte auf.
»Das wird der junge Doktor Stauber sein«, sagte Frau Rosner und warf einen besorgten Blick nach der Tür, durch die Georgs Klavierspiel noch leiser drang als früher.
»Also Mama was is eigentlich?« sagte Josef.
Frau Rosner nahm ihre Geldbörse und reichte ihrem Sohn seufzend einen Silbergulden.
»Küß die Hand«, sagte Josef und wandte sich zum Gehen.
»Josef«, rief Herr Rosner. »Es ist doch einigermaßen unhöflich grade in dem Augenblick, wenn ein Besuch kommt…«
»Ah, ich dank schön, ich muß nicht von allem haben.«
Es klopfte, Doktor Bertold Stauber trat ein.
»Entschuldigen vielmals, Herr Doktor«, sagte Josef, »ich bin grad im Weggehen.«
»Bitte«, erwiderte Doktor Stauber kühl, und Josef verschwand.
Frau Rosner forderte den jungen Arzt auf, Platz zu nehmen. Er setzte sich auf den Divan und horchte nach der Seite hin, von wo das Klavierspiel kam.
»Der Baron Wergenthin«, erklärte Frau Rosner etwas verlegen. »Der Komponist. Anna hat eben gesungen.« Und sie schickte sich an, ihre Tochter herein zu rufen.
Doktor Berthold hielt sie ganz leicht am Arme fest und sagte freundlich. »Nein. Ich bitte Fräulein Anna nicht zu stören, absolut nicht. Ich habe nicht die geringste Eile. Es ist übrigens ein Abschiedsbesuch.« Der letzte Satz kam wie hervorgestoßen aus seiner Kehle; doch lächelte Berthold zugleich verbindlich, lehnte sich bequem in die Ecke und strich mit der rechten Hand den kurzen Vollbart zurecht.
Frau Rosner sah ihn förmlich erschreckt an.
Herr Rosner fragte: »Ein Abschiedsbesuch? Haben Herr Doktor Urlaub genommen? Das Parlament ist doch erst vor kurzer Zeit zusammen getreten, wie man den Zeitungen entnehmen konnte.«
»Ich habe mein Mandat niedergelegt«, sagte Berthold.
»Wie?« rief Herr Rosner aus.
»Jawohl niedergelegt«, wiederholte Berthold und lächelte zerstreut.
Das Klavierspiel hatte plötzlich aufgehört, die angelehnte Tür tat sich auf. Georg und Anna erschienen.
»O Doktor Berthold«, sagte Anna und streckte ihm, der rasch aufgestanden war, die Hand entgegen. »Sind Sie schon lange da? Haben Sie mich vielleicht singen gehört?«
»Nein, Fräulein Anna, das hab ich leider versäumt. Nur ein paar Töne auf dem Klavier hab ich vernommen.«
»Der Baron Wergenthin«, sagte Anna, als wollte sie vorstellen. »Die Herren kennen sich doch?«
»Gewiß«, erwiderte Georg und reichte Berthold die Hand.
»Der Doktor kommt uns einen Abschiedsbesuch machen«, sagte Frau Rosner.
»Wie?« rief Anna erstaunt aus.
»Ich verreise nämlich«, sagte Berthold und schaute Anna ernst und undurchdringlich in die Augen. »Ich gebe meine politische Karriere auf«, setzte er dann wie spöttisch hinzu… »besser gesagt, ich unterbreche sie auf eine Weile.«
Georg lehnte im Fenster, die Arme über der Brust verkreuzt, und betrachtete Anna von der Seite. Sie hatte sich gesetzt und sah ruhig zu Berthold auf, der aufrecht dastand, die eine Hand auf die Lehne des Divans gestützt, als wenn er eine Rede halten wollte.
»Und wohin reisen Sie?« fragte Anna.
»Nach Paris. Ich will im Pasteurschen Institut arbeiten. Ich kehre wieder zu meiner alten Liebe zurück, zur Bakteriologie. Es ist eine reinlichere Beschäftigung als die Politik.«
Es war dunkler geworden. Die Gesichter verschwammen, nur die Stirne Bertholds, der gerade dem Fenster gegenüberstand, war noch in Helle getaucht. Es zuckte um seine Brauen. Eigentlich hat er seine besondere Art von Schönheit, dachte Georg, der regungslos in der Fensterecke lehnte und sich von einer angenehmen Ruhe durchflossen fühlte.
Das Stubenmädchen brachte die brennende Lampe und hing sie über dem Tisch auf.
»Aber die Journale«, sagte Herr Rosner, »brachten noch keinerlei Meldung, daß Herr Doktor Ihr Mandat zurückgelegt haben.«
»Das wäre auch verfrüht«, erwiderte Berthold. »Meine Parteigenossen kennen wohl meine Absicht, aber die Sache ist noch nicht offiziell.«
»Diese Nachricht«, sagte Herr Rosner, »wird nicht verfehlen, in den beteiligten Kreisen großes Aufsehen zu erregen. Besonders nach der bewegten Debatte von neulich, in die Herr Doktor mit solcher Entschiedenheit eingegriffen haben. Herr Baron haben wohl gelesen«, wandte er sich an Georg.
»Ich muß gestehen«, erwiderte Georg, »ich verfolge die Parlamentsberichte nicht so regelmäßig, als man eigentlich müßte.«
»Müßte«, wiederholte Berthold nachsichtig. »Man muß wahrhaftig nicht, obzwar die Sitzung neulich nicht uninteressant war. Wenigstens als Beweis dafür, wie tief das Niveau einer öffentlichen Körperschaft sinken kann.«
»Es ist sehr hitzig zugegangen«, sagte Herr Rosner.
»Hitzig?… Nun ja, was man bei uns in Österreich hitzig nennt. Man war innerlich gleichgültig und äußerlich grob.«
»Um was hat es sich denn gehandelt?« fragte Georg.
»Es war die Debatte anläßlich der Interpellation über den Prozeß Golowski… Therese Golowski.«
»Therese Golowski…«, wiederholte Georg. »Den Namen sollt ich kennen.«
»Natürlich kennen Sie ihn«, sagte Anna. »Sie kennen ja Therese selbst. Wie Sie uns das letztemal besucht haben, ist sie eben von mir fortgegangen.«
»Ach ja«, sagte Georg, »eine Freundin von Ihnen.«
»Freundin möcht ich sie nicht nennen; das setzt doch eine gewisse innere Übereinstimmung voraus, die nicht mehr so recht vorhanden ist.«
»Sie werden Therese doch nicht verleugnen«, sagte Doktor Berthold lächelnd, aber herb.
»O nein«, erwiderte Anna lebhaft, »das fällt mir wahrhaftig nicht ein. Ich bewundere sie sogar. Ich bewundere überhaupt alle Leute, die imstande sind, für etwas, was sie im Grunde nichts angeht, so viel zu riskieren. Und wenn das nun gar ein junges Mädchen tut, ein hübsches junges Mädchen wie Therese…«, sie richtete die Worte an Georg, der gespannt zuhörte – »so imponiert mir das noch mehr. Sie müssen nämlich wissen, daß Therese eine der Führerinnen der sozialdemokratischen Partei ist.«
»Und wissen Sie, wofür ich sie gehalten habe?« sagte Georg. »Für eine angehende Schauspielerin!«
»Herr Baron, Sie sind ein Menschenkenner«, sagte Berthold.
»Sie wollte wirklich einmal zur Bühne gehen«, bestätigte Frau Rosner kühl.
»Ich bitte Sie, gnädige Frau«, sagte Berthold, »welches junge Mädchen von einiger Phantasie, das überdies in engen Verhältnissen lebt, hat nicht in irgend einer Lebensepoche mit einer solchen Absicht wenigstens gespielt?«
»Es ist hübsch, daß Sie ihr verzeihen«, sagte Anna lächelnd.
Berthold fiel es zu spät ein, daß er mit seiner Bemerkung eine noch empfindliche Stelle in Annas Gemüt berührt haben mochte. Aber um so bestimmter fuhr er fort: »Ich versichere Sie, Fräulein Anna, es wäre schade um Therese gewesen. Denn es ist gar nicht abzusehen, wieviel sie für die Partei noch leisten kann, wenn sie nicht irgendwie aus ihrer Bahn gerissen wird.«
»Halten Sie das für möglich?« fragte Anna.
»Gewiß«, entgegnete Berthold. »Für Therese gibt es sogar zwei Gefahren: entweder redet sie sich einmal um den Kopf…«
»Oder?« fragte Georg, der neugierig geworden war.
»Oder sie heiratet einen Baron«, schloß Berthold kurz.
»Das verstehe ich nicht ganz«, sagte Georg ablehnend.
»Daß ich gerade Baron sagte, war natürlich ein Spaß. Setzen wir statt Baron Prinz, so wird die Sache klarer.«
»Ach so… Jetzt kann ich mir ungefähr denken, was Sie meinen, Herr Doktor… Aber was für einen Anlaß hatte das Parlament, sich mit ihr zu beschäftigen?«
»Ach ja. Im vorigen Jahre – zur Zeit des großen Kohlenstreikes – hielt Therese Golowski in irgend einem böhmischen Nest eine Rede, die eine angeblich verletzende Äußerung gegen ein Mitglied des kaiserlichen Hauses enthielt. Sie wurde angeklagt und freigesprochen. Man könnte daraus vielleicht schließen, daß die Anschuldigung nicht besonders haltbar gewesen sein dürfte. Trotzdem meldete der Staatsanwalt die Berufung an, ein anderes Gericht wurde designiert und Therese zu zwei Monaten Gefängnis verurteilt, die sie übrigens soeben absitzt. Und damit nicht genug, wurde der Richter, der sie in erster Instanz freisprach, versetzt… irgendwohin an die russische Grenze, von wo es keine Wiederkehr gibt. Nun, über diesen Fall haben wir eine Interpellation eingebracht, sehr zahm meiner Ansicht nach. Der Minister erwiderte, ziemlich heuchlerisch, unter dem Jubel der sogenannten staatserhaltenden Parteien. Ich habe mir erlaubt, darauf zu replizieren, vielleicht etwas energischer, als man es bei uns gewohnt ist; und da man von den gegnerischen Bänken aus nichts Sachliches erwidern konnte, hat man versucht, mich mit schreien und schimpfen tot zu machen. Und was das kräftigste Argument einer gewissen Sorte von Staatserhaltern gegen meine Ausführungen war, können Sie sich ja denken, Herr Baron.«
»Nun?« fragte Georg.
»Jud halts Maul«, erwiderte Berthold mit schmal gewordenen Lippen.
»O«, sagte Georg verlegen und schüttelte den Kopf.
»Ruhig Jud! Halts Maul! Jud! Jud! Kusch!« fuhr Berthold fort und schien in der Erinnerung zu schwelgen.
Anna sah vor sich hin. Georg fand innerlich, es wäre nun genug. Ein kurzes, peinliches Schweigen entstand.
»Also darum?« fragte Anna langsam.
»Wie meinen Sie?« fragte Berthold.
»Darum legen Sie das Mandat nieder?«
Berthold schüttelte den Kopf und lächelte. »Nein, nicht darum.«
»Herr Doktor sind über diese rohen Insulte gewiß erhaben«, sagte Herr Rosner.
»Das will ich nicht eben behaupten«, erwiderte Berthold. »Aber immerhin mußte man auf dergleichen gefaßt sein. Der Grund meiner Mandatsniederlegung ist ein anderer.«
»Und darf man wissen…?« fragte Georg.
Berthold sah ihn durchdringend und doch zerstreut an. Dann erwiderte er verbindlich: »Gewiß darf man. Nach meiner Rede begab ich mich ins Büfett. Dort begegnete ich unter andern einem der allerdümmsten und frechsten unserer freigewählten Volksvertreter, dem, der wie gewöhnlich, auch während meiner Rede, der Allerlauteste gewesen war… dem Papierhändler Jalaudek. Ich kümmerte mich natürlich nicht um ihn. Er stellt eben sein geleertes Glas hin. Wie er mich sieht, lächelt er, nickt mir zu und grüßt heiter, als wäre nichts geschehen: »Habe die Ehre, Herr Doktor, auch eine kleine Erfrischung gefällig?«
»Unglaublich!« rief Georg aus.
»Unglaublich?… Nein, österreichisch. Bei uns ist ja die Entrüstung so wenig echt wie die Begeisterung. Nur die Schadenfreude und der Haß gegen das Talent, die sind echt bei uns.«
»Nun, und was haben Sie dem Mann geantwortet?« fragte Anna.
»Was ich geantwortet habe? Nichts, selbstverständlich.«
»Und haben Ihr Mandat niedergelegt«, ergänzte Anna mit leisem Spott.
Berthold lächelte. Zugleich aber zuckte es um seine Brauen wie gewöhnlich, wenn er unangenehm oder schmerzlich berührt war. Es war zu spät, ihr zu sagen, daß er eigentlich gekommen war, sie um Rat zu fragen wie in früherer Zeit. Und doch, das fühlte er, er hatte klug daran getan, sich gleich beim Eintritt jeden Rückzug abzuschneiden, seinen Verzicht auf das Mandat als bereits vollzogen, seine Reise nach Paris als unmittelbar bevorstehend anzukündigen. Denn nun wußte er ja, daß Anna ihm wieder einmal entglitten war, vielleicht auf lange. Daß irgend ein Mensch sie ihm wirklich und auf immer nehmen konnte, das glaubte er freilich nicht, und auf diesen eleganten, jungen Künstler eifersüchtig zu sein, der so ruhig mit verkreuzten Armen dort am Fenster stand, dazu wollte er sich auf keinen Fall verstehen. Schon manchmal war es geschehen, daß Anna für einige Zeit wie in einem für ihn fremden Element gleichsam verzaubert dahinschwebte. Und vor zwei Jahren, da sie ernstlich daran dachte, sich der Bühne zu widmen und ihre Rollen zu studieren begann, hatte er sie eine kurze Zeit hindurch völlig verloren gegeben. Später, als sie durch die Unverläßlichkeit ihrer Stimme genötigt wurde, ihre künstlerischen Pläne fahren zu lassen, schien sie wohl wieder zu ihm zurückzukehren; aber diese Epoche hatte er mit Absicht ungenutzt verstreichen lassen. Denn eh’ er sie zu seiner Gattin machte, wollte er irgend einen Erfolg errungen haben, entweder auf wissenschaftlichem oder politischem Gebiet, und von ihr wahrhaft bewundert sein. Er war auf dem Weg dazu gewesen. An der gleichen Stelle, wo sie jetzt saß und ihm mit klaren, aber wie fremden Augen ins Gesicht schaute, hatte sie die Korrekturbogen seiner letzten medizinisch-philosophischen Arbeit vor sich liegen gehabt, die den Titel trug: Vorläufige Bemerkungen zu einer Physiognomik der Krankheiten. Und dann, als sich sein Übergang zur Politik vollzog, zu der Zeit, da er in Wählerversammlungen Reden hielt, sich durch ernste geschichtliche und nationalökonomische Studien für den neuen Beruf vorbereitete, hatte sie sich seiner Vielseitigkeit und seiner Energie herzlich gefreut. All das war nun vorüber. Allmählich schien sie gerade seine Fehler, die ihm ja selbst durchaus nicht verborgen waren, insbesondere seine Neigung, sich an den eigenen Worten zu berauschen, mit schärferen Blick zu sehen als früher, und dadurch begann er wieder seine Sicherheit ihr gegenüber mehr und mehr zu verlieren. Er war nicht ganz er selbst, wenn er zu ihr oder in ihrer Gegenwart sprach. Auch heute war er nicht mit sich zufrieden. Mit einem Ärger, der ihm selbst kleinlich vorkam, ward er sich bewußt, daß er seine Begegnung im Büfett mit Jalaudek nicht wirksam genug vorgetragen hatte und daß er seinen Ekel vor der Politik viel glaubhafter hätte darstellen müssen. »Sie haben ja wahrscheinlich recht, Fräulein Anna,« sagte er, »wenn Sie darüber lächeln, daß ich wegen dieses läppischen Abenteuers mein Mandat niedergelegt habe. Ein parlamentarisches Leben ohne Komödienspiel ist ja überhaupt nicht möglich. Ich hätte es bedenken und selber mitagieren, dem Kerl womöglich zutrinken sollen, der mich öffentlich beschimpft hat. Das wäre bequem, österreichisch – und vielleicht sogar das Richtigste gewesen.« Er fühlte sich wieder im Zuge und sprach lebhaft weiter: »Es gibt am Ende doch nur zwei Methoden, mittels deren in der Politik praktisch etwas zu leisten ist; entweder durch eine großartige Frivolität, die das ganze öffentliche Leben als ein amüsantes Spiel betrachtet, die in Wahrheit für nichts begeistert, gegen nichts entrüstet ist, und der die Menschen, um deren Glück oder Elend es sich doch im letzten Sinn handeln sollte, vollkommen gleichgültig bleiben. So weit bin ich nicht, und ich weiß nicht, ob ich jemals dahin gelangen werde. Ehrlich gesagt, ich hab es mir schon manchmal gewünscht. Die andre Methode aber ist: bereit sein, in jedem Augenblick für das, was man das Rechte hält, seine ganze Existenz, sein Leben im wahrsten Sinne des Wortes –«
Berthold schwieg plötzlich. Sein Vater, der alte Doktor Stauber, war eingetreten und wurde herzlich begrüßt. Er reichte Georg, der ihm von Frau Rosner vorgestellt wurde, die Hand und sah ihn so freundlich an, daß sich Georg sofort zu ihm hingezogen fühlte. Er sah offenbar jünger aus, als er war. Sein langer, rötlichblonder Bart war nur von einzelnen grauen Fäden durchzogen, und das schlicht gekämmte lange Haar zog in dichten Strähnen zu dem breiten Nacken hin. Die Stirn, die von auffallender Höhe war, gab der ganzen, ein wenig untersetzten, ja hochschultrigen Erscheinung eine gewisse Würde. Die Augen, wenn sie nicht eben mit einiger Absicht gütig oder klug schauten, schienen sich hinter den müd gewordenen Lidern gleichsam für den nächsten Blick auszuruhen.
»Ich habe Ihre Mutter gekannt, Herr Baron«, sagte er ziemlich leise zu Georg.
»Meine Mutter, Herr Doktor…?«
»Sie werden sich kaum daran erinnern. Sie waren damals ein kleiner Bub von drei, vier Jahren.«
»Sie waren ihr Arzt?« fragte Georg.
»Ich besuchte sie zuweilen als Vertreter des Professors Duchegg, bei dem ich Assistent war. Sie haben damals in der Habsburgergasse gewohnt, in einem alten Haus, das längst niedergerissen ist. Ich könnte Ihnen heute noch die Einrichtung des Zimmers schildern, in dem Ihr Herr Vater mich empfing… der leider auch allzufrüh gestorben ist… Auf dem Schreibtisch stand eine Bronzefigur und zwar ein gepanzerter Ritter mit einer Fahne. Und an der Wand hing eine Kopie nach einem Van Dyck aus der Liechtensteingalerie.«
»Ja«, sagte Georg verwundert über das gute Gedächtnis des Arztes, »ganz richtig.«
»Aber ich habe da die Herrschaften in einem Gespräch unterbrochen«, fuhr Doktor Stauber fort, in dem ein wenig melancholisch singenden und doch überlegenen Ton, der ihm eigen war, und ließ sich in die Ecke des Divans sinken.
»Eben teilt uns Doktor Berthold zu unserm Erstaunen mit«, sagte Herr Rosner, »daß er sich entschlossen hat, sein Mandat niederzulegen.«
Der alte Stauber richtete einen ruhigen Blick auf seinen Sohn, den dieser ebenso ruhig erwiderte. Georg, der dies Augenspiel bemerkte, hatte den Eindruck, daß hier ein stilles Einverständnis waltete, das keiner Worte bedurfte.
»Ja«, sagte Doktor Stauber, »mich hat es allerdings nicht überrascht. Ich habe immer das Gefühl gehabt, daß Berthold im Parlament nur wie zu Gaste sitzt, und bin eigentlich froh, daß er nun eine Art von Heimweh nach seinem wahren Beruf bekommen hat. Ja, ja, dein wahrer, Berthold«, wiederholte er wie zur Antwort auf ein Stirnrunzeln seines Sohnes. »Damit ist ja nichts für die Zukunft präjudiziert. Nichts erschwert uns die Existenz so sehr, als daß wir so häufig an Definitiva glauben… und daß wir die Zeit damit verlieren, uns eines Irrtums zu schämen, statt ihn einzugestehen und unser Leben einfach neu zu gestalten.«
Berthold erklärte, daß er in spätestens acht Tagen abreisen wolle. Jeder weitere Aufschub hätte keinen Sinn. Es wäre auch möglich, daß er nicht in Paris bliebe. Seine Studien konnten eine weitere Reise notwendig machen. Ferner war er entschlossen, alle Abschiedsbesuche zu unterlassen; wie er hinzusetzte, hatte er ohndies allen Verkehr früherer Jahre in gewissen bürgerlichen Kreisen, wo sein Vater eine ausgebreitete Praxis übte, vollkommen aufgegeben.
»Sind wir uns denn nicht diesen Winter einmal bei Ehrenbergs begegnet?« fragte Georg mit einiger Genugtuung.
»Das ist richtig«, erwiderte Berthold. »Mit Ehrenbergs sind wir übrigens entfernt verwandt. Das Bindeglied zwischen uns ist merkwürdigerweise die Familie Golowski. Jeder Versuch, Ihnen das näher zu erklären, Herr Baron, wäre vergeblich. Ich müßte sie eine Wanderung durch die Standesämter und Kultusgemeinden von Temesvar, Tarnopol und ähnlichen angenehmen Ortschaften unternehmen lassen – und das möcht ich Ihnen doch nicht zumuten.«
»Und übrigens«, fügte der alte Doktor Stauber resigniert hinzu, »weiß der Herr Baron gewiß, daß alle Juden miteinander verwandt sind.«
Georg lächelte liebenswürdig. In Wirklichkeit aber war er eher enerviert. Seiner Empfindung nach bestand durchaus keine Notwendigkeit, daß auch der alte Doktor Stauber ihm offizielle Mitteilung von seiner Zugehörigkeit zum Judentum machte. Er wußte es ja, und er nahm es ihm nicht übel. Er nahm es überhaupt keinem übel; aber warum fingen sie denn immer selbst davon zu reden an? Wo er auch hinkam, er begegnete nur Juden, die sich schämten, daß sie Juden waren, oder solchen, die darauf stolz waren, und Angst hatten, man könnte glauben, sie schämten sich.
»Gestern hab ich übrigens die alte Golowski gesprochen”, fuhr Doktor Stauber fort.
»Die arme Frau«, sagte Herr Rosner.
»Wie gehts ihr denn?« fragte Anna.
»Wie wirds ihr gehen… Sie können sich denken… die Tochter eingesperrt, der Sohn Freiwilliger auf Staatskosten, wohnt in der Kaserne… Stellen Sie sich das vor, Leo Golowski als Patriot… Und der Alte sitzt im Kaffeehaus und schaut zu, wie die andern Leut Schach spielen. Er selbst hat doch nicht mehr die zehn Kreuzer, um das Spielgeld zu zahlen.«
»Die Haft von Therese muß übrigens bald abgelaufen sein«, sagte Berthold.
»Dauert doch noch zwölf, vierzehn Tage«, erwiderte sein Vater… »Na, Annerl«, wandte er sich dann an das junge Mädchen, »es wäre wirklich schön von Ihnen, wenn Sie sich wieder einmal in der Rembrandtstraße anschauen ließen; die alte Frau hat eine fast rührende Schwärmerei für Sie. Ich versteh wirklich nicht warum«, setzte er lächelnd hinzu, während er Anna beinah zärtlich betrachtete. Sie aber sah vor sich hin und erwiderte nichts.
Die Wanduhr schlug sieben.
Georg erhob sich, als wenn er nur dieses Zeichen erwartet hätte.
»Herr Baron verlassen uns schon«, sagte Herr Rosner aufstehend.
Georg bat die Anwesenden, sich nicht stören zu lassen, und reichte allen die Hand.
»Es ist merkwürdig«, sagte der alte Stauber, »wie Ihre Stimme an die Ihres verstorbenen Herrn Vaters erinnert.«
»Ja, man hat es mir vielfach gesagt«, entgegnete Georg. »Ich selbst konnte es allerdings nie finden.«
»Es gibt keinen Menschen auf der Welt, der seine eigene Stimme kennt«, bemerkte der alte Stauber, und es klang wie der Beginn eines populären Vortrags.
Aber Georg empfahl sich. Anna begleitete ihn, trotz seiner leisen Abwehr, ins Vorzimmer und ließ – etwas absichtlich, wie es Georg vorkam – die Türe halboffen stehn. »Es ist schade, daß wir nicht länger musizieren konnten«, sagte sie.
»Mir tuts auch leid, Fräulein Anna.«
»Das Lied hat mir heut noch besser gefallen, als beim erstenmal, wie ich mich selber begleiten mußte. Nur zum Schluß verläuft es ein bißchen… ich weiß nicht, wie ich sagen soll.«
»Ich weiß, was Sie meinen. Der Schluß ist konventionell, das hab ich gleich gefühlt. Hoffentlich kann ich Ihnen bald was Besseres bringen, Fräulein Anna.«
»Lassen Sie mich aber nicht zu lange darauf warten.«
»Gewiß nicht. Also Adieu Fräulein Anna.«
Sie reichten einander die Hände und lächelten beide.
»Warum sind Sie nicht nach Weißenfeld gekommen?« fragte Anna leicht.
»Es tut mir wirklich leid, aber sehen Sie, Fräulein Anna, ich hätte wahrhaftig heuer keine angenehme Gesellschaft vorgestellt, das können Sie sich wohl denken.«
Anna sah ihn ernst an. »Glauben Sie nicht«, sagte sie, »daß man Ihnen vielleicht hätte helfen können manches tragen?«
»Es zieht, Anna«, rief Frau Rosner von drinnen.
»Ich komm ja schon«, erwiderte Anna etwas ungeduldig. Aber Frau Rosner hatte die Tür schon geschlossen.
»Wann darf ich wiederkommen?« fragte Georg.
»Wann es Ihnen angenehm ist. Allerdings… ich müßte Ihnen eigentlich eine schriftliche Stundeneinteilung geben, damit Sie wissen, wann ich zu Hause bin, und damit wäre auch noch nichts getan. Oft geh ich spazieren, oder habe Besorgungen in der Stadt, oder schau mir Bilder an, oder Ausstellungen…«
»Das könnte man doch einmal zusammen tun«, sagte Georg.
»O ja«, erwiderte Anna, nahm ihr Portemonnaie aus der Tasche und entnahm diesem ein winziges Notizbuch.
»Was haben Sie denn da?« fragte Georg.
Anna lächelte und blätterte in dem Büchlein. »Warten Sie nur… Donnerstag elf Uhr wollte ich mir die Miniaturausstellung in der Hofbibliothek ansehen. Wenn Sie das auch interessiert, so können wir uns dort treffen.«
»Aber sehr gern.«
»Also schön. Dort können wir gleich besprechen, wann Sie mich das nächstemal zum Singen begleiten.«
»Abgemacht«, sagte Georg und reichte ihr die Hand. Es fiel ihm ein, daß gewiß, während hier draußen Anna mit ihm plauderte, sich drin im Zimmer der junge Doktor Stauber ärgern oder gar kränken mochte. Und er wunderte sich, daß er diesen Umstand selbst offenbar unangenehmer empfand als Anna, die doch im ganzen ein gutmütiges Wesen zu sein schien. Er löste seine Hand aus der ihren, nahm Abschied und ging.