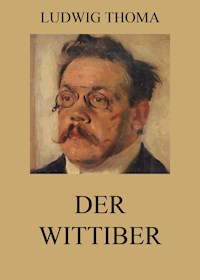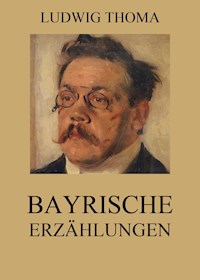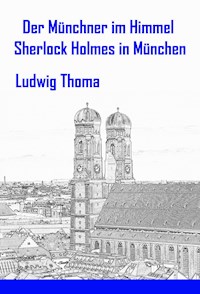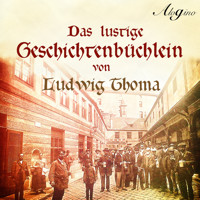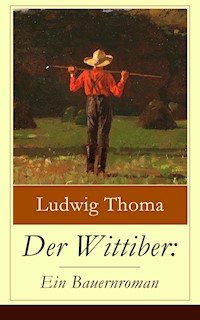
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: e-artnow
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Dieses eBook: "Der Wittiber: Ein Bauernroman" ist mit einem detaillierten und dynamischen Inhaltsverzeichnis versehen und wurde sorgfältig korrekturgelesen. Ludwig Thoma (1867-1921) war ein bayerischer Schriftsteller, der durch seine ebenso realistischen wie satirischen Schilderungen des bayerischen Alltags und der politischen Geschehnisse seiner Zeit populär wurde. Ludwig Thoma bemühte sich in seinen Werken darum, die herrschende Scheinmoral bloßzustellen. Ebenso prangerte er kompromisslos Schwäche und Dummheit des spießbürgerlichen Milieus und das chauvinistische und großmäulige Preußentum mit seinem Pickelhauben-Militarismus an. Er stieß sich auch am Provinzialismus und der klerikalen Politik seiner Zeit im Königreich Bayern, was sich beispielhaft in Jozef Filsers Briefwexel niederschlägt. Als brillant werden die mit Humor und Satire gewürzten Erzählungen oder Einakter aus dem bäuerlichen und kleinstädtischen Lebenskreis in Oberbayern angesehen. Die unsentimentalen Schilderungen agrarischen Lebens in den Romanen sindwohl deshalb besonders lebensnah gelungen, weil Thoma aus seiner Rechtsanwaltstätigkeit eine Fülle praxisnaher Einblicke in die Lebensumstände auf dem Lande gewinnen konnte. Aus dem Buch: "Es war nicht eigentlich behaglich im Wirtshause Zum Lamm. Die wenigen Gäste, die zukehrten, trugen Schnee in die Stube, der zu schmutzigen Wasserlachen zerging, und von Hut und Mantel tropfte es auf den Boden, und es roch nach schlechten Zigarren und nassen Kleidern. Die Lampe über dem Ofentische schwelte, und die dicke Kellnerin mußte immer wieder auf einen Stuhl klettern und den Docht herunterschrauben. Bei dem kümmerlichen Lichte sah man den Schormayer in einer Ecke vor seinem abgestandenen Biere sitzen; und wer kam oder ging, redete ihn an."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 276
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Wittiber: Ein Bauernroman
Unsentimentale Schilderungen agrarischen Lebens
Inhaltsverzeichnis
Erstes Kapitel
»Um d’ Kathi is schad; dös behaupt’ i, weil ‘s wahr is, und koa besserne Hauserin is weit umadum net g’wes’n«, sagte der Zwerger von Arnbach, und Männer und Weiber, die beim Leichentrunk saßen, nickten beistimmend.
»De Ehr’ muaß ihr a niada Mensch lass’n, daß ihr d’ Arbet guat von da Hand ganga is.«
»Han?«
Die Fischerbäuerin von Neuried redete undeutlich, weil sie ein tüchtiges Stück Wurst kaute; aber wie sie es hinuntergeschluckt hatte, wiederholte sie ihre Worte.
»Daß ihr d’ Arbet guat von da Hand ganga is, sag i.«
»Und halt vastanna hat sie ‘s aa«, rief einer über den Tisch hinüber.
»Freili hot sie ‘s vastanna. Und gar so viel a guate Melcherin is sie g’wesen,« sagte die Fischerbäuerin, die als Schwester der Verstorbenen heute ein Aufhebens machen durfte. »Solchene muaß it viel geb’n, und it leicht, daß a mal a Kuah nach ihr ausg’schlag’n hat, und vo drei Strich hat sie so viel Milli ausg’molka, wia’r an anderene aus vieri.«
»Und g’rath’n is ihr alssammete,« rief die Huberin von Glonn, »sie hat a niad’s Kaibi durchbracht; und bal sie oans no so g’ring herg’schaugt hat, is ihr it umg’stanna.«
»Was mög’st?« fragte der Zwerger, den die Fischerbäuerin anstieß. »Ah so! Geh, theat’s d’ Würscht no mal her!«
Und er gab der Nachbarin hinaus, die mit Messer und Gabel darüberging und wehleidig sagte: »Es is schad um sie, weil sie gar so viel a guate Melcherin war.«
Der Schormayer von Kollbach hörte die Lobreden oder hörte sie nicht; er schaute verloren an sein Bierglas hin; und wenn er den Deckel aufmachte und eines trank, geschah es auch gedankenverloren und ohne Genuß.
»Was hoscht jetzt an Sinn?« fragte ihr der Zwerger.
»Wia?«
»Was d’ an Sinn hoscht? Übergibst, oda machst alloa furt?«
»I bin do it alloa.«
»Ja no, die Tochta werd aa it ledi bleib’n mög’n; und bal sie heireth, was is nacha?«
»Dös woaß i jetzt aa it.«
»Geh, Zwerger, laß guat sei! Wer red’t denn von Übageb’n, bal ma d’ Muatta erst vor a Stund ei’grab’n hamm?«
Der Schormayer Lenz sagte es, und zeigte sich überhaupt als rechtsinnigen Menschen, der auch im Unglück seine fünf Sinne beisammen hat, indem er achtgab, daß beim Leichenmahl alles in Ordnung ging und Verwandte und Gefreundete herzhaft zugriffen.
»Ja no,« antwortete der Zwerger, »mi red’t grad; und wer woaß, wann mi wieda beinand is. Und es is guat g’moant g’wen, Schormayer; des sell derfst g’wiß glaab’n.«
»Wia?«
»I sag, daß i dir nix schlecht’s moan, und nix für unguat!«
»Na, na!«
»Bal d’ Kathi bei’n Leb’n blieb’n waar, kunnt’st freili no a fünf Jahr regier’n, aber a so werd ‘s dir hart o’kemma.«
»Ja, ja.«
»Sie is so viel a guate Melcherin g’wen, und in Stall überhaupts hat ‘s koa besserne gar it geb’n,« sagte die Fischerbäuerin, indes sie einen Löffel Rübenkraut zum Schweinefleisch nahm.
»Der Herr gebe ihr die ewige Seligkeit und lasse sie ruhen in Frieden, Amen!« rief am untern Ende eine scharfe Stimme, die zu den frommen Worten nicht recht paßte.
Und sie ging von der Asamin aus, die mit einem kleinen Gütler ein armseliges und streiterfülltes Leben führte.
Sie hatte aber auch mit der Katharina Schormayer eine Schwester begraben und mußte deswegen an diesem traurigen Tage gehört werden.
»Amen!« responsierten die Verwandten und Gefreundeten, und räusperten sich dazu; denn sie gönnten der Asamin nicht, daß sie das Wort führen sollte.
Dann war es still; bloß daß man Gabeln und Messer auf den Tellern kratzen hörte, oder auch einen, der seufzte, oder einen, der sagte: »Ja no! Jetzt is scho amal a so.«
Nach einer Weile jedoch brachte der Zwerger die Unterhaltung wieder in Fluß.
»Des muaß mi sag’n, schö hat da Herr Pfarra g’redt, und g’rad fei’ hat a sei Sach’ fürbracht.«
»Er hot überhaupts a guat’s Mäuwerk«, lobte der Schneiderbauer; »da is er ganz anderst wia der inser in Arnbach. Der sell ko gar nix.«
»Dös is wahr, bei dem muaß mi einschlafa, aba an Herrn Metz lob’ i. Er hat der Schormayerin ihr Ehr geb’n, daß mi z’fried’n sei muaß.«
»Ein fleißiges Weib ist eine Krone ihres Mannes, hat a g’sagt, und dessell hat er aa g’sagt: durch ein weises Weib wird das Haus erbauet. I hon ma ‘s guat g’mirkt.«
Die Asamin ließ sich zu oft hören.
»Mirk d’ as no! Du ko’st as guat braucha!« schrie der Schneiderbauer grob und brachte viele zum Lachen.
»Bal’s aba da Herr Pfarra g’sagt hat!«
»Is ja recht, mirk da ‘s no g’rad!«
»Von a Predigt ko si a niada was hoam nehma, net grad i alloa.«
»Is ja recht.«
»Und des sell derf i do sag’n, daß mi de Predigt g’fall’n hat, und überhaupts is sie von mir so guat a Schwesta g’wen als wia vo de andern; und des is amal wahr, daß er dös g’sagt hat. Ein fleißiges Weib, hat er g’sagt, ist die Krone des Mannes.«
»Is ja recht, bal’s no du aa oane waarst!«
»Nacha krieget der Asam vielleicht gar was für di«, sagte der Zwerger; und wieder lachten Verwandte und Gefreundete.
»Schaug no, daß du was kriagst für de Dei’; und des sell muaß i dir no sag’n …«
»Sei amal staad!« mahnte der Lenz so nachdrücklich, daß die Asamin einhielt.
Und jetzt schob auch seine Schwester Ursula die Fleischplatte vor den alten Schormayer hin.
»Geh, Vata, iß dennerscht was!«
»I mog it.«
»Dös is jetzt aa nix, bal du a so da hockst; is ja des best’ Sach!«
»I mog it, sag’ i.«
»Wickel ‘s eahm ei!« sagte die Fischerbäuerin. »Dahoam mag er ‘s na scho.«
Der Wittiber trank ein ums andere Mal und schaute mit leeren Augen vor sich hin, daß es den Schneiderbauer erbarmte.
»Wie lang bist jetzt verheireth g’wen?« fragte er den stillen Mann.
»I?«
»Ja, muaß do bald dreiß‘g Jahr sei.«
»It ganz. Achtazwanzgi san mi beinand g’wen.«
»Is a lange Zeit. Da g’wohnt ma si z’samm.«
»Da g’wohnt ma si z’samm, ja, ja! Und jetz woaß i gar nix mehr, wo i hi’g’hör, und dahoam is nix, und anderstwo is aa nix.«
»Es werd scho wieder, Vata, laß no guat sei!« sagte Lenz.
»Nix werd ‘s. Dös vastehst du net. Bal mi achtazwanz’g Jahr mitanand g’arbet hat, und is oan Tag g’wen wia den andern, und auf oamal is ‘s gar, dös is dumm ganga. Dös hätt ‘s it braucht.«
»No schau, bei dir is no net allssammete aus«, tröstete der Zwerger. »Du host a Baargeld und kost zuaschaug’n, wann’s d’ heut übagibst.«
»Ja, bal i d’ Arbet nimma hab, was is denn nacha? Und alloa is d’ Arbet aa nimma luschti. Dös is amal nix mehr und werd nix mehr.«
Er schaute wieder vor sich hin und rührte nichts an von allem, was aufgetragen wurde.
Den andern aber hatte die Trauer den Appetit nicht verschlagen; sie langten herzhaft zu, und über Essen und Trinken wurde es lebhafter.
Von der seligen Schormayerin war nicht mehr so viel die Rede als von der Ernte und von den Viehpreisen; und jeder wußte etwas zu sagen, was seiner Kenntnis Ehre machte.
Und wie sich der Eifer steigerte, wollte auch der Lenz zeigen, daß er gut beschlagen war.
Die Fischerbäuerin wieder nahm sich der Ursula an und erzählte ihr von einigen Bauernsöhnen, die rundherum mit guter Aussicht fürs Leben zu heiraten waren.
Und wenn ihr die Namen ausgingen, wußte gleich eine andere noch einen besseren zu rühmen; und über ein kurzes steckten die Weiber ihre Köpfe zusammen und waren vom Sterben mitten ins Heiraten gekommen.
Die Asamin nicht.
Ihre Meinung hatte in solchen Fragen erst recht keine Geltung, und überdem hielt sie es für richtig, jetzt mit einigen Wünschen an den Schormayer zu gehen.
Ohne daß es die andern viel bemerkten, setzte sie sich hinter den Wittiber und fing erst einmal kräftig zu seufzen an. Da er nicht darauf achtete, zupfte sie ihn am Ärmel und sagte: »Dös is a wahr’s Kreuz!«
Der Schormayer wandte sich um. »Was willst?«
»A Kreuz is, sag i, daß d’ Kathi hat sterb’n müass’n.«
»Jetz laß du mi aus!«
»Ja, glaabst, mi bekümmert dös nix? Sie is vo mir aa’r a Schwesta g’wen.«
»I woaß scho.«
»Und bal i aa g’rad an arme Güatlerin bi, des sell macht da gar nix aus. Vielleicht hon i mehra Derbarma mit dir als an anderne.«
»I dank da schö. Ja, is scho recht.« Und er drehte ihr den Rücken zu.
Aber die Asamin war darüber nicht traurig, sie schaute links und rechts, ob die Gespräche noch am Fließen waren; und wie sie das mit Befriedigung sah, faßte sie wiederum den Schwager am Ellenbogen.
»Was hoscht denn?«
»Du, hat d’ Kathi gar it dergleich’n tho, daß sie ihre Verwandt’n a bissel was zuakemma laßt?«
»Na, gar nix.«
»Koan Pfennig it?«
»Na, sag i.«
»Sollt’st nacha schon du a wengl was thoa, daß mi liaba bet’ dafür.«
»Bal’s d’ net gern bet’st, laßt d’ as bleib’n.«
»Sie no net glei so gach. Mi sagt ja grad, weil ‘s a guat’s Werk waar, wann mi an arma Menschen was gab.«
»Du hoscht ihra Lebzeit’n gnua kriagt, und hoscht as do bloß vabutzt.«
»I?«
»Ja, du! Und jetz laß mi mei Ruah!«
»Jetz da muaß i lacha. Wos hon denn i kriagt von ihr?«
»I red nix mehr.«
Der Schormayer war ein weniges aus seiner allertiefsten Trübseligkeit gerissen und zeigte seiner Schwägerin die breite Seite.
»Luada!« brummte er vor sich hin und trank einmal.
Die Asamin gab viel und doch nicht alles verloren; sie wartete etliche Zeit, bis nach ihrer Meinung die Trauer wieder obenauf schwamm.
Dann kriegte sie den Wittiber noch mal am Ärmel.
»Ja Herrgott …!«
»Geh! Muaßt it a so sei! I sag nix mehr von an Geld!«
»Du kriagst schon koans.«
»Dös san mi arma Leut g’wohnt. Aba, paß auf, den brauna Rock von ihr und den Spensa kunnt’st ma do scho geb’n.«
»Wos für an brauna Spensa?« fragte mit einmal Ursula, und fragte es sehr scharf.
»I ho do mit dir it g’red’t.«
»Na, aba an Vata that’st o’bettln und schamst dir gor it.«
»Dös is it bettelt, bal mi fragt!«
»Dei Frag’n kenn i scho, und schama thuast di du gor it. Möcht sie ‘s G’wand vo da Muatta!«
»Was waar ‘s nacha, bal mi an Spensa kriagat? Hoscht du it gnua Sach? Is dös it da Brauch, daß mi an Verwandt’n was gibt? Da möcht i scho von Betteln sag’n und ‘s Mäu recht aufreiß‘n, als wenn sie koan Schwesta net g’wen waar von mi und ‘s Bet’n net aa braucha kunnt!«
Die Asamin deckte ihren Rückzug tapfer und gut, wie ein jeder sagen mußte, aber sie mußte eben doch zurückweichen und von allen Angriffen abstehen.
Sie saß wieder am untern Ende des Tisches und blieb von den flinken Augen der Ursula bewacht, so daß kein lautes Gespräch mehr für sie eine neue Gelegenheit gab.
»Und jetz geh i,« sagte der Schormayer bald darauf und stand auf.
»I geh mit dir, Vata,« rief der Lenz.
»Na, du bleibst do, und de andern aa. I find alloa’ hoam, und koan Unterhaltung brauch i net. S’ Good beinand!«
Er schwankte etwas und hatte in Kümmernis und Nachdenken mehr Bier getrunken, als mancher Fröhliche ertragen könnte; aber die Türe erreichte er doch in einer mäßigen Bogenlinie.
Die Trauerversammlung rief ihm Grüße nach und hielt wieder eine Zeitlang Betrachtungen ab über die Schormayerin und ihr schnelles Sterben und über den Tod im allgemeinen.
»Es is wirkli hart für eahm,« sagte die Fischerbäuerin, »und bal mi ‘s recht sagt, is er z’ alt zu’n no mal Heireth’n und z’ jung zu’n Aufhör’n.«
Die Schneiderin rückte näher zu ihr und wisperte leise, daß es die Mannsbilder n hören sollten: »Überhaupts sag i dös: bei dem Alter is besser, wann da Mo z’erscht stirbt, weil si inseroans leichter in d’ Ruah gibt.«
»Da hoscht amal recht, und des sell is no allemal wahr g’wen, wie ma sagt: bal unser Herrgott an Hanswurst’n hamm will, laßt er oan mit fufz’g Jahr Wittiber wer’n.«
Die Fischerin sah die Schneiderin bedeutsam an, und sie nickten mit den Köpfen und waren sich einige darüber.
Zweites Kapitel
Der Schormayer trat tiefe Löcher in die weiche Dorfgasse, wie er jetzt an dem trübseligen Herbstnachmittage heimging, aber er achtete nicht auf den glucksenden Lehm, der ihm an den Stiefeln hängenblieb.
Wenn er vom Wege abkam und beinahe knietief in den Schmutz trat, fluchte er still und lenkte in die Mitte der Straße ein, aber bald zog es ihn wieder links oder rechts an einen Zaun, und er blieb stehen und brummte vor sich hin:
»Nix mehr is, gar nix mehr.«
»Himmelherrgott!« sagte er, wenn ein Windstoß in die Obstbäume fuhr und ihm kalte Regentropfen ins Gesicht schleuderte.
Ein Hund riß an der Kette und bellte ihm heiser nach; beim Finkenzeller öffnete die alte Mariann ein Fenster und rief ihm zu: »Derfst ma ‘s it übel ham, daß i net bei da Leich’ g’wen bi; i hon an Wehdam in die Haxen und kimm it bei da Tür außi. I waar ihr so viel gern ganga, und derfst ma ‘s g’wiß glaab’n, i bi ganz vokemma, wia’n i dös g’hört hab, und weil sie gar so …«
Der Schormayer hörte sie nicht; er bog scharf um die Hausecke und war nun bald, unverständliche Worte murmelnd, an der Einfahrt seines Hofes.
Die Spuren vieler Tritte waren noch sichtbar; sie liefen mitten über den geräumigen Platz bis zur Haustüre, und bei ihrem Anblick raffte der Schormayer seine Gedanken wieder fester zusammen.
»Da hamm s’ as raustrag’n. Ah mei! Ah was!«
Er faßte zögernd nach der Türklinke, als vom Kuhstall herüber eine helle Weiberstimme klang.
»Bauer!«
»Was is?«
»Schaugst it eina? D’ Schellerin hat a Kaibi kriagt.«
»Was nacha?«
»A Stierkaibi.«
Die Stalldirne klapperte auf ihren Holzpantoffeln mit hoch aufgeschlagenen Röcken näher heran.
»Vor a Stund is ‘s kemma, und hat gar it viel ziahg’n braucha, und i ho mir z’erscht denkt, i schick umi zu’n Wirt, aba nacha is an Tristl sei Knecht da g’wen, und nacha …«
»Ja, ja! Is scho recht …«
Er trat ins Haus und schlug die Türe hinter sich zu.
Im Flötz stand noch der weiß gedeckte Tisch, und darauf ein Kruzifix, auch war ein süßlicher Duft von Weihrauch zu merken, und so blieb der Schormayer nachdenklich stehen und schaute die Stiege hinauf, über die sie vor wenigen Stunden seine Bäuerin heruntergetragen hatten.
Er zog den Mantel nicht aus und hing den Hut nicht an den Nagel; wie er war, ging er mit schmutzigen Stiefeln in die Stube und setzte sich auf die Ofenbank.
Es wurde schon Abend, und die Fenster schauten wie große Augen in dei dämmerige Stube herein; eine Uhr tickte laut und aufdringlich, als das einzige Ding, was hier zu vernehmen war, und ihr Schlag und die Stille und dunkle Winkel erinnerten den Schormayer an seine Verlassenheit. Er dachte wohl nicht viel darüber nach und malte sich keine wehmütigen Bilder vor, aber er spürte die Einsamkeit, wie er sich so vornüberbeugte und auf den Boden sah.
Da waren einige weiße Flecken; und wie er nachdachte, woher sie kämen, trat ihm lebhaft und deutlich die traurigste Stunde seines Lebens vor Augen.
Das waren Tropfen von Wachskerzen, und da herinnen waren die Weiber versammelt, als der Pfarrer die Leiche aussegnete.
Er hörte die Hammerschläge, die von oben heruntertönten, als sie den Sarg zumachten, und dann schwere Tritte auf der Stiege, und das Schleifen der Totentruhe, und die tiefen Stimmen der betenden Männer und die hellen der Weiber, und dann wieder durch die Stelle eine fette Singstimme, der eine andere erwiderte mit fremden Worten, die er oft und oft gehört, aber heute sich erst gemerkt hatte:
»Requiescat in pa-ha-ce! A-ha-men!«
Eine zitternde, verschnörkelte Stimme, und dann das Klirren des Weihrauchfasses, und gleich darauf ein weißer, beizender Rauch, der viele zum Husten brachte.
Und ein Flüstern unter den Männern, die den Sarg aufhoben, und wieder viele dumpfe Tritte und schreiende Stimmen durcheinander.
»Vater unsa, der du bischt in dem Himmel, geheiliget werde dein Name …«
Der Bauer fuhr zusammen, weil die Stubentüre aufging.
»Wos geit ‘s?«
»I bin’s«, sagte die Stalldirne, die auf Strumpfsocken hereinkam.
»Was willst?«
»I ho ma denkt, ob’s d’ as Kaibi net o’schaugst, weil’s gar so fei’ is.«
»Morg’n nacha.«
»Und d’ Kuah is aa guat beinand; gar it viel ei’brocha.«
»So?«
»Ganz leicht is ganga; i hätt an Tristlknecht schier gar it braucht; aba no, mi woaß net.«
Der Bauer gab keine Antwort.
Zenzi ging ans Fenster und schaute hinaus; gegen die Helligkeit erschien ihre Gestalt so groß und mächtig, daß sie der Schormayer zum erstenmal daraufhin anschauen mußte. Die hatte einen Buckel wie ein starkes Mannsbild und dicke Arme und volle Brüste.
»Soll i dir a Kaffeesuppen kocha?« fragte sie.
»Na.«
»Aba d’ Ursula werd so schnell it kemma, und i ko d’ as leicht macha.«
»I mog nix.«
Zenzi trat zur Ofenbank; und wie der Bauer sie nicht wegschickte, setzte sie sich neben ihn.
Ihr Arm streifte den seinen, und eine Wärme ging von ihr aus, die ihm wohltat; den ganzen Tag hatte er das Gefühl gehabt, daß es ihn fröstle beim Alleinsein, und in der Stube hatte es ihn erst recht so überkommen.
Zenzi drehte den Kopf nach ihm zu; ihr sinnlicher, breitgezogener Mund und ihre flackernden Augen versprachen Dinge, die selten einer verschmäht.
Aber der Schormayer schaute sie nicht an.
»Wia lang is sie jetzt krank g’wen?« fragte Zenzi.
»A schlecht’s Blüat hat sie scho lang g’hot,« erwiderte er, »aba g’leg’n is sie it länger wia ‘r a viertl Jahr; dös woaßt ja selm.«
»An da Lungl hat ‘s ihr g’feit, gel?«
»Ja.«
»A meiniger Vetta, wo i in Deanst g’wen bi, hot ‘s aa’r a so g’habt und is alle Täg weniga worn. Da is g’scheidter, bal oans stirbt.«
»Ja, ja.«
»Dös ko mi net anderst macha, und da waar jetzt net a so trauri.«
»Dös vastehst du z’weni«, sagte er und streifte sie mit einem Blick.
»Moanst?«
»Wenn ma so lang vaheireth is mitanand, da g’hört ma so z’samm, daß ma sie dös gar it anderst ei’bild’n ko.«
»Aba d’ Freud ko aa nimmer so groß g’wen sei.«
»Was für a Freud?«
»No, a so halt«, sagte Zenzi und stieß ihn mit dem Ellenbogen an.
Er schaute sie wieder an; ihr Mund war zu einem sinnlichen Lachen verzogen, und ihre Augen wichen nicht aus.
»Ah mei!« sagte er. »An selle Dummheit’n denkt mi do net.«
»Waar ma scho gnua!« sagte sie. »Da denkat i freili dro. Für was is ma denn vaheireth?«
»Geah! Du bischt halt no jung und dumm. In Ehstand is ganz anderst als wia lediger.«
»Warum nacha?«
»Weil mi halt g’scheidter werd, und älter aa, und weil mi an was anders z’ denka hot.«
»Du bischt do net z’ alt.«
Zenzi rückte näher, und da faßte er mit einer groben Bewegung ihren Arm und drückte ihn fest.
»Herrgott! Aber Arm hoscht scho her!« sagte er.
»Da is was dro, gel?«
»Ja, du bischt scho a Mordstrumm Weibsbild!«
Er griff nach ihrer Brust.
Sie kicherte.
»Geah du!«
»Was hoscht denn für an Schatz?« fragte er.
»I ho koan.«
»Ja, dös wer i dir glaub’n. Vielleicht bischt gar no bei’n Jungfernbund?«
»Da kunnt i leichter dabei sei als wia anderne. I mag mit die Bursch’n nix z’ thoa hamm.«
»So schaugst du aus!«
»Weil nix G’scheidt’s rauskimmt dabei. Aba du bischt oana! Hörst it auf? Hörst it auf?«
Sie lachte und wehrte sich gegen seine derben Griffe; er legte den Arm um ihre Hüfte und zog sie keuchend zu sich heran, und im Ringen fiel ihm der Hut auf den Boden.
Plötzlich machte sie sich mit einem Ruck frei und sprang in die Höhe. »Es kimmt wer!« sagte sie hastig und streifte ihren Rock zurecht.
Er sah verstört und mit blöden Augen nach der Tür und bückte sich, um seinen Hut aufzuheben, als Ursula eintrat. Sie warf einen schnellen Blick auf den Vater, der seine Verlegenheit verbergen wollte und den Staub vom Hute abblies, und dabei fuhr sie die Magd an:
»Was hoscht denn du da herin z’ thoa?»
»I hon an Bauern g’sagt, daß mi a Kaibi kriagt hamm.«
»Na geh no wieda an Stall außi!«
»I geh scho.«
Der Schormayer kam ihr zu Hilfe.
»A Stierkaibi is, hoscht g’sagt? Gel?«
»Ja.«
»Und da Tristlknecht hat da g’holfa?«
»Ja. Da Toni.«
»Is scho recht nacha. Sagst eahm: i zahl eahm a paar Maß«
»Jetz mach amal, daß d’ weiterkimmst, du hoscht di lang gnua vahalt’n da herin, moan i«, schrie Ursula.
»‘s nachstmal sag i halt nix mehr, bal dös aa no net recht is; und so was geht do an Bauern o.«
Zenzi schlug die Türe hinter sich zu, und man hörte sie noch im Flötz schelten, und ein Stück weit über den Hof.
Der Schormayer hatte derweilen seine Fassung gewonnen, und der Ärger stieg in ihm auf.
»Daß du gar so grob bischt mit ihr?« fragte er.
»Red’ liaba it, Vata!«
»Wos? Derfst du mir ‘s Mäu biat’n? Gang dös scho o? Herr bin i, daß d’ as woaßt!«
»Und dös g’hört si amal it, daß des Mensch da herin steht.«
»So? Geaht mi dös nix o, was an Stall draußd g’schiecht? Dös waar mi des neuest! Bin i gar nix mehr, weil d’ Muatta nimma do is?«
Jetzt hatte der Schormayer einen Boden unter sich und kam sich in seinem Rechte gekränkt vor. Und da schrie er, daß ihm die Halsadern schwollen.
»Da waar ja i der gar nix mehr auf mein Hof, und ‘s Mäu laß i mi no lang it biat’n von enk!«
»Dös hon i it tho.«
»Jo hoscht as to! Aba probier ‘s grad nomal, na zoag i dir an Weg!«
»Mögst mi nausschaffa am nämlinga Tag, wo mi d’ Muatta eigrab’n hamm?«
»Und i laß mir amal ‘s Mäu it biat’n!«
Der Lenz stand unter der Türe und schaute verwundert den Vater an, der zornig in der Stube auf und ab ging und die weinende Ursula anschrie.
»Was geit ‘s denn?«
»Dös is mei Sach!«
»Öhö!« machte der Lenz.
»Ja, gar nix öhö! Und Herr bin i, dös mirkt’s enk all zwoa!«
Der Schormayer ging in die Schlafkammer, die nebenan war, und schmiß die Türe krachend ins Schloß.
»Was hot er denn?«
»I sag d’ as schon an andersmal«, sagte Ursula weinerlich und ging hinaus; und droben hörte der Lenz sie murmeln und zwischen hinein sich schneuzen.
Drittes Kapitel
Es war nicht eigentlich behaglich im Wirtshause Zum Lamm. Die wenigen Gäste, die zukehrten, trugen Schnee in die Stube, der zu schmutzigen Wasserlachen zerging, und von Hut und Mantel tropfte es auf den Boden, und es roch nach schlechten Zigarren und nassen Kleidern.
Die Lampe über dem Ofentische schwelte, und die dicke Kellnerin mußte immer wieder auf einen Stuhl klettern und den Docht herunterschrauben.
Bei dem kümmerlichen Lichte sah man den Schormayer in einer Ecke vor seinem abgestandenen Biere sitzen; und wer kam oder ging, redete ihn an.
Aber kein Gespräch wurde so lebhaft, daß nicht die Frau Wirtin schon am frühen Abend laut gähnte und die Kellnerin aus einem Winkel heraus als Echo mit Gähnen antwortete.
Wenn die Uhr rasselnd und ächzend, als wenn sie einen Kropf hätte, achtmal schlug, legte der Schormayer sein Geld für drei Halbe auf den Tisch und ging mit einem brummigen Gruße hinaus.
»Er kimmt jetzt jed’n Tag,« sagte die Wirtin, »und früherszeiten hat ma ‘n ganz weni g’sehg’n. Er muaß dahoam it viel Schön’s hamm.«
Und da hatte sie das Richtige getroffen.
Dem Schormayer verging ein Tag um den andern mit Langweile oder Verdruß; und er war recht übel daran, daß ihm sein Weib gerade vor dem Winter weggestorben war.
Er hatte wenig Arbeit, die ihm über seine Gedanken hätte weghelfen können; die Ernte war ausgedroschen, und im Holze war nicht viel zu tun; im Roßstall hantierte sein Lenz, und bei den Kühen schaute er nicht gerne nach, weil ihm die Ursula auf Schritt und Tritt nachging und jedesmal ein Geschrei mit der Stalldirne anhob.
Und es war ihm selber zuwider, wenn die Zenzi Augen auf ihn machte und ihn damit an eine Dummheit erinnerte, die ihm bloß im Rausche hatte geschehen können.
Davon wollte er nichts mehr wissen; und wäre die Tochter so gescheit gewesen, die Geschichte nicht immer aufzurühren, er hätte sie gern vergessen.
Aber von den Weibsbildern kann ja einer bloß Vernunft erwarten, wenn er sie nicht kennt.
Freilich redete sie darüber nicht offen, aber der Herrgott hatte auch ihr das Talent gegeben, daß sie versteckt und von hinten herum immer wieder auf die Sache kommen konnte.
Ging denn ein Mittag vorüber, ohne daß sie Streit in die Stube trug und hinter Schimpfen und Plärren ihm einen Brocken zu schlucken gab, den er am Geschmack recht wohl erkannte?
Wie sie der Magd die Schüssel hinschob und den Löffel hinwarf, hatte es auch für ihn eine Nutzanwendung, und in jeder Grobheit, mit der sie die Mahlzeit segnete, war ein spitziger Steften, der ihm ins Fleisch drang.
Nein, er hatte es nicht schön daheim, und wenn er auch wirklich nicht feinfühlig war, kam ihm das Haus doch leer und fremd vor. Die eigenen Schritte werden so laut, wenn man weiß, daß niemand auf sie horcht, der zu einem gehört; und da kriecht einem die kalte Einsamkeit ans Herz.
Zärtlichkeiten und schöne Worte braucht man wohl nicht; aber die Gewißheit, daß jemand um einen froh sein muß, hilft einem leicht einschlafen und wieder frisch aufwachen zur Arbeit.
Und das merkte der Schormayer überall, daß sein Kümmern und Anschaffen keine rechte Achtung fand.
Der Lenz widersprach ihm nicht und tat auch, was er ihm sagte; aber es war doch so, als wenn er nachprüfte, ob es ihm für das baldige Regiment paßte.
Eigenmächtigkeiten ließ sich der Lenz genug zuschulden kommen, und es war noch viel, wenn er hinterdrein dem Vater sagte, was für eine Arbeit er übertags getan hatte.
Das konnte dem Schormayer mitten bei der Nacht einfallen und ihm das Schlafen verleiden. War ihm damit nicht deutlich vor Augen gehalten, daß man ihn bloß zum Schein das Regiment führen lasse und gerade noch ein wenig Geduld mit ihm habe?
Da machte er sich zornige Gedanken darüber, ob er es so bald und so unabwendbar an sich kommen lassen müsse, daß ihm der Sohn das Regiment abnehme.
Freilich, wenn er es ruhiger betrachtete: wie sollte er es aufhalten können?
Sobald die Ursula aus dem Hause war, mußte eine Frau herein; und daß er noch einmal heiraten sollte, fiel ihm nicht ein.
In seinem Alter das Leben von vorne und mit schweren Verdrießlichkeiten und Zerwürfnissen anfangen, das konnte nicht gut ausfallen und hieß ins Ungewisse hineintappen. Auch war der Lenz fleißig und rechtschaffen und verdiente es wohl, den Hof so zu kriegen, wie er jetzt beisammen war. Nein, noch einmal heiraten wollte er nicht.
Aber gerade, weil er über eine kleine Weile nichts mehr zu sagen hätte, sollte ihn der Sohn nicht jetzt schon daran erinnern.
Und er sagte ihm, daß er noch auf dem Bock säße und kutschiere und noch lange nicht neben dem Wagen herlaufen wolle; und wenn der Lenz meine, er könne ihm das Sitzbrett wegziehen, dann solle er blaue Wunder erleben.
Da war dann freilich ein verdrießliches Gesicht mehr in der Stube, und neben der keifenden Ursula setzte der Sohn grobe Ellenbogen auf den Tische und stach wütend in die Schüssel hinein. Diesen Zuständen ging der Schormayer gerne aus dem Wege und hockte sich lieber neben die gähnende Lammwirtin; und das beste davon war, daß sein Haus im Schlafen lag, wenn er heimkam.
Eines Abends aber sah er schon von weitem Licht in der Küche brennen, und auf des Nachbarn Hauswand lag der breite Schatten einer Weibsperson.
In der üblen Hoffnung, daß ihn noch ein Gespräch mit seiner Tochter erwarte, trat er mürrischer wie sonst ein; und da klinkte auch schon eine Tür auf.
»Bischt as du, Vata?«
»Ja, wer sinscht?«
»I hätt’ di gern was g’fragt.«
»Frag halt!«
»Die Bas’n vo Arnbach hat ma’r a Botschaft tho, und i soll morg’n zu ihr umikemma, und es waar oana do.«
»Was für oana?«
»A so halt oana.«
»Fallt dera nix anders ei, daß sie jetza scho kuppeln muaß?«
»Ja no, weil ‘s halt da Prückl Kaschpa vo Hirtlbach waar, und an sellan geht ma’r it alle Tag auf.«
»Ko der it zu mir herkemma und bei mir frag’n, wia ‘s si g’hört?«
»Er werd no nix wiss’n vo dem, und er hot grad a G’schäft z’ Arnbach, und ‘s Basl moant, wann i drent waar, na kunnt mi vielleicht auf des sell aa ‘z red’n kemma.«
»Geh halt umi, vo mir aus!«
»I geh aa, wann d’ Zollbrechtin für d’ Aushülf’ kimmt.«
»Was für an Aushülf?«
»Dahoam halt.«
»I brauch’ koane. Z’weg’n dem verhungern mi net, bal du net do bischt.«
»Aaba’r i mog it, daß du alloa do bleibst.«
»Han?«
»I mog it, daß du alloa mit dem Weibsbild dahoam bischt.«
Der Schormayer rückte den Hut aus der Stirne und fragte ruhig:
»Wia red’st denn du mit dein Vata? Han?«
Ursula verzog greinend das Maul und stampfte auf den Boden.
»Weil ‘s wahr is!«
Aber da schrie er schon:
»Wia du mit mir red’st, frag i, du Herrgottsaggerament!«
»Ja, du wurd’ mi g’schimpft, und …«
»‘s Mäu halt, du Saufratz, du nixiga!«
Sie trat einen Schritt zurück, denn er zog die Hand auf.
»No mal sag’ so was, na fangst d’ aba’r oane, du Rotzlöffi, du! Schaug so was o!«
»Und i ho ‘s amal g’sehg’n …«
Da packte der Schormayer seine Tochter mit harten Fingern am Arme und schob sie zur Tür hin.
»Naus, sag i, und marsch in dei Bett!«
Sie schrie weinerlich auf.
»Laß mi do aus!«
»I wer di na scho auslass’n, di! Und dös mirk’ da: bei’n erst’nmal, wo’s d’ no mal frech bischt, muaßt d’ aus’n Haus! Du Kramp’n, du mistiga!«
Er gab ihr einen derben Stoß und warf die Tür hinter sich zu.
Sie blieb eine Weile im Hausflötz stehen und überlegte sich, ob sie gescheiterweise noch etwas sagen sollte, aber sie griff dann lieber, wie viele Frauenzimmer, zu einem Selbstgespräch, indes sie in ihre Kammer hinaufging:
»Und bal i s amal g’sehg’n ho, daß sie bei eahm sell g’hockt is auf a Ofabank, und ganz hibei is sie g’hockt, und d’ Red’ hat ‘s eahm aa verschlag’n, wia’r i in d’ Stub’n eina bi, und jetz wisset a bal gor nimma, was er mi allssammete hoaß‘n muaß. Und was i amal woaß, des sell woaß i.«
Und was die Ursula einmal wußte, das vergaß sie nicht und brummte es ins Kopfkissen hinein, bis der Unwille in Schlaf und Schnarchen überging.
Aber auch sonst gab es noch Geräusch im Hause; denn unten flog ein Stiefel an die Kammertür, und ein Fluch wurde länger wie der andere, bis die Müdigkeit den Zorn wegräumte und dafür dem Schormayer einen schweren, astreichen Block unter die Säge schob. Und oben klinkte leise eine Tür ins Schloß, und barfuß tastete jemand über ein knarrendes Brett und schloff heimlich und still ins warme Nest zurück und schaute noch eine Weile mit nachdenklichen Augen zur Decke hinauf.
Dann drehte sich die Zenzi gegen die Wand und schickte den letzten Gedanken zwei Türen weiter, zur Ursula hinüber: »Wart, du Luada!« sagte sie beim Einschlafen.
Viertes Kapitel
Alle Dinge sind in der Nacht größer und schreckhafter wie am Tage; und sie werden kleiner, wenn sie deutlicher zu erkennen sind.
Das graue Morgenlicht zeigte dem Schormayer, daß hinter seinem gehabten Verdruß eigentlich nichts stand wie die Dummheit einer Weibsperson, die er niemals für gescheit genommen hatte.
Und er hätte beim Aufwachen nicht einmal daran gedacht, wenn ihm nicht einige Nebenumstände die Erinnerung aufgerüttelt hätten.
Denn wie er mit der Hand nach dem Nagel langte, an dem sonst seine Taschenuhr hing, fühlte er, daß sie nicht dort war, und wie er sich’s zurechtlegte, wo sie nur sein könnte, fiel es ihm ein, daß sie noch im Gilet stecken müßte; und als seine Augen das Gilet suchten, lag es wieder nicht auf dem Stuhl, sondern auf dem Boden, unweit von einem Stiefel, der recht verlassen von seinem Kameraden dastand.
Dieser Gefährte aber lehnte unwillig an der Tür neben einem zerknüllten Hute.
Es war eine lange Geschichte, der man in der frühen Stunde nur langsam mit den Gedanken folgen konnte; und erst an ihrem Ende kam die nächtliche Frechheit der Ursula.
Der Schormayer überdachte Ursachen und Folgen des Auftritts, und er wollte gerade finden, daß er sich von einigen anderen recht wenig unterschied, als es klopfte.
»Was geit ‘s?«
»D’ Kaffeesupp’n is firti.«
Das war eine fremde Stimme.
Er richtete sich auf.
»Han? Was is?«
»Da Kaffee is firti.«
»Wer is denn do?«
»I.«
»Wer i?«
»Die Zollbrechtin.«