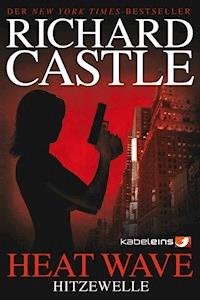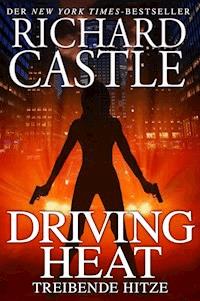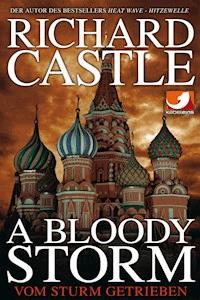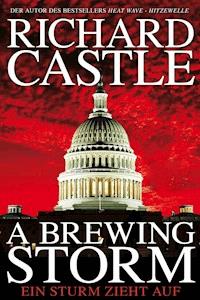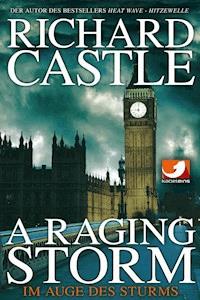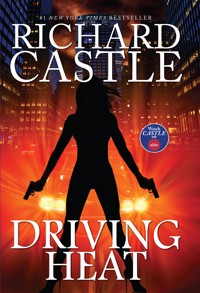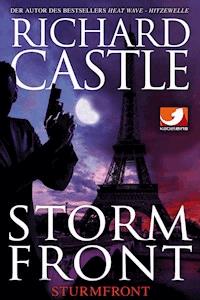
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Cross Cult
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Derrick Storm
- Sprache: Deutsch
Vier Jahre nach seinem mutmaßlichen Tod, ist Derrick Storm - der Mann, der Richard Castle zu einem konstanten Bestseller-Autoren gemacht hat - in diesem großartigen Thriller zuruck. Überall, von Tokio über London nach Johannesburg, werden Spitzenbanker grauenvoll gefoltert und ermordet. Der Mörder, nur in einem flüchtigen Schwenk einer Überwachungskamera eingefangen,wurde als Psychopath mit Augenklappe beschrieben. Und das bedeutet, dass Gregor Volkov, Derrick Storms alter Erzfeind, zuruckgekehrt ist. Die CIA ist verzweifelt bemuht herauszufinden, für wen Volkov arbeitet und warum. So sucht sie den einen Mann auf, der sich mit Volkovs Stärke und Gerissenheit messen kann: Derrick Storm. Storm entdeckt mithilfe einer schönen, geheimnisvollen ausländischen Agentin, mit der er sich romantisch und professionell verheddert, dass Volkovs Verrat einen wohlhabenden Hedgefonds-Manager und einen US-Senator gefährdet. In einem Rennen gegen die Zeit verfolgt Storm Volkovs Spur von Paris uber das Versteck eines Computergenies in Iowa bis zu den Straßen von Manhattan - und endet in einer Verfolgungsjagd mit dem Auto auf dem New Jersey Turnpike. Dabei deckt er einen Komplott auf, der die globale Wirtschaft zerstören könnte. Und nur er kann es aufhalten!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 512
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
RICHARDCASTLE
STORM FRONT
STURMFRONT
ÜBERSETZUNG
SABINE ELBERS
Die deutsche Ausgabe von CASTLE: STORM FRONT – STURMFRONTwird herausgegeben von Amigo Grafik, Teinacher Straße 72, 71634 Ludwigsburg.Herausgeber: Andreas Mergenthaler und Hardy Hellstern, Übersetzung: Sabine Elbers; verantwortlicher Redakteur und Lektorat: Markus Rohde; Lektorat: Katrin Aust; Satz: Rowan Rüster/Amigo Grafik; Cover Artwork: Shubhani Sarkar; Printausgabe gedruckt von CPI Morvia Books s.r.o., CZ-69123 Pohorelice. Printed in the Czech Republic.
Castle © ABC Studios. All rights reserved
Originally published in the United States and Canada as STORM FRONT by Richard Castle.This translated edition published by arrangement with Hyperion, an imprint of Buena Vista Books, Inc.
German translation copyright © 2013 ABC Studios.
Print ISBN ISBN: 978-3-86425-290-7 (Okt. 2013) · E-Book ISBN 978-3-86425-325-6 (Okt. 2013)
WWW.CROSS-CULT.DE
Für meinen Vater
EINS
VENEDIG, Italien
Den Gondoliere konnte man nur als auf verwegene Weise gutaussehend beschreiben, mit seinem dunklen Haar und den dunklen Augen, dem markanten Kinn und den ansehnlichen Muskeln, die von seinem täglichen Umgang mit dem Ruder herrührten. Er trug die Kleidung, die die Touristen von seinem Berufszweig erwarteten: ein enganliegendes quergestreiftes rot-weißes Shirt, eine schwarze Stoffhose und ein rotes Halstuch. Abgerundet wurde das Outfit durch einen breitkrempigen Sonnenhut, den er weiterhin trug, obwohl es bereits kurz vor Mitternacht war. Das typische Erscheinungsbild musste eben aufrechterhalten werden.
Mit kräftigen, geübten Bewegungen steuerte er das Boot unter der Fußgängerbrücke der Calle delle Ostreghe entlang. Als sie seiner Meinung nach schnell genug unterwegs waren, öffnete er den Mund und ließ seinen lauten Bariton erklingen.
„Arrivederci Roma“, trällerte er. „Good-bye, au revoir, mentre …“
„Bitte nicht singen“, sagte der Passagier, ein blasser, untersetzter Mann mit Tweed-Jackett, dessen Akzent stark nach britischem Internat klang.
„Aber-e das gehört-e zum Service“, erwiderte der Gondoliere mit starkem italienischem Akzent. „Es ist-e, wie sagt man, romantisch. Vielleischt-e finden wir ein hübsches Mädschen für Sie? Für bessere Laune?“
„Nicht singen“, wiederholte der Brite.
„Aber-e, isch könnte meine Lizenz-e verlieren“, protestierte der Gondoliere.
Er ruderte einen Moment lang stumm weiter, drehte dann sein Gesicht dem Briten zu und nahm seinen Gesang wieder auf.
„Assshoooooole-omio“, trällerte er, „Ooooo-sodomia …“
„Ich sagte doch, Sie sollen nicht singen“, schnauzte der Brite. „Mein Gott, das klingt, als ob jemand eine Ziege erwürgt. Hören Sie zu, ich zahle Ihnen das Doppelte, wenn Sie aufhören.“
Der Gondoliere murmelte stumm einen Fluch auf Italienisch, doch er sang nicht weiter. Der Mond wurde teilweise von Wolken verdeckt, und so blieb ihm nur wenig Licht zum Navigieren. Er konzentrierte sich auf seine Aufgabe und richtete den hohen, kunstvoll verzierten Bug des Bootes auf die Mitte des Canal Grande aus. Dann steuerte er auf die offenen Gewässer der Laguna Veneta hinaus, ein seltsamer Platz für eine Gondel mitten in der Nacht.
Die Strömung war hier stärker, und das flache Boot war nicht wirklich für die steife Brise gemacht, die aus westlicher Richtung hereinwehte. Der Gondoliere legte die Stirn in Falten, als der Markusturm in der Ferne hinter ihnen kaum noch sichtbar war.
„Wohin-e fahren wir noch mal?“, fragte er.
„Rudern Sie einfach weiter“, antwortete der Brite, während seine Augen die Dunkelheit zu durchdringen versuchten.
Ein paar Minuten später erhellten drei kurz aufeinanderfolgende Lichtsignale eines Scheinwerfers aus mehreren hundert Metern Entfernung die Nacht. Sie stammten vom Bug eines kleinen Fischerboots, das sich der Gondel von steuerbord näherte.
„Da“, sagte der Brite und zeigte nach rechts. „Da rüber.“
„Sì, signore“, erwiderte der Gondoliere und richtete das Boot in Richtung der Lichtquelle aus.
Bald darauf befanden sie sich längsseits des Fischerboots, eines weißen Fiberglastrawlers. Der Gondoliere verschaffte sich schnell einen Überblick über die Besatzung. Es befanden sich drei Personen an Bord, und keiner davon war ein Fischer. Einer stand am Bug und hielt ein AK-47 im Anschlag. Die Mündung des Gewehrs beschrieb einen Halbkreis, während er den Horizont absuchte. Ein anderer hielt sich in der Kabine auf und hatte beide Hände fest um das Steuerruder geschlossen. Im Holster an seiner rechten Hüfte trug er eine Waffe. Der dritte, ein kahlköpfiger Albino, stand am Heck. Er war offenbar unbewaffnet und konzentrierte sich einzig auf den Briten.
Es würde also recht einfach werden.
Der Motor des Fischerboots wurde in den Leerlauf geschaltet, und es kam langsam zum Stehen. Als sich die Boote schließlich Heck an Heck befanden, folgte eine kurze Unterhaltung zwischen dem Albino und dem Briten. Der Gondoliere wartete geduldig auf den Austausch, und dann war es so weit: Ein kleiner Samtbeutel wanderte in den Besitz des Briten.
Der Gondoliere machte seinen Zug. Der Mann mit dem AK-47 bekam nicht einmal mit, wie das lange Ruder aus dem Wasser auftauchte, geschweige denn, dass es sich mit hoher Geschwindigkeit auf ihn zubewegte – jedenfalls nicht, bis sich das Blatt nur noch wenige Zentimeter von seinem Ohr entfernt befand. Doch da war es längst zu spät. Ein dumpfer Knall war zu hören, als er auf dem Deck aufschlug.
Einer erledigt.
Der Mann am Steuerruder reagierte, allerdings nur langsam. Seine erste Handlung bestand darin, die Kabine zu verlassen und nach dem Ursprung des Geräuschs zu suchen. Das war ein Fehler. Er hätte seine Waffe ziehen sollen. Als ihm sein Fehler endlich bewusst wurde, hatte der Gondoliere bereits sein Ruder fallen lassen und war auf das Fischerboot gesprungen. Mit erhobenen Händen kam er näher. Zwar hätte der Gondoliere aus einer Vielzahl fernöstlicher Kampfkünste auswählen können, doch er entschied sich stattdessen für eine eher westliche Taktik. Eine kurze linke Gerade traf den Mann auf die Nase und machte ihn bewegungsunfähig. Es folgte ein rechter Aufwärtshaken direkt unters Kinn, der den Kerl endgültig ins Land der Träume schickte.
Zwei erledigt.
Der Albino beugte sich bereits zu seinem Knöchel herunter, an dem er ein Messer verborgen hatte. Doch auch er reagierte viel zu spät und viel zu langsam. Der Gondoliere machte einen großen Schritt auf ihn zu, drehte sich und versetzte dem Albino einen heftigen Tritt gegen den Kopf. Sein Körper sackte augenblicklich leblos in sich zusammen.
Schnell fesselte der Gondoliere alle drei Männer mit Kabelbindern, die er aus einer seiner Hosentaschen hervorgeholt hatte. Der Gondoliere schien noch nicht einmal außer Atem zu sein.
„In Ordnung, jetzt sind Sie dran“, sagte er zu dem Briten und zog einen weiteren Kabelbinder hervor. Sein italienischer Akzent war plötzlich verschwunden. Er war … Amerikaner?
„Wer … wer sind Sie?“, fragte der Brite.
„Das sollte im Moment wohl nicht Ihre größte Sorge sein“, erwiderte der Gondoliere und bereitete sich darauf vor, wieder an Bord der Gondel zu gehen. „Eine Anklage wegen Hochverrats dagegen …“
„Bleiben Sie, wo Sie sind“, rief der Brite und zog eine Derringer aus seinem Tweed-Jackett hervor.
Der Gondoliere betrachtete die Pistole, wirkte jedoch eher genervt als besorgt. Der Geheimdienst hatte behauptet, dass der Brite nicht bewaffnet sei – was mal wieder bewies, wie gut informiert der Geheimdienst in Wirklichkeit war.
Ohne zu zögern, vollführte der Gondoliere einen Kopfsprung rückwärts vom Trawler hinunter in das unruhige Wasser der Laguna Veneta. Der Brite riss am Abzug der Derringer und feuerte einen Schuss ab. Doch der Gondoliere war zu schnell gewesen. Die Chancen, auf dem entfernten Markusplatz eine der unzähligen Tauben zu treffen, hätten deutlich besser für den Briten gestanden.
Der Brite wandte den Kopf nach links, nach rechts und wieder nach links. Er drehte sich um und dann wieder nach vorn. Er wartete darauf, dass ein Kopf an der Oberfläche auftauchte, und er hatte fest vor, ihn zu durchlöchern. Zwar war die Derringer keine wirklich genaue Waffe, aber der Brite war ein hervorragender Schütze. Wie die meisten Spione.
Er wartete. Zehn Sekunden. Zwanzig Sekunden. Dreißig Sekunden. Eine Minute. Zwei Minuten. Der Gondoliere war verschwunden, aber wie war das nur möglich? Hatte die Kugel des Briten ihr Ziel doch nicht verfehlt? Es musste wohl so sein. Der Mann, wer auch immer er gewesen sein mochte, lag nun auf dem Grund der Lagune.
„Das wäre erledigt“, sagte der Brite, steckte die Derringer zurück in sein Jackett und hielt sich auf beiden Seiten der Gondel fest, damit er aufstehen und sich umsehen konnte.
Dann spürte er eine Hand. Sie kam aus dem Nichts, nass und kalt, und umklammerte sein Handgelenk. Als Nächstes durchfuhr ihn ein heftiger Schmerz, als die Hand seinen Arm verdrehte, bis das Ellbogengelenk brach. Er schrie schmerzerfüllt auf, doch seine Qual dauerte nur kurz. Der Gondoliere katapultierte sich aufs Boot und verpasste dem Mann seitlich einen Schlag gegen den Kopf. Augenblicklich wich jegliche Kraft aus dem Körper des Briten, und er sackte auf dem Sitz des Gondoliere zusammen.
„Du hättest mich einfach singen lassen sollen“, sagte der Gondoliere zu dem bewusstlosen Briten. „Ich fand, dass es sich wundervoll anhörte.“
Der Gondoliere fesselte den Briten, fand den Samtbeutel und begutachtete den Inhalt. Eine Handvoll Diamanten, mindestens zwei Millionen Dollar wert, funkelte ihm entgegen.
„Papa hätte wirklich besser auf die Familienjuwelen aufpassen sollen“, meinte er zu dem immer noch reglos daliegenden Briten.
Dann stand der Gondoliere auf. Er brachte seine Armbanduhr nahe an sein Gesicht heran, drückte auf einen Knopf an der Seite und sprach hinein.
„Müllabfuhr, hier spricht Vito“, meldete er. „Es wird Zeit, den Müll abzuholen.“
„Verstanden, Vito“, antwortete eine Stimme, die aus den kleinen Lautsprechern der Uhr drang. „Es kommt gerade ein Müllwagen rein. Sind Sie sicher, dass Sie die gesamte Route fertig haben?“
„Bestätige.“ Der Gondoliere betrachtete die vier bewusstlosen Männer vor ihm. „Habe nur vier Tonnen gefunden. Sie wurden alle ausgeleert.“
Eine neue Stimme drang aus den Lautsprechern der Uhr. „Wir wussten, dass wir auf Sie zählen können“, sagte sie. „Gute Arbeit, Derrick Storm.“
ZWEI
ZÜRICH, Schweiz
Der Räuber war in der Küche. Dessen war sich Wilhelm Sorenson sicher. Mit rasendem Herzen näherte er sich der Schwingtür, die in den Raum hineinführte. Er hielt inne und lauschte auf das kleinste Geräusch.
Ja, da war was. Ein leises Klappern von einem der Kupfertöpfe, die von der Decke herabhingen. Das war der Räuber, ganz sicher. Die Jagd würde schon bald vorbei sein. Der Räuber würde gefasst und seiner gerechten Strafe zugeführt werden. Seiner Version einer gerechten Strafe.
Sorenson bewegte sich wie ein Polarfuchs in der Tundra, bis er seine Hand an die Tür legte. Wieder ein Geräusch. Dieses Mal war es ein Kichern.
Er liebte ihre Version des Räuber-und-Gendarm-Spiels.
„Oh Vögelein!“, rief er auf Deutsch.
Sie kicherte erneut. Er stürmte durch die Tür und schnaufte aufgrund der Anstrengung. So viel bewegte er sich sonst nie.
Doch sie war schon wieder weg. Er spürte Feuchtigkeit auf seiner Stirn und sah zu, wie die Schweißperlen von seinem Gesicht herunterrannen und auf den Boden tropften. Er hatte vor einer halben Stunde die dreifache Dosis seiner Medikamente gegen erektile Dysfunktion eingenommen, und die Pillen hatten quasi jedes Blutgefäß in seinem Körper erweitert. Nun rauschte das Blut durch ihn hindurch, verfärbte sein sonst eher blasses Gesicht beinahe schon lila und schraubte seine Körpertemperatur so stark nach oben, dass ihm der Schweiß aus allen Poren rann, als wäre er ein Schwein auf dem Weg zur Schlachtbank.
Glücklicherweise konnte ihn gerade keiner der anderen Vorstandsmitglieder sehen, geschweige denn jemand von der Presse: Wilhelm Sorenson, einer der reichsten Männer der Schweiz und einer der mächtigsten Banker der Welt, nur mit Socken, Boxershorts und Sockenhaltern sowie einem Polizeihut aus dem Karnevalsbedarf bekleidet.
Er hatte seine Frau in ihr Chalet im Loire-Tal verfrachtet, wo sie das Wochenende gemeinsam mit ein paar Freundinnen bei einer Weinprobe verbrachte. Genau das, was die alte Schnapsdrossel wollte. So hatte er ihr Anwesen am Ufer des Greifensees für sich allein.
Oder eher für sich und Brigitte, das neunzehnjährige Mädchen aus Schweden, die das neueste Objekt in einer langen Reihe von Wilhelms gerade noch legalen Begierden war.
Ihre kleinen Tête-à-têtes waren auch nach den strengsten Gesichtspunkten des Gesetzes keinesfalls illegal, nur unmoralisch, ehebrecherisch und total ekelhaft. Um ehrlich zu sein, gab es wenige Dinge, die noch mehr wider die Natur waren als der Anblick von Wilhelm, einem verheirateten Mann, der stramm auf die siebzig zuging, dem das Fett schlaff über die Unterwäsche hing und der diesem schlanken, blonden, wunderschönen jungen Ding hinterherjagte.
Doch wie dem auch sei, so ging ihr kleines Spiel. Sie schlüpfte in jedes absurd teure Stück Reizwäsche, das er ihr mitbrachte – zuletzt ein vierhundert Dollar teurer Hauch von Nichts aus mit Federn besetzter pinker Seide, den er von einer Reise nach New York mitgebracht hatte – und rannte durchs Haus. Sie trank die ganze Zeit über einen vierhundertfünfzig Euro teuren Bollinger Vieilles Vignes Françaises direkt aus der Flasche. Fünf lange Züge daraus reichten ihr aus, um vorzutäuschen, dass sie betrunken war. Zehn waren genug, um ihn zu ertragen, wenn er grunzend und schwitzend auf ihr lag. An diesem Punkt angelangt ließ sie sich für gewöhnlich einfangen, hauptsächlich damit sie es endlich hinter sich bringen konnte. Meistens brauchte er nicht mehr als fünf Minuten.
„Oh, Schnucki!“, säuselte sie – vermutlich war dies das unpassendste Kosewort in der Geschichte der gesprochenen Sprache.
In der Küche war sie nicht. Also folgte er dem lieblichen Klang ihrer Stimme ins Wohnzimmer, einen Raum mit hohen Decken und einem beeindruckenden Blick auf den See. Allerdings erregte das sanfte Wasser im Moment nicht seine Aufmerksamkeit.
„Ich kriege dich, Vögelein!“, sagte er.
Er stieß sich seinen Zeh an der Couch und stieß einen leisen Fluch aus. Er hatte nicht getrunken, denn er lief selbst nüchtern kaum zu großer Form auf. Betrunken wäre er der Sache überhaupt nicht gewachsen, da halfen auch die ganzen blauen Pillen nicht, die er eingeworfen hatte.
Das Kichern schien nun aus dem Flur zu kommen, der ins Foyer führte, also folgte er dem Geräusch. Ja, das Ganze würde bald vorüber sein. Ein kleines Wohnzimmer grenzte an das Foyer, aber ansonsten war es eine Sackgasse. Schon bald würde er sie erwischen.
Dann hörte er sie schreien.
Sorenson verzog das Gesicht. Sie sollte es ihm doch nicht so einfach machen. Das gehörte nicht zum Spiel.
Aber egal. Er würde kriegen, was er wollte, und sie dann mit seiner Kreditkarte ausgestattet hinunter in die Stadt schicken, wo sie die Nacht über durch die Clubs zog. Auf diese Weise bekam er etwas Schlaf.
„Jetzt habe ich dich, Vögelein“, rief er.
Er bog um eine Ecke ins dunkle Foyer und hielt inne. Dort standen sechs schwer bewaffnete Männer in schwarzer taktischer Kleidung. Da sie Nachtsichtgeräte trugen, waren ihre Gesichter kaum zu erkennen.
Einer der Männer, der größte aus der Gruppe, hatte Brigitte an einem ihrer Zöpfe gepackt und hielt ihr ein Messer an die Kehle. Ihre Augen weiteten sich vor Angst.
„Was ist hier los?“, fragte Sorenson auf Deutsch.
Der kleinste der Männer, ein Muskelprotz, der kaum größer war als eins sechzig, nahm sein Nachtsichtgerät ab und enthüllte eine Augenklappe und eine von wachsartigen Brandnarben entstellte Gesichtshälfte. Er richtete eine Ruger Halbautomatik Kaliber .45 auf Sorensons Bauch.
„Klappe halten“, befahl der Mann und deutete auf das Wohnzimmer. „Da rein.“
Wilhelm Sorenson war der führende Devisenhändler bei der Nationale Banc Suisse, der größten Bank der Schweiz mit Vermögenswerten von mehr als zwei Billionen Schweizer Franken. Mit nur einem einzigen Knopfdruck bewegte er täglich unermessliche Reichtümer in Euro, US-Dollar, Yuan und Rand. Allein sein Bonus hatte im vorangegangenen Jahr fünfundvierzig Millionen Franken betragen, die Erträge aus seinen privaten Investments nicht dazugerechnet. Niemand kommandierte ihn herum.
„Das ist … das ist eine Unverschämtheit“, echauffierte sich Sorenson und wechselte damit ins Englische, die Sprache der Eindringlinge. „Wer sind Sie?“
Augenklappe wandte sich zu dem Mann um, der Brigitte festhielt, und nickte. Der Mann machte eine Bewegung mit der Hand, in der er das Messer hielt, und durchschnitt die Kehle des Mädchens. Ihr Schrei hörte sich an, als befände sie sich unter Wasser. Dann fiel sie auf die Knie. Blut strömte unablässig aus ihrer durchtrennten Halsschlagader. Sie legte ihre Hand an ihren Hals, doch es war, als wolle man Wasser mit einem Abtropfsieb auffangen. Das Blut schoss nur so durch ihre Finger.
„Man sollte meine Anordnungen besser nicht missachten“, warnte Augenklappe.
Sorenson schaute voller Entsetzen dabei zu, wie das Leben aus seinem Spielzeug herausströmte. Um sie machte er sich keine Sorgen, nur um sich selbst. Panik überkam ihn. Er hatte seinen Sicherheitsleuten das Wochenende über frei gegeben, damit er und Brigitte ihr kleines Stelldichein ungestört genießen konnten. Er besaß eine Waffe, eine alte Walther P38, die ihm sein Vater, ein Nazi-Sympathisant, vererbt hatte. Allerdings lag die oben eingeschlossen in einem Safe. Sein Telefon hatte er offensichtlich nicht dabei, und diese Typen sahen auch nicht wirklich so aus, als würden sie ihn telefonieren lassen.
Er war ihnen ausgeliefert.
„Bitte lassen Sie uns die Sache mit Vernunft angehen“, sagte Sorenson und versuchte, ruhig zu klingen. „Ich bin ein sehr vermögender Mann, ich kann …“
„Klappe halten“, befahl Augenklappe, hob die .45er und richtete sie auf Sorensons Gesicht. „Da rein. Bewegung.“
Sorenson spürte, wie sich der Lauf einer Waffe in seinen Rücken bohrte. Einer der anderen Männer war hinter ihn getreten und benutzte seine Waffe, um ihn in das kleine Wohnzimmer zu drängen. Er gab nach und ließ sich langsam hineinführen. Währenddessen versicherte er sich selbst, dass diese Männer nicht hier waren, um ihn töten. Er musste unbedingt die Nerven behalten. Man tötete einen Mann wie Wilhelm Sorenson nicht einfach. Die Sache würde viel zu große Kreise ziehen. Allerdings würde es ihn eine Menge Geld kosten, ganz zu schweigen von der Bloßstellung.
Sorenson warf einen letzten Blick zurück auf Brigitte, die nun mit dem Gesicht nach unten in einer sich ausbreitenden Blutlache lag. Wie sollte er das nur seiner Frau erklären? Er war immer sehr diskret mit seinem kleinen Hobby umgegangen, jedenfalls diskret genug, damit er und die blöde Kuh vorgeben konnten, eine ganz normale Ehe zu führen. Noch schlimmer war, dass Brigittes Blut in den antiken Hereke gesickert war, den er in der Türkei gefunden hatte. Es war der Lieblingsteppich seiner Frau. Verdammt. Jetzt hatte er ein echtes Problem.
Als sie das Wohnzimmer betraten, sagte Augenklappe: „Da hin“ und zeigte auf einen Windsor-Stuhl mit hoher Lehne, der ein Geschenk eben jener Windsors gewesen war. Zwei Männer fesselten Wilhelm fachmännisch mit Klebeband an den Stuhl und klebten mehrere Bahnen um seine Fußgelenke, Knie, Hüfte, Brust und Rücken. Nur seine Arme blieben frei.
„Wer auch immer Sie für das hier bezahlt, ich kann Ihnen mehr bieten“, erklärte Sorenson. „Das verspreche ich Ihnen.“
„Klappe halten“, erwiderte Augenklappe und verpasste ihm einen Schlag mit dem Handrücken.
„Sie verstehen wohl nicht, ich …“
„Wollen Sie etwa, dass ich Ihnen die Lippen abschneide?“, fragte Augenklappe. „Ich werde mich mit Freuden an die Arbeit machen, wenn Sie weiterreden.“
Sorenson presste die Lippen aufeinander. Sie wollten also zunächst ihre Dominanz ihm gegenüber unter Beweis stellen? Alles klar. Er würde sie gewähren lassen. Als die beiden Männer damit fertig waren, Sorenson am Stuhl zu fixieren, öffnete Augenklappe eine schwarze Reisetasche und holte einen seltsam aussehenden Holzblock hervor. Es handelte sich augenscheinlich um eine Art Holzfessel mit ovalen Aussparungen für beide Handgelenke und verstellbaren Klammern, mit denen der Block an einer glatten Oberfläche befestigt werden konnte.
Augenklappe sah sich nach einem passenden Tisch um und fand in einer Ecke, was er suchte: einen handgeschnitzten Tisch aus Ebenholz mit marokkanischen Mosaikintarsien. Das Ding wog mehrere hundert Kilo. Es waren zwei Männer und eine Sackkarre nötig gewesen, um ihn dort zu platzieren, als man ihn vor drei Jahren geliefert hatte. Seitdem war er nicht mehr bewegt worden. Augenklappe hob ihn allein hoch, und offensichtlich kostete es ihn kaum Anstrengung. Er stellte ihn vor Sorenson ab und befestigte dann die Holzfessel daran.
Augenklappe nickte, woraufhin die beiden Männer, die den Banker gefesselt hatten, jeweils einen von Sorensons Armen ergriffen. Sorenson hatte das Gefühl, dass sie dies schon mal getan hatten, denn jede ihrer Bewegungen schien einstudiert. Sie führten seine Arme durch die Aussparungen der Holzfessel. Augenklappe ließ die Vorrichtung zuschnappen und justierte sie, bis Sorensons Handgelenke fixiert waren.
Als Nächstes zog Augenklappe eine spitz zulaufende Pinzette aus der Tasche und betrachtete sie einen Moment lang. Dann riss er, ohne weiteren Kommentar, jeden einzelnen Fingernagel an Sorensons rechter Hand heraus. Sorenson schrie, fluchte, bettelte, drohte, wimmerte, weinte und fluchte noch etwas mehr. Augenklappe war vollkommen ungerührt. Er war ausnahmslos auf seine Tätigkeit konzentriert, so als würde er alte Nägel aus einem Brett ziehen. Nach jedem bearbeiteten Finger hielt er kurz inne, um den blutigen Fingernagel zu betrachten, bevor er ihn in einen Beutel an seinem Gürtel gleiten ließ. Er liebte Fingernägel. In seiner Sammlung befanden sich Hunderte davon.
Sorensons Daumen war etwas störrisch gewesen. Augenklappe hatte den Nagel in drei Teilen abnehmen müssen. Er verzog das Gesicht, als er seine schlampige Arbeit betrachtete. Den würde er nicht aufbewahren.
Er nickte, und seine Männer entfernten Sorensons blutige rechte Hand aus der Fessel. Daraufhin wandte sich Augenklappe der linken zu.
„Nun denn“, sagte Augenklappe. „Nennen Sie mir Ihren Zugangscode.“
Sorenson stand kurz vor einem Herzstillstand. Sein Herz hämmerte mit beinahe zweihundert Schlägen pro Minute in seiner Brust. Aufgrund der Schmerzen hatte er einen Schock erlitten, daher war sein Körper eiskalt, obwohl er gleichzeitig aus allen Poren schwitzte.
„Welcher … welcher Zugangscode?“, keuchte er.
Patchs Antwort auf diese Frage bestand in der Entfernung des Fingernagels an Sorensons linkem kleinem Finger. Der Banker heulte erneut auf. Vollkommen gelassen platzierte Augenklappe den Fingernagel in seinem Beutel.
„Oh Gott, sagen Sie mir doch einfach, welchen Zugangscode Sie meinen“, flehte er. „Ich gebe Ihnen den Code, ich muss nur wissen, welchen.“
„Für den MonEx 4000“, antwortete Augenklappe.
Den MonEx 4000? Was wollten die mit … Aber es spielte keine Rolle mehr. Es zählte nur noch der Schmerz. Und wie er ihn stoppen konnte. Ohne zu zögern, ratterte Sorenson seinen Zugangscode herunter. Augenklappe sah zu einem Mann hinüber, dessen langes feuerrotes Haar unter seinem Nachtsichtgerät hervorlugte. Dieser zog ein kleines Handgerät hervor und tippte die Kombination aus Buchstaben und Ziffern ein, die Sorenson ihnen genannt hatte. Der Mann nickte nur ein einziges Mal mit dem Kopf.
Zufrieden nahm Augenklappe die .45er aus dem Holster und verpasste Sorenson zwei Kugeln in die Stirn.
Als Sorensons Leiche am nächsten Morgen von seinem Gärtner gefunden und die zuständigen Behörden informiert wurden, war es drei Uhr morgens Eastern Standard Time.
Etwa um vier Uhr dreißig versahen die Computer von Interpol, der internationalen kriminalpolizeilichen Organisation, das Verbrechen mit einer Markierung, da ihnen Übereinstimmungen mit anderen Morden, die in den vorangegangenen fünf Tagen in Japan und Deutschland verübt worden waren, auffielen.
Innerhalb der nächsten halben Stunde bestätigten die Mitarbeiter bei Interpol die Computeranalyse und entschieden, ihr Benachrichtigungsprotokoll zu aktivieren. Sie begannen damit, ihre Kontakte rund um den Globus zu alarmieren, inklusive der amerikanischen Strafverfolgung.
Die Amerikaner brauchten eine geschlagene Stunde, um zu entscheiden, wie sie damit am besten umgehen sollten.
Eine Stunde später, um exakt 6:03 Uhr morgens, klingelte das Telefon von Jedidiah Jones.
Offiziell arbeitete Jones für den National Clandestine Service der CIA. Seine genaue Jobbeschreibung lautete Leiter der internen Vollstreckungsabteilung. Doch in den offiziellen Aufzeichnungen der CIA tauchten weder seine Missionen noch sein Personal oder das ihm zur Verfügung stehende Budget auf.
Der Mann am Telefon entschuldigte sich dafür, ihn so früh an einem Samstag anzurufen, dabei hätte er sich darüber überhaupt keine Sorgen machen müssen. Jones war um vier Uhr bereits Joggen gewesen und saß seit fünf Uhr dreißig an der Arbeit. So sah sein gemütlicher Samstagsterminplan aus.
Jones nahm die Informationen entgegen, dankte dem Mann und machte sich an die Arbeit. Er zog an Fäden, von denen nur er wusste, wie er sie ziehen musste.
Es dauerte etwa eine Stunde, seine Leute in der Schweiz, Japan und Deutschland vor Ort zu aktivieren.
Nur zwei Stunden später erhielt er bereits ihre vorläufigen Berichte.
Zu diesem Zeitpunkt erfuhr er auch, dass der Killer in der Schweiz eine Augenklappe getragen hatte, und sein nächster Zug stand fest. Es gab nur einen einzigen Mann in seiner Kontaktliste, der über die Fähigkeiten, den Intellekt und die Hartnäckigkeit verfügte, um mit diesem bestimmten Killer fertigzuwerden.
Er griff nach seinem Telefon und rief Derrick Storm an.
DREI
BARCHAU, Rumänien
Es waren die Augen, mit denen sie einen erwischten. Derrick Storm wusste das aus Erfahrung. Man konnte sich einreden, dass es einfach nur ganz normale Kinder waren. Man konnte sich einreden, dass für sie alles gut werden würde. Man konnte sich einreden, dass sie es gar nicht so schwer hatten.
Aber die Augen. Oh, diese Augen. Groß, dunkel, glänzend. Voller Hoffnung und Schmerz. Was für Geschichten sie erzählten. Wie sie flehten: „Bitte hilf mir, bitte bring mich nach Hause.“ „Bitte, bitte nimm mich in den Arm, nur ganz kurz, und ich gehöre für immer dir.“
Ja, sie erwischten dich. Jedes Mal. Wegen dieser Augen kehrte Storm immer wieder zum Waisenhaus des Heiligen Namens zurück, zu diesem kleinen Ort voller Liebe und unerwarteter Schönheit inmitten einer ansonsten tristen Industriestadt im Nordosten Rumäniens. Wenn man ein Mal in solche Augen geblickt hatte, musste man einfach immer wieder zurückkehren.
Aus diesem Grund absolvierte Storm, nachdem er den Job in Venedig erledigt hatte, einen weiteren Besuch hier. Das Waisenhaus des Heiligen Namens war in einem uralten Kloster untergebracht, das von den Bombenangriffen im Zweiten Weltkrieg verschont geblieben und kurz nach Kriegsende für seinen jetzigen Zweck umgebaut worden war. Storm hatte sich über die Hauptmauer ins Innere geschlichen, sich eine Harke gegriffen und sammelte nun in aller Stille Blätter im Hof auf, als er bemerkte, dass ihn ein Paar große braune Augen neugierig anstarrte.
Er wandte sich um und sah ein kleines Mädchen, kaum älter als fünf, das einen verschmutzten Stofffetzen im Arm hielt, der viele Jahre und viele Kinder zuvor vielleicht mal ein Teddybär gewesen war. Ihre Kleidung konnte man fast schon als Lumpen bezeichnen. Sie hatte braunes Haar und einen ernsten Gesichtsausdruck, der ein wenig zu traurig für ein Kind ihres Alters wirkte.
„Hallo, mein Name ist Derrick“, sagte er in fließendem Rumänisch. „Wie heißt du denn?“
„Katya“, antwortete sie. „Katya Beckescu.“
„Es freut mich, dich kennenzulernen.“
„Ich bin hier, weil meine Mami tot ist“, erklärte Katya auf diese direkte Art, mit der alle Kinder Neuigkeiten mitteilten, egal ob gute oder schlechte.
„Das tut mir sehr leid“, erwiderte Storm. „Gefällt es dir hier?“
„Es ist schön“, sagte Katya. „Aber manchmal wünschte ich mir, ich hätte ein richtiges Zuhause.“
„Dann werden wir wohl sehen müssen, ob wir da etwas tun können“, versprach Storm, doch dann wurde er unterbrochen.
Eine Frau in einem Nonnengewand näherte sich mit strengem Gesichtsausdruck. Sie war kaum größer als eins fünfzig und sehr sehnig. „Nun aber los, Katya“, sagte sie auf Rumänisch. „Du hast deine Aufgaben immer noch nicht erledigt.“
Ihre nächsten Befehle richtete sie an Storm.
„Es tut mir leid, Kleiner, aber wir nehmen im Moment keine weiteren Bewohner auf“, erklärte sie und wechselte ins Englische, das sie mit einem deutlichen Dubliner Akzent sprach. „Also ab mit dir.“
„Hallo Schwester Rose“, grüßte Storm, ließ seine Harke fallen und umarmte die Nonne.
Schwester Rose McAvoy lächelte, während sie zuließ, dass Storm sie beinahe an seiner steinharten Brust zerquetschte. Sie ging stramm auf die achtzig zu, sah aus wie sechzig, bewegte sich, als sei sie vierzig, und hatte sich das unbeugsame Temperament eines Teenagers bewahrt, mit dem sie als junge Novizin vor vielen Jahrzehnten hierher gesandt worden war. Sie pflegte zu sagen, dass sie Irin nach Herkunft, Rumänin aus Notwendigkeit und Katholikin dank der Gnade Gottes war.
Während ihrer Zeit im Waisenhaus hatte sie die Einrichtung unerschrocken durch die Sowjetbesatzung und Ceaușescu geführt, hatte der Austeritätspolitik der Achtziger Jahre und der Revolution von 1989, der Nationalen Rettungsfront und jeder weiteren Regierung, die darauf gefolgt war, getrotzt und zuletzt auch dem Internationalen Währungsfonds.
Es war kaum zu glauben, aber sie hatte stets dafür gesorgt, dass ihr die Autorität gewogen und das Waisenhaus geöffnet blieb. Wenn man sie fragte, wie ihr das gelungen sei, sagte sie nur: „Gott erhört unsere Gebete, weißt du.“
Storm war sich nicht sicher, was er vom Einfluss Gottes halten sollte, doch er vermutete, dass der Erfolg des Waisenhauses eher mit den Fähigkeiten von Schwester Rose als Leiterin, Spendensammlerin, Arbeitgeberin und liebender Mutterfigur vieler Generationen zusammenhing.
Es lag ganz bestimmt nicht daran, dass sie es leicht hatte. Schwester Rose hatte es sich zur Aufgabe gemacht, die schlimmsten Notfälle aufzunehmen. Die Kinder, die die anderen Waisenhäuser nicht aufnehmen wollten, und auch solche, die kaum noch darauf hoffen konnten, adoptiert zu werden. Viele waren geistig oder körperlich behindert. Viele blieben noch lange nach ihrem achtzehnten Geburtstag, an dem sie das Waisenhaus eigentlich verlassen sollten, einfach weil sie nicht wussten, wohin sie gehen sollten. Und Schwester Rose setzte niemals jemanden einfach vor die Tür. Sie waren alle Gottes Kinder, also war auch für alle ein Platz an ihrem Tisch frei.
Storm war ein paar Jahre zuvor während eines Auftrags, dessen schreckliche Einzelheiten er um jeden Preis hinter sich lassen wollte, über das Waisenhaus gestolpert. Wann immer er zu Besuch kam, brachte er einen Koffer oder zwei voller großer Banknoten für Schwester Rose mit.
Nun spazierten sie Arm in Arm durch den Garten, den Schwester Rose genauso liebevoll pflegte wie ihre Kinder. Storm spürte den unglaublichen Frieden an diesem Ort. Hier ergab die Welt einen Sinn. Es gab keine Unklarheiten, keine Betrügereien, keinen Anlass, Motive zu analysieren und das Wie und Wofür infrage zu stellen. Hier gab es nur Schwester Rose und ihre unermüdliche Güte. Und all die Kinder mit ihren großen Augen.
„Schwester Rose“, Storm seufzte wehmütig, „wann werden Sie mich endlich heiraten?“
Sie tätschelte seinen Arm. „Ich sag’s dir doch immer wieder, Kleiner, ich bin schon mit Jesus Christus verheiratet“, erinnerte sie ihn und fügte dann mit einem Blinzeln hinzu: „Aber falls er mich irgendwann abserviert, bist du der Erste, den ich anrufe.“
„Ich warte voller Ungeduld auf diesen Tag“, erwiderte er. Storm hatte ihr über die Jahre nicht weniger als zwanzig Anträge gemacht.
„Vielen Dank für deine Spende“, sagte sie leise. „Du bist ein Geschenk Gottes, Derrick Storm. Ich wüsste nicht, was wir ohne dich tun sollten.“
„Das ist das Wenigste, was ich tun kann, besonders für Kinder wie dieses“, antwortete er und deutete auf das kleine Mädchen, das nun einem Schmetterling hinterherjagte.
„Oh, du meinst sie“, sagte Schwester Rose und seufzte. „Die hat’s faustdick hinter den Ohren. Schlau wie ein Fuchs, aber nichts als Unsinn im Kopf. Genau wie du.“
Schwester Rose tätschelte erneut seinen Arm, dann verschwand das Lächeln aus ihrem Gesicht.
„Was ist los?“, fragte Storm.
„Ich … ich mache mir nur Sorgen, Derrick. Ich bin nicht mehr der junge Hüpfer von damals. Ich frage mich, was geschehen wird, wenn ich nicht mehr hier bin.“
„Warum? Wo wollen Sie denn hin?“ Storm hob die Brauen. „Sagen Sie bloß, dass Sie nun doch mein Angebot annehmen und mit mir nach Saint-Tropez durchbrennen wollen. Keine Sorge, es wird Ihnen dort gefallen. Es gibt tolle Oben-ohne-Strände.“
„Derrick Storm!“, ermahnte sie ihn und knuffte ihn in die Schulter. „Du siehst zwar wie ein großer starker Mann aus, aber unter dem Ganzen steckt doch nur ein kleiner Schurke.“
Storm grinste. Doch Schwester Rose wurde wieder ernst. „Unser Vater hat mir viele gesegnete Jahre auf dieser Erde beschert, aber du weißt auch, dass das nicht immer so weitergehen kann. Wenn er mich zu sich ruft, dann muss ich gehen. Er ist mein Chef, weißt du.“
„Ja. Da wir gerade davon sprechen, Sie müssen unbedingt mit ihm über seinen Rentenplan reden. Ich habe mir Ihr …“
Storm wurde vom Klingeln seines Satellitenhandys unterbrochen. Er warf einen Blick darauf und entschied, das Klingeln zu ignorieren. Es klingelte erneut. Die Nummer des Anrufers war unterdrückt, also konnte er sich denken, wer der Anrufer war.
„Nun geh schon an dein Handy, Derrick“, schalt ihn Schwester Rose. „Ich lasse nicht zu, dass du dich in meinem Beisein vor der Arbeit drückst.“
Storm ließ es noch zweimal klingeln. Erst als Schwester Rose ihn böse anblickte, nahm er das Gespräch an.
„Privatdetektei Storm“, meldete er sich. „Sie sprechen mit Derrick Storm, dem Inhaber.“
„Ja, ich glaube, dass meine Freundin mich betrügt. Könnten Sie sich im Gebüsch vor einem heruntergekommenen Motel verstecken und ein paar Fotos schießen?“, ertönte die bekannte raue Stimme, die er zuletzt vor zwei Tagen in Venedig gehört hatte.
Jedidiah Jones war einer der wenigen Menschen in Storms Leben, die darüber Bescheid wussten, dass er mal als erfolgloser Privatdetektiv gearbeitet hatte. Ein Veteran der Marines, der zu einem Versager verkommen war und tatsächlich die meiste Zeit in solchen Gebüschen zugebracht hatte – wenn er überhaupt Arbeit hatte. Bis eine Frau namens Clara Strike Storm entdeckt hatte. Sie wurden Partner. Und ein Paar. Doch obwohl die Sache nicht gut ausgegangen war, hatte ihre Beziehung doch dazu geführt, dass sie ihn in die CIA gebracht und an Jones übergeben hatte.
Es war Jones gewesen, der Storm ausgebildet, ihn als freien Mitarbeiter der CIA etabliert und schließlich zu dem gemacht hatte, was er heute war: ein Mann fürs Grobe, ein Außenstehender, der tun konnte, was getan werden musste, ohne die rechtlichen Einschränkungen, die die Agenten oftmals behinderten. Jones’ Karriere war durch die vielen Erfolge Storms weiter gediehen.
„Es tut mir leid, Sir“, sagte Storm und spielte das Spiel weiter mit. „Mir ist klar, dass sie durch die Taten Ihrer Freundin verletzt sind. Aber ich mache keine Fotos von Ziegen.“
„Sehr witzig, Storm“, konterte Jones. „Aber die Zeit für Witzeleien ist vorbei. Ich habe hier einen Auftrag, auf dem dein Name steht.“
„Vergiss es. Ich habe dir doch gesagt, dass ich mir nach Venedig einen langen Urlaub gönnen werde. Und das habe ich auch fest vor. Schwester Rose und ich wollen nämlich nach Saint-Tropez.“
Storm zwinkerte der Nonne zu.
„Heb dir das für später auf. Die Sache hier ist wichtiger als dein Urlaub.“
„Mein Leben war so viel besser, als ich tot war“, bemerkte Storm wehmütig. Und er sagte das nur halb im Spaß. Vier Jahre lang galt Storm als im Kampf gefallen. Es gab sogar Zeugen, die beschworen, dass sie ihn hatten sterben sehen. Sie hatten nie erfahren, dass die große, überzeugend echt wirkende Austrittswunde an seinem Hinterkopf nur ein ausgetüftelter CIA-Trick gewesen war, oder dass Jones die gesamte Legende um Storms Ableben eingefädelt hatte und aufrechterhielt. Er hatte seine eigenen Gründe dafür, die Welt in dem Glauben zu lassen, dass Storm tot war. Storm hatte jene vier Jahre mit Angeln in Montana, Schnorcheln auf den Kaimaninseln und Wandern in den Appalachen verbracht. Außerdem war er in verschiedene Verkleidungen geschlüpft, damit er seinen Vater auf einige Spiele seiner Lieblingsbaseballmannschaft, den Orioles, begleiten konnte. Im Großen und Ganzen hatte er eine tolle Zeit gehabt.
„Nun ja, du hattest deinen Spaß“, sagte Jones. „Dein Land braucht dich, Storm.“
„Und aus welchem Grund genau?“
„Weil gestern ein prominenter Schweizer Banker in Zürich ermordet wurde“, erklärte Jones. Die folgenden Informationen trafen Storm wie ein Hammerschlag: „Wir erwarten einige Fotos des Killers. In den Beschreibungen heißt es, dass er eine Augenklappe trägt. Und dem Banker fehlten sechs Fingernägel.“
Storm versteifte sich unwillkürlich. Bei diesem Killer – mit dieser markanten Vorgehensweise – konnte es sich nur um eine Person handeln: Gregor Wolkow war also zurück.
„Aber er ist doch tot“, grummelte Storm.
„Nun ja, das warst du auch.“
„Für wen arbeitet er diesmal?“
„Wir sind nicht hundertprozentig sicher“, entgegnete Jones. „Aber meine Leute haben auf der Straße einige Informationen aufgeschnappt, die auf die Beteiligung eines chinesischen Agenten hindeuten könnten.“
„Okay. Du kannst mit dem Briefing loslegen, wenn du so weit bist.“
„Nein, nicht telefonisch“, widersprach Jones. „Dafür musst du zurück ins Kämmerlein kommen.“
Kämmerlein nannte Jones die kleine Abteilung, die er vom National Clandestine Service abgekapselt hatte.
„Ich nehme den nächsten Flug“, sagte Storm.
„Großartig. Ich lasse dich am Flughafen von einem Wagen abholen. Sag mir einfach Bescheid, welchen Flug du nimmst.“
„Keine Chance“, erwiderte Storm. „Du weißt doch, dass ich so nicht arbeite.“
Storm konnte beinahe hören, wie sich Jones über seinen kurzgeschorenen Kopf strich. „Ich würde mir wünschen, dass du etwas durchschaubarer wärst, Storm.“
„Vergiss es“, antwortete Storm. Dann wiederholte er das Mantra, das er schon viele Male zuvor hatte verlauten lassen: „Durchschaubarkeit endet immer tödlich.“
VIER
NEW YORK, New York
Der Marlowe Tower, ein zweiundneunzig Stockwerke hohes Monument der ökonomischen Macht Amerikas, eine glitzernde gläserne Menagerie, die einige der gefährlichsten Raubtiere des nationalen Finanzmarkts beherbergte, ragte hoch über Lower Manhattan auf. Auf New Yorks stark umkämpftem Immobilienmarkt reichte allein die Erwähnung des Namens – Marlowe Tower –, um einen gewissen Status zu symbolisieren. Das ging sogar so weit, dass das Renommee angrenzender Gebäude dadurch aufgebessert wurde, dass sie als „Nahe Marlowe gelegen“ angepriesen wurden.
Der Marlowe Tower war ein Ort, an den sich reiche Kapitalisten begaben, um ihre ohnehin schon große Macht auf dem Weltmarkt weiter auszudehnen. Nachdem sie ihre teuren importierten Autos in nahegelegenen Parkhäusern untergebracht hatten, betraten sie das Gebäude auf Straßenniveau durch die Drehtür aus poliertem Messing. Sie trugen handgearbeitete Lederschuhe und maßgeschneiderte Anzüge, und jeder von ihnen war fest entschlossen, ein Vermögen zu machen, ob es nun das erste, das zweite oder noch ein weiteres war.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!