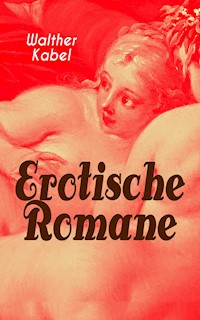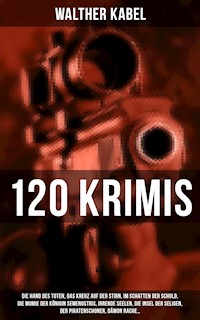1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Booksell-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
In "Detektiv Schaper-Krimis" entfaltet Walther Kabel sein meisterhaftes Können in der Konstruktion spannender Kriminalgeschichten. Die Erzählungen vereinen klassische Elemente des Detektivgenres mit einem unverwechselbaren, atmosphärischen Stil, der die Leser in die düstere Welt der Verbrechen und deren Aufklärung eintauchen lässt. Kabels beeindruckende Fähigkeit, Charaktere lebendig und vielschichtig zu gestalten, erlaubt es dem Leser, sich mit dem unkonventionellen Ermittler Schaper zu identifizieren, während dieser knifflige Fälle löst und gleichzeitig einen tiefen Einblick in menschliche Abgründe gewährt. Durch präzise Beschreibungen und eine dichte Handlung wird der Leser von der ersten bis zur letzten Seite gefesselt. Walther Kabel, ein bedeutender Vertreter der deutschen Kriminalliteratur, hat sich nicht nur als Autor fest etabliert, sondern auch durch seine zahlreichen literarischen Auszeichnungen Anerkennung gefunden. Sein Interesse an Psychologie und gesellschaftlichen Fragestellungen spiegelt sich in seinen Werken wider. Diese Kombination aus persönlicher Erfahrung und literarischer Leidenschaft hat Kabel inspiriert, einen Detektiv zu erschaffen, der nicht nur die Oberflächen der Verbrechen aufdeckt, sondern auch die komplexen Motivationen und Emotionen der Protagonisten erkundet. "Detektiv Schaper-Krimis" ist eine unverzichtbare Lektüre für alle Liebhaber von Kriminalromanen, die auf der Suche nach fesselnden Geschichten und tiefgründigen Charakterstudien sind. Kabels stilistische Raffinesse und seine Fähigkeit, Spannung aufzubauen, machen dieses Buch zu einem reizvollen Erlebnis für Leser, die sowohl Detektivgeschichte als auch psychologische Einsichten schätzen. Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der Ermittlungen – es lohnt sich!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Detektiv Schaper-Krimis
Inhaltsverzeichnis
Das stille Haus
1. Kapitel
Hildegard Börmer war sofort nach Beendigung der Literaturstunde, die von dem spindeldürren Fräulein Wallner mit einer die Aufmerksamkeit der jungen Damen nicht gerade fördernden Trockenheit und Einseitigkeit abgehalten wurde, in den großen Park hinabgeeilt, der sich ein Stück an der Elbe entlangzog, und in dem es so viele lauschige Winkelchen und Plätzchen gab. Diese waren sämtlich unter die Zöglinge des Töchterpensionats der Frau verwitweten Frau Major Agathe v. Queisner infolge gütlichen Übereinkommens verteilt worden, – Besitzrechte, die allgemein respektiert wurden, so daß jeder der knospenden Mädchenblüten Gelegenheit gegeben war, während des Sommers ganz nach Belieben sich mit ihren Träumereien in die Einsamkeit zurückzuziehen.
Das junge Mädchen, das nun schon ein ganzes Jahr in dem Pensionat lebte, ohne sich dort selbst nach Ablauf dieser langen Zeit heimischer als am ersten Tage zu fühlen, schritt jetzt, nachdem das weißgestrichene Haus hinter der bogenförmigen Allee alter Linden verschwunden war, langsam weiter und suchte seinen Lieblingsplatz auf, den von einer dichten Lebensbaumhecke umgrenzten Ausguck, von dem man einen entzückenden Fernblick über den breiten Strom bis weit hinunter auf das Häusermeer der sächsischen Residenz hatte, deren Kirchtürme in die bläulichschimmernden fernen Höhenzüge wie in ein Wolkenmeer hineinragten. Hier lehnte Hildegard Börmer sich an die erst kürzlich von dem Gärtner frisch gestrichene Holzbrüstung und schaute versonnen auf das wunderbare Landschaftsbild hinaus, das in den Ausschnitt der Lebensbaumhecke wie in einen dunkelgrünen Rahmen eingefaßt zu sein schien.
Lange stand sie so fast regungslos da. In ihren Augen lag jetzt ein Ausdruck stillen Sehnens, der dieses eigenartig anziehende Gesicht noch reizvoller machte. Als sie dann plötzlich hinter sich leichte Schritte vernahm, fuhr sie beinahe erschreckt aus ihren Gedanken auf und wandte sich mit einer Miene, die deutlich ihr Mißbehagen über die Störung ausdrückte, der Näherkommenden zu. Kaum hatte sie diese aber erkannt, als auch schon ein freundliches Lächeln über ihr meist in versonnene Melancholie getauchtes Antlitz flog.
Isa von Barnbiel war auf der obersten Stufe der nach dem Ausguck hinaufführenden Treppe zögernd stehen geblieben.
»Erlauben Sie, Frau Hadwig?« fragte sie halb im Scherze, wobei ihre spitzbübischen dunklen Augen die andere so bittend anblickten.
»Frau Hadwig«, – so hatte man nämlich Hildegard Börmer nach der schönen Heldin von Scheffels »Ekkehard« getauft – nickte der um drei Jahre jüngeren Pensionsgefährtin herzlich zu.
»Aber gewiß, Isa – kommen Sie nur. Ihnen gönn ich gern einen Rundblick von diesem Plätzchen, das ich jetzt ja doch bald aufgeben muß.«
Isabella von Barnbiel war mit ein paar schnellen Schritten neben Hildegard getreten und schaute jetzt zunächst in stummer Bewunderung auf das malerische Bild, das sich vor ihr ausbreitete. Frachtkähne, Dampfer und lange Schleppzüge belebten den von der Frühjahrssonne beschienenen, glitzernden Fluß, und weit hinten rollte soeben über die mächtige Brücke ein Eisenbahnzug, dessen Lokomotive eine lange, dunkle Rauchfahne hinter sich ließ.
Erst nach einer geraumen Weile wandte sie sich an Hildegard.
»So ist es also Wahrheit, Frau Hadwig, daß Sie uns demnächst verlassen wollen?« meinte sie, sich mit einem kühnen Schwung oben auf die Brüstung setzend. Und zögernd fügte sie hinzu: »Würden Sie mir einmal eine etwas indiskrete Frage gestatten, liebe Hildegard? Ich möchte mir so sehr gern über etwas Gewißheit verschaffen.«
»Frau Hadwig« errötete jäh. Und leise erwiderte sie dann: »Weil Sie es sind, Isa. – Fragen Sie …«
Die Baronesse Barnbiel strich sich verlegen die Falten ihres blauen Tuchrockes glatt.
»Man erzählt sich hier im Pensionat, Sie seien verlobt, Hildegard«, meinte sie mit einem forschenden Blick auf die vor ihr Stehende. »Ist das Tatsache?«
»Frau Hadwig« hatte den schönen Kopf mit der dunkelbraunen, lose frisierten Haarfülle gesenkt.
»Ja«, klang’s scheu zurück, »ich bin verlobt …«
Isa legte der jungen Braut jetzt behutsam den linken Arm um den Hals und zog sie sanft an sich. Ihre Stimme war voll herzlicher Anteilnahme, als sie dann sagte: »Meinen herzlichen Glückwunsch, Hildegard.« Und mit der ihr eigenen, oft etwas burschikosen Offenheit setzte sie schnell hinzu: »Ich begreife nur nicht, wie man dann stets so traurig, so melancholisch sein kann wie Sie. Wenn ich mich erst verlobt habe, dann … dann bin ich sicher ganz unausstehlich vor glücklichem Übermut.«
»Frau Hadwig« lächelte trübe. »Das glaube ich gern, Isa. Ihr Brautstand wird ja auch sicherlich anders werden als der meinige.«
Die Baronesse fühlte ihr mitleidiges Herzchen schneller schlagen. Und zärtlich streichelte sie der anderen das weiche, kastanienbraune Haar. »So lieben Sie den Mann nicht, dem Sie einst fürs ganze Leben angehören sollen?« meinte sie zögernd.
Da schlug Hildegard Börmer ihre wunderbar ausdrucksvollen Augen voll zu der Jüngeren auf. »Ich liebe ihn über alles«, entgegnete sie fast feierlich. »Und doch …«
Sie schwieg, und große Tränen stahlen sich hinter ihren Lidern hervor, rollten ihr langsam über die Wangen. Eilig wischte sie sie fort, den Kopf ängstlich zur Seite wendend.
Da hatte die kleine Baronesse die arme »Frau Hadwig« auch schon in ihre Arme genommen und küßte sie mit rührender Herzlichkeit auf den Mund, drückte sie an sich und bat immer wieder:
»Nicht weinen …, nicht weinen, liebste, beste Hildegard …«
Und jetzt, da sie sich endlich einmal nähergekommen waren, sprudelte Isa von Barnbiel auch in einem Atem alles das heraus, was sie schon lange auf dem Herzen hatte.
»Hildegard«, sagte sie innig, »laß uns Freundinnen sein, habe Vertrauen zu mir … Du ahnst ja nicht, wie lange ich schon um deine Freundschaft geworben habe. Die anderen hier, das sind ja alles eingebildete Zierpuppen, aus denen ich mir auch nicht einen Deut mache! Aber du – du hast mir gleich gefallen, als ich vor einem halben Jahr auf Wunsch meines guten Pa’s in dieses ›Institut für höhere Bildung‹ eintrat. Du warst so ganz, ganz anders als die übrigen, hieltest dich stets für dich allein und hattest so liebe, traurige Augen. Ja, Hilde, deine Augen haben’s mir angetan … Und auch deine Stimme. So oft hatte ich in Romanen von Frauen gelesen, deren Organ wie Musik sein sollte, weich, einschmeichelnd. Bei dir fand ich es – zum erstenmal in meinem Leben. Und dann … dich umgab so etwas Geheimnisvolles, das mich lockte. Dein ganzes Wesen, deine Art, wie du dich gabst, zogen mich an. Sieh, Hildegard, das ist keine unreife Mädchenschwärmerei, – glaube das nicht. Die Kinderschuhe habe ich mit meinen siebzehn und einhalb Jahren längst ausgetreten. Sympathie war’s, die ich zunächst für dich empfand. Bald wurde es mehr. Ich verehre dich. Aber immer wichst du mir aus … Nun endlich habe ich dich, Hilde, und ich lasse dich nicht mehr von mir, bis du mir versprichst, meine aufrichtige Freundschaft anzunehmen. – Sag’, bin ich dir denn ebenso gleichgültig wie die übrigen hier, oder …«
Hildegard Börmer ließ sie nicht ausreden. Mit einem wahren Jubelruf zog sie die kleine Baronesse an sich. Und mit einer Stimme, die Tränen des Glücks beinahe erstickten, fragte sie:
»So ist’s also Wirklichkeit geworden, was ich schon seit langem erhoffte! … Ja, Isa, auch ich fühlte mich zu dir hingezogen … Ich war hier ja so einsam, so verlassen … Aus Vorsicht hielt ich mich von den anderen zurück. Gerade ich wollte mich niemandem aufdrängen … Jetzt, – jetzt wird es mir sehr, sehr schwer werden, von hier fortzugehen. Und doch – welch beglückender Gedanke für mich, hier wenigstens einen Menschen gefunden zu haben, der gern an mich zurückdenken wird …«
Dann saßen die beiden jungen Mädchen Hand in Hand auf der schmalem Bank, die im Schatten der Lebensbaumhecke stand, und »Frau Hadwig« schüttete der eben gewonnenen Freundin ihr übervolles Herz aus.
»Die Geschichte meiner Verlobung, Isa, ist wie ein Roman«, begann sie mit ihrer weichen, lieben Stimme. »Ich bin das einzige Kind meiner Eltern, die seit mehr denn zwanzig Jahren in einem kleinen Dörfchen am Ostseestrande in der Nähe von Kolberg leben, wo mein Vater Volksschullehrer ist. Da meine Mutter seit meiner Geburt kränkelte und durch ihre Pflege die geringen Einkünfte meines Vaters völlig verbraucht wurden, besuchte ich nur die Dorfschule und mußte dann, als ich kaum konfirmiert war, mit im Haushalt Hand anlegen. Nebenbei habe ich mich ja noch aus Büchern fortzubilden versucht. Aber viel Zeit blieb dazu nicht übrig. So wurde ich neunzehn Jahre, ohne daß ich je weiter als nach Kolberg gelangt war, wo für mich die Welt aufhörte. Und dann kam das große Ereignis, kam der … Märchenprinz, der plötzlich Sonnenschein in mein freudloses Dasein brachte. – Hin und wieder hatten wir eines unserer Zimmer an Sommergäste vermietet. Das Mietsgeld, mochte es auch noch so gering sein, half manche Arzt- und Apothekerrechnung bezahlen. Eines Tages im Juni erschien bei uns im Dorfe ein Herr aus Berlin, der den Sommer über in stiller Zurückgezogenheit leben wollte. Er wohnte erst einige Tage im Gasthause, sah sich inzwischen nach einer passenden Privatunterkunft um, und seine Wahl fiel schließlich auf unser Zimmer, das er gleich bis zum Herbst mit Beschlag belegte. Mein Vater, der den elegant gekleideten Berliner zunächst mit einem gewissen Mißtrauen behandelte, lernte dessen offene, heitere Art bald schätzen, und in kurzer Zeit waren sie die besten Freunde. Edgar Bornemann, wie der Fremde sich nannte, war Ingenieur und besaß in dem Villenort Wannsee bei Berlin ein kleines Häuschen, das er allein mit einem Diener bewohnte. Mehr erfuhren wir über ihn nicht, und mehr weiß ich auch heute noch nicht, trotzdem ich seine Braut bin und wohl ein Anrecht darauf besitze, über seine Verhältnisse genau unterrichtet zu sein. Wir verlobten uns, kurz bevor er Ende September wieder nach der Reichshauptstadt zurückkehrte. Mein Glück wäre vollkommen gewesen, wenn ich nicht das Gefühl gehabt hätte, daß Edgar vor meinen Eltern und mir irgend etwas verbarg. So sprach er zum Beispiel über seine Familie und die Art seiner Beschäftigung nur das Notwendigste. Seine Eltern wären beide bereits gestorben. Er selbst befände sich in einer auskömmlichen Stellung und besäße auch ein bescheidenes Vermögen. Das war alles. Als er dann abgereist war, zog mein Vater über ihn bei einer Berliner Auskunftei, die mein Bräutigam gelegentlich erwähnt hatte, Erkundigungen ein, die recht günstig lauteten und alles bestätigten, was Edgar uns über seine Person mitgeteilt hatte. Jeden Monat kam mein Verlobter für einige Tage zu uns. Inzwischen hatte er meine Mutter auf seine Kosten nach Stettin in ein Sanatorium geschickt, aus dem sie im Frühjahr völlig geheilt zurückkehrte. Du wirst begreifen, Isa, wie dankbar meine Eltern ihm waren, daß durch seine Güte das Gespenst der Krankheit endlich aus unserem kleinen Heim für immer verbannt war. Als mein Vater ihm dies bei seinem nächsten Besuche mit herzlichen Worten sagte, als auch ich ihn überglücklich immer von neuem unseren guten Engel nannte, da trat er mit einer Bitte hervor, die zu äußern er bis dahin nicht recht gewagt hatte: Meine Eltern sollten gestatten, daß er mich, bevor wir heirateten, noch auf ein Jahr in ein Pensionat schicke, damit ich später imstande sei, seinem Haushalt würdig vorzustehen. – So kam ich hierher, ich, die Tochter des Dorfschullehrers, – hierher, wo ich auf Wunsch Frau v. Queisners sowohl den Stand meines Vaters als auch meine Verlobung verheimlichen mußte. Ich tat’s Edgar zuliebe, so sehr sich auch mein Stolz dagegen sträubte, Dinge geheim zu halten, die doch wahrlich jeder wissen durfte. Für mich war eben mein Verlobter maßgebend, der mir in seiner zartfühlenden Art und Weise klar gemacht hatte, warum es für mich besser wäre, wenn ich mich den Bedingungen Frau v. Queisners fügte. Nun wirst du begreifen, Isa, weshalb ich mich hütete, auch nur den Anschein zu erwecken, als wolle ich mich einer der Pensionsgefährtinnen aufdrängen. War ich doch hier die einzige Bürgerliche, noch dazu die Tochter eines einfachen Rentiers, zu dem Frau v. Queisner meinem Vater umgemodelt hatte, damit ihr Pensionat nicht – herabgewürdigt werde. – Schier endlos ist mir dies eine Jahr geworden. Und doch war ich meinem Verlobten auch wieder von Herzen dankbar, daß er mir die Möglichkeit gegeben hatte, die Lücken in meiner Erziehung auszufüllen. Gewiß – in der ersten Zeit hatte ich Edgar flehende Briefe geschrieben, er möge mich wieder fortholen von hier. Stets klangen seine Antworten dann in dem Satze aus: ›Halte Dich tapfer, mein Lieb, – der Lohn wird nicht ausbleiben. Du wirst es später einmal besser haben als all die anderen jungen Mädchen, mit denen Du jetzt unter einem Dache lebst. Deiner wartet eine glückliche, sorgenlose Zukunft …‹ – So blieb ich denn, obwohl ich mich in Sehnsucht nach meinen alten Eltern und nach dem Geliebten, die ich jetzt ein ganzes Jahr nicht gesehen habe, verzehrte. In der vergangenen Woche erhielt ich dann eine Nachricht, die mir wieder bewies, wie herzensgut Edgar ist. Mein Vater soll sich pensionieren lassen und fortan die Villa in Wannsee bewohnen, die meinem Bräutigam gehört. Und ich selbst soll ebenfalls dorthin kommen, sobald die Meinen nach Berlin übergesiedelt sind, was schon in ein paar Wochen geschehen kann. Dann habe ich ihn wieder bei mir, nach dem ich mich sehne, dem mein Herz entgegenschlägt, und dann muß er mir Antwort geben auf all die Fragen, die ich mir längst zurechtgelegt habe, damit endlich volle Klarheit zwischen uns herrscht. Denn, Isa, ein Geheimnis hat Edgar vor mir. Das ist nicht nur eine bloße Vermutung von mir, nein, dafür sprechen so manche Kleinigkeiten, die mir aufgestoßen sind. Worin dieses Geheimnis besteht, ahne ich nicht. Und diese Ungewißheit ist’s, die mich traurig stimmt, die mir die rechte Lebensfreude raubt und bisweilen meine Seele mit düsteren Schreckbildern erfüllt. Wir Kinder des Strandes neigen ja überhaupt so leicht zum Grübeln. Die See mit ihrem Rauschen stimmt unwillkürlich melancholisch. Und deshalb mag Frau Hadwig die bewußte Angelegenheit vielleicht auch tragischer nehmen, als nötig ist …«
Noch lange plauderten die beiden jungen Mädchen, sich zärtlich umschlungen haltend, von ihren kleinen Sorgen, bis die Mittagsglocke sie in das Haus zurückrief. Arm in Arm schritten sie durch den Park, Arm in Arm betraten sie den Speisesaal, wo erstaunte Blicke sie gar nicht genug mustern konnten.
2. Kapitel
Dr. phil. Bertold Matra schüttelte energisch den Kopf.
»Beste Frau Lange, es geht wirklich nicht. Sie können unmöglich verlangen, daß ich mir hier die Nerven ruiniere, nur weil Sie mich als Mieter nicht aufgeben möchten. Seitdem da über mir diese klavierwütige Familie eingezogen ist, habe ich noch keine vernünftige Zeile zusammengebracht. Begreifen Sie doch in aller Welt, daß ich kein Steinklopfer, sondern Schriftsteller bin und als solcher Ruhe ebenso notwendig brauche wie der eben vergleichsweise herangezogene ehrenwerte Steinklopfer z. B. seinen Hammer! Ich habe heute morgen gezählt: seit acht Uhr sind die ›Donauwellen‹ fünfmal, ›Puppchen, mein Augenstern‹ acht- und die ›Tangomelodie‹ genau achtzehnmal heruntergehämmert worden, – denn einen anderen Ausdruck verdient diese Art, auf einem Instrumente unter ständiger Pedalbenutzung herumzupauken, wirklich nicht! – Dabei wird man langsam verrückt. Und um diesem Schicksal zu entgehen, kündige ich Ihnen hiermit zum Ersten ausdrücklich und unwiderruflich!«
Die korpulente Frau Lange mit der etwas verfänglich glänzenden Wollbluse versuchte noch ein Letztes.
»Herr Doktor, ich werde nochmals zum Hauswirt gehen und mich beschweren«, meinte sie mit einem wütenden Blick zur Decke empor, von wo eben wieder die harten Klänge eines altersschwachen Klaviers herabtönten. »Er muß für Abhilfe sorgen. Ich arme Frau lebe doch nun mal vom Möbliert-Vermieten. Und die Bande da oben macht mich bankerott, – da hört sich wirklich alles auf! Vier Töchter, und jede übt zwei Stunden täglich, das – das – –«
»… macht acht zusammen«, vollendete Bertold Matra ungeduldig. »Und die acht genügen, um mich aus dem Hause zu jagen. – Nun räumen Sie bitte das Kaffeegeschirr ab und trösten Sie sich mit dem Gedanken, daß es noch genug Junggesellen gibt, die nicht Schriftsteller sind, und die das Gepauke da über uns weniger belästigen wird als gerade mich.«
»Sie lassen also wirklich nicht mit sich reden, Herr Doktor?« meinte Frau Lange nochmals weinerlichen Tones.
»Nein. Sie kennen mich ja auch in dieser Beziehung zu Genüge. Wenn ich einmal zu etwas entschlossen bin, bleibt es dabei.«
Seufzend schlurfte die Frau mit dem Tablett hinaus.
Dr. Matra aber setzte sich aufatmend an den schräg vor dem Erkerfenster stehenden Schreibtisch und begann seine Arbeit. – Über ihm nahm das Geklimper unentwegt seinen Fortgang. Fünf Minuten verstrichen. Grimmig warf er den Federhalter hin. – »Der Teufel halte bei den Gassenhauern die Gedanken beisammen!« knurrte er aufgebracht. »Ich bin gewiß ein friedliebender Mensch, der niemandem etwas Böses wünscht. Doch den vier Sekretärstöchtern gönne ich eine kleine Fingerlähmung von Herzen!«
An dem Fortspinnen dieser feindseligen Rachegelüste hinderte ihn eine laute Stimme, die draußen im Korridor Frau Lange »einen schönen guten Morgen« wünschte.
Gleich darauf wurde die Tür aufgerissen, und Edgar Bornemanns breite Gestalt schob sich ins Zimmer.
»Na, Bert – schon bei der Arbeit?« meinte er, dem Freunde die Hand schüttelnd.
Matra zuckte ärgerlich die Achseln und deutete stumm nach oben.
Bornemann lauschte einen Augenblick. »Der Marsch aus Carmen«, erklärte er dann, eine Grimasse schneidend. »Mensch – sei doch zufrieden! Jeder fünfte Ton ist mindestens richtig!«
Der Schriftsteller mußte nun doch lachen, ob er wollte oder nicht. Bornemann hatte eine geradezu zwingende Art, seine trockenen Bemerkungen vorzubringen. Jetzt warf er ein in einem Kreuzband steckendes Zeitungsblatt vor Matra auf die Schreibtischplatte.
»Da – das gab mir unten vorm Hause dein Briefträger. Schau dir’s nur an. Vielleicht lenkt es dich etwas von der holden Carmenmusik ab. Über deiner Adresse steht ja rot unterstrichen: ›Genau durchsehen! Äußerst wichtig!!‹ – Vielleicht hast du in der preußisch-süddeutschen Klassenlotterie einen Haupttreffer gemacht. Es ist jetzt ja gerade Ziehung.«
Matra hatte ziemlich gleichgültig das Kreuzband gelöst.
»Wie kommst du auf die Lotterie?« meinte er, die Zeitung auseinanderfaltend.
»Weil ich selbst gestern abend entdeckte, daß meine Nummer 131 326 mit zehntausend Mark gezogen ist«, erwiderte Bornemann, indem er sich in die Sofaecke setzte und eine Zigarre anzündete.
Der Schriftsteller schaute auf. »Unglaublich! Man sieht, das alte Sprichwort trifft nur zu gut zu: ›Ohne Wahl verteilt die Gaben, ohne Billigkeit das Glück!‹ – Ausgerechnet gewinnst du, der du ohnehin schon von dem schnöden Mammon übergenug besitzt!«
Edgar Bornemann seufzte. »Ich schäme mich ja auch beinahe über diesen Dusel! Und mein eigener Trost ist, daß die Unglücksnummer 131 326, die kein Mensch dem Kollekteur abnehmen wollte, den Treffer gemacht hat.«
Inzwischen hatte Matra das Zeitungsblatt, das lediglich Annoncen enthielt, flüchtig durchgesehen. Plötzlich stutzte er.
»Merkwürdig«, sagte er, sich tiefer über die Zeitung beugend. »Hier ist eine Anzeige mit Rotstift dick kenntlich gemacht. Und daneben steht am Rande: ›Etwas für Sie. – Ein Gönner.‹«
Auch Bornemann war jetzt aufmerksam geworden. »Wie lautet denn die Anzeige?« fragte er, sich langsam vom Sofa erhebend.
»Elegant möbliertes Zimmer in ruhigem Hause an stillen Mieter, am liebsten Schriftsteller oder Gelehrten, billig abzugeben. Bei Übernahme kleiner Verpflichtungen fast umsonst. Zu erfragen bei Thomas van Heidersen, Schöneberg, Philippstraße 16.«
Matra hatte es langsam, jedes Wort betonend, vorgelesen und reichte nun dem Freunde das Blatt hin.
Bornemann überflog die Anzeige nochmals und verglich dann die Schriftzüge der Adresse auf dem Kreuzband mit den am Rande der Zeitung stehenden fünf Worten.
»Der Absender hat seine Handschrift verstellt«, meinte er endlich. »Wer mag dir nur das Blatt zugeschickt haben? Hast du in dieser Hinsicht irgendeine Vermutung?«
Der Schriftsteller verneinte. »Ein Gönner? – Ich besitze von dieser wertvollen Sorte von Mitmenschen nur zwei: Herrn Rentier Edgar Bornemann und Herrn Baron von Barnbiel. Und von diesen hätte sich sicher keiner die überflüssige Mühe gemacht und sich in geheimnisvolles Dunkel gehüllt!«
Der junge Millionär lehnte jetzt dem Freunde gegenüber am Fenster. »Hm«, meinte er mit listigem Augenzwinkern, »du vergißt deine Gönnerin, Fräulein Isa von Barnbiel. Wäre es nicht möglich, daß die …«
»Laß, bitte, die Baronesse aus dem Spiel«, unterbrach Matra ihn ungeduldig. Und doch konnte er es nicht verhindern, daß ihm die helle Röte in sein frisches, energisches Gesicht flutete.
»Pardon!« Bornemann verneigte sich übertrieben höflich. »Es war ja auch nur ein Scherz von mir«, fügte er entschuldigend hinzu. »Fräulein von Barnbiel kommt ja auch deswegen schon nicht in Betracht, weil dies hier zweifellos eine Männerhandschrift ist, und weil sie sich ferner zurzeit in einer Dresdener Zwangserziehungsanstalt für adlige junge Damen befindet, während diese Sendung hier nach dem Poststempel in Berlin-Schöneberg aufgegeben worden ist.«
Eine Weile schwiegen die beiden. Jeder suchte nach einer Lösung des seltsamen Rätsels, das diese Mitteilung doch fraglos darstellte.
Schließlich erklärte Matra, indem er das Zeitungsblatt zu sich steckte: »Wir wollen uns nicht weiter die Köpfe zerbrechen, wer der Absender sein kann. Jedenfalls meint er es gut mit mir. Und da ich ohnehin dieses klavierverseuchte Haus am Ersten verlassen will, werde ich dem freundschaftlichen Wink Folge leisten und mir zunächst einmal dieses ruhige, billige, elegant möblierte Zimmer ansehen. Mich lockt zweierlei: die Ruhe und die Billigkeit. Denn meine Finanzen stehen augenblicklich herzlich schlecht, und meine Nerven brauchen Grabesstille nach diesen letzten vierzehn Tagen der Qual!«
Bornemann streute die Asche seiner Zigarre in das breite Maul des Messingfrosches, der, als Aschbecher dienend, auf dem Schreibtisch stand, und sagte dabei zögernd: »Bert – darf ich dir vielleicht mit etwas Mammon aushelfen? Ich weiß ja, daß …«
»… ja, du weißt, daß ich auf dem Standpunkt stehe, man soll seine Freunde, und wenn’s Millionäre und noch so liebe, gute Kerle sind, nie anpumpen«, ergänzte der Schriftsteller ernst. »Diesem Prinzip bleibe ich treu, – eben um mir deine Freundschaft zu erhalten, ohne Mißklang, ohne den störenden Gedanken, dir auf diese Weise verpflichtet zu sein. – Und nun, wenn’s dir recht ist, benutzen wir das schöne Aprilwetter – eigentlich in sich ein Widerspruch, diese letzten Worte! – und schauen wir uns Philippstraße 16 einmal aus der Nähe an.«
Von Matras Wohnung, die in dem Berliner Vorort Schmargendorf dicht an dem gleichnamigen Bahnhof der Ringbahn lag, bummelten die beiden gemächlich die noch unbebauten Straßenzüge entlang, die das Schöneberger Gelände von dem schnell aufblühenden Schmargendorf trennten.
Bert Matra, der den Ärger über die in seinem Hause ausgebrochene »Klavierpest« längst vergessen hatte, mußte die Kosten der Unterhaltung ganz allein tragen, da Bornemann mit einemmal ohne ersichtliche Ursache recht einsilbig geworden war.
Schließlich fiel dies dem Schriftsteller doch auf. Und mit der Offenheit, die zwischen ihnen in allen Dingen herrschte, fragte er jetzt ganz unvermittelt: »Sag mal, Alterchen – was hast Du nur? Du schleichst da jetzt mit einem Gesicht neben mir her, als ob du ein Gespenst gesehen hättest. Und vorhin warest du doch noch ganz munter und vergnügt.«
Bornemann hatte sich seinen kurzen, seidengefütterten Sportpaletot aufgeknöpft, als ob ihm plötzlich zu warm würde.
»Bert«, begann er dann ganz feierlich, »beichten ist doch eine verflixt schwere Sache …«
Matra blieb stehen und schaute ihn verwundert an.
»Beichten? Habe ich recht gehört?«
Bornemann nickte mit einer wahren Armesündermiene.
»Wollen aber hier nicht anwachsen, Bert«, meinte er. »Die Geschichte läßt sich auch im Gehen erledigen. – Sag’ mal, hast du nicht in letzter Zeit eine gewisse Veränderung an mir bemerkt?« begann er dann, nachdem sie ihren Weg fortgesetzt hatten.
Matra, der noch immer annahm, daß diese angebliche Beichte auf nichts anderes als irgendeinen faulen Witz hinauslaufen würde, erwiderte denn auch prompt:
»Allerdings, du trägst einen neuen Paletot, seit vorgestern eine neue Kragenform und …«
»Bitte, laß die Dummheiten!« unterbrach der andere ihn ungeduldig. »Ich habe etwas Ernstes mit dir durchzusprechen. Berücksichtige das gefälligst …«
Der Schriftsteller schob schnell seinen Arm in den des Freundes.
»Verzeih, Alterchen, das ahnte ich nicht. – So, und nun will ich dir vernünftige Antwort geben. Allerdings hast du dich verändert – sogar sehr. Soweit ich mich erinnere, wurde etwa vor anderthalb Jahren Edgar Bornemann definitiv aus der Liste der Lebemänner gestrichen und entpuppte sich plötzlich als Musterknabe von reinstem Wasser, worüber die Welt, in der man sich nicht langweilt, nicht genug die Köpfe und Köpfchen schütteln konnte. Doch – wozu sage ich dir das! Gehört hast du es von mir ja schon verschiedentlich, freilich stets mit dem Zusatz, daß ich mich über diese Verwandlung des Saulus in einen Paulus ehrlich freue, da ich selbst nichts öder und langweiliger finde als das Leben dieser reichen jungen Leute, die nachmittags aufstehen und abends, wenn andere nach des Tages Last und Mühen ihr Lager aufsuchen, ihre erste Mahlzeit einnehmen.«
Bornemann nickte zufrieden vor sich hin. »Gut, die Wirkung hast du also konstatieren können. Ist dir nun noch nie der Gedanke gekommen, daß diese Wirkung notwendig auch einen Ursache haben muß?« meinet er mit einem eigenartigen Lächeln.
Matra beugte sich vor und schaute dem Freunde prüfend in das wie von innerem Glück durchwärmte, strahlende Gesicht.
»Du … Mensch … Alterchen …, mir geht eine Ahnung auf! Wär’s möglich, – du bist ernstlich verliebt – nur das kann es sein.«
Bornemann antwortete nicht sofort. Er holte aus seiner Brieftasche eine Photographie hervor und reichte sie dem Schriftsteller.
»Hildegard Börmer«, sagte er leise und mit einer Innigkeit, die niemand dem »tollen Edgar« von einst zugetraut hätte.
Dann beichtet er, erzählt von seinem Sommeraufenthalt in dem Fischerdörfchen, von der immer stärker werdenden Neigung zu dem liebreizenden, harmlosen Kinde, von seiner Verlobung … Alles teilte er dem Freunde mit, alles …
Matra hatte schweigend, oft mit einer gewissen stillen Rührung kämpfend, zugehört. Jetzt blieb er stehen und nahm des anderen Hände in die seinen, umspannte sie mit festem Druck.
»Meinen Glückwunsch, Alterchen!«
Bornemanns Augen leuchteten.
»Ich sehe es deinem Gesicht an, Bert, daß du dich von Herzen mit mir freust! – Und Hildegard verdient es wirklich, daß ihretwillen zwei Männer hier auf offener Straße, umgeben von Häusern, die erst noch gebaut werden sollen, eine kleine Rührszene aufführen. Du wirst sie ja kennen lernen, sogar sehr, sehr bald, meine ›Frau Hadwig‹, wie man sie im Pensionat getauft hat, meine kleine Zauberin, die den ›tollen Edgar‹ so urplötzlich völlig behext hat, daß er, wie du dich vorhin ausdrücktest, ›von der Liste der Lebemänner‹ gestrichen wurde. – Doch, komm weiter, sonst gelangen wir erst bei Dunkelwerden nach der Philippstraße.«
Matra brauchte doch noch eine geraume Weile, bis er sich von dieser Überraschung erholt hatte.
»Also deine Braut hat bisher tatsächlich keine Ahnung, daß du mit auf der Millionärsliste im Berliner Steuerregister stehst?« meinte er dann mit leisem Zweifel.
»Weder sie noch meine Schwiegereltern«, entgegnete Bornemann bestimmt. »Ich habe alles so einzurichten gewußt, daß sie mich noch heute für einen simplen Ingenieur mit viertausend Mark Jahreseinnahme halten, der in Wannsee ein bescheidenes Häuschen sein eigen nennt. – Sieh, Bert, deshalb verehre ich ja dieses Mädchen so über alles, deshalb bin ich ja auch so übermenschlich glücklich, weil ich eben bestimmt weiß, daß Hildegard mich allein liebt, mich mit allen meinen Fehlern und Schwächen, und nicht meine Millionen … Hätte ich mir mein zukünftiges Weib anderswo gesucht, nie wäre ich den Verdacht losgeworden, daß meine güldenen Schätze für sie der Hauptmagnet gewesen sein könnten …«
»So unrecht hast du nicht«, meinte der Schriftsteller ernst. »Jedenfalls kannst du dich glücklich preisen, daß dir ein gütiges Geschick nunmehr alles beschert hat, was des Menschen Leben angenehm macht … – Nebenbei – wann trifft deine Braut hier ein?«
»Wahrscheinlich bereits übermorgen. Genau kann ich das heute noch nicht sagen, da die Dekorateure in dem ›bescheidenen Häuschen‹ in Wannsee gräßlich gefaulenzt haben und ich Hildegard erst in das fix und fertige Heim ihrer Eltern führen will. – Auf diese Überraschung freue ich mich ja wie ein Kind …!«
Da sie jetzt in belebtere Viertel einbogen, nahm die Unterhaltung eine allgemeinere Wendung an. Die Philippstraße fanden sie dann erst nach zweimaliger Nachfrage bei einem Schutzmann und nach einigen Umwegen glücklich auf.
»Weiß der Himmel«, meinte Bornemann, »still ist’s hier allerdings. Da haben wir ja auch schon Nummer 16. Ganz nett und sauber, wenn auch nicht gerade sehr vornehm, dieser zweistöckige Bau. Fahrstuhl, Warmwasserversorgung und Dampfheizung dürften in diesem Palais unbekannte Einrichtungen sein.«
Sie waren auf dem Bürgersteig stehen geblieben und musterten eingehend das hell gestrichene Haus, das abseits von den übrigen in einem kleinen Garten lag und durch ein grünes Eisengitter von der Straße getrennt war.
»Von außen gefällt mir die Geschichte großartig«, erklärte Matra eifrig. »Kein Gegenüber – sehr viel wert! Scheint ein Holzhof zu sein da drüben. Licht und Luft reichlich vorhanden, dazu lärmende Kinder offenbar spärlich vertreten! – Was meinst du, ob ich diesem Herrn van Heidersen – klingt holländisch, der Name – mal einen Besuch abstatte?«
»Selbstredend. Probieren geht über Studieren! Nur mußt du nicht verlangen, daß ich mitkomme. Ich kann mein Mundwerk nur schwer im Zaume halten, und vielleicht verderbe ich dir durch eine meiner berüchtigten Bemerkungen den ganzen Spaß. – Halt – du, da verläßt eben jemand das Haus. Und – wahrhaftig! – das ist kein anderer als Karlchen Belling, der berühmte Filmdramatiker. Vielleicht ist der dir schon zuvorgekommen.«
Belling hatte die beiden jetzt auch erkannt. Er winkte ihnen schon von weitem mit der Hand zu.
»Morgen allerseits!« begrüßte er sie vertraulich. »Matra, willst du dich etwa auch um das Zimmer bewerben?« Er betonte dabei das letzte Wort eigentümlich. »Wenn ja, so lenke deine Schritte nur wieder heimwärts. Denn dieser Herr van Heidersen ist ein schnurriger Kauz, dem niemand so leicht gefallen wird. Stellt der Anforderungen an einen Mieter – unglaublich!! Dabei ist die Bude selbst gar nicht so übel.«
»Erzähle Genaueres, Belling«, bat Matra etwas enttäuscht. »Allerdings gedachte ich mich dem Herrn vorzustellen. Aber wenn du –«
»Nein, mein Bester«, unterbrach ihn der Filmdichter lachend. »Den Genuß mußt du dir gönnen. Dieser Heidersen ist wirklich ein Original. Inzwischen will ich mit Bornemann hier draußen warten. Zögere nicht lange. Du wirst dein helles Wunder erleben.«
Der Schriftsteller war neugierig geworden. Kurz entschlossen schritt er auf das Haus zu. Der Weg durch den Vorgarten war sauber mit gelbem Kies bestreut, und die Blumenbeete rechts und links hatte man offenbar erst kürzlich frisch bepflanzt. Von der Eingangstür führte eine mit Linoleum belegte Treppe in das Hochparterre hinauf. Dort hing an der rechten Flurtür eine geschriebene Visitenkarte: Thomas van Heidersen.
Matra läutete. Es dauerte eine ganze Weile, bevor geöffnet wurde. Und der Schriftsteller hatte das deutliche Gefühl, daß er durch das Guckloch von drinnen prüfend gemustert wurde, während er wartend in dem hellen Treppenflur stand.
Dann tat sich plötzlich die Tür lautlos auf. Ein älterer Mann mit glattrasiertem, bleichem Gesicht, in dem die Backenknochen sich scharf abzeichneten, lud Matra durch eine Handbewegung zum Nähertreten ein, ging voraus und stieß eine Tür auf: »Bitte!«
Es war eine tiefe, volle Stimme, wie sie der Schriftsteller dem schwächlich aussehenden Männchen nicht zugetraut hatte.
Das Zimmer, in dem sie dann an dem Mitteltisch Platz nahmen, war ein großer, zweifenstriger Raum. Die Möbel so neu, daß Matra noch deutlich den Geruch scharfer Holzbeize verspürte. Die Einrichtung bewies im übrigen einen verfeinerten Geschmack und erinnerte in nichts an die übliche Zimmereinrichtung der sonstigen billigen Junggesellenbehausungen. Das Bett stand hinter einem geschickt drapierten türkischen Vorhang, der zugleich die in den Nebenraum führende Tür verdeckte. Die Bilder an den Wänden, zum Teil Stahlstiche, zum Teil Ölgemälde, verrieten in ihrer Auswahl gleichfalls den Kunstsinn dessen, der dieses Zimmer für einen neuen Mieter hergerichtet hatte.
Thomas van Heidersen hatte inzwischen Zeit gefunden, seinen Besucher eingehend zu mustern, während dieser sich seinerseits in dem behaglichen Raume umschaute. Jetzt begann der Alte, während er seine knochige Rechte mit dem Daumen zwischen die Westenknöpfe einhakte:
»Daß Sie die Anzeige im Lokal-Anzeiger hergeführt hat, erwähnten Sie schon. – Wie war doch Ihr Name?«
»Dr. phil. Bertold Matra, Schriftsteller.«
»Schön. – Nun denn, Herr Doktor, wie sagt Ihnen dieser Raum zu?«
»Recht gut«, entgegnete Matra der Wahrheit gemäß.
Heidersen nickte grinsend vor sich hin. Es sollte wohl mehr ein wohlgefälliges Lächeln sein, aber in diesem Totenkopfgesicht sah es wirklich nur wie ein abscheuliches Grinsen aus, das zwei Reihen graugelber, falscher Zähne bloßlegte.
»Bevor wir uns über den Preis unterhalten«, meinte er darauf, »möchte ich Ihnen meine Bedingungen mitteilen. – Würden Sie bereit sein, hier gleich so etwas den Hausverwalter zu spielen? Ich meine, die Mieten zu kassieren, die Steuern zu bezahlen usw., kurz mir alles abzunehmen, was zu den Pflichten eines Grundstückeigentümers gehört? Ich bemerke jedoch, daß diese Arbeit äußerst gering ist. Ich habe dieses Haus erst vor einem halben Jahre gekauft und es vollständig herrichten lassen. Es enthält vier Wohnungen zu je vier Zimmern. Drei davon sind zurzeit bewohnt – von mir, den Damen Geschwister Bernhard und dem Rechnungsrat Schwarz nebst Frau. Die vierte hier gegenüber im Hochparterre steht leer, wird aber bereits in einer Woche von einem einzelnstehenden älteren Herrn bezogen. Kinder gibt’s im Hause überhaupt nicht. Über mir wohnen die Damen Bernhard, von denen man kaum etwas sieht und hört. Ruhig ist’s also. – Wie denken Sie über die Sache, Herr Doktor?«
»Ich wäre nicht abgeneigt. Bei nur vier Mietsparteien, eigentlich nur drei, kann die Verwaltung nicht allzu beschwerlich sein. Freilich – ich habe bisher derartige Geschäfte noch nie besorgt und weiß daher nicht, ob ich auch alles zu Ihrer Zufriedenheit zu regeln vermag.«
»Oh, da seien Sie ganz außer Sorge. Ich gebe Ihnen vorkommenden Falles genaue Anweisungen«, erklärte Heidersen eifrig. »Also würden wir in diesem Punkte einig sein, nicht wahr?«
»Ja«, bestätigte Matra etwas zögernd, denn er ahnte, daß der Alte jetzt erst mit seinen speziellen Wünschen herausrücken würde, die Karl Belling veranlaßt hatten, ihn als »schnurrigen Kauz« zu bezeichnen.
Und wirklich, Thomas van Heidersen richtete jetzt seine großen Augen voll auf seinen Besucher und sagte langsam: »Ich habe noch so einige Eigenheiten, die zu berücksichtigen Sie sich verpflichten müßten. Ihr Zimmer hier würde von derselben Aufwärterin instand gehalten werden, die auch für mich sorgt. Morgenkaffee bekommen Sie, falls Sie es wollen, aus meiner Küche nebst Weißbrot und etwas Aufschnitt. Dies wäre in den Mietzins miteingeschlossen. Die Bilder in diesem Zimmer, die alte Andenken sind, dürfen nicht wo anders aufgehängt werden. Ich habe sie außerdem von dem Dekorateur ganz fest an die Wand anschlagen lassen. Für Ihren eigenen Wandschmuck, den Sie eventuell mitbringen, Herr Doktor, ist ja noch Platz genug vorhanden. Schließlich – unser geschäftlicher Verkehr hinsichtlich der Hausverwaltung muß sich, so lange ich dies für gut befinde, schriftlich in der Weise abwickeln, daß Sie Ihre Fragen usw. auf Zettel schreiben und diese in den Briefkasten werfen, der drüben an der Tür nach meinen Privaträumen angebracht ist. Die Antwort erhalten Sie in gleicher Weise. Zu diesem Zweck werden Sie an Ihrer Stubentür außen ebenfalls einen Briefkasten entdecken. Auf keinen Fall darf ich je in meiner Arbeit dadurch gestört werden, daß Sie persönlich bei mir Einlaß begehren. Ich verreise zudem sehr häufig und habe auch viel außer dem Hause zu tun. Sie würden mich also höchst selten antreffen. Handelt es sich um eilige Sachen, so erledigen Sie sie nach Ihrem Dafürhalten. Trotzdem wird sich ja noch so manches Abendstündlein erübrigen lassen, wo Sie mir, wenn Sie so liebenswürdig sein wollen, Gesellschaft leisten können. Ich bin viel in der Welt herumgekommen, und manche meiner Erlebnisse dürften für Sie als Schriftsteller recht anregend sein. – So, das wäre alles. Wie stellen Sie sich nun zu meinen Wünschen, Herr Doktor?«
Matra, der nachdenklich vor sich hingeschaut hatte, blickte auf. Seine Augen begegneten denen Heidersens, und da überkam ihn plötzlich etwas wie ein leises Unbehagen. Denn der Ausdruck dieser Augen war jetzt hinterlistig forschend – so ganz anders, wie bisher. Ein unbestimmtes Gefühl des Argwohns beschlich ihn. Merkwürdig genug waren ja auch des Alten Bedingungen, so, als ob dahinter irgendein Geheimnis steckte. Trotzdem – warum sollte er nicht darauf eingehen –?! Geschehen konnte ihm ja gar nichts! Die Hauptsache, das Zimmer gefiel ihm.
Und so sagte er denn kurz entschlossen: »Gut so, Herr van Heidersen, ich bin einverstanden. Und der Preis?« –
»Monatlich zehn Mark – alles in allem, mit elektrischem Licht, Bedienung, Morgenkaffee und Heizung«, meinte darauf der Alte gelassen.
Matra war aufs angenehmste überrascht. Das war spottbillig.
»Angenommen!« erklärte er höchst befriedigt. »Und wann kann ich einziehen?«
»Sofort. Sie würden mir damit auch einen Gefallen erweisen, Herr Doktor. Ich muß nämlich schon in den nächsten Tagen verreisen und mag das Haus nicht ohne Aufsicht lassen.«
Er hatte sich dabei erhoben und streckte nun Matra seine knochige Hand hin.
»Schlagen Sie also ein, Herr Doktor. Zwischen Ehrenmännern genügt das als Vertragsabschluß.«
Bert Matra zuckte erschreckt, fast angewidert zusammen, als Heidersens eiskalte, feuchte Finger sich um die seinen legten. Aber er überwand diese lächerliche Regung schnell. Was konnte jener dafür, daß ihm die Natur diese unangenehme Beigabe, diese feuchtkalten Hände, beschert hatte?! Und mit leisem Lächeln meinte er: »Auf gute Kameradschaft und Nachbarschaft denn, Herr van Heidersen!« –
Wenige Minuten später gesellte er sich wieder den beiden Freunden zu, die indessen in der Philippstraße wartend auf und ab gegangen waren.
»Nun?« fragte der Filmdichter gespannt. »Was sagst du zu Herrn van Heidersen?!«
»Etwas seltsam ist der Mann, das stimmt«, entgegnete Matra, die Achseln zuckend. »Mir aber gleichgültig. Für zehn Mark ist das Zimmer ein Paradies, und das gab bei mir den Ausschlag.«
»So seid ihr also wirklich einig geworden?« Man merkte, daß Belling ganz starr vor Staunen war.
»Allerdings. – Weshalb hast du denn eigentlich nicht zugegriffen, Karlchen?«
Belling zögerte, offenbar etwas verlegen, mit der Antwort.
»Nun – weil ich diesem alten Totenkopf nicht gefiel«, sagte er dann ehrlich. »Erst teilte er mir all seine merkwürdigen Bedingungen mit, fügte aber sofort in einem Atem hinzu, ich wäre ihm als Anwärter für die Stellung nicht willkommen. Da lachte ich ihn aus – so etwas Enttäuschung und Ärger war wohl auch dabei – und ging. Ich dachte nun, er würde es mit dir ebenso machen, Bert.«
Matra war nachdenklich geworden.
»Komisch ist die Geschichte, hol’s der Henker!« meinte er. »Vielleicht hätte ich doch klüger getan, abzulehnen.«
Jetzt mischte sich auch Bornemann ins Gespräch.
»Kinder, nun erklärt mir doch nur endlich, was der Mann denn für Bedingungen stellt! Ich vergehe ja vor Neugierde.«
Matra berichtete darauf den Inhalt seiner Unterredung mit Heidersen in allen Einzelheiten.
Der Millionär äußerte sich jedoch nicht weiter dazu, sondern gratulierte dem Freunde nur herzlich zu der neuen Behausung.
»Kommt, – ich lade euch zu einer Flasche Rotspon ein«, fügte er hinzu. »Die Sache muß begossen werden.«
3. Kapitel
Als Edgar Bornemann mittags gegen ein Uhr seine Wohnung betrat – sie bestand aus der ersten Etage eines vornehmen, in der Tiergartenstraße gelegenen Hauses, das er von seinem Vater, einem durch Grundstücksspekulationen zu Reichtum gelangten Bauunternehmer, geerbt hatte, meldete ihm der Diener, daß ein Herr im Salon auf ihn warte, und reichte ihm gleichzeitig die Karte des Besuchers.
»Fritz Schaper, Schauspieler«, stand darauf.
Bornemann warf dem Diener plötzlich sehr eilig Hut und Paletot zu und betrat schnellen Schrittes den Salon, wo auf einem der Seidensessel ein jüngerer, nicht gerade übermäßig elegant gekleideter Herr saß.
»Fritz Schaper – bist du’s wahrhaftig?«
Der Millionär schüttelte dem alten Schulfreunde, den er seit Jahren nicht mehr gesehen hatte, warm die Hand.
»So, nun mache es dir aber zunächst einmal bequem«, meinte er nach der ersten Begrüßung in seiner herzlichen Art zu dem leicht verlegenen Schauspieler, dessen Gesicht trotz der jugendlichen Züge manche Leidensfalte aufwies. »Bitte, herunter mit dem Mantel; so, und gib auch deinen Hut her.«
Er klingelte nach dem Diener und gab diesem die Sachen. »Du bleibst doch zu Tisch hier, Fritz? – Keine Ausrede. – Und nun komm mit in mein Arbeitszimmer hinüber, dort ist’s behaglicher.«
Dann saßen sie sich in zwei bequemen Klubsesseln gegenüber.
»Wie ist’s dir denn in der Zwischenzeit gegangen, Fritz?« begann Bornemann ungezwungen die Unterhaltung und füllte dabei die grünen Römer, die auf dem kleinen Tischchen vor ihnen standen, mit einem köstlich duftenden Breisgauer. »Zunächst aber: prosit, Fritz, – unsere Jugenderinnerungen sollen leben!«
Der Schauspieler blieb trotz des liebenswürdigen Entgegenkommens seltsam bedrückt. Sein intelligentes, glattrasiertes Gesicht bedeckte sich mit einer verlegenen Röte, als er jetzt ehrlich herausplatzte: »Ich will dir gleich die Wahrheit sagen, Edgar: ich komme als Bittsteller zu dir.«
»Ändert das etwas daran, daß wir alte Freunde sind?!« meinte Bornemann ernst. »Sprich dir dein Herz frei. Ich sehe es dir an, Fritz, daß dir das Schicksal offenbar übel mitgespielt hat.«
Schaper nickte traurig.
»Du weißt, daß ich erst eine Weile Apothekerlehrling war«, fing er zögernd an. »Mir behagte der Beruf aber nicht. So wurde ich gegen den Willen meines Onkels, der mich nach dem Tode meiner Eltern zu sich genommen hatte, Schauspieler. Mich lockte einmal das ungebundene Künstlerleben, dann aber glaubte ich auch – das tun ja alle angehenden Mimen – ganz besonderes Talent für die Bühne zu besitzen. Sieben Jahre habe ich mich nun in kleinen und kleinsten Theatern herumgedrückt, habe bisweilen, durch die Not getrieben, auch andere Arbeiten auf mich genommen, – Schneeschaufeln, Adressenschreiben und ähnliches. Zuletzt war ich in Rathenow in Brandenburg an einer Sommerbühne verpflichtet. Aber die Schmiere, anders kann ich dieses Kunstinstitut nicht bezeichnen, verkrachte schon nach vierzehn Tagen. Seit einer Woche bin ich nun brotlos. Meine Bemühungen, anderswo unterzukommen, scheiterten. Da dachte ich an dich …«
Schaper schwieg und trank hastig sein Glas leer.
»Ja, an dich, nachdem ich gestern hier in Berlin in der großen Abfütterungsanstalt bei Aschinger meine letzte Mark für einen warmen Bissen ausgegeben hatte.«
»Aber Fritz – ich begreife dich nicht. Warum kamst du denn nicht früher zu mir?« unterbrach ihn Bornemann vorwurfsvoll. »Fürchtest du etwa, daß ich dich abweisen würde?! Kennst du mich wirklich so wenig?!«
Der Schauspieler schüttelt ernst den Kopf.
»Das wohl nicht. Aber der Plan, den ich dir unterbreiten will, ist erst heute morgen in meinem Kopf entstanden, als ich mich nach einer schlaflos verbrachten Nacht von dem harten Lager erhob, das ich in der Volksherberge in der Müllerstraße vorsichtigerweise gleich für acht Tage vorausbezahlt hatte. – Um mit der Hauptsache sofort herauszurücken: ich möchte dich um ein Darlehen zur Begründung eines Detektivinstitutes bitten. – Dein erstauntes Gesicht sagt mir, daß dir diese Idee etwas stark phantastisch vorkommt. Trotzdem hat sie einen ganz vernünftigen Hintergrund. Vor einem Jahr, als ich wieder einmal ohne Stellung war, habe ich in Frankfurt am Main vier Monate lang in Diensten eines solchen Instituts gestanden und dabei nicht nur den Geschäftsbetrieb ordentlich kennen gelernt, sondern persönlich auch Erfolge erzielt, die, wie der damalige Inhaber, ein Kriminalkommissar a. D., wiederholt betonte, weit über dem Durchschnitt standen. Deshalb beabsichtige ich jetzt, mir eine neue Existenz als Detektiv zu gründen. Alles ist so weit vorbereitet, – nur das Geld fehlt mir. In der Dresdener Straße gibt es eine billige Parterrewohnung, die sich für meine Zwecke eigenen würde, einen Bureauvorsteher habe ich in der Person eines Kollegen Lemke, dem es ebenso miserabel wie mir geht, auch schon gewonnen, die Zeitungsanzeigen sind im Entwurf fertig, durch die Berlin von der Gründung einer neuen ›Detektei‹ Kunde erhalten soll, – mit einem Wort: Ich könnte morgen Eröffnung feiern, wenn … Und wegen der Beseitigung dieses ›Wenn‹ kam ich zu dir. Nun weißt du alles.«
Eine Viertelstunde später hatte Fritz Schaper ein Päckchen Banknoten in seiner Brieftasche, die, solchen Inhalts ungewohnt, sich vor Stolz ganz gehörig aufblies.
Nachdem die alten Schulfreunde dann noch zusammen ein Mittagsmahl in Bornemanns fürstlich eingerichtetem Speisesaal zu sich genommen hatten, wie der neugebackene Detektiv es seit Jahren nicht einmal von weitem gesehen, trennten sie sich, da Schaper auch nicht eine Stunde länger mit der Verwirklichung seiner Pläne zögern wollte.
Bert Matra ließ noch an demselben Tage seine Habseligkeiten nach seinem neuen Heim herüberschaffen. Am nächsten Morgen stellte er sich auch den übrigen Hausbewohnern in seiner Eigenschaft als Verwalter vor. So erfuhr er denn, daß sowohl der Rechnungsrat Schwarz als auch die Damen Bernhard erst vor einem Vierteljahr eingezogen waren, und daß das Gebäude bis dahin seit längerer Zeit leer gestanden habe.
Am Nachmittag erhielt er dann einen Rohrpostbrief von Bornemann, in dem dieser ihn bat, abends bestimmt zu ihm zu kommen. Als er zu der verabredeten Zeit des jungen Millionärs Arbeitszimmer betrat, fand er diesen eifrig damit beschäftigt, eine Anzahl von mit einzelnen Buchstaben bedeckten Zetteln zu ordnen.
»Was tust du denn da, du Allerweltsgenie?« fragte der Schriftsteller, nachdem sie sich herzlich wie immer begrüßt hatten.
Bornemanns volles, rundes Gesicht verzog sich zu einem vielsagenden Lächeln.
»Bitte, setz dich, Bert. – Zigarre gefällig? – So, und nun höre und staune, was ich festgestellt habe: Kein anderer als Heidersen hatte dir damals die Annonce zugeschickt!«
Matra starrte den Freund ungläubig an. Er begriff nicht sofort, wie außerordentlich wichtig diese Mitteilung war, und welche Folgerungen sich leicht daran knüpfen ließen.
»Woher willst du das wissen?« meinte er unsicher. »Und – welches Interesse sollte Heidersen haben, gerade mich –«
»Bitte, zerbrich dir nicht unnötig den Kopf«, fiel Bornemann ihm ins Wort. »Hinter dieser Geschichte steckt meines Erachtens irgendein Geheimnis. Davon war ich gleich fest überzeugt, als du mir erzähltest, welch eigenartige Wünsche der Alte hinsichtlich seines geschäftlichen Verkehrs und wegen der Bilder in deinem Zimmer geäußert hatte. Absichtlich sagte ich dir jedoch nichts von dieser meiner Vermutung. Ich wollte mir erst Gewißheit verschaffen.«
Er machte eine kurze Pause. »Sag’ mal, Bert«, fuhr er dann fort, »ist es dir gar nicht aufgefallen, daß Heidersen dich als Mieter annahm, während er Belling, gegen den doch auch nichts einzuwenden ist, ohne jede Angabe von Gründen ablehnte?«
»Allerdings, seltsam kam mir das vor«, meinte Matra. »Aber ich habe nicht weiter darüber nachgedacht.«
»Ich aber!« versicherte der Millionär eifrig. »Und schon damals tauchte der Verdacht in mir auf, daß es Heidersen gerade um deine Person als Mieter für sein Zimmer zu tun war. Er wollte dich in seiner Nähe haben – deshalb der billige Preis, deshalb die Anzeige, die er dir zuschickte, um dich zu veranlassen, zu ihm zu kommen.« In Bornemanns Worten lag es wie ein versteckter Triumph über diese seine Entdeckungen.
»Alles doch nur Vermutungen, Alterchen«, meinte der Schriftsteller daraufhin achselzuckend. »Ich wiederhole, was ich schon vorhin sagte: Welches Interesse kann Heidersen an mir nehmen?«
»Auch das werden wir herauskriegen, Bert – verlaß dich darauf. Jedenfalls ist die Adresse auf dem Kreuzband und die Notiz am Rande des Anzeigenblattes von derselben Hand geschrieben, die auch die Visitenkarte an deines Wirtes Flurtür anfertigte – eben von der Heidersens. Bitte, betrachte dir diese Blätter hier. Es sind genaue Zeichnungen einzelner Buchstaben nach photographischen Vergrößerungen. Siehst du, wie auffallend sich diese beiden großen H ähneln, trotzdem der Schreiber sich alle Mühe gab, das H bei ›Herrn‹ auf der Adresse des Kreuzbandes anders zu formen! Aber die merkwürdige Art, die Schleifen dieses Buchstabens auszurunden, vermochte der Schreiber doch nicht ganz loszuwerden. Die Gewohnheit war eben stärker als sein Wille. Derartige Ähnlichkeiten zwischen der verstellten und der wirklichen Handschrift habe ich im ganzen acht gefunden. Das genügt mir. Für mich unterliegt es keinem Zweifel, daß Heidersen dieser geheimnisvolle ›Gönner‹ war, der dich auf die Anzeige, die er nur deinetwegen eingerückt hatte, aufmerksam machte.«
Matra war nun auch von der Richtigkeit dieser Feststellungen seines Freundes überzeugt.
»Also deshalb ließest du dir die Zeitung und das Kreuzband noch an demselben Tage von mir geben, an dem ich bei Heidersen gemietet hatte«, meinte er nachdenklich. Offenbar suchte er nach einer Erklärung, weshalb der alte Sonderling ihn auf diese Weise in sein Haus gelockt hatte.
»Ja, und aus demselben Grunde habe ich auch vorgestern, als du umzogst, mit meinem Westentaschenkodak, der so haarscharfe Bilder liefert, von der Visitenkarte einige Aufnahmen gemacht und von diesen wieder Vergrößerungen hergestellt, was für mich bei meinem reichen Material an photographischen Apparaten aller Art ein leichtes ist«, fuhr Bornemann fort. »Es handelt sich also nicht mehr um bloße Vermutungen, wie du vorhin annahmst, sondern um eine einwandfrei erwiesene Tatsache von weittragender Bedeutung, – nämlich darum, daß Thomas van Heidersen ein großes Interesse daran gehabt hat, daß du – und zwar gerade du! – zu ihm ziehst!«
»Die Sache ist mir vollkommen unerklärlich«, meinte der Schriftsteller kopfschüttelnd und starrte den Freund ganz ratlos an. »Was hältst du davon, Edgar? Ich werde daraus nicht klug.«
»Glaube ich gern. – Aber es kommt noch besser. Ich habe nämlich noch mehr entdeckt, Bert. – Du weißt, daß ich dir vorgestern beim Einrichten deiner neuen Behausung half, und während du deine Bücher auspacktest, die Bilder und Photographien annagelte. Wie ich nun oben auf der Trittleiter stand und deine vortreffliche Kopie des Rembrandtschen Gemäldes ›Nachtwache‹ neben dem riesigen alten Ölbild, das mit nicht weniger als acht Eisenhaken an die Mauer befestigt ist, aufhing, bemerkte ich etwas, das mir sofort höchst verdächtig vorkam. Das alte Ölbild des in die Tracht des 16. Jahrhunderts gekleideten Mannes hat nämlich nicht gemalte, sondern – Glasaugen, die tadellos eingesetzt sind und bei flüchtigem Hinsehen von unten aus niemandem auffallen würden. Anders bei mir, der ich mich auf der Leiter in gleicher Höhe mit dem Kopfe des Porträts, das sicher einen reichen Kaufherrn darstellt, befand. – Ahnst du, was diese sicherlich leicht zu entfernenden Glasaugen für ein Zweck haben, Bert?«
Matra nickte zerstreut. »Natürlich –! Das Bild hängt ja an der Wand nach dem Nebenzimmer hin, das zu Heidersens Wohnung gehört. Du glaubst, daß es in der Mauer eine Öffnung gibt, und der Alte mein Tun und Treiben durch die Augenlöcher beobachten will?«
»Genau dasselbe nehme ich an – genau dasselbe«, erklärte Bornemann eifrig, um dann hinzuzufügen: »Wenn wir nun noch in Betracht ziehen, daß Heidersen dir ausdrücklich verboten hat, die ihm gehörigen Bilder des Zimmers anzurühren, so gewinnt diese unsere Vermutung über den Zweck der Glasaugen bedeutend an Wahrscheinlichkeit. Eines der Bilder verdeckt eben eine geheime Vorrichtung, die dir auf jeden Fall verborgen bleiben soll. Merkwürdigerweise sind nämlich all die anderen Stahlstiche usw. nur des Scheines wegen mit drei oder vier Haken an der Wand befestigt, wie ich mich vorsichtig überzeugt habe. Nur das große Porträt mit dem breiten Goldrahmen hat die acht Eisenhaken als Stützpunkte erhalten, trotzdem schon drei von diesen klobigen Dingern genügt hätten, um das Gemälde für alle Ewigkeit zu tragen.«
Matras Zigarre war längst ausgegangen. Er war so vollständig von seinen Gedanken in Anspruch genommen, daß er für nichts anderes mehr Sinn hatte. Unaufhörlich irrte sein Denken im Kreise: Heidersen der Absender des Zeitungsblattes, Heidersen der, der ihn durch diese raffinierte Maßregel gewonnen, der das Zimmer ganz neu eingerichtet, der das Gemälde für seine Absichten besonders präpariert hatte – und wozu das alles, wozu?!
»Du hast also ebenfalls noch nicht die geringste Ahnung, wozu ich diesem Menschen dienen soll, Edgar?« fragte der Schriftsteller jetzt mißmutig.
»Nein. Aber das wird die Zukunft schon zeigen. Ist heute noch etwas geschehen, was mit Heidersen irgendwie zusammenhängt?«
Matra dachte nach. »Ja. – Ich habe heute die erste schriftliche Benachrichtigung von ihm in meinem Briefkasten gefunden, und zwar kurz bevor ich zu dir kam.«
Bornemann richtete sich interessiert in seinem Schreibsessel auf.
»Hast du den Brief mitgebracht?«
»Leider nein. Ich wußte ja nicht, daß er für uns so wichtig sein würde. Der Alte teilte mir mit, – auf einem offenen nur zusammengefalteten Zettel –, daß er morgen früh verreisen will, und daß der neue Mieter, ein gewisser Ewald Pickler, bereits diesen Sonnabend einzieht – also übermorgen.«
»So. – Und das wäre alles?« forschte Bornemann nochmals.
»Eigentlich ja. Aber vielleicht legst du Gewicht darauf, zu erfahren, daß Heidersens Aufwärterin, die ja auch meine Zimmer reinigt, taubstumm ist«, erwiderte Matra nach kurzem Besinnen.
»Taubstumm? So, so! Nun, das dürfte kein bloßer Zufall sein – wenigstens meines Erachtens. Ein dienstbarer Geist, der nicht horchen kann und sich zudem nur schwer mit anderen zu verständigen vermag, ist ein sehr bequemer Hausgenosse – meinst du nicht auch, Bert?«
»Für Heidersen vielleicht – für mich weniger. Ich muß der Frau nämlich alle meine Wünsche aufschreiben. Lesen kann sie zum Glück.«
Bornemann lachte belustigt.
»Ein recht gemütliches Heim, weiß der Himmel! Man verkehrt schriftlich miteinander, beobachtet sich durch die herausgeschnittenen Augen eines Porträtgemäldes, hat so ein kleines Dutzend anderer Heimlichkeiten voreinander, – alles für zehn Mark monatlich! – Mehr kann der Mensch nicht verlangen! – Doch, Scherz beiseite, wenn man alle diese Seltsamkeiten, die mit deiner neuen Wohnung zusammenhängen, einzeln betrachtet, so schauen sie nicht gerade bedenklich aus, zusammengekommen dagegen sehr, womit ich nur sagen will, daß eine gewisse Vorsicht immerhin am Platze ist. Deshalb kann es nichts schaden, Bert, wenn du jederzeit die Augen hübsch offen hältst. Irgendein Geheimnis liegt hier vor, darüber sind wir wohl einig. Und um nun dieser Sache auf den Grund zu gehen, habe ich einen Bekannten von mir, der sich seit heute hier in Berlin als Privatdetektiv niedergelassen hat, beauftragt, den alten Heidersen scharf zu beobachten.«
»Einen Bekannten?« fragte Matra verwundert. »Wer ist dieser Herr? Kenne ich ihn?«
»Soweit ich weiß, nicht. Er heißt Fritz Schaper und war früher Schauspieler. Gestern suchte er mich auf und bat, ich möchte ihn doch so etwas begünstigen. Da kam es mir also recht gelegen, daß ich ihn nun gleich ein wenig in Nahrung setzen könnte.«
Davon, daß er dem alten Schulfreunde mit Geld ausgeholfen und ihm so erst die Gründung einer neuen Existenz ermöglicht hatte, erwähnte der in solchen Dingen überaus vornehm denkende Millionär kein Wort.
In demselben Moment hörte man an der Tür das ungestüme Kratzen und leise Winseln eines Hundes.
Eilfertig sprang der sonst etwas bequeme Bornemann auf. »Hallo, da ist ja auch Hektor von seinem Spaziergang zurück. Ich hatte ihn mit dem Chauffeur ein paar Stunden ausgeschickt.
Kaum war die Tür geöffnet, als auch schon ein schlanker, schön gezeichneter Wolfshund ins Zimmer stürmte und seinen Herrn vor Freude bellend umsprang.
»Ruhig, Hektor – kusch dich! – So, und nun geh, begrüße den Onkel Matra.«
Gehorsam legte das kluge Tier seinen feinen, edlen Kopf mit den großen, verständigen Augen dem Schriftsteller in den Schoß. Und Matra, der dem Hund sehr zugetan war, begann ihm sofort das weiche Fell zu kraulen. –
Gegen halb zehn verabschiedete sich Matra dann.
Bornemann, welcher seinen Freund noch bis zur Flurtür begleitete, flüsterte ihm noch im letzten Moment zu:
»Heute nachmittag sind meine Schwiegereltern eingetroffen. Und morgen – ja morgen schon kommt sie, meine ›Frau Hadwig‹ …!«
»Wirklich? – Wann denn? – Darf ich mich nicht wenigstens zu der Begrüßung auf dem Bahnhof einfinden?« bat der Schriftsteller, dem andern warm die Hand drückend.
Bornemann schüttelte lachend den Kopf.
»Nein, Bert, die Feier morgen geht im allerengsten Familienkreise vor sich. Aber übermorgen, da bist du herzlich nach Wannsee eingeladen. – Gute Nacht, auf Wiedersehen!«
Matra versuchte dann daheim noch etwas zu arbeiten. Aber es fehlte ihm die nötige Stimmung, um das begonnene Romankapitel zu vollenden. Eine nervöse Unruhe ließ ihn immer wieder aufstehen und das Zimmer mit schnellen Schritten durchqueren. Öfters schaute er dann unwillkürlich zu dem großen Porträtgemälde mit den matt glänzenden Augen empor.
Wie eine geheimnisvolle Macht ging es von diesen Augen aus. Matra, gewiß nicht abergläubisch, drehte schließlich das Licht der dreiarmigen Krone an, da die Schreibtischlampe in den Ecken des Zimmers nur ein ungewisses Halbdunkel verbreitete, das den Schriftsteller heute störte. Er mußte wirklich alle Energie anwenden, um sich wieder an seine Arbeit zu setzen. Doch bereits nach der ersten halben Seite machte sich der Einfluß des Bildes, das in seinem Rücken an der Wand hing, wieder fühlbar. Es ging nicht – die Glasaugen waren stärker als er.
Unmutig legte der die Feder hin, erhob sich und nahm in einem der Sessel am Mitteltisch Platz, um die Abendzeitung durchzusehen. Bald merkte er aber auch jetzt, daß seine Blicke über die Zeilen dahinglitten und er nichts von dem Gelesenen begriff. Seine Gedanken waren bei dem Gemälde, hinter dem jetzt vielleicht der magere Totenkopf Heidersen lauerte und neugierig auf ihn herabstierte. Und diese Vorstellung ließ sich durch keinerlei Mittel hinwegscheuchen.
Endlich gab Matra den Kampf auf und suchte im Schlafe Vergessen zu finden. – Auch das half nicht viel. Stundenlang lag er noch wach und horchte mit angespannten Sinnen auf jedes Geräusch im Hause.
4. Kapitel
Edgar Bornemann ging wartend auf dem Bahnsteig drei des Anhalter Bahnhofs auf und ab. Die Ungeduld hatte ihn einen volle halbe Stunde zu früh von Hause fortgetrieben. Und jetzt schlichen die Minuten förmlich. Alles mögliche hatte er schon versucht, um die Zeit sich zu verkürzen. Und doch fühlte er, wie ihm das Herz vor Nervosität in immer schnelleren Schlägen klopfte.
Der elegant gekleidete Herr, der mit einem in Seidenpapier eingehüllten Strauß unruhig auf und abschritt, zog manchen neugierigen Blick auf sich. Jetzt passierten zwei Offiziere in Uniform die Sperre und kamen langsam näher.
Bornemann machte plötzlich kehrt und verschwand hinter dem kleinen, mitten auf dem Perron stehenden Diensthäuschen.
»Die fehlen mir gerade noch!« brummte er ärgerlich. »Hoffentlich haben sie mich nicht bemerkt …!«
Er hatte Glück. Ratternd fauchend lief jetzt der D-Zug in die mächtige, von Ruß geschwärzte Halle ein.
Wenige Minuten noch, und er hielt Hildegard Börmer wortlos in den Armen. Was kümmerten ihn die Menschen, die das junge Paar lächelnd musterten, was kümmerten ihn die beiden Oberleutnants, die ihn längst erkannt hatten und nun voller Interesse die junge Dame beäugten, der jetzt der Diener des Millionärs die Handtasche abnahm, um dann in angemessener Entfernung seinem Herrn zu folgen. Arm in Arm schritten sie dem Ausgang zu, beide wie im Traum. Hildegards Augen schimmerten feucht … Und um die aufsteigenden Tränen tiefsten Glücks zu verbergen, tauchte sie jetzt ihr von innerster Seligkeit verklärtes Gesichtchen tief in die duftenden, dunkelroten Rosen.
Unten auf der Straße vor dem Hauptportal hielt ein elegantes, blitzendes Privatauto. Der Diener hatte schon die Türe geöffnet, stand nun kerzengerade daneben.
»Steig ein, Liebling«, flüsterte Bornemann.
Sie zögerte etwas. Ein Blick in das Innere hatte ihr hellseidene Polster, einen raffinierten Luxus der Ausstattung enthüllt.
Und dann rollte das Auto davon, wand sich durch das Straßengewühl der Riesenstadt mit der Geschicklichkeit eines lebenden Wesens. Eng aneinander geschmiegt saßen die beiden da, ganz, ganz dicht. Er hatte Ihre Hände zwischen die seinen genommen und schaute immer aufs neue in dies geliebte, so lang entbehrte, reizvolle Antlitz, aus dem ihm ein Paar wunderbare Augen mit tiefer Zärtlichkeit entgegenleuchteten.
Was er zu ihr sprach? Törichte, zusammenhanglose Worte, und doch besagten sie so unendlich viel.
Nur langsam wurde er ruhiger.
»Du leichtsinniger Verschwender«, meinte sie jetzt mit sonnigem Lächeln. »So teure Rosen! Und dann das Auto! Das muß ja eine Unsumme Miete kosten! Sogar ein Diener neben dem Chauffeur! Wo hast Du das alles nur aufgetrieben?!«
»Gefällt dir der Wagen, Liebling?« fragte er glücklich.
»Das wohl. Aber eine Fahrt in einem solchen Luxusgefährt paßt nicht recht zu unseren Verhältnissen«, erwidert sie zögernd.
Bornemann schüttelt anscheinend betrübt den Kopf.
»Ich wollte mein Bräutchen doch in recht würdiger Weise dem neuen Heim der Eltern zuführen. Etwas leichtsinnig mag’s ja gewesen sein.«
Sie sah nicht, wie es um seine Mundwinkel zuckte und wetterleuchtete.
Das Auto hatte soeben das Brandenburger Tor passiert und bog jetzt in die schnurrgerade Charlottenburger Chaussee ein.
»Da – die Siegesallee«, machte er sie auf die von Marmorgruppen eingefaßte Prachtstraße aufmerksam.
Immer weiter ging’s in einem Tempo, daß Hildegard bisweilen fast ein wenig angst wurde.
Jetzt tauchten zu beiden Seiten weite Kiefernwaldungen auf.
»Der berühmte Grunewald, Liebling. Etwas eintönig auf die Dauer.«
Eine knappe Viertelstunde später waren sie am Ziel.
Der Diener riß die Tür auf. Staunend stieg Hildegard Börmer aus. Ein Blick in die Runde, ein Ausruf des Entzückens.
Eine schloßartig gebaute Villa war’s, vor deren breiter Freitreppe das Auto hielt. Das schneeweiße Gebäude mit den vergoldeten Ziergittern vor den Fenstern hob sich gegen den dunklen Hintergrund eines mit Tannengruppen bepflanzten, sanft an der Berglehne ansteigenden Parkes wie eine Silhouette ab. Der Vorgarten, eine weite Rasenfläche mit einer Marmorfontäne in der Mitte, senkte sich sacht zu dem Ufer des Wannsees hinab, auf dessen im Sonnenlicht glänzenden Spiegel eine Anzahl Jachten mit weißen, leuchtenden Segeln dahinglitten.
Hildegard Börmer stand noch immer wie gebannt.
Dann eine verwunderte, ungläubige Frage:
»Ist dies – dies dein – Häuschen, Edgar?«
Bornemann fühlte seine Augen feucht werden.
So, genau so hatte er sich diese Szene immer in Gedanken ausgemalt. Und – da kamen auch schon Vater und Mutter Börmer eilig die Treppe heruntergetrippelt.
»Hilde – Hilde!«
Das junge Mädchen fuhr herum, flog ihnen entgegen.
»Mutter – Vater!«
Stumm, ergriffen schaute der Millionär auf die Wiedervereinten. Er sah, wie der alte Herr dem Töchterchen jetzt etwas zuflüsterte, wie er stolz auf den Schwiegersohn wies.
Da war ›Frau Hadwig‹ schon neben ihm.
»Ist’s wahr? – Ist’s wahr, was Vater mir eben erzählte – du – du ein Millionär? Das Auto – hier die Villa – alles dein Eigentum?«
»Ja, Liebling, und das war mein Geheimnis! – Ist mir die Überraschung geglückt?«
Hildegard lehnte sich an ihn, faßte beinahe scheu nach seiner Hand. »Ich habe dir viel abzubitten, unendlich viel, du Guter …«