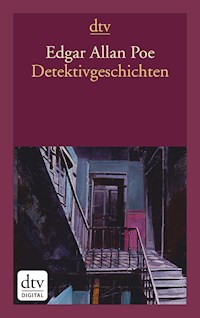
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Neuübersetzung zum 200. Geburtstag des Schriftstellers am 19. Januar 2009 Neuübersetzung zum 200. Geburtstag des Schriftstellers am 19. Januar 2009 Edgar Allan Poes genialer Detektiv Auguste Dupin klärt mysteriöse Vorfälle und deckt düstere Geheimnisse auf. Als Stammvater aller berühmten Ermittler in der Literatur entwickelt er ausgeklügelte Verfahren zur Verbrechensaufklärung und verlässt sich auf sein logisches Kalkül und eine rationale Herangehensweise. In den Erzählungen »Die Morde in der Rue Morgue«, »Das Geheimnis um Marie Rogêt« und »Der entwendete Brief« beweist Dupin Scharfsinn und analytische Kraft. Edgar Allen Poe schuf durch den Ermittler und den ihm assistierenden Ich-Erzähler eine Konstellation, die später Vorbild für nahezu alle folgenden Detektivgeschichten werden sollte. Nicht das Verbrechen selbst steht im Vordergrund, sondern das Rätsel, dessen Aufklärung nur mit dem Einsatz eines wachen Verstandes gelöst werden kann. Ein solches wird auch in der Erzählung »Der Goldkäfer« thematisiert, in der die Dechiffrierung einer Geheimschrift im Mittelpunkt steht. Poe beweist in den rätselhaften Geschichten sein unvergleichliches Talent für die Entwicklung mysteriöser Verstrickungen und deren kunstvolle Entwirrung - vier zeitlose Meisterstücke der Weltliteratur.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 274
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Edgar Allan Poe
Detektivgeschichten
Aus dem Englischen neu übersetzt und mit einem Nachwort von Sophie Zeitz
Deutscher Taschenbuch Verlag
Neuübersetzung 2009
© der deutschsprachigen Ausgabe:
Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG, München
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlags zulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.Rechtlicher Hinweis §44 UrhG: Wir behalten uns eine Nutzung der von uns veröffentlichten Werke für Text und Data Mining im Sinne von §44 UrhG ausdrücklich vor.
eBook ISBN 978-3-423-40156-2 (epub)
ISBN der gedruckten Ausgabe 978-3-423-13725-6
Ausführliche Informationen über unsere Autoren und Bücher sowie Themen, die Sie interessieren, finden Sie auf unserer Website
www.dtv.de
Inhaltsübersicht
Die Morde in der Rue Morgue
Das Geheimnis der Marie Rogêt
Der Goldkäfer
Der entwendete Brief
Edgar Allan Poe – Detektivgeschichten
Leben und Werk
DIE MORDE IN DER RUE MORGUE
Welches Lied die Sirenen sangen oder unter
welchen Namen Achill sich unter den Frauen
verbarg, mögen verwirrende Fragen sein,
doch sie sind nicht jenseits aller Spekulation.
Sir Thomas Browne, Urnenbegräbnis
Die geistigen Eigenschaften, die man analytisch nennt, lassen sich ihrerseits nur schwer analysieren. Wir schätzen an ihnen einzig ihre Wirkung. Unter anderem wissen wir, daß sie ihrem Besitzer, wenn in großem Maß vorhanden, stets Quelle lebhaften Vergnügens sind. Wie der starke Mann sich seiner körperlichen Kraft erfreut, wenn er seine Muskeln spielen läßt, so beglückt den Analytiker jene geistige Übung, die entwirrt. Die trivialsten Angelegenheiten bereiten ihm Freude, wenn sie sein Talent ins Spiel bringen. Rätsel, Wortspiele, Hieroglyphen schätzt er, und seine Lösungen beweisen einen Grad an Scharfsinn, der der normalen Vorstellung übernatürlich erscheint. Seine Ergebnisse, herbeigeführt allein durch Kern und Wesen der Methode, haben freilich allen Anschein von Intuition.
Die Gabe der Auf-Lösung läßt sich durch mathematische Studien noch erheblich steigern, insbesondere durch jene höchste Disziplin, welche zu Unrecht und nur aufgrund ihres rückschreitenden Verfahrens, gewissermaßen par excellence, Analysis genannt wird. Doch berechnen allein ist noch kein analysieren. Ein Schachspieler zum Beispiel tut das eine, ohne sich um das andere zu bemühen. Und so kommt es, daß das Schachspiel in seiner Wirkung auf die geistige Bildung weithin mißverstanden wird. Doch ich möchte keine Abhandlung verfassen, sondern stelle einer einigermaßen seltsamen Geschichte ein paar rein zufällige Beobachtungen voran; daher möchte ich die Gelegenheit ergreifen, zu behaupten, daß die erhabeneren Fähigkeiten des reflektierenden Verstandes gezielter und entschiedener vom schlichten Damespiel gefordert sind als von der raffinierten Oberflächlichkeit des Schachs. Bei letzterem, dessen Figuren unterschiedliche und bizarre Bewegungen ausführen, mit verschiedenen und veränderlichen Werten, wird, was nur komplex ist, gern mit Tiefe verwechselt (kein ungewöhnlicher Irrtum). Die Konzentration wird hier stark gefordert. Läßt sie nur einen Augenblick nach, kommt es zu einem Flüchtigkeitsfehler, aus dem Nachteil oder Niederlage folgen. Daß die möglichen Züge nicht nur mannigfach sind, sondern auch im Zusammenhang stehen, vervielfacht das Risiko derartiger Fehler; in neun von zehn Fällen gewinnt der aufmerksamere, nicht der klügere Spieler. Im Damespiel dagegen, wo die Züge eindeutig sind und sich nur wenige Möglichkeiten eröffnen, ist die Gefahr eines Versehens geringer, und während es weniger auf bloße Aufmerksamkeit ankommt, werden die Vorteile, die auf beiden Seiten zu erzielen sind, durch ein höheres Maß an Scharfsinn erzielt. Weniger abstrakt ausgedrückt: Stellen wir uns ein Damespiel vor, in dem nur vier Damen vorhanden sind und daher mit einem Flüchtigkeitsfehler nicht zu rechnen ist. Es ist offensichtlich, daß in diesem Fall (bei einander ebenbürtigen Spielern) allein ein gut durchdachter Zug, das Ergebnis einer großen Anstrengung des Verstandes, über den Sieg entscheiden kann. Anderer Mittel beraubt, versetzt sich der Analytiker in die Lage seines Gegners, identifiziert sich mit ihm, und erkennt dabei nicht selten mit einem Blick die einzigen Möglichkeiten (zuweilen tatsächlich absurd einfache), durch die er zum Irrtum verführen oder zur Fehlkalkulation treiben kann.
Das Whist-Spiel ist seit langem bekannt für seinen Einfluß auf das, was man gemeinhin Berechnungsvermögen nennt; und es ist bekannt, daß Männer von höchstem Intellekt ein offenbar unschätzbares Vergnügen daran finden, während sie Schach als zu oberflächlich meiden. Zweifellos gibt es kein anderes Spiel, das die Analysefähigkeit derart fordert. Der beste Schachspieler unter dem Himmel ist möglicherweise wenig mehr als der Beste im Schach; dagegen bedeutet das Beherrschen von Whist, in allen wichtigeren Unternehmungen, wo Geist mit Geist ringt, erfolgreich zu sein. Wenn ich hier von Beherrschen spreche, meine ich jene Vollkommenheit im Spiel, die das Begreifen aller Mittel einschließt, aus denen sich ein legitimer Vorteil ziehen läßt. Diese sind nicht nur zahlreich, sondern vielgestaltig, und liegen oft in Tiefen des Denkens verborgen, die dem gewöhnlichen Verstand unzugänglich sind. Achtsam hinzusehen heißt genau zu erinnern; und bis zu diesem Punkt schlägt der konzentrierte Schachspieler sich auch im Whist sehr gut, da Hoyles Regelwerk (das auf dem bloßen Mechanismus des Spiels beruht) hinreichend und allgemein verständlich ist. Und so sind ein gutes Gedächtnis und das Vorgehen »nach dem Buche« die Komponenten, die in der Summe allgemein als gutes Spielen gelten. Doch es sind Faktoren jenseits der reinen Regel, wo sich die Kunst des Analytikers erweist. Im stillen stellt er eine Fülle von Beobachtungen an und zieht Schlußfolgerungen. Gleiches tun vielleicht auch seine Mitspieler; doch gibt es einen Unterschied im Ausmaß der gesammelten Information, der weniger in der Gültigkeit der Folgerung als in der Qualität der Beobachtung liegt. Worauf es ankommt, ist zu wissen, was zu beobachten ist. Unser Spieler setzt sich keinerlei Grenzen; und er verzichtet auch nicht, nur weil das Spiel der Gegenstand ist, auf Folgerungen, die er aus Dingen außerhalb des Spiels ziehen kann. Er ergründet die Miene seines Partners, vergleicht sie aufmerksam mit der eines jeden seiner Gegner. Er berücksichtigt, wie die Karten auf jeder Hand sortiert sind; oft zählt er Trumpf für Trumpf, Honneur für Honneur, an den Blicken ab, die die Spieler ihren Karten widmen. Im Spielverlauf achtet er auf jede Veränderung der Mimik, gewinnt eine Fülle von Eindrücken durch die unterschiedlichen Ausdrucksweisen von Gewißheit, Überraschung, Triumph oder Verdruß. An der Art, wie ein Stich aufgenommen wird, erkennt er, ob der Spieler, der ihn aufgenommen hat, einen weiteren in derselben Farbe machen kann. Eine Täuschung erkennt er an der Art, wie eine Karte ausgespielt wird. Ein zufälliges oder unbesonnenes Wort, das versehentliche Fallenlassen oder Aufdecken einer Karte gepaart mit der Besorgnis oder Achtlosigkeit bezüglich ihrer Geheimhaltung, das Zählen der Stiche in der Reihenfolge ihrer Anordnung, Verlegenheit, Zögern, Eifer oder Angst – all dies liefert seiner scheinbar intuitiven Wahrnehmung Hinweise auf den wahren Stand der Dinge. Kaum sind die ersten zwei oder drei Runden gespielt, hat er volle Kenntnis des Inhalts einer jeden Hand und spielt von nun an seine Karten mit einer so absoluten Sicherheit, als hielten die Mitspieler ihre eigenen mit dem Bild nach außen.
Die Fähigkeit zur Analyse ist nicht mit schlichter Intelligenz zu verwechseln; denn während der Analytiker notwendigerweise intelligent ist, ist der Intelligente nur allzu oft bemerkenswert unfähig zur Analyse. Die folgernde oder kombinatorische Kraft, in der Intelligenz sich gewöhnlich manifestiert, und der die Phrenologen (irrtümlich, wie ich meine) in der Annahme, es handle sich um eine angeborene Fähigkeit, ein eigenes Organ zuschreiben, wurde so häufig auch bei jenen gesehen, deren Verstand ansonsten an Idiotie grenzte, daß die Wissenschaftler sich längst damit befassen. Zwischen Intelligenz und analytischer Fähigkeit besteht ein Unterschied, der weitaus größer ist als der zwischen Phantasie und Vorstellungskraft, diesem jedoch im Grunde sehr ähnlich ist. Man wird sogar feststellen, daß die Intelligenten immer phantasievoll sind, aber die, die echte Vorstellungskraft besitzen, nichts anderes als analytisch.
Die folgende Geschichte wird dem Leser gewissermaßen als Kommentar zu den hier vorgebrachten Thesen dienen.
Als ich mich während des Frühlings und Frühsommers 18__ in Paris aufhielt, machte ich dort die Bekanntschaft eines Monsieur C.Auguste Dupin. Der junge Herr stammte aus einer vornehmen, um nicht zu sagen erlauchten Familie, doch eine Folge ungünstiger Umstände hatte ihn in solche Armut gestürzt, daß die ganze Tatkraft seines Charakters daher zum Erliegen kam und er jede Bemühung einstellte, sich in die Welt zu begeben oder sich um das Wiedererlangen seines Vermögens zu bemühen. Dank seiner Gläubiger war ihm ein kleiner Rest des väterlichen Erbes geblieben; und durch das Einkommen daraus schaffte er es, mittels strenger Sparsamkeit seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, ohne sich um Überflüssigkeiten den Kopf zerbrechen zu müssen. Bücher waren freilich sein einziger Luxus, und in Paris sind diese leicht zu bekommen.
Unsere erste Begegnung fand in einer dunklen Buchhandlung in der Rue Montmartre statt, wo uns ein Zufall ins Gespräch brachte, denn wir waren beide auf der Suche nach demselben ebenso seltenen wie beachtlichen Band. Wir sahen einander wieder und wieder. Ich interessierte mich sehr für die kleine Familiengeschichte, und er offenbarte sie mir mit all dem Freimut, dem ein Franzose frönt, wenn das reine Selbst das Thema ist. Auch beeindruckte mich das Ausmaß dessen, was er las; vor allem aber fühlte ich, wie er meine Seele ansteckte mit der wilden Leidenschaft und lebhaften Frische seiner Vorstellungskraft. Auf der Suche nach den Dingen, die ich in Paris damals finden wollte, spürte ich, daß die Gesellschaft eines solchen Mannes von unschätzbarem Wert für mich sein würde; und dieses Gefühl vertraute ich ihm offen an. Bald war vereinbart, daß wir während meines Aufenthalts in der Stadt gemeinsam wohnen wollten; und da meine weltlichen Umstände etwas besser waren als seine, war mir erlaubt, für Miete und Einrichtung aufzukommen, in einem Stil, welcher der phantastischen Düsterkeit unseres gemeinsamen Temperaments entsprach, in einem verwitterten, grotesken Anwesen, das wegen irgendeines Aberglaubens, dem wir nicht weiter auf den Grund gingen, seit langem leer stand und an einem abgelegenen, trostlosen Ende der Faubourg St. Germain seinem Niedergang entgegenwankte.
Hätte die Welt vom Ablauf unseres Alltags dort erfahren, man hätte uns für wahnsinnig gehalten – wenn auch vielleicht für harmlos. Wir lebten in vollkommener Abgeschiedenheit. Wir empfingen keinen Besuch. Selbst vor meinen ehemaligen Geschäftsfreunden hatten wir den Ort unseres Rückzugs sorgfältig geheimgehalten, und es war viele Jahre her, daß Dupin in Paris Bekanntschaften pflegte oder bekannt war. Wir existierten allein in uns.
Es war eine der phantastischen Launen meines Freundes (wie sonst soll ich es nennen?), in die Nacht verliebt zu sein; und dieser Bizarrerie, wie all seinen anderen, schloß ich mich leise an, unterwarf mich mit vollkommener Hingabe seinen tollen Einfällen. Die dunkle Göttin wollte nicht immer bei uns weilen, doch wir konnten ihre Gegenwart vortäuschen. Beim ersten Dämmer des Morgens schlossen wir die schweren Läden unseres alten Gemäuers, zündeten ein paar Kerzen an, die, stark parfümiert, nur die fahlsten und mattesten Strahlen aussandten. Mit ihrer Hilfe überließen wir unsere Seelen den Träumen – wir lasen, schrieben oder unterhielten uns, bis die Uhr die Ankunft der wahren Dunkelheit ankündigte. Dann brachen wir auf, gingen hinaus auf die Straßen, Arm an Arm, knüpften an die Themen des Tages an oder streiften bis in die Morgenstunden weit herum, zwischen den wilden Lichtern und Schatten der bevölkerten Stadt auf der Suche nach jener Unendlichkeit geistiger Aufregung, wie sie nur stille Beobachtung gewähren kann.
In solchen Momenten kam ich nicht umhin, Dupins besondere analytische Fähigkeit zu bemerken und zu bewundern (obgleich seine unerschöpfliche Idealität nichts anderes erwarten ließ). Auch er schien an ihrer Ausübung – wenn nicht gar an ihrer Vorführung – großes Vergnügen zu finden, und er zögerte nicht, mir seine Freude daran zu gestehen. Mit einem leisen, glucksenden Lachen rühmte er sich, daß die meisten Menschen in seinen Augen ein Fenster auf der Brust trügen, und ließ solchen Behauptungen direkte und überaus verblüffende Beweise seiner intimen Kenntnis meines eigenen Innenlebens folgen. Bei solchen Gelegenheiten war sein Gebaren kühl und abstrakt, der Blick in seinen Augen war leer, während seine Stimme, gewöhnlich ein voller Tenor, zu einem Diskant anstieg, der verdrießlich geklungen hätte, wäre da nicht die Bedächtigkeit und vollkommene Klarheit seines Ausdrucks gewesen. Wenn ich ihn in diesen Launen ansah, mußte ich häufig an die alte Philosophie der zweigeteilten Seele denken und fand Gefallen an der Vorstellung eines doppelten Dupin – des schöpferischen und des auflösenden.
Was ich eben gesagt habe, soll freilich nicht den Eindruck erwecken, ich wolle ein Rätsel aufgeben oder ein Märchen erzählen. Das Phänomen, das ich an dem Franzosen beschrieben habe, war lediglich das Ergebnis eines gereizten oder vielleicht kranken Geistes. Doch um die Art seiner Bemerkungen in solchen Momenten verständlich zu machen, ist ein Beispiel wohl am besten geeignet.
Eines Abends flanierten wir durch eine lange schmutzige Straße in der Nähe des Palais Royal. Da wir offensichtlich beide in Gedanken waren, hatte seit wenigstens fünfzehn Minuten keiner von uns eine Silbe gesprochen. Plötzlich kam Dupin ganz unvermittelt mit diesen Worten heraus:
»Er ist fürwahr ein winziger Kerl und würde sich besser im Théâtre des Variétés machen.«
»Daran besteht kein Zweifel«, antwortete ich unwillkürlich, ohne daß mir gleich auffiel (so sehr war ich in Gedanken), auf welch erstaunliche Weise sich der Sprecher in meine Gedankengänge eingeschaltet hatte. Einen Moment später besann ich mich, und meine Verwunderung war groß.
»Dupin«, sagte ich ernst, »das übersteigt mein Verständnis. Ich gebe zu, ich bin verblüfft und will kaum meinen Sinnen trauen. Wie konnten Sie wissen, daß ich an –?« Ich sprach den Namen nicht aus, da ich mich jenseits jeden Zweifels vergewissern wollte, ob er tatsächlich wußte, an wen ich gedacht hatte.
»An Chantilly«, antwortete er, »sagen Sie es ruhig. Eben dachten Sie darüber nach, daß er seiner geringen Körpergröße wegen als Tragöde nicht geeignet ist.«
Exakt dies war der Gegenstand meiner Gedanken gewesen. Chantilly, ein ehemaliger Flickschuster aus der Rue St. Denis, hatte, als ihn das Bühnenfieber packte, für die Rolle des Xerxes vorgesprochen, in Crébillons gleichnamiger Tragödie, und sich mit seinen Mühen in aller Öffentlichkeit zum Gespött gemacht.
»Um Himmels willen, verraten Sie mir«, rief ich, »die Methode – falls es eine Methode gibt – durch die es Ihnen möglich war, meine Seele derart auszuloten.« In Wirklichkeit war ich noch erschrockener, als ich zuzugeben bereit war.
»Der Obsthändler war es«, erwiderte mein Freund, »der Sie zu dem Schluß brachte, der Sohlenflicker habe nicht die angemessene Größe für einen Xerxes et id genus omne.«
»Der Obsthändler! – Sie erstaunen mich – Ich weiß von keinem Obsthändler.«
»Der Mann, der Sie anrempelte, als wir die Straße betraten – es ist vielleicht fünfzehn Minuten her.«
Jetzt erinnerte ich mich wirklich, daß ein Obsthändler, der einen großen Korb mit Äpfeln auf dem Kopf getragen hatte, mich beinahe umgerannt hätte, als wir von der Rue C_ auf die Durchgangsstraße kamen, auf der wir gegenwärtig standen; doch was das mit Chantilly zu tun haben sollte, war mir ein Rätsel.
Dupin aber hatte nicht den Hauch eines Scharlatans an sich. »Ich werde es Ihnen erklären«, sagte er, »und damit Sie es vollkommen verstehen, lassen Sie uns zuerst den Gang Ihrer Gedanken zurückverfolgen, von dem Augenblick, da ich zu Ihnen sprach, bis zu der Begegnung mit dem fraglichen Obsthändler. Die größeren Bindeglieder sind folgende – Chantilly, Orion, Dr.Nichols, Epikur, Stereotomie, die Pflastersteine, der Obsthändler.«
Die meisten Menschen haben sich schon einmal im Leben den Spaß gemacht, die Schritte im Kopf zurückzuverfolgen, über die sie zu gewissen Schlußfolgerungen gelangt waren. Oft ist diese Beschäftigung höchst aufschlußreich, und wer sich das erste Mal darin versucht, wird erstaunt sein über die scheinbar endlose Strecke und Zusammenhanglosigkeit zwischen Ausgangspunkt und Ziel. Wie groß war meine Verblüffung, als ich den Franzosen sagen hörte, was er gerade gesagt hatte, und ich kam nicht umhin anzuerkennen, daß er die Wahrheit sagte. Dupin fuhr fort:
»Wir hatten von Pferden gesprochen, wenn ich mich recht erinnere, kurz bevor wir die Rue C_ verließen. Das war das letzte Thema, das wir erörterten. Als wir nun in diese Straße einbogen, stürzte ein Obsthändler an uns vorbei, mit einem großen Korb auf dem Kopf, und stieß Sie gegen einen Haufen Pflastersteine, die an einer Stelle gesammelt wurden, wo das Trottoir repariert wird. Sie traten auf einen der losen Steine, glitten aus, knickten mit dem Knöchel um, machten ein irritiertes oder verdrossenes Gesicht, murmelten ein paar Worte, warfen einen Blick auf den Steinhaufen und setzten dann schweigend Ihren Weg fort. Ich achtete nicht einmal besonders auf das, was Sie taten; doch ist mir Beobachtung in letzter Zeit zu einer Art Zwang geworden.
Sie hielten den Blick weiterhin auf den Boden gerichtet – mit einem mißmutigen Ausdruck betrachteten Sie die Löcher und Furchen im Pflaster (woran ich sah, daß Sie immer noch an die Steine dachten), bis wir die kleine Gasse namens Lamartine erreichten, die versuchsweise mit überlappenden und zusammengenieteten Blöcken gepflastert ist. Hier hellte sich Ihre Miene auf, und indem ich die Bewegung Ihrer Lippen sah, war ich mir sicher, daß Sie das Wort ›Stereotomie‹ murmelten, ein Begriff, der sehr gut auf diese Art des Pflasters paßt. Nun wußte ich, daß Sie das Wort ›Stereotomie‹ nicht sagen konnten, ohne an Atome zu denken und damit an die Theorien des Epikur; und da ich, als wir vor nicht allzu langer Zeit über das Thema sprachen, erwähnte, wie außerordentlich die jüngste Nebularhypothese mit den vagen Vermutungen des edlen Griechen übereinstimmte, ohne daß dies viel Aufsehen erregt hätte, spürte ich, daß Sie nun zwangsläufig den Blick zu den großen Orionnebeln erheben würden, und erwartete nichts anderes von Ihnen. Sie blickten hinauf, und ich war versichert, daß ich Ihre Schritte richtig verfolgt hatte. Doch in der bitteren Tirade über Chantilly, die gestern im Musée erschien, hatte der Kritiker bei seiner rüden Äußerung zum Namenswechsel des Schusters, als dieser ins Tragödienfach wechselte, eine lateinische Zeile zitiert, über die wir des öfteren gesprochen haben. Ich meine die Worte
Perdidit antiquum litera prima sonum.
Ich hatte Ihnen erklärt, daß sie sich auf Orion beziehen, früher Urion genannt; und wegen gewisser Spannungen im Zusammenhang mit dieser Erklärung wußte ich, daß Sie sie nicht vergessen haben würden. Es war mir also klar, daß Sie die Gedanken an Orion und Chantilly miteinander in Verbindung bringen würden. Daß Ihnen die Verbindung tatsächlich in den Sinn kam, sah ich an der Art des Lächelns, das über Ihre Lippen huschte. Sie dachten an die Opferung des armen Schusters. Bis dahin waren Sie mit krummem Rücken gegangen; doch nun sah ich, daß Sie sich zu voller Größe aufrichteten. Damit überzeugten Sie mich, daß Sie an Chantillys geringe Größe dachten. An dieser Stelle unterbrach ich Ihre Betrachtungen, um festzustellen, daß er fürwahr ein winziger Kerl ist – dieser Chantilly – und sich besser im Théâtre des Variétés machen würde.«
Nicht lange danach lasen wir eine Abendausgabe der Gazette des Tribuneaux, als folgende Zeilen unsere Aufmerksamkeit erregten.
»AUSSERGEWÖHNLICHE MORDE. – Heute morgen gegen drei Uhr wurden die Bewohner des Quartier St. Roch von einer Reihe schrecklicher Schreie aus dem Schlaf gerissen, die offenbar aus dem vierten Stock eines Hauses in der Rue Morgue drangen, dessen einzige Bewohner, wie bekannt ist, eine Madame L’Espanaye und ihre Tochter Mademoiselle Camille L’Espanaye waren. Nach einigen Verzögerungen, verursacht durch den vergeblichen Versuch, auf die übliche Art Einlaß zu finden, wurde das Tor mit einem Brecheisen aufgestemmt, und acht oder zehn Nachbarn traten in Begleitung von zwei Gendarmen ein. Inzwischen waren die Schreie verstummt; doch als die Gesellschaft zum ersten Treppenabsatz hinaufeilte, waren zwei oder mehr rauhe Stimmen, die aus dem oberen Teil des Hauses zu kommen schienen, in wütendem Streit zu hören. Beim Erreichen des zweiten Absatzes waren auch diese Stimmen verstummt, und alles war vollkommen still. Die Gesellschaft verteilte sich und eilte von Raum zu Raum. Bei der Ankunft in einem großen Hinterzimmer in der vierten Etage (dessen Tür, die verriegelt war und deren Schlüssel von innen im Schloß steckte, man mit Gewalt aufbrach) bot sich ein Anblick, der alle Anwesenden ebenso in Entsetzen wie in Verblüffung stürzte.
Die Wohnung befand sich in wildester Unordnung – das Mobiliar war zerstört und durcheinandergeworfen. Es gab nur ein Bettgestell, davon war das Bettzeug entfernt und mitten auf den Boden geworfen worden. Auf einem Stuhl lag ein Rasiermesser, blutverschmiert. Im Kamin lagen zwei oder drei lange, dicke Strähnen grauen Menschenhaars, ebenfalls voller Blut, und offenbar an den Wurzeln herausgerissen. Auf dem Boden lagen vier Napoleons, ein Topasohrring, drei große Silberlöffel, drei kleinere aus métal d’Alger und zwei Taschen, die fast viertausend Francs in Gold enthielten. Die Schubladen einer Kommode, die in einer Ecke stand, waren herausgezogen und anscheinend durchwühlt worden, auch wenn viele Gegenstände darin zurückgeblieben waren. Ein kleiner eiserner Tresor wurde unter dem Bettzeug (nicht unter dem Bettgestell) entdeckt. Er war offen, der Schlüssel steckte im Schloß. Es war nichts darin bis auf ein paar alte Briefe und andere unbedeutende Dokumente.
Von Madame L’Espanaye war keine Spur zu sehen; doch als vor dem Kamin eine ungewöhnliche Menge Ruß entdeckt wurde, nahm man eine Durchsuchung der Esse vor, und zog (fürchterlich zu berichten!) die Leiche der Tochter, kopfüber, aus dem Schlot; sie war ein beachtliches Stück weit in die schmale Öffnung hinaufgezwungen worden. Die Leiche war noch recht warm. Bei der Untersuchung wurden mehrere Wundabreibungen festgestellt, die zweifelsfrei von der Gewalt herrührten, mit der sie hinaufgestoßen und herausgezogen worden war. Im Gesicht hatte sie mehrere tiefe Kratzer, und an der Kehle dunkle Blutergüsse und tiefe Abdrücke von Fingernägeln, als wäre die Verstorbene erdrosselt worden.
Nachdem eine sorgfältige Durchsuchung des ganzen Hauses keine weiteren Entdeckungen lieferte, betrat die Gesellschaft einen kleinen gepflasterten Hof hinter dem Gebäude, wo die Leiche der alten Dame lag, der die Kehle so tief durchschnitten war, daß beim Versuch, sie anzuheben, der Kopf abfiel. Rumpf wie Kopf waren fürchterlich verstümmelt – ersterer so stark, daß kaum noch Ähnlichkeit mit einem menschlichen Wesen bestand.
Zu diesem grauenhaften Rätsel gibt es unseres Wissens bisher nicht den geringsten Schlüssel.«
Die Zeitung des folgenden Tages enthielt diese zusätzlichen Einzelheiten.
»DIE TRAGÖDIE IN DER RUE MORGUE. – Zahlreiche Einzelpersonen wurden in Verbindung mit der außergewöhnlichen und schrecklichen Affäre befragt« (Der Ausdruck ›Affäre‹ hat in Frankreich noch nicht die Anrüchigkeit, die ihm bei uns anhaftet), »doch es ist noch nichts bekannt, das Licht ins Dunkel brächte. Wir geben im folgenden alle relevanten Zeugenaussagen wieder.
Pauline Dubourg, Wäscherin, sagt aus, sie habe beide Verstorbene seit drei Jahren gekannt, weil sie in besagtem Zeitraum für sie gewaschen habe. Die alte Dame und ihre Tochter schienen gut auszukommen – seien sehr liebevoll miteinander umgegangen. Sie hätten sehr gut bezahlt. Könne nichts über ihre Lebensweise oder ihren Lebensunterhalt sagen. Vermutet, Madame L. habe diesen mit Wahrsagerei verdient. Hätte angeblich etwas auf der hohen Kante gehabt. Sei im Haus nie jemandem begegnet, wenn sie die Wäsche abgeholt oder gebracht habe. Sei sich sicher, daß es keine Hausangestellten gab. Bis auf die vierte Etage sei anscheinend kein Teil des Hauses möbliert gewesen.
Pierre Moreau, Tabakhändler, sagt aus, er habe Madame L’Espanaye seit etwa vier Jahren regelmäßig kleinere Mengen Tabak und Schnupftabak verkauft. Sei in der Gegend geboren und habe immer hier gewohnt. Die Verstorbene und ihre Tochter hätten das Haus, in dem die Leichen gefunden wurden, seit mehr als sechs Jahren bewohnt. Vorher sei es von einem Juwelier bewohnt gewesen, der die oberen Räumlichkeiten an verschiedene Personen untervermietet hätte. Das Haus sei das Eigentum von Madame L. gewesen. Sie hätte sich über den Mißbrauch ihres Gebäudes durch den Mieter geärgert, sei deshalb selbst eingezogen und habe sich fortan geweigert, irgendeinen Teil zu vermieten. Die alte Dame sei kindisch gewesen. Der Zeuge habe die Tochter während der sechs Jahre vielleicht fünf- oder sechsmal gesehen. Die beiden hätten ein ausgesprochen zurückgezogenes Leben geführt – nach allgemeiner Annahme hätten sie Geld gehabt. Nachbarn habe er sagen hören, Madame L. würde wahrsagen – glaubte es nicht. Habe nie jemanden durch die Tür treten sehen außer der alten Dame und ihrer Tochter, ein- oder zweimal einen Träger, und einen Arzt, vielleicht acht- bis zehnmal.
Verschiedene andere Personen, Nachbarn, machten ähnliche Angaben. Es wird niemand erwähnt, der das Haus regelmäßig besucht hätte. Es sei nicht bekannt, ob Madame L. und ihre Tochter lebende Angehörige hätten. Die Läden der vorderen Fenster seien selten geöffnet worden. Die nach hinten waren immer geschlossen, mit Ausnahme derer des großen Hinterzimmers in der vierten Etage. Das Haus sei ein gutes Haus – nicht sehr alt.
Isidore Musèt, Gendarm, sagt aus, er sei gegen drei Uhr morgens zu dem Haus gerufen worden und habe am Tor etwa zwanzig bis dreißig Personen vorgefunden, die versuchten, sich Einlaß zu verschaffen. Habe das Tor schließlich aufgebrochen, mit einem Bajonett – nicht mit einem Brecheisen. Habe kaum Schwierigkeiten gehabt, es zu öffnen, da es sich um ein Doppel- oder Falttor handelte, das weder oben noch unten verriegelt gewesen sei. Die Schreie hätten angedauert, während das Tor geöffnet wurde – dann hätten sie abrupt geendet. Es habe sich angehört wie die Schreie einer Person (oder mehrerer Personen) unter größten Qualen – laut und langgezogen, nicht kurz und schnell. Der Zeuge sei auf dem Weg nach oben vorangegangen. Beim Erreichen des ersten Absatzes habe er zwei Stimmen in lautem und wütendem Streit gehört – eine barsche Stimme, die andere viel schriller–, eine sehr seltsame Stimme. Habe ein paar Worte der ersten verstehen können, die die eines Franzosen gewesen sei. Sei sich sicher, daß es keine Frauenstimme war. Konnte die Wörter ›sacré‹ und ›diable‹ verstehen. Die schrille Stimme war die eines Ausländers. Könne nicht mit Gewißheit sagen, ob es sich um einen Mann oder eine Frau gehandelt habe. Habe nicht ausmachen können, was gesagt wurde, doch er glaube, die Sprache sei Spanisch gewesen. Den Zustand des Zimmers und der Leichen beschrieb der Zeuge genau so, wie wir ihn gestern beschrieben haben.
Henri Duval, Nachbar, Silberschmied von Beruf, sagt aus, er sei einer der ersten gewesen, die das Haus betreten hätten. Bestätigt im großen und ganzen die Aussage von Musèt. Sobald sie sich Einlaß verschafft hatten, schlossen sie die Tür hinter sich, um die Menge draußen zu halten, die sich, ungeachtet der späten Stunde, schnell versammelt hatte. Der Zeuge hält die schrille Stimme für die eines Italieners. Auf keinen Fall Franzose. Könne nicht sicher sein, daß es eine Männerstimme war. Hätte auch die einer Frau gewesen sein können. Sei mit dem Italienischen nicht vertraut. Habe keine Wörter unterscheiden können, doch die Satzmelodie habe ihn davon überzeugt, daß der Sprecher Italiener sein müsse. Kannte Madame L. und ihre Tochter. Hatte mit beiden häufig gesprochen. Sei sich sicher, daß die schrille Stimme zu keiner der Verstorbenen gehörte.
__ Odenheimer, Restaurator. Dieser Zeuge bot seine Aussage freiwillig an. Spricht kein Französisch, weshalb er von einem Übersetzer befragt wurde. Stammt aus Amsterdam. Sei zum Zeitpunkt der Schreie an dem Haus vorbeigekommen. Die Schreie hätten mehrere Minuten angedauert – wahrscheinlich zehn. Sie waren lang und laut – sehr schlimm und quälend. Sei einer der ersten gewesen, die das Gebäude betreten hätten. Bestätigte die vorhergehenden Aussagen in jeder Hinsicht bis auf eine: Sei überzeugt, daß die schrille Stimme die eines Mannes gewesen sei – eines Franzosen. Habe nicht unterscheiden können, was er sagte. Die Worte seien laut und schnell gewesen – abgehackt – und offensichtlich in Angst und Wut geäußert. Die Stimme war rauh – eher rauh als schrill. Könne es keine schrille Stimme nennen. Die barsche Stimme sagte wiederholt ›sacré‹, ›diable‹ und einmal ›mon Dieu‹.
Jules Mignaud, Bankier der Firma Mignaud et Fils, Rue Deloraine. Der ältere Mignaud. Madame L’Espanaye sei begütert gewesen. Habe im Frühjahr des Jahres __ (acht Jahre zuvor) ein Konto in seinem Bankhaus eröffnet. Habe regelmäßig kleine Summen eingezahlt. Habe nie Geld abgehoben, bis drei Tage vor ihrem Tod, als sie persönlich die Summe von viertausend Francs wünschte. Der Betrag sei in Gold ausbezahlt worden, und man habe einen Angestellten mit dem Geld zu ihr nach Hause geschickt.
Adolphe Le Bon, Angestellter bei Mignaud et Fils, sagt aus, am fraglichen Tag Madame L’Espanaye gegen Mittag mit den viertausend Francs, auf zwei Taschen verteilt, zu ihrem Wohnsitz begleitet zu haben. Als die Tür geöffnet wurde, sei Mademoiselle L. erschienen und habe ihm eine der Taschen abgenommen, während die alte Dame die zweite nahm. Daraufhin habe er sich verbeugt und sei gegangen. Habe zu diesem Zeitpunkt niemanden auf der Straße gesehen. Es ist eine Seitenstraße – sehr einsam.
William Bird, Schneider, sagt aus, er sei einer derjenigen gewesen, die das Haus betreten hätten. Sei Engländer. Lebe seit zwei Jahren in Paris. Sei einer der ersten gewesen, die die Treppe hinaufstiegen. Habe Stimmen im Streit gehört. Die barsche Stimme sei die eines Franzosen gewesen. Habe mehrere Wörter ausmachen können, aber erinnere sich nicht an alles. Habe eindeutig ›sacré‹ und ›mon Dieu‹ gehört. In dem Moment habe es ein Geräusch gegeben, als würden mehrere Personen miteinander kämpfen – ein schleifendes und polterndes Geräusch. Die schrille Stimme sei sehr laut gewesen – lauter als die barsche. Sei sich sicher, daß es nicht die Stimme eines Engländers war. Schien die eines Deutschen gewesen zu sein. Vielleicht die einer Frau. Verstehe kein Deutsch.
Vier der oben genannten Zeugen bestätigten auf Nachfrage, daß die Tür des Zimmers, in dem die Leiche von Mademoiselle L. aufgefunden wurde, von innen abgeschlossen gewesen sei, als die Gesellschaft ankam. Alles sei vollkommen still gewesen – keine Klagelaute oder sonst irgendwelche Geräusche. Nachdem die Tür aufgebrochen war, wäre niemand zu sehen gewesen. Die Fenster sowohl des vorderen als auch des hinteren Zimmers seien zu und von innen verriegelt gewesen. Eine Tür zwischen beiden Zimmern war zu, aber nicht abgeschlossen. Die Tür, die vom vorderen Zimmer in den Gang führte, war abgeschlossen, der Schlüssel steckte von innen. Ein kleines Zimmer am Ende des Ganges im vorderen Teil des Hauses, in der vierten Etage, war offen, die Tür angelehnt. Dieser Raum war mit alten Betten, Kisten und so weiter vollgestellt. Alles wurde sorgfältig herausgenommen und untersucht. Es gab keinen Winkel des Hauses, der nicht sorgfältig untersucht wurde. Feger wurden die Kamine hinauf und hinunter geschickt. Das Haus hat vier Etagen, mit Dachstuben (Mansarden). Eine Falltür zum Dach war sehr fest zugenagelt – schien seit Jahren nicht geöffnet worden zu sein. Wie viel Zeit zwischen dem Verlauten der streitenden Stimmen und dem Aufbrechen der Zimmertür verging, wurde von den Zeugen nicht eindeutig festgestellt. Bei manchen waren es nur drei Minuten – bei anderen bis zu fünf. Die Tür konnte nur unter Schwierigkeiten geöffnet werden.
Alfonzo Garcio, Bestatter, sagt aus, er wohne in der Rue Morgue. Stamme aus Spanien. Gehörte zu der Gesellschaft, die das Haus betrat. Ging nicht mit nach oben. Sei ein nervöser Mensch und habe Angst vor den Folgen der Aufregung gehabt. Die barsche Stimme sei die eines Franzosen gewesen. Habe nicht verstehen können, was gesagt wurde. Die schrille Stimme sei die eines Engländers gewesen – da sei er sicher. Versteht die englische Sprache nicht, doch urteilt nach der Betonung.
Alberto Montani, Konditor, sagt aus, er sei unter den ersten gewesen, die die Treppe hinaufstiegen. Habe die fraglichen Stimmen gehört. Die barsche Stimme sei die eines Franzosen gewesen. Konnte verschiedene Wörter verstehen. Der Sprecher schien heftig zu protestieren. Konnte nicht verstehen, was die schrille Stimme sagte. Habe schnell und holprig gesprochen. Glaubt, es war die Stimme eines Russen. Bekräftigt die allgemeinen Aussagen. Sei selbst Italiener. Habe nie mit einem gebürtigen Russen gesprochen.
Mehrere Zeugen erklärten auf Nachfrage, daß die Kamine aller Räume im vierten Stock zu eng seien, als daß ein Mensch hinaufklettern könne. Mit ›Feger‹ seien die zylindrischen Bürsten gemeint, die von Schornsteinfegern benutzt werden. In jedem Rauchfang im ganzen Haus seien Bürsten auf- und abgelassen worden. Es gab keine Hintertreppe, über die jemand hätte absteigen können, während die Gesellschaft die Vordertreppe hinaufstieg. Die Leiche der Mademoiselle sei so fest in den Kamin geklemmt gewesen, daß sie erst durch die geeinten Kräfte von vier bis fünf Personen habe herabgezerrt werden können.
Paul Dumas, Arzt, sagt aus, er sei gegen Tagesanbruch gerufen worden, um die Leichen zu beschauen. Zu diesem Zeitpunkt lagen beide auf dem Sackleinen des Bettgestells in der Stube, in der Mademoiselle L. gefunden worden war. Die Leiche der jungen Dame war mit Blutergüssen und Schürfwunden übersät. Der Umstand, daß sie den Kamin hinaufgestoßen worden war, sei eine hinreichende Erklärung für diese Male. An der Kehle fanden sich starke Abschürfungen. Mehrere tiefe Kratzer waren unter dem Kinn zu sehen, nebst einer Reihe blauer Flecken, die offensichtlich die Abdrücke von Fingern waren. Das Gesicht war gräßlich verfärbt, und die Augäpfel standen hervor. Die Zunge war zum Teil durchgebissen. Ein großer Bluterguß wurde in der Magengrube entdeckt, anscheinend vom Druck eines Knies verursacht. Nach Meinung von M.Dumas sei Mademoiselle L’Espanaye von einer oder mehreren unbekannten Personen erdrosselt worden. Die Leiche der Mutter war fürchterlich verstümmelt. Alle Knochen des rechten Beins und Arms waren mehr oder weniger zerschmettert. Das linke Schienbein stark zersplittert, ebenso alle Rippen auf der linken Seite. Der ganze Körper grausig geprellt und verfärbt. Unmöglich zu sagen, was die Verletzungen verursacht hatte. Ein schwerer Holzknüppel oder eine breite Eisenstange – ein Stuhl–, irgendeine große, schwere und stumpfe Waffe hätte eine derartige Wirkung haben können, in den Händen eines sehr starken Mannes. Eine Frau hätte mit keiner Waffe solche Schläge ausführen können. Der Kopf der Verstorbenen war zu dem Zeitpunkt, als der Zeuge ihn untersuchte, vollkommen vom Rumpf abgetrennt und ebenfalls stark zerschmettert. Die Kehle war offensichtlich mit einem sehr scharfen Instrument durchschnitten worden – wahrscheinlich mit einem Rasiermesser.
Alexandre Etienne, Chirurg, wurde von M.Dumas gerufen, um die Leichen zu beschauen. Bestätigte die Zeugenaussage und die Meinungen von M.Dumas.





























