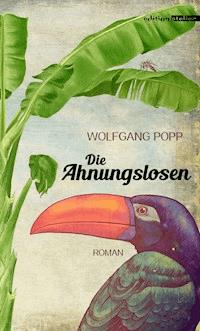
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Atelier
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Lustvoll und listig zieht der Zufall seine Fäden und knüpft seine Netze. Das erfahren auch die Protagonisten in Wolfgang Popps Roman "Die Ahnungslosen". Klarissa Alber, die auf der Flucht vor den Nazis in Shanghai landet und dort ihre große Liebe trifft, kann davon ein Lied singen. Genauso wie Tim, der auf der anderen Seite der Welt nicht nur durch Tempelruinen, sondern auch über seinen Schatten springt. Oder der Musiker Raul, dem nach einer langen Durststrecke ausgerechnet ein Teufelsintervall zum Erfolg verhilft. Eine mitreißende Hommage an die Unvorhersehbarkeit des Lebens.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 384
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
WOLFGANG POPP
Die Ahnungslosen
ROMAN
Ich möchte so gerne Wesen begegnen, die anders sind.
Michel Houellebecq
Inhalt
Kalifornischer Kreuzgang
Regenlachen
Kapitän Nemo
Schiffbruch
Drei Giraffen
23 Uhr 57
Zwischenluft und Zaubersprüche
Unter Palmen
Zwiebelschneiden
Gastauftritt im Bademantel
Die gelbe Gießkanne
Die Vertreibung aus dem Gelobten Land
Ein Kapitel für sich
Aus den Augen
Aus dem Leben einer Hexe
Gänsehaut
Heilige Motoren
Der Geruch von Hautcreme
Der Griff der Meerjungfrau
Zeitverschiebung
Dem Himmel so nah
Zurück ins Wasser
Der gläserne Traum
Morgendliche Dünenlandschaft
Frei nach Bosch
Motten im Kopf
Stichtag
Das Teufelsintervall
Der rote Mantel
Farbe bekennen
Vanille und Zedernholz
Im Skriptorium
Drei Arten Zufall
Tollwut
Versuch über die Freundschaft
Blue Suede Shoes
Noch einmal Insekten
Boulevard of rotten dreams
Der Tod des Künstlers
Natürlich
Blicke und Blühen
Das Lachen des Mister Fate
Erinnerungskrabbeln
Menschen im Aquarium
Der Jäger und die Tänzerin
Tears will love us apart
Das Lachen des Aperol
Aus Ernst wird Spiel
Haarersatz
Die Wut im Bauch und die Faust auch
All about Steve
Whiskysonne
Rote Punkte
Geduldspiel
Zwei Farben Rot
Blutende Denker
Hilfskraft
Die Lebenden und die Tote
Das Leben und Lieben der Gebrüder Azar
Zwischen Bett und Uhr
Weniger See ist Meer
Dazwischendurch
Kalifornischer Kreuzgang
»Weißt du, wie sie ihn damals genannt haben?«
Tim streicht mit der Hand diese nicht enden wollende himmelblaue Kurve entlang, die nichts ähnlich sieht, was Su kennt. Am ehesten vielleicht noch einem Wassertropfen, den der Wind waagrecht vor sich hertreibt. Erst bei der Kühlerhaube merkt Su, dass Tims Finger den Lack des Citroën gar nicht berühren. Es ist Donnerstagnachmittag, die Wettervorhersage hat den letzten warmen Abend des Jahres versprochen, und Su schüttelt den Kopf.
»Die Göttin«, sagt Tim.
Manche Menschen hüten ihre Leidenschaften wie Geheimnisse, Su hat jedenfalls nicht gewusst, dass Tim sich für alte Autos begeistert, und sagt es ihm.
»Ist nichts Ernstes«, winkt er ab.
›Sieht aber nicht so aus‹, denkt Su, und denkt auch, dass ihr das fehlt, solch eine Faszination für eine Sache. Zumindest fällt ihr nichts Vergleichbares ein, obwohl sie einige Zeit mit langen Fingern in ihren Erinnerungen wühlt. Und dann fährt sie sich mit denselben langen Fingern durch ihre Haare, um den Hauch von Neid loszuwerden, der dort wie eine Spinnwebe klebt.
»Wollen wir?«, fragt Su, und Tim hält ihr mit einem »Voilà« die Tür auf. Das ockerfarbene Leder erinnert sie an Handtaschen oder Mäntel, und sie rutscht in ihrem Sitz hin und her, als würde sie ihn anprobieren. Es riecht warm, und die tiefstehende Nachmittagssonne zeichnet samtige Schlieren auf die Windschutzscheibe. Tim startet den Citroën DS, und Su wundert sich, wie leise der Motor ist. Der Schalthebel kommt aus dem Armaturenbrett, Tim zieht und dreht ihn, dann wirft er einen Blick über seine Schulter und reiht sich in den langsam einsetzenden Abendverkehr ein.
»Wie woanders«, sagt er, und Su nickt stumm. Aus der himmelblauen Göttin heraus sehen die Straßen tatsächlich aus, als wäre es nicht weit nach Saint Tropez. Nicht weit zu Gauloises und Pastis. Zu Catherine und Jean-Luc. An dem DS hängt eine ganze Welt oder zumindest die halbe Côte d’Azur, und als sie an der nächsten Ampel zum Stehen kommen, streckt der Fahrer neben ihnen anerkennend seinen Daumen in die Höhe. Su lächelt ihm ein »Danke« zu und dreht sich wieder nach vorn, spürt aber, wie der Blick des Mannes an ihr hängenbleibt und wie sie rot wird, und beugt sich unter dem Blick weg zum Autoradio. Sie drückt den chromsilbernen Knopf, ein metallisches Klicken ist zu hören und dann ein schleifendes Geräusch.
»Da ist noch eine Kassette drin«, sagt Tim überrascht und dreht am Lautstärkeregler. Dann sind die ersten Takte zu hören, und Su sieht das Autoradio vorwurfsvoll an wie jemanden, der sie an eine peinliche Geschichte erinnert.
»Das darf nicht wahr sein«, sagt sie, »Dirty Dancing«.
Die erste Strophe summen sie noch zaghaft mit, beim Refrain setzen sie aber beide lauthals mit ein und kaum ist der Song zu Ende, spult Su die Kassette zurück.
»Hattest du die jemals?«, fragt sie Tim, während der Song bandraschelnd seinen Anfang sucht.
»Was meinst du?«, fragt er, »die Platte?«
»Nein. The time of your life?«
»Jetzt gerade habe ich sie«, sagt er, »hier mit dir.«
»Du weißt schon, was ich meine«, sagt Su.
Tim schaut aus dem Seitenfenster, als würde die Erinnerung, die er sucht, am Straßenrand stehen.
Und dann scheint er sie tatsächlich da draußen zu entdecken. »Mmh«, nickt er gleichzeitig sich selbst und Su zu, die in dem Moment merkt, dass es ihr lieber gewesen wäre, Tim wäre nichts eingefallen.
»Und?«, sagt sie, als er nicht gleich zu erzählen beginnt, und bemüht sich dabei erfolglos, gleichgültig zu klingen.
»Die Tage mit Raul«, sagt Tim und richtet den Rückspiegel, als würde die Erinnerung daran noch immer da hinten an der Straße stehen.
»Wer ist Raul?«
»Wir sind uns auf der Uni über den Weg gelaufen, auf einer Exkursion, mittelalterliche Geschichte.«
Und dann erzählt Tim von einem Kloster, in dem sie zwei Tage waren, von alten Handschriften, von einer schlaflosen Nacht und einer Begegnung um drei Uhr früh im Klosterhof.
»Da ist Raul, mit dem ich bis zu diesem Zeitpunkt noch kein Wort gewechselt hatte, auf einer Mauer im Kreuzgang gesessen. Er hat in den Garten mit dem alten steinernen Brunnen geschaut und geraucht, Kopfhörer auf, und neben ihm ein Walkman. Er hat mich angesehen, prüfend, ob ich es wert bin, und dann hat er die Kopfhörer abgenommen und sie mir hingehalten. Das war die Begrüßung. Statt ›hallo‹ zu sagen, hält er mir die Kopfhörer hin. Ich setze sie genauso wortlos auf und höre eine Frau, nur von einem Klavier begleitet, in einer miesen Tonqualität, aber irgendwie hat das Rauschen die Musik noch schöner gemacht. Dazu der Klosterhof, die alten Steine und die Nacht, das war schon irgendwie besonders. Als der Song aus war, habe ich ihn gefragt, wer das ist. ›Joni Mitchell‹, hat Raul gesagt, und ich habe gesehen wie er sich freute, dass ich von Joni Mitchell offensichtlich noch nie etwas gehört hatte. Er hat eine Flasche Bourbon aus seiner Manteltasche gezogen, sie aufgeschraubt und mir hingehalten. Mir ist zuerst der Bourbon heiß die Kehle hinuntergelaufen und gleich darauf Rauls Satz.
›Wir leben am falschen Ort‹, hat er gesagt und seiner Zigarette an einem Stein langsam die Asche abgedreht. Ich habe ihn gefragt, was er meint, und er hat einen tiefen Zug genommen. ›Man muss dort leben, wo so eine Musik geschrieben wird‹, hat er gesagt, und dann eine Songzeile zitiert, die im Kreuzgang wie ein dunkles Gebet geklungen hat.«
Tim lehnt sich zurück am Steuer, grinst verlegen die Vergangenheit an wie eine verlorene Schwester und klopft den Takt zu Joni Mitchells Song, der unhörbar für Su in seinem Kopf spielt.
»Los, sag schon!«, zieht sie ihn am Ärmel.
»Everybody’s saying that hell’s the hippest way to go. Well, I don’t think so. But I’m gonna take a look around it, though.«
Su denkt langsam den Zeilen hinterher und sieht sich in der Hölle um, ohne dort viel zu entdecken.
»Und diese Stunden im Kloster, die waren so time-of-your-life für dich?«
Tim stellt die rechte Hand am Lenkrad zu einem »Warte!«, »Langsam!« und »Der Reihe nach!« auf.
»Raul hat plötzlich von Los Angeles zu schwärmen begonnen, von den Palmen am Straßenrand und Kreuzungen, an denen du am liebsten in alle Richtungen gleichzeitig weiterfahren würdest, und von einem Café, in dem Schriftsteller, Musiker und Maler ihre Tage und Nächte und Tage verbringen. Ich habe ihn gefragt, wann er dort gewesen sei, und er hat gesagt, ›noch gar nicht‹, doch als wir in der Morgendämmerung zurück zu unseren Betten geschlichen sind, war unsere gemeinsame Reise nach Kalifornien beschlossene Sache.«
»Ich habe gar nicht gewusst, dass du schon mal drüben warst«, sagt Su und deutet mit dem Kopf Richtung Übersee. Die Straße dreht auch gerade Richtung Westen, und sie fahren jetzt direkt auf die Abendsonne zu. Su hält die Hand vor die Augen und Tim klappt seine Sonnenblende herunter.
»War ich auch nicht«, sagt er.
»Warum?« Su sieht ihn fragend an.
Tim atmet ein, sagt aber nichts und tut, als müsse er sich auf die Straße konzentrieren, obwohl die kerzengerade vor ihnen liegt.
»Hallo?«, stößt Su ihn an.
»Die Reise hätte eine Menge gekostet«, sagt er. »Wir wollten ja mindestens zwei Monate unterwegs sein. Außerdem war ich noch nie so weit weg und wusste mit einem Mal auch nicht mehr so genau, was ich dort eigentlich sollte.«
»Ja und?«, fragt Su.
»Eine Woche vor Abflug habe ich Raul abgesagt.«
Am nächsten Morgen wacht Tim um sechs Uhr auf und kann nicht mehr einschlafen. Er denkt daran, wie er am Abend zuerst Su zu Hause abgesetzt und anschließend den Citroën zum Händler zurückgebracht hat. Er ist auf den dunklen Parkplatz gefahren, hat die Scheinwerfer abgedreht und noch einmal Dirty Dancing gehört. Und dann hat er die Autoschlüssel wie ausgemacht in den Briefkasten geworfen.
Su liegt mit dem Gesicht zu ihm, die Decke bis zur Nase hochgezogen. Er kriecht leise aus dem Bett, stellt einen Kaffee auf und setzt sich an den Küchentisch. Die zusammengefaltete Zeitung vom Vortag liegt noch da, darauf ein Kugelschreiber, und Tim beginnt am Rand herumzukritzeln. Zuerst zeichnet er nur das schlangenförmige Lenkrad des DS, aber dann macht er weiter, zeichnet das Armaturenbrett, die Windschutzscheibe und schließlich, hinter der Windschutzscheibe, die Skyline von Los Angeles und das Meer.
Regenlachen
Es war ein ungewöhnlich heißer Sommer. Anfang August wurde es schließlich unerträglich. Die Straßen waren leer gefegt von der Hitze. Die Luft stand still. Wir verließen die Wohnung nicht mehr, trugen Unterhosen oder gar nichts und legten die Matratzen auf den Boden, weil wir uns einredeten, dort wäre es um einen halben Meter kühler als im Bett. In die Küche, aufs Klo und ins Bad krochen wir auf allen Vieren. Zuerst aus Spaß, später, weil die Hitze aus unserem Spaß Ernst machte. Dieser Zustand dauerte nicht länger als zwei oder drei Tage, uns kamen sie aber vor wie Wochen. Als sich eines Abends plötzlich Wolken über der Stadt aufbauten, von Ferne ein Donnergrollen zu hören war und der Himmel schwarz wurde, standen wir Hand in Hand am Fenster wie Seefahrer, die am Horizont Land entdeckten. Und als es in großen Tropfen zu regnen begann, rannten wir auf die Straße wie Verdurstende. Auch aus den anderen Häusern drängten die Menschen ins Freie, und alle sahen wir uns an, als hätten wir Großes erreicht. Wir umarmten Wildfremde, jemand stellte die Boxen seiner Anlage in die Fenster seiner Wohnung, und dann tanzten wir gemeinsam im Regen.
Ich hatte ihn nicht bemerkt. Er tauchte plötzlich hinter meinem Rücken auf, streckte die Hand nach Zora aus, und sie ließ ihn mittanzen in unserem Kreis. In seinen Augen lag ein besonderes Glänzen. Noch mehr Lebenslust als wir anderen, und auf dem Kopf trug er einen Hut, bei dem man sich fragte, wo er den her hat. Er drehte sich schneller als wir, und Zora ließ meine Hand los, weil ich nicht mehr mitkam. Ich lehnte mich an ein Auto, sah hinunter zu meinen Flipflops und ließ sie im Wasser quietschen, die knatschigen Stimmen kleiner Trolle, von denen ich nicht wusste, wollten sie mich warnen oder beruhigen. Dann hörte ich Zora lachen und blickte auf. Sie bemerkte mich, und ich lachte zurück zu ihr, doch da hörte sie mit ihrem Lachen auf und sah mich an, als kennte sie mich nicht oder nicht mehr so gut wie bisher.
Zwei Tage später verließ sie mich, und als wir uns Wochen danach in einem Café gegenübersaßen, meinte sie, der Regen habe ihr die Augen geöffnet. Anschließend zählte sie die Dinge auf, die sie die Jahre über an mir gestört hatten. An einer Hand, und nicht einmal die fünf Finger bekam sie voll. Und überhaupt: So schlimm können diese Dinge nicht sein, wenn du einen Regen brauchst, damit sie dir überhaupt auffallen?
Jedenfalls habe ich es seit damals nicht mehr so mit Regen – und Zora auch nicht wiedergesehen. Der mit dem Hut, dessen Namen sie mir bei dem Treffen unter keinen Umständen verraten wollte, war übrigens rein zufällig unsere Straße hinuntergegangen. Zora nannte das ›ein Zeichen‹, wofür, sagte sie allerdings nicht. Mit Zufällen und Zeichen habe ich es seitdem jedenfalls auch nicht mehr so.
Wann ich damit begonnen habe, weiß ich nicht mehr, aber jeden Morgen beim Frühstück sehe ich mir auf Wikipedia die Liste mit den kürzlich Verstorbenen an. Irgendwie fühle ich mich wohl in ihrer Gegenwart. Oder Abwesenheit. Wie man’s nimmt. Bei ungewöhnlich jungen Toten lese ich nach, woran sie gestorben sind, auch wenn mir ihre Namen gar nichts sagen. Am 17. August, also fast auf den Tag genau zwölf Jahre nachdem Zora mir im Regen davongetanzt war, fand ich dort ihren Namen. Zora Gast (38), Politikerin. Zuerst hielt ich das Ganze für eine zufällige Namensgleichheit, aber das Alter stimmte, und als ich den Eintrag öffnete, fand ich dort ihr Geburtsdatum und ihren Geburtsort. Ich klickte den Link zu ihrem Nachruf in einem kleinen Lokalblatt an, und dort war ihr Foto. Sie lachte ihr Regenlachen von damals, kurz bevor sie mich bemerkte und ihr Lachen in die nächste Pfütze warf. Zora war frühmorgens auf der Fahrt zu einem Pressetermin am Steuer ihres Wagens eingeschlafen und in einen Brückenpfeiler gerast. Sie war sofort tot. Sie hinterließ einen Mann und zwei Kinder. Der Bürgermeister ihrer Heimatgemeinde sprach von einem schrecklichen Verlust.
Als meine Freundin in die Küche kam und fragte, warum ich feuchte Augen hätte, deutete ich auf meine Kaffeetasse, verzog den Mund und sagte, ich hätte mir die Zunge verbrannt.
Karoline hat einen Laden für Künstlerbedarf. Sie verkauft Notizbücher in allen Formaten und Farben, und Papierbögen in allen Größen und Stärken. Hauchdünnes Reispapier aus Japan und Büttenpapier aus Italien. Sie sagt, sie mag die erwartungsvollen Blicke ihrer Kunden: Schriftsteller, die mitten in einer Geschichte stecken, und Künstler, die ihr neues Bild im Kopf haben. Allerdings hat man noch von keinem von ihnen etwas gehört. Wir sind seit drei Jahren zusammen. Ich habe ihr nie von Zora erzählt.
Zwei Wochen später veranstaltete Karoline ihr Herbstfest. Das machte sie jedes Jahr nach den Sommerferien, lud ihre Kunden in den Laden ein, es gab Wasser und Wein und ein kleines Buffet.
Das Wetter war mild an diesem Abend und alle balancierten ihre randvollen Pappbecher ins Freie, hinaus in den Hinterhof, wo eine alte Kastanie und eine Sitzbank standen. Besonders sympathisch waren mir Karolines Kunden nicht. Ich kenne diesen Menschenschlag zur Genüge. Sie quatschen dich den ganzen Abend mit ihren Projekten voll, und wenn du sie ein Jahr später wiedertriffst, sind ihre Geschichten noch haargenau dieselben, was nichts anderes heißt, als dass sie die letzten zwölf Monate nichts auf die Reihe bekommen haben. Als ich einmal in so einer Runde den Fehler machte, zu erzählen, ich hätte einen fixen Job, sahen sie mich an wie den Klassenfeind persönlich. Ich wollte an diesem Abend also nur Karoline meine Schuldigkeit tun, aber auf keinen Fall lange bleiben. Als ich hinkam, stand sie in einem Pulk von Menschen, und ich winkte ihr nur aus der Ferne zu. Sie deutete mir, ich solle mich am Büffet bedienen, also holte ich mir einen Weißwein und ging damit hinaus zu der alten Kastanie. Um genau zu sein, stellte ich mich halb hinter die Kastanie, weil ich einen »Künstler« entdeckt hatte, der mich letztes Jahr eine geschlagene Stunde lang zugelabert hatte. Ich glaubte, unbeobachtet zu sein, lehnte den Kopf zurück an den Stamm und schloss kurz die Augen.
»Auch Künstler?«
Vor mir stand eine Frau, die genauso aussah wie ihre Stimme.
»Was?«, fragte ich.
»Ob du auch Künstler bist?«
Mein zynisches Grinsen war schneller als ich und nahm mir die Antwort ab.
»Sondern?«, fragte sie.
Ich überlegte kurz, ob ich sie anlügen sollte, konnte mich aber nicht entscheiden, ob ich sie beeindrucken oder loswerden wollte, und ließ deshalb die Wahrheit entscheiden.
»Systembetreuer«, sagte ich.
Zora hatte sich damals in mich verliebt, weil sie es beeindruckend fand, wie ich in Codes und Zahlen dachte, und mich möglicherweise verlassen, weil sie bemerkt hatte, was das aus meinem Denken machte.
»Und du?«, fragte ich die Frau, die aussah wie ihre Stimme.
»Schauspielerin«, sagte sie, »ich bin der Star sämtlicher nicht subventionierter Kellerbühnen. Ich spiele um ein Viertel von dem, was eine Putzfrau verdient, du hast meinen Namen also mit Sicherheit schon gehört. Vor dir steht the one and only Zora Gast.«
Sie merkte nicht, wie ich erstarrte, sondern hielt mir die Hand hin. Ich brauchte einen Moment, bis ich einschlagen konnte, und selbst dann noch rechnete irgendetwas in mir fest damit, dass sie sich in Luft auflösen würde, sobald ich sie berührte.
»Bist du alleine hier?«, fragte sie, weiterhin völlig unbekümmert.
Ich nickte, und fast gleichzeitig verschwand die Sonne und es kühlte rasch ab.
»Brrr«, sagte sie und rieb sich die Oberarme, »der Sommer ist mit Sicherheit vorbei.«
Was mir nur recht war, denn damit würde es beim nächsten Wolkenbruch auch mit Sicherheit zu kalt sein, um im Regen zu tanzen.
»Gehen wir woanders hin«, sagte ich.
Kapitän Nemo
Sie stand mit zwei Milchpackungen in den Händen am Kühlregal und verglich das Ablaufdatum.
»Krissi, bist du das?«
Seit einer Ewigkeit hatte sie keiner mehr so genannt, die Stimme war ihr aber völlig fremd, genau wie der Mann, der mit Augen wie weit offene Arme auf sie zusteuerte.
»Hallo«, sagte sie, in jeder Hand noch immer eine Packung Milch. Er blieb vor ihr stehen, und sie stellte die Milch in ihren Einkaufswagen.
»Du hast keinen Schimmer, wer ich bin«, sagte der Mann, grinste sie an und ließ sie zappeln. Er war in ihrem Alter, Anfang, Mitte vierzig, schmales Gesicht, sportlich, die Haare schon leicht grau meliert, was ihm aber gut stand. Kris Blick flimmerte über sein Gesicht wie ein Scanner über einen unbekannten Barcode.
»Tut mir leid«, gab sie es schließlich auf.
»Käfer«, sagte der Mann, und da machte es Klick bei ihr.
»Alf«, sagte sie mit ungläubigen Augen, denn der Mann vor ihr passte nicht zu ihrer Erinnerung an den eigenbrötlerischen Mitschüler, der in einer Plastikdose mit selbst gestochenen Luftlöchern Insekten in die Schule mitgebracht hatte.
Sie hatten ihn Spiderman genannt, abschätzig und mit gespieltem Ekel in der Stimme, und er hatte ihnen hundertmal erklärt, dass er sich für Insekten interessiere und Spinnen keine Insekten seien, jeder könne das ganz leicht feststellen, weil Spinnen acht Beine hätten und Insekten nur sechs. Das alles fiel ihr wieder ein, und auch, dass sie damals geglaubt hatte, er sei in sie verliebt. Vor dem Schulball hatte sie sich schon eine Ausrede zurechtgelegt und war dann enttäuscht gewesen, als er sie gar nicht erst fragte, ob sie mit ihm hinginge.
»Was machen die Insekten?«, fragte Kri.
»Ich bin jetzt untergetaucht«, antwortete Alf.
Sie fanden ein Café unweit des Supermarkts. Auf dem Weg dorthin kam die Sonne heraus, und sie setzten sich an einen der Tische vor dem Lokal. Jetzt am Vormittag war wenig los, nur ein Mann saß da noch, zwei Tische weiter, im dunklen Sakko. Sein oberster Hemdknopf stand offen und seine Krawatte hing über der Armlehne des Nebensessels. Kopfüber baumelte sie herunter wie ein Kind an einer Reckstange, während er lautstark telefonierte, vor sich auf dem Tisch den aufgeklappten Laptop. Die Hektik des Mannes steckte Kri an und sie holte ihren Terminplaner aus der Tasche, der alte Affe Angst, irgendetwas vergessen zu haben. Alf lehnte sich unterdessen zurück, schloss die Augen und ließ sich die Sonne ins Gesicht scheinen, die Hände hinter dem Kopf verschränkt.
»Wie damals beim Schule schwänzen«, sagte er, als Kri aus ihrem Terminkalender zurück an den Tisch kam, sie konnte sich aber nicht erinnern, dass sie jemals gemeinsam Schule geschwänzt hatten.
»Geht’s bei dir sonst auch so zu?«, fragte er und deutete mit dem Kopf zu dem am Telefon gestikulierenden Mann.
»Bei wem nicht?«
Alf zuckte ein »Rate mal« mit den Schultern und genoss dabei sich selbst genauso wie die Sonne. Nicht arrogant, aber beneidenswert zufrieden. Dann lehnte er sich nach vorn und verschränkte die Hände.
»Und bei dir?«, fragte er. »Was ist aus der Klassenbesten geworden?«
Alf hatte den Tonfall ihres ehemaligen Direktors ziemlich gut hinbekommen, und Kri erzählte ihm grinsend, was sie machte.
»Du hast deine eigene Firma?«, sagte Alf.
»Das hört sich nach mehr an, als es ist. Ich manage den Laden eigentlich allein und stelle nur stundenweise Leute ein.«
»Und? Läuft es?«
»Ich kann mich nicht beklagen, aber es geht oft die ganze Nacht durch.«
»Dafür lernst du interessante Leute kennen«, sagte Alf.
»Mmmh …«, hielt Kri mit wiegendem Kopf ihr Glück in der Schwebe. »Aber es bleibt ohnehin keine Zeit, sich zu unterhalten, weil es immer irgendetwas gibt, das nicht passt. Entweder ist der Kaviar zu wenig, der Weißwein zu warm oder die Musik zu laut.«
»Ach was!«, richtete Alf Kris Kopf wieder gerade. »Dein berühmtes Lächeln – und sofort lösen sich alle Probleme in Luft auf.«
Kri wusste nicht, was sie von Alfs letzter Äußerung halten sollte. In der Schulzeit hatte es immer wieder Neider gegeben, die gemeint hatten, ihre guten Noten hätten nicht wenig mit ihrem guten Aussehen zu tun. In dem Moment klappte der Geschäftsmann am Nebentisch seinen Laptop zu, streifte sich die Krawatte über den Kopf, zog sie fest und verlangte nach der Rechnung.
»Jetzt erzähl aber, was du machst«, sagte Kri.
»Habe ich doch schon gesagt, ich bin jetzt unter Wasser unterwegs.«
»Was? Fische?«
»Kraken«, sagte er, und Kri sah ihn an, als würde er einen Scherz machen.
»Du hast das mit den Tieren wirklich durchgezogen?«
Alf nickte, und Kri dachte, »Kapitän Nemo«. Obwohl er nur eine Armeslänge entfernt saß, schien es für Alf eine andere Form der Schwerkraft zu geben, die es ihm erlaubte, durchs Leben zu schweben, während sie sich von einem Tag zum anderen schleppen musste.
»Ich arbeite im Aquarium«, sagte er, und Kri fand, dass die beiden Worte nicht zusammengingen, »arbeiten« und »Aquarium«. Und dann dachte sie noch, dass sie dort seit einer Ewigkeit nicht mehr gewesen war.
Christian brachte die Kinder immer abends um sieben. Kri stand schon am Fenster, als er in zweiter Spur hielt. Sie läuteten. Anscheinend hatte Jens die Schlüssel vergessen. Kri öffnete ihnen und ging zum Fenster zurück. Christian stand neben seinem Wagen und winkte Jens und Jolanda hinterher. Er sah gut aus. Trotz der Glatze merkte man ihm die fünfundvierzig nicht an. Auf dem Beifahrersitz entdeckte Kri Laras Knie und den Saum ihres Rocks und zog den Vorhang zu. Dann hörte sie schon die Kinder im Vorzimmer.
»Und, wie war es?«, fragte sie.
»No comment«, sagte Jens und ging, ohne Kri anzusehen, in sein Zimmer. Dafür fiel ihr Jolanda um den Hals. Mit ihren Dreizehn war sie nur zwei Jahre jünger als ihr Bruder, aber die machten den großen Unterschied.
»Alles okay?«, fragte Kri.
»War ganz schön. Minus den komischen Momenten halt«, sagte Jolanda.
Jens und Jolanda und der Abend vor mehr als fünfzehn Jahren: Als Kri bemerkte, dass sie schwanger war, als Christian sie ansah wie eine fremde Küste und als sie gemeinsam, stolz wie Seefahrer, stundenlang Namen überlegten für ihre Entdeckung. Die halbe Nacht hatten sie sich damit um die Ohren geschlagen, seitenlange Listen mit den Namen von Heldinnen, Göttern und heiligen Bäumen anzulegen und sie ihrem ungeborenen Kind anzuprobieren. Ihre Favoriten hatten sie sich schließlich ein Dutzend Mal laut vorgesagt, um zu hören, ob sie sich abnutzten. Sie hatten sich entschieden, gerade als die Sonne aufging, und ihre Wahl niemals bereut. Anders als ihre Ehe hatten die Namen ihrer Kinder gehalten.
»Und bei dir?«, fragte Jolanda.
»Ich bin gestern beim Einkaufen zufällig einem alten Schulkollegen über den Weg gelaufen und habe ans Meer denken müssen«, sagte Kri.
»An Ägypten?«, fragte Jolanda mit belegter Stimme, und Kri nickte.
»Das war meine allerschönste Reise überhaupt«, sagte Jolanda, und Kri merkte, wie ihr die Augen feucht wurden. Sie ging ins Bad, wusch sich das Gesicht kalt ab, und als sie sich wieder gefangen hatte, drückte sie die Klospülung und rief hinaus, ob Jolanda noch etwas essen wolle.
Als die Kinder schliefen, fragte Kri Wikipedia nach Kraken und Tintenfischen, nach Oktopussen und Kopffüßern. Sie klickte sich in alle Richtungen und dann auch in die Tiefe, bis sie bei Fachartikeln landete, von denen sie kein Wort mehr verstand. Es war fast Mitternacht, als sie ihren Computer hinunterfuhr und ins Bad ging. Gleich darauf kam sie aber, die Zahnbürste im Mund, an den Tisch zurück, klappte den Laptop wieder auf, sah im schwarzen Bildschirm ihr Gesicht widergespiegelt, kleine Augen und Schaum vor dem Mund, dann breitete der Browser schon seine weiten Arme aus, und Kri gab den Namen des Aquariums ein und schrieb die Öffnungszeiten ab.
Rechts ging es zum Amazonas-Delta, links zum Roten Meer. Am großen Becken mit den Haien und Rochen drängelte sich eine Schulklasse. Drei Kinder rangelten um eine Kappe, und Kri musste an die Prügeleien der Buben denken und wie Alf sich abseits gehalten und im Gras seine Käfer hatte krabbeln lassen.
»Pass auf, dass du nicht gebissen wirst, Spiderman«, hatten ihre Freundinnen gerufen, und sie hatte breit, aber stumm mitgelacht, so dass Alf, der mit dem Rücken zu ihr saß, ihr Lachen nicht hören konnte.
Ein Sandhai starrte leer ins Leere, und Kri fiel das alte Werlacht-zuerst-Spiel ein. Sie war gut darin gewesen. Sehr gut sogar. Wenn sie nicht wollte, konnte sie keiner zum Lachen bringen. Hin und wieder ließ sie aber doch einen gewinnen, weil sie gerne sah, wie ihr Lachen wirkte, wie sie gewann, auch wenn sie verlor.
Kri waren die Blicke der anderen immer bewusst gewesen. Selten, dass man sie einmal aus den Augen ließ. Irgendeinen gab es immer, der sie unverhohlen oder verstohlen anstarrte. Alf hatten sie zwar immer wieder mit ihren Blicken unten am Boden, wo er mit seinen Käfern saß, festgenagelt, dann aber auch wieder für Stunden völlig ignoriert. Was für ein anderes Leben das war, dachte Kri, wenn man nicht die ganze Zeit über beobachtet wurde. Welch andere Beweglichkeit man da entwickeln konnte und wie viel Platz man für sich hatte.
Im Roten-Meer-Becken knabberten drei gelb und blau schimmernde Papageienfische an einem Korallenstock, und Kri versetzte es einen Stich. Genau solche hatte sie damals beim Schnorcheln gesehen und sich gewundert, wie gut man dieses knirschende Geräusch unter Wasser hören konnte. Ägypten war ihr letzter gemeinsamer Familienurlaub gewesen, ohne das geringste Anzeichen, dass irgendetwas nicht stimmte. Und dann, kaum dass sie wieder daheim waren – Kri räumte tatsächlich gerade die Koffer aus –, kam Christian zu ihr und gestand ihr seine Affäre mit Lara. Er habe alles versucht die letzten zwei Wochen, sagte er, die ganze Zeit in Ägypten über nicht mit Lara telefoniert und auch versucht, nicht an sie zu denken, aber es gehe einfach nicht mehr. Kri war aus allen Wolken gefallen. Für sie war es der perfekte Urlaub gewesen. Sie und Christian hatten einander beim Schnorcheln die an den Korallen knabbernden Papageienfische gezeigt, sich von der Begeisterung des anderen anstecken lassen und sich sogar geliebt unter Wasser. Ausschließlich unter Wasser, war ihr im Rückblick aufgefallen, versteckt hinter ihren Tauchermasken und ohne sich zu küssen, weil sie die Schnorchel im Mund hatten.
Für sie hatte sich der Ägypten-Urlaub wie der zweite Beginn ihrer Ehe angefühlt und nicht wie ihr Ende. Das Rote Meer war für sie seit damals so etwas wie das Paradies vor dem Sündenfall gewesen. Unter Wasser war die Welt noch in Ordnung. Sobald man aus dem Wasser stieg, war es aus mit dem Leben im Schweben.
In diesem Moment entdeckte Kri den Kraken. Er saß auf dem kiesigen Grund und blickte sie mit großen weisen Augen an. Der Blick erinnerte sie an Gandalf aus den Herr-der-Ringe-Filmen. Ganze Sonntage hatte sie unmittelbar nach der Trennung von Christian mit den Kindern vor dem Fernseher verbracht. Bei zugezogenen Vorhängen eine DVD nach der anderen eingelegt und in dieser Welt mit ihren menschenhohen Farnen und knolligen Trollen, mit den wüsten Orks und dem beruhigenden Blick Gandalfs gelebt, weil es dort nichts gab, was sie an die Wirklichkeit erinnerte. Und der Krake da vor ihr, seine Augen, in denen steckte diese fremde Welt, der sah aus wie ein Botschafter aus Mittelerde, das erste Tier, von dem Kri wissen wollte, was es dachte.
Mit einem Mal kam Bewegung in den Kraken. Er drehte sich um die eigene Achse und schwamm mit raschen Stoßbewegungen seiner acht Arme in Richtung Wasseroberfläche davon. Kri kauerte sich hin, um dem Tier unter einem Korallenstock hindurch hinter-hersehen zu können. Schemenhaft war dort oben ein Mensch zu erkennen. Jetzt streckte er die Arme ins Wasser, und der Krake spürte nach ihnen, umschlang sie und saugte sich an ihnen fest. Die Umstehenden bekamen davon nichts mit, nur die am Boden hockende Kri wurde Zeugin dieser berührenden Berührung, dieser Begegnung der zweiten oder dritten Art, diesem Fenster zum Roten Meer in ihr.
Schiffbruch
Flo nennt Martha eine Hexe. Nicht boshaft, er hat dabei immer ein Grinsen auf den Lippen. Trotzdem merkt man, dass sie ihm nicht ganz geheuer ist. Martha putzt seit drei Jahren bei uns, kommt jeden Mittwoch für fünf Stunden. Deshalb laden wir Gäste auch meist für Mittwochabend ein, wenn die Wohnung aussieht wie aus einem Lifestyle-Magazin. Egal wer uns besucht, jedem fällt auf, wie alles glänzt, und wir schwärmen dann von Martha, und Flo bringt seinen Spruch mit der Hexe an. Das macht unsere Gäste natürlich neugierig, und Flo lässt es sich dann auch nicht nehmen, die eine oder andere Anekdote über Martha zu erzählen. Was immer für gute Stimmung sorgt. Oft fragen unsere Freunde, ob wir ihnen Martha nicht weitervermitteln könnten, aber ich sage dann jedes Mal, sie sei völlig ausgelastet, weil ich gar nicht daran denke, eine Perle wie Martha mit anderen zu teilen. Dass ihr in regelmäßigen Abständen Dinge zu Bruch gehen, stört uns nicht weiter. Das macht sie nur noch schrulliger, und Flo ist ziemlich gut darin, ihre kleinen Missgeschicke mit witzigen Pointen zu versehen und so zum Besten zu geben.
Martha kommt aus Rumänien, glaube ich, oder aus der Ukraine, irgendwas im Osten, und sie sieht aus, als sei sie schon immer alt gewesen. Sie spricht auch ein ziemlich seltsames Deutsch mit verschachtelten Sätzen, in denen immer wieder Wörter auftauchen, die bei uns niemand mehr sagen würde. Ähnlich ist es auch mit ihrem Gewand. Martha trägt immer dasselbe Kleid, das mich an alte Märchenbücher erinnert. Großmütter oder Marktfrauen haben dort solche Kittel an, aus einem Stoff so dick und fest, als müsste er ewig halten, und einem Muster wie ein alter Couch-Bezug. Als ich Martha einmal nach ihrem Kleid fragte, erzählte sie mir, dass es von ihrer Mutter stammte.
»Sie ist gestorben in diesem Kleid«, sagte Martha, und dabei zog sie das O in die Länge und rollte das R, dass es sich anhörte, als würde sie gerade die Totenrede auf ihre Mutter halten. Als Flo von der Arbeit kam, erzählte ich ihm von Marthas Kleid, und als wir später mit unseren Gästen beim Abendessen saßen, baute er die Anekdote prompt in seine Hexengeschichte über Martha ein. Ich lachte zwar mit, es störte mich aber, dass er sich in so einer Sache über Martha lustig machte. Trotzdem sagte ich nichts, auch später nicht, als wir beide im Bett lagen und beschwipst darüber kicherten, dass Martha der Wasserkocher heruntergefallen war.
Dass Flo Martha eine Hexe nennt, geht auf die Sache mit Mias Warzen zurück. Als Mia sechs war, sind die plötzlich aufgetaucht, erst nur an ihren Füßen, dann auch auf ihren Handrücken. Wir haben alles Mögliche versucht, sind zu sicherlich fünf Hautärzten gegangen, die ihr die unterschiedlichsten Salben verschrieben haben, und sogar zu einem chinesischen Heiler, der für sie einen Kräutertee zusammengestellt hat. Vier Wochen lang mussten wir sie überreden, diese schreckliche Brühe zu trinken, die so ekelhaft roch, dass ich mir beim Kochen die Nase zuhalten musste. Half alles nichts. Irgendwann erwähnte ich eher nebenbei Martha gegenüber Mias Warzen. Sie überlegte kurz und sagte dann, dass sie in der folgenden Woche ausnahmsweise am Donnerstag kommen würde. Als ich sie fragte warum, sagte Martha nur: »Vollmond«, mit zwei langgezogenen Os.
Am folgenden Donnerstag richtete Martha sich ihre Zeit so ein, dass sie mit dem Putzen fertig war, als Mia aus der Schule kam. Wir aßen gemeinsam zu Mittag, doch danach meinte Martha, ich solle jetzt gehen, einkaufen oder einen Kaffee trinken. Ich sah fragend zu Mia hinüber, doch die setzte ihren Mama-sei-jetzt-bitte-nicht-peinlich-Blick auf, und so ließ ich die beiden eben allein. Als ich eineinhalb Stunden später nach Hause kam, sah ich von der Straße aus, dass Martha alle Vorhänge zugezogen hatte. Sie war nicht mehr da, dafür klebte an Mias Zimmertür ein Zettel, auf dem in schnörkeliger Handschrift stand: Muss schlafen, nicht aufwecken. Mias Tür quietscht leicht, deshalb traute ich mich nicht, zu ihr hineinzugehen, und warf nur einen Blick durchs Schlüsselloch. Es war aber völlig dunkel und ich konnte nichts erkennen. Als Flo aus der Arbeit kam, schlief Mia immer noch. Flo tat ganz entspannt und setzte sich mit der Zeitung ins Wohnzimmer, ich sah aber, wie nervös er war, weil er mehr raschelte und blätterte als zu lesen. Dann hielt er es nicht mehr aus, legte die Zeitung weg und stand auf. Ich folgte ihm, als er leise die Tür aufdrückte und in Mias Zimmer schlich. Es roch nach Wald und Wiese und auch ein wenig streng nach Erde und Pilzen. Mia lag wie aufgebahrt in ihrem Bett, die Hände und Füße in weiße Baumwolltücher gewickelt, das Gesicht etwas blass, kam mir vor, aber mit einem seligen Lächeln auf den Lippen. Flo hielt seine Hand nah an ihren Mund und nickte dann langsam. Ich tippte ihn an, und leise schlichen wir wieder hinaus. Am nächsten Morgen weckte uns Mia kurz nach sechs. Mit einem triumphierenden Ta-ta-ta-ta stand sie in der Tür unseres Schlafzimmers und hielt ihre warzenfreien Hände in die Luft.
Das ist jetzt auch schon wieder ein Jahr her. Ein Jahr, in dem nicht viel passiert ist, bis ich vor drei Wochen in einer Zeitschrift die Anzeige für einen Zeichenkurs entdeckte. Plötzlich hatte ich aus dem Nichts heraus so ein Glücksgefühl, in meinen Fingern begann es zu kribbeln und ich erinnerte mich an Buntstifte und Blumenwiesen, an zitronengelbe Sonnenstrahlen und Prinzessinnen in langen Kleidern. Im Kurs nahm das Kribbeln in den Fingern noch zu, und dann noch einmal, als mir Walt, unser Lehrer, die Hand führte.
Wir treffen uns immer in seiner Wohnung, die gleichzeitig auch sein Atelier ist. Allein die Atmosphäre dort: die Leinwände, die an der Wand lehnen, der Geruch der Ölfarben und die struppigen Pinsel in den alten Marmeladegläsern. Besonders erfolgreich ist er nicht, aber selbst das finde ich speziell, wie er trotzdem weitermacht mit der Kunst. Ich könnte so nicht leben, aber ein Ausflug in diese Welt ist wie ein Abenteuerurlaub. Außerdem mag ich Sex am Morgen. Ich gehe dann ganz anders in den Tag. Viel euphorischer als sonst, angepisst von nichts, neugierig auf alles. Mit Flo kann ich nur abends schlafen, weil Mia am Morgen in die Schule muss. Allzu viel ist bei uns also allzu oft nicht los.
Bei Walt kommt dazu, dass er im Bett so ganz anders ist, wobei ich jetzt gar nicht genau sagen könnte wie. Es ist nicht so, dass er ungewöhnliche Spielchen vorschlagen oder Handschellen aus der Nachttischschublade ziehen würde, nein, es ist eher die Art, wie er mich berührt oder eher noch, wo er mich wann berührt: Seine Finger sind jedenfalls nie dort, wo ich sie gerade erwarte.
Mir ist es jetzt auch schon ein paar Mal passiert, dass ich mich vor dem Sex beim Blick auf eines von Walts Bildern gefragt habe, was das sein soll, und als ich danach auf dem Weg ins Bad wieder daran vorbeigekommen bin, plötzlich etwas erkannt habe. Ich sehe das schon als ein Zeichen dafür, dass diese Affäre gut für meine persönliche Entwicklung ist.
Seinen Künstlernamen Walt finde ich übrigens ziemlich peinlich, auf den legt er aber großen Wert. Einmal habe ich mittendrin aus Versehen Walter zu ihm gesagt, und da ist ihm alles eingeschlafen und er ist hinausgegangen auf seinen winzigen Balkon und hat dort eine geraucht, während ich dagelegen bin und nicht gewusst habe, wie mir geschieht.
Ich hatte einen tollen Job, bis ich schwanger wurde. Sekretärin bei einer japanischen Firma. Habe ihre Wien-Niederlassung quasi im Alleingang gemanagt. Von den Japanern konnte ja keiner Deutsch, und ihr Englisch hat außer mir kaum jemand verstanden. Auf jeden Fall ist die Firma während meiner Karenz pleitegegangen, und ein gleichwertiger Job war nicht mehr zu finden. Dass ich einfach irgendetwas mache, ist nicht infrage gekommen, da waren Flo und ich uns einig, und dass ich jetzt daheim bin und er sich um nichts kümmern muss, ist ihm auch ganz angenehm, kommt mir vor. Weil ja auch immer etwas zu tun ist: Anfangs überhaupt, als Mia noch klein war. Da habe ich mir eingebildet, ich muss nebenher auch noch die Wohnung neu einrichten. Als Mia in die Schule kam, ging es dann leichter. Endlich wieder Zeit für mich, Joggen, Yoga, Bauch-Beine-Po. War ein hartes Stück Arbeit, bis ich wieder ausgesehen habe wie vor der Schwangerschaft. Danach habe ich alles Mögliche ausprobiert, ein halbes Jahr Interior Design, einen zweiwöchigen Kochkurs, Fusion-Kitchen zwischen Thailand und Orient und dann endlich die Idee mit dem Zeichnen. Kunst war ja eigentlich schon immer meins, keine Ahnung, warum ich da nicht früher draufgekommen bin. Als ob man die Dinge, die einem wirklich wichtig sind, so gut in sich verstecken würde, dass man sie irgendwann nicht mehr wiederfindet. Der Zeichenkurs hat mir jedenfalls eine Tür geöffnet: Ich gehe jetzt in Ausstellungen, kaufe mir Bildbände und bin viel ausgeglichener. Und mit Flo läuft es auch gut. Mir kommt es vor, als wirkte ich wieder mehr auf ihn. Richtig verliebt sieht er mich manchmal an, so wie damals, als wir uns kennengelernt haben. Deshalb hält sich mein schlechtes Gewissen auch in Grenzen.
Und dann der letzte Mittwoch: Gleich beim Reinkommen hat mich Martha zweimal angesehen. Das erste Mal, ganz wie immer, begleitet von ihrem freundlich gerollten und entspannt langgezogenen »Grüß Sie Gott, Frau Dio«, dann aber gleich noch einmal, als hätte sie in meinem Gesicht etwas entdeckt. Und Marthas Blick ist einer, der nicht auf deiner Haut endet, sondern Röntgenstrahlen aussendet, die dich durchleuchten. Wie immer, wenn ich nervös bin, habe ich begonnen, mir mit den Fingern über mein Muttermal am Hals zu fahren, und da beginnt Martha auch noch so wissend mit dem Kopf zu nicken. Und später, als ausnahmsweise einmal mir ein Glas zerbrochen ist, hat sie beim Aufkehren irgendetwas in sich hineingemurmelt. An dem Abend habe ich mit Flo geschlafen und mich anschließend in seine Armbeuge gekuschelt.
»Martha wird mir in letzter Zeit unheimlich«, habe ich zu ihm gesagt, und er hat mich mit verschlafener Stimme gefragt, was ich meine.
»Als würde irgendetwas nicht stimmen mit ihr«, habe ich gesagt.
»Wir wissen, dass etwas mit ihr nicht stimmt, deshalb mögen wir sie ja so«, hat Flo nur gemeint, ich habe aber nicht locker gelassen.
»Langsam bekomme ich Angst vor ihr«, habe ich gesagt und tief Atem geholt, »und deshalb denke ich, wir sollten mal über eine andere Putzfrau nachdenken.«
Da hat sich Flo plötzlich aufgerichtet und mich groß angesehen.
»Bist du verrückt? Was sollen wir ohne Martha?«
»Es geht hier nicht um eine alte Freundin«, habe ich gleich zurückgeblafft, »sondern um unsere Putzfrau.«
»Martha ist für uns wie eine alte Freundin«, hat Flo daraufhin gemeint, »sie hat Mias Warzen weggezaubert, sie ist eine treue Seele, ehrlich, verlässlich, gründlich, keine Ahnung, wie du auch nur auf die Idee kommen kannst, Martha vor die Tür zu setzen.« Und damit hat er sich umgedreht und geschlafen.
Es gibt eine Sache, die Flo heilig ist und der niemand zu nah kommen darf. Ein Modell der Santa Maria. Das war das Schiff, mit dem Kolumbus Amerika entdeckt hat. Es steht bei uns im Regal. Flos Großvater hat es aus Streichhölzern gebaut. Flo hat seinen Großvater abgöttisch geliebt. Weil seine Eltern wenig Zeit hatten, ist Flo bei ihm aufgewachsen. Bis heute spricht er von ihm wie von einem Heiligen, und das Schiff staubt er jeden Abend eigenhändig ab. Leicht ist es mir nicht gefallen, aber nachdem Martha heute gegangen ist, ist es passiert.
Drei Giraffen
Das glaubst du vorher nicht. Dass dir das Meer einmal zu viel wird. Dass dich das ununterbrochene Heranrollen der Wellen, das dauernde Rauschen der Brandung auch einmal fertigmachen kann. Du stehst bis zu den Knöcheln in der schaumigen Gischt und denkst dir, komm doch mal zur Ruhe! Lass nur eine einzige Welle aus! Schreist es auch laut in die salzige Luft hinaus, weil dich bei dem Lärm, den die Brandung fortwährend macht, ohnehin keiner hören kann. Jetzt rauscht die S-Bahn vor dem Fenster – auch nicht das Gelbe vom Ei. Aber egal. Home is … wo man trotzdem lacht.
Andere ziehen mit Dutzenden Kisten um. Da ist die Wohnung voll, bevor sie beginnen, ihre Sachen auszupacken. Bei mir? Zwei Koffer, und einer davon ist die Gitarre. Heute früh habe ich mir den Spaß gemacht, alles, was ich besitze, in einer Reihe aufzustellen. Bei der Wohnungstür habe ich angefangen. Und bin nicht einmal bis zum Fenster gekommen.
Dann habe ich meine Gitarre aus dem Koffer genommen. Den leeren Koffer hingelegt und danach die Gitarre. So ist es sich ausgegangen bis zum Fenster. Die Gitarre hat ausgesehen, als würde sie ihren Hals Richtung Himmel recken. Sie vermisst die kalifornische Sonne. Ich bin gespannt, wann es bei mir so weit ist. Wann ich bereue, zurückgekommen zu sein.
34 Jahre alt, das Studium abgebrochen, die letzten zehn Jahre in Übersee, U.S.A. und Kanada. Und in dieser Zeit 218 Songs geschrieben. 21,8 Songs pro Jahr, 1,8 Songs im Monat, ungefähr einen halben Song pro Woche. Alle sieben Tage eine Strophe, alle vierzehn Tage einen Refrain. Das ist mein Problem: Dass ich für meine Art zu leben zu gut rechnen kann. Mein Geld reicht noch bis Monatsende.
Was mache ich hier?
Was würde ich dort machen?
Als ich in Kalifornien angekommen bin, habe ich nicht einen Augenblick lang überlegt. Weil im Evangelium nach Uncle Sam klipp und klar steht, dass wer ganz nach oben will, ganz unten anfangen muss. Und da gibt es schließlich nur einen einzigen Job.
Ich habe also Teller gewaschen. In einer Küche ohne richtige Fenster, nur eine Luke gab es, knapp unter der Decke, die sich kippen ließ, mit Blick auf gerade einmal eine Handbreit Himmel.
There is a heaven for everyone.
Wer den ganzen Tag nur einen schmalen Streifen Horizont sieht, lernt ihn zu schätzen. Und auf den Horizont kommt schließlich alles an in Amerika. Der Horizont ist die magische Grenze. Bis zum Horizont sind Schulden, aber zum Glück ist das Land groß genug, dass es dahinter weitergeht. Eigentlich sollte ja ein künstlicher Horizont vor Manhattan im Meer stehen und nicht die Freiheitsstatue. Eine Skulptur des Horizonts vor dem Horizont.
Im Leben eines Tellerwäschers schiebt sich übrigens ein Horizont voller Speisereste vor den Silberstreifen hoch über deinem Kopf. Und auf der anderen Seite endet deine Welt bei der schreienden Stimme deines Bosses.
Und trotzdem hat jeder amerikanische Musiker, der auf sich hält, einmal als Tellerwäscher gearbeitet und in dieser Zeit geniale Songs geschrieben. Zumindest steht das in jeder Musiker-Biografie, die mit A wie Amerika beginnt. Deshalb war ich anfangs auch geduldig und dachte bei den Rauchschwaden in der Küche an den Morgendunst über der San Francisco Bay, und die Erzählungen der Illegalen, die neben mir Teller schrubbten, hörten sich an wie die heiseren Weisheiten der staubigen Straßen. Und was brauchst du mehr als den Glauben an die Landschaft und das Gesetz der Straße, um den perfekten Song zu schreiben. Das dachte ich damals zumindest.
Was dir keiner sagt, was du aber ziemlich schnell merkst: Weil du die ganze Zeit über nasse Finger hast, kannst du deine besten Ideen gar nicht aufschreiben, und dass dir die Seifenlauge die Hornhaut an den Fingerkuppen aufweicht, ist nicht gerade angenehm beim Gitarrespielen. Meinen ersten Song habe ich geschrieben, eine Woche nachdem ich meinen Job als Tellerwäscher hingeschmissen habe.
Ich kenne hier keinen mehr und weiß noch nicht, wie ich das ändern kann. Tim anrufen? Dem ich vielleicht auch noch recht geben muss, weil er damals gekniffen hat und hiergeblieben ist. So weit ist es mit mir noch nicht.
Die letzte Stunde habe ich mir immer wieder eingebildet, dass mein Telefon in der Hosentasche vibriert. Ich habe es jedes Mal herausgezogen, aber da war natürlich nichts. Kein Anruf und auch kein SMS. Kann ja auch gar nicht sein. Es gibt ja niemanden, der weiß, dass ich hier bin, und keinen, der diese Nummer hat. Aber was schert sich die Hoffnung darum, was möglich ist und was nicht.
Natürlich könnte da jemand sein, genauso allein wie ich gerade, der einfach eine bestimmte Zahlenfolge in sein Telefon tippt, und gleich darauf klingelt es bei mir.
Also, interessieren würde es mich schon, wer abhebt, wenn ich mein Geburtsdatum wähle.
Eine Zeit lang habe ich in Portland, Oregon gelebt. Da gab es einen Songwriter, Künstlername Earl Darkgrey, genauso wie der Tee, nur dunkel, mit dem habe ich gespielt. Sein ganzes Gesicht war Bart, und der hat, neben viel Stuss, einmal auch etwas sehr Schönes gesagt. Als wir einmal übers Songschreiben geredet haben, hat er gemeint, dass die Wörter in Gruppen zusammenstehen, während sie darauf warten, dass sie dir einfallen, und dass, wenn du ein Wort denkst, sich die anderen ungefragt anhängen. Und weil Wörter ganz schön fest aneinanderkleben können, braucht es eine gehörige Kraft, um sie zu trennen und nur das zu sagen, was man auch wirklich sagen will. Und das ist der Grund, warum das Songschreiben so anstrengend ist.





























