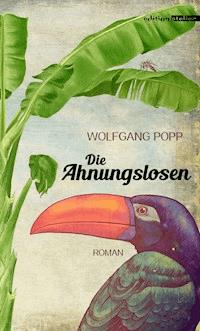Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Atelier
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Fünf Menschen brechen plötzlich alle Kontakte und Zelte in ihrer Heimat ab und beginnen ein neues Leben, in Cambridge, Pompeji und Sri Lanka. Viele Jahre später tauchen sie wieder auf - während die einen zufällig gefunden werden, wenden sich die anderen an die, die sie einst zurückgelassen haben. Wolfgang Popp lässt fünf Erzähler von ihren Wiederbegegnungen mit diesen »Verschwundenen« berichten. Sie versuchen, hinter das Geheimnis ihres plötzlichen Verschwindens zu kommen und machen dabei erstaunliche Entdeckungen sowie die eine oder andere Reise in die Vergangenheit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 297
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wolfgang Popp
DIEVERSCHWUNDENEN
Roman
Inhalt
Alpbacher oder das Mädchen aus der Asche
Felder oder mit dem Rücken zur Welt
Philip oder der Weg ist das Spiel
Heise oder die Sprache unterm Asphalt
Couvier oder von hier bis zur Ewigkeit
»People disappear every day.«
»Every time they leave the room.«
Beruf: Reporter (R: Michelangelo Antonioni)
Alpbacher oder das Mädchen aus der Asche
Ich saß auf der Piazza Torquato Tasso in Sorrent und aß gerade einen Teller Cannelloni al Mascarpone e Ricotta, als ich Alpbacher sah. Auch wenn unsere letzte Begegnung fast zwanzig Jahre zurücklag, war ich mir doch gleich sicher, dass es sich bei dem auf einem schwarzen Waffenrad vorbeifahrenden Mann mit dem weißen Panamahut um meinen ehemaligen Lateinlehrer handelte. Nicht nur war sein Gesicht mit dem sorgfältig gestutzten Schnurrbart seit damals fast unverändert, auch das dunkelbraun karierte Sakko ähnelte auf verblüffende Weise dem, das er im Unterricht immer getragen hatte. Was mir aber letztendlich die Gewissheit gab, Alpbacher vor mir zu haben, war seine Art sich zu bewegen, eine genießerische Langsamkeit, die sich jeder Anstrengung verweigerte.
Ich verdiente mein Geld als Hotelkritiker. Schon gut acht Jahre ging ich dieser Beschäftigung nach und war in dieser Zeit fast ununterbrochen unterwegs gewesen. Dass ich einmal drei oder vier Tage an demselben Ort verbrachte, geschah nur selten. Meine Bekannten beneideten mich darum, derart viel in der Welt herumzukommen, ich hingegen bemerkte, wie mir mein Leben durch die dauernden Ortsveränderungen zunehmend unwirklich wurde. Oft brauchte ich morgens nach dem Aufwachen einige Momente, bis ich wieder wusste, wo und manchmal auch wer ich war. Letzteres hatte mit Sicherheit auch damit zu tun, dass ich, um unerkannt zu bleiben, unter wechselndem falschen Namen und Beruf reiste.
Alpbacher war mir immer wie der archetypische Einzelgänger vorgekommen. Wäre er ein Gebäude gewesen, dann eine freistehende Kathedrale. Genauso wirkte er auch auf seine Umgebung. Allein seine Anwesenheit gebot Ruhe, und so ausgelassen die Pausenstimmung auch gewesen sein mochte, sobald Alpbacher den Klassenraum betrat, wurde es augenblicklich still. Niemals musste er sich durch ein lautes Wort oder die Androhung von Strafen Respekt verschaffen. Es reichte sein Gesichtsausdruck, der uns Schüler ernst nahm, schon Jahre bevor wir uns selbst ernst nehmen konnten.
Meinen richtigen Namen trug ich nur mehr auf dem Weg von einem Hotel zum nächsten, befreit von der eigentlich kindischen Geheimniskrämerei um meine wahre Identität. Immer wichtiger wurden mir daher diese Zeiten unterwegs, und um sie möglichst lang auszudehnen, nahm ich, wann immer es die Entfernungen erlaubten, nicht den Flieger, sondern die Eisenbahn, in diesem Fall den Nachtzug nach Neapel. Oft ergaben sich unterwegs erstaunliche Gespräche. Keiner tauscht sich so offen aus, bemerkte ich erstaunt, wie zwei Fremde im Schutz ihrer Fremdheit. So hoffte ich, dass sich vielleicht auch im Nachtzug nach Neapel vor dem Einschlafen noch das eine oder andere Gespräch ergeben würde, doch als ich dann meine Mitreisenden sah, war keiner dabei, mit dem ich reden wollte, und ihnen schien es nicht anders zu gehen, alle löschten sie schon bald ihre Lichter, zwei von ihnen sogar ohne ein Gute Nacht. Dann atmete einer meiner Bettnachbarn auch noch keuchend und mit langen Unterbrechungen, was auf eine merkwürdige Weise ansteckend wirkte, sodass ich selbst bald das Gefühl hatte, nur schwer Luft zu bekommen. So schlimm wurde mir die Atemnot schließlich, dass ich aufstehen musste und hinausgehen auf den Gang, wo ich dann den Rest der Nacht unruhig vor mich hindösend auf einem Klappsessel verbrachte und in einer langgezogenen Linkskurve fast auf den Boden gerutscht wäre.
Um fünf Uhr morgens erreichten wir Neapel, und ich überbrückte die Wartezeit auf den Anschlusszug nach Sorrent – es ging um eine knappe Stunde – im bereits geöffneten Bahnhofscafé. Um mich auf den Beinen zu halten, trank ich zwei Espresso und danach noch einen Cappuccino, sodass mir, als ich wieder im Zug saß und die Amalfiküste entlangfuhr, die Hände zitterten. Kurz vor acht kam ich in meinem Hotel an und hätte dort sofort mein Zimmer beziehen können, was ich auch positiv in meinen Aufzeichnungen bemerkte, nur war ich von dem Kaffee so aufgeputscht, dass an Schlaf nicht zu denken war. Ebenso wenig war ich aber in der Lage, einen klaren Gedanken zu fassen. In diesem flirrenden und zugleich tranceartigen Zustand wanderte ich ziellos durch Sorrent, entdeckte auf dem Markt männerfaustgroße Zitronen, und in meinem Reiseführer las ich, dass hier vor der Küste die Sirenen einst ihre unendlich verführerischen und deshalb verhängnisvollen Lieder gesungen hatten.
Seit Alpbachers plötzlichem Fortgang vor knapp zwanzig Jahren hatte ich mir immer wieder gewünscht, ihn wiederzutreffen, und sogar einige, allerdings nur halbherzige und deshalb auch nicht von Erfolg gekrönte Versuche unternommen, etwas über seinen Aufenthaltsort herauszufinden, denn er hatte damals nicht nur seinen Lehrerposten gekündigt, sondern war auch aus Wien weggezogen. Als Alpbacher auf der Piazza Torquato Tasso an mir vorbeiradelte, aus der Richtung des Bahnhofs kommend und anschließend in die Via della Pietà mit ihren mittelalterlichen Wohnhäusern einbiegend, war ich jedoch durch sein plötzliches Auftauchen zu überrascht, um reagieren zu können. Als ich wieder in der Lage gewesen wäre, ihn auf mich aufmerksam zu machen, war er bereits zu weit weg und gleich darauf um eine Straßenecke verschwunden.
Anna wechselte in der sechsten Schulstufe in unsere Klasse. Am auffallendsten war ihre Unscheinbarkeit, die beinahe an Unsichtbarkeit grenzte. Anna gehörte zu den Menschen, die im Café eine Ewigkeit an ihrem Tisch saßen, ohne vom Kellner bemerkt zu werden. Ihre Haut war auch im Hochsommer von einer Blässe, die an eine frisch geweißte Wand denken ließ. Gerahmt wurde ihr wandfarbenes Gesicht von einem pechschwarzen Pagenkopf. Annas Stimme war ähnlich unscheinbar wie ihr Aussehen. Häufig wusste ich nicht, ob sie gerade etwas gesagt oder ob ich mir das nur eingebildet hatte. Sie trug ausschließlich Kleider, die grau waren oder beige oder die Farbe von Eierschalen hatten. Ich hätte damals nicht sagen können, ob mir Anna gefiel. Dafür war zu wenig von ihr da.
Bei Alpbacher bewirkte ihr Auftauchen jedoch eine seltsame Wandlung. Mir fiel auf, dass er nach dem Unterricht immer wieder auf sie zuging und sie in Gespräche verwickelte, in den Stunden wirkte er manchmal mit den Gedanken woanders, und seine überwältigende innere Ruhe war dünn geworden und durchscheinend. Hin und wieder kam es jetzt vor, dass Unruhe herrschte in der Klasse.
Für mich stand damals auf der Piazza Torquato Tasso fest, dass ich Sorrent nicht verlassen würde, bevor ich nicht mit Alpbacher gesprochen hatte. Wie er an mir vorbeigeradelt war, das hatte etwas Gewohnheitsmäßiges gehabt, und so nahm ich an, dass er mit der Stadt vertraut war, ja wahrscheinlich seit geraumer Zeit hier lebte. Möglicherweise hatte er sich auf dem täglichen Heimweg befunden und würde auch morgen wieder hier vorbeikommen, auch weil die Piazza Torquato Tasso wie ein Nadelöhr mitten in Sorrent lag, die einzige wesentliche Verbindung zwischen der Neustadt im Osten und der Altstadt im Westen.
Etwa ein halbes Jahr nach Annas Wechsel in unsere Klasse verkündete Alpbacher am Ende einer Lateinstunde ganz überraschend seinen Abschied von der Schule. Mit dem heutigen Tag, so Alpbacher damals, werde er nicht nur unserem Gymnasium, sondern dem Lehrberuf überhaupt den Rücken kehren. So tragisch ich damals seinen Weggang empfand, wirkte die Entscheidung auf mich doch folgerichtig, da Alpbacher, als er diese Ankündigung machte, wieder seine frühere Ruhe ausstrahlte.
Ich legte mich früh hin an diesem ersten Abend in Sorrent und schlief so tief wie schon lange nicht mehr. Beim Aufwachen am nächsten Morgen wusste ich auch gleich, wo ich mich befand. Ich trat ans Fenster und sah hinaus aufs Meer und hinüber zu dem Felsen, von dem aus die Sirenen der Legende nach die Menschen mit ihrem Gesang in Wahnsinn und Tod getrieben hatten. Ich machte noch zwei, drei kurze Notizen die ruhige Lage des Hotels und den schönen Ausblick aus den Zimmern betreffend, dann fiel mir Alpbacher wieder ein und ich wurde ungeduldig, sodass ich gleich nach einem hastigen Frühstück die wenigen Schritte zur Piazza Torquato Tasso hinüberging.
Denke ich an meine Schulzeit, dann fällt mir zuallererst immer die Lateinstunde ein, in der Alpbacher mit einem verschmitzten Grinsen das Klassenzimmer betreten hatte. Heute, meine Damen und Herren, so begann Alpbacher, der uns als einziger Lehrer ausschließlich mit Sie ansprach, damals voller Genugtuung, und ich hatte seine Stimme auf der Piazza Torquato Tasso noch ganz genau im Ohr, so wie ich sie auch heute wieder ganz genau im Ohr habe, heute, meinte Alpbacher also, geht es um Epikur, und das ist so ganz das Meine. Dabei hatte er spitzbübisch geschmunzelt, so als wäre Epikur kein toter Philosoph, sondern ein alter Freund, mit dem er den gestrigen Abend verbracht und dabei einiges getrunken hatte.
Bei Anna war mir von Anfang an aufgefallen, dass sie beim Sprechen überhaupt nicht gestikulierte und auch ihr Gesicht kaum mimische Regungen erkennen ließ, sodass ich häufig das Gefühl hatte, sie merke gar nicht, wenn sie etwas sagte. Ihre Worte schienen aus dem Nirgendwo zu kommen, was ihnen aber eine seltsame Gültigkeit verlieh. Dabei war ihre Stimme ganz dünn und erinnerte mich nicht nur einmal an das Flüstern aus der Zeit gefallener Geister in Horrorfilmen.
Von halb zehn Uhr vormittags an saß ich auf meinem Platz im Gastgarten der Trattoria mitten auf der Piazza Torquato Tasso. Ein mitgenommener Hotelprospekt lag aufgeschlagen vor mir, ich las aber nicht einen einzigen Absatz daraus. Stattdessen ließ ich den Blick die ganze Zeit über wandern, vom einen Ende der Piazza zum anderen, immer bereit aufzuspringen, sobald ich den in der Sonne schneeweiß glänzenden Panamahut Alpbachers entdeckte. Es war schließlich später Nachmittag, als Alpbacher tatsächlich, genauso wie gestern, mit dem Rad auf mich zukam. Ihn durch Rufen und Winken auf mich aufmerksam zu machen, kam mir unpassend vor, hatte Alpbacher doch immer seine Abneigung gegen alles Schrille und Schnelle bekundet und als Beispielwort für die a-Deklination mit Vorliebe die Dezenz herangezogen. Decentia, decentiae, decentiae, decentiam, decentia, decentiae, decentiarum, decentiis, decentias, decentiis, spulte es die Wortfolge nicht nur augenblicklich in meiner Erinnerung ab, die Melodie blieb mir auch wie ein Ohrwurm im Kopf, während ich aufstand von meinem Tisch und einen Schritt machte hin zum Straßenrand, sodass Alpbacher unmittelbar an mir vorbeifahren musste. Zaghaft hob ich die Hand, ohne große Hoffnung allerdings, dass er mich erkennen würde. Er erwiderte jedoch meinen Blick und bremste sein Fahrrad ab, sodass es unmittelbar vor mir ausrollte.
Lechner, sagte er mit ruhiger Stimme und einem Lächeln, eine Überraschung.
Ich war mir nicht sicher, ob er sich freute, mich zu sehen, jedenfalls schien ihn mein plötzliches Auftauchen nicht zu stören, auch wenn er mir nicht die Hand reichte, sondern sie die ganze Zeit über auf der Lenkstange seines Fahrrads behielt.
Ein Zufall, Lechner, oder haben Sie eine Frage?, so Alpbacher lächelnd, und obwohl ich auf die vierzig zuging und er Mitte sechzig sein musste, fühlte ich mich in dem Moment wieder wie bei einer Prüfung in der Schule, nervös, nicht etwa, weil ich Angst vor einer schlechten Note hatte, sondern davor, Alpbacher zu enttäuschen.
Alpbacher konnte nicht umhin, in seinen Stunden regelmäßig die Gegenwart und vor allem den von ihm zutiefst verabscheuten Zeitgeist zu kommentieren. Einmal war es eine Fernsehshow, auf die er am Vorabend zufällig gestoßen war, die ihn zu einer Tirade veranlasste. Am sporadischen Blödsein, sagte Alpbacher damals, ist ja nichts auszusetzen. Bei einem blöden oder absurden Gedanken handelt es sich ja häufig um eine ganz willkommene Abwechslung, und dessen Herstellung kostet den Geist wahrscheinlich genauso viel Energie wie das Hervorbringen eines ernsten Gedankens. Leider werden aber blöde Gedanken kaum mehr vereinzelt und für den Eigengebrauch erdacht, sondern rauschen zu Blödheitslawinen geballt über die Köpfe der Massen hinweg. Aus der ursprünglich versteckten Freude am privaten Blödsein ist deshalb ein lautstarkes und geistloses Spektakel geworden. Es scheint der Fluch der Gegenwart zu sein, so Alpbacher damals abschließend, bevor er zum Unterrichtsstoff überwechselte, dass der Mensch nicht mehr allein blöd sein kann.
Ich folgte Alpbacher in eine enge Gasse zu einem unscheinbaren Haus mit grauer Fassade und kleinen Fenstern. Nur eine neben dem Haustor aufgehängte Speisekarte und ein viel zu kleines Schild verrieten, dass sich in dem Gebäude ein kleines Ristorante befand. Alpbacher öffnete das schwere Holztor und ging voran in einen Innenhof, in dem es angenehm kühl war. Die an zwei Seiten fensterlosen Mauern waren fast völlig von Efeu überwuchert, die Tische und Stühle einfache Klappmöbel aus Gusseisen und Holz. Wir setzten uns und Alpbacher ließ eine Karaffe Rotwein bringen.
Auch jetzt aus der Nähe sah er völlig unverändert aus, so als wäre er seit seinem Weggang nicht gealtert. Als ich ihn darauf ansprach, schmunzelte er und nannte dieses Phänomen, mit einem ironischen Unterton in der Stimme, seine Schockstarre. Dabei, sagte Alpbacher, hatte ich mich seit meiner Jugend auf Alterserscheinungen wie graue Haare, Gesichtsfalten oder Altersflecken gefreut, die mir immer wie eine von der Zeit verliehene Auszeichnung, ähnlich der Patina auf Kunstgegenständen, erschienen waren.
Er lächelte spitzbübisch und strich sich dabei genau wie zu Schulzeiten über seinen Schnurrbart, eine Geste, die mich sentimental machte wie schon lange nichts mehr.
Und Lechner, fragte Alpbacher dann, haben Sie noch Kontakt zu Leuten aus Ihrer Klasse? Haben Sie unseren Vorzeige-Intellektuellen Felder einmal wiedergesehen oder seinen Lakaien, der ihm immer ehrerbietig hinterhergehechelt ist?
Sie meinen Schulz?
Richtig, Schulz, sagte Alpbacher, so hat er geheißen, Felders ewiger Schatten.
Auf der Universität habe ich sie ein paar Mal getroffen. Sie haben gemeinsam studiert. Geschichte, glaube ich. Das ist aber lange her.
Und wissen Sie, wie es Anna geht?, fragte mich Alpbacher wie beiläufig, während er mir aus der Rotweinkaraffe einschenkte, den Blick dabei auf mein Glas gerichtet.
Nein, sagte ich, ich habe seit der Matura nichts mehr von ihr gehört.
In diesem Moment kam die alte Besitzerin des Ristorante, und wir bestellten unser Essen. Alpbacher erwähnte Anna an dem Abend nicht mehr, und er ging auch nicht weiter darauf ein, was genau denn seine Schockstarre damals ausgelöst hatte. Stattdessen redete er über Epikur und die Freuden einer guten Mahlzeit.
Auf dem Weg zurück ins Hotel dachte ich, dass Alpbacher in seinem Wissen von der Antike lebte wie andere Menschen in ihren Wohnungen und Straßen. Gerne stellte ich mir vor, dass er fiktive Gespräche führte mit seinem Epikur und den anderen von ihm verehrten antiken Philosophen. Ich hatte das Bild genau vor mir, wie er in einer winzigen Mansarde auf seinem Bett saß und in gepflegtestem Altgriechisch und stilvollstem Latein in den leeren Raum hineinflüsterte. Ich hätte viel dafür gegeben, dabei mithören zu können, denn ich war fest überzeugt, dass hier unwiederbringlich etwas verloren ging, wofür es anderswo nicht annähernd Ersatz gab, ja mir schien sogar, dass sich in diesen fiktiven Gesprächen Lücken schlossen und die Welt vollständig wurde wie nirgendwo sonst.
Alpbacher arbeitete, wie er mir in dem Ristorante erzählte, seit seinem Abschied aus Wien als Historiker im wissenschaftlichen Team von Pompeji. Er habe sich damit einen alten Traum erfüllt, denn die unter der Asche versunkene Stadt habe ihn seit jeher fasziniert. Ich erinnerte mich, dass er im Unterricht jeden Herbst von seinem Sommeraufenthalt in Pompeji geschwärmt und dabei vor allem eine Villa mit einem außergewöhnlichen Fresko erwähnt hatte. Auf dem sei ein Mädchen dargestellt mit einem Blick, wie er ihn noch nirgendwo sonst gesehen habe, erzählte Alpbacher damals. Entrückt und gleichzeitig voller Weisheit, als würde sie Dinge sehen, die außer ihr niemand sonst sehen konnte. Diese Malerei erwähnte Alpbacher jetzt wieder, gut zwanzig Jahre später in dem Ristorante in Sorrent. Und dann meinte er, er würde sie mir gerne zeigen. Da er das Ausgrabungsgelände auch außerhalb der Öffnungszeiten betreten konnte, bot er mir an, früh am nächsten Morgen gemeinsam mit ihm nach Pompeji zu fahren, noch bevor die eintreffenden Besuchermassen es unmöglich machen würden, sich das Fresko in der nötigen Ruhe anzusehen.
Wir trafen uns um fünf Uhr früh im Bahnhofscafé von Sorrent. Im Stehen an der Theke tranken wir unseren Kaffee, ich einen doppelten Espresso und Alpbacher einen Cappuccino, in dessen Milchschaum er immer wieder genüsslich sein Croissant eintauchte. Der Nahverkehrszug der Circumvesuviana-Linie brachte uns in zwanzig Minuten zum Bahnhof Villa dei Misteri, der keine hundert Meter entfernt lag von der Porta Marina, dem Haupteingang zum Ausgrabungsgelände von Pompeji.
Noch im Zug, mit Blick auf den im Morgendunst zu schweben scheinenden Vesuv, erzählte Alpbacher von den Überlebenden des Ausbruchs vor fast zweitausend Jahren, die von ihren Schiffen aus völlig verstört dabei zugesehen hatten, wie ihre Heimatstadt unter den Lavamassen verschwand. Die Menschen hatten Polster auf ihre Köpfe gebunden, zum Schutz vor den Gesteinsbrocken, die auch weit vor der Küste noch vom Himmel regneten. Ihm, so Alpbacher, war es beim Lesen dieser Berichte aber immer vorgekommen, als wollten die Pompejaner sich mit den Polstern nicht vor Verletzungen schützen, sondern damit die Erinnerung an ihre vor ihren Augen verschwindende Heimatstadt in den Köpfen halten.
Wir folgten der ehemaligen Ausfallstraße nach Herculaneum. Die Sonne stieg hinter uns in den Himmel und warf uns auf der menschenleeren Via della Tombe unsere Schatten vor die Füße, und wir gingen ihnen nach ins Schattenreich, denn nach etwa hundert Metern deutete Alpbacher nach rechts und erklärte, dass sich hier der Friedhof der Stadt befunden hatte, bevor die ganze Stadt zum Friedhof geworden war. Alpbacher machte aber keine Anstalten, die antike Nekropole zu betreten, sondern blieb auf der Straße, die sich gleich darauf verzweigte, worauf wir uns nach rechts wandten. Wir gelangten zu einem weitläufigen Gebäudekomplex mit unzähligen Räumen.
Das sei, meinte Alpbacher, die Mysterienvilla, und dann führte er mich ins ehemalige Esszimmer mit dem alle vier Wände umlaufenden Fresko. Hier ist sie, meinte Alpbacher und deutete auf eine ätherische Mädchengestalt, die von einem weißbärtigen alten Mann aus einer im Trompe-l’œil-Stil gemalten Türöffnung heraus beobachtet wurde. Die Darstellung zeigt die feierliche Initiation der jungen Frau, sagte Alpbacher, ihre Aufnahme in den Kreis der Anhänger des Gottes Dionysos. Es war augenscheinlich, warum die Darstellung Alpbacher derart faszinierte. Das blasse Mädchen schien wie nicht von dieser Welt und ihr Gesichtsausdruck wirkte entrückt, als wüsste sie Dinge, die andere nicht einmal ahnten. Wir standen wortlos nebeneinander, und je länger ich die Figur betrachtete, umso mehr erinnerte sie mich an Anna. Dann merkte ich, dass Alpbacher mich beobachtete, und als er auf meinem Gesicht mein stummes Erstaunen entdeckte, nickte er mir zu, so als würden wir jetzt ein Geheimnis teilen.
Ich hatte gehofft, auch noch den Rest des Tages mit Alpbacher verbringen zu können, als wir jedoch am späten Vormittag wieder in Sorrent ankamen, reichte er mir noch in der Bahnhofshalle die Hand und verabschiedete sich von mir. Ich hatte nur noch Zeit, mich für den Ausflug nach Pompeji zu bedanken, bevor Alpbacher sich umdrehte und davonging, eine schwarze Silhouette vor dem gleißend hellen Viereck des Ausgangs.
Zurück in Wien machte ich mich auf die Suche nach Anna. Es war einfacher, als ich gedacht hatte, denn ich fand sie im Internet unter ihrem Mädchennamen. Ich notierte die Nummer, es vergingen dann aber etliche Tage, bevor ich tatsächlich zum Telefon griff und sie anrief. Sie meldete sich nicht mit ihrem Namen, sondern mit einem kurz angebundenen Ja, das verärgert klang, so als wäre sie bei etwas gestört worden. Als sie hörte, wer am Apparat war, fragte sie nicht, was ich wolle, sondern schwieg und wartete darauf, dass ich weitersprach. Ein wenig über die alten Zeiten plaudern, sagte ich bemüht beiläufig, und dann meinte ich noch, als wäre es mir gerade eben eingefallen, dass ich zufällig Alpbacher wiedergesehen hätte. Sie schwieg, dann hörte ich, wie sie mehrmals Atem holte, so als wolle sie etwas sagen, es kam aber nichts. Schließlich schlug sie ein Treffen vor, noch für denselben Nachmittag.
Ich machte eine Runde durch das Café, ohne Anna zu entdecken, und setzte mich schließlich an einen Tisch am Fenster, von dem aus ich den Eingang im Blick hatte. Kaum dass ich saß, trat jemand von hinten zu mir. Es war Anna, die schon im Lokal gewesen sein musste. Dass sie mir nicht aufgefallen war, hatte aber nichts mit ihrer früheren Unscheinbarkeit zu tun. Anna hatte sich völlig verändert, und von ihrem ätherischen Wesen war nichts mehr zu bemerken. Ihre Haut war grobporig und glänzte ungesund, ihr Gesicht zeigte die ersten Falten, und die Haare hatte sie kurz geschnitten und rot gefärbt, was ihr überhaupt nicht stand. Zwischen den Fingern, die gelb waren vom Nikotin, hielt sie eine Zigarette. Es war offensichtlich, dass sie zu viel rauchte und zu wenig schlief.
Auf meine Frage, was sie so mache, gab sie nur zurückhaltende Antworten. Dass sie viel unterwegs und im Musikgeschäft tätig sei, sagte sie. Nein, sie sei keine Musikerin, sie könne weder singen noch spiele sie ein Instrument. Als ich sie drauf ansprach, dass sie in der Schule ganz hervorragend Klavier gespielt habe, winkte sie ab, nahm einen Schluck von ihrem kleinen Bier und sagte, das sei vorbei. Schließlich erzählte sie, dass sie mit Musikgruppen auf Tour gehe und verantwortlich sei für Aufbau und Tontechnik, und da fielen mir auch die Kratzer auf ihren Handrücken auf und wie rau ihre Finger waren. Sie sagte, sie liebe es zuzupacken, und ich glaubte ihr kein Wort.
Dann fragte sie mich nach meinem Beruf, es klang aber wie eine Floskel. Als ich ihr sagte, dass ich als Hotelkritiker mein Geld verdiente, meinte sie, das sehe mir ähnlich und dass ich mich seit der Schulzeit gar nicht verändert habe, und ich wusste, dass sie es abschätzig meinte.
Schließlich begann ich zu erzählen, von meiner Italienreise und wie ich in Sorrent Alpbacher getroffen hatte, und so sehr sie sich bisher bemüht hatte, teilnahmslos zu wirken, bekam ihre Ruhe jetzt Sprünge wie eingetrocknetes Make-up nach einer durchgemachten Nacht. Ich sah Anna an, dass sie plötzlich nicht mehr wusste, wohin mit ihren Gedanken. Ich fürchtete schon, sie würde aufstehen und sich davonmachen, sie blieb aber sitzen und fitzelte sich abstehende Haut vom Rand ihres Zeigefingernagels, und dann begann sie mit gänzlich veränderter Stimme zu erzählen, einer Stimme, die mich zum ersten Mal an die frühere Anna erinnerte.
Sie sprach von den Blicken Alpbachers und dem darin liegenden Staunen.
Ein leidenschaftliches Interesse, sagte Anna, aber frei von jedem Begehren. Immer wieder suchte er das Gespräch mit mir, stellte dann aber kaum Fragen, sondern wartete meist ab, dass ich von mir aus zu reden begann. Oft standen wir uns deshalb schweigend gegenüber, und dabei kam es mir nicht nur einmal so vor, als würde er in mir jemand anderen sehen. Jemand, der ich nicht war oder noch nicht war, als gäbe es ein verstecktes Wesen in mir, das geweckt werden müsse.
Ich kann Alpbacher jedoch nichts vorwerfen, denn er hat sich mir gegenüber immer völlig korrekt verhalten. Nichtsdestotrotz hat mich sein Blick aber nicht mehr losgelassen, so Anna abschließend. Diese stumme Forderung, zu sein, was er in mir gesehen hat, dieses rätselhafte Wesen, von dem ich nichts wusste, das aber irgendwo in mir schlummern musste, war gleichzeitig Fluch und Versprechen. Einerseits wollte ich wie jede andere Jugendliche auch mich selbst entdecken, andererseits war ich natürlich neugierig auf dieses unbekannte Wesen in mir und hatte außerdem das ungute Gefühl, dass mein eigener Lebensentwurf niemals heranreichen würde an die Vorstellungen, die Alpbacher von mir hatte. Und auch die Männer, denen ich von da an begegnete und die ich hätte lieben wollen: Ihre Blicke kamen nicht heran an die Blicke von Alpbacher. Was sie in mir sahen, kannte ich schon längst. Zumindest kam mir das so vor.
Die Worte waren nur so aus Anna herausgesprudelt wie etwas, das schon die längste Zeit den Weg ins Freie gesucht hatte. Jetzt schien ihr bewusst zu werden, dass sie ihr wahrscheinlich größtes und intimstes Geheimnis gerade mir erzählt hatte, einem ehemaligen Klassenkollegen, von dem sie nie besonders viel gehalten hatte.
Gleich darauf stand Anna auf und ging aufs Klo. Als sie zehn Minuten später nicht wieder zurück war, zahlte ich und verließ das Lokal. Ich schlief schlecht in dieser Nacht und schreckte frühmorgens auf aus einem Traum. Anna war darin vor dem Fresko im Esszimmer der Mysterienvilla gestanden und hatte mit einem Schraubenzieher dem blassen Mädchen Stück für Stück das Gesicht weggekratzt. Der weißbärtige Alte war in meinem Traum zu Alpbacher geworden. Er beobachtete Anna, bis sie ihr Werk vollendet hatte, und verschwand dann rückwärts im Dunkel der gemalten Türöffnung. Alpbachers Gesichtsausdruck war dabei unbestimmt, sodass ich nicht hätte sagen können, ob er bedrückt war oder froh über das endgültige Verschwinden des Mädchens.
Felder oder mit dem Rücken zur Welt
Als ich beim Nachhausekommen meine Post aus dem Briefkasten holte, erkannte ich auf einem Kuvert sofort Felders Handschrift. Sie hatte auch etwas Unverwechselbares. Es war die Schrift eines Kindes, die Buchstaben ungelenk und unsicher, und die Zeile halten konnte Felder auch nicht. Ich war so neugierig, dass ich den Brief noch im Stiegenhaus aufriss.
Letzten Sommer waren es sieben Jahre, dass Felder nach Cambridge gegangen war. Er hatte in Wien seinen Doktor in Philosophie und Geschichte gemacht, doch dann war, kurz nach der Promotion, sein Vater gestorben. Felder hatte seinen Vater abgöttisch geliebt und verschwand nach dessen Tod spurlos. Für Wochen hörte und sah ich nichts von ihm. Ich rief ihn mehrmals an, er hob aber nicht ab. Ich fuhr auch zu seiner Wohnung, läutete und wartete anschließend eine Stunde auf der Straße. Ich starrte immer wieder hinauf zu seinem Fenster, konnte aber nicht einmal einen Schatten hinter den zugezogenen Vorhängen entdecken. Dann rief er eines Tages an. Er klang so beiläufig, als hätten wir uns erst gestern das letzte Mal gesehen, und schlug ein Treffen vor. Wir verabredeten uns für den Abend im Weidinger, seit der Schulzeit unser Stammcafé. Bei billigem Weinbrand erzählte mir Felder, dass er dem Ruf nach Cambridge folgen würde. Es gäbe da ein Forschungsprojekt, das wie auf ihn zugeschnitten sei. Über das Thema der Arbeit könnte er noch nicht sprechen, das Vorhaben würde aber mindestens fünf Jahre in Anspruch nehmen. Für den Umzug nach England wäre schon alles vorbereitet. Seine Wohnung hätte er aufgegeben und den größten Teil seines Besitzes verkauft, sodass er nur einen Koffer als Umzugsgepäck hätte. Nicht anders, als würde er auf eine Reise gehen. Ich nahm an, dass Felder wegen seiner brillanten und auf Englisch verfassten Doktorarbeit eine Assistenzstelle in Cambridge angeboten worden war. In dieser mehr als vierhundert Seiten umfassenden Schrift The Dandys of Revolution, einer Doppelbiografie über Karl Marx und Friedrich Engels, vertrat Felder die These, dass erst der Hedonismus und die dandyhaften Allüren es den beiden Männern ermöglicht hätten, ihre sozialen Ideen zu entwickeln. Solche Ideen hat man nicht mit schmutzigen Fingernägeln, sagte Felder damals. Irgendwann erwähnte er auch , dass Friedrich Engels nach dem Tod von Karl Marx dessen Werke herausgegeben hatte, weil Marx selbst an dieser Aufgabe gescheitert war.
In dem Brief, den ich ungeduldig noch im dämmrigen Licht des Stiegenhauses las, schrieb Felder, dass seine Studien so gut wie beendet seien. Nicht, weil sein Opus Magnum auch tatsächlich abgeschlossen sei, sondern weil er im Sterben liege. Er habe Krebs, und von dem halben Jahr Lebenserwartung, das ihm die Ärzte ursprünglich prophezeit hatten, sei nicht mehr viel übrig. Und dann schrieb er, dass er mich sehen wolle.
Ich kannte Felder, seit ich zehn war. Wir waren zusammen aufs Gymnasium gegangen. Lange Zeit wussten wir nichts miteinander anzufangen, erst mit fünfzehn oder sechzehn begannen wir mit unseren gemeinsamen Kaffeehausbesuchen. Fast täglich gingen wir nach der Schule hinüber ins Weidinger, wo wir Billard spielten, das Felder als seine Leibesübung bezeichnete. Tatsächlich weigerte er sich, noch irgendeiner anderen sportlichen Betätigung nachzugehen und ließ sich regelmäßig mit fadenscheinigen Ausreden und gefälschten ärztlichen Attesten vom Turnunterricht befreien. Wenn er doch einmal mitmachen musste, konnte man sicher sein, dass er noch in der ersten Minute des Aufwärmens mit einem vermeintlich lädierten Knöchel aus dem Turnsaal humpeln und den Rest der Stunde in der Garderobe verbringen würde, lesend. Felder trug immer ein Buch bei sich, nie in seiner Schultasche, sondern immer direkt am Körper. Entweder in seiner Jacken- oder Hosentasche oder überhaupt in der Hand.
Es war gar nicht einfach, auf die Schnelle einen halbwegs erschwinglichen Flug zu finden. Ich buchte schließlich ein Ticket für eine Maschine, die am nächsten Tag um neun von Bratislava aus nach London Stansted fliegen würde. Von Stansted aus gab es dann, laut Felder, einen direkten Zug, der mich in weniger als einer Stunde nach Cambridge bringen würde. Ich wollte mir das frühe Aufstehen am nächsten Morgen ersparen und fuhr deshalb schon am Abend nach Bratislava. Ich fand eine günstige Pension auf halbem Weg zwischen Stadt und Flughafen, direkt an der Endstation der Trolleybuslinie 204. Die einzigen Gäste außer mir waren zwei ältere Russen, beide schwarz gekleidet und grauhaarig, die bei meinem Kommen im Aufenthaltsraum neben der Rezeption bei einem Bier zusammengesessen waren und das Zimmer neben meinem bewohnten. Sie unterhielten sich bis Mitternacht, nicht laut, die Wände waren aber dünn, und so hörte ich ihr Gespräch mit, ohne jedoch ein Wort zu verstehen. Mir fielen die langen Pausen auf, für mich ein Zeichen für die Vertrautheit, die zwischen ihnen herrschte. Felder und ich, wir würden uns nie als alte Männer Nächte in fremden Hotelzimmern mit endlosen Gesprächen um die Ohren schlagen. Felder würde sterben. In wenigen Wochen schon.
Am nächsten Morgen ging ich ohne Frühstück aus dem Haus. Ich wollte unterwegs einen Tee trinken, fand mich aber in einem Industriegebiet wieder, wo es außer Tankstellen, Werkstätten und weitläufigen Fabrikgeländen nichts gab. An einer vierspurigen Ausfallstraße wartete ich schließlich auf den Bus zum Flughafen. Eine gute Viertelstunde saß ich auf der metallenen Bank des Wartehäuschens gegenüber einer von Pappeln umstandenen Werkshalle. Ein Stück die Straße hinunter kündigten haushohe Werbetafeln einen Supermarkt und eine Shopping-Mall an. Der Morgenverkehr zog an mir vorbei, eine junge Frau kontrollierte mit einem nervösen Blick in den Rückspiegel, ob sie die Spur wechseln konnte. Wer weiterkommen wollte, musste nach vorne und zurück schauen. Ich würde Felder nicht nur zum ersten Mal seit sieben Jahren wiedersehen, ich würde auch Zeuge seines endgültigen Verschwindens werden. Kurz wünschte ich mir, Felder wäre schon tot, und ich müsste nicht zu ihm, sondern nur zu seinem Begräbnis fliegen, denn bei aller Neugier auf Felder verursachte mir unsere Begegnung auch Unbehagen.
Wenn Felders Misanthropie gespielt war, dann war sie gut gespielt. Als einem Blinden einmal vor unseren Augen die Geldbörse auf die Straße fiel, ging er weiter und sah mir vom Gehsteig aus zu, wie ich die verstreut liegenden Münzen, Geldscheine und Plastikkarten aufsammelte. Als mich der Blinde schließlich mehr misstrauisch als verunsichert fragte, ob denn jetzt wirklich wieder alles in seiner Geldbörse sei, machte Felder ein Gesicht, als hätte er nichts anderes erwartet, ja als wäre Enttäuschung die einzig mögliche Folge eines einmal eingegangenen zwischenmenschlichen Kontakts.
Schon mit dem Erhalt seines Briefes war es mir vorgekommen, als zöge mich Felder hinüber in seine Welt, die nichts zu tun hatte mit dem Leben der anderen. Dieses Gefühl verstärkte sich noch, als ich im Flughafen London Stansted aus der Ankunftshalle hinunterging zum Bahnhof. Fast alle Passagiere drängten dort nämlich zu den Bahnsteigen eins und zwei, von denen aus alle paar Minuten die Züge nach London abfuhren, ich aber ging als einziger weiter zum abseits gelegenen Gleis drei. Der Zug stand schon da, würde aber erst in fünfzig Minuten losfahren und war deshalb noch versperrt. Ich studierte den Fahrplan. Die Fahrt nach Cambridge dauerte, genau wie Felder gesagt hatte, eine knappe Stunde. Der Zug würde anschließend weiterfahren Richtung Norden, über Petersborough und Leicester nach Birmingham.
Ich stellte meinen Rollkoffer neben einen Laternenmast und ging den Bahnsteig auf und ab. Über mir stiegen immer wieder Flugzeuge in den Himmel, und auf einer Grünfläche jenseits der Gleisanlagen standen mehrere Holzbänke und Holztische, an denen die Angestellten einer Cargo-Firma ihre Mittagspause hielten. Der Zug war vollständig mit einem Werbetransparent beklebt. Die gesamte Seitenfront sah aus wie die Benutzeroberfläche eines Internetbrowsers, und neben einer der noch immer verschlossenen Waggontüren fand sich ein Button mit der Aufschrift SEARCH. Heute, da ich die Entwicklung kenne, die meine Reise genommen hat, erscheint mir das wie eine zynische Bemerkung des Schicksals.
Im fast völlig leeren Zug suchte ich mir einen Platz am Fenster und holte die Zeitung heraus, die ich mir am Flughafen gekauft hatte. Ich schlug sie auf, schaute dann aber, als der Zug losfuhr, hinaus in die seltsam zeitlose Landschaft. Der Himmel war grau verhangen und gab keinerlei Aufschluss über die Tageszeit, und die Äcker waren frisch gepflügt, sodass es genauso gut Frühlingsbeginn hätte sein können und nicht Mitte Oktober. Dann entdeckte ich unmittelbar neben der Bahntrasse einen Wildhasen, ein Rebhuhn und schließlich eine ganze Schar Fasane, die völlig ungestört vom Lärm des vorbeifahrenden Zuges in meine Richtung starrten, so als blickten sie mich aus einem Märchen heraus an. Dunkel erinnerte ich mich an Geschichten aus meiner Kindheit, in denen Tiere am Wegesrand den Helden gewarnt hatten vor der von ihm eingeschlagenen Richtung. Der wählte daraufhin einen Umweg, was ihm das Leben rettete. Ich spürte, wie der Zug langsamer wurde, und gleich danach kündigte die Lautsprecherstimme den ersten Halt an. Ich stutzte, als ich den Namen der Ortschaft hörte, denn was ich verstand, war Oddly End, so als würde mir in einem holprigen Englisch mitgeteilt, dass ich auf ein seltsames Ende zusteuerte. Als wir einfuhren in die Station, konnte ich jedoch lesen, dass die Ortschaft den Namen Audley End trug, und ich fragte mich, was es wohl sei, das Felder von mir wollte. Sentimentalitäten waren seine Sache nicht, nie gewesen. Er hatte mich sicher nicht zu sich gerufen, um Abschied von mir zu nehmen.
Mir fiel ein Ausspruch Felders ein, der mir die ganzen Jahre hindurch so deutlich im Gedächtnis geblieben war, dass ich noch heute seine Stimme höre, ja den exakten Tonfall, in dem Felder diesen Satz gesagt hatte. Wir waren noch in der Schule, vielleicht sechzehn oder siebzehn Jahre alt, und Felder hatte damals gemeint, der bequemste Platz im Leben sei in der zweiten Reihe. Die Zugehörigkeit zu den Besten, egal ob in der Schule oder später im Berufsleben, hätte nämlich ganz unzweifelhaft lästige und die Existenz korrumpierende Zwänge zur Folge. Der geordnete Rückzug sei deshalb die einzig vernünftige und auch von ihm angewandte Strategie. Tatsächlich hatte er in den ganzen acht Jahren, in denen wir Klassenkollegen waren, nicht ein einziges Mal auf eine mündliche oder schriftliche Arbeit ein Sehr gut bekommen, dabei hatte er aber genauso in den ganzen acht Jahren keine einzige falsche Antwort gegeben oder geschrieben. Stattdessen hatte er die jeweils letzte Frage immer mit einem kurzen Ich weiß nicht beantwortet. Dieses Ich weiß nicht schloss aber so nahtlos und ohne jedes Nachdenken an die Frage des Lehrers an, dass es für jeden augenscheinlich war, dass Felder sich einfach weigerte, die richtige Antwort zu geben. Mit dem Studium ließ er diese Angewohnheit allerdings fallen. Dort gehörte er von Anfang an zu den Besten.