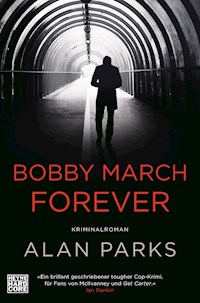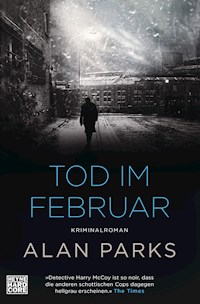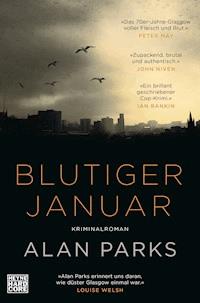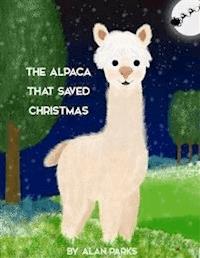21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Polar Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Der vierte Fall für den Glasgower Polizisten Harry McCoy spielt 1974 vor dem Hintergrund der Spannungen zwischen Großbritannien und der IRA. McCoy wird in einem Pub von Andrew Stewart, einem Amerikaner, angesprochen, der ihn um Hilfe bei der Suche nach seinem Sohn Donny bittet, der sich von einer US-Marinebasis unerlaubt entfernt hat. Während McCoy nachforscht, wird Glasgow von einer Welle von Bombenanschlägen heimgesucht. Er und sein Partner Douglas Watson werden zu einer Wohnung gerufen, in der sich ein Attentäter beim Versuch, eine Bombe zu bauen, selbst in die Luft gesprengt hat. Bald wird McCoy klar, dass Donny Stewart möglicherweise ein Teil einer Organisation ist, die von einem gefährlichen Fanatiker angeführt wird und sich für ein neues Schottland einsetzt. Ein Schottland, für das seine Mitglieder zu töten bereit sind. Stephie Cooper, McCoys krimineller Jugendfreund, der aus dem Gefängnis entlassen wird, bittet ihn ebenfalls um seine Hilfe. Er ist überzeugt, dass er einen Verräter in seiner Mitte hat. Als sich auf den Straßen herumspricht, dass weitere Explosionen in Glasgow geplant sind, kämpft McCoy gegen die Korruption in den eigenen Reihen an und versucht, eine Stadt zu retten, in der die schottische nationalistische Bewegung, von der geheimen britischen Special Branch für ihre eigenen Zwecke ausgenutzt wird. Shortlisted für den The McIlvanney Prize, 2021
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 496
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Alan Parks
Die April-Toten
Aus dem schottischen Englisch von Conny Lösch
Herausgegeben von Wolfgang Franßen
Polar Verlag
Originaltitel: The April Dead
Copyright: © 2021 by Alan Parks
Das Recht von Alan Parks, als Autor dieses Werks ausgewiesen zu werden, wurde von ihm
gemäß dem Copyright, Design and Patents Act 1988 geltend gemacht.
Deutsche Erstausgabe, 1. Auflage 2024
Aus dem schottischen Englisch von Conny Lösch
Mit einem Nachwort von Doug Johnstone, übersetzt von Conny Lösch
© 2024 Polar Verlag e.K., Stuttgart
www.polar-verlag.de
Auszug aus »Fortunate Son«. Text und Musik von John Fogerty, copyright © 1969 Jondora
Music c/o Concord Music Publishing. Copyright erneuert. Alle Rechte vorbehalten. Verwendung
mit Genehmigung von Hal Leonard Europe Limited.
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie,
Mikrofilm oder andere Verfahren) oder unter Verwendung elektronischer Systeme ohne
schriftliche Genehmigung des Verlags verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Lektorat: Tobias Schumacher-Hernández
Korrektorat: Andreas März
Umschlaggestaltung: Robert Neth, Britta Kuhlmann
Coverfoto: © kankankavee / Adobe Stock
Autorenfoto: © Alan Parks
Satz/Layout: Martina Stolzmann
Gesetzt aus Adobe Garamond PostScript, InDesign
Druck und Bindung: CPI Books GmbH, Ulm, Deutschland
ISBN: 978-3-910918-06-1
In Erinnerung an Jean Parks
1933 - 2020
»Will you bleed for me?«
James King and The Lone Wolves
»Ich ließ ihn weiterfaseln, diesen Papp-Mephisto, mir war, ich könnte ihn,
wenn ich wollte, mit meinem Zeigefinger durchbohren und hätte nichts in
seinem Inneren gefunden außer vielleicht ein paar Krümel Dreck.«
Joseph Conrad
12. April 1974
Eins
»Wer lässt denn eine Bombe in Woodlands hochgehen?«, wunderte sich McCoy. »Das ist doch am Arsch von Glasgow.«
»Die IRA?«, fragte Wattie zurück.
»Nicht ausgeschlossen«, sagte McCoy. »Ist schließlich Karfreitag. Aber ich weiß nicht, ob’s eine gute Idee ist, eine beschissene Mietwohnung in Glasgow in die Luft zu jagen, wenn man eigentlich das britische Establishment treffen will. Sind ja nicht die Houses of Parliament.«
Sie standen mitten auf der West Princes Street und sahen an der verkohlten Sandsteinfassade des Hauses hinauf zu den herausgesprengten Scheiben, hinter denen sich bis vor Kurzem noch Wohnung Nummer 43 befunden hatte. Die anderen Wohnungen drum herum hatten ebenfalls einiges abbekommen, zerrissene Vorhänge wehten durch die kaputten Fenster nach draußen, ein Blumenkasten mit Osterglocken lag auf der Straße. McCoy zog seine Zigaretten aus der Tasche, zündete sich eine an, wedelte das Streichholz aus und ließ es auf den nassen Asphalt fallen.
»Woher weißt du überhaupt, dass das eine Mietwohnung ist?«, fragte Wattie.
»Das ist hier alles vermietet oder untervermietet, ohne Papiere, ohne Verträge. Die Hälfte aller Herumtreiber und Ausreißer Glasgows wohnt hier.«
»Meinst du, das geht jetzt auch hier bei uns los? Mit Anschlägen, meine ich«, fragte Wattie.
McCoy zuckte mit den Schultern. »Hoffentlich nicht, aber du weißt ja, was man sagt: Glasgow ist wie Belfast, nur ohne Bomben.«
»Bis jetzt«, erwiderte Wattie.
Ein Feuerwehrmann rief ihnen etwas zu und sie traten zurück auf den Gehweg, weil ein Einsatzwagen versuchte, in drei Zügen auf der engen Straße zu wenden. Es herrschte ein wildes Durcheinander aus Feuerwehrwagen, Krankenwagen, Streifenwagen und Wasserschläuchen, uniformierte Polizisten sperrten den gesamten Bereich um das Haus ab.
Die Wohnungen ringsum waren bereits evakuiert worden, die Bewohner standen in den unterschiedlichsten Aufmachungen sichtlich erschrocken auf der Straße. Einige trugen Schlafanzüge oder Unterwäsche, hatten sich nur schnell eine Decke übergeworfen. Ein Mann im Nadelstreifenanzug war ohne Schuhe, nur mit Socken herausgelaufen, er hielt eine Katze im Arm.
Ein kräftiger Feuerwehrmann kam aus dem Haus, zog seinen Helm ab, die sandfarbenen Haare klebten ihm schweißnass am Kopf. Er spuckte ein paarmal aus und kam herüber.
»Ist jetzt einigermaßen sicher«, sagte er. »Ihr könnt nach oben gehen.«
McCoy nickte. »Gab’s Tote?«
»Einen«, sagte er. »Eine Hälfte klebt großflächig verteilt an der Wand, die andere liegt völlig verkohlt am Boden.«
Schon bei der Beschreibung drehte sich McCoy der Magen um.
»Gehört alles euch«, sagte der Feuerwehrmann und ging in Richtung des rückwärts rangierenden Feuerwehrwagens davon.
»Mist«, sagte McCoy. »Müssen wir da wirklich rauf?«
»Natürlich«, sagte Wattie. »Willst du lieber gleich kotzen gehen? Dann haben wir’s wenigstens hinter uns.«
»Klugscheißer«, sagte McCoy, der genau das am liebsten getan hätte. »Vielleicht sollten wir auf Faulds warten? Er ist schon unterwegs.«
»Fallen dir sonst noch Ausreden ein?«, fragte Wattie. »Oder war’s das jetzt?«
McCoy seufzte. »Okay, los.«
Sie schlängelten sich zwischen den Feuerwehrleuten durch, die gerade dabei waren, ihren Schlauch wieder aufzurollen, und verschwanden im Hauseingang. Wasser lief die Treppe hinunter, es stank nach Rauch und verbranntem Holz. Sie trotteten hinauf bis ins oberste Stockwerk, dem unausweichlich grauenhaften Anblick entgegen.
»Denkst du noch an heute Abend?«, fragte Wattie.
»Wie könnte ich’s vergessen?«, fragte McCoy. »Du erinnerst mich alle fünf Minuten daran. Ich werde, wie verabredet, um sechs Uhr bei deinem Dad sein.«
»Er hat einen Tisch beim Chinesen reserviert«, sagte Wattie. »In der Stadt. Ist halt billig.«
»Super«, erwiderte McCoy und beschloss, sicherheitshalber vorher zu essen. Bei dem Besuch eines China-Restaurants in Greenock, das sich vor allem dadurch auszeichnete, dass es billig war, schienen Verdauungsbeschwerden im besten und eine Lebensmittelvergiftung im schlimmsten Fall vorprogrammiert.
Sie waren jetzt auf dem obersten Treppenabsatz angekommen. Die Feuerwehrleute hatten die Wohnungstür aufgebrochen, sie hing völlig schief in den Angeln. McCoy versuchte es noch einmal.
»Wollen wir nicht lieber auf Phyllis Gilroy warten?«, schlug er vor. »Was verstehen wir schon von Sprengstoff-Opfern? Immerhin ist sie die Gerichtsmedizinerin, sie kann viel mehr ausrichten als du oder ich.«
Wattie seufzte, sah ihn an. »Hör zu, wenn du nicht da reinwillst, dann ist das okay. Aber ich gehe jetzt.«
»Wirklich?«, fragte McCoy. »Das wäre sup…«
»Na klar. Und nachher auf der Wache berichte ich Murray, dass mein befehlshabender Vorgesetzter zu viel Schiss hatte, um sich den Tatort anzusehen.«
»Allmählich wirst du ein richtig blöder Arsch, Watson«, erwiderte McCoy.
»Hab schließlich vom Besten gelernt. Bereit?«, fragte Wattie und stieß die Tür auf.
Die eine Hälfte der Wohnung sah ganz normal aus, in der anderen war alles schwarz verkohlt und triefte vor Wasser. Der Rauchgestank war hier noch intensiver, schlug ihnen sofort beim Eintreten entgegen und setzte sich in ihren Kehlen fest. Darunter lag noch ein anderer Geruch, erinnerte entfernt an einen Sonntagsbraten. McCoy zog ein Taschentuch hervor, hielt es sich vor Nase und Mund, was aber kaum half. Sie gingen durch den Flur ins Wohnzimmer, ihre Schuhe schmatzten auf der klebrig-schleimigen Schicht aus Asche und Wasser, die den Teppichboden bedeckte.
Die Bombe musste im Wohnzimmer hochgegangen sein. Die zerfetzten Vorhänge flatterten im Wind, wehten zu den scheibenlosen Fensterrahmen rein und raus. Auch die Matschschicht auf dem Boden war hier dicker, quoll ihnen über die Schuhe. McCoy folgte Wattie, hielt sich möglichst hinter ihm, sodass er nicht gut an ihm vorbeisehen konnte – er war ein paar Zentimeter größer als McCoy und deutlich breiter. Die Taktik funktionierte wunderbar, bis Wattie plötzlich in die Hocke ging, um eine halb geschmolzene LP aus dem Dreck zu fischen. Plötzlich hatte McCoy freie Sicht.
Die Tapete mit dem Bambusmuster am Kamin sah aus, als hätte jemand rote Farbe darauf verspritzt. Bevor er weggucken konnte, fiel sein Blick auf Haare und einen in der Wand steckenden Zahn. Auf dem Boden neben den Sofatrümmern lag etwas, das er zunächst für einen Haufen verbrannte Klamotten hielt. Dann sah McCoy ein bisschen genauer hin, entdeckte einen weißen Knochen daraus hervorragen und wich einen Schritt zurück. Der ihm bereits wohlvertraute Schwindel überfiel ihn.
»Paul McCartney. Ram«, sagte Wattie und sah auf das Cover der völlig verzogenen LP. »Grauenvoll«, und legte sie wieder in den Dreck. »Genau wie das Album, das ich nur gekauft hab, weil du mich bequatscht hast. Was war das noch mal? Inside Outside? Oh Mann! Bei dir alles klar?«, fragte er.
McCoy war an die Wand zurückgewichen, zählte seine Atemzüge und konnte eine Ohnmacht nur mit Mühe unterdrücken. Er bekam gerade so noch ein Nicken hin, hielt sich erneut das Taschentuch vor die Nase, versuchte möglichst, den Roastbeef-Gestank nicht einzuatmen. Er sah sich im Raum um, sorgsam bemüht, an den sterblichen Überresten des ehemaligen Bewohners vorbeizugucken. Die Wohnung sah aus wie jede andere in Woodlands. Verblichene Tapete, ein kleiner Gaskocher, ein eingesunkener Sessel, Wasserflecken an der Decke und an den Wänden. Warum sollte jemand eine Bruchbude wie diese hier in die Luft jagen?
»Ich geh kurz ans Fenster, frische Luft schnappen«, sagte McCoy und schob sich an der Wand entlang. An der großen Öffnung angekommen, die einst ein Fenster gewesen war, streckte er den Kopf hinaus.
»Was für eine Schweinerei«, sagte Wattie. »Im Putz über dem Kamin stecken Schädelsplitter.«
»Ach?«, erwiderte McCoy, den Blick entschieden auf die versammelten Schaulustigen unten auf der Straße gerichtet. Er versuchte, sich möglichst nicht vorzustellen, wie in der Wand steckende Schädelsplitter aussahen.
»Ich hab gedacht, du hast den Scheiß inzwischen überwunden?«, sagte Wattie.
»Hab ich auch gedacht«, erwiderte McCoy. »Hör mal, ich geh mich umsehen, vielleicht finde ich was mit einem Namen drauf, hm?«
Wattie schüttelte den Kopf, während McCoy sich langsam durch den Flur ins Schlafzimmer verzog. Der Raum war unversehrt, hier hatte die Explosion nicht viel angerichtet. Dem Aussehen nach hatte die Tür gebrannt und war mit Wasser gelöscht worden, aber das war’s auch schon. Ein ungemachtes Einzelbett, ein geöffneter Schlafsack. Auf einer kleinen Kommode stand ein Aschenbecher, der Melody Maker lag daneben, dazu ein Black-Sabbath-Poster an der Wand und ein paar Bilder von Ferraris über dem Bett. Allem Anschein nach hatte hier ein junger Mann gelebt.
Er zog die Kommodenschubladen auf, das übliche Durcheinander an Unterhosen und Socken, ein Pornoheft unter einem Stapel T-Shirts. Kaum Aufschlussreiches und nichts mit einem Namen. Er zog eine weitere Schublade auf. Ein Pulli, eine 747 Jeans. Ein paar zusammengelegte Hemden. Er schob die Schublade wieder zu und ging zum Fenster. Die Scheibe war herausgesprungen und McCoy nahm ein paar Züge Frischluft. Unten schob sich ein schwarz-weißer Polizeiwagen durch die Menge zwischen den Feuerwehrautos. Er hielt so nah wie möglich vor dem Wohnblock, dann stieg Hughie Faulds hinten aus, strich sein Sakko glatt, streckte sich.
McCoy konnte es ihm nicht verdenken, nicht ganz einfach, sich bei einer Größe von eins dreiundneunzig auf den Rücksitz eines Viva zu zwängen.
Faulds blickte zur Wohnung hinauf, sah McCoy und winkte.
McCoy rief ins andere Zimmer: »Faulds ist da!«
Dann setzte er sich kurz aufs Bett. Es roch muffig, der Kissenbezug glänzte vor Pomade. Er wusste nicht so genau, wonach er suchte. In dem Zimmer hier sah es aus wie in jeder x-beliebigen Mietwohnung. Sein Blick fiel auf einen Koffer neben der Kommode. Er hievte ihn aufs Bett und öffnete ihn. Einige weitere Klamotten lagen darin – drei Button-Down-Hemden, eine Krawatte, Baseballschuhe. Er klappte den Koffer zu, stellte ihn zurück, ging wieder ins Wohnzimmer und bezog erneut Stellung am Fenster.
»Meinst du, die kommen an seine Brieftasche?«, fragte McCoy.
Wattie betrachtete die verkohlte Leiche, atmete durch die Zähne ein. »Das möchte ich bezweifeln. So wie der aussieht, war die Hitze so groß, dass seine Brieftasche vollständig verbrannt ist.«
»Wahrscheinlich«, erwiderte McCoy. »Dann überlassen wir’s lieber Gilroy, sie zu suchen.«
Ein breiter Belfaster Akzent donnerte in den Raum: »Wie habt ihr den denn hier hochgekriegt?«
Sie drehten sich um und sahen Hughie Faulds, er füllte den Türrahmen vollständig aus.
»War nicht leicht«, erwiderte Wattie. »Kannst du mir glauben.«
Faulds grinste: »Bloß Blut und ein paar Eingeweide, Harry. Hast du dich immer noch nicht dran gewöhnt?«
»Ich arbeite dran«, sagte McCoy und fixierte weiterhin die Fassade gegenüber. Ein alter Mann in einer Strickjacke starrte ihm entgegen. »Kommt dir das bekannt vor?«, fragte er.
»Bin ich deshalb hier?«, fragte Faulds. »Weil ich jetzt euer verfluchter Sprengstoffexperte bin?«
»Genau«, sagte McCoy. »Ich glaube nicht, dass von unseren Leuten sonst schon mal jemand einen solchen Anschlag gesehen hat, geschweige denn irgendwas über Sprengstoff weiß.«
Faulds warf einen flüchtigen Blick auf den angerichteten Schaden und nickte. »Zu Hause in Belfast hab ich so was einige Male gesehen, aber das hier war kein Anschlag.«
»Was denn?«, fragte McCoy.
Faulds zeigte auf den Klamottenhaufen neben dem Sofa. »Der dämliche Blödmann da hat sich bei dem Versuch, eine Bombe zu bauen, selbst in die Luft gejagt.« Er ging näher an den verkohlten Klumpen heran, schnupperte. »Mandeln? Riecht ihr das?«, fragte er. McCoy schüttelte den Kopf. Er würde auf keinen Fall noch einmal das Taschentuch von der Nase nehmen.
»Ein bisschen«, sagte Wattie. »Was ist das?«
»›Co-op Mix‹«, erklärte Faulds.
»Was?«, fragte McCoy, der immer weniger verstand.
»Man nennt es ›Co-op Mix‹, weil die Zutaten in jedem Supermarkt frei erhältlich sind. Einfach herzustellen und sehr effektiv. Die UDA und die IRA benutzen das Zeug ständig.«
»Sicher?«, fragte McCoy. »Wenn eine von beiden Organisationen was damit zu tun hat, sind wir raus. Dann geht der Fall direkt an die Special Branch.«
Faulds nickte zur Leiche. »Kommt öfter vor, als man denkt«, sagte er. »Nur weil’s einfach ist, die Bestandteile zu kaufen, denken viele, mehr braucht es nicht und so was kann jeder bauen. Glaubt mir, eine Bombe zu bauen ist längst nicht so einfach, wie diese Scherzkekse glauben.«
»Aber bist du sicher, dass es so war?«, fragte Wattie.
Faulds nickte. »Wie aus dem Lehrbuch.« Er sah sich um. »Außerdem, aus welchem Grund sollte sonst eine Bombe in einer Wohnung wie dieser explodieren? Ist nicht gerade ein strategisch wichtiges Ziel, oder?«
McCoy blieb an der Wand stehen und sah zu, wie Faulds herumging und den Tatort genauer in Augenschein nahm. Im Prinzip tat er, was eigentlich McCoys Aufgabe gewesen wäre. Faulds zog sich die Hose bis an die Waden hoch, ging vor dem Toten in die Hocke, um ihn besser betrachten zu können.
»Fies«, sagte er. »Er muss sich direkt darüber gebeugt haben, als das Ding hochgegangen ist, vermutlich wollte er die Zündkapsel anschließen.« Dann nickte Faulds zur Wand. »Weiß nicht, ob ihr ihn über die Zähne identifizieren könnt, das Gebiss scheint mir viel zu zersplittert. Die Hälfte vom Kinn und einige Zähne stecken da drüben in der Wand.«
Er stand auf, nahm ein Buch in die Hand, das neben dem Kamin im Schlamm schwamm. Er schüttelte den matschigen Dreck ab und entzifferte den Titel. »The Life and Death of St. Kilda. Hast du das gelesen?«
McCoy schüttelte den Kopf.
Faulds schlug das Buch auf, betrachtete die verblichene Kugelschreiberwidmung. »Für Paul. Alles Gute zum Geburtstag von Henry.«
»Mist«, sagte McCoy. »Paul passt zu beiden Seiten, der protestantischen und der katholischen.«
»Was hast du dir denn erhofft?«, fragte Faulds. »Finbar?«
»Wäre schön gewesen«, erwiderte McCoy. »Oder Gary. Gibt nicht viele Katholiken, die Gary heißen.«
Wattie kam aus dem Flur, in der Hand einen durchweichten Stapel Rechnungen und Werbezettel.
»Alles unterschiedliche Adressaten«, sagte er und las die Namen laut vor. »Miss E. Fletcher, Thomas Wright, Die Anwohner, Mr S.A. Bowen, C. Smith. Immer so weiter.«
»Irgendwelche Pauls dabei?«, fragte McCoy.
Wattie ging den Stapel noch einmal durch. »Ein Peter, aber kein Paul.«
»Bist du fertig, Faulds?«, fragte McCoy.
Faulds nickte. »Ich kann nichts Ungewöhnliches entdecken. Sieht alles genau so aus, wie es aussieht, wenn ein dämlicher Blödmann an einer Bombe herumbastelt und keine Ahnung davon hat.«
»Wenn es also Co-op Mix ist, dann könnte es was Paramilitärisches sein. Ist dir so was schon mal in Glasgow untergekommen?«, fragte McCoy.
Faulds schüttelte den Kopf. »Eigentlich nicht. Ein paar Jungs tun so, als wären sie bei der IRA, prahlen damit in den Pubs. Aber hauptsächlich beschränken die sich hier aufs Spendensammeln, vielleicht wird auch mal jemand versteckt, der aus Irland verschwinden muss. Ich kann ja mal zu Hause nachfragen, was aktuell der Stand der Dinge ist. Darf ich jetzt zurück in die Tobago Street? Meinen eigentlichen Job machen?«
McCoy nickte. »Wir kommen mit«, sagte er. »Ich will auf keinen Fall hier sein, wenn die Special Branch eintrifft.«
»Oder noch länger Blutspritzer anstarren«, ergänzte Wattie.
»Und du, Watson«, sagte McCoy, »solltest die Klappe halten.« Faulds grinste. »Aber er hat nicht ganz unrecht, oder? Schon irgendwie blöd, wenn man als Detective kein Blut sehen kann.«
»Viel blöder ist es, wenn man ein großes irisches Arschloch ist. Also los.«
Zwei
»Die Ergebnisse sind da.«
McCoy sah den Arzt an. Eigentlich hatte er sich gar keine großen Gedanken gemacht, aber jetzt war er plötzlich doch beunruhigt. Vor ein paar Wochen war er zum ersten Mal hier gewesen, seine Magenschmerzen waren schließlich doch einfach zu heftig geworden. Er hatte Mühe, überhaupt etwas zu essen, es tat praktisch ununterbrochen weh. Der Arzt hatte ihn ins Krankenhaus geschickt, wo er einen halben Liter von einer kalkig weißen Flüssigkeit trinken und sich anschließend röntgen lassen musste.
»Gut«, sagte er.
Der Arzt, ein griesgrämiger Schnauzbartträger aus Dundee, nahm den Brillenbügel aus dem Mund, legte das Röntgenbild ab und hob den Blick. Lächelte.
»Also, Mr McCoy, sieht ganz danach aus, als hätten Sie ein peptisches Geschwür.«
»Ein was?«, fragte er.
»Ein Geschwür auf der Magenschleimhaut. Das verursacht die Schmerzen.«
»Gottverdammt«, sagte McCoy.
»Verkneifen Sie sich bitte Ihre gotteslästerlichen Bemerkungen«, ermahnte ihn der Arzt.
»Tut mir leid«, sagte McCoy, obwohl es nicht stimmte. »Und was mache ich jetzt?«
»Sie hören auf, Alkohol zu trinken und Zigaretten zu rauchen, essen einfache, ballaststoffarme Kost. Gedünsteten Fisch, Haferschleim, Milch, Reis, ungetoastetes Brot. Solche Sachen. Wenn die Schmerzen zu stark werden, nehmen Sie Pepto-Bismol.«
McCoy wollte gerade wieder gotteslästerlich fluchen, konnte sich aber gerade noch beherrschen.
»Wenn Sie sich daran halten, sollten die Schmerzen abnehmen«, sagte der Arzt. »Als Polizist haben Sie vermutlich einen stressigen Beruf, unregelmäßige Arbeitszeiten, das trägt alles nicht unbedingt zur Genesung bei. Versuchen Sie trotzdem, auf sich zu achten. Einen besseren Rat kann ich Ihnen nicht geben. Ich fürchte, es gibt keine Medikamente, die diesen Zustand heilen oder auch nur lindern könnten. Es kommt jetzt ganz allein auf Sie selbst an.«
McCoy stand draußen auf der Straße vor der Praxis und zündete sich eine an. Er hatte immer noch den Gestank aus der Wohnung in den Klamotten. Er war erst zweiunddreißig, wie konnte es sein, dass er ein verfluchtes Magengeschwür hatte? Er hatte gedacht, so was kriegen nur dicke alte Männer. Er sah einen Mann mit einer Plastiktüte voller Bierdosen aus dem Getränkeladen gegenüber kommen und zum Bus rennen.
Aber eins stand fest – er würde auf keinen Fall mit dem Rauchen und Trinken aufhören, das war völlig ausgeschlossen. Wenn ihm dann nichts anderes mehr blieb außer fadem Essen und Pepto-Bismol, dann war das eben so. Er sah auf die Armbanduhr. Wenn er noch nach Greenock wollte, musste er jetzt los.
Er ging über die Straße zu seinem Wagen. Die Diagnose hatte immerhin einen Vorteil – sie war der perfekte Vorwand, heute Abend beim Chinesen nichts zu essen.
McCoy schaffte es, bis kurz nach sechs bei Watties Vater einzutreffen, der ihn – »Sag ruhig Ken zu mir« – in ein sehr aufgeräumtes kleines Wohnzimmer führte. Beige gestrichene Strukturtapete und Teppichboden mit verwirbelt grünem Muster. Auf dem Sofatisch stand ein Teller voll Sandwiches mit Lachspaste. Eine Gasheizung verbreitete Wärme. Home sweet home.
Mary, Watties Freundin, saß auf dem Kunstledersofa am Fenster und wirkte immer noch ein bisschen verdattert über das, was ihr widerfahren war. McCoy wunderte sich auch. Eigentlich war er es gewohnt, ihr in Zeitungsredaktionen und an Verbrechensschauplätzen zu begegnen, und nicht, sie mit einem Babyfläschchen in der einen und einem flauschigen Koala-Bär in der anderen auf dem Sofa sitzen zu sehen.
»Wie geht’s?«, fragte McCoy und setzte sich neben sie.
»Völlig erledigt«, sagte Mary und guckte niedergeschlagen. »Wenn ich mir vorstelle, dass ich mich früher über Doppelschichten beschwert habe … Dabei hab ich bloß am Schreibtisch gesessen, Tee getrunken, Kippen geraucht und nicht geahnt, wie gut es mir ging. Hab gehört, ihr wart heute bei einem Bombenanschlag?«
Mary hatte dem kleinen Duggie und seinen Windeln nicht ihr gesamtes Vorleben als Reporterin geopfert. Ihren Sinn für modischen Stil jedenfalls nicht. Sie trug einen kurzen Jeansrock, dazu rote Plateaustiefel und ein lila T-Shirt mit der Aufschrift »Keep on Trucking«, ein trampender Mann war darunter abgebildet.
McCoy nickte. »Irgendein Blödmann hat sich mit seiner eigenen Bombe in die Luft gejagt.«
»Wird die Special Branch übernehmen?«, fragte Mary.
McCoy nickte, nahm einen Drink von Sag-ruhig-Ken entgegen. »Douglas ist mit dem Baby zu den Nachbarn rüber«, erklärte Sagruhig-Ken. »Ist aber gleich wieder da.«
»Keine Angst, ich sehe ihn tagsüber auf der Arbeit lange genug«, sagte McCoy.
»War nur eine Frage der Zeit, denke ich«, sagte Mary. »Bomben in London, Birmingham, Manchester. Früher oder später muss es hier auch passieren.«
»Sieht ganz danach aus«, stimmte McCoy ihr zu.
»Na toll«, sagte Mary. »Eine große Story und ich sitze hier, stopfe mir Taschentücher in den BH, damit bloß nichts ausläuft, und singe alle fünf Minuten Coulter’s Candy.«
McCoy grinste. »Hast es ja nicht anders gewollt.«
»Oh doch, das hab ich, verdammt. Ich würde jederzeit eine Kinderfrau in Vollzeit einstellen. Kann ich mir aber nicht leisten, jedenfalls nicht, solange wir nicht im Lotto gewonnen haben.« Sie seufzte. »Und was ist sonst noch so los in der großen bösen Welt da draußen?«
»Nicht viel«, erwiderte McCoy. »Gestern hab ich einen Anschiss von Murray kassiert. Wegen dir.«
»Wegen mir?«, fragte Mary.
»Er war in der Pitt Street und leider rollt Scheiße immer bergab. Die haben ihn dort zusammengestaucht, also hat er mich zusammengestaucht. Der Daily Record führt gerade einen Kreuzzug. ›Gewalt auf unseren Straßen‹ auf der Titelseite und auch sonst ist die halbe Zeitung voll davon.«
»Das behaupten die alle paar Jahre«, sagte Mary. »Das heißt, es gibt nichts anderes zu berichten.«
»Du weißt das, und ich weiß es auch«, sagte McCoy. »Aber denen in der Pitt Street müsste das mal jemand verklickern.«
Die Wohnzimmertür ging auf und die Blicke aller richteten sich dorthin, als Wattie mit dem Baby auf dem Arm und einem breiten Grinsen im Gesicht auftauchte.
»Hab dir doch gesagt, dass er sich freuen wird«, sagte McCoy. »Der geborene Vater.«
»Dad! Hol mal die Kamera«, sagte Wattie. »Ich will ein Foto vom Baby mit seinem Patenonkel machen.«
McCoy stand auf und Wattie drückte ihm das Baby in den Arm. Sofort fiel ihm alles wieder ein, lag wohl am Geruch nach Babypuder, Wolle und Milch. Nach Bobby hatte er wahrscheinlich kein Baby mehr im Arm gehabt.
»Alles klar?«, fragte Mary.
Er nickte. Komisches kleines Ding. Der kleine Duggie war ein hübscher Junge mit blondem Haarschopf und schläfrigen blauen Augen. Ein Blick und ein Blitz und das war’s. Wattie nahm McCoy das Baby wieder ab, hielt es ihm an die Wange, sagte ›Gib Onkel Harry ein Küsschen‹. Das Baby sabberte McCoy brav über die Wange.
Plötzlich schien Wattie aber beunruhigt. »Nicht schon wieder«, sagte er, hielt sich den Babyhintern an die Nase und schnupperte.
»Ich glaube, da ist was in der Windel«, sagte er und wollte seinen Sohn an Mary übergeben.
»Wieso? Was ist mit dir?«, fragte Mary. »Funktionieren deine Hände plötzlich nicht mehr?«
»Das ist doch keine Aufgabe für einen Mann, Liebes«, meinte Sag-ruhig-Ken.
Und das war’s.
»Der Wickeltisch ist nebenan«, erklärte Mary. »Ist nicht nur mein Sohn, ist auch deiner. Los, mach schon.«
Wattie brummte leise vor sich hin, ging aber zur Tür, während Sag-ruhig-Ken den Kopf schüttelte.
»Schick ihn schön die Windeln wechseln«, sagte McCoy. »Angela hat mich das auch machen lassen.«
»Hast du mal wieder was von ihr gehört?«, fragte Mary.
»Schon länger nicht mehr. Ich glaube, sie ist noch in Amerika«, sagte McCoy.
Ein Ruf ertönte aus dem Schlafzimmer. »Mary! Wo ist dieses Puderzeug?«
Mary verdrehte die Augen und stand auf. »Die hat’s gut.«
Sie tranken noch ein bisschen was, fotografierten McCoy noch einige Male mit dem frisch gewickelten und nun wieder wohlriechenden kleinen Duggie, der jetzt in etwas steckte, das offensichtlich Marys Mutter gestrickt hatte. Dann verkündete Sagruhig-Ken, es sei Zeit, sich zu dem gefürchteten Chinesen zu begeben.
»Warst du schon mal da?«, fragte McCoy leise.
Mary drehte sich um, sodass Sag-ruhig-Ken sie nicht hören konnte, und sagte: »Absolut grauenhaft. Nimm auf gar keinen Fall das Schweinefleisch.«
McCoy nickte. Mary war nicht wählerisch, sie aß alles. Wenn sie das Restaurant für schlecht hielt, würde er unter gar keinen Umständen auch nur probieren.
McCoy, Wattie und Sag-ruhig-Ken traten aus dem Hauseingang. McCoy wurde ein kleines bisschen schwummrig, als ihm die frische Luft entgegenschlug und er merkte, dass er doch mehr getrunken hatte als gedacht. Die Wohnung von Watties Vater lag hoch oben auf einem Hügel hinter der Stadt. Von hier oben konnte man bis rüber zu den Werften sehen, bis auf die andere Seite des Clyde. Auf den fernen Hügeln lag noch Schnee, der jetzt im Licht der untergehenden Sonne rosa glühte.
»God’s own country«, sagte Sag-ruhig-Ken, als sie den Hang hinunter gingen. »Beste Aussicht der Welt.«
God’s own country schön und gut. Vielleicht auf der anderen Seite vom Fluss, rund um die Hügel und Seen von Argyll, aber Greenock war alles andere als das. Die ganze Stadt wirkte grau, Menschen mit griesgrämigen Gesichtern eilten vorbei, alle eingewickelt gegen den kalten Wind, der ihnen vom Wasser aus entgegenschlug. Sie kamen an einigen verrammelten Geschäften vorbei, die Fenster waren mit Holzlatten vernagelt und die Latten mit Graffiti besprüht. Eine Gruppe Jugendlicher saß auf einem Autowrack, die Scheiben waren zerschlagen, in einer Mülltonne loderte ein Feuer und erleuchtete die Szene. Wie in Glasgow standen auch hier junge Männer an den Ecken und froren in winzigen Bomberjacken und Schlaghosen. Alle hatten verkniffene Gesichter, ließen Zigaretten und Dosen herumgehen, waren auf Krawall gebürstet.
Wie vorausgesehen, war der Chinese eine schmierige Klitsche. Was aber niemanden davon abhielt, sich vollzustopfen. Watties Brüder kamen gleichzeitig mit ihnen an. Beide sahen aus wie Sagruhig-Ken – dunkle Haare, ungefähr eins siebzig groß. Gott weiß, wie Wattie hatte passieren können. Wusste der Milchmann mehr? James war Tischler, Robby Klempner. Nette junge Männer, aber du liebe Güte, sie konnten was vertragen. Noch mehr Bier, Frühlingsrollen, Rippchen, Curry, Chow Mein, dann doppelte Brandys und gebackene Bananen zum Nachtisch. McCoy pickte an allem nur herum und erklärte, es sei ganz köstlich.
Nach dem Essen gingen sie ins Imperial, eine der angeblich nettesten Kneipen in Greenock, wo noch ein paar Schulfreunde von Wattie zu ihnen stießen. Sie setzten sich nach hinten, schoben ein paar Tische zusammen. Wattie fragte McCoy alle fünf Minuten, ob’s ihm gut ging und ob er Spaß hatte, und kippte selbst ein Bier nach dem anderen runter, die ihm andere in die Hand drückten, um »aufs Baby anzustoßen«. McCoy behauptete, er habe total viel Spaß, achtete aber darauf, sich nicht dabei erwischen zu lassen, wie er auf die Uhr sah. Er überlegte, wann er sich frühestmöglich aus dem Staub machen konnte, ohne unhöflich zu erscheinen.
Er wollte gerade eine weitere Runde am Tresen bestellen, als James sich neben ihn schob und ihm ein Tütchen Speed zusteckte. Das war’s dann. Nach ein paar Lines vom Spülkasten im Männerklo geschnieft, hatte er seine besten Vorsätze vergessen.
Drei Stunden später war er immer noch da und nicht im Bett, um endlich mal früher zu schlafen. Stattdessen war er hellwach, stand an der Bar in einem Laden namens Rotunda und kaute seine Lippe. Möglicherweise war’s nicht mal der schlimmste Club, in dem er je war, aber nah dran. Irgendein Club im Keller einer Bar, das Gebäude gehörte irgendwie zum Busbahnhof. Die ganze Kneipe war offensichtlich von jemandem eingerichtet worden, der ausschließlich auf Orange stand. Orangefarbene Wände, orangefarbener Teppichboden, orangefarbene Lampenschirme aus Plastik über der Bar. Typisch Greenock, Glamour ohne Ende.
McCoy lehnte sich an den Tresen und sah zu, wie der Barmann einem schwankenden Betrunkenen in einem braun karierten Anzug mit dem breitesten Jackett-Aufschlag, den McCoy je gesehen hatte, zu erklären versuchte, dass er genug getrunken hatte. Wie vorauszusehen, wollte der Betrunkene aber nichts davon hören, und so wurde gestritten. Er sah ihnen zu und fragte sich, ob die Bombe in der West Princes Street wirklich der Beginn einer schlimmen Serie war. Vielleicht würden in Glasgow demnächst noch mehr Bomben hochgehen. Er dachte an den Mann, diesen Paul, wie er da gehockt hatte und das Ding zusammenbauen wollte. Wahrscheinlich war er sofort tot, er konnte gar nicht gemerkt haben, was ihm da passierte. Egal für welche Ziele man kämpfte, sie konnten es nicht wert sein, dass man sich dafür in die Luft jagte. Die eigentliche Frage, die sie sich stellen mussten, war eher, für wen die Bombe bestimmt war, wen sie eigentlich hätte treffen sollen.
Am Tresen wurde immer noch gestritten, inzwischen zeigten sie gegenseitig mit den Fingern auf sich. McCoy sah auf die Uhr, kurz nach eins. Allmählich näherten sie sich dieser gefährlichen Zeit. Der Zeit, wenn sich die Aufreißer, die Pärchen und die One-Night-Stands gefunden hatten und den Übrigen klar wurde, dass sie nicht dazugehörten. Sie tranken dann noch mehr und suchten Gründe, beleidigt zu sein. Verschüttetes Bier, eine Bemerkung, Lob für den falschen Fußballverein.
Er sah Wattie im Spiegel hinter der Bar. Seine Krawatte war offen, die Haare zerzaust, er hing zwischen seinen beiden Brüdern auf der orangefarbenen Kunstlederbank an der Wand. Für einen so großen Kerl vertrug er wirklich gar nichts. McCoy dachte, Wattie würde ihn nicht vermissen, wenn er sich jetzt einfach verzog. Am Montag würde er ihn ja wieder auf der Arbeit sehen, vorausgesetzt, Mary ließ ihn am Leben, wenn er in diesem Zustand nach Hause kam. McCoy wollte gerade den letzten Schluck seines doppelten Bells trinken, den er sich als Absacker aufgehoben hatte, um das Tempo ein bisschen runterzufahren, als ihm jemand auf die Schulter tippte.
Er seufzte. Fast wäre er unbehelligt davongekommen. Er beschloss, es zu ignorieren in der vagen Hoffnung, dass er es sich nur eingebildet hatte. Aber es funktionierte nicht, wieder ein Tippen, dieses Mal fester. Soweit er sah, gab es zwei Möglichkeiten. Er konnte seine Polizeimarke ziehen und den Typen ermahnen, sich nicht zum Affen zu machen, oder er konnte so tun, als wäre nichts und einfach verschwinden. Sobald er den Mund aufmachte, würde er sich für das eine oder das andere entscheiden müssen. Sein Glasgower Akzent würde ihn verraten und mehr brauchte ein besoffener Greenock Wide Boy nicht, um eine Schlägerei vom Zaun zu brechen. Er schluckte den letzten Rest Whisky, verzog das Gesicht und drehte sich um.
»Kann ich dir helfen, mein Freund?«, fragte er möglichst unfreundlich.
Als Erstes fiel ihm auf, dass der Mann lächelte, als Zweites, dass er Hände wie verfluchte Schinken hatte. Außerdem zwei große Ringe an Fingern der linken.
»Jemand hat behauptet, Sie sind Bulle«, sagte er.
Waschechter amerikanischer Akzent, wie im Kino. Jetzt, da er ihn ansah, leuchtete es ihm ein. Weiße Zähne, blonder Bürstenschnitt, blauer Blazer mit silbernen Knöpfen über einem hellen, karierten Hemd. Er sah ein bisschen aus wie Jack Nicklaus. McCoy nickte.
»Darf ich Sie auf einen Drink einladen?«, fragte der Mann. »Whisky?«
McCoy nickte erneut, wusste nicht so genau, was das sollte.
Der Mann zeigte in eine ruhige Ecke weiter hinten im Club. »Setzen Sie sich da hin«, sagte er. »Ich bring ihn rüber.« Und dann tauchte er im Gedränge am Tresen unter.
McCoy fand einen freien Stuhl an einem winzigen runden Tischchen und zog einen weiteren heran. Hier in der Ecke, weit weg von der Tanzfläche, war »Do the Bump« nur noch als fernes Dröhnen im Hintergrund zu hören. Er zog seine Kippen aus der Tasche, zündete sich eine an und fragte sich, was der Typ von ihm wollte, beschloss dann aber, dass es ihm eigentlich egal war. Er wollte gerade los, als er den Mann durch die Menge auf der Tanzfläche mit einem kleinen Tablett, zwei Whiskys und zwei Pints auf sich zukommen sah. Gott weiß, was Amerikaner zu essen bekamen, es musste jedenfalls gut sein, denn der Kerl war ungefähr genauso breit wie lang. Er stellte das Tablett auf dem Tischchen ab. Grinste und zeigte darauf.
»Ich hab Ihnen auch noch ein Bier geholt«, sagte er. »Anscheinend macht man das hier so.« Er streckte McCoy eine Hand hin. »Andrew Stewart.«
McCoy schlug ein, sein bleiches Händchen verschwand in der riesigen Pranke seines Gegenübers.
»Harry McCoy«, sagte er und hob das Bier. »Prost.«
Stewart setzte sich, nahm einen Schluck Bier, verzog das Gesicht.
»Tut mir leid«, sagte er. »Hab mich immer noch nicht an das Bier hier gewöhnt.« Er zeigte auf Wattie und seine Freunde. »Ich hab gehört, wie einer der Jungs da drüben gesagt hat, Sie sind Polizist?« McCoy nickte. »Super, vielleicht könnten Sie mir helfen. Mein Sohn ist verschwunden.«
Also das war’s. Er wollte Beratung unter der Hand. McCoy ließ sich gern einen ausgeben, aber er würde sich auf keinen Fall auf so etwas einlassen, nicht zu dieser Uhrzeit. Außerdem hatte er die perfekte Ausrede. Er hob die Hand.
»Verzeihung, dass ich Sie unterbrechen muss, Andy, aber ich bin Polizist in Glasgow. Das hat hier gar nichts zu bedeuten. Sie müssen mit jemandem aus Greenock sprechen.«
»Hab ich schon«, sagte Stewart. »Reine Zeitverschwendung, der Fall interessiert die nicht.«
»Damenwahl!«, überschrie der DJ die ersten Klänge von »Seasons in the Sun«. »Los schnappt sie euch!«
McCoy wartete, bis er wieder die Klappe hielt, dann fragte er: »Wie alt ist Ihr Sohn?«
»Zweiundzwanzig«, sagte Stewart. »Erst vor Kurzem zweiundzwanzig geworden …«
»Und wie lange wird er schon vermisst?«, fragte McCoy.
»Drei Tage«, erwiderte Stewart. »Ich bin gestern hier angekommen und direkt vom Flughafen zur Polizei …«
McCoy hob erneut die Hand, fest entschlossen, ihn abzuwürgen und zu gehen.
»Das ist das Problem«, sagte er. »Er ist erwachsen und wird noch nicht lange vermisst. Ehrlich gesagt, so ein Fall hat nirgendwo Priorität.« Bis seine Leiche gefunden wird, dachte er, aber so anzufangen hatte jetzt keinen Sinn. »Vielleicht wär’s besser, einen Privatdetektiv einzuschalten.«
»Das haben die auch gesagt.« Stewart kramte in seiner Tasche und zog eine Karte heraus. »Die haben mir einen gewissen …« Er sah auf die Karte. »Bernard Raeburn empfohlen.«
»Oh Gott!«, sagte McCoy. »Das ist wirklich der Letzte, den Sie brauchen, der ist absolut unfähig. Lassen Sie mich mal nachdenken, es muss jemand Besseres geben …«
Er blickte auf und sah Wattie, er schwankte vor und zurück, das Gesicht grau, die Augen halb geschlossen.
»Ich muss nach Hause«, sagte er. »Mir geht’s nicht gut und Mary bringt mich um. Ich bin im Arsch, Harry. Du musst mir helfen.« Mit diesen Worten wandte er sich ab und kotzte auf die Tanzfläche.
»Verfluchte Scheiße!«, sagte McCoy und zog seine Beine weg, damit sie keine Spritzer abbekamen. Stewart guckte entsetzt. Wattie wischte sich den Mund am Jackettärmel ab. Sah elend aus.
»Mir geht’s nicht gut«, sagte er. »Ich glaube, das Chow Mein war nicht gut.«
Die Barleute sahen ihn an, wirkten alles andere als erfreut. Ein breitschultriger Mann mit hochgekrempelten Hemdsärmeln, unter denen 1690-Tätowierungen zum Vorschein kamen, stieß die Barklappe auf und kam auf sie zu.
»Ja, leck mich am Arsch, Dougie!«, rief James und tauchte plötzlich aus dem Trockeneisnebel auf der Tanzfläche auf. »Du stinkender Drecksack!«
McCoy kippte seinen Whisky runter, stand auf und legte seinen Arm um Wattie, stützte ihn, wandte sich dabei aber möglichst von ihm ab, um dem Kotzegestank aus seinem Mund zu entgehen.
»James, du fängst den Barmann ab«, sagte er. »Und ich bring den bescheuerten Blödmann hier nach Hause.«
Stewart saß immer noch da, das Bier auf halbem Wege zum Mund, Entsetzen stand ihm ins Gesicht geschrieben.
»Tut mir leid, mein Freund, ich muss los«, sagte McCoy. »Viel Glück.« Dann versuchte er, Wattie zur Tür zu lotsen, schrie dabei über seine Schulter. »Nicht vergessen! Finger weg von Raeburn, sparen Sie Ihr Geld.«
Stewart nickte und stand auf. Der Barmann tauchte hinter ihm auf, zog ihn am Arm und wirbelte ihn herum.
»Hey! Alter Freund! Ist die Schweinerei hier von dir?«
McCoy überließ es Stewart, den Kopf zu schütteln und dem Barmann zu erklären, dass er nichts damit zu tun hatte, während er selbst Wattie zur Treppe und zum Ausgang nach oben schob, möglichst schnell, bevor er noch mal kotzen konnte. Von wegen Chow Mein. Zehn Bier kam schon eher hin.
13. April 1974
Drei
Der Wecker klingelte. McCoy tastete danach, schaltete ihn aus und stöhnte. Sieben Uhr. Er brauchte ein paar Sekunden, bis ihm wieder einfiel, wo er sich befand. Plötzlich sah er alles vor sich. Er war im Sea-View Boarding House in Greenock. Er setzte sich auf, fühlte sich gar nicht mal so schlecht, wenn man bedachte, dass es nach zwei war, als er Wattie nach Hause gebracht hatte und anschließend selbst ins Bett gefallen war. Er konnte sich ungefähr vorstellen, wie Wattie sich jetzt fühlte. Auf dem Nachhauseweg hatte er sich noch ein paarmal übergeben. Der blöde Idiot hatte immer wieder behauptet, es läge nicht am Alkohol, sondern einzig und allein am Chow Mein.
McCoy war es schließlich gelungen, ihn erst den Hang und dann zu Hause die Treppe hinauf zu verfrachten. Er hatte an die Wohnungstür geklopft und gehofft, Sag-ruhig-Ken würde sie reinlassen, aber kein Glück. Die Tür wurde aufgerissen und Mary stand im Nachthemd da, der kleine Duggie brüllte auf ihrem Arm. Ihr Gesichtsausdruck hätte auch den stärksten Mann in die Knie gezwungen. Wattie stolperte an ihr vorbei, knallte gegen den Garderobenständer und fiel mit dem Gesicht voran auf den Teppich. Dort blieb er leise schnarchend liegen, während McCoy versuchte, das Baby zu beruhigen und Mary zu erklären, dass es nicht seine Schuld war. Ehrlich.
Mary wollte nichts davon hören. Sie erklärte ihm, er sei ein unfähiger Blödmann, der nicht hätte zulassen dürfen, dass Wattie sich so zuschüttet. McCoy versuchte ihr zu sagen, dass Watties Brüder ihn angestiftet hatten, aber sie hörte schon nicht mehr hin, hatte mit dem schreienden Baby genug zu tun. Sie ließ McCoy an der Tür stehen, trat Wattie auf dem Rückweg ins Schlafzimmer kräftig in die Seite und knallte die Tür zu. Wattie blieb schnarchend liegen, ahnte nicht, was ihm am Morgen nach dem Aufstehen blühte, wenn Mary ihn sich vorknöpfen würde.
Um halb acht war McCoy gewaschen und angezogen, nahm seine kleine Reisetasche und ging die Treppe hinunter in den Speiseraum. Es roch nach Speck und verbranntem Toast. Sein Magen knurrte, er hatte am Abend zuvor eigentlich kaum etwas gegessen, aber jetzt war keine Zeit mehr für seinen verordneten Porridge. Stattdessen nahm er sich vor, in ungefähr zwei Stunden irgendwo an der Straße zu halten, jetzt wollte er erst mal schnell los. Ein Kaffee und eine Zigarette würden ihn auf Trab bringen.
Der Frühstücksraum war in einem fröhlichen Gelb gehalten, ein heller Raum auf der Vorderseite des Hauses. Große Fenster, hübsche Aussicht auf den Clyde und die schneebedeckten Hügel auf der anderen Seite des Flusses. Die Tische waren für das Frühstück gedeckt, gefaltete Servietten und eine kleine Speisekarte jeweils darauf. Ein Paar mittleren Alters saß bereits dort, beide waren gekleidet, als wollten sie wandern gehen, sie hielten die Köpfe über eine ausgebreitete Generalstabskarte gesenkt. McCoy setzte sich an einen Tisch am Fenster und bestellte Kaffee bei der jungen Kellnerin, die, ihrem Aussehen und dem gebrummten Hallo nach zu urteilen, eine ebenso lange Nacht hinter sich hatte wie er selbst. An der Wand hing ein Gestell mit Zeitungen. Alle Schlagzeilen lauteten irgendwas mit BOMBE und KONFLIKT ERREICHT SCHOTTLAND. Keine Lust, das Zeug zu lesen.
Er hatte seinen Kaffee getrunken und drückte gerade seine Zigarette in dem »Souvenir aus Dunoon«-Aschenbecher aus, als ein Cortina mit einem Aufkleber von CLYDE TAXIS draußen vorfuhr.
Der Amerikaner vom Vorabend stieg aus, spähte zu den Fenstern herein. Anscheinend übernachtet er auch hier, dachte McCoy, und überlegte sofort, wie er sich davonstehlen konnte, ohne mit ihm reden zu müssen. Zu spät, Stewart hatte ihn bereits durchs Fenster entdeckt und winkte ihm breit grinsend. Er steckte dem Taxifahrer ein paar Scheine zu, holte seine Tasche aus dem Kofferraum und ging zur Haustür.
McCoy fluchte, blieb aber schicksalsergeben an seinem Tisch sitzen. Wenige Sekunden später wurde die Tür zum Speiseraum geöffnet und Stewart walzte herein, dicht gefolgt von der Kellnerin und der Pensionswirtin.
»Junge, Sie sind ganz schön schwer zu finden«, sagte er. »Das ist wahrscheinlich die sechste Pension, die ich aufsuche. Die Jungs von gestern Nacht konnten sich nicht mehr erinnern, in welcher Sie abgestiegen sind.«
Er zeigte auf den Platz McCoy gegenüber, der nickte, und der Amerikaner setzte sich. Der gestrige Blazer war jetzt einer Strickjacke mit Reißverschluss gewichen, dazu trug er eine karierte Hose und Bootsschuhe. Er sah wirklich aus wie Jack Nicklaus.
»Wie geht’s Ihrem Kumpel heute Morgen?«, fragte Stewart. »Hat lange gedauert, bis ich den Barmann davon überzeugen konnte, dass nicht ich ihm den ganzen Boden vollgekotzt hatte. Angetan war er nicht, das können Sie mir glauben.«
»Wattie?«, sagte McCoy. »Dem geht’s gut, eine Flasche Irn-Bru und ein Speckbrötchen, dann ist er geheilt. Das Problem ist eher der Anschiss, den er von seiner Frau bekommt.«
Stewart guckte ratlos, nickte aber trotzdem.
McCoy stand auf, streckte ihm eine Hand entgegen. »Jedenfalls schön, Sie wiedergesehen zu haben, und viel Glück bei der Suche nach Ihrem Sohn. Ich muss jetzt los, bin spät dran.«
Stewarts Fröhlichkeit schwand. »Was? Aber ich muss mit Ihnen reden. Ich habe Sie den ganzen Morgen gesucht. Wo wollen Sie hin?« Er warf die Hände in die Höhe. »Verzeihung, das geht mich gar nichts an, aber …«
»Nach Aberdeen«, sagte McCoy und nahm seine Tasche. »Ich muss los.«
»Aberdeen?«, fragte Stewart. »Ist das weit?«
»Oben im Norden«, sagte McCoy. »Ungefähr hundertfünfzig Meilen von hier.«
McCoy bekam ein schlechtes Gewissen beim Anblick von Stewarts enttäuschter Miene, der arme Kerl sah aus, als hätte er fünf Pfund verloren und nur eins wiedergefunden.
»Hören Sie«, sagte McCoy. »Wenn Sie in den nächsten Tagen in Glasgow sind, kommen Sie bei mir vorbei. Stewart Street Station, ist nicht weit vom Zentrum, jeder kann Ihnen sagen, wo das ist …«
»Darf ich mit Ihnen fahren?«, platzte es aus Stewart heraus. »Bitte? Tut mir leid, aber was Sie gestern Abend in fünf Minuten gesagt haben, hat mehr Sinn ergeben als alles, was die Polizisten in Greenock in drei Stunden von sich gegeben haben. Sie scheinen zu wissen, was …«
»Das ist keine gute Idee …«
»Bitte«, sagte Stewart erneut. »Er ist mein einziges Kind. Er ist alles, was ich noch habe. Ich bin so weit gereist und renne überall gegen Mauern. Ich kann nicht …«
Plötzlich traten ihm Tränen in die Augen. Er schnappte sich eine Serviette vom Tisch, wischte sie weg.
»Tut mir leid, ich weiß nicht, was ich sonst tun soll. Ich dachte, Sie könnten mir helfen. Ich habe so darauf gehofft.«
Stewart versuchte, sich zusammenzureißen, rieb sich wieder die Augen. Er war ein großer stämmiger Typ, voller Selbstvertrauen wie die meisten Yanks, aber McCoy tat er auch ein bisschen leid. Egal wer er war, er wirkte verloren in einem ihm unbekannten Land auf der Suche nach seinem verschwundenen Sohn, für den sich offenbar niemand interessierte. McCoy würde kein Zacken aus der Krone brechen, wenn er sich seine Geschichte anhörte und ihm ein paar Ratschläge gab.
»Warum nicht?«, sagte McCoy. »Sie können mir Gesellschaft leisten.«
Breites Grinsen auf Stewarts Gesicht, er packte McCoys Hand, pumpte damit auf und ab.
»Danke, mein Freund. Sie sind ein guter Kerl. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Ich mache Ihnen auch keine Umstände. Versprochen.«
McCoy spähte durch die verregnete Windschutzscheibe, sah das Schild nach Dunblane, noch vier Meilen. Dunblane bedeutete vor allem eins: das Fourways Café, traditionell die beste Anlaufstation für einen Zwischenhalt auf der Fahrt in den Norden. Sie waren jetzt schon seit ein paar Stunden unterwegs und gut vorangekommen, McCoys Magen knurrte wieder. Zeit, anzuhalten und aufzutanken. Er blickte zum Beifahrersitz. Stewart hatte recht behalten, er hatte ihm wirklich keine Umstände gemacht … hauptsächlich deshalb, weil er zwei Stunden lang tief und fest geschlafen hatte. Eingezwängt auf dem Beifahrersitz des Viva schnarchte er jetzt immer noch leise. Kaum hatte er im Wagen gesessen, hatte er schon angefangen zu gähnen und McCoy erklärt, dass er wegen dem Jetlag die ganze Nacht nicht geschlafen habe. Kaum hatten sie die Kingston Bridge überquert, war er auch schon eingedöst. Seitdem hatte er gepennt.
McCoy bog aus dem Kreisverkehr ab und auf den Parkplatz des Cafés, machte den Motor aus. Er beschloss, Stewart schlafen zu lassen und erst mal in Ruhe zu frühstücken, aber kaum stieg er aus dem Wagen, schlug Stewart die Augen auf, sah sich um.
»Sie sind eingeschlafen«, sagte McCoy.
»Tut mir leid«, erwiderte Stewart und setzte sich auf. »Sind wir schon da? Ist das Aberdeen?«
»Noch lange nicht«, antwortete McCoy. »Kommen Sie, Zeit fürs Frühstück.«
Im Fourways herrschte reger Betrieb wie immer. Sie mussten ein paar Minuten warten, bis der junge Mann, der die Aufgaben eines Kellners versah, einen Tisch abgeräumt hatte, sodass sie sich setzen konnten. McCoy zwang sich, Porridge zu bestellen. Stewart nahm frisch gepressten Orangensaft, Pancakes mit Ahornsirup und extra kross gebratenem Speck. Er bekam ein Würstchen im Schlafrock, ein Speckbrötchen und eine Dose Fanta. Nach ein paar Bissen schien er mit seinem »eingepackten Würstchen« durchaus zufrieden zu sein. »Wie ein Burger, aber mit Pfiff«, lautete sein Urteil.
Zehn Minuten und ein bisschen Small Talk über den Flug aus Amerika und das Wetter später schob McCoy seine leere Schüssel zur Seite und zündete sich eine Zigarette an.
»Okay. Erzählen Sie mir die Geschichte«, sagte er. »Fangen Sie einfach von vorn an.«
Stewart nickte, trank seinen Kaffee aus, verzog das Gesicht und legte los.
»Vor drei Tagen habe ich zu Hause in Beacon Hill einen Anruf erhalten.«
»Beacon Hill?«, fragte McCoy.
»Boston«, sagte Stewart und fuhr fort. »Es hieß, mein Sohn Donald habe sich unerlaubt von der Truppe entfernt, er sei nach seinem Landurlaub nicht auf sein Schiff zurückgekehrt.«
»Welches Schiff?«, fragte McCoy und merkte, dass er die Frage längst hätte stellen sollen. »War er am Holy Loch stationiert?«
Stewart nickte. »Genau.«
Der Holy Loch lag von Greenock aus gesehen auf der anderen Seite, und an dessen Ufer, in der Nähe von Dunoon, befand sich ein riesiger amerikanischer Marinestützpunkt, unter anderem für Atom-U-Boote. Manchmal sah man Matrosen in Greenock, die mit protzigen Angeberschlitten herumfuhren, die sie aus den USA mitgebracht hatten. Ein paar Hundert Soldaten waren dort stationiert, sie hatten eigene Schulen, Bowlingbahnen und Restaurants, ein bisschen so, als wäre eine amerikanische Kleinstadt vom Himmel gefallen und am Ufer des Clyde gelandet.
»Er dient auf der USS Canopus«, fuhr Stewart fort. »Ist Division Officer. Ungefähr sechs Monate war er da.«
Irgendwie kam McCoy die Geschichte komisch vor.
»Moment mal, die rufen Sie in Amerika an, nur weil er einen Tag überfällig ist?«, fragte er. »Ist das nicht ein bisschen voreilig? Betrinken sich Matrosen nicht andauernd und kehren zu spät zum Stützpunkt zurück? Oder hab ich nur zu viele Filme gesehen?«
Stewart schüttelte den Kopf. »Nein, Sie haben recht. Das ist auch nicht das normale Verfahren. Der Anruf war eine Gefälligkeit, man wollte mich vorwarnen.«
»Wie nett«, sagte McCoy. »Mir war nicht bewusst, dass die amerikanische Navy so freundlich ist.«
Stewart lehnte sich zurück. »Ehrlich gesagt sind die möglicherweise auch nicht zu allen so freundlich. Sagen wir mal, ich habe darum gebeten, dass man mich auf dem Laufenden hält.«
»Und wie geht das?«, fragte McCoy.
Stewart guckte ein bisschen verlegen. »Na ja, bis zu meiner Pensionierung gehörte ich selbst dazu. Ich war Captain.«
»Klingt nach einem hohen Tier«, sagte McCoy.
»Der derzeitige Commander der Canopus war einer meiner Lieutenants. Er dachte, ich würde es wissen wollen, aber er dachte auch, dass Donny am nächsten Tag zurückkommt. Er wollte, dass ich ihn anrufe und zusammenstauche. Ihm zu verstehen gebe, dass man ihn im Auge behält und er sich keine weiteren Dummheiten erlauben darf.«
»Aber dann ist er am nächsten Tag nicht zurückgekommen …«, sagte McCoy.
»Nein«, erwiderte Stewart, »und am übernächsten auch nicht. Ich bin sofort in ein Flugzeug gestiegen und nach Prestwick geflogen. Hatte aber gehofft, dass er zurück ist, wenn ich dort ankomme.«
»Was ist mit seiner Mutter, was sagt sie denn dazu?«
»Grace lebt schon seit zehn Jahren nicht mehr«, sagte Stewart. »Krebs.«
»Das tut mir sehr leid«, sagte McCoy.
Stewart nickte. »Sie würde mir nie verzeihen, wenn ich nicht alle Hebel in Bewegung setze, um ihn zu finden.«
McCoy dachte kurz nach. »Ich weiß nicht so genau, wie ich das formulieren soll, aber ist er einer, der einfach so verschwindet? Der öfter mal in Schwierigkeiten steckt?«
Stewart schüttelte den Kopf. »Eben nicht. Manchmal hab ich mir das sogar gewünscht, dass er einfach hin und wieder mal Dampf ablässt, sich betrinkt, ein Mädchen abschleppt. Aber dafür ist er nicht der Typ, er ist ein sehr schüchterner Junge. Sehr still, umso mehr seit Grace’ Tod. Ich war nicht mal sicher, ob er überhaupt die Grundausbildung übersteht, aber er hat es geschafft. Dann wurde er hier stationiert, darüber hat er sich total gefreut.«
McCoy blickte in den grauen Himmel und dann auf den verregneten Parkplatz voller Pfützen.
»Gefreut hat er sich?«, fragte er. »Wirklich? Wollen Sie mir weismachen, hier ist es schöner als in Pearl Harbor?«
Stewart nickte. »In Donnys Augen schon. Wenn ich im Ausland war, hat er bei seinem Großvater gewohnt, und der hat ihm immer erzählt, eigentlich sei er ja Schotte, dass sei sein Erbe, Schottland sei seine wahre Heimat.«
McCoy sah ihn zweifelnd an.
Stewart hob die Hände. »Ich weiß, mir müssen Sie das nicht erzählen. Er ist Amerikaner durch und durch, so amerikanisch wie Apple Pie, aber sein Großvater sieht das anders. Nein, Sir. Unsere Familie stammt ursprünglich aus Schottland, von dort aus sind sie über Neufundland nach Boston ausgewandert. Walfänger, später dann Navy. Vielleicht hat mein Vater es umso mehr bei Donny versucht, weil er’s nicht geschafft hatte, mich zum Schotten zu machen. Ich sitze lieber in Shorts auf einem Fischerboot in South Carolina und fange Schwertfische mit der Sonne im Rücken und einem Bier in der Hand. Das haben Grace und ich jeden Sommer gemacht, aber Donald fährt total auf Schottland ab. Ein Bild von Robert the Bruce und Landkarten, auf denen sämtliche Clans eingezeichnet sind, hängen bei ihm an der Wand. Als Junge hatte er sogar ein schottisches Fußballtrikot, weder Geld noch gute Worte konnten ihn davon überzeugen, auch mal eins von den Patriots anzuziehen, und glauben Sie mir, ich hab’s versucht. Immer wieder.«
»Und was haben die von der Navy gesagt, als Sie dort angekommen sind?«, fragte McCoy.
Stewart zuckte mit den Schultern. »Nicht viel. Wie Sie gesagt haben, besonders in ausländischen Häfen entfernen sich ständig Matrosen von der Truppe. Die haben mir nur gesagt, was ich schon wusste. Normalerweise kommen sie zurück, wenn ihnen das Geld ausgeht oder die Frau, bei der sie untergekrochen sind, sie auf die Straße setzt.«
»Kann das nicht auch bei Donald so sein?«, fragte McCoy. »Scheint mir die einfachste Erklärung.«
»Wissen Sie was? Ich wäre glücklich, wenn es so wäre«, sagte Stewart. »Die Sorgen halte ich gern aus, wenn ich wüsste, dass er da draußen eine gute Zeit hat. Aber Donny ist nicht so. Wie gesagt, er ist kein Abenteurer.« Stewart sah McCoy an. »Deshalb mache ich mir Sorgen.«
McCoy stand auf. »Ich habe morgen frei. Wenn er heute nicht auftaucht, hören wir uns gemeinsam um. Aber ab Montag bin ich dann wieder im Dienst. Abgemacht?«
Stewart nickte, wirkte erleichtert. Er griff in seine Tasche und zog eine Rolle Zwanziger heraus. »Ich kann Sie bezahlen, ist kein Problem.«
»Stecken Sie Ihr Geld wieder ein«, sagte McCoy. »Seien Sie nicht albern.« Dann überlegte er kurz. »Aber wenn Sie großzügig sein wollen, könnten Sie den Sprit bezahlen. Wir sind schon auf Reserve.«
Stewart guckte verständnislos.
»Das Benzin«, sagte McCoy.
Stewart nickte. »Ah! Sehr gerne.«
Sie standen auf, gingen zur Tür.
»Sie haben gar nicht gesagt, warum Sie nach Aberdeen fahren«, sagte Stewart.
»Ich muss dort jemanden abholen«, sagte McCoy. »Ist eine Gefälligkeit.«
Stewart nickte, sie traten aus dem Café hinaus in den Regen und rannten zum Wagen. McCoy hatte nicht gelogen, er war unterwegs, um jemanden abzuholen. Das Problem war nur, dass derjenige gar nichts davon wusste.
Vier
Das Gefängnis Peterhead befand sich auf den Klippen vor Aberdeen über einer Bucht, ein riesiger Wellenbrecher unterhalb hielt die zornig tosende Nordsee in Schach. Der Komplex bestand aus einer elenden Reihe flacher, rechteckiger Gebäude, roh verputzt mit winzigen Fenstern, die Höfe dazwischen waren mit Drahtnetzen überspannt und gesichert. An den meisten Tagen kamen Wind und Regen vom Meer herübergefegt, sie rüttelten an den Fenstern, rissen Bäume aus, ließen Wärter, so schnell sie konnten, ins Gebäude zurückeilen. Die anderen Gefängnisse schickten ihre besonders schweren Fälle nach Peterhead. Solche, die Beamte oder andere Insassen angegriffen hatten, weil sie so geladen waren, so wütend und frustriert, dass sie beim geringsten Anlass austickten. Sie wurden in einen Transporter verfrachtet und hier hoch in den Norden gebracht, an einen Ort, vor dem selbst sie sich fürchteten.
»Wir fahren in ein Gefängnis?«, fragte Stewart, als sie von der Hauptstraße abbogen und er das Schild las.
»Genau«, sagte McCoy. »Ein Freund von mir ist in Schwierigkeiten geraten, nichts Ernstes. Er wird heute entlassen.«
Wäre er Pinocchio, dachte McCoy, würde seine Nase jetzt die Windschutzscheibe durchstoßen. Aber was Stewart nicht wusste, würde ihn auch nicht weiter beunruhigen. Er fuhr auf den Kiesparkplatz, machte den Motor aus, sah durch die Scheibe hinaus zu dem großen Tor und dem Gefängnis dahinter.
»Was für ein höllischer Kasten«, sagte Stewart. »Daneben sieht der Knast in Miramar direkt gemütlich aus.«
McCoy schaute auf die Uhr. Fünf vor eins. Perfektes Timing. Er erklärte Stewart, er würde höchstens zehn Minuten brauchen, und stieg aus. Sofort spürte er den bitterkalten Wind, der vom Meer heranwehte. Unten in Glasgow war es April und der Frühling machte sich bemerkbar. Hier oben nicht, hier war noch Winter. Er stellte den Kragen seines Jacketts auf, schob die Hände in die Taschen und ging zum Tor. Die Nordsee krachte grau und zornig an die Felsen, Gischt sprühte auf. Er schmeckte das Salz in der Luft, die Kälte fuhr ihm in die Knochen und er fragte sich, ob hier überhaupt jemand freiwillig lebte.
Draußen warteten einige wenige Menschen, sahen jämmerlich aus. Ein etwas älteres Paar, eine junge Frau mit einem kleinen Jungen, dick eingepackt in einen Anorak und mit blauer Strickmütze. McCoy nickte zur Begrüßung und stellte sich dazu. Nach mehreren Versuchen gelang es ihm, sich eine Zigarette anzuzünden. Ihm wurde bewusst, dass er ausnahmsweise mal keine Magenschmerzen hatte. Vielleicht war das mit dem Porridge ja tatsächlich eine gute Idee.
»Kann nicht mehr lange dauern, mein Lieber«, sagte der ältere Mann und sah auf seine Armbanduhr. »Wenn die Dreckschweine eins sind, dann pünktlich, das muss ich denen lassen.«
Kaum hatte er es gesagt, ging die in das Haupttor eingelassene Tür auf und ein junger Mann mit kahl rasiertem Schädel, Jeansjacke und Jeans, trat mit einer Tasche unter dem Arm nach draußen. Er verzog sofort das Gesicht wegen der Kälte.
Der kleine Junge schrie »Daddy!« und rannte ihm entgegen, sprang ihm in die Arme. Hinter ihm kam ein Mann, winkte dem älteren Paar und ging zu ihnen. Dann nichts. Niemand mehr. McCoy fluchte leise. Wenn er das falsche Datum bekommen hatte und noch mal hier rausfahren musste, würde ihn das ganz schön anpissen. Er wartete noch ungefähr eine Minute, wischte sich die Gischt aus dem Gesicht, dann drehte er sich zum Wagen um. Im selben Moment hörte er eine vertraute Stimme.
»Scheiße, was machst du denn hier?«
Er drehte sich um, und Stevie Cooper trat aus der Tür, ein in braunes Papier eingewickeltes Päckchen in der Hand und ein breites Grinsen im Gesicht.
»Ihre Kutsche steht bereit«, erwiderte McCoy, verneigte sich und zeigte auf den ramponierten Viva.
Cooper kam näher, musterte ihn von oben bis unten. Wirkte nicht besonders angetan. »Du brauchst mal einen neuen Anzug«, sagte er. »Siehst schlimm aus.«
»Danke«, sagte McCoy. »Ich freu mich auch, dich zu sehen.«
»Na, komm schon«, sagte Cooper grinsend.
McCoy schüttelte den Kopf. »Nein.«
»Komm«, sagte Cooper. »Ich will dich nur umarmen. Hab dich vermisst.«
»Alles klar«, sagte McCoy, drehte sich um, wollte gehen, aber Cooper rührte sich nicht von der Stelle, blieb mit weit geöffneten Armen stehen. McCoy seufzte und beschloss, es einfach hinter sich zu bringen. Cooper packte ihn, klemmte McCoys Kopf unter seinen Arm und schrammte ihm mit den Fingerknöcheln über den Schädel.
»Gibst du auf?«, fragte er.
McCoy wollte Ja sagen, bekam aber kein Wort heraus, sein Gesicht war in Coopers Jacke vergraben.
»Was?«, fragte Cooper. »Ich verstehe dich nicht!«
McCoy brachte ein ersticktes »Ja« zustande und Cooper ließ ihn los. Er stolperte, fiel auf den nassen Kies und schüttelte den Kopf. »Wie oft noch? Verdammt«, sagte er. »Wie alt bist du, Cooper? Neun? Wir sind doch keine kleinen Kinder mehr.«
Cooper streckte die Hand aus, zog ihn zu sich. »Komm schon«, sagte er. »Hör auf zu jammern. Wo ist die nächste Kneipe?«
McCoy klopfte sich den Schmutz ab und sie gingen zusammen über den Parkplatz zum Wagen. Cooper blieb stehen. »Wer ist das?«, fragte er. »Da im Wagen.«
»Der?«, erwiderte McCoy, der selbst kaum glauben konnte, was er da sagte: »Das ist Andrew Stewart, Captain der United States Navy im Ruhestand.«
Cooper sah ihn an. »Willst du mich verarschen?«
»Ich erklär’s dir später«, sagte McCoy, öffnete die Wagentür. »Jetzt steig ein, ich frier mir den Arsch ab.«
Zwanzig Minuten später hatte Cooper ein Bier in der Hand und saß in der Ecke einer schäbigen Kneipe mit dem schönen Namen Peep Peeps Bar. Sie befand sich unten an den Docks und war die erste, die sie gefunden hatten. Sie waren die Einzigen dort, was nicht erstaunlich war, angesichts der kargen Begrüßung durch den Wirt und dem allgemeinen Zustand. Auf einem Regal an der Wand befand sich ein Fernseher, es liefen Pferderennen bei abgestelltem Ton, die schmalen Heizkörper konnten kaum etwas gegen die Kälte ausrichten. Cooper schüttete sich das halbe Pint in einem Zug in den Rachen, stellte es auf den Tisch. Stewart hatte angeboten, ein bisschen spazieren zu gehen, »damit ihr Jungs euch unterhalten könnt«, und war durch den strömenden Regen davonspaziert, um sich, wie er meinte, die Schiffe im Hafen von Aberdeen anzusehen.
»Oh Mann«, sagte Cooper und fuhr sich über den Mund. »Darauf hab ich mich lange gefreut! Hast du Kippen?«
McCoy reichte ihm ein Päckchen Number 10. Eigentlich sah Cooper aus wie immer, ein bisschen blasser, aber im Prinzip wie sonst. Blonde Tolle, rote Harrington, Jeans. Im Gefängnis schien er ein paar Muskeln bekommen zu haben, wirkte breiter als vorher. Musste wohl trainiert haben.
»Und wie war’s?«, fragte McCoy. »Dir ist unter der Dusche hoffentlich nicht die Seife aus den Fingern geflutscht.«
Cooper zuckte mit den Schultern. Lachte aber nicht.
»Ist das alles?«, fragte McCoy. »Du warst fast sechs Monate da drin. Irgendwas muss doch passiert sein.«
»Willst du’s wirklich wissen?«, fragte Cooper.
McCoy nickte, war aber plötzlich gar nicht mehr so sicher.
»Hol mir noch ein Bier, dann erzähl ich’s dir«, sagte Cooper.
McCoy ging zum Tresen, überlegte, woran es lag, dass Cooper so verändert wirkte. Dann wurde ihm bewusst, dass er sich gar nicht verändert hatte, im Gegenteil, er war wieder der Alte, so wie damals, als er dabei war, sich hochzuarbeiten. Bevor er der große Boss wurde, abgeschirmt von seinen Leuten und geschützt durch sein Geld.
Er war wieder der alte Cooper, der nichts zu verlieren und nichts zu fürchten hatte. Der gefährliche Cooper. Wodurch der Erfolg von McCoys Reise nach Aberdeen in weite Ferne rückte. Trotzdem musste er’s versuchen. Auf dem Tresen stand ein kleiner Wärmebehälter mit Glashaube, darunter zwei vertrocknete Pies. Dem Aussehen nach lagen sie schon seit Wochen dort.
»Willst du einen?«, fragte der Wirt und stellte zwei Pints auf den Tresen vor ihm ab.
McCoy schüttelte den Kopf.
»Selbst schuld«, sagte der Wirt und widmete sich wieder seiner Zeitung.
McCoy kehrte mit den Pints zurück, stellte sie auf den Tisch. Cooper nahm eine Münze, drehte sie über zwei Finger hin und her, wippte nervös mit dem Fuß. Er war angespannt, trank einen Schluck Bier und fing an zu reden. »Die Schweine fangen schon auf der Hinfahrt im Transporter an. Erklären dir, dass sie im Gefängnis auf dich warten, alles über dich wissen, dass sie dich zusammentreten und du eine Woche nicht mehr laufen kannst. Wenn du versuchst, einen von uns zu ficken, ficken wir dich.«
»Wen meinst du? Die Wärter?«
Cooper nickte. »In Barlinnie hab ich einem von den Schweinen was aufs Dach gegeben, deshalb haben die mich nach Peterhead geschickt. Du kommst im Gefängnis an und wirst in so eine Zelle