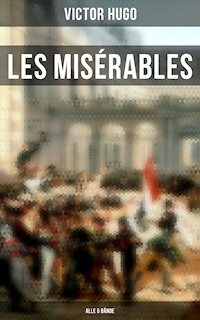Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Erotik
- Sprache: Deutsch
Victor Hugos Roman 'Die Arbeiter des Meeres' ist ein Meisterwerk der französischen Literatur des 19. Jahrhunderts. Das Buch erzählt die Geschichte eines einfachen Fischers, der sich auf eine gefährliche Mission begibt, um die Ehre seiner geliebten Insel Guernsey zu retten. Hugos literarischer Stil in diesem Werk ist geprägt von seiner tiefen Menschlichkeit und seinem Sinn für die Schönheit und Unberechenbarkeit der Natur. 'Die Arbeiter des Meeres' fängt die romantische und tragische Atmosphäre der Zeit perfekt ein und bleibt den Lesern bis zum Ende fesselnd. Victor Hugo, bekannt für seine Werke wie 'Les Misérables' und 'Der Glöckner von Notre-Dame', war ein Schriftsteller und politischer Aktivist im 19. Jahrhundert. Sein Engagement für soziale Gerechtigkeit und sein Talent für die Beschreibung von menschlichen Emotionen und Konflikten spiegeln sich deutlich in 'Die Arbeiter des Meeres' wider. Hugos eigenes Exil auf Guernsey während der politischen Unruhen in Frankreich inspirierte ihn zu diesem kraftvollen Roman. 'Die Arbeiter des Meeres' ist ein Buch, das sowohl Liebhaber der klassischen Literatur als auch Leser, die spannende Abenteuergeschichten genießen, begeistern wird. Victor Hugos meisterhafte Erzählung von Leidenschaft, Tapferkeit und Opferbereitschaft macht dieses Buch zu einem zeitlosen Klassiker, der die Leser in seinen Bann ziehen wird.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 597
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Arbeiter des Meeres
Books
Inhaltsverzeichnis
Ich widme dieses Buch dem Felsen der Gastfreundschaft und Freiheit, jenem Winkel altnormannischer Erde, wo das kleine edle Volk des Meeres lebt, der rauhen und lieben Insel Guernesey, gegenwärtig meine Zufluchtstätte und wahrscheinlich mein Grab.
V. H.
Die Religion, die Gesellschaft, die Natur, sie bilden die drei Kämpfe des Menschen. Diese drei Kämpfe sind zugleich seine drei Bedürfnisse. Er muß glauben, daher der Tempel; er muß schaffen, daher die Gemeinde; er muß leben, daher der Pflug und das Schiff. Aber diese drei Lösungen schließen drei Kriege ein. Aus allen Dreien ergiebt sich die geheimnißvolle Schwierigkeit des Daseins. Der Mensch besteht den Kampf mit dem Hinderniß in der Gestalt des Aberglaubens, in der Gestalt des Vorurtheils, in der Gestalt des Elements. Ein dreifacher verhängnißvoller Zwang lastet auf uns, der Zwang der Dogmen, der Zwang der Gesetze, der Zwang der Verhältnisse. In Notre Dame de Paris wies der Verfasser auf den erstern hin, in den Miserables deutete er den zweiten an, im vorliegenden Buch bezeichnet er den dritten. Zu diesem dreifachen den Menschen einhüllenden Verhängniß gesellt sich das innere Verhängniß, die höchste aller Notwendigkeiten, das menschliche Herz.
Erster Theil. Herr Clubin.
Inhalt
Erstes Buch. Worauf ein schlechter Ruf sich gründet.
Erstes Capitel. Ein Wort, geschrieben auf ein weißes Blatt.
Der Weihnachtstag des Jahres 182* zeichnete sich zu Guernesey durch ein ganz unerhörtes Factum aus: Es schneite an diesem Tage. Auf den Inseln des Canals ist Eis eine Merkwürdigkeit und Schnee ein Ereigniß.
An diesem Christmorgen war der Weg am Ufer des St. Patrikhafens ganz weiß. Es hatte von Mitternacht bis gegen Morgen geschneit. Bald nach Sonnenaufgang, etwa um die neunte Stunde, um welche Zeit die Anglikaner noch nicht in die Kirche von St. Sampson und die Wesleyaner noch nicht nach der Kapelle Eldad zu wandern pflegen, war der Weg am Ufer noch fast menschenleer. Auf der ganzen Strecke, welche die Thürme beider Kirchen von einander scheidet, befanden sich nur drei Wanderer, ein Kind, ein Mann und ein Weib. Jeder Einzelne dieser Fußgänger schritt, getrennt von den Uebrigen, einsam seines Weges dahin; kein sichtbares Band vereinigte sie. Das Kind, welches ungefähr acht Jahre zählen mochte, war stehen geblieben und beobachtete mit Neugier den Schnee. Der Mann ging in einer Entfernung von ungefähr hundert Schritten hinter der Frau her und verfolgte gleich ihr, den Weg nach Saint-Sampson. Er war noch jung; sein Aeußeres verrieth einen Arbeiter oder Matrosen. Er trug seinen Werktagsanzug, einen Kittel von grobem Tuch und ein nach unten betheertes Beinkleid, was anzudeuten schien, daß er ungeachtet des Festtages in keine Kirche zu gehen beabsichtigte. Seine schweren Schuhe waren von rohem Leder, mit dicken eisernen Nägeln beschlagen; sie hinterließen im Schnee Spuren, welche eher einem Gefängnißschlosse, als den Fußtapfen eines Menschen glichen. Die weibliche Fußgängerin hatte eine sorgfältigere Toilette gemacht; sie trug ersichtlich ihren Sonntagsstaat, welcher aus einem weiten wattirten schwarz seidenen Mantel bestand, der ein sehr kokettes Kleid von irischem Popelin mit rosa und weißen Falbelas in seine reichen Falten hüllte. Hätte sie nicht rothe Strümpfe getragen, so hätte man sie für eine Pariserin halten können. Sie schritt mit jenem leichten und elastischen Gang eines jungen Mädchens dahin, dem das Leben noch keine Bürde ist. Ihre Haltung besaß jene flüchtige Grazie, die der zartesten Uebergangsperiode eigen ist, welche zwei Dämmerungen, die der endenden Kindheit und der beginnenden Jungfräulichkeit mit einander verbindet. Der männliche Wanderer hatte für alles Dieses keine Augen.
Als sie jedoch, in der Nähe eines Eichengebüsches, den ein Hanffeld begrenzte, an einem Orte angekommen war, welchen man »die niedrigen Häuser« nannte, wandte sie sich um, und nun sah ihr der Mann in's Angesicht. Sie blieb stehen, schien ihn einen Augenblick zu beobachten, und er glaubte zu bemerken, daß sie mit dem Finger etwas in den Schnee schrieb. Dann erhob sie sich schnell, verdoppelte ihre Schritte, sah sich nochmals um, lächelte, und verschwand dann links hinter den Hecken, welche den Weg begrenzen, der nach dem Schlosse von Lierre führt. Als sie sich zum zweiten Male umgewendet hatte, erkannte sie der Mann: es war Deruchette, ein reizendes Landmädchen.
Er fühlte nicht das geringste Bedürfniß, seinen Schritt zu beschleunigen; einige Augenblicke später erreichte er den Eichenbusch am Winkel des Hanffeldes. Er dachte schon nicht mehr an Diejenige, welche soeben diese Stelle verlassen, und es ist sehr wahrscheinlich, daß, wenn in diesem Moment ein Delphin aus dem Meer hervorgetaucht, oder ein Rothkehlchen im Busch gesungen hätte, er das Auge auf den kleinen Vogel oder den Fisch gerichtet haben würde. Zufällig hatte er in diesem Augenblick die Wimper gesenkt, und so kam es, daß unwillkürlich sein Blick an jener Stelle haftete, auf welcher das junge Mädchen stehen geblieben war. Zwei kleine Fußspuren bezeichneten dieselbe, und daneben las der Wanderer das in den Schnee geschriebene Wort »Gilliatt.«
Es war sein Name.
Er hieß Gilliatt.
Lange blieb er regungslos auf dieser Stelle stehen, betrachtete die Schrift, sowie die in den Schnee eingedrückten kleinen Fußspuren, und ging dann gedankenvoll weiter.
Zweites Capitel. Das Gespensterhaus.
Gilliatt wohnte in der Pfarrei von Saint-Sampson. Er war dort nicht beliebt. Das hatte seine Gründe.
Erstens bewohnte er ein Haus, in dem es nicht geheuer war. Dem, welcher die Gegend von Jersey und Guernesey besucht, begegnet es wohl leicht, daß ihm auf dem Lande, in der Stadt, in irgend einem einsamen Winkel, oder auch in einer belebten Straße, ein Haus auffällt, dessen Eingang verbarrikadirt ist. Stechpalmen und Dorngestrüpp versperren die Thür; mit Nägeln beschlagene Bretter bedecken wie häßliche Pflaster die Fenster des Erdgeschosses. Die des oberen Stockwerks sind zugleich geschlossen und geöffnet; die Rahmen der Fenster nämlich sind alle sorgfältig verriegelt, die Scheiben jedoch sämmtlich zerbrochen. Wenn solch ein Haus einen Hof hat, wächst fußhohes Gras darin; hat es zufällig auch einen Garten, so kann man sich darauf verlassen, daß in demselben eine Fülle von Unkraut, Brennnesseln, Dornen und Schierling wuchert, und man kann darin die Bekanntschaft vieler seltener Insecten machen. Im Innern aber ist das Haus zerfallen; die Schornsteine sind geborsten, die Dächer schadhaft, die Balken verfaulen, die Steine verschimmeln, die Tapeten der Zimmer hängen in Fetzen von den entblößten Mauern herab. Man kann auf diesen Fetzen die wechselnden Moden der verschiedenen Epochen studiren. Man findet auf ihnen die Greife des Kaiserreichs, die bogenartigen Draperien des Directoriums, wie die Geländer und Halbsäulen, welche den Geschmack des Zeitalters Ludwig XVI. kennzeichneten. Die dichten Spinnengewebe mit ihrer Menge von Fliegenleichen lassen auf den tiefsten Frieden, die ungestörteste Ruhe dieser fleißigen Arbeiterinnen schließen. Hie und da bemerkt man einen zerbrochenen Topf auf einem Brett. Von solchen Häusern sagt man, es spuke darin, und der Teufel treibe dort allnächtlich sein Wesen.
Ein Haus kann, wie der Mensch, eine Leiche werden. Der Aberglaube vermag es zu tödten. Dann ist es ein Gegenstand des Grauens. Diese todten Häuser sind nicht selten auf den Inseln des Canals.
Die Land- und Seeleute verstehen, was den Teufel betrifft, keinen Spaß. Die vom Canal, dem englischen Archipelagus und der französischen Küste haben ihre ganz bestimmten Vorstellungen von ihm. Der Teufel hat nach ihrer Meinung seine Abgesandten in allen Weltgegenden. Belphegor ist sein Gesandter in Frankreich, Hutgin in Italien, Belial in der Türkei, Thamutz in Spanien, Martinet in der Schweiz und Mammon in England. Satan ist so gut Kaiser wie ein Anderer. Satan-Cäsar! Er macht ein großes Haus. Dagon ist Groß-Bannerträger, Succor Benoth das Haupt der Eunuchen, Asmodeus der Chef der Spielbanken, Kobal Theater-Director und Verdelet Groß-Ceremonienmeister; Nybbas ist der Hofnarr; Wiérus, den ausgezeichneten Gelehrten, guten Vampyrkenner und wohlunterrichteten Dämonograph, nennt Nybbas »den großen Parodisten.«
Die Fischer der Normandie sind auf offner See sehr auf ihrer Hut vor den Blendwerken des Teufels. Man war lange Zeit der Meinung, daß der heilige Maclou den großen viereckigen Felsen Ortach bewohne, welcher sich zwischen Aurigny und den Klippen von Gers befindet, und viele alte Matrosen versichern, ihn oft auf diesem Felsen sitzend und in einem Buche lesend gesehen zu haben. Vorüberfahrende Schiffer versäumten es daher auch niemals, vor dieser Steinmasse andächtig ihr Kniee zu beugen, bis die Alles besiegende Wahrheit auch diese Sage verdrängte. Man hat seitdem die Entdeckung gemacht, daß der Bewohner des Felsens Ortach kein Heiliger, sondern ein Teufel sei. Dieser Teufel, mit Namen Jochmus, hatte sich arglistiger Weise mehrere Jahrhunderte hindurch für den heiligen Maclou ausgegeben. Solche Irrthümer kommen vor; ist doch die Kirche selber zuweilen darin befangen. Die Teufel Raguhel, Oribel, Tobiel waren Heilige bis zu dem Jahre 745, wo der Papst Zacharias ihre Teufelei gewittert und sie ausgetrieben. Um solche Austreibungen vornehmen zu können, welche sicherlich sehr nützlich sind, muß man in der Teufelei sehr bewandert sein.
Die alten Landleute erzählen – jedoch gehören diese Thatsachen der Vergangenheit an – daß die katholische Bevölkerung des normännischen Archipelagus, obgleich gegen ihren Willen, mit dem Bösen in engerer Verbindung stand als die Hugenotten. Warum? wissen wir nicht. Sicher ist, daß diese Minorität ehemals vom Bösen sehr geplagt wurde. Der Teufel hatte die Katholiken in ganz besondere Affection genommen, und zog ihren Umgang dem der Hugenotten vor, was für die Wahrscheinlichkeit spricht, daß der Teufel eher Katholik als Protestant ist. Zu den unerträglichsten Vertraulichkeiten, welche er sich herausnahm, gehörten die nächtlichen Besuche, die er katholischen Eheleuten in dem Augenblick, wo der Mann schon ganz, die Frau jedoch erst halb eingeschlafen war, abstattete. Daher die vielfachen Mißgeburten. Patrouillet erklärte Voltaire's Entstehung auf diese Weise. Diese Meinung ist nicht ganz unwahrscheinlich. Ein solcher Fall ist übrigens ganz bekannt und in den Beschwörungsformeln unter der Rubrik: de erroribus nocturnis et de semine diabolorum beschrieben. Er wurde zu St. Helier mit ganz besonderer Strenge behandelt; wahrscheinlich zur Strafe für die Sünden der Revolution. Die Folgen der revolutionären Frevel sind unberechenbar. Wie dem aber auch sein mag, die Möglichkeit eines nächtlichen Besuchs vom Teufel machte vielen rechtgläubigen Frauen großen Kummer. Es ist freilich nicht angenehm, einen Voltaire zur Welt zu bringen. Eine dieser Frauen erkundigte sich in ihrer Herzensangst bei ihrem Beichtiger nach einem Mittel, noch bei Zeiten dem Unfug dieser Verwechselung zu steuern. Der Beichtvater antwortete: Wenn Ihr wissen wollt, ob Ihr es mit Eurem Manne oder mit dem Teufel zu thun habt, so dürft Ihr ihn nur an die Stirn fassen; fühlt Ihr dort Hörner, so könnt Ihr sicher sein, daß ... Was denn? fragte die Frau.
Das Haus, welches Gilliatt bewohnte, gehörte ehemals zu denen, in welchen es spukte. Jetzt zwar stand es nicht mehr in dem Ruf, allein gerade deshalb war es um so verdächtiger. Es herrschte kein Zweifel, daß. wenn in einem Haus, in welchem es spukte, ein Hexenmeister wohne, der Teufel dasselbe gut verwahrt glaube und dann so höflich sei, wie der Arzt zum Kranken, der nur, wenn er gerufen wird, kommt.
Dieses verrufene Haus also hieß das Gespensterhaus. Es befand sich an der Spitze einer Land- oder vielmehr Felsenzunge, welche einen eigenen kleinen Ankerplatz in der Bucht von Houmet-Paradis bildete. Das Wasser ist dort tief. Fast abgeschnitten von der übrigen Insel, stand das Haus ganz allein auf der Landzunge; das geringe Erdreich seiner Umgebung lieferte nur nothdürftig den Raum zu einem kleinen Gemüsegarten. Zur Zeit der Fluth stand derselbe völlig unter Wasser. Zwischen dem Hafen von St. Sampson und der Bucht von Houmet-Paradis befindet sich der große Hügel, welchen die mit Epheu umrankten Thürme des Schlosses du Valle krönen. Man konnte daher von St. Sampson aus das Gespensterhaus nicht sehen.
In Guernesey sind Hexenmeister noch etwas ganz Gewöhnliches. Diese Art Leute üben in gewissen Kirchspielen ihr Geschäft aus, ohne daß das neunzehnte Jahrhundert etwas dagegen einzuwenden hätte. Die Ausübung dieser Künste ist wahrhaft sträflich. Sie machen Gold, pflücken um Mitternacht Kräuter, und behexen das Vieh durch den bösen Blick. Man holt sich Rath bei ihnen, bringt ihnen das Wasser der Kranken und schüttelt kummervoll den Kopf, wenn sie sagen: »Das Wasser scheint höchst bedenklich.« Einer von ihnen hatte im März des Jahres 1857 in dem Wasser eines Kranken nicht weniger als sieben Teufel entdeckt. Solche Leute sind eben so gefürchtet als furchtbar. Ein Anderer von Ihnen hatte einmal einen Bäcker sammt seinem Backofen verhext. Wieder ein Anderer hatte die Bosheit, mit der größesten Sorgfalt Briefcouverts zu versiegeln, welche nichts enthielten. Noch ein Anderer hatte in seinem Hause drei Flaschen auf einem Brette stehen, welche mit einem Etiquette versehen waren, auf welchem der Buchstabe B zu lesen war. Diese Thatsachen sind erwiesen. Einige dieser Zauberer sind sehr mitleidiger Natur; sie übernehmen für drei Goldgulden die Krankheiten ihrer Nebenmenschen, wälzen sich auf ihren Betten umher und schreien. Währenddessen sind die Kranken gesund und von ihren Qualen erlöst. Anderen helfen sie durch ein Taschentuch, welches sie ihnen um den Leib binden. Es ist dabei nur zu verwundern, daß man nicht schon früher an dieses höchst einfache Heilmittel gedacht. Im vorigen Jahrhundert wurden diese Leute durch den Gerichtshof zu Guernesey zum Scheiterhaufen verurtheilt und verbrannt; in unserer Zeit sperrt man sie acht Wochen ein: vier Wochen bei Wasser und Brod, und vier Wochen in Einzelhaft. Beide Strafarten wechseln mit einander ab. Amant alterna catenae.
Der letzte Scheiterhaufen, auf welchem man einen Hexenmeister verbrannte, wurde zu Guernesey im Jahre 1747 errichtet. Die Stadt hatte zu dieser außerordentlichen Gelegenheit einen ihrer Plätze, den Kreuzweg der Doggs, hergegeben. Von 1565 bis 1700 wurden auf diesem Platze elf Zauberer verbrannt. In den meisten Fällen legten die Schuldigen ein Geständniß ab. Man erleichterte es ihnen durch die Folter. Dieser Kreuzweg leistete der Gesellschaft und der Religion auch noch andere Dienste. Man verbrannte dort die Ketzer unter Maria Tudor, unter anderen Hugenotten auch eine Mutter, Perrotine Massy mit ihren zwei Töchtern. Eine dieser Töchter war in gesegneten Umständen und genas auf dem Scheiterhaufen eines Knäbleins. Die Chronik bewahrt dieses merkwürdige Ereigniß der Nachwelt durch folgende Notiz auf: Ihr Leib spaltete sich, und es entglitt ihm ein Kindlein, welches vom Scheiterhaufen herab auf die Erde rollte. Ein Mann, Namens House, hob das Kindlein auf, aber der Herr Landvogt Hélier Gosselin, ein guter Katholik, ließ dasselbe wieder in die Flammen werfen.
Drittes Capitel. Für Deine Frau, wenn Du Dich vermählst.
Kehren wir zu Gilliatt zurück.
Man erzählte sich dort zu Lande, daß gegen das Ende der Revolution eine Frau mit einem kleinen Kinde nach Guernesey gekommen wäre, vermuthlich eine Engländerin; war sie dies nicht, so war sie wahrscheinlich eine Französin. Sie hatte einen Namen, aus welchem die Sprache und die Orthographie der Einwohner von Guernesey den Namen Gilliatt machte. Diese Frau lebte allein mit ihrem Kinde, das Einige für ihren Neffen, Andere für ihren Sohn, und wieder Andere für keins von Beiden hielten. Sie hatte nur gerade so viel Geld, um knapp davon leben zu können. Sie kaufte eine Wiese nahe bei dem Polizeigericht und ein Grundstück in Crespel bei Roquaine. In dem Gespensterhause spukte es zu dieser Zeit. Es war seit dreißig Jahren nicht bewohnt worden, und fiel in Trümmer. Der Garten, durch gar zu häufige Ueberschwemmungen verwüstet, brachte Nichts hervor.
Außer dem allnächtlichen Lärmen und den Lichtern, welche man in diesem Hause flackern sah, erzählten sich die Leute auch noch eine höchst merkwürdige und in der That sehr grauenhafte Geschichte, welche dort passirte. Man sagte, daß wenn man am Abend vor dem Schlafengehen einen Knäuel Strickwolle nebst Stricknadeln auf das Kamin lege und einen Teller voll Suppe daneben stelle, so fände man am nächsten Morgen den Teller leer und daneben ein Paar gestrickte Fausthandschuhe. Man bot das Haus sammt dem darin sein Wesen treibenden Kobold für einige Pfund Sterling zum Kaufe an. Diese Frau, entweder vom Teufel oder von der Billigkeit verführt, wagte den Kauf. Ja, sie that mehr als das: sie bewohnte auch das Gespensterhaus mit ihrem Knaben, und von diesem Augenblick an wurde es dort ganz ruhig. Die Leute meinten, das Haus hätte nun, was es wollte. Die Gespenster hörten auf, ihr Wesen zu treiben. Man hörte des Morgens nicht mehr schreien und toben, und sah kein anderes Licht darin, als das Talglicht, welches die gute Frau jeden Abend anzündete. Das Licht eines Zauberers, sagten die Leute, ist so gut wie die Fackel des Teufels. Diese Erklärung genügte dem Publicum.
Die Frau lebte von dem Ertrag ihrer wenigen Morgen Landes und von einer guten Kuh, die vortreffliche Milch und gelbe Butter lieferte. Sie verkaufte, wie jede andere Frau vom Lande, ihre Pastinakwurzeln in kleinen Tonnen, ihre Zwiebeln in Bündeln, sowie Bohnen und Kartoffeln metzenweise. Doch brachte sie ihre Waaren nicht selber zu Markte, sondern ließ sie durch einen Bekannten, einen Landmann aus der Umgegend, Namens Guilbert Falliot, feil bieten.
Die Schäden des baufälligen Hauses wurden mühsam ausgebessert, und es wurde wieder in einen etwas wohnlichen Zustand gesetzt. Es mußte schon arges Unwetter sein, wenn das Wasser durch die Dachritzen und Oeffnungen in die Stuben lief. Die Wohnung bestand aus einem Erdgeschoß und einem Speicher. Das Erdgeschoß hatte drei Säle, welche durch eine Leiter mit dem Speicher in Verbindung standen. Die Frau besorgte nicht nur Haus und Küche, sondern lehrte auch ihr Kind lesen. In die Kirche ging sie nicht. Aus diesem Umstande schloß man, daß sie eine Französin sei. Das »Nirgend-Hingehen« erregte große Bedenklichkeiten.
Im Ganzen genommen wußte man nicht recht, was man aus diesen Leuten machen sollte.
Eine Französin konnte diese Frau wohl sein. Vulkane werfen Steine, Revolutionen Menschen aus. Ganze Familien werden aus ihrem natürlichen Boden gerissen und in fremdes Erdreich verpflanzt; die verschiedenen Glieder zerstreuen und verlieren sich. Menschen fallen aus den Wolken: Diese weht der Wind nach Deutschland, Jene nach England, Andere nach Amerika. Die Eingeborenen dieser Länder wundern sich: »Wo kommen diese Fremden her?« Der Vesuv hat sie ausgespieen. Man giebt diesen ausgestoßenen, verlorenen, aus der Luft gefallenen, diesen vom Schicksal bei Seite geschafften Wesen Namen. Man nennt sie Emigrirte, Flüchtlinge, man nennt sie Abenteurer. Wenn sie bleiben, werden sie geduldet; wenn sie gehen, hat man nichts dagegen. Es sind dies oft – und besonders die Frauen unter ihnen – harmlose Geschöpfe, den Ereignissen, die sie aus ihrer Heimath vertrieben, völlig fremd, und verwundert, ohne ihr Verschulden, ohne Haß noch Zorn zu hegen; sich als von vulkanischen Auswürfen in die Luft geschleuderte Körper betrachten zu müssen. Arme, aus ihrem heimathlichen Boden gerissene Pflanzen, suchen sie im fremden Land, so gut sie können, Wurzel zu fassen. Sie, die Niemandem etwas zu Leid gethan. verstehen das ihnen auferlegte Schicksal nicht. Ich sah, wie einst ein armseliges Büschel Gras von einer Pulvermine in die Luft gesprengt wurde, wie sich die Halme von einander trennten, wie sie sich in der Luft zerstreuten und verloren gingen. Die französische Revolution hatte mehr solcher Ausgeworfener als irgend ein anderer Ausbruch. – Die Frau, welche man in Guernesey Gilliatt nannte, war vielleicht der Halm eines solchen Grasbüschels.
Sie wurde alt, ihr Knabe wuchs heran. Sie lebten allein; von Jedermann gemieden, genügten Mutter und Sohn einander. »Wölfin und Wölflein liebkosen sich,« sagten die wohlwollenden Nachbarn. Der Knabe wurde ein Jüngling, der Jüngling ein Mann. Der Baum des Lebens schält sich, die alten Rinden fallen ab und machen den jungen Platz. Die Mutter starb. Sie hinterließ ihrem Sohne ihre Wiese, ihr Grundstück und das alte, baufällige Haus. Im Inventarium waren ferner hundert Goldgulden aufgeführt, welche sich in einem Strumpfe befinden sollten. Das Haus war anständig ausgestattet; es befanden sich in demselben zwei eichene Koffer, zwei Betten, sechs Stühle und andere Utensilien. Auf einem Brett waren einige Bücher aufgestellt, und in der Ecke eines Zimmers stand ein Koffer von durchaus gewöhnlichem Aussehen, welcher wegen des aufzunehmenden Inventariums geöffnet werden mußte. Dieser Koffer war von falbem Leder; es waren Arabesken darin eingepreßt, und der Deckel war mit kupfernen Nägelköpfen und zinnernen Sternchen geziert. Derselbe enthielt eine vollständige weibliche Aussteuer, Hemden und Unterröcke von holländischer Leinwand, und seidene Kleider im Stück. Es lag ein Zettel dabei, worauf die Worte zu lesen waren: » Für deine Frau, wenn du dich vermählst.«
Dieser Tod verursachte dem Ueberlebenden großen Kummer. War er bisher ungesellig, so wurde er nun förmlich menschenscheu. Die Welt ward ihm zur Einöde. Es war nicht mehr Einsamkeit; es war völlig Leere um ihn. Zweien ist stets das Leben leicht; dem Einsamen, Verlassenen wird es zur Last, zur Bürde, die er kaum zu tragen vermag. Er versucht es auch gar nicht. Das ist der Anfang der Verzweiflung. Später lernt man es begreifen, daß uns das Leben die Pflicht auferlegt, es zu ertragen. Man betrachtet den Tod, man betrachtet das Leben und willigt darein, diese Pflicht auf sich zu nehmen; doch wird der Entschluß mit blutendem Herzen gefaßt.
Gilliatt war noch jung, seine Wunde vernarbte. In seinem Alter heilen noch die Herzenswunden. Seine persönliche Schwermuth milderte sich in dem Anblick der Natur. Dieses Gefühl, das eine Art von Reiz hat, zog ihn von den Menschen ab zu den Dingen, und söhnte seine Seele mehr und mehr mit der Einsamkeit aus.
Viertes Capitel. Unbeliebtheit.
Gilliatt war, wie schon gesagt, in seinem Kirchspiel nicht beliebt. Dieser Unbeliebtheit fehlte es nicht an Ursachen. In erster Reihe stand das Haus, welches er bewohnte. Sodann wußte man so gut wie gar nichts über seinen Ursprung. Wer war jene Frau? Und was hatte es mit dem Kinde für eine Bewandtniß? Die Leute in dortiger Gegend zerbrechen sich nicht gern den Kopf über die Fremden, welche sich in ihrer Gegend ansiedeln. Ferner gab ihnen der Arbeiter-Anzug des Sohnes zu denken. Warum kleidet er sich wie ein Arbeiter, wenn er zu leben hat und nicht zu arbeiten braucht? Alsdann war es höchst auffallend, daß der Garten dieser Leute trotz der Aequinoctialstürme und der häufigen Ueberschwemmungen so gedieh, daß er prächtige Kartoffeln und ausgezeichnetes Gemüse lieferte. Und was mochte es wohl mit den großen dicken Büchern sein, die auf dem Brette standen, und in welchen Gilliatt so häufig las?
Aber das war noch nicht Alles!
Woher kam es, daß Gilliatt so allein das düstere Gespensterhaus bewohnte? Es war eine Art Lazareth; man hielt ihn in Quarantaine; so war es ganz natürlich, daß man sich über seine Einsamkeit wunderte und ihn dafür verantwortlich machte.
Er ging niemals in die Kirche. Oft ging er in der Nacht aus seinem Hause; er mußte mit Zauberern verkehren. Ein Mal überraschte man ihn in einem höchst auffälligen Zustande von Geistesabwesenheit im Grase sitzend, wo er mit Kräutern, Blumen und Steinen Zwiegespräche hielt. Man schwor darauf, es gesehen zu haben, wie er vor dem singenden Felsen eine Verbeugung machte. Es war ferner ebenso auffallend als unbegreiflich, daß er alle Vögel, welche ihm zum Kaufe angeboten wurden, fliegen ließ. Er war zwar artig und zuvorkommend gegen die Bürger von St. Sampson; man bemerkte indessen, daß er Umwege machte, um ihnen auszuweichen. Er fischte häufig und kam nie ohne Beute nach Hause. Man sah ihn Sonntags in seinem Garten arbeiten. Er hatte bei Gelegenheit eines Durchmarsches von einem schottischen Soldaten eine Flöte gekauft, auf welcher er bei einbrechender Nacht am Meeresstrand und in den Felsenriffen blies. Seine Bewegungen waren wie die eines Säemannes. War es ein Wunder, wenn er unter solchen Umständen nicht beliebt war? Was sollte wohl ein Land mit einem solchen Menschen anfangen?
Die Bücher, welche ihm die Verstorbene hinterlassen, und in denen er zuweilen las, waren nicht minder beunruhigend. Der hochwürdige Herr Pastor Jaquemin Hérode bemerkte bei Gelegenheit des Begräbnisses der verstorbenen Frau auf dem Rücken der Bücher folgende äußerst verdächtige Titel: Dictionnaire von Rosier, Candide, von Voltaire, Gesundheitslehre für das Volk, von Tissot. Ein französischer Emigrant, welcher sich nach St. Sampson zurückgezogen hatte, hielt es für sehr möglich, daß dieser Tissot derselbe sei, welcher den Kopf der Prinzessin von Lamballe auf einem Spieß getragen habe.
Der hochwürdige Herr Pastor hatte übrigens auch noch auf einem anderen Buche den ebenso sonderbaren als bedrohlichen Titel: » De Rhabarbero « gelesen.
Es muß jedoch hinzugefügt werden, daß das Buch, wie schon der Titel besagt, in lateinischer Sprache abgefaßt war; es war daher anzunehmen, daß Gilliatt, welcher diese Sprache nicht verstand, besagtes Buch auch nicht gelesen hatte.
Aber gerade die Bücher, welche ein Mensch nicht lies't, zeugen gegen ihn. Die spanische Inquisition hat dieses außer allen Zweifel gestellt.
Das Buch war übrigens nur eine Abhandlung des Doctor Tilingius über den Rhabarber, welche im Jahre 1679 in Deutschland erschienen war.
Man wußte es nicht ganz genau, aber man hatte Gilliatt sehr stark im Verdacht, daß er allerhand Zaubertränke bereitete, denn er war im Besitz von Phiolen.
Und warum ging er des Abends aus dem Hause und trieb sich bis Mitternacht auf den steilen Küstenabhängen umher? Ohne allen Zweifel, um mit den bösen Geistern Umgang zu pflegen, welche des Nachts an den Ufern des Meeres, auf den Felsenriffen und im Nebel hausen.
Man wußte, daß er einmal einer alten Hexe, mit Namen Montonne Gahy, einen Karren aus dem Schlamme ziehen half.
Bei Gelegenheit einer Einwohner-Zählung, welche auf den Inseln vorgenommen wurde, gab er auf die Frage nach seinem Stand und seiner Beschäftigung den Beamten folgende, ebenso merkwürdige als verdachterregende Antwort: » Ich fische, wenn es etwas zu fischen giebt.«
Stellen wir uns auf den Standpunkt der Leute, so werden wir leicht begreifen, welchen Anstoß derartige Antworten geben mußten.
Armuth und Reichthum sind relative Begriffe. Gilliatt hatte eine Wiese, Felder und Haus. Im Vergleich zu Denen, welche gar Nichts hatten, war er nicht arm zu nennen. Eines Tages fragte ihn ein Mädchen, entweder um seine Meinung zu prüfen, oder einer Werbung entgegen zu kommen – denn Weiber heirathen ja den Teufel, wenn er reich ist – ob, und wann er sich zu verheirathen gedächte. Gilliatt antwortete ihr: » An dem Tag, an welchem sich der singende Berg verheirathet.«
Dieser singende Berg ist ein großer Felsblock, welcher das Hanffeld des Herrn Lemezurier de Fry durchschneidet. Dieser Steinmasse ist nicht zu trauen, sie muß sorgfältig überwacht werden. Es ist eine unerklärliche, aber deshalb nicht minder auffällige Thatsache, daß auf besagtem Felsen ein Hahn kräht, den man wohl hören, allein nicht sehen kann. Dieses eben so unwiderlegte als unwiderlegliche Factum ist höchst unheimlicher Art. Man ist ferner darüber einig, daß der singende Berg von Kobolden in das Hanffeld des Herrn Lemezurier de Fry geschoben wurde.
Wenn in der Nacht unter Blitz und Donner schwarze Gestalten in den rothen Wolken des Himmels und in der zitternden Luft erscheinen, so kann man sich darauf verlassen, daß es Kobolde sind. Eine Frau in Grand Mellier kennt sie ganz genau. Als eines Abends ein Fuhrmann unschlüssig an einem Kreuzweg stand und nicht recht wußte, welche Richtung er einschlagen sollte, rief sie ihm zu: Fragt nur die Kobolde; es sind gute, sehr umgängliche Geister, höflich und leutselig gegen Jedermann, die gern den Leuten Rath ertheilen. Es ist Hundert gegen Eins zu wetten, daß diese Frau eine Hexe war.
Der eben so scharfsinnige als gelehrte König Jacob I. ließ alle Weiber dieser Art lebendig brühen, kostete die Brühe und entschied nach dem Geschmack der Brühe, ob es eine Hexe war oder nicht. Schade, daß die Könige der Jetztzeit nicht auch solche Talente besitzen, welche die Nützlichkeit von dergleichen Einrichtungen begreiflich machen.
Gilliatt stand nicht ohne triftige Gründe in dem Geruch der Hexerei. Man sah ihn einmal in der Nacht während eines Sturmes ganz allein in einem Kahn der Gegend der Sommeilleuse zuschiffen. Man hörte ihn fragen: Ist hier wohl durchzukommen?
Eine Stimme antwortete vom Felsen herab: Sieh zu, Verwegner! Mit wem sprach er, wenn nicht mit Einem, der ihm Antwort gab? Die Sache scheint uns ein neuer Beweis für unsere Behauptung.
In einer anderen Sturmnacht, so schwarz, daß man nichts sah, hörte man ganz in der Nähe des Catiau-Roque, der eine Doppelreihe von Felsen bildet, auf welchen Hexen, Ziegenböcke und Gestalten aller Art in der Freitag-Nacht tanzen, die Stimme Gilliatts ganz deutlich. Man belauschte folgendes Gespräch, das er mit den Gespenstern führte.
– Wie befindet sich Meister Brovat? (Das war ein Maurer, welcher vom Dach herab gefallen.)
– 's geht besser.
–Was Ihr sagt! Er ist höher als von diesem Pfosten heruntergefallen. Es ist wunderbar, daß er sich nichts gebrochen hat! –
– Die Leute hatten vorige Woche gutes Wetter am Strand.
– Besseres als heute.
– Laßt's gut sein, sie werden ihren Fang schon machen.
– Es ist zu windig.
– Man wird die Netze nicht tief genug legen können.
– Und was macht die Cathrin?
– Ach, die ist wie behext.
Die »Cathrin« war offenbar eine Hexe, und Gilliatt ohne Frage ein Hexenmeister; wenigstens zweifelte Niemand daran.
Er goß auch zuweilen Wasser aus einem Krug auf die Erde. Aber Wasser, welches man auf die Erde gießt, zeichnet die Gestalt von Teufeln.
Es giebt auch auf dem Wege von St. Sampson, nicht weit von dem ersten Felsen drei Steine, welche treppenförmig übereinander liegen. Ehemals stand ein Kreuz, wenn nicht gar ein Galgen darauf; jetzt sind sie leer. Diese Steine sind sehr verrufen.
Ganz erstaunlich kluge und glaubwürdige Leute versichern gesehen zu haben, wie Gilliatt ganz in der Nähe dieser Steine mit einer Kröte sprach. Nun weiß Jeder, der die Gegend von Guernesey kennt, daß es dort keine Kröten giebt; es sind nur Nattern in Guernesey, in Jersey aber giebt es Kröten. Die Kröte, mit welcher Gilliatt sprach, mußte daher von Jersey aus zu ihm geschwommen sein, das lag auf der Hand. Sie plauderten übrigens sehr freundschaftlich mit einander.
Daß dies Alles erwiesene Thatsachen sind, bezeugen die drei Steine, welche noch immer auf derselben Stelle liegen. Wer daran zweifelt, kann sich selber davon überzeugen. Die Steine liegen nahe bei einem Hause, welches an folgendem Schild zu erkennen ist: Hier kauft man todtes und lebendes Vieh, alte Stricke, Eisen, Knochen und Lumpen. Für höfliche Behandlung und prompte Bezahlung wird garantirt.
Es gehört schon böser Wille dazu, die Existenz dieser Steine und dieses Hauses zu leugnen. Alles das schadete Gilliatt.
Nur Unwissende wissen nicht, daß der König von Auxcriniérs das Gefährlichste in den Gewässern des Canals ist. Es giebt kein furchtbareres Seegespenst als ihn. Wer ihn gesehen hat, leidet binnen Jahresfrist Schiffbruch. Er ist klein, denn er ist ein Zwerg, und taub, denn er ist ein König. Er weiß die Opfer, welche das Meer verschlungen, alle mit Namen zu nennen; er kennt die Stellen, wo sie begraben sind; er kennt den Kirchhof Ocean gründlich. Ein oben schmaler, unten breiter Kopf, eine untersetzte Gestalt, ein unförmiger Leib, knotige Auswüchse auf dem Schädel, kurze Beine und lange Arme, Flossen statt der Füße, Krallen statt Hände, ein breites, grünes Gesicht – das ist das Bild des Königs von Auxcriniérs. Seine Krallen sind mit Schwimmhäuten versehen, seine Flossen mit Nägeln. Man denke sich ein Fisch-Gespenst mit einem Menschenantlitz. Um es unschädlich zu machen, müßte man es beschwören oder – angeln. Jedenfalls ist es unheimlich. Nichts ist beunruhigender, als es zu sehen. Eine niedrige Stirne, Stumpfnase, platte Ohren, ein ungeheurer Mund, in welchem die Zähne fehlen, eine gräuliche Mundöffnung, ziegenartig gezeichnete Augenbrauen, große lustige Augen. Wenn falbe Blitze es beleuchten, ist sein Gesicht flammenroth, bei flammenrothen fahl. Er trägt einen starren triefenden Bart, der sich, viereckig gestutzt, auf einer pelzartigen Haut ausbreitet, welche vorn und hinten mit je sieben, also mit vierzehn Muscheln geziert ist. Diese Muscheln sind äußerst merkwürdig für den Kenner. Der König von Auxcriniérs ist nur bei hochgehender See sichtbar; er ist der finstere Possenreißer des Sturmes. Im Regen, Nebel, Wind erkennt man nur undeutlich, wie eine blasse Skizze, seine Formen. Sein Nabel ist häßlich. Ein Schuppenharnisch bedeckt seine Seiten und die Brust. Er erhebt sich über die zischenden Wogen des Meeres, welche sich unter den mächtigen Athemzügen des Sturmes bäumen und sich kräuseln wie Holzspähne unter dem Hobel des Tischlers. Seine Gestalt bleibt unberührt von dem Schaumspritzen, und wenn am Horizont Fahrzeuge erscheinen, welche ihren letzten Kampf mit den Wogen kämpfen, dann strahlt sein im Schatten fahles Antlitz im Glanz eines wüsten Lächelns und, das Antlitz in wahnwitzigem Schrecken verzerrt, beginnt er zu tanzen. Das ist ein böses Begegnen. Zu der Zeit aber, als Gilliatt den Leuten in St. Sampson zu reden gab, hatte der König von Auxcriniérs nur noch dreizehn Muscheln an seinem Barte. Wo war die vierzehnte geblieben? Hatte er sie verschenkt? Und wem hatte er sie geschenkt? Das wußte Niemand zu sagen. Man weiß nur, daß Herr Lupin-Mabier, ein höchst ansehnlicher Mann, dessen Besitzungen sehr hoch abgeschätzt waren, bereit war, eidlich zu erhärten, daß er in den Händen Gilliatt's eine höchst merkwürdige Muschel gesehen habe.
Es war nichts Seltenes, zwei Bauern aus der dortigen Gegend Gespräche wie folgendes führen zu hören:
– Findet Ihr nicht, Nachbar, daß mein Ochse ein ganz prächtiges Thier ist?
– Zu aufgeschwemmt, Nachbar.
– Hm – könnt Recht haben.
– Nichts Solides – mehr Talg als Fleisch.
– Daß Dich das Wetter!
– Seid Ihr ganz sicher darüber, daß Gilliatt ihn nicht behext hat?
Gilliatt blieb zuweilen auf einem Feldweg bei den Ackersleuten und an den Gärten bei den Gärtnern stehen und sprach dann wohl mitunter geheimnißvolle Worte zu ihnen, z. B.:
– Wenn der Teufelsbiß blüht, schneidet den Winterroggen. (Der Teufelsbiß ist die sogenannte Scabiose.)
– Sobald die Esche Knospen treibt, giebt es keinen Frost mehr. Um die Sommersonnenwende blüht die Distel.
– Wenn es im Juni nicht regnet, bekommt das Getreide den weißen Rost.
– Wenn die Vogelkirsche grün wird, traut dem Vollmond nicht.
– Habt Acht auf das Thun und Treiben der Nachbarn, mit denen Ihr im Rechtsstreit lebt. Wenn ein Schwein heiße Milch trinkt, geht's caput; und reibt man der Kuh die Zähne mit Lauch ein, so frißt sie nicht mehr und fällt.
– Frischer Schierling bewahrt vor den Fiebern.
– Wenn sich der Frosch zeigt, säet die Melonen.
– Säet die Gerste, wenn's Leberkraut blüht.
– Wenn die Linde blüht, mähet die Wiesen.
– Wenn die Ulme blüht, werfet die Laichnetze aus.
– Blüht der Tabak, so schließt Eure Gewächshäuser.
Und schrecklich! Wer seinen Rath befolgte, befand sich wohl dabei.
Als er eines Abends in der Gegend von Demie de Fontenelle auf der Düne die Flöte blies, ging der Makrelen-Fang fehl.
Zur Zeit der Ebbe fiel in der Nähe seiner Wohnung ein Frachtwagen um. Wahrscheinlich aus Furcht vor polizeilicher Untersuchung, half er mit der ungeheuersten Anstrengung den Wagen wieder aufrichten, und belud ihn auch selber wieder mit dem herausgefallenen Seegras. Ein kleines Mädchen aus der Nachbarschaft hatte Läuse; da ging Gilliatt nach Saint-Pierre-Port, holte dort eine gewisse Salbe und rieb das Kind damit ein. Er befreite es von seinen Läusen; es ist also klar, daß Gilliatt sie ihr angehext hatte.
Alle Welt ist darüber einig, daß man einem Menschen Läuse anhexen kann.
Er hatte auch die Gewohnheit, die Brunnen in der Umgegend zu besichtigen; ein sehr gefährliches Unternehmen, wenn man » den bösen Blick« hat. Eines Tages wurde das Wasser eines Brunnens so trübe, daß die gute Frau, welcher derselbe gehörte, Gilliatt zu Rathe zog. Dieser besah das Wasser, welches die Frau ihm in einem Glase zeigte, und sagte: Es ist wahr, das Wasser ist trübe. Die gute Frau aber, welche ihm nicht traute, sagte zu Gilliatt: Macht, daß das Wasser wieder gut wird. Er richtete darauf folgende, höchst bedenkliche Fragen an die Frau: – Ob sie einen Stall habe? – Ob dieser Stall einen Abflußkanal habe? – Ob vielleicht dieser Abflußkanal sehr nahe bei dem Brunnen vorbeiflösse? – Die gute Frau sagte zu Allem: Ja.
Da ging Gilliatt in den Stall, machte sich an dem Kanal zu schaffen, leitete die Gosse ab, und das Wasser des Brunnens wurde wieder klar. Man dachte sich am Ort so Mancherlei. Ein Brunnen wird nicht, so mir nichts dir nichts, schlecht und dann wieder gut. Man fand die Verwandlung des Wassers sehr unnatürlich, und der Verdacht lag nahe, Gilliatt habe diesen Brunnen verhext.
Einmal, als er nach Jersey gegangen war, hatte man bemerkt, daß er in einem Hause Quartier genommen, welches in der Schatten-Straße stand. Schatten aber sind bekanntlich Gespenster.
In den Dörfern merken die Leute auf dergleichen Dinge. Sie erkundigen sich nach Allem. Die Erkundigungen werden zu einem Resultat zusammengeschmolzen: dieses bildet den Ruf eines Menschen.
Es kam vor, daß man Gilliatt überraschte, als ihm die Nase blutete. Das war eine wichtige Entdeckung. Ein Bootsmann, welcher fast die ganze Welt gesehen hatte, behauptete, daß bei den Tungusen alle Hexenmeister Nasenbluten hätten. Blutet also einem Menschen die Nase, so weiß man, was man von ihm zu halten hat.
Freilich machten einige vernünftige Leute die Bemerkung, daß, wenn bei den Tungusen die Zauberer auf diese Weise kenntlich wären, dieses in Guernesey nicht in demselben Grade der Fall zu sein brauchte.
Es war zu Michaelis, als man Gilliatt einmal auf einem mit der Heerstraße von Videclins in Verbindung stehenden Feldweg gewahrte. Man sah ihn auf einer Wiese Halt machen und hörte ihn pfeifen. Bald darauf ließ sich in seiner Nähe ein Rabe nieder und es dauerte gar nicht lange, so kam auch eine Elster. Diese Thatsache ist durch einen der glaubwürdigsten Zeugen verbürgt.
Auch waren in der Gegend von Guernesey alte Frauen, welche ganz deutlich gehört haben wollten, wie eines Morgens ganz früh einige Schwalben den Namen Gilliatt gezwitschert hätten. Dazu kam noch, daß Gilliatt ein schlechtes Herz haben mußte.
Ein armer Mann schlug einst einen störrischen Esel, der nicht vorwärts wollte. Als alle Püffe nichts fruchten wollten, gab er ihm mit seinen schweren Holzschuhen einige derbe Fußtritte in die Seiten, so daß der Esel fiel. Gilliatt eilte hinzu, um ihm wieder aufzuhelfen. Der Esel war todt. Gilliatt ohrfeigte den armen Mann.
Ein anderes Mal sah er einen kleinen Knaben von einem Baum herabsteigen, mit einem Nest voll neugeborener fast noch nackter Vögelchen. Gilliatt nahm dem Knaben das Nest aus der Hand und trieb die die Ruchlosigkeit so weit, es wieder dahin zu bringen, wo es der Bube gefunden hatte.
Als einige Vorübergehende ihm Vorwürfe machten, zeigte er statt aller Antwort auf den Baum, wo die Alten ängstlich schreiend das Nest ihrer Jungen umflatterten. Er hatte eine Liebhaberei für Vögel. Das ist ein Zeichen, woran man in der Regel die Zauberer erkennt.
Den Kindern macht es Spaß, die Nester der Seemöven an den steilen Küsten-Abhängen auszunehmen. Sie bringen ganze Massen blauer, gelber und grüner Eier mit nach Hause, welche sie als Zierde des Kamingesimses reihenweise aufpflanzen. Da die Abhänge steil und glatt sind, geschieht es leicht, daß Jemand ausgleitet, fällt und um's Leben kommt. Nichts ist verlockender für ein Kind, als diese hübschen bunten Vogeleier auf dem Kamin. Was that Gilliatt, um den Kindern das unschuldige Vergnügen zu stören?
Er erkletterte mit eigener Lebensgefahr die höchsten Felsen und brachte Vogelscheuchen an den gefährlichsten Stellen an. So verhinderte er die Vögel, hier zu bauen, und die Kinder hinzugehen.
Darum war Gilliatt beinahe in der ganzen Gegend verhaßt. Wer wäre es nicht, wenn solche Gründe vorliegen?
Fünftes Capitel. Andere zweideutige Seiten Gilliatts.
Man hatte zwar seine Meinung über Gilliatt, allein man war doch noch nicht ganz einig.
Die Meisten hielten ihn für einen »Marcou,« Einige aber gingen so weit, ihn für einen »Cambion« auszugeben. Ein Cambion ist der Sohn des Teufels und eines menschlichen Weibes.
Wenn eine Frau von einem Manne sieben männliche Kinder hinter einander zur Welt bringt, so ist das siebente ein Marcou. Die Reihe darf aber nicht durch die Geburt eines Mädchens unterbrochen sein.
Der Marcou hat an irgend einer Stelle seines Körpers das Zeichen der Lilie, welches ihm die Fähigkeit verleiht, die Scropheln eben so gut zu kuriren wie die Könige von Frankreich. Es giebt in Frankreich fast aller Orten Marcous, besonders um Orleans. Jedes Dorf in der Gegend von Gätin hat seinen Marcou. Er darf die Verwundeten nur anhauchen, oder von ihnen seine Lilie berühren lassen, so sind sie geheilt. In der Nacht des Charfreitag gelingen solche Operationen am besten. Ungefähr vor zehn Jahren lebte in Ormes ein Küfer – ein angesehener Mann, der Wagen und Pferde hielt – man nannte ihn nur den schönen Marcou, der einen ganz außerordentlichen Zuspruch hatte. Von Nah und Fern strömten aus der Umgegend die Leute in sein Haus. Man mußte, um seinen Wundern Einhalt zu tun, mit militärischer Gewalt einschreiten. Er hatte die Lilie unter der linken Brust. Andere haben sie anderswo.
Es giebt Marcous in Jersey, in Aurigny, in Guernesey. Dies kommt wohl daher, weil Frankreich Rechte auf die Normandie hat. Wozu wären sonst die Lilien?
Es giebt auch Scrophelnbehaftete auf den Inseln des Canals, was wiederum die Marcous nothwendig macht.
Als Gilliatt eines Tages in offener See badete, glaubten einige Anwesende die Lilie an seinem Körper zu bemerken. Als man ihn darüber befragte, lachte er, anstatt zu antworten. Ja, ja, Gilliatt lachte zuweilen, ganz wie ein anderer Mensch. Seit dieser Zeit jedoch badete er nicht mehr in offener See, sondern an versteckten einsamen Orten. Man vermuthete, daß er es des Nachts bei Mondenschein that. Wie dem aber auch sei: die Sache war sonderbar.
Diejenigen, welche darauf versessen waren, Gilliatt für einen Cambion, das heißt für einen Sohn des Teufels auszugeben, befanden sich offenbar im Irrtum. Sie hätten wissen müssen, daß es fast nur in Deutschland Cambions giebt. Allein in le Valls und St. Sampson waren vor fünfzig Jahren die Leute in der Wissenschaft noch sehr zurück.
Daß man aber in Guernesey einen Sohn des Teufels suchen wollte, war offenbar eine Phantasie.
Obgleich man Gilliatt fürchtete, suchte man doch seinen Rath. Mit einer gewissen inneren Unruhe, welche die Furcht erzeugte, befragten ihn die Bauern über ihre verschiedenen Krankheitsfälle. Diese Furcht schließt das Vertrauen nicht aus, im Gegentheil: je verrufener auf dem Lande ein Arzt ist, desto wirksamer sind seine Mittel. Gilliatt hatte seine eigenen Arzneien; sie waren ihm von der verstorbenen alten Frau übermacht worden; er half damit Allen, welche seine Hülfe begehrten, ohne sich dafür bezahlen zu lassen. Er heilte Nagelgeschwüre durch kühlende Kräuter; eine seiner Phiolen enthielt einen Saft, welcher das Fieber heilte; der Chemiker in St. Sampson, den man sonst Apotheker zu nennen pflegt, hielt diesen Saft für ein Decoct von Chinarinden. Selbst die böswilligsten Lästerer konnten nicht leugnen, daß Gilliatt, wenigstens was die Heilung der gewöhnlichen Krankheiten anbelangte, ein ziemlich guter Teufel war; wer aber seine Heilkünste als Marcou in Anspruch nehmen wollte, hatte einen weit schwierigeren Stand. Wenn sich ein Aussätziger meldete, welcher durch Berührung seiner Lilie Heilung suchte, so schlug er ihm ohne Umstände die Thür vor der Nase zu; Wunder durfte Keiner von ihm verlangen, zu solchen Sachen mochte er sich durchaus nicht verstehen – für einen Zauberer eine lächerliche Weigerung! Wenn Ihr kein Hexenmeister sein wollt, gut! Seid Ihr es aber einmal, so thut, was Eures Amtes ist!
Der allgemeine Widerwille hatte jedoch eine oder zwei Ausnahmen. Die eine dieser Ausnahmen bildete der Sieur Landoys, welcher die Stelle eines Schreibers in der Pfarrei des Hafens von Saint-Pierre bekleidete; ihm war das Register der Geburten, Heirathen und Todesfälle anvertraut. Besagter Herr Landoys war nicht wenig stolz darauf, sich für einen Abkömmling des Schatzmeisters Pierre Landoys halten zu dürfen, welcher im Jahre 1485 in der Bretagne gehängt worden war. Dieser Sieur Landoys hatte sich einmal beim Baden zu weit in die offene See gewagt, und schwebte in großer Gefahr zu ertrinken. Gilliatt rettete ihn mit Gefahr seines eigenen Lebens. Von diesem Tage an redete Landoys nichts Böses mehr über Gilliatt. Wenn man sich darüber verwunderte, antwortete er: Wie kann ich einen Mann verachten, der mir nichts zu Leide gethan und der mir einen so wichtigen Dienst geleistet? Der frühere Widerwille des Herrn Amtschreibers war nicht allein völlig gewichen, sondern hatte sogar einem gewissen Gefühl von Freundschaft Platz gemacht. Er war ein Mann ohne Vorurtheile. Er glaubte nicht an Zauberei. Er lachte über die Gespensterfurcht. Obgleich er, der den Fischfang als Liebhaberei trieb, oft Stunden lang in seinem Kahn auf dem Meere segelte, so war ihm doch noch niemals etwas begegnet, den einzigen Fall ausgenommen, daß er einmal eine weiße Frau im Mondenschein in das Meer springen sah; und auch das konnte er nicht als Wahrheit verbürgen, es mochte wohl eine Täuschung gewesen sein. Montonne Gahy, die Hexe von Torteval, hatte ihm ein kleines Säckchen gegeben, welches, auf der Brust getragen, vor den bösen Geistern schützen sollte; er lachte Ueber diesen Aberglauben, er hatte das Säckchen nicht einmal untersucht, wußte also gar nicht, was es enthielt; nichts desto weniger trug er es, weil er sich mit diesem Säckchen sicherer fühlte, auf der Brust.
Noch einige andere Leute von Muth hatten die Kühnheit, dem Vertheidigungs-Eifer des Sieur Landoys beizustimmen, indem sie durch Anführung gewisser mildernder Umstände den Stachel von Gilliatts bösem Leumund zu entkräften suchten. Wenn man auch Alles über ihn ergehen ließ, so mußten doch selbst seine erbittertsten Widersacher gelten lassen, daß es keinen mäßigeren und nüchterneren Menschen gab als Gilliatt. Man vermaß sich sogar zu der ungeheuer schmeichelhaften Frage: Wer ist so mäßig als Gilliatt? Er raucht nicht, er schnupft nicht, er trinkt nicht, er spielt nicht.
Nach der Meinung der Leute aber ist die Nüchternheit nur dann eine lobenswerthe Eigenschaft, wenn andere dazu kommen.
Die öffentliche Meinung war nun einmal gegen Gilliatt.
Wie dem aber auch sei, als Marcou konnte Gilliatt wesentliche Dienste leisten. Es erschien daher an einem gewissen Charfreitag um Mitternacht, an welchem Tag und zu welcher Stunde gewisse Wunderkuren unfehlbar waren, ein ganzes Heer Aussätziger im Gespensterhaus. Sie streckten flehend die Hände aus, entblößten ihre Wunden, und baten Gilliatt inständig, er möchte ihnen helfen. Er schlug es ab. Jetzt war man über seine Schändlichkeit im Klaren.
Sechstes Capitel. Ein altmodisches Schiff.
So war Gilliatt.
Die Mädchen fanden ihn häßlich. Er war es nicht; er war vielleicht das Gegentheil. Er hatte in seinem Profil etwas von einem antiken Barbaren. In Momenten der Ruhe glich er einem der Dacier auf der Säule des Trajan. Seine Ohren waren klein, von zierlicher Form und durch die Abwesenheit sogenannter Ohrlappen, wie durch einen bewunderungswürdig akustischen Bau ausgezeichnet. Zwischen den Augenbrauen hatte er jene stolze Linie, welche den kühnen und beharrlichen Mann verräth. Seine Mundwinkel waren herabgezogen, ein Kennzeichen der Schwermuth und Melancholie. Die Wölbung seiner Stirn war edel und klar, sein Auge offen und frei, obgleich die Ruhe seines Blickes öfter durch jenes Zucken der Lider unterbrochen wurde, welches den Fischern eigen ist; eine Erscheinung, die das wechselnde Licht der Wogen erzeugt. Sein Lachen war kindlich und reizend. Man konnte nichts Schöneres sehen als seine blendend weißen Zähne. Aber die Sonne hatte einen Neger aus ihm gemacht. Nicht ungestraft setzt man sich Tag und Nacht den Stürmen und Wettern des Oceans aus; obgleich erst dreißig, glich er einem Mann von fünfundvierzig Jahren. Er trug die dunkle Maske des Sturmes und der See.
Man nannte ihn Gilliatt, den Schelm.
Eine indische Fabel erzählt: Eines Tages frug Brâhma die Stärke: »Wer ist noch stärker als Du?« Sie antwortete: »Die Gewandtheit.« Ein chinesisches Sprichwort sagt: »Was vermöchte nicht der Löwe, wenn er ein Affe wäre?« Gilliatt war weder Löwe noch Affe; allein die indische Fabel und das chinesische Sprichwort paßten auf das, was er that, und wie er es that. Nur mittelmäßig groß und mit nur gewöhnlichen Körperkräften begabt, war er dennoch im Stande, Riesenlasten zu heben und Athletenwerke zu leisten. Keiner wußte wie er, durch Erfindungsgabe, durch Klugheit und Geschicklichkeit die Wirkungen der Kraft zu erzielen.
Ihm war die Gymnastik angeboren; er bediente sich mit gleicher Leichtigkeit der linken wie der rechten Hand.
Er war kein Jäger, aber ein Fischer. Die Vögel schonte er, doch nicht die Fische. Wehe den Stummen! Auch war er ein trefflicher Schwimmer.
Die Einsamkeit bildet Talente und Blödsinnige. Gilliatt konnte für Beides gelten. Er hatte zuweilen ein »erzdummes« Aussehen, dann aber hatte er wieder einen bezaubernd tiefen Blick. Im alten Chaldäa gab es solche Menschen; in gewissen Stunden leuchteten Magier durch die undurchsichtige Hülle des Hirten.
In Wahrheit war Gilliatt nichts weiter als ein armer Mensch, der lesen und schreiben konnte. Er stand auf der Grenze, welche den Träumer vom Denker scheidet. Der Denker will, der Träumer läßt sich leiten. Gesellt die Einsamkeit sich zur Einfalt, so vervollkommnet sie dieselbe. Sie erfüllt sie ohne ihr Wissen mit einem heiligen Grauen. Der Schatten, welcher Gilliatts Geist umhüllte, war aus zwei verschiedenen, doch in ihrer Stärke fast gleichen Elementen zusammengesetzt; in ihm war Unwissenheit, Schwäche, außer ihm das Geheimniß, die Unendlichkeit.
Das Inselmeer hatte ihn mit seinen tausendfältigen Gefahren, denen er muthig die Stirn bot, wenn er die steilen Felsen erkletterte und sich im Sturme bei Tag und Nacht dem Untergang Preis gab, indem er das erste beste Fahrzeug regierte, ohne sein Wissen und Wollen zu einem bewunderungswürdigen Seemann gemacht.
Er war ein geborener Lootse. Der Lootse ist ein Seemann, der mehr nach dem Grund, als nach der Oberfläche fragt. Die Woge ist eine räthselhafte Fläche, deren Gestalt fortwährend wechselt nach den Formen des Meergrundes, über welchen das Fahrzeug dahingleitet. Wenn man Gilliatt durch die Wasserberge und Felsenriffe des normännischen Archipelagus sich wie eine Wasserschlange winden sah, schien es, als ob unter der Wölbung seiner Stirn die Karte des Meeresgrundes verborgen wäre. Er kannte Alles und überwand Alles. Er kannte die Baken besser als die Seeraben, welche sich darauf setzen. Die unmerklichen Unterschiede, durch welche jeder einzelne der vier mit Pfählen gespickten Leinpfade der Creux, der Alligande, der Tremies und der Sardrette sich auszeichnet, waren für ihn im Nebel und selbst in der Dunkelheit der Nacht vollkommen klar und erkennbar.
Seine Seemannskunst bewährte sich glänzend bei Gelegenheit eines Schifferstechens, welches in Guernesey eines Tages stattfand. Man hatte nämlich die Aufgabe gestellt, ganz allein ein Schiff mit vier Segeln von St. Sampson bis zu der Insel Herm, – zwei Orte, welche zur See eine Meile weit von einander entfernt liegen – und wieder zurück zu führen. Das Lenken eines Schiffes mit vier Segeln ist für einen geübten Seemann nun gerade keine Hexerei. Die Schwierigkeit bestand aber erstens in dem zu regierenden Schiffe selber, welches eine jener breiten, schweren, kolossalen Schaluppen war, die aus Holland stammen und welche die Seeleute des vorigen Jahrhunderts » Holländische Bäuche« nannten. Man begegnet noch heute auf offener See solchen altmodischen Schiffsmodellen. Sie sind bausbäckig, flach, sie haben am Backbord und Steuerbord zwei Flügel, die den Schiffskiel vertreten. Die zweite Schwierigkeit war der Rückweg von Herm, wo das Schiff mit einer schweren Ladung Steine versehen wurde. Leer stach es in See, schwer beladen kam es zurück. Der Preis des Schifferstechens war eben diese Schaluppe. Der Sieger behielt sie. Dieser dickbäuchige Holländer wurde früher zum Lootsendienste benutzt. Der Lootse, welcher ihn zwanzig Jahre lang führte, war der kräftigste Seemann im Canal; als er starb, blieb das Schiff herrenlos, weil kein Anderer es zu regieren im Stande war, daher man denn auf den Gedanken kam, es zum Preis eines Schifferstechens zu machen. Das Schiff, obgleich mit keinem Verdeck versehen, hatte nichts desto weniger seine dem Kundigen erkennbaren Vorzüge. Es war nach vorn mit einem Maste versehen, was die Triebkraft des Segelwerkes vermehrte. Es hatte ein festes Gerippe, schwer, aber breit und hielt gut die weite See; es war so ein rechtes Sonntagsschiff. Es schien den Appetit der Seeleute sehr zu reizen; denn es entspann sich ein reger Wettkampf um den Besitz desselben. Sieben oder acht Fischer, die kräftigsten auf der Insel, waren als Kämpfer um den Preis in die Schranken getreten. Sie versuchten Alle nach einander ihr Heil, aber kein Einziger von ihnen erreichte Herm. Der Letzte, welcher es versuchte, war als kühner Wagehals bekannt, der einmal bei Sturm und Wetter den gefährlichen Engpaß zwischen Serk und Brecq-Hon in einem Kahne, und nur von dem Ruder Gebrauch machend, durchschifft hatte. Wie gebadet im Schweiße fruchtloser Anstrengung brachte er den dickbäuchigen Holländer zurück und sagte: Es ist unmöglich! Nun war die Reihe an Gilliatt, sein Glück zu versuchen. Er bestieg das Fahrzeug, stach in See und erreichte Herm nach einem Zeitraum von drei viertel Stunden. Nach drei Stunden brachte er das Schiff mit seiner schweren Ladung nach Sampson zurück. Das Fahrzeug war zum Ueberfluß noch mit der kleinen Kanone von Bronze beladen, welche die Bewohner von Herm alljährlich am fünften November, dem Todestag von Guy Fawkes abzufeuern pflegten.
Guy Fawkes war, beiläufig gesagt, vor zweihundert sechszig Jahren gestorben; die Freude über seinen Tod war also von sehr altem Datum.
Gilliatt erreichte St. Sampson ungeachtet der Kanone des Guy Fawkes, und ungeachtet eines conträren Südwindes, welcher sich bei der Rückfahrt erhoben hatte.
Als ein gewisser Mess Lethierry, von welchem später die Rede sein wird, das beladene Fahrzeug ankommen sah, rief er begeistert aus: Das nenne ich mir einen Seemann!
Er reichte Gilliatt die Hand. Die Schaluppe wurde demselben feierlichst zugesprochen.
Trotz dieser Heldenthat behielt er seinen Beinamen: der Schelm.
Einige Leute suchten das Wunder durch die Vermuthung zu erklären, daß Gilliatt irgendwo in diesem Schiffe einen wilden Mispelzweig verborgen habe; denn wie sollte gerade er, der doch kein Seemann war, etwas vollbringen können, was erfahrene Schiffskundige nicht vermochten? Nein, es war nicht möglich, es mußte Zauberei im Spiel sein.
Seit jenem Tage hatte Gilliatt kein anderes Fahrzeug mehr in Gebrauch, als diese altmodische holländische Schaluppe. Sie diente ihm sogar zum Fischfang. Er brachte sie in jenem, ihm allein gehörenden kleinen Hafen neben seinem Hause unter. Wenn es donnerte, warf er seine Netze über den Rücken, schritt durch den Garten, setzte dann über eine Brustwehr trockener Steine, und von einem Felsen zu dem andern springend, erreichte er sein Fahrzeug und stach in See.
Er brachte stets reiche Beute mit nach Hause. Die Leute meinten, dies auffallende Glück im Fischfange schreibe sich daher, daß er noch immer den Mispelzweig in der Schaluppe verberge; es hatte ihn indessen Keiner dort entdeckt.
Seinen Ueberfluß an Fischen verkaufte Gilliatt nicht, sondern er verschenkte ihn.
Die Bedürftigen nahmen seine Fische an, waren aber nichts desto weniger empört über die Hexerei mit dem wilden Mispelzweig. Das ist sündlich, sagten sie; man darf das Meer nicht um sein Eigenthum betrügen.
Gilliatt war Fischer; aber er trieb nicht allein den Fischfang, sondern auch noch manche andere Dinge zum Zeitvertreib. Er war auch Tischler, Schmied, Wagner, Schiffs-Zimmermann und sogar auch ein wenig Mechanikus. Er hatte eine angeborene Geschicklichkeit zu allen Dingen und trieb diese verschiedenen Handwerke, ohne sie gelernt zu haben, zum Vergnügen. Keiner konnte ein so gut gearbeitetes Rad liefern als er. Alle seine Fischerwerkzeuge verfertigte er sich selbst. Er hatte in einem Winkel seines Hauses eine vollständige kleine Schmiedewerkstätte eingerichtet. Seine Schaluppe hatte nur einen Anker; er fertigte ohne die Hülfe eines Arbeiters und ohne jede Anweisung einen zweiten, der ganz vortrefflich war, und er verstand die Größe und Stärke des Ankerstocks so zu berechnen, daß ein Umschlagen des Schiffes nicht möglich war.
Er hatte mit großer Geduld alle eisernen Nägel aus den Schiffsplanken gezogen und sie durch hölzerne ersetzt, wodurch er die gefährlichen Rostlöcher unmöglich machte.
Auf diese Weise hatte er seinen »Holländer« noch weit seetüchtiger gemacht. Er machte auf demselben von Zeit zu Zeit kleine Streifzüge und brachte oft monatelang auf irgend einer einsamen Insel zu. Dann sagten die Leute, Gilliatt ist fort; Keiner aber nahm sich seine Abwesenheit besonders zu Herzen.
Siebentes Capitel. Ein sonderbarer Mensch in einem sonderbaren Haus.
Gilliatt war ein Träumer. Aus seiner Träumerei entsprang sowohl seine Kühnheit wie seine Schüchternheit. Er hatte seine Gedanken für sich.
Er hatte etwas von einem Geisterseher, etwas von einem Illuminaten. Jeder Bauer kann eben so gut Geisterseher sein, wie König Heinrich IV. Der geheimnißvolle Schleier, welcher die Welt des Unbekannten vor den Blicken der Erdbewohner verhüllt, öffnet sich zuweilen, wenn auch nur für Augenblicke. Der dichte Schatten, welcher das Unsichtbare birgt, lüftet sich plötzlich, um sich dann wieder zu schließen. Solche Visionen verklären zuweilen die Menschen, welchen sie verliehen sind. Sie machen aus einem Kameeltreiber einen Mahomed und aus einer Hirtin eine Johanna d'Arc. Es giebt gewisse erhabene Geistesverirrungen, welche die Einsamkeit erzeugt. Sie sind der Rauch des flammenden Dornbusches. Aus ihnen entsteht ein geheimnißvolles Zittern der Gedanken, welches den Arzt zum Hellseher, den Dichter zum Propheten erhebt. Es hat Horeb, Cedron, Ombos, Peleïa in Dodonaien, Phemonoë in Delphis, Trophonius in Lebadea, Ezechiel auf dem Kebar, Hieronimus in der thebischen Wüste hervorgebracht.
Gewöhnlich wirkt der Zustand des Hellsehens betäubend auf den Menschen. Es giebt einen heiligen Stumpfsinn. Der Fakir ist mit seiner Vision behaftet, wie der Cretin mit seinem Kropf. Luther, der auf der Wartburg dem Teufel sein Dintenfaß an den Kopf warf, Pascal, der sich mit seinem Bettschirm vor dem Fegefeuer geschützt, der Negerpriester, der mit dem weißen Gotte Bossum spricht – alles dieselbe Erscheinung, die sich nach der Verschiedenheit der Intelligenz verschiedenartig gestaltet. Luther und Pascal sind und bleiben große Männer; der Negerpriester ist ein Wahnwitziger.
Gilliatt war weder das Eine noch das Andere. Er war ein Träumer; weiter nichts.
Es waren ihm im Meerwasser zuweilen sonderbare medusenartige Thierformen verschiedenster Gestaltungen und Größe aufgefallen, die außerhalb des Wassers wie weicher Krystall aussahen und welche, wieder in das Wasser geworfen, demselben an Farbe und Durchsichtigkeit so vollkommen ähnlich waren, daß ihre eigenthümlichen Formen ganz verschwanden und sie wie aufgelöst in der Allgemeinheit des Elementes erschienen. Gilliatt schloß daraus, daß, wie im Wasser, so auch wohl in der Luft lebendige Wesen existiren könnten, deren Gestaltungen mit dem Element so verschmolzen seien, daß man ihre besondere Erscheinung nicht unterscheiden könne. Die Vögel sind nicht die Bewohner der Luft, sie sind ihre Amphibien. Gilliatt glaubte nicht an die Leere der Luft. Er sagte: Wie sollte die Luft leer sein, wenn das Meer voll von unsichtbaren Wesen ist? Sollten nicht auch in der Luft Wesen existiren, deren Gestaltung wir nicht wahrnehmen können, weil sie aus demselben Element gebildet, welches sie bewohnen? Die Analogie deutet darauf hin, daß die Luft ebenso gut ihre Fische habe wie das Meer die seinigen, nur sind diese Fische Luftfische, durchsichtig und anscheinend körperlos wie das Element, das sie bewohnen; das hat zu ihrem und zu unserem Wohl die göttliche Vorsehung so eingerichtet; das Licht des Tages durchdringt ihre ätherischen Körper ohne einen Schatten zu bilden; das ist der Grund, warum wir sie nicht sehen. Gilliatt bildete sich ein, daß, wenn man die Atmospäre, das Luftmeer wie das Wassermeer behandeln, wenn man dieses Meer wie ein anderes befahren, und Netze darin auswerfen könnte, man eine Fülle der wunderbarsten Wesen finden würde. Und, setzte Gilliatt träumerisch hinzu, es würden viele Dinge offenbar werden, die unserem begrenzten Menschenauge sich entziehen.