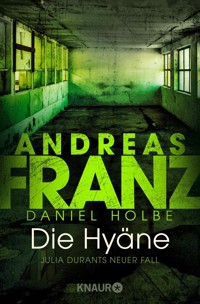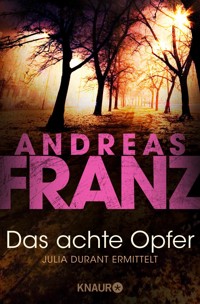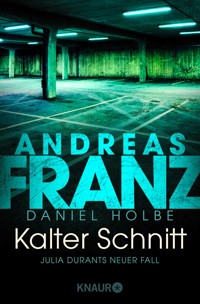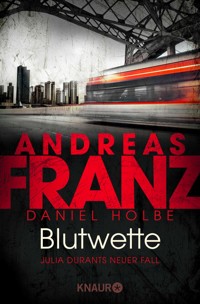9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Der erfolgreiche Jungunternehmer David Marquardt ist betrogen worden und steht vor dem Nichts. Hilfe erhält er von einer Bankerin. Allerdings ist deren Hilfsbereitschaft an sehr merkwürdige Bedingungen geknüpft. Die Bankerin von Andreas Franz: Spannung pur im eBook!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 579
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Andreas Franz
Die Bankerin
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Inhaltsübersicht
Prolog
22. April, Samstag
Mittwoch, 26. April
Donnerstag, 16.30 Uhr
Freitag, 18.30 Uhr
Samstag, 8.45 Uhr
Montag, 8.30 Uhr, Polizeipräsidium
Freitag, 20.00 Uhr
Samstag, 10.00 Uhr
Montag, 19. Juni
Dienstag, 18.00 Uhr
Mittwoch, 8.30 Uhr
Freitag, 20.00 Uhr
Samstag, 1.15 Uhr
Montag, 9.15 Uhr
Dienstag, 7.15 Uhr
Mittwoch, 11.00 Uhr
Samstag, 8.00 Uhr
Montag, 9.00 Uhr
Dienstag, 8.15 Uhr
Mittwoch, 1.25 Uhr
Donnerstag, 8.30 Uhr
Freitag, 10.00 Uhr
Montag, 8.00 Uhr
Dienstag, 11.50 Uhr
Mittwoch, 8.00 Uhr
Donnerstag, 19.30 Uhr
Samstag, 9.00 Uhr
Epilog
Prolog
Die Luft im Zimmer war stickig und schwül. Der Mann war mit Handschellen ans Bett gefesselt, er hatte es so gewollt, in der Absicht, eine außergewöhnliche Liebesnacht zu verbringen.
»Na, gefällt es dir?« fragte sie lächelnd, während sie ihr Kleid auszog, unter dem sie einen schwarzen BH und einen schwarzen Slip trug.
»Ja, verdammt noch mal, ja, es gefällt mir! Mach mit mir, was du willst, du wirst es auch nicht bereuen.«
Sie ging näher an das Bett heran, beugte sich hinunter, ihr Gesicht war direkt vor seinem, aus seinem Mund drang der penetrante Geruch von Whisky. Er hatte Schweißperlen auf der Stirn, als sie sagte: »Nein, ich werde es ganz sicher nicht bereuen. Ganz sicher nicht. Du wirst es bereuen, mich in dein Haus gelassen zu haben.«
Sein Blick veränderte sich, aus anfänglicher Lust wurde mit einemmal Angst. Er rüttelte an den Bettpfosten, doch seine Hände hatten kaum Spielraum. Die Frau öffnete ihren Koffer, holte einen Sack heraus, warf einen kalten, abschätzenden Blick auf den Mann. Sie trat wieder an das Bett, im Sack war Bewegung. Die Frau hatte lange Stiefel und bis über die Ellbogen reichende Lederhandschuhe an. Alle Fenster waren geschlossen, nur der riesige Ventilator bewegte sich mit leisen Umdrehungen. Das Haus stand einsam am Ende der Straße, direkt dahinter breitete sich ein schier undurchdringlicher Dschungel aus.
»Wie klein dein Schwänzchen doch geworden ist …«
»Was willst du? Wer bist du?«
»Wer ich bin?« sagte sie verklärt, den Sack noch immer in Händen haltend. »Nenn mich Bastard, einfach nur Bastard … du weißt doch, was ein Bastard ist, oder?«
»Ja, ja, ja … aber was um alles in der Welt willst du von mir? Ist das ein neues Spiel?«
»Es ist vielleicht ein Spiel. Aber im Grunde möchte ich, daß du eine Schuld begleichst … Nur eine Schuld. Ich sehe an deinem Blick, daß du mich nicht kennst, und ich sehe deine Angst, deine verfluchte, gottverdammte Angst. Ich kenne dich, und irgendwie kennst du mich auch. Irgendwie. Und irgendwie sind wir eins, irgendwie aber auch nicht …«
»Was soll der Scheiß, was faselst du da? Schuld, Schuld, Schuld! Von was für einer verdammten Schuld redest du?« Sie reagierte nicht darauf, sagte: »Nackt siehst du übrigens überhaupt nicht mehr gut aus. Du bist zu fett, und ich kann fette Männer nicht ausstehen. Ich ekle mich vor ihnen … Ein fetter Bauch und ein winzig kleines Schwänzchen. Und trotzdem hast du damit schon ganz schön viel Unheil angerichtet …«
Der Schweiß rann in Bächen über sein Gesicht und seinen nackten Körper. »Was meinst du damit?« schrie er hysterisch. »Und was hast du da in diesem Sack?«
Sie lachte auf, doch ihr kalter Blick strafte das Lachen Lügen. »In dem Sack befinden sich die Schuldeneintreiber. Damit wird ein für allemal deine Schuld getilgt sein. Ist das nicht herrlich, endlich schuldenfrei zu sein, diesen Ballast loszuwerden? Schulden sind doch etwas Erdrückendes, oder?«
Sie öffnete vorsichtig die Schlaufe, die den Sack zusammenhielt. Warf dem Mann einen undefinierbaren Blick zu, ging ans Bett, sah seine vor Angst weit geöffneten Augen, seine Unfähigkeit, auch nur einen Laut herauszubringen.
»Möchtest du noch etwas sagen? Vorher, meine ich?«
»Ich habe nichts Unrechtes getan«, krächzte er. »Nie in meinem Leben habe ich etwas Unrechtes getan. Glauben Sie mir, ich bin unschuldig, was immer Sie glauben mögen.«
»Möchtest du vielleicht noch etwas zu trinken, deine Stimme hört sich nicht gut an. Ein Whisky? Du kannst von mir aus die halbe Flasche trinken, dann spürst du vielleicht den Schmerz nicht so sehr …«
»Bitte!!!!!«
»Trink den Whisky, ich will nicht zu grausam sein. Hier, ich halt sie dir an den Mund, nimm ein paar Schlucke.«
Er trank hastig, mit einemmal riß sie die Flasche weg und stellte sie auf den Tisch. Sie riß den Sack mit dem sich immer heftiger bewegenden Inhalt auf, trat direkt vor den Mann, der nur noch keuchte, drehte den Sack um und ließ den Inhalt auf den Körper des Mannes fallen. Er schrie, als die Giftzähne sich in seinen zuckenden Körper bohrten, während sie sich das Kleid anzog, die Tasche umhängte, einen letzten verächtlichen Blick auf den Mann warf und das Haus verließ. Ein paar Minuten noch, und es würde diesen Mann nicht mehr geben. Sie lächelte.
Es waren furchtbare Tage. Nach zwei Wochen brütender Hitze, die in diesem Jahr ungewöhnlicherweise bereits Mitte April begonnen hatte, war der Regen gekommen, Sturzfluten hatten sich über die Stadt und das Land ergossen, und jetzt regnete es schon seit drei Tagen fast ununterbrochen, herrschte graue, triste Dämmerung. Zwar hatte der Regen Abkühlung mit sich gebracht, dafür war die Feuchtigkeit in jeden Winkel der Wohnung gekrochen. Aber der Regen war nicht der Grund, weshalb er sich miserabel fühlte, seit Tagen unter stechenden Kopfschmerzen in der linken Schläfe litt, keinen Appetit hatte und ein gähnendes schwarzes Loch sich wie ein riesiger, gefräßiger Schlund vor ihm auftat. Begonnen hatte es am Dienstag, als die erste Rechnung wie eine tickende Bombe im Briefkasten lag, am Mittwoch, Donnerstag und Freitag waren es jeweils zwei Rechnungen, und am Samstag kamen gleich fünf auf einen Streich. Es war das gleiche wie immer, Telefon, Versicherung sowie die Rate für den Autokredit, die von der Bank wieder einmal mangels Deckung nicht überwiesen worden war. Dazu kamen die Reparatur der Waschmaschine, ein Strafmandat für falsches Parken (vierzig verdammte Mark für zehn Minuten Parken im eingeschränkten Halteverbot, nur weil die dämliche Kuh in seiner Bankfiliale geschlagene fünf Minuten ein privates Telefonat führte!), die in einem Monat fällige Kfz-Steuer, die zweimonatliche Gas- und Wasserrechnung. Alles in allem, zusammen mit Miete und den anderen Ausgaben eines großen Haushalts, 2937,85 DM. Das war verdammt viel für jemanden, dessen Einkommen kaum höher lag. Verdammt viel für jemanden, dessen Kinder dringend neue Sommerkleidung brauchten. Verdammt viel für jemanden, der ohnehin nichts mehr hatte und wahrscheinlich auch nie wieder etwas haben würde. Er dachte die absurdesten Gedanken, wie er die Situation seiner Familie verbessern konnte, doch entweder waren diese Gedanken kriminell oder nicht durchführbar.
Dabei hätte er noch vor einem Jahr angesichts der Höhe dieser Rechnungen nur müde lächelnd mit den Schultern gezuckt und sich nicht einmal im Traum vorstellen können, kaum zwölf Monate später auf der anderen, der lausigen Seite des Lebens zu stehen.
Es war der 10. Mai gewesen. Ein warmer, sonniger Tag. Er war gerade ins Büro gekommen, etwas später als sonst wegen eines Zahnarzttermins, die meisten anderen der siebenundzwanzig Angestellten waren bereits anwesend, bis auf eine Schreibkraft, die nur halbtags arbeitete und heute erst um dreizehn Uhr kommen würde, und der Buchhalter und Prokurist Dr. Edouard Meyer, dessen Krankmeldung auf David von Marquardts Schreibtisch lag. Er würde die nächsten zehn Tage nicht da sein. David nahm sich vor, ihn gegen Mittag anzurufen, nicht um ihm nachzuspionieren, dazu kannte er Meyer zu gut, er war zu korrekt, als daß er eine Krankheit nur simuliert hätte, sondern um sich nach seinem Befinden zu erkundigen. Seit fünfzehn Jahren kannten sie sich, seit elf Jahren war er für David eine unverzichtbare Kraft, ein fleißiger, analytischer Kopf, dem es mit zu verdanken war, daß das Unternehmen so florierte. Doch es war vor zwölf Jahren auch Glück gewesen, in einen gerade boomenden Markt vorzustoßen – Software für PC-Anwender, Textverarbeitung, Tabellenkalkulation. Vor allem mit dem Textverarbeitungsprogramm hatten sie den Markt gestürmt, hatten ein Produkt entwickelt, Marqword, das alle anderen damals erhältlichen Programme mit Riesenschritten hinter sich ließ. Entwickelt von David und seinem besten Freund Michael Treusse, der aber den gewaltigen Erfolg des Produkts nicht mehr auskosten konnte, ein ruptiertes Aneurysma der Bauchschlagader hatte seinem noch jungen Leben ein jähes Ende bereitet. Das einzige Glück war, wenn es überhaupt etwas Positives an seinem Tod gab, daß er weder eine Frau noch Kinder noch eine Geliebte hinterließ, er war schwul, lebte allein, hatte nur dann und wann eine lose Beziehung, die sich in den meisten Fällen auf One-Night-Stands beschränkte. Was David jedoch am meisten vermißte, war die unbeschreibliche Genialität, mit der Treusse selbst schwierigste Probleme bei der Programmentwicklung scheinbar mühelos knacken konnte.
Innerhalb von nur einem Jahr wuchs die Zahl der Angestellten von drei auf zehn. Mittlerweile zählte das Unternehmen insgesamt siebenundzwanzig Mitarbeiter, von denen fünfzehn direkt mit der Neu- und Weiterentwicklung von Programmen sowie der Erstellung von Handbüchern beschäftigt waren. Der Ertrag betrug im letzten Jahr achtundzwanzig Millionen Mark, der Kreditrahmen bei der Bank fünfzehn Millionen Mark. Seit Gründung des Unternehmens war der Umsatz Jahr für Jahr um zehn bis fünfzehn Prozent gesteigert worden. Es gab nichts, aber auch gar nichts, wovor sich die MARQUARDT GMBH hätte fürchten müssen. Das Produkt stimmte, der Umsatz war gigantisch, das Betriebsklima ausgezeichnet. Es gab kein Mobbing, keinen Neid, alle verdienten überdurchschnittlich gut.
David von Marquardt, gerade vierzig geworden, genoß dieses Leben, das er sich in akribischer Feinarbeit aufgebaut hatte. Er lebte mit seiner Frau Johanna und den vier Kindern, von denen sie eins mit in die Ehe gebracht hatte, in einer großzügigen Villa in der nobelsten Ecke von Niederrad, er fuhr abwechselnd den Jaguar oder den Porsche, Johanna begnügte sich mit einem kleinen Renault. Es gab fast nichts, was sie sich nicht leisten konnten. Der einzige Wermutstropfen in ihrem Leben war ihr zehnjähriger Sohn Maximilian, der mit einem schweren Herzfehler zur Welt gekommen war und bereits zwölf Operationen über sich hatte ergehen lassen müssen, und die Frage war, wie lange sein ohnehin schwächlicher Körper noch durchhielt. Er ging zwar zur Schule, aber wegen der vielen Arztbesuche und Krankenhausaufenthalte war er statt in der dritten erst in der zweiten Klasse. Die Ärzte sagten, es wären noch mindestens fünf Operationen notwendig, um die schlimmsten Beschwerden zu beseitigen. Ob er jedoch jemals ganz gesund sein würde, das vermochte niemand zu prophezeien.
Der zweiundzwanzigjährige Thomas studierte in Harvard Amerikanistik und Geschichte, der sechzehnjährige Alexander und die dreizehnjährige Nathalie besuchten Privatschulen; beide zählten zu den besseren Schülern ihrer Klasse, beide waren sehr musisch veranlagt, was sie offensichtlich von ihrer Mutter geerbt hatten, die, bevor sie David kennenlernte, ihr Brot als Pianistin verdient hatte. Johanna war fünf Jahre älter als David, doch das störte weder sie noch David. Seit neunzehn Jahren kannten sie sich, er hatte sich gerade an der Uni eingeschrieben, sie spielte in Bars, um den Unterhalt für sich und den unehelichen Sohn Thomas zu verdienen. Er ging noch immer zur Uni, als sie heirateten, sie spielte weiter Klavier und gab Unterricht. Mit vierundzwanzig, direkt nach seinem Examen, trat er in eine große, jedoch überalterte Firma ein, wo er es drei Jahre aushielt, bis er feststellte, daß er mit seinen Fähigkeiten am falschen Ort war. Innovationen gegenüber zeigte man sich wenig aufgeschlossen, unzählige Häuptlinge, fast alle über fünfzig, machten sich selbst das Leben schwer, und David hatte kaum Möglichkeiten, seine Kreativität zu entfalten. Er hatte heimlich und nebenbei mehrere Kontakte zu Firmen aufgebaut, die interessiert waren an innovativer Software für ihre speziellen Computerbedürfnisse. Von dem Geld, das er mit seinen ersten drei Programmen verdiente, gründete er die MARQUARDT GMBH. Und seitdem war sein Aufstieg nicht mehr zu bremsen.
Er warf einen kurzen Blick auf die Krankmeldung von Meyer, legte sie wieder auf den Schreibtisch, ging die Notizen durch, die auf dem Tisch lagen, sah nach, welche Termine für den Tag anstanden. Er setzte sich, nahm den Hörer in die Hand und wollte gerade eine Nummer eintippen, als Frau Seubert, seine Sekretärin, in der Tür stand. Sie hatte hektische Flecken am Hals, brachte kaum einen Ton heraus, wurde etwas rüde von einem Kerl in einem beigefarbenen Lederblouson zur Seite geschoben. Jetzt sah David noch mehr Männer auftauchen, und bevor er irgend etwas sagen konnte, meinte der in dem Lederblouson: »Herr Marquardt?«
»Ja?«
»Bitte stehen Sie auf und rühren Sie nichts mehr an. Sie sind vorläufig festgenommen.«
»Bitte was?« fragte David ungläubig und erhob sich von seinem Sessel; er versuchte zu grinsen, was aber gründlich mißlang. »Warum, um alles in der Welt, bin ich verhaftet?«
»Stellen Sie doch um Himmels willen nicht so blöde Fragen!«
»Ich stelle sie aber!« schrie David erregt. »Ich habe nämlich keine Ahnung, was hier eigentlich vorgeht!«
»Na gut, spielen wir das Spiel«, sagte der Kerl mit zynischem Grinsen und zündete sich ungeniert eine Zigarette an, obgleich keiner in der Firma rauchte. »Sie sind pleite, bankrott. Es ist aus und vorbei mit der MARQUARDT GMBH. Jetzt kapiert?«
»Was sagen Sie da? Ich und pleite? Sie müssen sich täuschen«, sagte David von Marquardt und brachte wieder nur eine Grimasse zustande.
»Ja, ja, das sagen alle …«
»Nein, verdammt noch mal, Sie müssen sich täuschen! Wir und pleite! Wir sind das stabilste und am schnellsten wachsende Unternehmen im Softwarebereich in Europa. Und wir sollen pleite sein?! Daß ich nicht lache! Spielen Sie Ihre albernen Spielchen woanders, aber nicht hier! Gehen Sie doch zu meiner Bank oder zu meinen Kunden …«
»Bevor Sie weiterreden, Herr Marquardt – es ist genau Ihre Bank, die uns geschickt hat. Und einige Gläubiger, die seit Monaten auf ihr Geld warten. Und nicht nur die sind scharf auf Sie, sondern vor allem das Finanzamt, wegen Steuerhinterziehung. Sie sind pleite, guter Mann, ob Sie es wahrhaben wollen oder nicht. So, ich denke, Ihre anderen Angestellten wissen inzwischen auch Bescheid. Sie werden jetzt mit uns kommen, sämtliche Akten werden beschlagnahmt …«
»Dr. Meyer! Er ist mein Buchhalter und Prokurist, er könnte Ihnen sicherlich sagen, daß dies alles ein riesengroßer Irrtum ist …«
»Wo ist dieser Dr. Meyer?«
»Er ist krankgeschrieben. Hier«, sagte David und hielt dem Kerl in dem Lederblouson den gelben Schein hin, »hier ist die Krankmeldung. Sie lag, als ich vorhin kam, auf dem Tisch. Dr. Meyer wird alles aufklären können …«
»Wo wohnt er?«
»Orffweg zwölf.«
»Gut, wir werden gleich jemanden hinschicken, der sich mit ihm unterhalten wird. Ist er öfters krankgeschrieben?«
David fuhr sich übers Kinn, blickte nachdenklich auf den Mann vor ihm, der ihm von Sekunde zu Sekunde unsympathischer wurde. Er schüttelte den Kopf. »Nein, eigentlich nicht. Eigentlich ist er, solange ich ihn kenne, noch überhaupt nicht krank gewesen. Seltsam …«
»Kommen Sie, wir gehen jetzt. Auf dem Präsidium werden Sie einige Fragen zu beantworten haben.«
Das war das letzte Mal gewesen, daß er seine Firma betreten hatte. Alle Akten waren beschlagnahmt, er selbst vier Wochen lang von morgens bis abends verhört worden. Vier Wochen in Untersuchungshaft, vier Wochen Angst vor der Zukunft, die nichts war als ein riesiges schwarzes Loch, in das er fiel und fiel und fiel. Vier Wochen lang keinerlei Kontakt zu seiner Familie. Sie hatten ihm nicht glauben wollen, daß er ahnungslos war, sie hatten ihm nicht abgenommen, daß er von den getürkten Steuererklärungen nichts wußte, genausowenig wie von den seit drei Monaten nicht bezahlten Versicherungsbeiträgen, am wenigsten aber, daß er behauptete, nicht zu wissen, daß das Dispositionslimit bei der DEUTSCHEN GENERALBANK von zehn Millionen um zwei Millionen überschritten war, obgleich bis vor einem Dreivierteljahr ein Guthaben von fast zwanzig Millionen bestanden hatte, aber seit fünf Monaten nicht ein einziger Eingang mehr verzeichnet worden war. Sämtliche Zahlungseingänge waren auf ein anderes, vor einem halben Jahr eingerichtetes Konto bei einer anderen Bank gegangen. Ein Konto, für dessen Einrichtung David von Marquardts Unterschrift vorlag, genau wie die von Dr. Meyer. Doch David hatte nie eine Einwilligungserklärung für die Einrichtung eines neuen Kontos unterschrieben. Er konnte es sich nicht erklären, und er grübelte verzweifelt.
Und Dr. Meyer war verschwunden. Seit dem Tag vor Davids Verhaftung. Eine Nachbarin hatte ihn am späten Nachmittag in einem Taxi wegfahren sehen, er hatte zwei große Koffer bei sich. Und auch Davids Steuerberater, Gerhard Neubert, war unauffindbar. Beide auf und davon. Mit über dreißig Millionen Mark, wie es schien. Interpol war eingeschaltet, zwei internationale Haftbefehle ausgeschrieben worden, doch jeder wußte, wie leicht es war, mit diesem Geld eine neue Identität in einem anderen Land anzunehmen. Wahrscheinlich würden die beiden nie gefunden, es sei denn, meinte ein Kriminalbeamter, einen der beiden plagte das Heimweh, was in solchen Fällen gar nicht einmal so selten vorkam. Das wäre dann vermutlich die einzige Möglichkeit, sie zu schnappen.
David hatte alles verloren, was er sich aufgebaut hatte. Seine Firma, seine Reputation, sein Haus, seine Autos. Keine Einkäufe mehr mit der Golden American Expresscard, der Eurocard, der Visacard. Keine Reisen mehr, keine der wenigen, aber ergiebigen Bummel durch noble Geschäfte. Aus und vorbei. Kein Harvard mehr, keine Privatschule. Die Menschen, denen er am meisten vertraut hatte, hatten ihn betrogen und ausgeraubt. Die ersten Monate hatte er wie in Trance zugebracht, er war wie hypnotisiert, wollte nicht wahrhaben, daß all dies geschehen war, geschehen konnte, daß es Menschen in seiner Umgebung gab, die so niederträchtig waren. Er kam sich vor wie in einem bösen Traum, hoffte immer wieder, bald daraus zu erwachen, doch da war niemand, der mit den Fingern schnippte und ihn von diesen Ketten befreite.
Die Versteigerung des Hauses samt Mobiliar und Bildern, darunter ein Modigliani und ein Manet, der Autos, des Firmeninventars deckte in etwa die Hälfte des entstandenen Schadens. Ein weiterer beträchtlicher Teil wurde durch das Abstoßen von Aktienpaketen und den Verkauf der Softwarerechte an einen zunächst unbekannt gebliebenen Käufer gedeckt. Später erfuhr David, daß eine Firma mit Namen SOFPRO die neue Eigentümerin der Rechte war. Aber noch blieben achtundachtzigtausend Mark Restschuld.
Einem Freund bei der Kripo Frankfurt, Hauptkommissar Manfred Henning, hatte er es schließlich zu verdanken, daß man ihn nach nur vier Wochen aus der U-Haft entließ, doch leider konnte dieser Freund sonst nichts weiter für David tun; er arbeitete für die Mordkommission und nicht für die Steuerfahndung.
Kurz nachdem er aus der U-Haft entlassen worden war, hatte er wieder Arbeit gefunden, bei Werner Holbein, dem ebenfalls ein Softwareunternehmen, die PROCOM, gehörte und der David in der Poststelle untergebracht hatte. Als sie zur Uni gingen, waren sie dicke Freunde gewesen; sie hatten zusammengearbeitet, bis sie sich, was die Entwicklung eines Programms anging, in die Haare gerieten und sich ab da ihre Wege trennten. Drei Jahre lang waren die beiden Firmen härteste Konkurrenten auf dem Gebiet der Softwareentwicklung, wobei die MARQUARDT GMBH die PROCOM schließlich weit hinter sich gelassen hatte und diese sich, um bestehen zu können, auf unternehmensspezifische Programme für NetServer spezialisierte.
Werner Holbein war, als der Bankrott der MARQUARDT GMBH bekannt wurde, trotz der ehemaligen Feindschaft einer der wenigen, die hinter David standen, ihm glaubten, daß er mit dem Konkurs seiner Firma nichts zu tun hatte. Er hatte sich bei der Deutschen Generalbank für David eingesetzt und einen Deal ausgehandelt, woraufhin die Bank bereit war, die noch ausstehende Schuldsumme in ein befristetes Darlehen umzuwandeln, das mit monatlich eintausendfünfhundert Mark rückgeführt wurde.
Jetzt hausten sie in einer schäbigen Fünfzimmerwohnung in einem Hochhaus in einem der elendsten und schmutzigsten Gebiete von Frankfurt. Ihre Wohnung lag im zweiten Stock, die Aufzüge waren meist außer Betrieb, das Treppenhaus eine stinkende Müllhalde, in die gepißt und geschissen wurde, wo Junkies sich ungeniert einen Schuß setzten, wenn ihnen danach war. Vor drei Wochen war sein Wagen, ein acht Jahre alter Peugeot 505 Familiale, von Unbekannten über und über mit Fäkalien beschmiert worden, man hatte ihm einen Schuhkarton mit Hundekot vor die Tür gelegt, der nachts um zwei explodierte, in seinen Briefkasten war uriniert worden, immer wieder klingelte das Telefon, ohne daß sich jemand meldete, man hörte nur schweres Atmen am anderen Ende der Leitung, und er hatte schon mehrere Drohbriefe von Unbekannt erhalten, daß ihm und seiner Brut, wie es hieß, das Leben zur Hölle gemacht werden würde. Er hatte mit seinem Freund Manfred Henning von der Kripo gesprochen, ihm die Briefe gezeigt; er vermutete, daß hinter alledem ehemalige Mitarbeiter steckten, die sich auf diese abscheuliche Weise an ihm rächen wollten. Henning war der gleichen Meinung, sagte aber, daß die Polizei absolut nichts ausrichten könne, solange kein physischer Schaden entstand und das Leben der Familie nicht in unmittelbarer Gefahr war. Worüber David nur hämisch lachte, weil ihm diese Mitteilung ganz und gar nicht die Angst nahm, daß ihm oder einem Mitglied seiner Familie etwas zustoßen könnte.
Und jetzt waren da diese wie ein Damoklesschwert über ihm hängenden Rechnungen; jeder wollte sein Geld sofort haben. Kleinere Beträge wie Strafmandate ließen sich hinauszögern bis zur zweiten Mahnung oder sogar bis zum Einschreiben mit Androhung von Erzwingungshaft. Doch weder der Vermieter noch das Finanzamt, noch die Stadtwerke oder das Fernmeldeamt ließen mit sich spaßen, Strom und Telefon waren ganz leicht abzustellen.
Das war es, was ihm Kopfzerbrechen bereitete. Er hätte besser aufpassen müssen, nicht so gutgläubig sein dürfen, hätte öfters selber überprüfen müssen, ob mit dem Konto und den Rechnungen alles in Ordnung war. Aber jetzt war es zu spät, über diese Versäumnisse nachzugrübeln.
Möglicherweise wäre das alles auch nicht so schlimm gewesen, irgendwie hätte er es geschafft, wären da nicht die vier Kinder. Von der Kinderzahl her zählten sie bereits zu den Minderheiten, zu den mitleidig, aber auch spöttisch Belächelten, den jenseits der Gutbürgerlichkeit Angesiedelten. Vier Kinder – auch wenn eines davon bereits erwachsen war – in einem Land, in dem kaum noch Großwohnungen gebaut und Kindergartenplätze zu einer heißbegehrten Mangelware wurden, zeugten in den Augen vieler von grober Verantwortungslosigkeit. Vier Kinder konnten schon den ersten Schritt zur Asozialität bedeuten.
Bereits zweimal hatte er um Stundung der Raten gebeten, jetzt, beim drittenmal, hatte die Bank die Nase voll von seinen Überziehungen, Bitten und Betteleien um Stundung, und es hätte schon eines mittleren bis großen Wunders bedurft, aus dieser Misere mit einigermaßen heiler Haut herauszukommen.
Er und Johanna, diese kleine, bis vor kurzem noch so zierliche, liebenswürdige Person, die fast immer ohne zu murren zu ihm gehalten hatte (welchen Grund zu murren hätte sie in den letzten Jahren auch schon gehabt!?), suchten seit Tagen nach einem Ausweg aus der Misere, doch ihre Gedanken waren gefangen, drehten sich im Kreis, sie waren verzweifelt. Wovon sollten sie in Zukunft leben, wovon die hungrigen Mäuler stopfen? Schlaflose Nächte, Tage voll endlosem Grübeln. Die Stimmung zwischen Johanna und ihm sank auf einen Tiefstpunkt. Sie redeten nur noch das Nötigste, umarmten sich kaum noch, seit genau fünf Wochen hatten sie nicht mehr miteinander geschlafen, manchmal flehten Johannas Augen voll Inbrunst nach etwas Zärtlichkeit, die er ihr nicht gab oder geben konnte, weshalb immer häufiger Spannung zwischen ihnen herrschte und sie spöttische Bemerkungen über seine Männlichkeit fallenließ, doch sie würde nie verstehen können, daß seine »männlichen« Fähigkeiten zur Zeit auf Eis gelegt waren.
Er war unzufrieden, mürrisch, kaum ansprechbar. Was Johanna als pure schlechte Laune auslegte (wer konnte es ihr verdenken?), denn in diesen Tagen vermochte selbst sie, die sonst so Einfühlsame, sich nicht in seine Sorgen- und Alptraumwelt hineinzuversetzen, die nur noch aus Grau- und Schwarztönen bestand.
Am Samstag dann der Brief! Die Bank. Keine Kontoauszüge, diese Briefe fühlten sich immer leichter an. Er riß ihn mit fahrigen Fingern in dem stinkenden Treppenhaus auf, blieb auf den steinernen, ausgetretenen, unansehnlichen Stufen neben einer Urinlache stehen. Der Brief kam von der Zentrale. Ein kurzes, unmißverständliches Schreiben, die Bitte, mit den aktuellen Gehaltsunterlagen am Mittwoch um zehn Uhr morgens dort vorzusprechen, um zu klären, wie ihm – er nahm aber an, vor allem der Bank – geholfen werden konnte; falls er verhindert wäre, so sollte er doch bitte am Montag morgen kurz anrufen.
Er überflog die Zeilen. Sein Puls raste, er fühlte sich wie auf einem riesigen Karussell. Er lehnte sich an die schmutzige Wand mit den Schmierereien und den getrockneten Urinfäden, schloß kurz die Augen, dachte nach. Eine Strategie, er mußte eine Strategie entwickeln. Der Brief war von einer Frau unterzeichnet worden, und wenn er überhaupt einen Vorteil für sich sah, dann den, es mit einer Frau zu tun zu haben, denn in der Regel kam er mit Frauen besser zurecht als mit Männern, was immer auch der Grund dafür sein mochte, denn er war weder groß noch muskulös, noch verfügte er über jene äußeren Attribute, auf die Frauen in der Regel flogen.
Er suchte alle Unterlagen zusammen, die ihm am Mittwoch das Leben retten konnten, Gehaltsabrechnungen, Kindergeld- und Wohngeldbescheid, Mietquittungen, Versicherungen und was sonst noch an größeren und kleineren Beträgen innerhalb eines Monats anfiel. Am Mittwoch dann, nach schlaflosen, alptraumhaften Nächten, war er bereit, den Weg zum Schafott anzutreten. Schweißnasse Hände, kein Frühstück, sein Magen rebellierte seit Tagen (am Sonntag hatte er sich fünfmal übergeben müssen!), im großen und ganzen fühlte er sich tatsächlich wie kurz vor seiner Hinrichtung – Herzklopfen, Schweißausbrüche, Durchfall, Schüttelfrost.
Der strategische Stützpunkt der Bank war in zwei riesigen Türmen untergebracht, in deren gläserner Fassade sich Schönwetter-Kumuli und der blaue Himmel spiegelten, die Türme wirkten von innen noch gewaltiger als von außen. Acht Fahrstühle sausten in einem fort rauf und wieder runter, ein ständiges Kommen und Gehen, ein vielzähliges Stimmengewirr in der überdimensionalen Halle, in deren Zentrum sich ein großflächiges, quadratisches Wasserbecken mit einem polierten Marmorrand befand, das nur wenige Zentimeter tief war, mit einem Springbrunnen in der Mitte, doch kaum einer warf auch nur einen Blick auf das in sanften Fontänen aus den Düsen gestoßene Wasser.
Er meldete sich an, der Pförtner, ein älterer Mann mit ausdruckslosen Augen in einem leeren, zerknautschten Bulldoggengesicht, die fette Gestalt in eine dunkelblaue Uniform gezwängt, füllte mit ungelenken Fingern einen Zettel aus mit seinem Namen und der Uhrzeit seines Kommens, dann schickte er ihn in den dreizehnten Stock. Mit einem mulmigen Gefühl betrat er den Aufzug, eine angeborene Klaustrophobie hatte ihn stets einen großen Bogen um Aufzüge und große Menschenansammlungen machen lassen. Mit ihm in der Kabine befand sich eine junge Frau mit schulterlangem, blondem Haar; sie hatte zwar kein sonderlich hübsches Gesicht, doch ihre Kleidung und Ausstrahlung und der sie umgebende Duft verliehen ihr etwas ungemein Erotisches. Klaustrophobie hin, Klaustrophobie her – in seine Phantasie schmuggelte sich für Sekunden der frivole Gedanke – ein purer Traum –, der Aufzug könnte irgendwo zwischen den Stockwerken hängenbleiben und ihm die Gelegenheit geben, es mit diesem Wesen zu treiben. Der Lift glitt fast geräuschlos nach oben, womöglich war dieser dreizehnte Stock ein schlechtes Omen. Zweimal verlief er sich im Labyrinth der weitverzweigten Gänge, bevor er seine Richtstätte mit fünfminütiger Verspätung erreichte. Er klopfte an die Tür mit dem Namensschild Dr. N. Vabochon, ein leises »Herein«.
Er öffnete so lautlos wie möglich die Tür, steckte den Kopf durch den Spalt und blickte auf eine Frau, die allein in einem großen, hellen Zimmer saß. Eine unscheinbare Person in einem unscheinbaren Kostüm, die mit unscheinbaren Bewegungen hinter ihrem für sein Gefühl viel zu wuchtigen Schreibtisch hervorgekrochen kam. Ihre schmalen, blassen Lippen lächelten leicht verkniffen, die dunkle Hornbrille verlieh ihrem Gesicht etwas schulmeisterlich Strenges. Sie war weiß Gott nicht der Typ Frau, den er sich in einer solchen Position in einem solchen Hause vorgestellt hatte. Auch sonst hätte er kaum mehr als einen flüchtigen Blick an sie verschwendet, dieses genaue Gegenteil der duftenden Fee aus dem Aufzug. Er war in keiner Weise auf den sich ihm bietenden Anblick vorbereitet; erfolgreiche Frauen hatte er sich stets groß, attraktiv, in teures Tuch gehüllt und von einer Wolke Chanel No. 5 umgeben vorgestellt. Dazu ein liebenswürdiges, aufmunterndes Lächeln als Fassade für eiskalte Berechnung. Nichts von dem erwartete ihn hier. Es roch nach Büro und sonst nichts, ihr graues Kostüm erinnerte auf fast groteske Weise an Grenzbeamtinnen ehemals sozialistischer Länder (denen ja auch ein Hang zum Sadismus nachgesagt wurde), und großgewachsen war die Frau auch nicht. Und statt Blumen auf dem Schreibtisch verkümmerte lediglich ein traurig herabhängender Efeu mit vielen gelben Blättern auf der Fensterbank.
Er ging auf die Frau zu, sie trafen sich genau in der Mitte des Raumes, sie streckte ihre Hand aus, er nannte artig seinen Namen. Ihr Händedruck war schlaff, kaum spürbar. Für einen Sekundenbruchteil musterte sie ihn abschätzend aus kaltblauen Augen, doch sie kehrte sofort hinter ihren Schreibtisch zurück, deutete mit einer Hand auf den ihr gegenüber stehenden Stuhl.
Er setzte sich gehorsam, die Knie eng beieinander, die dünne Aktentasche auf den leicht zitternden Schenkeln. Sie hatte einen Aktenordner aufgeschlagen vor sich liegen und schrieb etwas auf ein Blatt Papier, schlug dann die Akte zu, legte sie auf die Seite. Sie sah auf, die Unterarme auf die Schreibtischplatte gestützt, die Hände gefaltet.
Sie hatte kein häßliches Gesicht, nur ihre offensichtliche Unfähigkeit, ihm Schönheit zu verleihen, ließ es matt und grau erscheinen. Das streng nach hinten gekämmte, dunkle Haar war zu einem Knoten gebunden, die Fingernägel unlackiert, kein Lippenstift, kein Rouge, kein Lidschatten, kein nichts.
»Herr …«, sie stockte einen Moment, nahm eine andere Akte und sprach weiter, »Herr von Marquardt«, in ihrer Stimme schwang Traurigkeit, als hätte man sie gezwungen, ihm mitzuteilen, daß das bereits verhängte Todesurteil leider sofort zu vollstrecken sei und der Henker ungeduldig im Zimmer nebenan warte, »es ist nett, daß Sie vorbeigekommen sind. Sie wissen ja, weshalb ich Sie sprechen möchte?«
»Ja, ja, sicher.« Er wischte den Schweiß in seinen Handflächen an der Hose ab. »Ich weiß. Es geht um dieses leidige Darlehen und …«
»Nun«, unterbrach sie ihn kopfschüttelnd, legte die Hände aneinander und führte sie an die Nase, und für Sekunden blickte sie durch ihn hindurch, »es ist nicht allein das Darlehen, Herr von Marquardt, es geht leider auch um Ihr Konto … Sie wissen, wir sind Ihnen … damals … mehr auf Drängen Ihres Bekannten, großzügigerweise entgegengekommen, indem wir Ihnen sogar einen Dispositionskredit von DM dreitausend einräumten. Aber jetzt ist Ihr Konto so weit überzogen, daß wir unmöglich weitere Abhebungen zulassen können.«
Er spürte, wie das Blut seinen Kopf verließ und sich in den Zehenspitzen sammelte. Seine Alpträume! Wie inständig hatte er gebetet, ja gefleht, sie würde nur wegen des Darlehens mit ihm sprechen wollen, nicht wegen des Kontos. Er hatte jeden Gedanken an das Konto einfach verdrängt; er wollte nichts damit zu tun haben, wollte nicht, daß davon gesprochen wurde.
»Es tut mir leid, Herr von Marquardt«, fuhr Dr. Vabochon geschäftsmäßig kühl fort, »aber Ihr Verhalten in der letzten Zeit … vor allem die nicht eingehaltenen Zusagen … läßt uns einfach keine andere Wahl. Ich bedaure …«
»Und wovon sollen wir leben?« stammelte er.
»Das, Herr von Marquardt, hätten Sie sich früher überlegen müssen.«
»Aber, ich meine, ich bin doch damals zu Ihnen gekommen und Sie haben mir …«
»Ich habe überhaupt nichts.«
»Nein, natürlich nicht Sie persönlich, aber Ihre Bank und Ihre Leute …«
»Es ist nicht meine Bank, und es sind nicht meine Leute.«
»Mein Gott, mir geht es doch nicht darum, daß ich mir irgendwelchen Firlefanz leisten will, bei uns geht es nur noch ums nackte Überleben! Sie wissen doch selber, was mit mir und meiner Firma passiert ist …« Er hatte Schweiß auf der Stirn, in den Handflächen, am Rücken.
»Was geschehen ist, ist geschehen.«
»Ich bin betrogen worden, und jetzt –«
»Inwieweit Sie Schuld trifft, kann ich nicht sagen, ich kenne weder Ihre Firma noch Ihre Geschäftsgepflogenheiten. Doch wenn die genauso waren wie … Nun, ich glaube, ich brauche nicht deutlicher zu werden.«
»Okay«, sagte er und versuchte so ruhig wie möglich zu bleiben, »dann lassen Sie mich wenigstens erklären, wie ich in das jetzige Dilemma geraten bin.«
»Herr von Marquardt«, unterbrach sie seinen Redefluß, »Erklärungen können Sie abgeben, so viele Sie wollen, nur«, sie schürzte die blutleeren Lippen, »sie werden Ihnen nichts nützen! Sie hätten sich früher überlegen müssen, welche Konsequenzen die Nichteinhaltung Ihrer Zusagen letzten Endes für Sie hat. Daß wir gerade bei Ihnen besonders vorsichtig sind und sein müssen, das liegt in der Natur der Sache. Und für Ihre Liquidität sind nicht wir zuständig.« Sie hielt kurz inne, sah ihn wieder mit undefinierbarem Blick an. »Aber lassen Sie mich doch bitte erst einmal Ihre Unterlagen sehen.«
Mit nervösen Fingern kramte er aus seiner Tasche die Klarsichthülle hervor und reichte sie über den Tisch. Dr. Vabochon nahm sie in ihre zerbrechlich wirkenden Finger und ging, ohne eine Miene zu verziehen, Blatt für Blatt durch. Nach menschlichem Ermessen hätte sie mindestens einen halben Tag brauchen müssen, um alles zu studieren und durchzurechnen, aber diese Maschine benötigte nur anderthalb oder zwei Minuten. Sie legte die Papiere beiseite und kniff die Lippen zusammen, bis sie dünner als ein Federstrich waren.
»Und wie stellen Sie sich das alles in Zukunft vor? Wie ich Ihren Unterlagen entnehme, verdienen Sie gerade dreitausendzweihundert netto …«
Er lachte kurz auf, unterbrach sie: »… vor einem Jahr war das ein Trinkgeld für mich …«
»Was vor einem Jahr war, interessiert mich nicht. Und wenn ich richtig überschlagen habe, bleiben Ihnen nach Abzug aller Ausgaben jetzt und heute gerade noch dreihundertfünfzig Mark zum Leben. Dies erscheint mir ehrlich gesagt reichlich wenig, um davon eine sechsköpfige Familie zu ernähren. Oder wie sehen Sie das?«
»Dazu kommen noch Kindergeld und Wohngeld. Es sind in Wirklichkeit tausend Mark, die wir zur Verfügung haben.«
»Hm, tausend Mark. Nicht gerade viel, vor allem in Frankfurt. Laut der letzten Statistik benötigt eine sechsköpfige Familie in dieser Stadt mindestens achtzehnhundert Mark für die täglichen Dinge, exklusive Miete und Strom. Wie schaffen Sie es, mit soviel weniger auszukommen?«
»Sie sehen doch, daß ich es nicht schaffe!« erwiderte er leise, den Blick zu Boden gerichtet. Dieses verfluchte Geld, er fühlte sich so erniedrigt, er hätte sein letztes Hemd dafür verwettet, daß die Vabochon entweder eine vertrocknete alte Jungfer oder eine verdammte Lesbe war.
»Richtig, das sehe ich.« Sie sah ihn von Mal zu Mal länger an, sie hätte schöne Augen und eigentlich auch einen schönen Mund gehabt, hätte sie versucht, beides besser zur Geltung zu bringen. Er siedelte ihr Alter irgendwo zwischen dreißig bis Mitte Vierzig an, ihr Gesicht war falten- und ihre Augen ausdruckslos, doch dadurch, daß sie sich so altmodisch und erzkonservativ gab, war es nicht leicht, ihr Alter genau zu bestimmen. Auch hatte sie keine schlechte Figur, ein klein wenig pummelig vielleicht, aber dieser Eindruck konnte auch von dem unvorteilhaft geschnittenen Kostüm herrühren, das nicht verriet, ob sie einen großen oder kleinen Busen hatte, eine schlanke oder füllige Taille, kräftige oder dünne Oberschenkel. Doch etwas vermochte sie nicht zu verbergen – ihre Hände. Selten zuvor hatte er solch formvollendete Hände gesehen, lange, schmale Finger, so gerade, als wären sie nach Lineal gearbeitet worden, sauber geschnittene, makellose Fingernägel, weder zu lang noch zu kurz, alles, was seiner Meinung nach fehlte, war ein die Makellosigkeit der Finger noch hervorhebender Nagellack. Sie trug auch weder einen Ring noch Ohrringe, keine Halskette und kein Armband, nur eine schmucklose, häßliche Digitaluhr, die dem sie umgebenden Grau den letzten »Pfiff« verlieh. Diese Frau war so ziemlich das schmuckloseste Wesen, das ihm je unter die Augen gekommen war. Und eines der kaltherzigsten. Aber natürlich, dachte er mit bitterem Groll, was für Leute sollten in einem Haifischrachen wie dieser Bank auch sonst schon arbeiten?!
»Herr von Marquardt, was machen wir mit Ihnen?«
»Ich …« Hilflosigkeit. Hoffnungslosigkeit. Angst.
»Passen Sie auf«, sagte sie, und für einen winzigen Moment, einen Wimpernschlag lang, huschte so etwas wie ein Lächeln über ihren schmalen Mund, »Sie lassen mir Ihre Unterlagen hier. Ich werde Ihre Angelegenheit noch einmal prüfen und Sie morgen anrufen. Wann kann ich Sie erreichen?«
»Morgen ist Donnerstag, da werde ich so gegen fünf, halb sechs zu Hause sein.«
»Fünf«, sagte sie, unsicher den Kopf wiegend, »das ist etwas spät … Kann ich Sie auch im Büro erreichen?«
»Sicher«, erwiderte er.
Er nannte die Telefonnummer, sie schrieb sie auf. »Ich werde um halb fünf anrufen.« Sie erhob sich, ein weiteres Mal lächelte sie, diesmal nicht wie beim ersten Mal in Lichtgeschwindigkeit. Er reichte ihr die Hand, fragte stotternd: »Was ich fragen wollte, ich bin im Augenblick etwas knapp bei Kasse und …«
»Auch darüber werden wir morgen sprechen.«
»Hundert Mark?« fragte er gequält. »Ich habe wirklich nichts mehr.«
»Meinetwegen, hundert Mark. Ich werde Ihrer Zweigstelle Bescheid geben. Und überlegen Sie bitte mit, wie wir den Wagen wieder flott kriegen.«
»Sicher, und vielen Dank für Ihre Hilfe«, murmelte er im Hinausgehen. Er spürte ihren bohrenden Blick in seinem Rücken, drehte sich aber nicht mehr um. Auf dem Weg nach Hause dachte er unentwegt an morgen und übermorgen und dieses ganze beschissene Leben.
Das Telefon läutete genau um halb fünf. Den ganzen Tag über war in seinem Kopf nichts als diese Schulden, Dr. Vabochon, der Anruf. Vor Nervosität hatte er mit dem Zeigefinger die Haut am rechten Daumen abgepult, bis es blutete, er spielte alle Möglichkeiten durch, was schlimmstenfalls passieren könnte, legte sich Worte zurecht, obgleich er nicht einmal wußte, was sie ihm sagen oder ihn fragen würde. Er hatte die Tür zur Poststelle zugemacht, zuckte zusammen, als das Telefon anschlug, nahm erst nach dem dritten Läuten ab. Sollte sie es sein, dann sollte sie nicht denken, er hätte nur auf ihren Anruf gewartet.
Dr. Vabochon. »Herr von Marquardt«, sagte sie, durch das Telefon klang ihre Stimme warm und weich, »ich habe mir fast einen ganzen Tag nur für Ihre Angelegenheit Zeit genommen, bin aber bis jetzt noch zu keinem endgültigen Resultat gekommen. Ich möchte Sie deshalb bitten, noch einmal vorbeizukommen, damit wir über die Vorschläge, die ich Ihnen zu machen habe, sprechen. Allerdings sollte das auch in Ihrem eigenen Interesse schnellstens geschehen, denn Sie wollen ja sicherlich auch endlich eine Klärung. Würde es Ihnen heute abend passen?«
»Heute abend?« fragte er überrascht. »Wie lange sind Sie denn im Büro?«
»Nun, es gibt ein kleines Problem. Ich werde morgen und am Montag geschäftlich unterwegs sein … Aber ich gehe donnerstags immer zu ENRICO essen. Kennen Sie ENRICO?«
»Nein, aber –«
»Gut«, unterbrach sie ihn und beschrieb den Weg dorthin, »ich erwarte Sie dann um halb acht bei ENRICO. Es tut mir leid, wenn ich Ihnen dadurch Umstände bereite, aber wie gesagt … Es genügt übrigens, wenn Sie allein kommen.«
»Also gut, ich werde da sein«, sagte er, legte auf, fuhr sich nachdenklich über das kratzige Kinn, schüttelte verwundert den Kopf. Er stand auf, packte seine Tasche und machte sich auf den Weg nach Hause.
»Und, haben sie angerufen?« fragte Johanna, kaum daß er die Wohnung betreten hatte.
»Ich soll heute abend noch hinkommen«, sagte er und wich ihrem Blick aus.
»Heute abend?« Ihre mattgrünen Augen konnten die Überraschung nicht verbergen, sie hatte die Stirn in Falten gezogen. »Machen die extra wegen dir Überstunden?«
Er zuckte nur mit den Schultern und sagte: »Schatz, unsere Lage ist hoffnungslos. Aber wenn es einen Weg geben sollte, der diese Hoffnungslosigkeit ein wenig erträglicher macht, dann werde ich diesen Weg gehen. Und wenn sie mich für Mitternacht nackt auf den Hauptfriedhof bestellt hätten, ich würde hingehen.«
»Es ist aber trotzdem komisch …«
»Komisch oder nicht, es ist eine Chance, zumindest hoffe ich das.« Etwas, eine innere Stimme, hinderte ihn, Johanna von dem ungewöhnlichen Treffpunkt zu berichten, sie wäre wahrscheinlich nur mißtrauisch geworden, aus welchen Gründen auch immer.
»Und wie lange, schätzt du, wird es dauern?«
»Was weiß ich, eine halbe Stunde, eine Stunde … kommt drauf an, was es alles zu besprechen gibt.«
Er ging ins Schlafzimmer, Johanna folgte ihm. Er zog die Schuhe aus, stellte sie unters Bett. »Die machen sich eine ganz schöne Mühe mit uns, nicht?« Er grinste etwas gequält und umarmte sie. Sie roch nach Küche und Schweiß, eine Haarsträhne klebte ihr an der Stirn. Sie roch, seit sie hier wohnten und keine Putzfrau und Köchin mehr hatten, viel nach Küche und Putzen und Schweiß, ihre Haare klebten oft an ihrer Stirn, es fiel ihm nicht leicht, sie in solchen Momenten zu umarmen.
»Wie du noch lachen kannst!« sagte sie leicht vorwurfsvoll und legte ihren verschwitzten Kopf an seine Brust. »Ich wünschte, es würde einen Knall geben und wir wären alle unsere Sorgen los. Aber auf Wunder zu warten lohnt sich wohl kaum. Wenn ich bedenke, wie es noch vor einem Jahr war …!«
»Ich versuche, nicht mehr daran zu denken. Und du solltest es auch sein lassen. Wir sind betrogen worden, aber wir sind weiß Gott nicht die einzigen, denen so übel mitgespielt worden ist. Und vielleicht schaffen wir es ja eines Tages wieder?!«
»Eines Tages?« sagte sie seufzend. »Wann wird dieses ›eines Tages‹ wohl sein? Es ist alles so eng geworden! Wenn ich sehe, wie andere Leute leben, und uns damit vergleiche …«
»Johanna, bitte, jetzt hör doch endlich mit dieser alten Leier auf!« Er stieß sie weg, lehnte sich wütend gegen die Wand, die Arme über der Brust verkreuzt. Ihre unverblümten Worte verletzten ihn, dabei wußte er, sie verrieten nur, daß sie den tiefen Absturz vom Luxus ins Elend bis jetzt nicht verkraftet hatte; die Frage war, ob sie es je verkraften würde, so wie er. Dennoch fuhr er sie laut und theatralisch gestikulierend an: »Ich weiß, es ist alles meine Schuld! Ich bin der Haushaltsvorstand, ich muß die Familie ernähren, ich muß mit dem Geld klarkommen, ich hätte nicht so gutgläubig sein dürfen, ich sollte endlich zusehen, daß wir so schnell wie möglich wieder aus dieser Scheißgegend rauskommen, und, und, und …!« Er schnaufte tief durch, schloß die Augen, beruhigte sich allmählich, sagte: »Meinst du etwa, für mich ist das leicht? Meinst du etwa, ich gehe gerne heute abend zur Bank, um mir von denen ihre Vorstellungen aufzwingen zu lassen? Ich hasse dieses verfluchte Leben genauso wie du, glaube mir.«
Sie sah ihn aus großen, erschrockenen Augen an, ein leichtes Beben zuckte um ihre Mundwinkel. »Ich weiß gar nicht, weshalb du auf einmal so eingeschnappt bist! Und so laut zu werden brauchst du auch nicht, oder willst du unbedingt, daß die Kinder alles mitbekommen? Ich habe dir keine Schuld gegeben, wenn, dann sind wir beide schuld!«
»Ach komm, hör doch auf damit! An was bist du denn, bitteschön, schuld?! Dummes Geschwätz!«
Sie betrachtete ihre rissigen, spröden Hände, sie spielte noch immer gern Klavier, gab Nathalie und Alexander Unterricht, aber das Spielen fiel ihr zusehends schwerer, denn trotz ihrer noch relativ jungen Jahre ließ Arthritis ihre Finger verkrüppeln, und meist bei Wetterumschwüngen litt sie arge Schmerzen; sie tat ihm unendlich leid, weil es in ihrem Leben nichts gab, sie nie etwas verbrochen hatte, das diese Schmerzen gerechtfertigt hätte, sie tat ihm leid, weil sie sich nicht mehr ansehnlich fand; all dies für ihn ein zusätzlicher Grund, diese ganze elende Lage noch mehr zu verfluchen, denn wenn jemand verdient hätte, das sorgenfreie Leben von früher zu führen, dann Johanna. Letztlich war es auch ihr Verdienst gewesen, daß sie sich einige Jahre jeden Luxus leisten konnten, sie hatte schließlich damals durch ihr Klavierspiel mitgeholfen, sein Studium zu finanzieren.
Sie hatte die Hände gefaltet, den Blick gesenkt, die Haarsträhne an ihrer Stirn löste sich, sie sagte leise: »Vielleicht sollten wir einfach nur mehr Gottvertrauen aufbringen.«
Er seufzte auf, schüttelte kaum merklich den Kopf. Gott. Wenn nichts mehr ging, kam Johanna mit Gott. Der Gott, den sie morgens, mittags und abends anbetete, von dessen Existenz sie so fest überzeugt war, selbst jetzt, in dieser trostlosen Lage. Sie hatte nie Gott die Schuld gegeben, daß er ihnen nicht beigestanden hatte, als sie von einer Sekunde zur andern alles verloren hatten. Johanna hatte einen bedingungslosen, kindlich-naiven Glauben, um den David sie bisweilen beneidete. Doch er gestand sich ein, daß ihm dieser letzte Rest an Kindlichkeit, an Naivität fehlte, vielleicht lagen die Ursprünge dafür in seiner Kindheit, als Gott für ihn ein Monster gewesen war, das nur strafte und seine Kinder nur dann liebte, wenn sie mit essigsaurer Miene durchs Leben gingen und den ganzen Tag über Rosenkränze beteten. Wie Mutter, die einen Rosenkranz nach dem anderen herunterleierte, die nie lächelte, nur Bitterkeit und Groll in sich hatte. David hatte oft gerätselt, was die Wurzeln dieser Verbitterung und dieses Zorns waren, Antworten hatte er keine gefunden. Vielleicht kam sie nicht darüber hinweg, mit einem Adeligen verheiratet zu sein, der aber, anstatt sich zu seinem Stand zu bekennen und entsprechend zu leben, einfach nur ein Landarzt für Mensch und Vieh war, der seine Arme bis zu den Schultern in die Ärsche von Rindern steckte und wenig später Menschen behandelte. Vielleicht war es das relativ bescheidene Leben, das zu führen sie verdammt war, vielleicht verwand sie nicht den Wohlstand ihrer Schwester Maria und deren Mann Gustav, die einen riesigen Gutshof mit ausgedehnten Ländereien bewirtschafteten und bei denen David sich gerne aufhielt, als er noch klein war. Tante Maria war eine herzensgute Frau, liebevoll und gütig, die für einige wenige Jahre mehr Mutter für ihn war als seine eigene Mutter, die ihn auf den Schoß nahm, ihm Geschichten erzählte oder vorlas, die mit ihm Lieder sang, mit ihm durch die Wälder oder entlang der Felder spazierenging. Damals, als er noch ein kleines Kind war, vor Ewigkeiten also, lebten sie in einem gottverlassenen Kaff in Oberfranken, nahe der tschechischen Grenze, von der bei Ostwind an manchen Tagen der Gestank von Katzendreck herübertrieb.
Aber es war nur eine kurze Zeit, in der ihm die Kindheit etwas versüßt wurde, genau gesagt bis er fünfeinhalb war und Tante Maria schwanger wurde. Und wenn er auch noch ein kleines Kind war, er spürte die Veränderung, die mit seiner Tante vor sich ging. Noch bevor die Schwangerschaft sichtbar war, verfiel sie in tiefe Depressionen, warum, vermochte keiner zu sagen, aber sie wurde immer in sich gekehrter. Sie nahm ihn kaum noch auf den Schoß, und wenn, dann nicht mehr mit der Zärtlichkeit vergangener Wochen, Monate, Jahre. Dann und wann sah er sie stumme Tränen weinen. Die ganze Atmosphäre im Haus wurde gedrückter, es war, als hinge eine unsichtbare Spannung wie ein dichtes, undurchdringliches Spinnennetz in allen Räumen, und so sehr man sich auch bemühte, es zu durchdringen, es schien unmöglich.
Sie brachte ein Mädchen zur Welt, kurz nachdem David sechs geworden war. Nur noch selten ging David zu Onkel Gustav und Tante Maria, mit seiner kindlichen Sensibilität spürte er, daß er nicht mehr so willkommen war wie früher. David war acht und das Mädchen knapp zwei Jahre alt, als das Unglück den ganzen Ort erschütterte und lähmte. Tante Maria hatte sich offensichtlich in einem Anfall tiefster Depression eine großkalibrige Pistole in den Unterleib geschoben und zweimal schnell hintereinander abgedrückt. Es hieß, der ganze Raum sei von Blut getränkt gewesen, die Decke, die Wände, der Schrank, die Stühle, das Sofa, der Fußboden und der Teppich, selbst Tante Marias liebevolle Sammlung kleiner Porzellanfiguren und -figürchen. Und niemand kannte den Grund für diese scheinbar sinnlose und wahnsinnige Tat.
Onkel Gustav, ein gebrochener Mann, verkaufte kurz darauf seinen Hof, nahm seine Tochter und verließ den Ort. Er verriet niemandem, wohin es ihn trieb, wo er ein neues Leben anfangen wollte, um zu vergessen, was er in seiner alten, vertrauten Umgebung nie würde vergessen können.
Vielleicht hatte David dies und so einiges mehr mißtrauisch gegenüber allem gemacht, was mit Gott zusammenhing, vielleicht war es auch nur ein Teil seines Wesens. Und zudem versuchte er mit dem Verstand zu erforschen, was mit dem Verstand nicht erforschbar war, glaubte er nur die Dinge, die er mit seinen fünf Sinnen wahrnehmen konnte. Dies unterschied ihn von Johanna. Und obwohl er lange Zeit Sonntag für Sonntag mit Johanna die Kirche besuchte und dort vorgab, an Gott zu glauben, an diesen von Johanna als liebevoll und gütig und vergebend gepriesenen Gott, so fehlte ihm die echte Überzeugung, ob all dies, was dort gepredigt wurde, auch der Wahrheit entsprach. Doch oft, wenn Johanna in brenzligen Situationen mit Gott kam, dann explodierte etwas in ihm. Wie jetzt.
Einen Moment herrschte Stille, er preßte die Arme noch fester an die Brust, mahlte mit den Kiefern aufeinander, schloß die Augen, hörte das dumpfe Schlagen seines Herzens, lachte zynisch auf, seine Worte mußten wie Speerspitzen in ihr Herz und ihre Seele dringen: »Gott, Gott, Gott, daß ich nicht lache! Wo war er denn, als wir ihn so dringend brauchten?! Gott ist parteiisch, diesem gibt er, den andern lacht er aus! Er macht Gewinner und er macht Verlierer. Und die Gewinner werden belohnt, die Verlierer gedemütigt. Das ist sein Spiel des Lebens! Weiß der Teufel, nach welchen Kriterien er seine Gunst verteilt, aber ich gehöre ganz sicher nicht zu denen, die seine Sympathie haben! Und seit wir hier in diesem … gottverdammten … Haus dahinvegetieren, sind wir sowieso überhaupt nichts mehr wert!« Er streckte provozierend den rechten Mittelfinger in die Höhe, machte ein verächtliches Gesicht. »Es ist einfach nur zum Kotzen!«
»Es ist nicht Gottes Schuld. Wir sind zwei erwachsene Leute, wir haben Fehler gemacht …«
»Verdammt, jetzt hör endlich auf! Ich habe Fehler gemacht und nicht du.«
»Und vielleicht leben wir einfach nicht so, wie wir sollten«, sagte sie trotzig, stand auf, stellte sich dicht vor ihn. Ihr Atem berührte sein Gesicht, er roch ihren Schweiß, sie streichelte mit ihren nach Zwiebeln riechenden Fingern über seine Stirn und sagte versöhnlich: »Komm, hören wir auf, zu streiten. Zieh dir für heute abend was Gutes an. Diese Bande soll auf gar keinen Fall denken, daß wir asozial geworden sind. Wenn wir auch so gut wie nichts haben, wir sind nicht asozial!«
Er war innerlich aufgewühlt, als er sich auf den Weg zu diesem ENRICO machte. Der Verkehr war zäh und stockend. Johannas Worte hallten in seinen Ohren wider und wider. Es waren immer nur Kleinigkeiten, mit denen sie ihn in letzter Zeit immer häufiger zur Weißglut treiben konnte, ein Wort nur, ein Satz, vielleicht auch nur eine Geste oder ein Blick. Geschickt versteckte Anspielungen, mit denen sie ihn offensichtlich aufforderte, ihre Situation zu ändern; zumindest empfand er es so. Er fühlte sich einfach nur miserabel. Immer öfter hielt sie ihm einen Spiegel vor, stellte Anforderungen, die sie früher so nie gestellt hatte, nie zu stellen brauchte. Sie erwartete, daß er den Kindern ein »Vater« war, Zeit für sie aufbrachte, mit ihnen etwas unternahm. Es war wieder einer der Momente gekommen, der ihm die Sinnlosigkeit seines jetzigen Daseins mehr als deutlich vor Augen führte.
Er parkte das Auto im Halteverbot, in der Hoffnung, jetzt am Abend nicht aufgeschrieben oder gar abgeschleppt zu werden. Er trug eine helle Sommerhose, ein weißes Hemd mit dezenter, gelb-grüner Krawatte und ein kariertes Sommersakko. Er malte sich die bevorstehenden Minuten, mehr würden es sicher nicht werden, in den düstersten Farben aus. Bedingungen, knallhart und unnachgiebig, auf die einzugehen er auf Gedeih und Verderb verdammt war. Keine Chance, den stählernen Klauen eines übermächtigen Gegners zu entkommen. Für Augenblicke zerfloß er zu einem Brei aus triefendem Selbstmitleid, während er in einem Pulk von Menschen mitgerissen die Straße überquerte.
Er fand ENRICO sofort, auch wenn der sich in einer winzigen Seitenstraße versteckte und ein noch winzigeres Schild seinen Namenszug trug. ENRICO war ein Insider-Restaurant hauptsächlich für Yuppies und Banker, qualitativ wahrscheinlich eher mittelmäßig, dafür um so teurer, wie David vermutete. Eine schmale, steile Treppe führte in den angenehm kühlen Keller, der Geruch von Zwiebeln und Knoblauch, Spaghetti und Lasagne, Essig und Öl, Wein und fremdländischen Gewürzen, das alles vermischt mit dem kalten Qualm unzähliger Zigaretten, hatte sich in jedem Quadratmillimeter des um diese Zeit nur spärlich besuchten Restaurants festgesetzt.
Sie saß in einer Nische. Er erkannte sie, obgleich sie ihr Äußeres verändert hatte. Sie trug kein graues Kostüm, sondern ein türkisfarbenes, geblümtes Kleid, und seine Vermutung vom Vortag, sie könnte pummelig sein, wurde deutlich widerlegt. Die Haare waren hinten nicht hochgesteckt, sie fielen in leichtem Schwung über ihre Schultern, die Lippen leuchteten in hellem Rot und wirkten dadurch voller, sie hatte blauen Lidschatten aufgelegt und Wangenrouge, und sie trug auch keine Brille mehr. Eine mit Abstrichen aparte, anziehende Frau – sie schön zu nennen wäre übertrieben gewesen, zumindest hatte er seit seiner frühesten Jugend ein bestimmtes Schönheitsideal, geschmückt mit langen, dunklen Haaren, feurigen, ebenso dunklen, Leidenschaft versprühenden Augen und diesem einen Mann um den Verstand bringenden sinnlichen Blick, eine perfekt modellierte Figur … Sie saß vor einem Glas Wein und verfolgte aufmerksam jeden seiner Schritte zu ihrem Tisch. Sie lächelte freundlich, wenn auch mit einer gewissen Distanz, deutete mit einer Hand auf den ihr gegenüber stehenden Stuhl.
»Guten Abend«, sagte er und versuchte, die Verblüffung über die Metamorphose dieses gestern noch so unscheinbaren Wesens, das sich von einer grauen, unattraktiven Raupe in einen bunten, glänzenden Schmetterling verwandelt hatte, zu verbergen.
»Ich bin auch eben erst gekommen«, erwiderte sie sanft, ihre Stimme hatte den sozialistischen Grenzbeamtinnentonfall mit dem grauen Kostüm abgelegt. »Möchten Sie etwas essen?«
»Nein, danke, ich habe bereits zu Hause gegessen. Ich dachte ja, daß …«
»Dann erlauben Sie mir wenigstens, Sie zu einem Glas Wein einzuladen.«
»Das brauchen Sie nicht«, wehrte er ab, »ich …«
»Tun Sie mir den Gefallen. Meine Bank ist in letzter Zeit nicht sehr freundlich mit Ihnen umgegangen. Sagen wir, ein Glas Wein zur Versöhnung? Und außerdem komme ich mir albern vor, wenn ich esse und trinke und Sie nur dasitzen und mir zusehen.«
»Nun, eigentlich trinke ich keinen Alkohol, ich bin Abstinenzler.«
»Ein Glas! Sie werden nicht daran sterben. Bei einem Italiener muß man Wein trinken.«
Um sie nicht zu enttäuschen, sagte er: »Bitte, wenn Sie darauf bestehen.«
»Sehen Sie, es kommt nicht oft vor, daß jemand mit mir an einem Tisch sitzt. Darf ich Sie nicht doch einladen, eine Kleinigkeit zu essen?«
»Ich weiß nicht, ich …«
Sie lächelte verständnisvoll. »Sie machen hier phantastischen Salat mit Frutti di Mare. Ich kann ihn nur empfehlen.«
»Ja, wenn Sie meinen …«
»Also gut, ich bestelle zweimal Salat und je eine Portion Lasagne nach Art des Hauses. Sie werden nie wieder eine andere Lasagne anrühren, nachdem Sie diese hier probiert haben.«
Er lehnte sich zurück, faltete die Hände, sah einen Moment der ihm gegenüber sitzenden Frau ins Gesicht, wandte den Blick aber gleich wieder ab, sobald ihre Augen sich trafen. Was um alles in der Welt geschah hier? Was hatte sie vor? Warum lud sie ihn zum Essen ein? Was sich hier abspielte, war absurd, ja geradezu unmöglich. Was für ein perfides Manöver der Bank steckte hinter alledem?
»Ähm«, sagte er und rieb seine juckende Nasenspitze (sie juckte immer, wenn er nervös war), »Sie sagten, Sie hätten sich Gedanken gemacht über –«
»Herr von Marquardt«, unterbrach sie ihn, »heben wir uns doch das Geschäftliche für nach dem Essen auf. Erzählen Sie mir etwas aus Ihrem Leben. Wo Sie herkommen, was genau Sie machen, wie Sie in dieses Dilemma geraten sind. Schießen Sie los!«
»Sie sind auf einmal an meinem Leben interessiert?«
»Natürlich.«
Der Ober, einer von diesen jungen, überaus gutaussehenden Papagalli, trat an den Tisch, beugte sich leicht nach unten, sie gab flüsternd die Bestellung auf. Der gelackte Schönling verschwand lautlos und kehrte nach höchstens einer Minute mit zwei Gläsern und einer Flasche Chianti zurück. Sie hob das Glas und prostete ihm zu, David nahm einen Schluck. Er war an Wein nicht gewöhnt und verzog den Mund; das einzige Mal, daß er welchen getrunken hatte, war in seiner Jugend gewesen, und die lag Ewigkeiten zurück. Er stellte das Glas auf den Tisch, fuhr mit dem Zeigefinger über den Rand, verfolgte mit seinen Augen den sich im Kreis drehenden Finger.
»Nun, ich bin zweiundvierzig Jahre alt, komme aus einer kleinen Stadt in Oberfranken, das ist in Nordbayern. Mein Vater hat die Familie verlassen, als ich vierzehn Jahre alt war, den genauen Grund kenne ich nicht, aber vermutlich hat es mit meiner Mutter zu tun, die, nun sagen wir, nicht gerade eine vor Lebensfreude sprühende Frau ist. Wissen Sie, wenn meine Frau von morgens bis abends den Rosenkranz runterleiernd durch die Wohnung ziehen würde, ich weiß nicht, wie lange ich das aushalten würde … Ich weiß nicht einmal, wohin es ihn verschlagen hat. Wir haben nie wieder etwas von ihm gehört.« Er zuckte mit den Schultern, nippte an seinem Wein, fuhr fort: »Na ja, als ich zwanzig war, bin ich nach Frankfurt gegangen. Ich habe studiert, meine Frau kennengelernt, wir haben geheiratet … Mit siebenundzwanzig habe ich mich selbständig gemacht, mit dreißig war ich Millionär …« Er seufzte auf, schüttelte mit einem bitteren Lächeln den Kopf. »… Und mit vierzig war ich urplötzlich arm wie eine Kirchenmaus. Und ob Sie’s mir glauben oder nicht, ich habe nichts, aber auch gar nichts verbrochen. Meine Angestellten haben alle ein exzellentes Gehalt bezogen, meiner Familie fehlte es an nichts, ich brauchte mir um meine Zukunft keine Sorgen zu machen … Um mehr als dreißig Millionen Mark bin ich betrogen worden, betrogen von den zwei Leuten, denen ich am meisten vertraute. Mein Prokurist, Dr. Meyer, er war, solange ich ihn kannte, oder zumindest zu kennen glaubte, die Zuverlässigkeit in Person. Er war nie krank, hat sich nie etwas zuschulden kommen lassen, hat immer alle Zahlungstermine eingehalten, wir hatten keine Probleme miteinander …«
»Und Sie hatten nie einen Verdacht, daß er eines Tages zu einem solchen … Verbrechen … fähig sein würde?«
»Er war zwar ein etwas eigenbrötlerischer Mensch, war geschieden, hatte hier und da eine Beziehung, aber wir kannten uns einfach zu lange, als daß ich ihm nicht vertraut hätte. Glauben Sie, ich hätte ihn zum Prokuristen ernannt, hätte ich auch nur den geringsten Zweifel an seiner Integrität gehabt? Unbescholtener als Dr. Meyer kann ein Mensch überhaupt nicht sein.« Er lachte bitter auf. »Und deswegen war ich um so mehr vor den Kopf gestoßen, daß ausgerechnet er mir das angetan hat. Aber nicht nur mir, auch meiner Familie und meinen Angestellten. Er und mein Steuerberater, dieser Neubert, müssen das Ganze über einen recht langen Zeitraum hinweg geplant haben. Wenn ich so überlege, dann muß die Planung mindestens ein Jahr vor Ausführung begonnen haben.« Er machte eine erneute Pause, sie schwieg ebenfalls, er sagte: »Das war’s, mehr gibt’s nicht zu berichten.«
»Und jetzt, was machen Sie jetzt?«
»Ich bin bei einem ehemaligen Kollegen und späteren Konkurrenten untergekommen. Er hat mich eingestellt, obwohl wir im Streit auseinandergegangen sind. Er sagte, er glaube an meine Unschuld und … na ja, wenigstens habe ich einen Job. Aber Sie kennen ihn ja, er hat sich für mich bei Ihrer Bank eingesetzt.«
»Und was machen Sie?«
»In der Poststelle, woanders hat er mich nicht unterbringen können. Ist ja auch egal, Hauptsache ich kann arbeiten. Trotzdem, ich hätte nie gedacht, eines Tages so zu enden. Und jetzt wohnen wir in einer viel zu kleinen Wohnung in einem absolut heruntergekommenen Stadtteil! Wir werden bedroht, belästigt, ich warte nur auf den Tag, an dem einem von uns wirklich etwas passiert. Die Polizei meint, sie könne uns nicht schützen, solange …«
»Solange nicht wirklich etwas passiert«, führte sie den Satz zu Ende.
Dann fuhr er leiser werdend fort, wobei er sich am Weinglas festhielt: »Und Sie können es ruhig glauben, mein sehnlichster Wunsch ist, endlich schuldenfrei zu sein. Nicht jeden Pfennig zigmal umdrehen zu müssen und alles, was ich kaufe, wieder bar bezahlen zu können.« Er nahm einen kleinen Schluck von dem zu trockenen Wein und sah Dr. Vabochon an, eine bis jetzt aufmerksame Zuhörerin, auf deren Gesicht sich keiner ihrer Gedanken widerspiegelte.
»Sie sind also unglücklich«, stellte sie trocken fest.
»Ja, das gebe ich ganz offen zu. Das wäre wohl so ziemlich jeder an meiner Stelle. Ich glaube, meine Kinder verstehen am wenigsten, was geschehen ist. Ich mußte meinen Ältesten von Harvard nehmen, meine beiden anderen Kinder von der Privatschule, und mein Jüngster ist schwer herzkrank.«
»Was halten Sie davon, wenn ich Ihnen helfe?«
»Sie mir helfen? Wie soll das funktionieren?«
»Später«, sagte sie, drehte das Glas zwischen den Fingern und setzte es an die Lippen. Sie lehnte sich zurück, nahm ihre Handtasche von der Lehne, holte eine Schachtel mit filterlosen, schwarzen Gauloises heraus, hielt ihm die Schachtel hin, er lehnte dankend, doch entschieden ab. Sie zündete die Zigarette an und inhalierte tief. Durch den ausgeblasenen Rauch sah sie ihn aus zu Schlitzen verengten Augen an.
»Schauen Sie mich an … was glauben Sie … bin ich glücklich?«
Er hob nur die Schultern.
»Sicher, wenn man Glück allein am Geld messen würde, müßte ich es eigentlich sein. Aber mein Leben ist eintönig, in etwa so aufregend wie das einer hundertjährigen Schildkröte. Ich lebe allein, ich arbeite allein, ich esse allein. Abends läuft meist der Fernsehapparat, und oft schlafe ich dabei ein. Ich habe weiter keine Hobbys, ich glaube, ich bin so ziemlich die untalentierteste und langweiligste Person in ganz Frankfurt. Also, glauben Sie immer noch, ich sei glücklich?«
»Tut mir leid …«
»Es braucht Ihnen nicht leid zu tun. Ich möchte nur manchmal meine Sachen packen und alles hinschmeißen und abhauen. Weit, weit weg, aber ich weiß, daß ich damit nichts, aber auch gar nichts ändern würde. Sie sehen, jedes Ding hat zwei Seiten. Sie haben kein Geld, aber eine große und wie ich hoffe glückliche Familie. Bei mir ist es genau umgekehrt. C’est la vie, c’est le péché, c’est la guerre!«