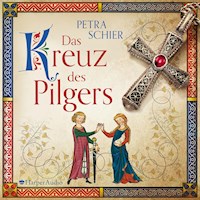7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Kreuz-Trilogie
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Koblenz, 1362. Die schöne Enneleyn lebt mit einem Makel: Sie ist unehelich geboren. Zwar hat Graf von Manten sie als Tochter anerkannt, die gesellschaftliche Akzeptanz jedoch bleibt ihr verwehrt. Als Ritter Guntram von Eggern um ihre Hand anhält, zögert sie deshalb nicht lange. Schon bald stellt sich heraus: Sie hat einen Pakt mit dem Teufel geschlossen. Nach außen ganz liebevoller Gatte, verbirgt Guntram geschickt seine dunklen Seiten. Nur Enneleyn weiß um seine Brutalität und Machtgier. Und um seinen großen Plan, der sie alle ins Unglück stürzen kann ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 721
Ähnliche
Petra Schier
Die Bastardtochter
Historischer Roman
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Koblenz, 1362. Die schöne Enneleyn lebt mit einem Makel: Sie ist unehelich geboren. Zwar hat Graf von Manten sie als Tochter anerkannt, die gesellschaftliche Akzeptanz jedoch bleibt ihr verwehrt. Als Ritter Guntram von Eggern um ihre Hand anhält, zögert sie deshalb nicht lange.
Schon bald stellt sich heraus: Sie hat einen Pakt mit dem Teufel geschlossen. Nach außen ganz liebevoller Gatte, verbirgt Guntram geschickt seine dunklen Seiten. Nur Enneleyn weiß um seine Brutalität und Machtgier. Und um seinen großen Plan, der sie alle ins Unglück stürzen kann ...
Über Petra Schier
Petra Schier, Jahrgang 1978, lebt mit ihrem Mann und einem Schäferhund in einer kleinen Gemeinde in der Eifel. Sie studierte Geschichte und Literatur und arbeitet seit 2003 als freie Autorin.
Die Veröffentlichungen
Adelina-Serie
Tod im Beginenhaus
Mord im Dirnenhaus
Verrat im Zunfthaus
Frevel im Beinhaus
Verschwörung im Zeughaus
Aachen-Trilogie
Die Stadt der Heiligen
Der gläserne Schrein
Das silberne Zeichen
Kreuz-Trilogie
Die Eifelgräfin
Die Gewürzhändlerin
Die Bastardtochter
Andere Romane
Das Haus in der Löwengasse
Der Hexenschöffe
Inhaltsübersicht
Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde: geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit; pflanzen hat seine Zeit, ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit; töten hat seine Zeit, heilen hat seine Zeit; abbrechen hat seine Zeit, bauen hat seine Zeit; weinen hat seine Zeit, lachen hat seine Zeit; klagen hat seine Zeit, tanzen hat seine Zeit; Steine wegwerfen hat seine Zeit, Steine sammeln hat seine Zeit; herzen hat seine Zeit, aufhören zu herzen hat seine Zeit; suchen hat seine Zeit, verlieren hat seine Zeit; behalten hat seine Zeit, wegwerfen hat seine Zeit; zerreißen hat seine Zeit, zunähen hat seine Zeit; schweigen hat seine Zeit, reden hat seine Zeit; lieben hat seine Zeit, hassen hat seine Zeit; Streit hat seine Zeit, Friede hat seine Zeit.
(Prediger, Kapitel 3)
Stört die Liebe nicht auf,
weckt sie nicht,
bis es ihr selbst gefällt.
(aus: Salomos Hohelied)
Prolog
«Es ist fort.» Robert de Berge, seines Zeichens Ritter König Ludwigs VII. und Angehöriger des Ordens der Tempelritter, übergab einem der Mönche in der Komturei der Heiligen Stadt die Zügel seines Reittieres, während er dem Großkomtur Bericht erstattete.
«Was ist fort?» Der Großkomtur blickte ihn verwundert an.
Robert klopfte sich den Staub von der Kutte. «Unsere Söldner haben die Sarazenen, die in die Schatzkammer eingedrungen sind, tapfer bekämpft und niedergeschlagen. Einer der heidnischen Kämpfer aber ist mit dem Kreuz des Zachäus entkommen. Wir haben ihn verfolgt, konnten ihn jedoch nicht gefangen nehmen. Später, auf dem Weg von Damaskus hierher, sind wir Zeugen mehrerer kleiner Scharmützel geworden. Wir waren nicht genug Männer, um eingreifen zu können, aber ich habe gesehen, dass ein deutscher Ritter jenen Sarazenen tötete und das Kreuz an sich nahm.»
«Warum habt Ihr es ihm nicht abgenommen?»
Robert seufzte. «Wir haben ihn im Gewühl aus den Augen verloren. Es hat Tage gedauert, bis ich ihm wieder begegnet bin. Ich konnte noch mitansehen, wie der Mann Kreuz, Rahmen und Kette mit zwei anderen Soldaten geteilt hat, dann verschwanden sie.»
«Er hat die drei Teile voneinander getrennt?» Der Großkomtur starrte Robert entsetzt an.
«Bevor ich etwas tun konnte, kam von König Konrad der Befehl zum Aufbruch.»
«Wissen diese Männer, welch mächtige Reliquie sie gestohlen haben?»
Robert schüttelte den Kopf. «Das glaube ich kaum. Nur sehr wenige kennen die Geschichte des Zachäus.»
«Die Reliquie ist also verloren.»
«Vielleicht auch nicht.» Robert folgte dem Großkomtur in dessen Wohnräume und nahm dankend den Becher mit Wein entgegen, den er ihm anbot. «Wir wissen immerhin, dass das Kreuz, der Rahmen und die Kette kaum Kraft haben, solange sie getrennt sind. Das wird verhindern, dass jemand darauf aufmerksam wird.»
«Die drei Teile werden dafür sorgen, dass diejenigen, die sie besitzen, sie wieder zusammenfügen», gab der Großkomtur mit Besorgnis in der Stimme zu bedenken. «Dies geschieht vielleicht nicht heute oder morgen, vielleicht nicht einmal zu unseren Lebzeiten. Nur der Allmächtige weiß, was diese Männer mit ihrer Beute anstellen werden und wohin es die drei Teile verschlagen wird. Wenn sie eines Tages wieder zusammengefügt werden, wird ihre Kraft den Besitzer vernichten.»
«Nur, wenn er nicht im Herrn wandelt», widersprach Robert. «Der Zöllner Zachäus hat das Kreuz anfertigen lassen als Zeichen der christlichen Nächstenliebe und als Sinnbild des Unrechts, das unserem Heiland durch den Tod am Kreuz widerfahren ist. Er selbst ist durch Jesu Liebe zu einem Erleuchteten geworden. Das Kreuz wird das Gute in der Welt stets schützen.»
«Mir wäre es lieber, wir würden Gesandte ausschicken, die versuchen, die Reliquie zurückzuholen.»
«Mit Verlaub, Großkomtur, das würde einer Suche nach der Nadel im Heuhaufen ähneln. Wir haben viel zu wenig Männer im Heiligen Land, die Kämpfe gegen die Sarazenen reiben uns auf. Der Großmeister Everard wird in Kürze mit König Ludwig nach Frankreich zurückkehren. Auch wenn er seine Männer hierlässt, reicht unsere Streitmacht doch gerade aus, um unsere Position zu halten und den Gralsschatz zu verteidigen.»
«Ich weiß, Robert, ich weiß. Aber wie sollen die Menschen jemals erfahren, was es mit dem Kreuz des Zachäus auf sich hat?»
Robert rieb sich nachdenklich das Kinn. «Vielleicht, indem wir seine Geschichte niederschreiben.»
«Niederschreiben? Die meisten Christen können nicht einmal ihren eigenen Namen lesen!»
«Großkomtur, du darfst den Glauben an die Menschen nicht verlieren. Das Kreuz des Zachäus ist ein mächtiges Zeichen der Liebe. In ihm lebt die Erkenntnis von Recht und Unrecht, von Gut und Böse. Meinst du nicht, es wird auf seine ganz eigene Weise dafür sorgen, dass seine drei Bestandteile wieder vereint und von den rechten Menschen mit Ehrfurcht behandelt werden?»
Der Großkomtur dachte lange über Roberts Worte nach, schließlich nickte er zustimmend. «Also gut, lass die Geschichte des Kreuzes niederschreiben und sorge dafür, dass sie verbreitet wird. Aber achte darauf, dass man den Weg zum Gralsschatz nicht bis hierher zurückverfolgen kann.»
«Natürlich, Großkomtur.» Robert war schon im Begriff, den Auftrag in die Tat umzusetzen. «Es wird sich alles zum Guten wenden, wenn wir nur daran glauben. Und wer weiß, vielleicht wird eines Tages das Kreuz des Zachäus seinen Weg wieder zum Gralsschatz zurückfinden.»
1. Kapitel
Nervös zupfte Enneleyn an ihrem neuen rostroten Brokatkleid herum, dessen Ärmel, Saum und Ausschnitt sie eigenhändig mit zartgelben Blütenranken bestickt hatte. Wieder und wieder hatte sie ihr Aussehen in dem ovalen Spiegel mit dem langen Silbergriff begutachtet. Nicht, weil sie sich der Eitelkeit hingab, das stand ihr nicht zu und dazu war sie auch viel zu bescheiden. Aber sie wollte unbedingt, dass alles perfekt war: ihr Kleid, ihr honigblondes, kunstvoll hochgestecktes Haar, ihre Haltung, ihr Benehmen. Sie fand sich selbst nicht übermäßig hübsch, wenngleich alle Welt beteuerte, sie habe sich seit jenem Tag vor gut zehn Jahren, als Graf Johann von Manten sie bei sich aufgenommen und als seine leibliche Tochter offiziell anerkannt hatte, sehr zu ihrem Vorteil entwickelt.
Sie gab sich alle Mühe, hatte sich geschworen, die beste, gehorsamste Tochter zu sein, die sich ein Graf und Ritter nur wünschen konnte. Zum Vorbild nahm sie sich stets ihre Stiefmutter, Frau Elisabeth, die an Vornehmheit, Wohlerzogenheit und Herzensgüte nicht zu übertreffen war. Nur in einem scheiterte Enneleyn beständig – sie brachte es nicht fertig, dieselbe stolze, energische und entschlossene Unerschrockenheit gegenüber fremden Menschen oder Vertretern des männlichen Geschlechts aufzubringen, wie es ihre Stiefmutter zu tun pflegte. Möglicherweise stand ihr so etwas auch gar nicht zu. Immerhin war sie nur eine Bastardin, das uneheliche Kind einer Schankwirtstochter, die Graf Johanns verstorbene erste Gattin für eine Weile ersetzt hatte. Zumindest in fleischlicher Hinsicht. Geliebt hatte er Aleidis nie; seiner Tochter hingegen gehörte sein Herz, jedenfalls der Teil, den nicht Elisabeth einnahm oder die vier Kinder, die sie ihm in den vergangenen zehn Jahren geboren hatte.
Eines dieser Kinder, der Stimme nach die Jüngste, Mariana, heulte gerade herzerweichend im Untergeschoss. Elisabeths beruhigende Stimme war zu vernehmen und dann die der Kinderfrau Christine, woraufhin sich das Geplärr in einen protestierenden Schluckauf verwandelte. Enneleyn schmunzelte. Mariana war eine zauberhafte und engelsgleiche Dreijährige, die ihrer Mutter geradezu aus dem Gesicht geschnitten zu sein schien. Doch sie hatte auch einen eisernen Willen, der nicht selten an Sturheit grenzte. Vermutlich hatte sie sich wieder einmal etwas in den Kopf gesetzt, mit dem entweder ihre um zwei Jahre ältere Schwester Reinhild nicht einverstanden war oder einer der Erwachsenen. Letzteres vermutlich zu ihrem Schutz, denn die Kleine war nicht nur ein Dickkopf, sondern darüber hinaus auch ausgesprochen abenteuerlustig.
Ein letztes Mal zupfte Enneleyn an ihrem Kleid herum, dann straffte sie die Schultern, atmete tief ein und begab sich hinunter ins Erdgeschoss des großen Stadthauses, in dem sie nun schon ihr halbes Leben verbracht hatte. Aus der Küche vernahm sie das Gezeter der Magd Hilla und die scharfe Zurechtweisung der Köchin Josefa. Herrliche Düfte stiegen ihr in die Nase; sie freute sich bereits auf das gute Mahl, das sie am Abend erwartete. Ihr Vater hatte Gäste zum Essen geladen – die Ratsherren Werner Sack sowie Walter und Christian Hole. Leider brachten die Herren heute nicht ihre Gemahlinnen mit, was auch Elisabeth sehr bedauert hatte. Doch zumindest ihre enge Freundin Luzia Wied, eine reiche Gewürzhändlerin, und deren Gemahl Martin, ein angesehener Weinhändler und ebenfalls Ratsmitglied, würden dafür sorgen, dass die Runde fröhlich und lebhaft werden würde. Sie unterhielten Abendgesellschaften immer gerne mit ihren Erzählungen von den Reisen, die sie hin und wieder unternahmen und die sie zumeist weit hinunter in den Süden führten. Zweimal hatten sie die Alpen überquert und Martins ältesten Bruder Bertholff besucht, der in Mailand ein großes Fernhandelskontor besaß und sie regelmäßig mit italienischen Weinen, kostbaren Gewürzen, Duftölen und Buchfarben belieferte.
Enneleyn liebte es, den Geschichten der beiden zu lauschen, denn sie war selbst noch nie weiter als bis Trier gereist oder zur Stammburg der Familie von Manten an der Mosel. Auch Münstermaifeld besuchte sie zwei- bis dreimal im Jahr, denn dort lebten ihre Mutter und ihre fünf jüngeren Halbgeschwister. Aleidis war mit dem Schankwirt Bert Mundschenk verheiratet, der schon aus erster Ehe drei Kinder hatte. Enneleyn mochte ihn, denn er war ein gutmütiger Mann, der seiner großen Familie mit viel Humor vorstand. Ihre Mutter konnte sich an seiner Seite sehr glücklich schätzen, und Enneleyn gönnte ihr das Glück von Herzen. Dennoch – oder gerade deswegen – waren ihre Gefühle, was ihre familiäre Situation anging, äußerst zwiespältig. Sie liebte ihre Mutter und deren Familie, doch ebenso liebte sie Graf Johann und Elisabeth, die ihr durch die offizielle Anerkennung als Tochter die Gelegenheit gaben, in einen Stand aufzusteigen, der dem von Aleidis und Bert so weit überlegen war, wie man es sich nur vorstellen konnte. Enneleyn war ihrem leiblichen Vater zutiefst dankbar, gleichzeitig lebte sie in der ständigen Angst, ihn zu enttäuschen. Die ersten neun Jahre ihres Lebens hatte sie in der Obhut ihrer Mutter verbracht, die meiste Zeit davon mit dem Makel der Unehelichkeit behaftet. Selbst als Aleidis dann aufgrund eines Handels zwischen Johanns inzwischen verstorbenem Vater und dem Grafen Simon von Kempenich mit Bert Mundschenk verheiratet worden war, haftete Enneleyn weiterhin der Ruf an, außerhalb der Ehe empfangen worden zu sein. Sie war nie ein anerkanntes Mitglied der Dorfgemeinschaft gewesen, selbst die Kinder der leibeigenen Bauern hatten auf sie herabgesehen und sie oft gehänselt. Schlagartig hatte sich das geändert, als bekannt geworden war, dass Johann von Manten und seine Gemahlin die kleine Bastardtochter legitimieren und bei sich aufnehmen wollten. Seither wurde sie bei ihren Besuchen in Münstermaifeld mit ausgesuchter Höflichkeit behandelt, ein Sonderling blieb sie aber nach wie vor.
In Koblenz verhielt es sich ähnlich, denn hier hatte das Gerücht über ihre niedere Herkunft bereits die Runde gemacht, noch bevor sie überhaupt im Hause ihres Vaters eingetroffen war. Zwar waren Bastarde in den Adelsfamilien nichts Seltenes, auch anerkannte nicht, dennoch hatte Enneleyn vom ersten Tag an das Gefühl, unter einem Vergrößerungsglas zu leben.
Die Koblenzer Bürger hatten sich inzwischen zwar längst an sie gewöhnt, und niemand wäre auf den Gedanken gekommen, sich ihr gegenüber despektierlich zu verhalten. Dazu waren Graf Johanns Ansehen und Einfluss in der Stadt, insbesondere im Rat, viel zu groß. Dennoch schwebte ihre uneheliche Geburt immer wie ein Schatten über ihr, der sie daran gemahnte, nichts im Leben als selbstverständlich anzusehen. Sie gab sich alle Mühe, eine mustergültige Tochter zu sein und niemandem Anlass zur Klage zu geben. An Tagen wie heute verdoppelte sie ihre Anstrengungen noch einmal, denn vor kaum etwas fürchtete sie sich mehr als davor, ihren Vater und dessen Gemahlin womöglich in Verlegenheit zu bringen.
«Da bist du ja.» Gerade als sie die unterste Treppenstufe erreicht hatte, kam Elisabeth durch die Haustür herein. «Ich habe mich schon gefragt, wo du so lange steckst. Hast du Mariana gehört? Ich sage dir, wenn das Kind weiter so laut brüllt, wird man sie eines Tages noch als Marktschreierin wiederfinden oder als Ausruferin für den Stadtrat.» Sie lachte. «Christine ist jetzt mit ihr und Reinhild nach draußen gegangen. Nicht lange natürlich, denn für die Kinder wird es bald Zeit zum Essen und danach fürs Bett. Aber möglicherweise werden sie ja müde, wenn sie im Hof herumtollen.»
«Ich kann mich auch um die beiden kümmern, Frau Elisabeth», bot Enneleyn sich sogleich an. «Ihnen vielleicht etwas vorlesen, bis sie einschlafen oder …»
«O nein, heute nicht.» Streng, jedoch mit einem schalkhaften Funkeln in ihren dunkelbraunen Augen, schüttelte die Gräfin den Kopf. Sie war eine wunderschöne Frau mit Haaren so dunkelbraun, dass sie beinahe schwarz wirkten. Heute hatte sie sie zu Schnecken geflochten und in silberdurchwirkten Haarnetzen gefangen. Ungewöhnlich war ihr hoher Wuchs, denn sie war größer als viele Männer und nur eine Handbreit kleiner als ihr Gemahl. Dies, zusammen mit ihrem ebenmäßigen Antlitz, dem glatten, dunklen Teint und ihrer würdevollen Ausstrahlung machte aus ihr eine beeindruckende Erscheinung, vor der Enneleyn sich als Kind sogar hin und wieder ein wenig gefürchtet hatte. Diese Zeiten waren inzwischen vorbei – meistens zumindest. «Du wirst dich nicht vor dem gemeinsamen Essen mit den Ratsherren drücken, meine Liebe.» Elisabeth legte ihr eine Hand auf den Arm. «Das wäre nicht nur unhöflich, sondern außerdem ausgesprochen schade. Du siehst nämlich in dem neuen Kleid sehr hübsch aus. Die Männer werden Stielaugen machen, wenn sie dich sehen, und ganz vergessen, dass sie sich mit deinem Vater wegen der Brückenzölle und den Stadtsoldaten beraten wollten.»
Enneleyns Wangen erwärmten sich leicht. «Danke, Frau Elisabeth.»
«Dafür, dass ich nur das Offensichtliche ausgesprochen habe?» Wieder lachte die Gräfin. «Komm, Kind, mach nicht so ein skeptisches Gesicht. Lächle und freue dich auf den Abend. Es wird ganz sicher sehr nett, denn Luzia wird uns erzählen, welche wunderbaren neuen Duftöle dieser Apotheker in Worms diesmal für sie hergestellt hat. Johann hat mir erzählt, dass die Ludwinagestern im Rheinhafen angelegt hat. Das bedeutet, die Familie Wied hat einen Berg neuer Waren erhalten. Bist du nicht auch neugierig darauf?»
«Natürlich bin ich das.» Unwillkürlich lächelte Enneleyn, denn sosehr sie sich auch um Bescheidenheit bemühte, den Duftölen und -essenzen, mit denen Frau Luzia handelte, konnte sie nur schwer widerstehen.
«Siehst du. Außerdem kann es sein, dass Luzia Nachrichten von ihrem Bruder Anton mitbringt. Sie erwartet nämlich einen Brief von ihm und hofft, dass er irgendwann dieses Jahr nach Koblenz kommt. Er ist nun schon so lange in der Fremde, und sie vermisst ihn sehr.»
«Das kann ich verstehen.» Enneleyn folgte ihrer Stiefmutter in die Stube und setzte sich neben sie an den großen rechteckigen Eichentisch, an dem bis zu sechzehn Personen Platz fanden. Beide Frauen griffen automatisch nach ihren jeweiligen Handarbeitskörben. Enneleyn zog eine angefangene Stickarbeit hervor, Elisabeth das Oberteil eines Kleides für Reinhild, an dem sie derzeit nähte. «Er ist ja inzwischen ein erfolgreicher Kaufmann, nicht wahr?»
«O ja, das Talent liegt wohl in der Familie.» Elisabeth stichelte an einer Naht, ohne hinzusehen. «Dabei haben wir uns lange Zeit Sorgen gemacht, was wohl einmal aus ihm werden wird. Er war ja ein so stiller, zurückhaltender Junge. Na ja, kein Wunder nach allem, was er während der großen Pest durchmachen musste.» Sie schauderte sichtlich.
Enneleyn wusste, dass auch Elisabeth während der Zeit der großen Pestilenz viel Schlimmes erlebt hatte. Sie selbst erinnerte sich nur noch bruchstückhaft an jene düsteren Tage. Sie war damals einfach noch zu klein gewesen.
«Es war ein großes Glück», fuhr Elisabeth fort, «dass Martin den Jungen in die Lehre nahm. Und als Bertholff Wied ihn dann zu sich nach Italien geholt hat … Liebe Zeit, wie lange ist das jetzt her? Acht Jahre? Nein, fast neun. Und nur zweimal hat Luzia ihn seitdem gesehen, als sie Martin auf seinen Reisen begleitet hat. Das letzte Mal vor über fünf Jahren.»
«Das ist wirklich eine lange Zeit. Und nun will er sie also hier besuchen?» Enneleyn versuchte, sich Antons Gesicht vorzustellen, doch es gelang ihr nicht ganz. Sie erinnerte sich noch daran, dass er rotblonde, kurze Locken gehabt hatte und blaue Augen. Hochgewachsen und schlaksig war er gewesen, für einen Jungen von sechzehn oder siebzehn Jahren nichts Ungewöhnliches. Er hatte als Knecht in Graf Johanns Haus gearbeitet, bevor er zu Martin Wied in die Lehre gekommen war. Lange Zeit hatte sie jedoch nicht mit ihm im selben Haushalt verbracht, und übermäßig viel miteinander gesprochen hatten sie erst recht nicht. Ein fast erwachsener junger Mann und die kleine Bastardtochter des Grafen hatten schließlich nicht das Geringste miteinander gemein.
Nein, so ganz stimmte das nicht. Enneleyn kannte die Geschichte von Luzia und Anton Bongert, dem Geschwisterpaar, das während der großen Pest die gesamte Familie verloren hatte. Luzia war damals bereits Leibmagd bei Elisabeth gewesen. Was sie – Enneleyn – mit dem Geschwisterpaar teilte, war die niedere Herkunft. Luzia und Anton waren die Kinder eines frei geborenen Bauern aus dem Eifeldorf Blasweiler. Kaum jemand außerhalb der Familien Wied und Manten wusste davon, und Enneleyn würde sich eher die Zunge abbeißen, als dieses Geheimnis zu verraten. Die beiden hatten mit der Hilfe ihrer hochgeborenen Freunde ihren Weg gemacht und sich über den niederen Stand ihrer Geburt erhoben. So etwas kam selten vor und Enneleyn bewunderte gerade Frau Luzia dafür, dass sie es geschafft hatte, eine weithin bekannte und geachtete Gewürzhändlerin zu werden. Ganz zu schweigen davon, dass ihre Ehe mit Martin Wied wie die von Johann und Elisabeth unter einem ausgesprochenen Glücksstern zu stehen schien. Beide Paare waren einander nicht nur in Pflicht, sondern in Liebe verbunden. Ein Glück, das bei weitem nicht allen Ehen beschieden war.
Vielleicht, so hoffte Enneleyn insgeheim, würde auch sie einmal einen Mann finden, der sie trotz ihrer unehelichen Geburt lieben und heiraten würde. Die nächsten Worte ihrer Stiefmutter rissen sie aus ihren Überlegungen.
«So, wie ich es verstanden habe, denkt Anton darüber nach, seine Geschäfte ganz nach Koblenz zu verlegen.» Elisabeth legte die Nadel beiseite und hob das Kleidchen ein wenig hoch, um die fertiggestellte Naht zu überprüfen. Mit einem zufriedenen Nicken legte sie es zurück in ihren Schoß und fädelte einen neuen Faden auf. «Ich könnte mir vorstellen, dass er nach der langen Zeit allmählich ein wenig Heimweh bekommen hat.»
«Bringt er seine Frau dann mit? Ich meine mich zu erinnern, dass Frau Luzia erwähnte, ihr Bruder wolle heiraten.»
«Das weiß ich nicht genau. Aber du hast recht, in einem seiner letzten Briefe hat wohl so etwas in der Art gestanden. Na, wir werden es heute Abend ganz sicher erfahren.» Als es leise klopfte, hob Elisabeth den Kopf. «Ja, Hilla, was gibt es?»
Die kleine knochige und grauhaarige Küchenmagd war im Türrahmen erschienen. «Herrin, ich soll euch von Josefa ausrichten, dass die Pasteten jetzt fertig sind. Ihr wolltet sie doch kosten, bevor wir sie heute Abend auf den Tisch bringen. Und der Godewin ist mit den Mehlsäcken und der Hirse zurückgekommen.»
«Oh, gut, ich kümmere mich um die Pasteten.» Elisabeth erhob sich und legte ihre Handarbeit zur Seite. «Enneleyn, sieh du nach dem Mehl und der Hirse. Achte genau darauf, wie fein der Müller diesmal gemahlen hat. Wenn das Mehl zu grob sein sollte, muss Godewin die Säcke zurückbringen. Und danach muss die Tafel für das Abendessen gerichtet werden. Hältst du bitte ein Auge darauf? Und schick Christine mit den Mädchen herein. Ich denke, es ist nun genug gespielt worden. Die Kinder müssen wirklich allmählich essen und dann zu Bett gebracht werden. Unsere Gäste werden bestimmt in Kürze eintreffen.»
«Sofort, Frau Elisabeth.» Rasch legte auch Enneleyn ihre Stickerei beiseite und eilte hinaus in den Hof. Auf dem Weg dorthin holte sie sich jedoch rasch noch einen grauen Arbeitskittel aus der Küche, den sie über ihr Kleid zog, damit es nicht schmutzig wurde. Sie wollte auf keinen Fall Mehlflecke auf dem teuren Brokat.
Godewin, ein kräftiger braunhaariger Knecht mit dichtem Bart, hatte den großen Schubkarren mit den Mehl- und Hirsesäcken neben der Hintertür abgestellt, die zur Küche und zur Vorratskammer hineinführte. Als Enneleyn auf ihn zuging, wischte sich der Knecht gerade mit dem Ärmel über die Stirn. Die Maisonne hatte bereits ordentlich Kraft, und obwohl es früher Abend war, fühlte sich die Frühlingsluft noch angenehm warm an.
«Jungfer Enneleyn.» Godewin nickte ihr freundlich zu. «Soll ich die Hirse schon mal reintragen? Sie ist in Ordnung, hab mich auf dem Markt davon überzeugt. Wegen dem Mehl müsst Ihr selbst schauen, aber diesmal ist es besser als die letzte Fuhre, die wir bekommen haben.»
«Lass mich trotzdem noch einen Blick auf die Hirse werfen.» So hatte es ihr Elisabeth ja schließlich aufgetragen. Enneleyn wollte sich auf keinen Fall Schlampigkeit nachsagen lassen. «Das dauert ja nicht lange.»
«Wie Ihr meint.» Der Knecht hob die Säckchen mit der Hirse vom Karren und öffnete sie nacheinander, um ihr die Gelegenheit zu geben, den Inhalt zu prüfen. Enneleyn ließ die winzigen Körnchen durch ihre Finger rieseln und nickte zufrieden. «Sehr gut. Bring die Hirse in die Vorratskammer. Ich sehe mir derweil das Mehl an.» Schon griff sie nach einem der schweren Säcke.
«So wartet doch, die kann ich Euch herunterheben.» Godewin half ihr, die Säcke neben dem Karren in einer Reihe aufzustellen.
Enneleyn öffnete den ersten Sack und ging in die Hocke, um das Mehl genau in Augenschein zu nehmen. Es schien in Ordnung zu sein, denn es fanden sich kaum Reste von Spelzen darin. Beim zweiten Sack runzelte sie die Stirn. Der ging gerade noch. Der dritte hingegen schien wieder einwandfrei zu sein.
«Welch lieblicher Anblick. Dafür hat es sich ja gelohnt, ein wenig zu früh hergekommen zu sein.»
Die Männerstimme, die so unvermittelt hinter Enneleyn erklang, ließ sie erschrocken hochfahren. Die Handvoll Mehl, die sie dem letzten Sack entnommen hatte, landete staubend auf ihrem Kittel. Einen undamenhaften Fluch unterdrückend, schüttelte und klopfte sie an dem Kleidungsstück herum und drehte sich gleichzeitig zu dem Unbekannten, der vom offenen Hoftor aus langsam auf sie zukam. Er war mittelgroß und schlank, mit braunem Haar und ebensolchem Oberlippen- und Kinnbart. Hose und Wams bestanden aus edlen Wollstoffen, der lange graue Wappenmantel sowie der Schwertgürtel wiesen ihn als Angehörigen des Ritterstandes aus. Seine braunen Augen musterten sie wohlwollend. «Verzeiht, edle Jungfer, wenn ich Euch erschreckt habe. Das lag nicht in meiner Absicht. Mein Name ist Guntram von Eggern. Die Ratsherren Walter und Christian Hole haben mich eingeladen, mich ihnen heute Abend auf ihrem Besuch bei Graf Johann von Manten anzuschließen. Ihr müsst der Beschreibung nach die Jungfer Enneleyn sein, Graf Johanns älteste Tochter.» Er verbeugte sich knapp. «Wenn ich das so sagen darf: Die Herren Stadträte haben, was Eure Schönheit angeht, eindeutig untertrieben. Ihr seht mich entzückt.»
Enneleyn spürte die verräterische Röte in ihre Wangen steigen. Sie war nicht daran gewöhnt, von Fremden so offene Komplimente zu erhalten. Schon gar nicht, wenn sie in einem hässlichen Kittel steckte, der noch dazu von Mehlflecken verunziert war. «Guten Tag, Herr von Eggern. Ich, äh …» Wieder klopfte sie fahrig an ihrem Rock herum. «Ihr seid also etwas früher hier eingetroffen?»
«Nicht viel zu früh, hoffe ich. Ich bin gerade mit der Fähre von Lahnstein herübergekommen und fand, dass es sich nicht lohnt, erst noch mein Haus aufzusuchen.»
«Ah. Ja, dann kommt herein …» Gerade als Enneleyn ihm den Weg weisen wollte, erschien Elisabeth in der Hintertür. «Enneleyn? Wo bleibst du denn mit Christine und den Kindern? Sie sollten längst … Oh, Verzeihung.» Als sie des Fremden ansichtig wurde, trat sie näher. «Ich habe nicht gesehen, dass wir Besuch haben.»
Der Ritter lächelte ihr zu und verbeugte sich ehrerbietig. «Frau Elisabeth, ich wünsche Euch einen guten Tag. Oder vielmehr Abend, denn der lässt ja nicht mehr lange auf sich warten. Verzeiht, dass ich hier so einfach eingedrungen bin und mich der Jungfer Enneleyn ganz formlos vorgestellt habe. Ich bin Guntram von Eggern und auf Einladung der beiden Ratsherren Hole hergekommen, um Euren Gemahl und die Familie kennenzulernen.»
«Tatsächlich.» Neugierig musterte die Gräfin den Ritter und nickte beifällig: Er wirkte gepflegt und sympathisch. «Es freut mich, Eure Bekanntschaft zu machen. Kommt herein und erfrischt Euch an einem Becher Wein.» Einladend wies sie auf den Eingang. Der Ritter folgte dankend.
Mit noch immer holprigem Herzschlag sah Enneleyn den beiden nach. Dieser Ritter war ausgesucht höflich und freundlich gewesen. Kein Grund, vor Verlegenheit im Boden zu versinken, auch wenn sie in ihrem Arbeitskittel alles andere als vorteilhaft aussah. Dennoch ärgerte sie sich, dass er sie so gesehen hatte. Der erste Eindruck zählte schließlich, und was für einen Anblick hatte sie ihm geboten! Er musste ja denken, dass sie ein ungeschickter Trampel war. Um sich abzulenken, lief sie hinüber in den Garten, sie wollte nachsehen, wo Christine mit den Mädchen steckte. Tatsächlich rannten die beiden ganz hinten um die Gemüsebeete der Köchin herum. Enneleyn gab der Kinderfrau mit Handzeichen zu verstehen, dass es Zeit wurde, Reinhild und Mariana zurück ins Haus zu bringen, dann kehrte sie zu dem Schubkarren zurück. Inzwischen war auch Godewin wieder da und sah sie erwartungsvoll an. «Ist das Mehl so in Ordnung? Ich hab dem Müller von der Gräfin ausgerichtet, dass er nicht mehr so schlampig mahlen darf, weil sie ihm sonst die Hölle heißmacht.»
«Das Mehl ist gut. Zumindest das meiste davon. Stell den Sack hier», sie deutete auf den zweiten, «ein wenig zur Seite und sag Josefa, dieses Mehl muss sie sieben, bevor sie es verwendet.»
«Mach ich sofort. Frau Elisabeth will übrigens, dass Ihr in die Stube kommt und dem Gast Gesellschaft leistet.»
Das hatte sich Enneleyn bereits gedacht. Ihre Stiefmutter ließ keine Gelegenheit aus, sie mit Gästen zusammenzubringen und ihr neue Bekanntschaften zu ermöglichen. Grundsätzlich war Enneleyn ihr dafür auch dankbar, wäre da nicht ihre Angst gewesen, sich zu blamieren. Sie wollte – musste – perfekt sein, um ihrem Vater und ihrer Stiefmutter Ehre zu machen. Also rief sie sich ins Gedächtnis, was Elisabeth ihr in den vergangenen Jahren immer und immer wieder gepredigt hatte: Eine hochgeborene Frau ließ sich weder Angst noch Unwohlsein anmerken, ging stets aufrecht, trug den Kopf hoch und den Blick gesenkt. Damit konnte Enneleyn nichts falsch machen, auch wenn sie nicht hochgeboren war.
Da dieser Guntram von Eggern auf Einladung der Ratsherren hier war, würde er sowieso hauptsächlich mit ihnen und Graf Johann reden wollen und keinerlei Interesse haben, sie noch einmal anzusprechen. Sie würde sich an ihre Stiefmutter und Frau Luzia halten, so wie es sich für eine brave Tochter gehörte.
2. Kapitel
«Dieser Guntram von Eggern hat ein Auge auf Enneleyn geworfen.» Luzia Wied nahm sich eine getrocknete Pflaume aus der Silberschale, die vom Abendessen noch auf dem Tisch stand. Die Männer hatten sich in Johanns Schreibzimmer zurückgezogen, um irgendwelche Schriftstücke zu sichten, die etwas mit dem Zoll der neuen Brücke hinüber nach Lützelkoblenz zu tun hatten. Enneleyn hatte sich bereits entschuldigt und zurückgezogen, sodass die beiden engen Freundinnen allein in der Stube zurückgeblieben waren.
Elisabeth nickte nachdenklich. «Dir ist es also auch aufgefallen.»
«Aufgefallen?» Luzia lachte. «Sein Interesse war ja wohl kaum zu übersehen. Nun ja, zumindest für das geschulte weibliche Auge. Dein Gemahl hat es vermutlich nicht bemerkt, ebenso wenig wie Martin. Aber sie waren ja auch zu sehr mit ihren Zöllen und den neuen Regelungen für die städtischen Soldaten beschäftigt. Seit man Martin in den Stadtrat berufen hat, schwirrt ihm der Kopf nur so vor lauter Gesetzen, Vorschriften und was weiß ich nicht alles. Versteh mich nicht falsch, es ist ein ehrenvolles Amt, aber ein äußerst zeitraubendes.»
«Das kann ich mir vorstellen.» Mitfühlend nickte Elisabeth. «Johann bemüht sich ja ebenfalls um einen Posten im Rat. Für Zugezogene sind die Hürden nur ein bisschen höher. Sie haben ihm den Posten des Rentmeisters in Aussicht gestellt. Eine hohe Ehre, aber auch eine große Verantwortung. Solange wir in Frieden leben, ist das alles einfach. Hoffen wir, dass der neue Erzbischof, wenn er demnächst offiziell ernannt wird, ein friedliches Regiment führt und seine Vasallen nicht gleich zu den Waffen ruft.»
«Er wird doch wohl nicht gleich einen Krieg beginnen, oder?»
«Ich hoffe nicht. Sein Vorgänger Boemund war ein friedliebender Mann. Na ja, er ist schon sehr alt, deshalb hat er abgedankt.»
«Herr Guntram ist auch ein Lehnsmann des Trierer Erzbischofs, nicht wahr?»
«So sagte er.» Elisabeth nickte. «Ich kenne die Familie nicht, auch wenn ich den Namen bereits gehört habe. Vielleicht sollte ich meinem Vater schreiben und ihn nach der Familie von Eggern fragen. Er weiß bestimmt mehr über sie. Oder Bruder Georg, aber er kommt erst in zwei oder drei Wochen von seinem Besuch in der Benediktinerabtei in Prüm zurück.»
«So eilig ist es nicht.» Wieder griff Luzia in die Schale mit den Trockenpflaumen. «Bestimmt werden Martin und Johann uns später noch etwas mehr über ihn erzählen können, und morgen oder übermorgen tauschen wir dann unsere Erkenntnisse aus.» Sie zwinkerte der Freundin zu. «Auf jeden Fall hat Herr Guntram deiner Ziehtochter gefallen, das habe ich ihr an der Nasenspitze angesehen. Sie hat zwar versucht, es zu verbergen, aber seine Komplimente sind nicht ungehört verhallt.»
«Nein, das sind sie wohl nicht.» Elisabeth schmunzelte. «Er ist aber auch ein ansehnlicher Mann, das muss man ihm zugestehen. Und im Besitz einer schmeichlerischen Zunge.»
«Allerdings. Aber warum auch nicht? Er ist noch unverheiratet und keine schlechte Partie, wenn ich das richtig einschätze. Gepflegter Landadel. Und das Beste: Er hat jetzt ein Haus hier in der Stadt.»
«Mmh, An der Arken.» Nachdenklich tippte sich Elisabeth mit dem Zeigefinger gegen die Unterlippe. «Er ist allerdings sechs- oder siebenunddreißig. Du weißt, dass ich keine Freundin von Ehen bin, in denen ein zu großer Altersunterschied besteht.»
Luzia lachte wieder. «Hör uns nur mal zu. Wir haben die beiden schon miteinander verheiratet, dabei kennen sie sich erst seit ein paar Stunden.»
«Über solche Dinge kann man sich nicht früh genug Gedanken machen.» Elisabeth bemühte sich um einen ernsten Tonfall, musste aber wieder schmunzeln. «Du hast ja recht, wir sollten nicht so viel in den heutigen Abend hineininterpretieren. Ich freue mich, dass Enneleyn die Aufmerksamkeit dieses Ritters geweckt hat. Sie ist ein so hübsches Kind, aber einen geeigneten Gatten für sie zu finden, gestaltet sich doch nicht so einfach, wie ich mir das einst gedacht hatte. Und nun ist sie zwanzig Jahre alt. Johann ist äußerst wählerisch. Er will seine Tochter nur einem Mann anvertrauen, der sie achtet und zu schätzen weiß. Seine Erfahrungen in der Vergangenheit haben ihn diesbezüglich geprägt.»
«Ganz zu schweigen von eurer gemeinsamen Geschichte, die nicht ganz gewöhnlich zu nennen ist», fügte Luzia hinzu.
«So ist es. Aber sag …» Als Luzia zum dritten Mal in die Schale mit den Pflaumen griff, runzelte Elisabeth leicht die Stirn. «Kann es sein, dass du heute Abend nicht genug gegessen hast?»
Verlegen zuckte Luzia zusammen und legte die Pflaume, die sie sich genommen hatte, auf den Tisch. Dann faltete sie die Hände über ihrem Bauch und räusperte sich.
«Nein!» Elisabeth sprang mit einem strahlenden Lächeln auf und zog die Freundin mit sich auf die Füße. «Sag bloß … Wirklich?»
«Wirklich.» Auch Luzia lächelte, ihre blauen Augen glitzerten fröhlich. «Ich weiß es noch nicht lange und habe Martin bisher nichts gesagt, weil er so beschäftigt war. Aber es sieht danach aus, dass wir bald noch ein weiteres Mäulchen zu stopfen haben werden. Ich schätze, es könnte kurz nach Weihnachten so weit sein.»
«Das ist ja wunderbar! Wie ich mich freue, Luzia.» Elisabeth nahm ihre Freundin fest in den Arm, dann setzten sich die beiden Frauen wieder. «Martin wird einen Freudentanz vollführen, nehme ich an.»
«Das will ich hoffen.» Luzia lächelte schalkhaft. «Immerhin vergöttert er seine älteste Tochter, und unsere Söhne sind ein Ausbund an Mustergültigkeit. Na ja, manchmal. Vor allem Jost.»
«Er ist ja erst zwei Jahre alt!»
Sie lachten. Luzia streichelte leicht über ihren Bauch. «Ist es vermessen, mir nach drei Jungen wieder ein Mädchen zu wünschen?»
Elisabeth beugte sich vor und legte ihre Hand über die der Freundin. «Ich glaube nicht. Immerhin ist die Erbfolge in eurer Familie mehr als gesichert. Und ich bin sicher, dass Martin auch eine weitere Tochter von Herzen lieben wird. Männer tun zwar immer gerne so, als würden ihnen nur die Söhne etwas bedeuten, aber sieh dir Johann an. Er ist vollkommen vernarrt in unsere Mädchen, ob er es zugibt oder nicht, der alte Brummbär. Und nun iss bitte diese Pflaume, denn wir wollen doch dafür sorgen, dass das Kindchen unter deinem Herzen gesund und kräftig wird.»
Luzia nickte, griff nach der getrockneten Frucht und betrachtete sie. «Falls es wirklich ein Mädchen wird, möchte ich sehr bitten, dass sie meinen Sinn fürs Rechnen und Verkaufen erbt. So lieb ich Kathrinchen auch habe, aber sie schlägt so gar nicht nach mir oder Martin. Hätte sie nicht seine Haare und meine Gesichtsform, müsste ich mir Gedanken machen, ob man sie uns vielleicht heimlich untergeschoben hat. Von wem sie ihre Begeisterung für Handarbeiten geerbt hat, ist mir jedenfalls schleierhaft, und auch der Gesang und das Talent für die Laute kommen ganz bestimmt nicht aus meinem Familienzweig.»
«O doch, das glaube ich schon. Immerhin hast du auch immer gerne getanzt», gab Elisabeth zu bedenken.
«Getanzt ja, aber Gesang gehörte noch nie zu meinen Stärken. Ich weiß gar nicht recht, was ich mit ihr anfangen soll.»
«Aber darüber haben wir doch schon einmal geredet, meine Liebe. Lass ihr eine gute Ausbildung zukommen, und wenn sie zwölf, dreizehn Jahre alt ist, nehme ich sie in unseren Haushalt auf und gebe ihr den passenden Schliff. Und wenn sie dann siebzehn, achtzehn Jahre alt ist, werden die potenziellen Bräutigame bei euch Schlange stehen, weil sie nicht nur hübsch, sondern auch eine gut ausgebildete Hausfrau sein wird.»
«Ihr würdet sie wirklich aufnehmen, auch wenn sie keine Edeljungfer ist?»
«Also bitte, Luzia. Ich werde ja wohl die Tochter meiner besten und liebsten Freundin – meine Patentochter! – bei mir aufnehmen.» Mit gespielter Empörung sah Elisabeth sie an. «Sie wird genauso liebevoll, aber auch streng erzogen wie jedes Edelfräulein, das meine liebe Schwiegermutter mir vermittelt. Habe ich dir übrigens erzählt, was Frau Jutta mir in ihrem letzten Brief geschrieben hat? Erinnerst du dich noch an den Ritter Einhard von Maifeld, der mich einst zwingen wollte, ihn zu heiraten, indem er versucht hat, mir Gewalt anzutun?»
Luzia schauderte. «Selbstverständlich erinnere ich mich. Der Gottseibeiuns schürt dafür hoffentlich ein ordentliches Feuer für ihn.»
«Ich glaube, das ist gar nicht notwendig. Einhard scheint bereits das Fegefeuer auf Erden zu erleben. Du weißt noch, dass er, nachdem Johann ihn für seinen Überfall auf mich verprügelt hatte, daraufhin aus Rache Johanns zukünftige Braut abspenstig gemacht hat, nicht wahr?»
«Hieß sie nicht Marie?»
«Maria Grosse. Die beiden scheinen eine wahrlich feurige Ehe zu führen. Frau Jutta schreibt, Maria sei mittlerweile mit Einhards neuntem Kind niedergekommen, alles Mädchen. Er hat zwar einen Sohn aus erster Ehe, aber stell dir das nur mal vor! Und sie soll sich weigern, auch nur eine der Töchter in ein Kloster zu geben.»
«Ei wei, dann werden ihn die Mitgiften arm machen, fürchte ich.»
«Er soll übrigens auch schon lange nicht mehr wagen, sich außerehelich zu verlustieren, wie er das früher gern getan hat. Seine Frau scheint ein herrisches Regiment zu führen … und eine gemeine Bratpfanne zu schwingen.»
«Geschieht ihm recht.» Luzia kicherte. «Obwohl, wenn ich mir die vielen Kinder ansehe, mag er vielleicht gar keine Kraft mehr haben, ein Dirnenhaus aufzusuchen. Offenbar versorgt Maria ihn mit allem, was er braucht.»
Schmunzelnd hob Elisabeth den Zeigefinger. Dann wurde sie wieder ernst. «Schade, dass du noch keine Nachricht von Anton erhalten hast. Ich bin so gespannt, wann er hier eintreffen wird.»
«Wenn er wirklich herkommt», schränkte Luzia ein. «Bertholff lässt ihn sicher nur ungern gehen, obgleich seine Söhne ja inzwischen erwachsen sind und ihm im Kontor helfen.»
«Enneleyn fragte mich vorhin, ob Anton denn auch seine Ehefrau mitzubringen gedenkt. Du sagtest ja, er wolle heiraten, nicht wahr?»
«Zumindest schrieb er mir, dass er sich für die Tochter eines Mailänder Kaufherrn interessiert, und sie schien auch nicht abgeneigt, sich ihm anzuverheiraten. Mehr weiß ich leider auch nicht. Mitbringen wird er sie bestimmt, falls er sie inzwischen geehelicht hat. Er weiß, wie gerne ich sie kennenlernen würde. Und wenn er tatsächlich vorhaben sollte, sich hier niederzulassen, muss sie ihn ja begleiten. Ach, Elisabeth, wäre das schön, meinen lieben Tünn wieder in meiner Nähe zu wissen. Nie hätte ich gedacht, dass wir einmal so weit voneinander entfernt leben würden. Noch dazu für so viele Jahre.»
«Wir hätten uns wohl alle nicht träumen lassen, wie unser Leben verlaufen würde», stimmte Elisabeth zu. «Aber sieh uns an, haben wir es nicht ganz wunderbar getroffen? Niemals würde ich auch nur einen Augenblick eintauschen wollen.» Nachdenklich hielt sie inne. «Wo hast du eigentlich das Kruzifix? Du trägst es heute gar nicht.»
«Nein, ich dachte, es passt nicht ganz, weil ich schon diese wunderschöne Perlenkette trage. Du weißt doch, dass Martin sie mir damals zur Geburt unseres ersten Kindes geschenkt hat. Ich komme so selten dazu, mich mit ihr zu schmücken. Heute war mir einfach danach.» Mit den Fingerspitzen fuhr sie sanft über die glänzenden Perlen an ihrem Hals. «Zu viel Geschmeide finde ich außerdem übertrieben. Stell dir vor, wie Bruder Georg mich schelten würde, wenn ich gleich zwei wertvolle Ketten zur Schau trüge!»
«O ja, damit würdest du dir eine Strafpredigt einhandeln.» Amüsiert nickte Elisabeth. «Trotzdem fehlt etwas, wenn du das Kruzifix nicht trägst.»
«Ich weiß, was du meinst.» Das silberne Kreuz war eine wertvolle Reliquie, die aus drei Teilen bestand – dem Kreuz selbst, dem mit roten und blauen Edelsteinen besetzten Rahmen und der ebenfalls mit Edelsteinen verzierten Kette. Luzias, Elisabeths und Martins Vorfahren hatten sie einst auf dem zweiten Kreuzzug ins Heilige Land den Sarazenen entrissen und untereinander aufgeteilt. Gleichzeitig hatten sie einen Schwur geleistet, sich und ihre Familien auf ewige Zeiten und für alle nachfolgenden Generationen gegenseitig zu beschützen und einander in Freundschaft verbunden zu bleiben, und zwar über alle Standesgrenzen hinweg. Dieses Erbe führten die betroffenen Familien auch über zweihundert Jahre später noch fort. Allerdings hatten erst Luzia und Elisabeth, als sie einander zum ersten Male begegnet waren, herausgefunden, dass es sich bei dem Kruzifix nicht nur um ein edles Schmuckstück handelte, sondern um eine machtvolle Reliquie mit wundersamen Kräften. «Wenn Anton zurückkehrt, wird das Kreuz endlich wieder vollständig sein und hoffentlich dafür sorgen, dass diese verrückten Träume aufhören.»
«Du hast noch immer diese Träume?» Alarmiert richtete Elisabeth sich auf. «Davon hast du nie etwas gesagt. Doch wohl nicht wieder warnende Gesichte, oder?»
«Und was für welche!» Luzia schüttelte halb erheitert, halb verärgert den Kopf. «In den letzten Jahren haben sie mich erfolgreich vor überkochender Milch, angebrannten Suppen und aufgeschlagenen Knien meiner Kinder gewarnt. Verhindern konnte ich einiges davon trotzdem nicht. Allerdings war ich in der Lage, den einen oder anderen betrügerischen Handelspartner vorzeitig zu erkennen, also darf ich mich eigentlich nicht über diese Vorahnungen beschweren.»
Elisabeth atmete hörbar aus. «Es surrt und leuchtet aber nicht mehr?»
«Nein, schon seit dieser Sache damals mit Albrecht nicht mehr. Anton hat auch nie etwas davon geschrieben, dass die Kette seltsame Zeichen gesendet hätte. Mag sein, dass er nicht so empfänglich dafür ist. Martin hat ja nie etwas von ihren magischen Fähigkeiten bemerkt. Aber mir gefällt der Gedanke, dass sie Anton beschützt und ihm Glück gebracht hat.»
«Ja, vielleicht liegt die größte Macht auch in Kreuz und Rahmen und nicht in der Kette. Wer weiß.» Noch einmal tippte sich Elisabeth nachdenklich gegen die Unterlippe. «Behüten wird sie Anton ganz sicher, davon bin ich überzeugt. Schau, wie gut es ihm ergangen ist. Ich bin sicher, wenn er erst einmal hier ist, wird er aus dem Erzählen monatelang nicht mehr herauskommen.»
«Ja, wenn wir ihn zum Reden bringen. Er war früher oft so still und in sich gekehrt. Allerdings wurde es besser, als er bei Martin in die Lehre kam. Doch selbst da hat er kaum jemals über die Stränge geschlagen. Außer …»
«Außer was?» Neugierig hob Elisabeth den Kopf.
Luzia lächelte versonnen. «Ich erinnere mich an das erste Mal, dass er sich betrunken hat. Er hat uns damals auf unsere gemeinsame Fahrt zur Benediktinerabtei Laach begleitet und von dort aus nach Kempenich. Auf der Burg hat er mit ein paar Knechten Wiedersehen gefeiert und …» Mit einem verlegenen Räuspern verstummte Luzia.
«Und was?», hakte Elisabeth ungeduldig nach.
«Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt erzählen darf. Immerhin waren Martin und ich damals noch nicht verheiratet, ja sogar noch meilenweit davon entfernt.»
«Ach?» Elisabeths Augenbrauen wanderten in die Höhe.
«Hm, ja. Anton nahm unsere gemeinsame Kammer in seinem Rausch derart in Beschlag, dass ich gezwungen war, bei Martin zu übernachten. In seinem Bett.»
«Luzia!»
«Ich hatte einen fürchterlichen Hexenschuss.»
«Hexenschuss?» Interessiert musterte Elisabeth die Freundin.
«Martin hat mich massiert, damit der Schmerz vergeht.» Wieder räusperte sich Luzia.
«Massiert?»
«Äh, ja. Und so weiter.»
«Und so weiter?»
«Musst du alles, was ich sage, wiederholen?»
«Ja, muss ich. Ich bin empört!» Das Lachen in Elisabeths Stimme strafte ihre Worte Lügen. «Dann habt ihr damals also miteinander …»
«Nein, nein, haben wir nicht. Aber fast. Wir sind noch rechtzeitig zur Besinnung gekommen.»
«Also ich muss schon sagen, ich erfahre hier Dinge über dich nach all den Jahren …» Belustigt schüttelte die Gräfin den Kopf. «Und Anton hat davon nichts mitbekommen?»
«Er hat geschlafen wie ein Säugling. Anderntags wurde er von schlimmer Übelkeit und Kopfschmerz geplagt. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass er sich seither noch einmal so übel betrunken hat.» Luzia lächelte beim Gedanken an ihren geliebten Bruder. «Er ist einfach zu sanftmütig und liebenswürdig dazu. Und zu vernünftig.»
3. Kapitel
«In diesem Sinne, meine lieben Freunde – Alla Salute!» Mit einer schwungvollen Bewegung hob Anton Bongert den Weinkrug an die Lippen und trank einen großen Schluck. Er war auf der Rückreise von Venedig nach Mailand und an diesem Abend, dem letzten vor Erreichen seines Zieles, in einer Taverne vor den Stadttoren Treviglios eingekehrt, um sich zu stärken und ein wenig zu feiern. Zwar war er als Vorhut seiner Handelskarawane allein unterwegs, doch an Gesellschaft mangelte es ihm nicht. Er hatte das Gasthaus bis auf den letzten Platz besetzt mit Kaufleuten aus aller Herren Länder vorgefunden. Unter ihresgleichen fühlte er sich wohl.
Die buntgemischte Gruppe von englischen, italienischen und französischen Handelsleuten trank ihm denn auch fröhlich zu. Es wurde gelacht und gegrölt. Was sie nicht bemerkten, war die Stille, die ringsum an den anderen Tischen eingekehrt war, und die Männer – und auch einige der wenigen anwesenden Frauen –, die sich heimlich und geduckt aus dem Staub machten. Grund für die so plötzlich umgeschlagene Stimmung war eine Bande bewaffneter Söldner, die den Gastraum betreten hatten.
Anton wurde erst auf sie aufmerksam, als er sich umdrehte, um nach der Schankmagd zu rufen. Mitten in der Bewegung hielt er inne. Seine freie Hand wanderte instinktiv zu dem Kurzschwert, das er stets am Gürtel trug. Er erkannte Räubergesindel, wenn er es sah, und dieses hier schien von der übelsten Sorte zu sein – und auf der Suche nach Streit.
Anton sprang auf, als einer der Söldner vortrat, den ersten ihm im Wege stehenden Tisch packte und mit einem Wutschrei umstürzte. Zinn- und Holzgeschirr flog scheppernd umher, die Gäste, die um den Tisch versammelt gewesen waren, sprangen und stolperten zur Seite. Irgendwo hörte Anton jemanden halblaut ein Ave Maria beten.
Er selbst dachte in diesem Moment weniger ans Beten und vielmehr daran, seine prall mit Silber- und Goldmünzen gefüllte Geldkatze vor diesen üblen Burschen in Sicherheit zu bringen. Schon forderte der Anführer in einem breiten, beinahe unverständlichen Dialekt die Anwesenden auf, ihre Börsen und Wertgegenstände auszuhändigen.
Als sich zunächst niemand rührte, zogen die Räuber Schwerter und Dolche. Der Anführer, groß, breitschultrig und, wie der umgeworfene Tisch bewies, mit Bärenkräften ausgestattet, zog eine kurzgriffige Streitaxt aus einer Schlaufe an seinem Gürtel und schwang sie kurz durch die Luft. Im nächsten Moment traf die Waffe einen alten, kahlköpfigen Mann, der unglücklicherweise im Weg stand, und spaltete ihm den Schädel. Blut und Hirn spritzten, der Alte sackte zu Boden.
Eine der Schankmägde kreischte schrill, die Gäste, die in der Nähe des Ermordeten standen, wichen entsetzt zurück. Die meisten zückten nun fahrig und voller Angst ihre Geldkatzen, warfen sie auf die Tische oder den Eindringlingen vor die Füße.
Anton tat nichts dergleichen. Er hatte sich langsam erhoben und jeden Muskel in seinem Körper angespannt. Solchen vagabundierenden Kriegsknechten war er bereits früher begegnet und hatte sich bisher immer erfolgreich gegen sie zur Wehr setzen können. Jedenfalls war er nicht gewillt, auch nur einen Heller des in seinem Besitz befindlichen Geldes herzugeben.
Einige der Söldner hatten begonnen, die Wertsachen einzusammeln. Der Anführer schritt derweil, die blutüberströmte Axt in der Hand, langsam durch den Raum. Er sprach nicht, aber das war auch nicht notwendig. Ein jeder Gast, an dem er vorbeikam, warf ohne weitere Aufforderung alles, was er an Münzen und Schmuck bei sich trug, hastig von sich.
Da der bullige Kerl immer näher kam, schätzte Anton rasch den Abstand zwischen sich und den möglichen Fluchtwegen ab. Die Erkenntnis, dass er keinen von ihnen schnell genug erreichen würde, ließ ihn den Plan, der sich in seinem Kopf geformt hatte, gleich wieder ändern.
Dicht vor Anton blieb der Hüne stehen. «Grana! Monete! Denari!», forderte er mit einer Reibeisenstimme, die durch Mark und Bein ging. Als Anton nicht reagierte, schwang der Räuber seine Streitaxt erneut. Die übrigen Männer am Tisch sprangen zur Seite oder warfen sich zu Boden.
Anton duckte sich gerade rechtzeitig, sodass der Schlag ins Leere ging. Der Hüne strauchelte ob des Schwungs, mit dem er ausgeholt hatte. Diesen Moment nutzte Anton und warf sich gegen ihn.
Der Räuber stürzte, die Axt flog ihm aus der Hand. Behände sprang Anton über ihn hinweg und brachte die gefährliche Waffe an sich.
Mit einem Wutschrei rappelte sich der Anführer der Bande wieder auf, während seine Kumpanen sich nun gegen einige weitere Gäste zur Wehr setzten, die das Überraschungsmoment ausgenutzt hatten, um sie ebenfalls anzugreifen. Mit so etwas hatte das Gesindel offenbar nicht gerechnet.
Anton warf die Streitaxt in hohem Bogen aus einem der Fenster. Flink und beweglich, wie er war, gelang es ihm, noch zwei weitere Söldner zu entwaffnen, bis er sich zum Ausgang vorgekämpft hatte. In der Taverne tobte mittlerweile eine üble Schlägerei. Auch Blut floss, jedoch schien es bisher kein weiteres Todesopfer zu geben.
«Diavolo!», hörte Anton den Anführer hinter sich brüllen. «Diavolo rosso!» Er machte den Fehler, sich umzudrehen, und bereute es sofort, weil ihn die Faust des Hünen im Gesicht traf. Er taumelte rückwärts, wäre beinahe gefallen. Gerade noch konnte er sich abfangen und einen Ausfallschritt machen, bevor ihn ein zweiter Schwinger erwischte.
«Diavolo rosso, diavolo rosso», brüllte sein Gegner immer wieder.
Anton wich ihm aus, so gut er konnte, musste aber mehrere Schläge einstecken, bis es ihm gelang, sich rechtzeitig zu ducken. Er warf sich zu Boden und wirbelte mit den Beinen so schnell herum, dass er seinen Gegner mit voller Wucht treffen und umwerfen konnte. Während der Hüne noch vor Zorn schäumte und versuchte, ihn festzuhalten, kam Anton bereits wieder auf die Füße, versicherte sich, dass Geldkatze und Schwert noch an Ort und Stelle waren, und machte, dass er fortkam. Sein Pferd hatte er hinter der Taverne in einer Stallung untergebracht. Es zu satteln, würde zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Da es sich aber sowieso nur um ein Mietpferd handelte, entschied er sich, es zurückzulassen. Stattdessen schwang er sich kurzerhand auf eines der Tiere, mit denen die Räuberbande offenbar hergekommen war. Der kräftige Rappe tänzelte schnaubend, als Anton sich auf seinen Rücken schwang.
Im gleichen Moment flog die Tavernentür auf, und der Anführer des Gesindels kam herausgerannt. Als er sah, was Anton vorhatte, brüllte er erneut etwas in seinem unverständlichen Dialekt.
Anton trat dem Pferd kräftig in die Seiten und trieb es an. Es wirbelte herum und galoppierte in großen Sätzen aus der Reichweite seines ehemaligen Besitzers.
«Diavolo!», konnte Anton den Räuber schreien hören. «Diavolo rosso!»
Als er sicher war, dass der Kerl ihn nicht mehr erreichen konnte, zügelte er sein Pferd und drehte sich um. «Diavolo rosso», murmelte er und fuhr sich mit einem spöttischen Lächeln durch sein lockiges rotes Haar, das er im Nacken mit einem Lederriemen zu einem Zopf gebunden hatte. «Roter Teufel.» Sein Grinsen verbreiterte sich. «Gern geschehen, du Hundsfott. Auf Nimmerwiedersehen!» Damit wendete er den Rappen und trieb ihn zu einem erneuten Galopp an.
Ein frisch gesäumtes Laken in der Hand, stand Enneleyn am Fenster ihrer Kammer und blickte hinunter in den Hof. Eigentlich hatte sie das Betttuch falten und in einer der Wäschetruhen verstauen wollen, stattdessen träumte sie schon eine geraume Weile vor sich hin. Sie wusste, dass das nicht recht war – Müßiggang galt als Sünde. Doch sie konnte sich von den Gedanken, die in ihrem Kopf kreisten, einfach nicht losreißen.
Vor einem Monat erst war sie Guntram von Eggern zum ersten Mal begegnet, und seither hatte er die Familie mehrmals besucht, meist wegen irgendeiner städtischen Angelegenheit, die auch ihren Vater betraf. Vor drei Tagen dann war er von ihrem Vater zum Mittagsmahl geladen worden und hatte danach fast zwei Stunden mit ihr verbracht. Allein! Nun ja, fast allein. Elisabeth hatte sich in der Nähe aufgehalten, während sie erst im Hof und danach in der Gartenlaube gesessen und sich unterhalten hatten. Und selbstverständlich war auch das Gesinde bei der Verrichtung der täglichen Arbeiten nicht fern gewesen.
Sie hatte die vielsagenden Blicke wohl bemerkt, die Elisabeth und Graf Johann ausgetauscht hatten, als Herr Guntram darum gebeten hatte, sich von Enneleyn den Garten zeigen zu lassen. Sie selbst war, wenn auch zunächst verlegen, so doch durchaus erfreut gewesen, dass er ihr eine solche Aufmerksamkeit schenkte. Er war ein gutaussehender Mann mit angenehmen Umgangsformen, und er hatte ihr wieder unzählige Komplimente gemacht und ihr mit Worten und Blicken geschmeichelt, bis ihre Wangen ganz heiß und rosig geworden waren.
Vor etwa einer halben Stunde war er erschienen und hatte um eine Unterredung mit Graf Johann gebeten. Enneleyn hatte gehört, wie ihr Vater kurz darauf Elisabeth ebenfalls hinzurief. Sie konnte sich denken, was das zu bedeuten hatte. Guntram von Eggern hielt womöglich in diesem Moment um ihre Hand an. Sie wusste inzwischen, dass er nördlich bei Eltville Land und Gut besaß, ebenso rheinaufwärts zwischen Koblenz und Mainz. Sein Familienname, so hatte er Enneleyn erzählt, stammte von seinen Vorfahren aus dem Alpenland, von denen eine Linie vor fast einhundert Jahren ins Rheingau gekommen war und seither Besitzungen in und um Eltville ihr Eigen nannte.
Enneleyn war sich nicht ganz sicher, was sie im Augenblick empfand. Innere Unruhe, vielleicht konnte man es auch freudige Erregung nennen. Es war aufregend, sich vorzustellen, dass ihr Vater jetzt in diesem Moment Herrn Guntram das Einverständnis gab, sie heiraten zu dürfen.
Es hatte auch früher schon Männer gegeben, die mit einer Verbindung zum Hause der Familie von Manten liebäugelten. Bisher hatte Graf Johann sie alle abgelehnt. Enneleyn war und blieb eine Bastardtochter, und es gab in anderen Adelsfamilien selbstverständlich auch Bastardsöhne. Einem solchen wollte ihr Vater sie aber nur ungern zur Frau geben, weil die rechtlichen Unwägbarkeiten nicht abzusehen waren. Bei den wenigen ehelich geborenen Anwärtern hatte es ebenfalls aus Graf Johanns Sicht immer den einen oder anderen Grund für seine Ablehnung gegeben. Seine Gemahlin hatte ihn bereits mehrfach gescholten, dass Enneleyn auf diese Weise eine alte Jungfer würde. Doch in traulichen Momenten hatte auch sie Enneleyn erklärt, dass es wichtig war, eine eheliche Verbindung ganz genau zu prüfen und nicht dem Erstbesten zuzusagen.
Enneleyn begriff das selbstverständlich, schließlich war sie in dem Wissen aufgezogen worden, einmal eine politisch sinnvolle Ehe einzugehen. Das war mehr, als viele andere Bastardinnen zu erwarten hatten. Immerhin hätte ihr Vater sie auch für das Leben im Kloster bestimmen können, wo sie dann mit entsprechend hoher Mitgift und der Protektion durch die Familie von Manten einen passenden Aufstieg bis zur Äbtissin hätte erwarten können.
Ein weltliches Leben war ihr allemal lieber. Sie schauderte ein wenig bei der Vorstellung, für immer hinter Klostermauern leben zu müssen. Auch wenn es den meisten Nonnen durchaus nicht schlechtging, wünschte sie sich tief in ihrem Herzen, einmal Kinder zu bekommen und einem Haushalt vorzustehen. Würde dieser Wunsch vielleicht nun bald in Erfüllung gehen? Guntram von Eggern war ein ehrenwerter Mann, das stand fest. Er war bereits siebenunddreißig Jahre alt, doch durfte so etwas nicht als Hindernis angesehen werden. Sie würde ihrem Vater Ehre machen, wenn sie die Frau dieses Ritters wurde. Er könnte stolz auf sie sein, und man würde sie allezeit schätzen und ehren. Wenn bekannt würde, dass sie einen solch wohlgeborenen und angesehenen Ritter zum Gemahl nehmen durfte, würden auch noch die letzten abschätzigen Blicke ob ihrer Herkunft der Vergangenheit angehören. Nicht, dass sie jemals offen wegen ihrer Unehelichkeit angegangen worden wäre, aber sie wusste, dass die Leute sich die Mäuler zerrissen hatten, als sie im Haus ihres Vaters eingezogen war. Ganz bestimmt würde das Gerede im Falle einer Hochzeit wieder aufflackern. Auf Dauer würde der Ehestand ihr Ansehen aber deutlich steigern.
Sie durfte bei all diesen Überlegungen nicht ausschließlich an sich selbst und ihre Befindlichkeiten denken. Letztlich war es gleich, ob sie ihn wollte oder nicht – sie hatte ihrem Vater zu gehorchen. Was sie bisher über Herrn Guntram erfahren hatte, war hauptsächlich, dass ein Ehebündnis mit ihm Graf Johann viele strategische und politische Vorteile böte. Guntram von Eggern stand in der Gunst Kaiser Karls IV., wie es hieß, was das Ansehen der von Mantens nur noch steigern konnte. Er befehligte darüber hinaus drei Gleven – berittene Soldaten mit jeweils bis zu drei Mann Gefolge. Zusammen mit den fünf Gleven ihres Vaters würde dessen Einflussbereich auch hier in Koblenz deutlich vergrößert. Vielleicht würde man ihn sogar zum Hauptmann der Stadtsoldaten machen und in den Rat wählen.
In einem Anflug von Nervosität knetete Enneleyn den glatten Leinenstoff des Lakens. Würde sie bald eine Ehefrau sein? Ihr Blick blieb an einer der Hofkatzen hängen, die, eines ihrer fünf kürzlich geborenen Jungen im Mäulchen, über den Hof lief. Die Katze wechselte den Standort ihres Nestes; offenbar war es ihr in der Remise nicht angenehm genug. Sie verschwand im Stall, kam kurz darauf zurück und brachte wenig später ein weiteres winziges Kätzchen zu ihrem neuen Wohnplatz.
Kinder. Sie würde bestimmt bald welche bekommen, denn das war ja Sinn und Zweck einer Ehe. Bei diesem Gedanken verstärkte die Nervosität sich noch ein wenig. Frau Elisabeth hatte ihr selbstverständlich all ihre Pflichten als Ehefrau erklärt. Eine Jungfer musste schließlich wissen, was auf sie zukam. Einiges hatte sie freilich bereits gewusst, denn die Umstände, in denen sie die ersten neun Jahre ihres Lebens aufgewachsen war, hatten ihr genügend Gelegenheit geboten zu erfahren, was zwischen Männern und Frauen auf dem Ehelager vor sich ging. Im Hause Bert Mundschenks gab es nur zwei Schlafräume, die dicht nebeneinanderlagen. Jedes Geräusch war laut und deutlich zu ihr und ihren Halbgeschwistern herübergedrungen. Und auch zuvor, in dem kleinen Dorf, in dem sie geboren war, hatte sie auf den Höfen der unfreien Bauern den Tieren ganz selbstverständlich bei der Paarung zugesehen.
Wärme stieg in ihre Wangen, als sie sich vorzustellen versuchte, wie es wohl sein mochte, bei einem Mann zu liegen. Ihrem Ehemann. Frau Elisabeth hatte gesagt, dass es den meisten Frauen durchaus Freude bereitete. Sie dürfe auf keinen Fall Angst davor haben, dazu gebe es gar keinen Grund.
Enneleyn rief sich das Gesicht Guntrams vor Augen und knabberte dabei an ihrer Unterlippe. Gewiss war er ein verständiger und sanfter Mann, der ihr die Verlegenheit rasch nehmen würde. So freundlich, wie er zu ihr war, und so lobend, wie er sich über ihre Schönheit und Wohlerzogenheit geäußert hatte, konnte es gar nicht anders sein. Ganz gewiss würde es angenehm sein, mit ihm das Ehelager zu teilen. Sie glaubte zwar nicht, ihn zu lieben, dazu kannte sie ihn nicht gut genug. Doch das würde mit der Zeit kommen, denn so war es in den meisten Ehen. Hoffentlich würde sie eines Tages ebenso vertraut mit Guntram sein, wie sie es von ihrem Vater und ihrer Stiefmutter her kannte. Oder von Frau Luzia und deren Gemahl. Wie wunderbar würde ihr Leben sein, wenn es sich so fügte!
«Jungfer Enneleyn? Seid Ihr hier oben?»
Sie schrak zusammen, als Hillas Stimme, gepaart mit dem Klappern ihrer Holzpantinen auf der Treppe, erklang. Hastig wandte sie sich vom Fenster ab und schüttelte das Laken aus. «Ja, ich bin hier drinnen.»
Die Magd erschien in der halboffenen Kammertür. «Ich soll Euch ausrichten, der Herr Graf und Frau Elisabeth wünschen Euch zu sprechen.»
Enneleyns Herzschlag holperte vor Aufregung und beschleunigte sich. «Danke, Hilla, ich komme sofort.» Sie faltete das Tuch rasch zusammen und legte es auf ihr Bett, dann strich sie, obgleich es unnötig war, ihr Kleid glatt und warf einen Blick in den Spiegel. Ihre Wangen schienen noch immer rosiger als üblich. Kein Wunder, so aufgeregt, wie sie war. Sie durfte sich jedoch nicht anmerken lassen, was in ihr vorging. Eine Dame hatte sich stets in Gleichmut zu üben.
Sie drückte den Rücken durch, nahm die Schultern zurück und setzte ein freundliches, nicht zu strahlendes Lächeln auf und ging gemessenen Schrittes die Stufen hinab ins Erdgeschoss. Vor der Schreibkammer ihres Vaters blieb sie kurz stehen, um Luft zu holen. Ehe sie die Hand heben konnte, um anzuklopfen, öffnete sich die Tür, und sie sah sich ihrer Stiefmutter gegenüber.
«Enneleyn, mein liebes Kind, da bist du ja. Komm herein. Dein Vater hat ganz erfreuliche Neuigkeiten für dich. Und begrüße auch unseren Gast, Herrn Guntram, dem wir die guten Nachrichten zu verdanken haben.» Sie trat beiseite und ließ Enneleyn eintreten.
Guntram von Eggern erhob sich, als sie das Zimmer betrat, ebenso ihr Vater, der hinter seinem Schreibpult gesessen hatte. Freundlich, aber nervös grüßte sie den Ritter. Ihre Hände verschränkte sie fest ineinander, damit niemand sah, wie sehr sie zitterten. Ein Blick auf ihren Vater ließ sie verwundert die Augenbrauen heben. Er war ein hochgewachsener, schlanker Mann mit kräftigen breiten Schultern. Sein blondes Haar war im Nacken zu einem Zopf gebunden. In den vergangenen beiden Jahren hatten sich erste graue Strähnen hineingeschlichen, die ihm etwas Würdevolles gaben. Seine linke Wange wurde von einer langen hässlichen Narbe verunziert, die ihm einst sein Vater während eines Übungsturniers zugefügt hatte. Auf Fremde wirkte er damit wohl zunächst abschreckend, Enneleyn jedoch empfand nichts als Zuneigung für ihn und fürchtete sich auch längst nicht mehr vor seinem gelegentlichen Donnergrollen. Seine gewittrige Miene wirkte im Augenblick alles anderes als hocherfreut. Der Tonfall, in dem er sie nun ansprach, klang förmlich, jedoch durchaus aufgeräumt und verwirrte Enneleyn noch mehr.
«Meine Tochter», er räusperte sich unterdrückt, «der Ritter Guntram von Eggern hat mich heute aufgesucht, um mich darüber in Kenntnis zu setzen, dass er eine Zuneigung zu dir gefasst hat und sich glücklich schätzen würde, dich in sechs Wochen vor die Kirchenpforte führen zu dürfen. Von meiner Seite aus bestehen gegen eine solche Verbindung keinerlei Einwände. Herr Guntram ist ein ehrenwerter Mann, seine Familie mit der unseren bislang nicht verwandt oder verschwägert. Selbstverständlich müssen wir die Details des Ehevertrags noch klären und auch der Form halber etwaige Ehehindernisse in Erfahrung bringen. Da ich davon ausgehe, dass selbige nicht bestehen, ist es nun an dir, uns mitzuteilen, ob du mit einer Heirat einverstanden bist.»