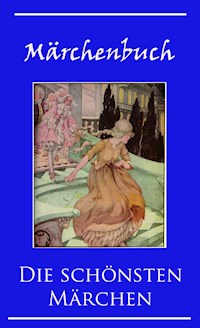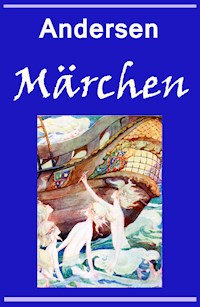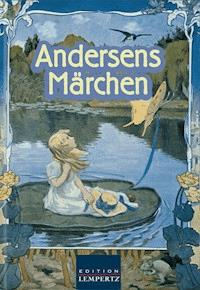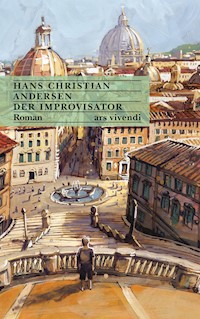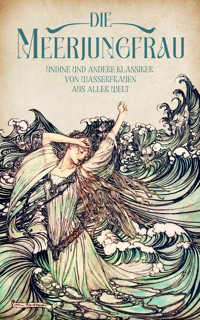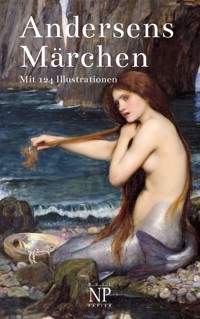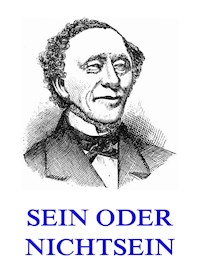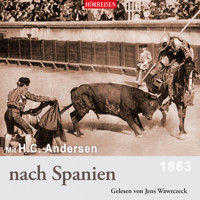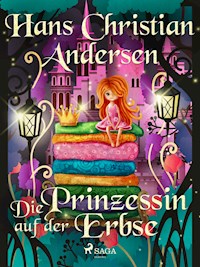Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ars vivendi Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In einer stürmischen Nacht strandet eine Gruppe junger Adliger auf der Insel Langeland und sucht Zuflucht in einem alten, halb verfallenen Herrenhaus. Dort werden sie Zeugen einer dramatischen Geburt. Die Mutter des Kindes stirbt und die Edelleute beschließen, das Neugeborene zu adoptieren. Die Waise Elisabeth wächst bei der unkonventionellen Großmutter von Baron Herman auf. Doch die glückliche Kindheit des Mädchens auf dem Gut nimmt ein jähes Ende, als sie eines Tages die Tür zu einem verbotenen Zimmer öffnet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 424
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ars vivendi Bibliothek
Band 25
Hans Christian Andersen
DIE BEIDEN BARONINNEN
Roman in drei Teilen
Aus dem Dänischen von Erik Gloßmann
ars vivendi verlag
Cadolzburg
Die dänische Originalausgabe erschien 1848 unter dem Titel De to Baronesser.
Die Übersetzung folgt dem Text aus:
Hans Christian Andersen Romaner og Rejseskildringer, Band IV,
hg. von Morten Borup, Kopenhagen 1943.
Vollständige eBook-Ausgabe der im ars vivendi verlag erschienenen Originalausgabe (1. Auflage)
© 2005 by ars vivendi verlag GmbH & Co. KG, Bauhof 1, 90556 Cadolzburg
Lektorat: Dr. Jörg Rauser
Umschlagillustration: Anton Atzenhofer
Datenkonvertierung eBook: ars vivendi verlag
eISBN 978-3-86913-258-7
Inhalt
ERSTER TEIL
1. Im offenen Boot · Das alte, verfallene Rittergut
2. Die Grossmutter
3. Die Studententochter
4. Der Kammerjunker
5. Der Leierkastenmann
6. Der Besuch bei der Grossmutter
7. Auf der Strasse und im Ballsaal
8. Caroline Heimeran
9. Die geheimnisvolle Kammer
10. Besuch bei Küsters
ZWEITER TEIL
1. Was in Dagebüll geschah
2. Das Haus des Kapitäns
3. Ein Sonntag
4. Elimar · Ein Winterleben · Lebensgefahr
5. Ein paar Jahre · Ein alter Bekannter tritt auF
6. Verzweiflung · Hilfe durch »Das Herz von Midlothian«
7. Die Gestrandeten · Brief von Elimar
DRITTER TEIL
1. Die Witwe
2. Im Vorzimmer, im Rathaus, im Theater und was später darauf folgte
3. Der Keller des Schuhmachers
4. Der Salon der Baronin
5. Herman und Elisabeth
6. König Frederik VI.
7. Der Kammerjunker
8. In der geheimnisvollen Kammer und in der Dorfkirche
9. Trennung und Wiedersehen
10. Ein wenig von allen · »Grossmutters Brautgabe«
ANMERKUNGEN HANS CHRISTIAN ANDERSENS
ANMERKUNGEN DES ÜBERSETZERS
NACHBEMERKUNG
ERSTER TEIL
1. Im offenen Boot · Das alte, verfallene Rittergut
Es wehte ein starker Nordostwind. Im Großen Belt türmten sich die Wellen; schwer schlugen sie gegen die schmale, waldbewachsene Insel Langeland, die Oehlenschläger in seiner Reise nach Langeland als einen »ins Wasser geworfenen Rosenzweig« besungen hat. Wir haben von ihr nur zu berichten, dass sich an der Nordspitze eine Gesellschaft um einen Picknickkorb versammelt hatte; der Wagen, der sie wieder zurück auf den Herrenhof bringen sollte, wartete ganz in der Nähe. Die Brandung spritzte von Mal zu Mal höher; in ihr Tosen mischte sich das Knallen der Champagnerkorken. Der Wind wirbelte die Servietten durcheinander und griff unter die Mäntel, die sich die Damen um die Schultern gelegt hatten, denn es war spät im Herbst.
»Das ist ja fast ein Sturm«, stellte die Älteste fest.
»Ja, es ist herrlich, Mama!«, rief die Jüngere. »Jetzt muss nur noch ein Schiff stranden!«
»Um Himmels willen, was redest du da!«, erwiderte die Mutter entsetzt.
»Warum? Die Gestrandeten hätten es doch gut bei uns. Wir würden sie zu Schinken und Champagner einladen und ihnen zu Hause die Gästezimmer herrichten …«
»Hör auf, das ist ja schrecklich. Sieh nur, da ist wirklich ein kleines Boot draußen! Mein Gott, wie das schaukelt! Das kann doch nicht gut gehen. Ein Segen, dass wir auf dem Trockenen sind.«
Von Seeland her kam ein offenes Boot. Nur ein Segel war gesetzt, doch es stand prall im Wind und führte das Boot in fliegender Fahrt über die hohen Wogen. Manchmal glaubte man, in der Hebung den Kiel zu sehen, dann wieder schien das Fahrzeug bis zur Mastspitze in einem Wellental zu verschwinden.
»Dort draußen geht es noch gut«, meinte ein älterer Mann aus der Gesellschaft. »Aber wenn sie erst einmal am Sandriff sind und wenden müssen, werden sie ihr blaues Wunder erleben. Es wird hart, bei Lohals zu landen, und nach Fünen kommen sie schon gar nicht; es sei denn, die See wird ruhiger.«
»Schau doch, Mama, wie aufregend!«, rief die junge Dame, als das Boot krängte und reichlich Wasser darüber spritzte.
»Schrecklich ist es«, sagte die Mutter. »Aber interessant!«
Wir wollen nun sehen, wie interessant die da draußen es finden.
Das Boot stammte aus dem Fischerlager Skovshoved oberhalb Kopenhagens und hatte also eine recht ansehnliche Seereise hinter sich. Am Steuer saß ein Mann in einem Anzug aus gelbem Wachstuch; ein breiter Hut aus demselben Stoff hing ihm auf die Schultern herab. Der Mann schien so gekleidet zu sein, um mit trockener Haut durch das Meer gehen zu können; es war der Eigner des Bootes, Ole Hansen aus Skovshoved. Neben ihm befand sich ein hübscher junger Mann, ebenfalls in einer Seemannstracht, die jedoch feiner, fast elegant geschnitten war. Es war Graf Frederik, ein Student; das Gut seines Vaters lag auf Fünen. Zwei weitere gut verpackte Personen saßen vor einem großen Picknickkorb, aus dem sich der eine immer wieder bediente. Ein vierter junger Mann lag, mit nassen Mänteln zugedeckt, auf dem Boden des Schiffes. Er litt unter dem Wetter. Sein edles Gesicht war leichenblass; das nasse, schwarze Haar klebte an den Wangen. Er sah aus wie die Leiche eines jungen, schönen Gladiators.
»Lassen Sie mich steuern, Herr Graf!«, schlug Ole Hansen vor, als das Wasser besonders hoch spritzte. Der Kranke, der nun völlig durchnässt war, schlug die Augen auf, die dunkel glänzten, als wäre er unter Italiens Sonne geboren.
Es war nötig, den Kurs zu ändern, um die Landspitze zu umschiffen; aufmerksam beobachtete Ole die Wogen, die nun mit ganzer Kraft wirken konnten. Er wusste sie mit viel Geschick gleichsam zu umfahren. Die Wellen leckten an der Reling und schienen das kleine Boot unter sich begraben zu wollen, aber es hob sich im letzten Moment immer wieder empor.
»Herrlich gesteuert, alter Ole!«, schrie Frederik. »Das ist eine Lust; wir fliegen wie die Möwen! Und der Wind lässt uns nicht im Stich, er treibt uns voran. He, schaut, dort steht ein Regenbogen in den Tropfen!«
»Wir bekommen bald Tropfen von oben«, knurrte Ole und zeigte auf eine dicke Wolke. »Der graue Kerl dort hinten schiebt sich heran und wird sich über uns entladen. Wir müssen uns noch mehr in den Wind drehen, dann kommen wir vielleicht davon. Segel in Lee!«
Rasch, wie ein geübter Matrose, führte Graf Frederik das befohlene Manöver aus. Eine starke See warf das Boot fast um. Die beiden am Picknickkorb sprangen auf, und sogar der Kranke kam auf die Beine.
»Stillgesessen!«, rief der Alte mit gebieterischer Stimme. »Schöpft das Boot aus!«
Sie gehorchten, und nun ging es mit halb gerafftem Segel seewärts.
»Und du wolltest der Lustigste von uns sein!«, wandte sich der Graf spöttisch an den Kranken, der sich wieder hingelegt hatte. »Dein Auftritt ist ja ganz bemerkenswert, aber doch irgendwie langweilig. Wir könnten dich eigentlich an Land bringen, als unsere Konterbande für die Insel Fünen. Keiner würde dich kennen.«
Es begann zu regnen; die Sonne ging soeben unter. Das ständige Kreuzen hatte sie kaum eine Viertelmeile an der Westseite Langelands vorangebracht. Ihr Ziel, das Gut von Graf Frederiks Vater, lag zwischen Svendborg und Faaborg an der Küste Fünens; sie hatten also noch eine beträchtliche Strecke zurückzulegen. Strömung und Wind wirkten ihnen entgegen; außerdem hatten sie auf dem Weg von Kopenhagen bereits eine Nacht unter freiem Himmel verbracht und litten unter der Nässe.
»Bei Tageslicht werden wir Svendborg nicht mehr erreichen«, meinte Ole. »Wir müssen irgendwo an Land gehen.«
»Hört mal«, sagte Frederik, »nur eine halbe Meile landeinwärts liegt ein altes Rittergut, das mein Vater gekauft hat, um es für mich aufbauen zu lassen. Wollen wir nicht dort übernachten? Es soll dem Aussehen nach eine wahre Räuberhöhle sein, aber ganz romantisch, und was noch besser ist: Wir hätten ein Dach überm Kopf und Leute zu unserer Bedienung, einen Großknecht und eine Meierin mit Suite. Wir würden weder Hunger noch Durst leiden. Einverstanden? Gut … Ole, steuere geradewegs auf den Kirchturm von Svindinge zu, der dort wie ein Flaschenhals aufragt! Ich weiß, dass da zwischen den Büschen ein kleiner Bach mündet. Bei Hochwasser, wie jetzt, kann man ein Stück hineinfahren, und dort liegt das Boot sicher wie in Abrahams Schoß.«
»Du hast uns ja auf eine schöne Segeltour mitgenommen«, spottete der junge Mann am Picknickkorb. »Wenn ich nicht solch einen gesegneten Appetit hätte, wäre es mir längst so ergangen wie Herman.« Und er wies auf den Seekranken.
Es wurde immer dunkler; das Boot schaukelte stark. Trotz der Steuerkünste des alten Fischers nahmen sie ein paar Mal Wasser. Der einsetzende Regen hatte für die ohnehin Durchnässten keine Bedeutung mehr.
»Hältst du drauf, Ole?«, erkundigte sich Frederik, als sie sich in schneller Fahrt der Küste näherten.
»Da ist der Bach!«, rief Ole kurz darauf. Die Kenntnis der Strömungen und sein scharfes Auge hatten ihn richtig geleitet. Das Segel fiel; mit einem Sprung war er an Land, zog das Boot an die Seite und vertäute es an einem großen Stein. Vom nahe gelegenen Fischerhaus bellte schon der Kettenhund zur Begrüßung.
Eine halbe Meile zu wandern konnte den durchnässten und verfrorenen jungen Menschen nur gut tun; deshalb wollten sie gleich zu dem verfallenen Rittergut. Ole sollte zunächst beim Boot bleiben; übernachten konnte er im Fischerhaus. Ihm wurden die kleine Flasche Rum und der halbe Mundvorrat überlassen.
»Mein Rucksack ist der leichteste«, erklärte Herman, der gesprächig wurde, weil er festen Boden unter den Füßen spürte. »Ich habe wenigstens ein Hemd für jeden von uns, das ist doch immerhin etwas!«
Die Wanderung durch die Finsternis begann. Der anhaltende Regen hatte den sandigen Weg in einen Morast verwandelt.
»Man kann nicht sagen, dass wir schon auf dem Trockenen angekommen sind«, stellte Herman fest. »Ich habe ein Gefühl, als spazierte ich auf dem Meeresboden, der ständig unter mir nachgibt.«
»Und wie es in den Bäumen rauscht«, sagte der andere. »Das wird ja immer schlimmer. Kennst du den Weg auch genau, Frederik? Ich habe keine Lust, die ganze Nacht herumzuirren und an einem Bauernhaus anzuklopfen, wo uns vielleicht nicht einmal aufgemacht wird. Erschrick nicht, ich muss mich an deiner Jacke festhalten, denn ich kann keinen Schritt weit sehen …« Im selben Augenblick stolperte er und schlug lang hin, kam aber unter allgemeinem Gelächter schnell wieder auf die Beine.
Sie waren schon fast eine Stunde unterwegs, als Graf Frederik versicherte, dass sie die Gabelung erreicht hätten, wo der Weg zum alten Rittergut abzweigte. Sie lauschten einen Moment und meinten, im Brausen des Sturmes Hundegebell zu vernehmen … nein … sie hatten sich wohl geirrt … Alles in allem war es wirklich eine Lustreise! Wieder lauschten sie … und hörten einen Schrei, der in ein Jammern überging.
»Was ist das?«, fragte einer.
»Ach, nur der Wind«, antwortete ein anderer.
»Nein, nein, da ist doch was!«, war sich der Dritte sicher. Keiner konnte erklären, was da an ihr Ohr drang, deshalb setzten sie ihren Weg nach kurzem Zögern fort.
Wir werden später erfahren, aus welcher Menschenbrust diese tiefen Seufzer kamen.
Plötzlich zeigte sich vor ihnen ein Licht.
»Jetzt weiß ich den Weg!«, rief Frederik. »Dort liegt das Gut!«
Im nächsten Moment war das Licht verschwunden, doch der Graf schritt entschieden weiter in diese Richtung.
»Ich habe die Stiefel so voller Wasser, dass ich gar nicht weiß, wie tief ich wate«, klagte der hinter ihm Gehende. »Hier scheint es mir aber allzu frisch um die Füße zu werden. Sind wir etwa in einen Sumpf geraten?«
»Stimmt«, bestätigte Frederik, »aber das ist der kürzeste Weg. Vertraut mir, das ist die so genannte trockene Seite des alten Wallgrabens. Genau vor uns ist das Haus!«
Tatsächlich wären sie fast gegen die Mauer gelaufen, hätte nicht über ihnen, nur eine Elle entfernt, erneut das Licht aufgeleuchtet. Sie riefen ein lautes Hallo zu dem Fenster hinauf, als wäre es einstudiert, und bekamen das Gebell von vier oder fünf Hunden zur Antwort. Niemand ließ sich blicken; der Wind heulte und schleuderte ihnen dicke Regentropfen ins Gesicht. Sie klopften gegen die Scheibe, bis sich dahinter erst ein Gesicht und dann noch eines zeigte. Doch die drinnen sagten keinen Ton und dachten nicht daran, das Fenster zu öffnen. Jetzt lärmten die jungen Leute wild durcheinander. Fredrik wurde wütend, sprang hoch und schlug mit der Faust die Scheibe entzwei. Dabei brüllte er: »Kommt mit Licht, ihr Schafsköpfe! Ich bin es, Graf Frederik. Wollt ihr uns bei dem Sauwetter draußen stehen lassen?«
»Jesus!«, kam es als Antwort. Nun entwickelte sich drinnen emsige Geschäftigkeit. Das Licht wurde weggenommen, so dass die draußen Wartenden wieder im Dunkeln standen. Endlich rasselte das Torschloss; das Hundegebell schwoll an, eine Laterne leuchtete, und Knecht und Magd empfingen die Eintretenden mit dem Ausruf: »Du lieber Gott, bei diesem Wetter!«
»Wir kommen von Kopenhagen«, erklärte Graf Frederik. »Wir waren in einem offenen Boot unterwegs und mussten wegen des Sturms an Land gehen. Richtet den Saal oben im Turm her, er taugt wohl am besten.«
»Dort sieht es wüst aus«, meinte der Knecht. »Aber es wird gehen. Wir können die Fenster verstopfen.«
»Meine Herren, so wollen wir nun Einzug halten in meinen kleinen Besitz«, verkündete Frederik. »Ich hoffe, dass er sich über Jahr und Tag in einem besseren Zustand präsentieren wird. Dann wollen wir ihn mit einem ordentlichen Gelage einweihen. Habt Acht beim Gehen! Wir müssen auf Brettern und Steinen balancieren.« Und den Dienstboten befahl er: »Schafft inzwischen etwas Warmes heran! Was habt ihr? Doch wenigstens Bier und Eier, denn Rum und Zitronen sind doch sicher nicht aufzutreiben?«
»Ja«, nickte die Magd und steckte ihr rotes, vergnügtes Gesicht aus der Schürze heraus, die sie sich wegen des Regens eilig über den Kopf geworfen hatte.
Sie liefen los, stolperten aber alle naselang über Steine und Bauholz. Der Knecht führte sie mit der Laterne einen mit Nesseln bewachsenen Hang hinab und bemühte sich vergeblich, einige Bretter zu richten, die den Weg erleichtern sollten.
»Wir überqueren gleich den zweiten Wallgraben«, erklärte der Graf. »Hier hat in alten Zeiten ein Schloss gestanden, mit allem Drum und Dran. Vor einem halben Jahrhundert wurde es bis auf einen Turm abgerissen. Stattdessen errichtete man ein großes Fachwerkgebäude, das aber unter dem seligen General wieder verfiel. Mein Vater hat den ganzen Schrott gekauft. Die Erde ist gut, der Wald gesund und das Ganze prächtig gelegen. Im nächsten Frühjahr wird der Kasten abgerissen und ein neues Haus gebaut.«
Sie standen nun in dem inneren Hof, der auf drei Seiten von einem zweistöckigen Gebäude umschlossen wurde. Ein herrlicher großer Lindenbaum breitete sein Äste nach allen Seiten aus. Das Haus wirkte im Schein der Laterne recht ansehnlich.
»Hier ist es ja herrlich!«, rief einer aus der Gruppe. »Schaut nur, die große Tür mittendrin!«
»Aber keine Treppe«, konstatierte Graf Frederik und drehte den Arm des Knechts, so dass der Schein der Laterne auf die Fassade fiel. Nun sah man, dass die breiten Treppensteine fehlten. Ein verrostetes Eisengeländer, das zum Aufgang gehört hatte, stand gegen die Tür gelehnt, die, genauer besehen, nur in einer Angel und schief im Rahmen hing.
»Halt das Licht höher, damit wir besser sehen können«, forderte Frederik den Knecht auf. Es zeigte sich, dass in den Fenstern kaum eine ganze Scheibe war. Einige Simse waren aus den Fugen gedrückt worden, und das Fachwerk zeigte Risse, als hätte das Gebäude kürzlich ein starkes Erdbeben überstanden.
Durch eine kleine Tür gelangten sie in einen schmalen Gang. Wieder stolperten sie über Schutt, Steine und Mauerreste. Dann betraten sie eine Kammer, wo die losen Tapeten buchstäblich im Luftzug wehten. Sie kamen an einem mächtigen Schornstein vorbei, durch den der Wind pfiff. Er war unten geborsten und wurde lediglich durch Balken und Stützen gehalten. Dann liefen sie durch einige verwüstete Zimmer, in denen der Fußboden ganz oder teilweise aufgebrochen war. Einzelne Möbelstücke, Gartengeräte und plumpe, weiß gestrichene Steinfiguren lagen in den Ecken herum.
Endlich kamen sie in einen großen Ecksaal, der nicht ganz so zerstört war. Hier waren die Wände zur Hälfte mit Paneelen versehen. Überall hingen wurmstichige Familienporträts aus der Ritterzeit. Darauf sah man ehrwürdige Damen mit ihrem Hündchen auf dem Arm oder einer großen Tulpe in der Hand, Ritter mit Schwertern und Jagdhunden oder aber Geistliche mit Gesangbüchern, lateinischen Wahlsprüchen und Jahreszahlen. Ein altes Klavier stand mit geöffnetem Deckel mitten im Raum.
»Und noch ein Instrument mitgekauft!«, rief jemand und schlug einen Akkord an. Man hörte die klappernden Tangenten und drei scharrende Saiten. Der Musikus vollführte einen jener komischen Sprünge, die man macht, wenn man fürchtet, das Gleichgewicht zu verlieren. Und so war es, denn vor ihm lag eine alte Tür, die zum Turm. Die Kerze aus der Laterne wurde in eine Flasche gesteckt, die glücklicherweise in dem alten Klavier gelegen hatte.
»Mehr Licht!«, befahl Graf Frederik. »Und bring uns ein paar von deinen Kleidern, Christen. Aber sauber müssen sie sein. Du siehst, wir triefen vor Wasser! Und schaffe so viele Pferdedecken wie möglich und einige Bund Stroh in den Turm, aber alles im Galopp! Das Mädel soll Hühner schlachten und das Beste auftischen, was die Speisekammer hergibt. Aber zuerst muss der Punsch her, damit wir warm werden! Galopp, Christen, Galopp!«
Und es ging im Galopp. Christen brachte seine besten Sonntagskleider und dazu einen großen gefütterten Reisepelz, der Frederiks Vater gehörte. Ein nasses Kleidungsstück nach dem anderen wurde abgelegt; nebenbei leerte man auch die Rucksäcke. Dabei wurde eine Badehose entdeckt, die jemand aus Versehen eingepackt hatte.
»Das ist eine Fügung des Himmels«, meinte unser seekranker Kandidat, der jetzt die Munterkeit selbst war. »Hier herrscht großer Hosenmangel, kleine Beiträge werden mit großer Dankbarkeit angenommen! Ich bin am besten an solche gewöhnt; ich nehme sie und den Pelz dazu. Badehosen und ein Schafspelz, das ist ein gutes Kostüm! Meine gnädigen Damen« – er verbeugte sich vor den Porträts an der Wand –, »Sie entschuldigen doch?« Und er zog sich um. »Die Sonntagskleider soll die Geistlichkeit haben«, erklärte er und zog seinen einzigen und besten Anzug aus dem Rucksack. »Unser guter, ehrwürdiger Mentor muss am menschlichsten aussehen.«
Der Angesprochene war der Älteste in der Runde, der einzige Bürgerliche in dieser kleinen Kameradschaft, ein Holsteiner namens Moritz Nommesen. Er hatte die drei anderen auf das philologische und philosophische Examen vorbereitet, das gerade hinter ihnen lag. Der Anführer des ganzen abenteuerlichen Zuges, Graf Frederik, dessen Vater, wie erwähnt, seine Besitzungen im östlichen Teil Fünens hatte, war von Jugend an daran gewöhnt, im eigenen Boot zu segeln. Als Knabe hatte er Touren nach Alsen und Angeln gemacht und war nach dem Artium mit Ole Hansen zweimal von Kopenhagen in die Heimat gesegelt. Jetzt befanden sie sich auf der dritten derartigen Seereise. Der Mentor war dabei und zwei Gleichaltrige, Baron Holger und Baron Herman, doch die Reise war, wie wir sahen, nicht sehr glücklich verlaufen. Jetzt saßen sie unter einem Dach in trockenen Kleidern; fünf große Talglichter wurden angezündet und in verschiedene Kerzenständer gesteckt. Im Turm wurde aus Stroh und Pferdedecken ein prächtiges Lager zurechtgemacht. Die Punschbowle dampfte, und nach dem ersten Glas tanzten – nicht die Wände, sondern die Freunde im Saal. Draußen strömte der Regen herab, und der Sturm rüttelte an den morschen Wänden.
»Herman«, rief Graf Frederik, »was würde deine Großmutter sagen, wenn sie jetzt zur Tür hereinkäme und dich hier sähe? Sie hat dir doch verboten, nach Fünen zu kommen!«
»Ich kann die Frau nicht verstehen«, meinte der Mentor kopfschüttelnd.
»Sie ist auch schwer zu begreifen«, bestätigte Herman. »Manchmal ist sie etwas … mhm … originell, dann aber wieder lieb und gut. Mit fast allem, was sie tut, beweist sie ihr edles Gemüt; die Armen segnen sie. Nur gegen uns, ihre Nächsten, ist sie etwas hart. Mich zum Beispiel hat sie von Geburt an nicht richtig leiden können.«
»Ja, wenn er von ihr erzählt, dann klingt das ganz gut«, sagte Frederik, »aber verrückt ist sie doch. Entschuldige, ich weiß natürlich, dass sie deine Großmutter ist. In Italien gefiel ihr Guido Renis Bild, das die Fahrt der Beatrice Cenci zur Richtstatt zeigt, so gut, dass sie sich ein Fantasiekostüm machen ließ. Sie trägt Richtstatt-Reisemäntel, Richtstatt-Morgenröcke und Richtstatt-Ballkleider aus Atlasseide; in einem solchen tauchte sie letztes Jahr auf einem der größten Feste auf.«
»Während man sie wegen ihres Aufzugs belächelt, sitzt sie mit allen ihren Dienstmädchen und näht Kleider für die Armen«, sagte Herman.
»Ich finde gar nicht, dass sie verrückt ist«, meinte Baron Holger. »Manchmal macht sie höchst treffende Bemerkungen. Sie sagt den Leuten die Wahrheit ins Gesicht, wenn sie zu ihr kommen. Vor kurzem lud sie die größten Vielfraße zu sich ein – der Pfarrer war auch dabei – und setzte ihnen eine vernünftige Mahlzeit vor. Sie bekamen nur Wassergrütze und Dorsch nebst einem Vortrag, wie schädlich es sei, sich den Magen zu verderben.«
»Das ist ja eine tolle Frau!«, rief der Mentor.
»Ich habe meine Großmutter zehn Jahre nicht gesehen, und es können gut und gern noch zehn Jahre vergehen, bis sie mich hierher ruft, falls sie so lange lebt«, sagte Herman.
»Soll sie leben!«, rief Holger. »Die Originale dürfen nicht aussterben; sie machen Eindruck in der Welt, wie die Uniformen im Theater.«
Er erhob sein Glas, und sie stießen an, aber noch während des Trinkspruchs vernahmen sie einen seltsamen, gleichsam ersterbenden Seufzer. Sie wandten die Köpfe in die Richtung, aus der das Geräusch gekommen war. Keiner sagte ein Wort, denn sie waren überzeugt, dass sie nur den Wind gehört hatten.
Während sie munter weiter feiern, wollen wir einen Augenblick zu der erwähnten Großmutter gehen.
2. Die Grossmutter
Vor achtzig Jahren sah es in Dänemark traurig aus für den armen Bauern; er hatte es nicht viel besser als ein Lasttier. An die Stelle der Leibeigenschaft, die König Frederik IV. aufgehoben hatte, war die Schollenbindung getreten, aber geändert hatte sich nichts. Fast alle Bauern waren bis zum fünfzigsten Lebensjahr zum Kriegsdienst verpflichtet. Viele junge Männer versuchten dem zu entgehen, indem sie sich versteckten. Andere verstümmelten sich, um nicht eingezogen zu werden.
Der Herr des Hofes, auf dem die merkwürdige Großmutter nun lebte, ihr Schwiegervater, war ein ruchloser Geselle gewesen, einer jener barbarischen Gutsbesitzer, von denen die Sagen Schreckliches zu berichten wissen.
Hinterm Tor zeigt man noch immer eine Öffnung, durch die der Bauer in das so genannte Hundeloch hinabgelassen wurde. Dort unten sickerte die Nässe aus dem Wallgraben durch die Mauern. In feuchten Jahren stand der Boden fußhoch unter Wasser, darin tummelten sich Frösche und Kröten. Da hinein steckte man den Bauern, und warum? Oft nur, weil er nicht bezahlen konnte, was er schuldig war für den elenden Acker, den ihm der Gutsherr zugewiesen hatte und für den er seine ererbten Schillinge zusetzen musste. Im Turm lag noch der »spanische Mantel«, den mancher brave Mann hatte tragen müssen. Mitten im Hof, wo jetzt auf einem Stück Rasen Provencerosen blühten, hatte das »hölzerne Pferd« gestanden. Auf dessen Rücken hatte sich der Bauer mit Bleigewichten an den Beinen zum Krüppel gesessen, während der Baron drinnen mit seinen Freunden um die Wette trank oder die Jagdhunde peitschte, so dass sie mit dem Reiter draußen um die Wette heulten.
In jene Zeit, auf jenen Hof und zu jenem Gutsherrn wollen wir uns begeben.
Ein paar zerlumpte Knaben standen herum und glotzten in den Hof hinein. Dort ritt wieder einmal einer auf dem »hölzernen Pferd«, denn »mit Bauernlümmeln konnte es am besten umgehen«. Es war der lange Rasmus, wie sie ihn nannten. Es war ihm einmal gelungen, etwas auf die hohe Kante zu legen, deshalb hatte ihn der Gutsherr gezwungen, einen schlechten, verfallenen Hof zu übernehmen. Rasmus rackerte von früh bis spät, doch es half alles nichts; er konnte die Abgaben nicht zahlen. Also ließ der Gutsherr die gesamte Habe taxieren und Rasmus nebst Frau und Kindern vom Hof jagen. Rasmus beschwerte sich und wurde deshalb ins Hundeloch geworfen. Nach seiner Freilassung überließ man ihm eine Kate ohne Land. Für diesen Schuppen, einen kleinen Kohlgarten und ein zwei Morgen großes Stückchen Hoffeld mussten er und seine Frau sich fast täglich auf dem Gutshof abplagen. An diesem Morgen hatte er geäußert, das Leben sei allzu hart; deshalb ritt er nun auf dem »hölzernen Pferd«. Es bestand aus einem an zwei Pfählen befestigten Brett. Auf dem saß nun der arme Sünder. Sie hatten ihm zwei schwere Mauersteine an die Füße gebunden, damit der Ritt auf dem schmalen Brett noch schmerzhafter wurde.
Eine bleiche, ärmlich gekleidete Frau mit verweinten Augen sprach freundlich mit dem Knecht, der die Aufsicht über den Sünder hatte. Es war die Frau des langen Rasmus. Ihr Mann trug weder Hut noch Mütze; das dichte Haar hing ihm ins Gesicht. Ab und zu schüttelte er den Kopf, wenn ihn die Fliegen zu sehr plagten. Die schweren Mauersteine zogen ihm die Beine nach unten, doch sosehr er sich auch mühte, er konnte sich nicht aufstützen.
Ein kleines, dreijähriges Mädchen, Rasmus’ Tochter, schön wie ein Engel Gottes, kroch im Gras umher. Während sich die Mutter mit dem Wächter unterhielt, näherte sich das Kind dem Vater und schob, aus Instinkt oder auf Anweisung der Mutter, heimlich einen Stein unter den Fuß des Vaters. Das Mädchen hatte schon nach einem weiteren Stein für den anderen Fuß gegriffen und schaute mit seinem klugen, hübschen Gesicht zum Vater hinauf, da stand plötzlich der Gutsbesitzer, der Herr Baron, mit seiner großen Reitpeitsche vor der Tür. Er hatte beobachtet, was vorging, und die Peitsche knallte auf das arme Kind herab, das bei dem Hieb Schmerzensschreie ausstieß. Die Mutter ging dazwischen, doch der Baron gab der Schwangeren einen Fußtritt, dass sie auf das Pflaster stürzte …
Wir verlassen diese abscheuliche Szene – solches geschah in den so genannten »guten alten Tagen« nicht selten – und verraten nur, dass jenes Kind, dessen Hals und Arm von dem Peitschenhieb anschwollen, weil es den Stein unter den Fuß des Vaters geschoben hatte, niemand anders gewesen war als die Großmutter Hermans. Das Mädchen, das der Gutsherr schlug, wurde später seine Schwiegertochter.
Dieses finstere Bild aus der Kindheit lebte noch in den Erinnerungen der alten Frau, die wegen ihrer Originalität von vielen belächelt wurde. Sie selbst herrschte nun schon viele Jahre auf demselben Herrenhof, auf dem ihre Mutter misshandelt worden war, wo ihr Vater im »Hundeloch« gesessen und das »hölzerne Pferd« geritten hatte. Auf die Richtstatt hatte sie die schönsten Rosen pflanzen lassen.
Von dem bösen Gutsherrn ging noch manche Sage um. Beim herrschaftlichen Begräbnis in der Kirche stand sein prächtiger Marmorsarkophag mit goldenen Inschriften, umgeben von Engeln. Er hatte die ganze Pracht noch zu Lebzeiten aus Italien kommen und die Kapelle damit schmücken lassen. In einer wilden, lustigen Laune liefen er und seine Saufbrüder zur Kirche hinüber. Dort setzte er sich in seinen Sarg und brachte Trinksprüche aus, zuerst auf sich selbst, dann auf die Kumpane und zuletzt auf den Teufel – und plötzlich fiel er tot um. Einige meinten, der Schlag habe ihn getroffen, doch die meisten wussten es besser: Der Leibhaftige hatte ihm den Hals umgedreht.
Der einzige Sohn des Gutsherrn war genauso roh und wild wie der Vater, aber nicht so bösartig. Er führte ein zügelloses Leben, war aber zuletzt wirklich verliebt, und zwar in die Pflegetochter des Schulmeisters, eine Schönheit, wie man sie im Land selten fand. Es war die Tochter des langen Rasmus; sie war keck, ausgelassen und rätselhaft, aber tugendhaft. So musste sie der Baron zur Frau nehmen, wenn er sie haben wollte. Freilich wird von bösen Zungen erzählt, dass er sich habe fangen lassen. Er wollte gerade nach Lolland abreisen, um ein adliges Fräulein zu heiraten, da sah er die schöne Dorothea vor der Küsterei. Der Schulmeister lud ihn ein, mit ihm zu trinken, und so kam es, wie es kommen musste. Ein alter Husar, als Pfarrer verkleidet, soll sie getraut haben, aber das sind Lügen und Erfindungen. Das Kirchenbuch zeigt es anders. Fest steht, dass er Dorothea nicht mehr losließ, die nun eine gnädige Frau war. Leider hat er sie nach seiner Art hart und schlecht behandelt.
Sie gebar mehrere Söhne, aber alle starben. Endlich, viele Jahre nach der Hochzeit, brachte sie ein Mädchen zur Welt. Die Tochter wuchs heran und wurde ein stilles Kind. In ihrer Jugend starb der Vater, und nun begann Dorotheas Regiment. Man sagte, dass ihr Leben bis dahin ein Trauermarsch gewesen war; nun ging es mit Pauken und Trompeten vorwärts! Zwar besuchte sie keiner von den hohen Adligen aus der Nachbarschaft, aber sie hatte das Haus trotzdem immer voller Gäste. Im Winter lebte sie munter in Kopenhagen und schloss Bekanntschaft mit Justiz- und Etatsräten, Künstlern und Witwen, die sie für den Sommer auf ihr Gut einlud, wo sie die gnädige Frau spielte. Frau Dorothea war klug, vielleicht hatte sie sogar Genie, doch führte sie ihr Verstand oft auf Abwege. Auch Herz zeigte sie, viel Herz, aber hier führte die Laune das Steuer und machte sie unberechenbar; jedenfalls schien es so.
Sie reiste nach Italien, wurde Kunstkennerin und kleidete sich à la Beatrice Cenci. In den Briefen berichteten unsere Landsleute aus Rom amüsante Anekdoten, in deren Mittelpunkt die Gutsherrenwitwe von Fünen stand. Ein nicht mehr ganz junger Mann, Baron Büncke-Rönnow aus Holstein, der sich damals im Vatikan aufhielt, besuchte die Frau Baronin und ihre hübsche Tochter, von der man sagte, sie habe schon in Kopenhagen Eindruck auf ihn gemacht. Mit einem Mal hieß es, die beiden seien verlobt, und wenig später, eine Hochzeit habe stattgefunden. Im Jahr darauf kehrten alle nach Dänemark zurück. Büncke-Rönnow war nicht der älteste Sohn, erhielt aber eine nicht unbedeutende Summe aus dem Familienvermögen; außerdem war er bei der deutschen Kanzlei angestellt und konnte also, wie man zu sagen pflegt, eine Frau ernähren. Durch den Schwiegersohn kamen nun mehrere erwachsene Söhne aus den ersten Familien in das Haus der Schwiegermutter; sie bemerkten deren Eigentümlichkeiten und sprachen darüber. Bald war sie ein bekanntes und beliebtes Original und lieferte Stoff für die Konversation in den mageren Salons.
Unmittelbar nach der Rückkehr aus Italien brachte die junge Frau einen Sohn zur Welt, der einen dunklen Teint und kohlschwarze Augen hatte – wie ein Italiener. Dieses Kind war Herman, unser junger Kandidat, den wir seekrank im Boot liegend kennen lernten und der nun in Badehosen und Reisepelz vor der Punschbowle hockte.
So innig sich die Eltern auch liebten – in diesem Kind schienen sie sich nicht zu treffen. Man erzählte sich, der Vater habe es, als man es ihm zum ersten Mal zeigte, kalt und wortlos betrachtet. Die Mutter dagegen begegnete dem Kleinen mit stiller Trauer; um ihren Mund spielte stets ein wehmütiger Zug, wenn sie ihn ansah. Dann schüttelte sie mit dem Kopf, als wollte sie lästige Gedanken vertreiben, brach in Tränen aus und küsste das Kind. Nur etwas mehr als ein Jahr behielt es seine Eltern; ein heftiger Typhus raffte den Vater dahin. Die Mutter, die ihn Tag und Nacht gepflegt hatte, wurde dabei selbst angesteckt und starb acht Tage nach seinem Begräbnis.
Die Großmutter ließ ihr Enkelkind sofort wegbringen; es kam zu einer braven Gärtnerfamilie in die Nähe von Odense und blieb dort bis zu seinem neunten Lebensjahr. Der kleine Herman war zu einem hübschen, kräftigen Knaben herangewachsen. In seiner Nähe ging es stets wild und lustig zu, denn er war es gewohnt, frei herumtollen zu können. Aber alle hatten ihn gern, denn er war von Herzen gut. Er zeigte viele Talente; besonders tat er sich beim Zeichnen hervor. Doch es war immer das Komische, das er auffasste und in seinen Skizzen wiedergab.
Nun war er, wie gesagt, neun Jahre alt geworden, und die Großmutter wollte ihn bei sich haben, um ihn »zu einem christlichen Räuber« zu erziehen, wie sie es nannte. Er kam und war drei Tage bei ihr im Haus, aber sie fand, dass er alles nur lächerlich mache und ein kleiner Tunichtgut sei – was wir entschieden verneinen müssen. Deshalb sollte er wieder fort, aber nicht zurück zu der Gärtnerfamilie, denn diese verstehe es nicht, Unkraut zu jäten. »Der Mann mag gut genug sein, Gurken zu säen, und die Madam, Johannisbeeren zu pflücken, aber Galgenkraut können sie nicht veredeln.«
Der väterliche Teil der Familie kümmerte sich nicht um den Knaben, und sein Vormund, der örtliche Pfarrer, folgte in allem der gnädigen Frau. Herman wurde also auf die Schule von Herlufsholm geschickt. Nach einem Jahr wechselte er, nun schon ein schmucker junger Mann, zur Universität. Es war etwas angeboren Ritterliches in seinem Wesen, ein lustig-leichter Sinn und eine nicht geringe Beredsamkeit. Das Talent, komische Bilder zu zeichnen, und seine adlige Abstammung hatten das Interesse Graf Frederiks auf ihn gelenkt. In den akademischen Vorlesungen hatten sie Bekanntschaft geschlossen und diese bei dem gemeinsamen Mentor vertieft. Der dritte junge Freund, Baron Holger, hatte sich ihnen angeschlossen.
Herman wusste, dass die Großmutter acht Tage zuvor nach Holstein gereist war, wo sie mindestens sechs Wochen bleiben wollte. Deshalb hatte er sich von Graf Frederik überreden lassen, die Seereise nach Fünen mitzumachen, wohin er ja sonst nicht kommen durfte. Jeden Monat musste er ihr schreiben, und am Posttag darauf erhielt er regelmäßig einige wenige Zeilen zur Antwort. »Gewiss möchte ich dich eines Tages sehen«, hatte sie neulich geschrieben, »aber ein bisschen können wir beide wohl noch warten. Komm nicht her, bevor ich dich rufe! Es würde sonst ein schales Vergnügen für dich werden.«
So kam Baron Herman nach zehn Jahren Abwesenheit wieder einmal auf seine Heimatinsel. Mit Jagden und Vergnügungen sollten einige Tage verbracht werden. Ein kleiner Ausritt würde am Gut der Großmutter vorbeiführen; dabei wäre wohl ein Blick auf den Hof möglich, ohne dass sie davon Kenntnis erhielt. Es wusste ja keiner, wer er war.
Sie waren mit gutem Wind von Kopenhagen losgesegelt, da sich dieser aber bald gedreht hatte, waren sie am ersten Tag nur bis Jungshoved auf Seeland gekommen. Hier hatten sie die Nacht im Boot verbracht und dann, wie wir wissen, am nächsten Abend Fünen erreicht. Nicht an der gewünschten Stelle, sondern bei dem alten Rittergut, wo wir sie wieder aufsuchen wollen, während sie auf die seligen Frauen und Fräulein trinken, deren wurmstichige Bilder die Damengesellschaft in dem Saal darstellen, wo uns noch in dieser Nacht eine seltsame Begebenheit bevorsteht.
3. Die Studententochter
Herman hatte schon den Bleistift gezückt und ein lustiges Bild in sein Skizzenbuch gezeichnet, das sie alle vier in ihrem seltsamen Aufzug zeigte. Auf der nächsten Seite hatte er sich als seekranken Kandidaten wiedergegeben – eine Zeichnung, die wegen ihrer Ähnlichkeit viel Spaß verbreitete.
Die Unterhaltung hatte eine andere Richtung genommen. Der Wind draußen blies nicht mehr so heftig, dafür regnete es umso mehr. Das Wasser lief in Strömen an den Wänden hinab und über den Fußboden in ein Flussbett, das es sich selbst geschaffen hatte.
Sie erzählten sich Jagdgeschichten. Graf Frederik berichtete so anschaulich von der letzten Dachsjagd, dass Herman meinte, er fühle es ordentlich knistern in den Stiefeln.
»Solche Tiere kann ich schießen!«, fuhr Frederik fort. »Füchse, Marder, große Raubvögel, aber einen Hirsch, ein Reh – nein! Ich bin kein richtiger Jäger. Schon stillzustehen, zu warten, zu lauern und das königliche Wild ankommen zu sehen, wie es so leicht und schwebend vorbeispringt, und ihm dann eine Kugel nachzuschicken, die Hunde darauf zu hetzen, dass sie ihre Zähne in seine braune, glänzende Haut schlagen, die Augen zu sehen, die im Sterben geradezu menschlich blicken – das halte ich nicht aus! Ich habe es gesehen und die Büchse weggeworfen. In den Augen des Tieres lag etwas, was mich beschämte und traurig machte. Nein, Jäger könnte ich nicht werden, aber Seemann, das ist ein freier, stolzer Beruf! Man kämpft gegen Wind und Wellen und beherrscht sie schließlich!«
»Ich dagegen halte nichts davon, mich mit der See zu messen, weder auf die eine noch auf die andere Weise«, erwiderte Herman. »Ich habe von diesen beiden Nächten genug. Jedoch bin ich einmal bei der Seehundjagd dabei gewesen; es war während der Ferien. Was wir für Sachen anhatten! Fast wie heute, aber ich trug lange Stiefel. Es war früh am Morgen, neblig und kalt; wir segelten zu sechst in einem großen Boot hinaus. Jeder von uns wurde im Abstand von hundert Metern auf einem der großen Steine ausgesetzt, die dort im seichten Wasser lagen. Es war ein seltsames Gefühl, so allein auf einem Stück Felsen zu hocken, das ganz glitschig war von den Leibern der Seehunde. Überall lag Seetang; ich konnte mich gut hinausdenken in das wilde Meer. Das Wasser schwappte gegen den Stein; ab und zu bellte ein Seehund hohl und hässlich. Mit einem Mal plätscherte es dicht neben mir. Ich lag ganz still auf dem Bauch; der Wind blies mir direkt ins Gesicht. Plötzlich tauchte der Seehund vor mir auf, genau vor meinem Büchsenlauf! Ich drückte ab. Das Ganze dauerte nur einen Augenblick, aber ich hatte in seine großen, braunen Augen gesehen und fühlte mich, als hätte ich einen Menschen erschossen.«
»Ich bin sicher, dass der Seehund mit seinen klugen Menschenaugen Anstoß zu der Sage vom Seemann und der Meerfrau gegeben hat. Wenn ich als Knabe unter den Bäumen am Strand lag, sah ich sie oft auftauchen, oft wenn das frische Seegras einem solchen Tier über dem Kopf hing, sah es wirklich aus wie ein Mensch ...«
Er verstummte plötzlich und schaute zum Nebenzimmer hinüber. Die anderen folgten seinem Blick. Alle hatten denselben Gedanken und dieselben Worte: »Wir sind hier nicht allein!«
Graf Frederik griff nach einer Kerze. »Es ist noch nicht Geisterstunde«, stellte er fest und schaute auf seine Uhr. »Gerade mal elf Uhr! Schnappt euch jeder eine Kerze; die Hälfte wird der Zugwind sowieso ausblasen.«
Deutlich hörte man ein Wimmern – es konnte ein Kleinkind, aber auch eine Katze sein. Die Tür klemmte, doch ein Fußtritt genügte und sie standen in einem völlig leeren Raum; der Wind ließ die Kerzen flackern. Die Tür zum nächsten Zimmer war ausgehängt und quer vor den Eingang gestellt. Von dort kam das Weinen; sie leuchteten hinein. Die Wand zum Garten war halb niedergerissen. In einem Winkel lag auf einem dürftigen Lager aus Erbsenstroh und Tapetenfetzen ein Mensch – eine Frau, die sich bei ihrem Kommen aufrichtete und ihnen ein nacktes kleines Kind entgegenhielt.
Graf Frederik war der Vorderste. Er stutzte, da sank die Frau mit einem Seufzer zurück, so dass ihr das Kind auf die Brust fiel. In diesem kurzen Moment hatte sie Frederik mit einem Blick angesehen, der tiefer und stärker war als der des verwundeten Wildes, von dem er soeben berichtet hatte.
»Jesus!«, rief er. Das Kind quäkte; die Mutter war tot oder besinnungslos. Sie hoben ihre Arme an; sie fielen kraftlos zurück.
»Das ist ein neugeborenes Kind«, stellte der Mentor fest. »Das arme Kleine! Und die Mutter krepiert hier in Wind und Wetter!« Schnell eilte er davon, holte einige der Decken, die für ihr Nachtlager bestimmt gewesen waren, und breitete sie über die Frau.
»Wer mag sie sein?«, überlegte Frederik. »Wir müssen einige von den Leuten herbeiholen und sie in ein Bett bringen lassen. Ich gehe selbst; von euch findet sich hier im Dunkeln sowieso keiner zurecht.« Und er lief sofort los.
»So ein armes Kind«, rief nun auch Herman, nahm das Kind aus den leblosen Armen der Mutter und hüllte es in seinen Reisepelz. »Ich hätte es mir nicht träumen lassen, heute Nacht noch zur Amme zu werden! Wahrscheinlich war es die Mutter, die wir jammern hörten, als wir übers Feld stapften.«
Und so war es auch. Die Schwangere hatte sich, als sie in dem schlechten Wetter unterwegs war, immer elender gefühlt und Zuflucht in dem leer stehenden Haus gesucht. In dem dunklen Winkel, auf Tapetenresten, hatte sie ihr Kind geboren. Die jungen Männer packten die Leiche – denn tot war sie – und trugen sie in den Saal, wo sie um die Punschbowle herum gesessen hatten. Sie hofften noch, dass die Frau nur bewusstlos wäre.
Graf Frederik kehrte mit Christen und einigen anderen Dienstboten zurück.
»Das ist die Frau des Musikanten, der den Leierkasten dreht und die Rohrflöte bläst, die oben in seinem Halstuch steckt«, erklärte Christen. »Die Frau ist noch sehr jung; sie schlug die Triangel und sang Lieder. Ich hörte ihr neulich zu, als sie hier auftraten, und sah, wie es um sie stand. Und nun ist sie tot und dahin.«
»Nein, nein«, sagte Frederik. »Lass sie uns in den Turm auf das Strohlager bringen, wo wir übernachten wollten. Dann schwingst du dich aufs Pferd, reitest, was das Zeug hält, und holst Madame Sørensen aus Qværndrup!«
»Aber die Frau ist doch tot, Herr Graf«, erwiderte Christen. »Ihre Hände sind ja schon ganz kalt.«
»Tu, was ich sage!«
Und Christen musste, obwohl es ihm gar nicht gefiel, aufs Pferd und zur Madame reiten, die hier gar nicht mehr helfen konnte.
Die Tote wurde im Turm auf das Strohlager gelegt und gut zugedeckt. Das Kind übergab man einer der Melkerinnen, die es mit ins Bett nehmen sollte; so lautete die Anweisung.
»Ja, nimm es mir ab«, sagte Herman erleichtert, als er das Kind übergab. »Sonst geht es noch in Stücke. Es sieht ja aus wie ein kupferroter Indianer.«
Das Kleine war ein Mädchen.
»Wir werden wohl alle bei ihr Pate stehen müssen«, meinte Herman. »Wenn uns die Jungfrau nur später keine Schande macht! Von einer jungen Dame, die das erste Mal ins Haus kommt und schon am Herzen eines Kavaliers in Badehosen liegt, kann man nicht viel erwarten.«
»Am Vaterherzen darf sie wohl ruhen«, scherzte Holger.
»Ich will nicht ihr Vater sein. Ihr habt genauso viel Anteil an der Geschichte wie ich«, konterte Herman. »Aber ich leiste gern meinen Teil zu einer christlichen Erziehung.«
»Habt ihr gesehen, wie die Mutter mich angeschaut hat?«, fragte Frederik.
»Ja, dir hat sie ihr Kind anvertraut! Da wir aber daneben standen, wollen wir auch unseren Teil an der Last tragen. Herman will seinen Beitrag leisten, ich auch – was sagt unser Mentor? Wir sind heute Abend zu einer Patenschaft gekommen. Aber wer sorgt dafür, dass die Kleine in gute Hände kommt, wer wird wie ein Vater für sie sein? Einer von uns jedenfalls. Lasst uns Strohhalme ziehen!«
Und sie zogen.
»Der Mentor hat den kürzesten! Also ist sie die Tochter des Mentors. So soll sie getauft werden!«
»Nein, Studententochter!«, schlug Moritz vor.
»Gut! Studententochter, das ist ein passender Name! Du bist ihr Vormund.«
»Aber wenn sich nun der richtige Vater meldet!«
»Das mag er tun, doch ich glaube nicht daran. Jetzt lasst uns aber zur Ruhe gehen, damit wir morgen bei besserem Wind und Wetter weiterkommen. Gute Nacht! … Ha, die Studententochter! Ein Hoch auf ihren Vormund! Sie mögen leben …« Und sie erhoben ihre Gläser und stießen mit dem Mentor an.
»Nein«, sagte dieser. »Wenn schon auf mein Wohl getrunken wird, dann lieber – ja, warum soll es ein Geheimnis bleiben? – auf meine Verlobung!«
»Verlobung? Sie haben sich verlobt?«, riefen alle durcheinander.
»Ja, vorgestern Abend, eine Stunde, bevor wir lossegelten. Daher meine Tapferkeit an Bord – ich dachte an meine Braut, deshalb lächelte ich, und nicht über die hohen Wellen, wie Sie dachten. Sie hat ausdrücklich gewünscht, dass ich mitsegle, wie es verabredet war – ich wäre, ehrlich gesagt, am liebsten zu Hause geblieben.«
»Das kann man gut verstehen«, meinte Frederik. »Aber wer ist die Glückliche?«
»Caroline Heimeran, die Tochter des Etatsrats.«
»Was – die? Nun wird mir alles klar! Sie hatte vergangenes Jahr ein Theaterabonnement für den Dienstag – deshalb mussten Sie alle Dienstagsstücke sehen!«
»Jetzt schreiben Sie sicher gleich nach Hause, dass Sie eine Tochter bekommen haben!«, lachte Herman. Wieder klangen die Gläser und ein dreifaches »Hoch!« ertönte dicht neben der toten Frau.
Eine Stunde später lagen alle vier ausgestreckt auf Decken und Strohbündeln und schliefen gesund und ruhig, trotz der zweitägigen Seereise und der Begebenheit dieses Abends. Sie schliefen, ohne zu träumen, mit Ausnahme des Mentors; vor ihm schwebte das Bild eines jungen, lebhaften Mädchens, fein gebaut und mit einem bezaubernden Lächeln. Mit ihren braunen Augen schaute sie ihm in die Seele hinein – das war seine Liebste, Caroline Heimeran.
4. Der Kammerjunker
Am nächsten Morgen war herrlich klares Wetter; der Himmel sah aus wie frisch gefegt. Die Freunde wanderten zum Strand. Ole machte das Boot klar, und mit gutem Seitenwind ging es rasch an der Küste entlang zum Svendborgfjord.
»Hier beginnt der Archipel unserer nordischen Mythologie«, erklärte Frederik.
»Wie kommen Sie darauf?«, fragte der Mentor.
»Hier liegt Fünen, wo Odin wohnte. Wir könnten einen Tag nach Odense fahren, Odins alter Stadt. Gleich erreichen wir die Insel Taasinge, die von Thor erzählt. Dort drüben liegt Thyrö, wo Balder Thora schlug.«
Sie fuhren bald in den Sund hinein, der hier so eine Ausdehnung hat wie der Rhein an seiner breitesten Stelle, doch ist das Wasser mehr durchsichtig-grün. An malerischen Buchten vorbei geht der frische Strom durch Eichen- und Buchenwälder.
»Hier tummelten sich Svend Tveskjaeg und Palnatoke und schlugen sich die Stirnen blutig; hier zogen die Wikinger des Nordens durch, unsere Argonauten. Sehen Sie dort hinter den Bäumen St. Jørgens Hof und Kirche? Dort kämpfte er gegen den Lindwurm. Die Schlange wohnte in Nyborg; sie kroch übers Land und forderte täglich ihr Opfer. Einmal fiel das Los auf die Tochter des Königs, aber der Ritter St. Jørgen befreite sie. Auch der Norden hat seinen Perseus und seine Andromeda.«
»Aus dem Griechischen übersetzt«, spottete der Mentor.
»Nein, ursprünglich, aus der Erde entsprungen«, meinte Holger und lächelte. »Lassen Sie es sich von den Bauern hier erzählen: Große unterirdische Kupfertore werden immer mitternachts auf- und zugeschlagen, Irrlichter brennen über versunkenen Schätzen. Sie werden auf den Feldern Fünens Steine sehen, die so groß wie Häuser sind – sie wurden von Hexen von den hohen Ufern Taasinges über den Sund geworfen. Ja, wir segeln hier gerade hinein in das Land der Sagen! Bald sehen Sie Lindø; die Insel war einst mit dichtem Wald bewachsen. Doch da war einmal ein Schiffer, der, als er von zu Hause fort ging, von seiner Mutter lernte, die Winde zu entfesseln. Als er wieder heimwärts segelte, konnte er es nicht erwarten und löste einen Sturm aus, der den ganzen Wald von Lindø wegwehte. Man sieht ja, dass die Geschichte wahr ist, denn auf der Insel ist noch immer kein Baum zu finden.«
»Jetzt sehe ich meinen Baum!«, rief Frederik. Das Boot steuerte auf eine mit Buschwerk bewachsene Landzunge zu, auf der ein hoher alter Baum stand. Er war nicht eingegangen, doch durch den Wind fast blattlos. Tausende Vögel stiegen von seiner Krone auf, als unsere Gesellschaft an Land ging. Ganz in der Nähe ergriff ein prächtiger Hirsch die Flucht, so leicht, so schwebend; ein Hase stob in der entgegengesetzten Richtung davon. Alles deutete darauf hin, dass man sich in einem Paradies für Jäger befand.
Durch das hohe, vom Regen der vergangenen Nacht noch nasse Gras wanderten sie zum Waldhaus hinüber, wo Eiler mit seiner Frau wohnte. Die beiden Alten kümmerten sich um das Wild, das in den Einhegungen lebte. Ihre ganze Welt war diese Landzunge, ihre Hauptstadt der Herrenhof, den sie zwei Mal im Jahr besuchten. Von der wirklichen Welt erfuhren sie nichts, es sei denn, ihr Sohn Hans, der auf dem Gut diente, erzählte ihnen, was er aus der Zeitung erfahren hatte – aber das vergaßen sie immer gleich wieder. Hans, der zufällig gerade bei seinen Eltern war, lief der jungen Gesellschaft entgegen. Die alte Frau zog ihre Holzschuhe aus und stand mit bloßen Strümpfen auf dem gepflasterten Fußboden.
»Warum tun Sie das, Mutter?«, fragte Frederik.
»Ehre, wem Ehre gebührt«, antwortete sie und lächelte verschmitzt. Dann breitete sie ihren Rock über den einen Stuhl und das Hemd ihres Mannes über den anderen und bat die Herrschaften, Platz zu nehmen.
Es sei ein großes Glück für den Grafen, dass er ihren Sohn hier treffe, erklärte sie; nun könne er gleich erfahren, wie es auf dem Gut stehe. Er sei gekommen, um Anna Lisbeth, die Schwester, zu trösten. Sie sei etwas über ein Jahr mit einem Seemann verheiratet gewesen, der ein Schiff für den Agenten in Faaborg geführt habe. Er sei durch eine Sturzsee weggespült worden; dazu habe Anna Lisbeth noch ihr kleines Kind in diesen Tagen verloren.
»Da haben wir doch eine Amme für die Studententochter«, meinte Holger. »Das trifft sich ja ausgezeichnet, wie arrangiert. So etwas passiert im wirklichen Leben; liest man es in Büchern, macht man seine Bemerkungen darüber.«
»Was sind denn für Fremde zu Hause?«, erkundigte sich Graf Frederik.
»Ja, der Kammerjunker ist jetzt angekommen, der jeden Abend etwas zu waschen hat, obwohl er in Lederhemd und Kragen herumläuft«, berichtete Hans. Dabei lachte er pfiffig.
»Was, der ist hier? Dann wird er sich für mehrere Monate festbeißen, der weiß unsere Gastfreundschaft zu schätzen. Er gehört zu den Leuten, die immer die Vornehmen spielen, obwohl sie fast verhungern. Sein ganzes Streben war darauf gerichtet, Kammerjunker zu werden.«
»Warum lässt er waschen, wenn er doch ein Lederhemd trägt?«, fragte Holger neugierig.
Hans, der an den Gesichtern ablas, dass er weitersprechen durfte, erklärte:
»Er hat so wenig Sachen dabei, dass er sie täglich in die Wäsche geben muss. Immer gibt er dem Koffer die Schuld; es gehe so wenig hinein. Zu uns ist er immer sehr nett; nur beim Trinkgeld spart er. Aber dafür bekommen wir ja die Höflichkeit.« Hans grinste.
»Und wer noch?«
»Der Kriegsrat von Odense mit seiner Frau.«
»Das ist vielleicht ein Paar!«, rief Frederik. »Er ist einmal sechs Wochen im Ausland gewesen und hat als Kurier einen Teil von Norddeutschland bereist. Einen halben Tag war er in Hannover, drei Stunden in Braunschweig, aber dann anderthalb Tage in Kassel. Von dieser Reise erzählt er nun, dass man glauben könnte, er wäre zwanzig Jahre außer Landes gewesen. Entweder hat er Leute getroffen, die mit den berühmtesten Männern nahe verwandt waren, oder er ist mit einer Person gereist, die diesem oder jenem so ähnlich sah, dass er der Betreffende wohl selbst gewesen sein musste. Ja, er schwört fast darauf, dass er mit Napoleon auf einem Floß den Rhein hinabgefahren ist. Am lustigsten ist: seine Frau hat die Berichte so oft gehört, dass sie aushelfen kann, wenn er mal ins Stocken gerät. Er ist ein moderner Gert Westphaler, von Kopenhagen nach Mainz. Die meiste Zeit während der sechs Reisewochen hat er im Postwagen und auf Landstraßen zugebracht. Trotzdem sind ihm, wie gesagt, die berühmtesten Personen begegnet: Napoleon, Lavater und Frau Krüdener. – Und das ist die ganze Gesellschaft?«
»Frau Bager aus Middelfart …«
»Na, wenigstens ein vernünftiger Mensch! Mehr nicht? Nun, dann wollen wir aufbrechen. Zamora, bei Fuß!«, rief er und pfiff. Ein prächtiger Jagdhund schoss auf ihn zu und sprang an ihm hoch. Dann wälzte er sich auf dem Boden, wedelte mit dem Schwanz und sprang erneut in die Höhe, um sich streicheln zu lassen. Schließlich preschte er in Richtung des Hofes davon, um kurz darauf zurückzukehren und die Begrüßungszeremonie zu wiederholen.
»Zamora ist gar nicht mit den Spaniern verwandt«, erklärte Frederik, »aber er soll einem Jagdhund ähneln, den mein Vater von Zamora bekam und der, als die Spanier aufbrachen, bei Nyborg mit an Bord schlich.«
Durch eine Reihe stattlicher Linden schimmerten jetzt die Nebengebäude des Hofes, von einer roten Mauer so schmuck eingefasst, als wären sie gerade erst errichtet worden. Die Inschriften und eisernen Jahreszahlen verrieten jedoch, dass sie bereits dreihundert Jahre alt waren. Die Dächer waren frisch gedeckt, und auf der Spitze des Giebels drehte sich ein vergoldeter Wetterhahn. Als die Freunde sich näherten, bog ein Reisewagen ins Tor ein, aber Hans kannte weder diesen noch die Livree.
Auf dem gut gepflasterten Hof wuchsen Aprikosen und Pfirsiche an der mit einem Holzspalier versehenen weißen Stallmauer.
Mehrere Diener des Gutes standen vor dem Wagen und beobachteten, wie Graf Frederiks Vater zwei Damen, offenbar Mutter und Tochter, heraushalf. Erstere konnte man wegen ihrer stolzen Haltung, der edlen Züge und der braunen, funkelnden Augen noch immer als eine Schönheit bezeichnen. Die Tochter war das genaue Abbild ihrer Mutter, nur in feinerer Form; hier zeigte sich die Jugend in ihrer ganzen blühenden Frische.