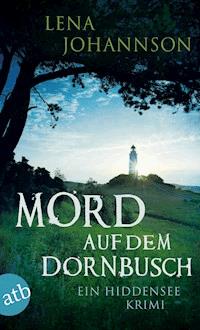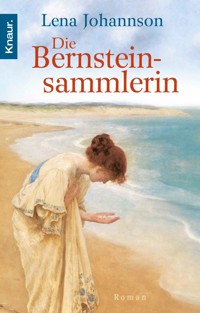
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Lübeck 1806: Die Thuraus sind eine Familie, die durch den Handel mit Wein reich und mächtig geworden ist. Ihre Tochter Femke aber, deren meeresgrüne Augen schon so manchen fasziniert haben, zaubert aus dem Bernstein, den sie am Ostseestrand sammelt, wahre Meisterwerke, denen man sogar magische Fähigkeiten nachsagt. Als die Familie aufgrund der Bedrohung durch Napoleons Truppen in wirtschaftliche Bedrängnis gerät, ist es Femkes Talent, das den Thuraus das Überleben sichert. Femke ahnt nicht, dass sie ein Findelkind ist und dass ein dunkles Geheimnis in ihrer Herkunft sie mit dem Stein verbindet, der ihr Schicksal ist … Die Bernsteinsammlerin von Lena Johannson: im eBook erhältlich!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 647
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Lena Johannson
Die Bernsteinsammlerin
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Lübeck 1806: Die Thuraus sind eine Familie, die durch den Handel mit Wein reich und mächtig geworden ist.
Ihre Tochter Femke aber, deren meeresgrüne Augen schon so manchen fasziniert haben, zaubert aus dem Bernstein, den sie am Ostseestrand sammelt, wahre Meisterwerke, denen man sogar magische Fähigkeiten nachsagt.
Als die Familie aufgrund der Bedrohung durch Napoleons Truppen in wirtschaftliche Bedrängnis gerät, ist es Femkes Talent, das den Thuraus das Überleben sichert. Femke ahnt nicht, dass sie ein Findelkind ist und dass ein dunkles Geheimnis in ihrer Herkunft sie mit dem Stein verbindet, der ihr Schicksal ist …
Inhaltsübersicht
Widmung
Karte
Prolog
I
II
III
IV
»Und, hat Monsieur Deval [...]
V
Danksagung
Meinem Vater, der mir eine große Portion Fleiß und wohl auch das sensible Gemüt vererbt hat
Prolog
3. Juni 1583. Ein kräftiger Wind fegte von Osten her auf die Küste des Samlandes zu. Auf der See tanzten Schaumkronen. Die Sonne hatte schon ungewöhnlich viel Kraft für diese Jahreszeit. Sie wärmte die Männer angenehm, die bis zur Hüfte im kalten Wasser der Ostsee standen und ihre Netze an langen Stöcken durch die Fluten führten. Es war ideales Wetter zum Bernsteinfischen. Der Wind ließ die Weizenfelder unter dem intensiv blauen Himmel auf und nieder wogen wie ein zweites Meer, dessen Wellen aus Halmen niemals den Strand erreichen konnten. Rote Mohnblüten und blaue Kornblumen leuchteten hier und da auf. Möwen flogen ein paar Meter und ließen sich dann von den Böen tragen. Die dicken Taue an den beiden Galgen sausten durch die Luft und knallten wie Peitschen. Wieder und wieder schlugen sie laut gegen das massive Holz. Die Galgen dienten nicht etwa nur der Abschreckung, sie wurden ohne großes Zögern genutzt, wenn einer sich ohne Pass an den Strand vor Königsberg wagte. Oder schlimmer noch, wenn einer Bernstein sammelte und für sich behielt, um zum eigenen Vorteil Handel damit zu treiben. Der wurde an Ort und Stelle aufgeknüpft.
Nikolaus stolperte voran. Es war kein gutes Vorwärtskommen in dem weichen Sand mit den schweren nassen Stiefeln an den Füßen. Als wäre der Teufel leibhaftig hinter ihm her, blickte er sich immer wieder um, rannte dabei weiter und strauchelte mehr als einmal, ja, wäre sogar fast gefallen. Doch es gelang ihm, sich mit den Armen rudernd zu fangen. Wieder ein Blick zurück. Noch konnte er die Männer mit ihren Netzen sehen und den kleinen Holzverschlag, in dem sie die Steine lagerten, die sie dem Meer abgerungen hatten. Genau wie sie hatte auch er eben noch im Wasser gestanden, sein Netz langsam darin bewegt und die gefundenen Brocken zusammen mit Algen und allerlei Unrat in den Beutel gestopft, den er über der Schulter trug. War der endlich ausreichend gefüllt, stapfte man an Land, hieb den Stock des Siebes kräftig in den Sand, so dass er dort steckenblieb, und lud die Fracht aus dem Beutel in den kleinen Unterstand. So hatte auch Nikolaus es gemacht. Stunde um Stunde. O ja, er hatte sehr wohl einen Pass, um die samländische Küste betreten zu dürfen. Er durfte das Gold der Ostsee auch fischen oder sammeln. Er musste es sogar, denn es war die Pflicht der Küstenbewohner. Dafür bekamen sie Salz, das für die Vorratshaltung unerlässlich war und sich gut verkaufen ließ. Wie so viele andere lebte Nikolaus vom Fischen und Sammeln des Bernsteins. Nur behalten durfte er keinen noch so kleinen Splitter. Auf Unterschlagung stand der Tod. Nikolaus fürchtete den Tod. Er fürchtete die Danziger Kaufmannsfamilie, die vom Staat als Generalpächter der preußischen Strände eingesetzt war, und deren Häscher. Er war kein Held und riskierte sein Leben gewiss nicht leichten Herzens. Aber war das überhaupt ein Leben, was er und seine Familie hatten? Arm und elend und herumkommandiert von anderen. Wie die meisten Männer, die täglich die Strände absuchten oder Bernstein aus dem Wasser holten, hatte er bisher nur sehr kleine Exemplare »versehentlich« in seinen Stiefel fallen lassen. Alle paar Tage mal einen Stein – das war ein überschaubares Risiko. Ansonsten war er stets gehorsam gewesen und unauffällig, führte mit seiner Frau und seinen fünf Kindern ein bescheidenes Leben und hätte nie auch nur daran gedacht, sich gegen den Staat aufzulehnen – bis zu dem Moment, als er diesen dunklen rötlich braunen Bernstein aus seinem Sieb fischte. Ein Stück von solcher Größe hatte Wert, das wusste er. Oft ging einem so ein Fang nicht ins Netz. An einer Stelle war die dünne Kruste abgeplatzt, und aus der Tiefe des geheimnisvollen Edelsteins blickte Nikolaus ein bronzefarben schimmerndes Auge an. Gebannt starrte er auf den Klumpen in seiner Hand.
»Heda, bist du etwa versteinert?«, rief einer der Fischer.
Die anderen schauten nun auch zu Nikolaus herüber. Er musste ein sehr verwirrtes Gesicht gemacht haben, denn sie lachten ihn aus.
»Ausruhen kannst du später bei deinem Weib! Spute dich!«, riefen sie gegen den tosenden Sturm.
Nikolaus hatte den Bernstein mit dem Einschluss rasch in seinen Lederbeutel gleiten lassen. Kurz danach war er aus dem Wasser gewatet, voller Aufregung und mit dem Gefühl, das Auge könne ihn durch das Leder anstarren. Allein in dem windschiefen Holzverschlag, wo schon der Ertrag des Tages auf kleinen Haufen lag, wagte er es, seinen Fund eingehend zu betrachten. Kein Zweifel, der Kopf einer Eidechse war vor Tausenden von Jahren, in einer Urzeit, die Nikolaus sich nicht vorzustellen vermochte, in diesen Stein geraten. Jede Schuppe konnte er erkennen, die Struktur der Haut des Reptils war bis ins kleinste Detail erhalten. Selbst die Zungenspitze, die einmal blitzschnell Insekten gefangen hatte, war sichtbar. Wie schon so oft war Nikolaus fasziniert. Die Eidechse sah aus, als hätte sie gestern noch gelebt, als wäre sie soeben erst den Baum hinaufgehuscht. Wie nur war es möglich, dass ein Tier von einem Edelstein gefangen wurde? In dem engen Lagerraum war es stickig. Die Sonne brannte auf das Dach herunter. Nikolaus begann zu schwitzen. Er strich sich eine Strähne seines roten Haares aus dem Gesicht. Das Auge des Tieres war erhaben und glänzte metallisch wie der Kopf eines Nagels. Nikolaus hätte nicht einmal sagen können, in welche Richtung das Tier geschaut hatte, als es in die tödliche Falle gegangen war. Trotzdem hatte dieses Auge etwas Lebendiges, etwas, das ihn vollkommen in seinen Bann schlug.
Wie viel von diesem Tier mag ans Tageslicht kommen, wenn der Bernstein erst geschliffen ist?, fragte sich Nikolaus. Vielleicht war das der Moment, in dem er beschloss, diesen Brocken nicht ordnungsgemäß abzuliefern. Er selbst wollte derjenige sein, der die glanzlose Kruste vollständig entfernte, der den Stein so lange schliff und polierte, bis das eingeschlossene Tier vollends zum Vorschein kam. In Königsberg war die Verarbeitung des Ostsee-Goldes verboten. Bernsteindreherzünfte gab es in Lübeck, Brügge oder eben Danzig. So hatte Nikolaus die Bearbeitung des weichen Materials nie gelernt. Er hatte nur selbst immer wieder ein paar Versuche gemacht, bis er eine recht ordentliche Fingerfertigkeit erlangt hatte.
Während er jetzt den festen Sandweg erreichte, auf dem er schneller vorankam, fragte er sich, was nur in ihn gefahren war. Wenn er schon ein so kostbares Stück unterschlagen musste, warum hatte er es dann nicht wie sonst auch in den Schaft seines Stiefels gleiten lassen? Warum hatte er nicht weitergearbeitet und war dann, zusammen mit den anderen Männern, ganz ruhig nach Hause gegangen? Aber nein, vollkommen kopflos machte er sich aus dem Staub. Es würde nicht lange dauern, bis die Strandreiter, die sicherstellten, dass nur Pass-Inhaber nach Bernstein suchten, auf ihn aufmerksam wurden.
Nikolaus blinzelte gegen den Schweiß an, der ihm brennend in die Augen lief. Er schmeckte das Salz auf seinen Lippen und bemerkte, wie durstig er war. Je länger er darüber nachdachte, desto wütender wurde er wegen seines törichten Verhaltens. Einen Bernstein von dieser Größe, in dem auch noch eine Eidechse eingeschlossen war, konnte er schwerlich einfach auf dem Markt anbieten. Kleine gewöhnliche Exemplare wurde man immer unter der Hand los, oder man verbrauchte sie eben selbst, um daraus heilsames Pulver zu machen oder sie anstelle teurer anderer Stoffe zu verbrennen. Doch diesen Klumpen mit seinem kostbaren Bewohner zu versilbern war für Nikolaus, der weder reiche Leute noch Halunken kannte, nahezu unmöglich.
Es knisterte und knackte in den Weizenfeldern zu seiner Linken und Rechten. Nikolaus sah sich um, versuchte gegen das grelle Licht Gestalten auszumachen, aber niemand schien in der Nähe zu sein. Es war der Wind, der die Halme wispern ließ. Fast wäre er über einen Ast gestolpert, der quer auf dem Weg lag. Keuchend vor Anstrengung, Aufregung und Hitze, verlangsamte er seine Schritte. Bis zu seiner Hütte war es nicht mehr weit. Er wusste nicht, was er mit seinem Fund anstellen sollte. Er wusste nur, dass er ihn in Sicherheit bringen, sich dann eine glaubhafte Erklärung für sein höchst merkwürdiges Fortlaufen einfallen und möglichst viel Zeit vergehen lassen musste, ehe er den Bernstein wieder zur Hand nehmen konnte. Endlich sah er das einfache kleine Haus, in dem er mit seiner Familie lebte. Er wurde wieder schneller. Da erkannte er eine Gestalt vor dem Häuschen. Es war seine Frau, die sich gerade anschickte, zum Strand zu gehen. Es war üblich, dass Frauen und manchmal auch die Kinder dabei halfen, den Bernstein einzusammeln. Sie lasen ihn vom Strand auf oder leerten die Netze der Männer und gaben darauf acht, dass sich im Tang kein Stein verbarg, den man womöglich wieder ins Meer werfen könnte. Hastig stolperte Nikolaus auf sie zu. Sie blieb stehen, als sie ihn sah, und wich sogar einen Schritt zurück, erschrocken über seine Anwesenheit um diese frühe Stunde und über seinen Anblick – glühend rote Wangen, Haarsträhnen, die im Gesicht klebten, und fast fiebrig glänzende Augen. Dann war er bei ihr.
»Ich habe eine große Dummheit begangen, Frau, aber ich konnte nicht anders.« Er zog den Bernstein unter seinem zerschlissenen Hemd hervor und hielt ihn ihr entgegen. Sie gab keinen Laut von sich, schlug sich nur die zur Faust geballte Hand vor den Mund. Natürlich war ihr klar, was das bedeutete. »Es ist ein magischer Stein, Frau. Die Eidechse hat mich verzaubert.«
Schnell lauter werdender Hufschlag kündigte das Unheil an, das über Nikolaus’ Familie kommen würde.
»Hier, du musst ihn verstecken!« Nikolaus griff nach der rechten Hand seiner Frau, presste den Brocken hinein und schloss ihre Finger darum. »Ich werde sie ablenken. Vielleicht kann ich ihnen entkommen.« Damit ließ er seine Frau stehen und rannte den beiden sich rasch nähernden Reitern zunächst einige Schritte entgegen. Dann bog er ab und schlug sich in ein Weizenfeld.
Vom Rücken der Pferde war es leicht, ihn auszumachen. Einer der Reiter lenkte sein Tier vom sandigen Pfad direkt in das Feld, um dem Flüchtigen den Weg abzuschneiden. Nikolaus’ Frau wusste in dem Moment, dass er keine Chance hatte. Sie lief nicht davon. Sie presste nur die Fäuste vor die Brust und ließ den unterschlagenen Stein in den Ausschnitt ihres einfachen derben Leinenkleides fallen. Sie spürte, wie er zwischen ihren Brüsten hindurch zu ihrem Bauch rutschte. Wie sie gehofft hatte, blieb er an der Kordel, die um ihre Taille lag, hängen, anstatt durch den Rock zu sausen und zwischen ihren Füßen auf den Sand zu schlagen. Sie presste die linke Faust auf die Stelle, an der die Beute ihres Mannes vermutlich den Stoff des Kleides ausbeulte. Mit der rechten Hand rieb sie nervös die linke und starrte den Kerl an, der sein Pferd direkt vor ihr zum Stehen gebracht hatte. Eine geschmeidige Bewegung, ein schneller Sprung, schon stand er neben dem Tier. Staub wirbelte um seine schwarzen Schuhe auf, während er die Zügel an einem Apfelbaum befestigte.
»Er wird nicht weit kommen«, stellte der Scherge ruhig fest. »Besser, du gibst mir, was er unterschlagen hat.« Seine Stimme klang nicht böse, nicht einmal streng. Fast schwang ein wenig Bedauern darin mit, als ob er es nicht guthieße, dass die Küstenbewohner die Arbeit machten und andere daran verdienten.
Nikolaus’ Frau rührte sich nicht. Sie stand wie festgewachsen und rieb unablässig die Faust, die sie vor den Bauch gepresst hielt, als wäre ihr nicht wohl.
»Aber er hat doch nicht … Er würde niemals …«, stammelte sie leise.
»Mach es mir doch nicht so schwer«, sagte der Handlanger des Generalpächters seufzend. Er schob sie beiseite und ging mit schweren Schritten auf das Haus zu.
»Warten Sie!«, schrie sie. »Bitte! Da drinnen ist doch nichts. Nur die Kinder sind da. Bitte, tun sie meinen Kindern nichts!« Sie rannte an ihm vorbei, die linke Hand noch immer vor den Leib gepresst, und erreichte den Eingang der Hütte vor dem Mann.
In dem Moment waren wieder Hufe zu hören, die im langsamen Trab den Sandweg heraufkamen. Der andere Reiter näherte sich. Im Schlepptau hatte er den gefesselten Nikolaus, der schwitzend neben dem braunen Hengst herlief. Blut lief aus einer Wunde an der Schläfe über sein Gesicht, das von einem Gemisch aus Staub, Schweiß und Blut verdreckt war.
»Da ist der Dieb«, rief der Blonde, noch immer hoch zu Ross, seinem Kameraden zu. »An den Galgen mit ihm. Und bring das Weib auch gleich mit.« Er musterte Nikolaus’ Frau von oben bis unten. »Vielleicht machen wir mit ihr im Feld eine kleine Pause. Was denkst du?« Er lachte gehässig. »Sind schließlich keine Unmenschen, wollen ihr noch ein wenig Spaß gönnen, bevor sie am Galgen baumelt.« Er lachte wieder.
»Sie hat nichts damit zu tun«, sagte Nikolaus keuchend. »Sie ist eine ehrbare und gute Frau und weiß nicht, dass ich Bernstein gestohlen habe.« Er hatte es gesagt. Er hatte sich selbst schuldig gesprochen. Eben noch im Feld hatte er alles geleugnet, hatte gehofft, sein Leben retten zu können. Doch nun gab es keinen Ausweg für ihn. Er konnte nur noch seine Frau und seine Kinder schützen. »Der Bernstein ist hinter dem Haus zwischen dem Brennholz in einer kleinen Schatulle. Ich habe meiner Frau verboten, das Kästchen zu öffnen. Es geht sie nichts an, was ich darin aufbewahre. Sie ist eine gehorsame Frau. Sie hat getan, was ich ihr gesagt, und nicht getan, was ich ihr verboten habe.« Während er das sagte, blickte er sie unablässig an.
»O Nikolaus, warum hast du das getan?«
Der Blonde sprang von seinem Pferd und machte es ebenfalls an dem Apfelbaum fest. »Ein Weib, das seine Neugier zähmen kann und nicht in ein geheimnisvolles Kästchen schaut?«, fragte er lauernd und kam auf sie zu. Er blieb so dicht vor ihr stehen, dass sie seinen Schweiß und seinen Atem riechen konnte. »Daran mag ich nicht glauben.«
»Aber es ist die Wahrheit«, bekräftigte Nikolaus verzweifelt und machte zwei Schritte vorwärts. Weiter kam er nicht, denn der Strick, mit dem er gefesselt war, endete in einem dicken Knoten direkt am Sattel.
Der zweite Häscher, ein großer schlanker Mann mit dunkelbraunem Haar, schlug vor: »Sehen wir nach, ob die Geschichte mit der Schatulle überhaupt stimmt. Wer weiß, vielleicht ist es eine Falle.«
»Hast recht. Fesseln wir das schöne Weib und nehmen uns dann das Brennholz vor.«
Lene, Nikolaus’ Frau, schluckte. Wenn sie ihr die Hände banden, fiel der Bernstein, dessen Wärme sie ganz deutlich auf ihrer Haut spürte, womöglich doch noch zu Boden. Dann wäre sie auch des Todes.
»Warum willst du das Weib fesseln«, fragte der Dunkle. »Hast du etwa Angst, von einer Frau hinterrücks erschlagen zu werden?« Er lachte spöttisch.
»Angst vor einem Weib?« Der Blonde schnaubte. »Niemals! Was aber, wenn die beiden doch unter einer Decke stecken? Dann wird sie fliehen.«
»Nehmen wir sie eben mit«, schlug sein Kamerad vor. Er griff Lenes rechten Ellbogen und sagte: »Geh mit uns!«
Sie nickte und folgte den beiden Häschern auf die Rückseite der Hütte, wo Holz zum Befeuern der Kochstelle und für den nächsten Winter gelagert war.
»Also, wo ist das Kästchen?«, fragte der Blonde und gab Lene einen Klaps auf den Po, um sie anzutreiben.
Sie hätte fast aufgeschrien, nahm sich aber zusammen. »Ich weiß es nicht«, antwortete sie.
Und das war die Wahrheit. Oft hatte sie sich, wenn sie Holz für den Ofen geholt hatte, gefragt, wo Nikolaus den Bernstein versteckt hielt. Sie wusste, dass es das Kästchen zwischen den Scheiten gab, doch gesehen hatte sie es nie. Wann immer ihr Mann einen Splitter nach Hause gebracht hatte, statt ihn ordnungsgemäß abzuliefern, hatte er ihn selbst verstaut. Auch war er es, der Lene das eine oder andere Exemplar aus der Schatulle geholt hatte, damit sie es bearbeiten konnte. Wie er hatte sie es nie gelernt, aber Lene war eine Meisterin. Sie verstand es, mit den wenigen und einfachen Hilfsmitteln, die sie zur Verfügung hatte, kleine Kunstwerke aus dem Bernstein zu formen. Hier ein Herz, dort einen Tropfen, einmal hatte sie sogar eine Möwe geschnitzt.
»Nun red schon«, kommandierte der blonde Strandwächter sie wieder.
»Lass sie in Ruhe«, sagte der andere. »Sie weiß nichts.«
»Ich glaube ihr nicht. Überlass sie mir, und ich werde die Wahrheit aus ihr herausbekommen.« Er legte einen Arm um ihre Taille und schob eine Hand mit festem Griff auf ihren Oberschenkel. Lene begann zu zittern und presste beide Hände verzweifelt auf ihren Leib. Dabei krümmte sie sich ein wenig, als hätte sie Schmerzen.
»Nun lass sie schon und hilf mir lieber suchen. So viel Holz ist es ja nicht. Da werden wir die Schatulle wohl bald finden, wenn wir beide zupacken.«
Der Blonde sah Lene an. Das Zucken seiner Wangen verriet, dass er die Zähne zusammenbiss. Er hätte wohl lieber bei der Frau zugepackt als bei Holzscheiten, die ihm Splitter in die Finger jagen würden. Trotzdem ließ er sie los und machte sich daran, die sorgsam aufgestapelten Klötze durcheinanderzuwerfen. Es dauerte kaum eine Minute, da flog eine kleine Holzkiste, nicht einmal halb so groß wie ein Scheit, durch die Luft und sprang auf, als sie auf den Boden schlug. Heraus kullerten sieben unbearbeitete Bernsteine und einer, der die Form eines Kleeblattes hatte.
»O nein, o nein, o nein«, jammerte Lene und krümmte sich immer mehr. Ihre kupferroten Haare fielen über die Schultern nach vorn und rahmten das Gesicht ein, das ganz blass geworden war.
»Da schau an«, sagte der Blonde gedehnt. Er trampelte durch das herumliegende Holz und stieß Stücke beiseite, die ihm im Weg waren. »Und davon willst du nichts gewusst haben?« Er bückte sich, hob das Unterteil des Kästchens – der Deckel war durch die Wucht des Aufpralls abgebrochen – und dann die Bernsteinbrocken auf.
Lene schüttelte den Kopf.
Der Dunkle trat einen Schritt näher heran. »Sogar verarbeitet hat er sein Diebesgut. Da ist uns ja ein dicker Fisch an die Angel gegangen!«
»Und wenn sie es war? Wette, die ist recht fingerfertig«, sagte der Blonde anzüglich.
»Eine Frau mit einem derartigen handwerklichen Geschick?« Der Dunkle nahm das Kleeblatt in die Hand und hielt es gegen die Sonne. Es hatte die Farbe von Honig, und sein Glanz verriet, dass es viele Stunden sorgfältig poliert worden war. Die Rundungen waren perfekt, nirgends stand eine Ecke vor oder fühlte sich eine Kante rauh an.
»Hast recht, das ist kaum möglich«, entgegnete der Blonde, während sie wieder um die Hütte zu den Pferden gingen. »Vollenden wir unser Werk, bringen wir die Diebe an den Galgen und den Bernstein zu seinem Besitzer.«
»So glaubt mir doch, sie wusste nichts davon«, keuchte Nikolaus leise, der sich vor Erschöpfung, Hitze und Durst kaum noch auf den Beinen halten konnte.
»Warum nur hast du das getan?«, fragte Lene noch einmal. Tränen rannen ihr über die bleiche Haut. Ihre nassen Augen schimmerten grün. Warum hast du gestanden, wollte sie wissen, doch der Scherge des Pächters verstand sie falsch oder wollte sie falsch verstehen.
»Du hörst doch, sie hatte keine Ahnung, dass ihr Mann unterschlagen hat. Knüpfen wir nur ihn auf, dann können sie und die Kinder weiter für den Pächter Bernstein sammeln.«
Einen Augenblick zögerte der andere noch. Dann machte er sein Pferd los und sagte: »Hast recht. Wäre auch zu schade um das hübsche Ding.« Er saß auf. Sein Kamerad tat es ihm gleich. »Keine Sorge«, rief der Blonde Lene zu, als er das Pferd wendete und den entkräfteten Nikolaus hinter sich herzog, »ich kümmere mich gern um die Witwen der Unglücksvögel, die am Galgen baumeln.« Er lachte laut und gab seinem Pferd die Sporen, so dass es in einen flotten Trab fiel. Nikolaus schaffte zwei Schritte, bevor er über seine Füße stolperte und fiel. Er schrie auf, als seine nackten Arme vom Sand geschliffen wurden wie sonst der Bernstein in den Händen seiner Frau. Er atmete den Staub ein und würgte und hustete.
»Vater!« Die Kinder waren im Haus geblieben, denn die beiden ältesten hatten schnell erkannt, dass draußen größte Gefahr herrschte. Bis zu diesem Moment war es ihnen gelungen, die kleinen Geschwister ruhig zu halten. Als sie jedoch den Schrei des Vaters hörten, stürmten sie aus der Hütte. Nur das Jüngste blieb zurück, das noch nicht laufen konnte. Lene packte ihre beiden ältesten Kinder, jedes mit einem Arm. Sie zerrten an ihr, wollten sich frei machen. Die beiden jüngeren weinten und zogen an Lenes Rockzipfel. Auch der andere Strandreiter hatte sein Pferd inzwischen losgebunden und war aufgesessen. Er sah sie noch einmal voller Mitgefühl an. Da fiel der Bernstein. Lene dachte, ihr bliebe das Herz stehen. Noch immer versuchten die Kinder, sich aus der Umklammerung der Mutter zu befreien. Sie kreischten, schimpften und schluchzten. Ihre Füße wirbelten Staub auf. Lene starrte den Reiter an. Ihre Blicke trafen sich. Sie sahen einander an. Dann zog er den Zügel herum, führte das Pferd in einem Bogen vom Haus fort und gab ihm die Sporen, um seinem Kameraden eilig zu folgen.
Das Spektakel war nicht unbemerkt geblieben. Einige Küstenbewohner trauten sich jetzt, da ein Schuldiger dingfest gemacht war und man offensichtlich nicht nach weiteren Dieben suchte, näher an das Geschehen heran. Ein paar Halbwüchsige hüpften um die Pferde herum und beeilten sich, zum nächsten Galgen am Strand zu kommen, um nur ja nicht das Beste zu verpassen. Die Bernsteinfischer wateten aus der See, legten ihre Netze beiseite und brachten ihre Lederbeutel in den Unterstand. Zwei Frauen waren inzwischen auch am Strand, die ihren Männern, genau wie Lene es vorgehabt hatte, halfen. Sie standen still beieinander und verfolgten ängstlich, wie die Häscher ihre Pferde anbanden und den Gefangenen losmachten.
»Ist das nicht der Nikolaus?«, flüsterte einer der Fischer.
»Kann ich mir nicht vorstellen«, antwortete ein anderer mit dickem Bauch und einer gewaltigen Knollennase. »Der Nikolaus hat doch nicht geklaut!«
»Nicht mehr als wir anderen auch, meinst du«, zischte der Erste. Der Knollennasige stieß ihm heftig in die Seite und funkelte ihn entsetzt an.
»Doch, das ist er«, sagte eine der Frauen, bevor der Dicke den Mund aufmachen konnte. Sie schüttelte langsam den Kopf.
Es war in der Tat nicht leicht, den Bernsteinsammler Nikolaus noch auf Anhieb zu erkennen. Er war in einem erbarmungswürdigen Zustand, als man ihn die letzten Meter zum Galgen schleifte. Das Blut an seiner Schläfe war verkrustet, ein Stein auf dem Weg hatte ihm die Nase zertrümmert, die Haut war an beiden Armen abgeschürft, frisches Blut sickerte in den Sand, wo Nikolaus’ geschundener Körper lag. Seine Lippen waren aufgesprungen, seine Zunge dick geschwollen vor Durst. Schmerzen hatte er keine mehr. Er fühlte sich eher wie betäubt, ja, sogar wie berauscht. Plötzlich sah er das metallisch glänzende Auge der Eidechse vor sich. Ihm war, als würde es leuchten, als gäbe es ihm neue Kraft.
Sie hoben ihn auf eine Kiste, die sie herbeigeholt hatten, und legten ihm die Schlinge um den Hals. Die Zuschauer am Strand, die eben noch eifrig miteinander über die Dummheit des Diebes gesprochen hatten, lautstark darüber, dass es ihm recht geschehe, oder leise flüsternd, dass es eine Ungerechtigkeit sei, für diese Nichtigkeit gleich mit dem Tode bestraft zu werden, verstummten. Sogar die Halbwüchsigen, die Spottlieder gesungen und die Henker eifrig angefeuert hatten, wurden nun ruhig.
»Wenn du noch etwas zu sagen hast, dann sag es jetzt, denn gleich wird dir der Strick die Kehle zuschnüren, dass es kein Wort mehr nach draußen schafft«, sagte der Blonde und grinste Nikolaus hämisch an.
Dieser holte tief Luft und nahm alle Energie zusammen, die noch in seinen Adern und seinen Lungen war. »Bewohner der Küste des Samlandes«, begann er krächzend, »wehrt euch! Niemand kann das Meer besitzen. Auch nicht das, was in ihm ist.« Er atmete schwer. Der Sturm hatte sich etwas gelegt, doch noch immer pfiffen Böen, gegen die er seine Stimme erheben musste. »Das Gold der Ostsee gehört dem, der es findet. Dafür müsst ihr kämpfen! Hört ihr mich? Ihr müsst …«
Der Blonde trat mit Wucht gegen die Kiste, die unter Nikolaus’ Füßen davonflog. Ein grausiges Knacken, und das Leben des Bernsteinfischers Nikolaus war beendet. Es trat eine unheimliche Stille ein. Die Zeugen der schrecklichen Tat hielten den Atem an. Die jungen Kerle, die sonst amüsiert um den Galgen herumtanzten, wagten ebenfalls nicht zu atmen. Sogar der Wind schwieg für ein paar Sekunden.
I
1784. Die letzten Karren rumpelten davon, die die Möbel der Thuraus zu ihrem neuen Sommerhaus gebracht hatten. Arbeiter waren damit beschäftigt, Tische, Stühle, Truhen, Kommoden und Schränke an ihre Plätze zu rücken. Sie räumten sorgsam eingewickeltes Glas und Porzellan aus den Kisten und legten Besteck und Tischwäsche in die dafür vorgesehenen Schubladen. Hanna Thurau, eine große schlanke Frau, die ihre blonden Haare meist zu einem Knoten gebunden trug, gab letzte Anweisungen. Dann trat sie hinaus, atmete tief ein und blickte zu den mächtigen Wallanlagen und den dahinter liegenden Türmen Lübecks. Die Hände tief in einem Muff aus Kaninchenfell vergraben, ging sie einige Schritte auf die Allee zu, die vom Palais zur Trave führte, drehte sich um und betrachtete zum wiederholten Mal das stattliche Gebäude, das ihr Mann dem einstmals reichsten Kaufmann der Hansestadt für einen Spottpreis abgekauft hatte. Sie empfand kein Mitgefühl für den Mann, der nur zu seinem Reichtum gekommen war, weil seine Eltern dafür tüchtig gearbeitet und sparsam gelebt hatten. Über ihn konnte man das gewiss nicht sagen. Kaum dass sie unter der Erde waren, hatte er das bescheidene Sommerhaus zu einem kleinen Schloss umbauen lassen. Unvorstellbar, welche ausschweifenden Feste er hier gefeiert haben mochte. Mit dem Einzug der Thuraus würde eine neue Ära anbrechen. Stolz hob sich die frisch geweißelte Sandsteinfassade vom blauen Himmel dieses kalten klaren Märztages ab. Eingerahmt wurde das Hauptgebäude von zwei ebenfalls in frischem Weiß strahlenden Torhäuschen. Ein schmiedeeiserner Zaun mit einem ebensolchen zweiflügligen weit über mannshohen Tor schützte den Gebäudekomplex. Den Garten vor dem Tor konnte jeder betreten. Er war lediglich von einer niedrigen Buchsbaumhecke umgeben. Doch um hierherzugelangen, musste man entweder den Weg über die Trave nehmen und die lange Allee zwischen Wiesen und Weiden hindurch heraufkommen, oder man musste sich ein gutes Stück quer durch Raps- und Getreidefelder schlagen. Im Winter war das nicht schwer. Aber im Winter würden die Thuraus ohnehin nicht hier draußen leben. Vor den Toren der Stadt verbrachte man lediglich die heißen Wochen im Sommer. Die übrige Zeit lebten Hanna Thurau und ihr Mann Carsten in ihrem Stadthaus in der Glockengießerstraße. Sie raffte ihren Rock und den langen Mantel und ging auf die kleine schmiedeeiserne Gittertür zu, die rechts vom Haupttor in einer Mauer aus Sandstein, der Verbindung von Haupttor und Torhäuschen, offen stand. Ihr Mann trat aus dem Wohngebäude, lief die Treppe herunter und ihr entgegen.
»Nun, wie fühlst du dich als Schlossherrin?«, fragte er und schob die bloßen Hände tief in seine Hosentaschen. »Misst du deine neue Sommerresidenz schon wieder mit Schritten ab?«
»Ach Carsten, ich kann es einfach noch nicht glauben. Das Haus ist so wunderschön, und der Garten ist eine Pracht.«
»Nun ja …« Carsten Thurau sah sich wenig begeistert um.
»Es ist März«, sprach sie unbeirrt weiter. »Aber wir haben den Park im August gesehen. Erinnere dich nur daran, wie alles geblüht hat. Er ist ein Paradies.«
»Hast ja recht«, entgegnete ihr Mann schmunzelnd, legte einen Arm um ihre Taille und führte sie zu den Stufen. »Im Moment ist es ein ziemlich kaltes Paradies. Lass uns hineingehen.«
»Warum läufst du auch ohne Mantel draußen herum?«, tadelte Hanna ihn.
»War doch nur eine Minute«, gab er zurück und rieb sich die Hände.
Kurzerhand schlüpfte sie aus ihrem Muff und schob seine Hände hinein.
Er wehrte sich. »Das ist nichts für Männer«, brummte er.
»Von wegen«, entgegnete sie. »Auch Männer haben kalte Hände.«
»Ja, aber sie wärmen sie sich lieber am Kamin bei einem guten Glas Wein.«
»Beides hast du hier aber nicht«, stellte sie fest.
»Meinst du!«
Hanna Thurau, die gerade ihren Mantel ablegen wollte, stutzte. »Du wirst doch keinen Wein hierher gebracht haben. Was sollte er hier, da wir uns doch gleich wieder auf den Weg zurück nach Lübeck machen müssen. Und den Kamin anzuheizen lohnt sich ebenfalls nicht.«
»Irrtum, meine Liebe. Das Feuer im Kamin brennt bereits, und in der warmen Stube warten eine Flasche Rotwein und das Abendessen auf uns.«
»Das ist nicht dein Ernst«, sagte sie ungläubig. »Wenn wir hier noch zu Abend essen, sind wir doch viel zu spät zu Hause.« Noch immer stand sie im Mantel vor ihm. Carsten Thurau nahm ihr das schwere Kleidungsstück ab und legte es über einen Stuhl, der in der Diele stand.
»Wir fahren gleich morgen früh zurück in die Stadt, nachdem wir die erste Nacht in unserem neuen Sommerschloss verbracht haben.«
Hanna strahlte ihn an. »Ist das wahr? Wir bleiben hier?«
»Aber sicher! Weißt du denn nicht? Was du in der ersten Nacht in einem neuen Haus träumst, das wird sich erfüllen. Was mich betrifft, ich möchte nicht länger darauf warten müssen.« Mit diesen Worten führte er sie die Treppe hinauf in den prächtigen Saal, der das Zentrum des Hauses bildete. Eingerichtet war er ähnlich wie das Gesellschaftszimmer in ihrem städtischen Wohnhaus. Stühle standen an der Wand aufgereiht, dazwischen ein Sofa. Von der Decke hing ein wuchtiger runder Leuchter, zwei Standleuchter rahmten eine Vitrine, die am Kopfende des Saals zwischen den beiden weißen Flügeltüren plaziert worden war, ein. Noch fehlten die Bilder an der Wand, aber ein dicker Teppich lag bereits in der Mitte des Raums und sorgte für eine warme Atmosphäre. An der Wand gegenüber der beiden Türen und der Vitrine standen zwei Stühle an einem kleinen runden Tisch mit geschwungenen Beinen direkt vor dem Kamin, in dem ein Feuer loderte und knackte. Auf dem Tisch standen bereits zwei Gläser und eine Flasche Rotwein. Carsten Thurau hatte alles rasch vorbereiten lassen, als seine Frau noch damit beschäftigt war, in den unteren Räumen den Bediensteten auf die Finger zu schauen.
Hanna Thurau, Kind eines Hamburger Kaufmanns und Senators und einer Lübecker Kaufmannstochter, war Überraschungen von ihrem Mann gewöhnt. Nach dem Tod ihrer Eltern war die gebürtige Hamburgerin mit vierzehn Jahren nach Lübeck gekommen, wo sie fortan bei einem Onkel lebte. In seinem Haus hatte sie mit gerade einmal achtzehn Carsten Thurau kennengelernt. Sie mochte auf Anhieb seine fröhlichen blauen Augen und sein Lachen. Thurau lachte viel. Der große kräftige Mann mit dem dichten braunen Haar, das sich unkontrolliert lockte, wenn er es nicht rechtzeitig schneiden ließ, nahm das Leben auf die leichte Schulter. Sein Vater, Aribert Thurau, stammte aus einer alteingesessenen Lübecker Familie. Er handelte mit russischen Waren wie Hanf, Flachs und Talg und war Mitglied der angesehenen Nowgorodfahrer. Das meiste Geld aber verdiente er mit einer Zuckerfabrik. Es war eine der ersten ihrer Art im gesamten Ostseeraum, und sie erwies sich als wahre Goldgrube. Carsten hatte eine gute Schulbildung genossen und bei seinem Vater das Kaufmannsgeschäft gelernt. Viel mehr als Hanf, Flachs oder Zucker interessierte den Spross aber der Wein, der im Keller seines Vaters lagerte. Der alte Thurau sammelte leidenschaftlich edle Tropfen. Seinen Sohn reizte es, damit Handel zu treiben. Und so eröffnete der damals Achtundzwanzigjährige seiner gerade angetrauten Frau Hanna, er werde sich aus dem Geschäft mit russischen Waren zurückziehen und stattdessen Weinhandel betreiben. Das war nun sechs Jahre her, und heute lagerten in den Kellern der besten Häuser und vornehmsten Familien Weinflaschen mit dem Thurauschen Siegel. Sie waren angesehene Bürger der Hansestadt und gingen bei Senatoren ebenso ein und aus wie bei Künstlern. Carsten musste häufig nach Frankreich reisen, wo er den Wein einkaufte. Er führte das Geschäft mit leichter Hand und Humor. Hanna begleitete ihn auf seinen Reisen, denn sie mochte nicht alleine in Lübeck bleiben, und Kinder hatten sie nicht. Wenn sie zu Hause waren, kümmerte sie sich um die Mitarbeiter. Sie war ebenfalls gebildet und konnte hervorragend planen und organisieren. Die beiden waren nicht nur ein glückliches Paar, sondern auch eine erfolgreiche Gemeinschaft. Der einzige Wermutstropfen, der selbst Carsten an manchen Tagen die gute Laune zu verderben vermochte, war die Tatsache, dass Hanna keine Kinder bekommen konnte. Er hatte es immer für selbstverständlich gehalten, eines Tages seinen Sohn in die Geschäfte einzuführen, wie sein Vater es mit ihm getan hatte. Die Vorstellung, dass sich dieser Traum nie erfüllen würde, machte ihm zu schaffen. Sie machte ihnen beiden zu schaffen. Nicht selten kamen sie darauf zu sprechen, was einmal aus ihrem Besitz werden sollte. Doch sie wechselten das Thema dann immer schnell, weil es sie deprimierte und sie keine Lösung sahen.
Und nun saßen sie also gemeinsam am Feuer und schwiegen viel. Beide wussten, dass auch der andere sich fragte, wer wohl in vierzig oder fünfzig Jahren, wenn sie sehr alt oder vermutlich gar nicht mehr am Leben waren, in diesen Räumen zu Hause war. Trotzdem freuten sie sich auf ihre erste Nacht im neuen Sommerhaus. Neben den dicken Daunenbetten hatte Carsten extra zwei große Wolldecken herbringen lassen, damit sie nicht gar zu sehr frieren mussten. Wenn doch, hatten sie noch immer sich, um einander zu wärmen.
Es war fast vier Uhr früh. Das Feuer im Kamin des Sommerschlösschens war längst verloschen. Eine Gestalt schlich durch die Dunkelheit. Achtlos trat sie die jungen Keimlinge des Winterweizens nieder, die den harten Boden erst vor einigen Tagen durchstoßen hatten. In einem Arm hatte die Gestalt ein dickes Bündel, den anderen Arm hielt sie gerade vor sich gestreckt, um Hindernisse in der Finsternis rechtzeitig ertasten zu können. Die Füße tasteten ebenfalls, machten unsichere langsame Schritte. Die Kälte des frostigen Bodens war längst durch die dünnen Sohlen der einfachen Schuhe gedrungen. Die Hand berührte von Rauhreif überzogene Blätter einer Buchsbaumhecke. Luise hatte den Garten erreicht. Ihr fiel ein Stein vom Herzen. Wie leicht hätte sie sich in der Schwärze der Nacht verlaufen können. Andererseits bot genau die ihr den Schutz, den sie brauchte, um ihr Bündel unbemerkt ablegen und sich davonmachen zu können. Sie tastete sich behutsam voran. Nur jetzt keinen Lärm machen. Inständig betete sie, dass der Kutscher Friedrich die Wahrheit gesagt hatte. Was, wenn der Weinhändler und seine Frau doch nicht über Nacht geblieben waren? Was, wenn es Tage dauerte, bis wieder jemand hierherkam? Sie presste das Bündel fest an sich.
»Sie sind da, du wirst sehen«, sagte sie mehr zu sich selbst als zu dem Neugeborenen, das sie in eine Wolldecke und ein Schaffell gewickelt hatte. Schemenhaft zeichnete sich ein Gebäude vor dem Nachthimmel ab. Noch ein paar Schritte, dann stieß Luises Fuß gegen etwas. Das musste die Treppe vor dem Hauptgebäude sein. Sie bückte sich vorsichtig und fühlte eine Stufe, dann eine zweite, eine dritte. Ja, sie war an ihrem Ziel angekommen. Der Stein war eiskalt, aber lange würde ihr Kind nicht aushalten müssen, hoffte sie inständig. Sie legte das Bündel ganz dicht an die Tür, wo es zumindest vor dem Wind geschützt war. Erschöpft ließ sie sich daneben fallen. Sie war noch von der Geburt vor wenigen Tagen geschwächt. Und nun der lange beschwerliche Marsch aus der Stadt, durch Feld und Flur bis hierher. Sie wollte nur ein wenig ausruhen. Vor allem wollte sie noch bei ihrem Baby bleiben. Von dem Moment an, als sie den Beschluss gefasst hatte, ihr Kind wegzugeben, hatte sie den Schmerz verdrängt, der damit verbunden sein würde. Sie hatte sich eingeredet, dass es das Beste für ihr Kleines war. Und das stimmte. Es gab ja auch keine andere Möglichkeit. Sie konnte sich glücklich schätzen, dass sie als Frau eine recht gute Arbeit hatte. Mit einem Bernsteindreher zog sie von Stadt zu Stadt und bot ihre Waren und vor allem ihre Handwerkskunst an. Seit vor einigen Jahren ein Professor in Königsberg behauptet hatte, Bernstein sei gar kein Edelstein, sondern pflanzlicher Herkunft, war das Interesse an daraus gefertigtem Schmuck beim Adel erloschen. Es waren bis zu dem Zeitpunkt nur Adlige, sehr reiche Kaufleute und gehobene Beamte, die sich Kunstgegenstände aus dem Gold der Ostsee, wie man es nannte, leisten konnten. Die Zünfte der Bernsteinmeister lebten recht gut davon. Doch seit sich herumgesprochen hatte, dass der Stein, der über magische Fähigkeiten zu verfügen schien und den das Meer einfach so an den Strand werfen konnte, lediglich versteinertes Baumharz sein sollte, ließ sich nicht mehr gut von dem Handwerk leben, das schon Luises Vorfahren ausgeübt hatten. Glücklicherweise entdeckten die Großbauern das Material nun für sich und ließen daraus Brautketten fertigen. Meist mussten dafür nur Kugeln von ansehnlicher und vor allem gleicher Größe geschliffen, poliert und durchbohrt werden – eine eintönige Arbeit. Manchmal jedoch, wenn es sich um einen sehr begüterten Bauern handelte, durfte Luise jede Kugel mit einem kunstvollen Facettenschliff versehen, bevor sie sie auffädelte. Und hin und wieder, wenn es ein besonders guter Tag war, verlangte jemand nach einem Kreuz oder einem Anhänger in einer anderen Form. Das war stets eine willkommene Abwechslung. Sie arbeitete zwölf Stunden und mehr an jedem Tag oder zog mit ihrem Gefährten über das Land. Was sollte sie da mit einem Kind anfangen?
Als die Kälte ihr den Rücken hochkroch, erhob sie sich mühsam. Sie stand vor dem Fellbündel, dessen Umrisse sie eben erkennen konnte. Sie sah, dass es sich bewegte. Hier ein Recken des Ärmchens, da ein Tritt mit einem der kleinen Füße. Luise beugte sich tief zu dem Säugling hinunter.
»Ich will dich nicht hergeben«, flüsterte sie. Tränen schossen ihr in die Augen, und sie musste schlucken. »Aber ich muss! Das ist kein Leben für ein Kind, hörst du? Das hier sind reiche Leute und ehrbare Bürger. Sie werden dich verwöhnen.« Sie konnte nicht mehr sprechen, denn ein Schluchzen schnitt ihr jedes weitere Wort ab. Sie presste eine Hand auf den Mund, um keinen Laut von sich zu geben. Man durfte den Winzling erst finden, wenn sie weit genug weg war. »Werde glücklich, mein Kind«, flüsterte sie, nachdem sie einmal tief Luft geholt hatte. Mit einem Finger berührte sie das winzige Näschen, fast das Einzige, was von dem Gesicht des Säuglings inmitten der Wolle zu sehen war. Dann schlich sie eilig die Stufen hinab und auf demselben Weg zurück zur Stadt, den sie gekommen war.
Hanna Thurau drehte sich im Schlaf auf die andere Seite. Was für ein wunderschöner Traum. Sie war doch noch – zur allgemeinen Überraschung – Mutter geworden. Sicher, mit einunddreißig war sie nicht mehr jung, vor allem für das erste Kind, aber sie war schließlich eine gesunde starke Frau. Sie hörte ihr Baby schreien. Bestimmt hatte es Hunger. Sie öffnete die Augen und überlegte eine Sekunde, wo das Kinderbettchen stand. Sie wusste es nicht. Dann wurde ihr klar, dass sie nur geträumt hatte. Die Enttäuschung legte sich schwer auf ihr Gemüt. Alles war so überzeugend gewesen, so echt, als ob es wirklich geschehen wäre. Carsten schlief noch fest, und es war noch dunkel. Hanna fröstelte ein wenig und wollte sich gerade näher an ihren Mann legen, um sich an ihm zu wärmen, als sie wieder das Geschrei eines Babys vernahm. Sie rührte sich nicht. Sie hatte Angst, dass sie noch im Halbschlaf war und durch eine falsche Bewegung den schönen Traum vertreiben könnte. Aber sie war nicht im Halbschlaf. Im Gegenteil, sie war jetzt hellwach. Da schrie ein Kind. Das Geräusch drang zwar leise an ihr Ohr, aber dafür umso deutlicher. Sie setzte sich auf und lauschte in die Dunkelheit. Es war doch völlig unmöglich, dass sich ein Säugling in diesem Haus befand. Es hätte jemand einbrechen müssen, um ihn hereinzuschmuggeln. Ihr wurde kurz mulmig bei dem Gedanken, doch dann schob sie ihn beiseite, weil er ihr zu abwegig erschien. Da war es wieder. Kein Zweifel, ganz in der Nähe schrie sich ein kleines Menschenkind die Seele aus dem winzigen Leib.
»Carsten, hör doch!« Sie rüttelte ihren Mann an der Schulter. Aber er brummte nur und vergrub sich tiefer in die Decken. »Du musst aufwachen«, sagte sie laut und schüttelte ihn kräftiger.
»Was ist denn los? Ist doch noch mitten in der Nacht.« Carsten Thurau schlug die Augen auf und blinzelte in das Dunkel.
»Hörst du denn nicht?«, beharrte Hanna. »Da schreit ein Baby!«
Jetzt setzte auch er sich auf. »Donnerschlag, du hast recht. Wo kommt das denn her?«
»Das müssen wir herausfinden.« Mit einem Schwung war Hanna aus dem Bett. Ihr Mann hatte zwar nicht vergessen, ihr ein Nachthemd herbringen zu lassen, an einen Morgenmantel hatte er aber nicht gedacht. Also zog sie kurzerhand eine der Wolldecken vom Bett und wickelte sich darin ein. Carsten hatte inzwischen eine Öllampe entzündet, die neben seinem Bett gestanden hatte. Er sah sie, eingewickelt wie eine Mumie, in ihre Schuhe schlüpfen und tat es ihr gleich. Unter anderen Umständen hätten beide herzhaft über den Anblick gelacht, den sie abgaben mit ihren Decken um die Körper geschlungen und den Schuhen, die zu Anzug oder Kleid gepasst hätten, doch sicher nicht zu Nachtgewand und Decke. Aber dies war eine ernste und zudem höchst aufregende Angelegenheit. Carsten schritt voran, die Lampe vor sich haltend. Hanna folgte dicht hinter ihm. Sie gingen die dunkle Treppe aus Eichenholz hinab, die in einem weiten Schwung in die Diele führte. Das Schreien war zu einem Wimmern abgeebbt, das jedoch noch immer deutlich zu hören war. Den Thuraus war klar, was das bedeutete. Sie waren auf der richtigen Spur. Es kam nicht selten vor, dass ein Neugeborenes vor einem Haus abgelegt wurde. Meistens handelte es sich allerdings um ein Waisenhaus. Carsten öffnete die schwere, mit ornamentaler Schnitzerei versehene Holztür und wäre fast über das Bündel zu seinen Füßen gestolpert.
»Donnerschlag!« Mehr fiel ihm nicht ein.
Hanna dagegen bückte sich rasch und hob das Fellknäuel mit dem höchst lebendigen Inhalt auf.
»Ist es denn zu glauben?«, fragte sie, ohne eine Antwort zu erwarten. »Wer tut denn so etwas? Wer legt denn einen hilflosen Wurm bei dieser Kälte einfach hier ab?« Während sie sprach, wiegte sie das Päckchen behutsam auf ihrem Arm. »Jetzt wird alles gut«, murmelte sie. »Jetzt bist du bei uns. Nun brauchst du nicht mehr zu frieren.«
Carsten hielt seine Lampe mal in die eine, mal in die andere Richtung. Er hätte wohl selbst nicht sagen können, wonach er suchte. Dann schloss er die Tür und stand ein wenig ratlos vor seiner Frau und dem noch immer wimmernden Baby, von dem er bisher nur die Nasenspitze gesehen hatte.
»Ist es ein Junge?«, fragte er.
»Aber Carsten, wie soll ich das denn jetzt schon wissen? Bringen wir es nach oben. Unser Bett ist sicher noch warm. Gewiss wird es dem Baby guttun, wenn wir es zwischen uns legen und aufwärmen.«
»Meinst du nicht, dass es Hunger hat?« Er fingerte neugierig das Fell und die Decke auseinander, um mehr sehen zu können.
»Lass doch«, tadelte Hanna, »sonst wird ihm ja noch kälter.« Dann erst reagierte sie auf den Vorschlag ihres Mannes. »Du hast recht. Gehen wir in die Küche und heizen den Ofen an. Wir werden ihm etwas Milch warm machen. Ist überhaupt Milch da?«
»Nichts ist da«, antwortete er seufzend. »Höchstens noch ein bisschen Huhn von gestern. Aber das wird ihm wohl nicht gefallen.«
»So ein Jammer. Also legen wir uns doch mit ihm hin. Vielleicht schläft es ein, wenn ihm wieder warm ist. Und später, wenn wir zu Hause sind, bekommt es gleich etwas.«
Zurück im Schlafzimmer, zog Carsten seine Taschenuhr hervor. »Gleich halb sechs«, sagte er. »Ich habe Friedrich aufgetragen, uns um sieben Uhr abzuholen. So lange wird ein strammer kleiner Junge doch aushalten, oder?«
»Wir wissen doch noch nicht einmal, ob es ein Junge ist«, antwortete Hanna und legte das gesamte Bündel mit Fell und Decke in die Mitte der Kissen.
»Dann pack es doch endlich aus«, drängelte er.
Sie stellte ihre Schuhe beiseite, wickelte sich aus dem provisorischen Umhang und breitete ihn über die Daunenbetten aus. Wieder machte Carsten es ihr nach. Beide schlüpften zurück in ihr Bett. Sie zogen die inneren Zipfel ihrer Daunendecken zusammen und formten daraus ein kleines Nest, in das sie das Findelkind samt seiner Verpackung schoben. Dann rückten sie ganz dicht heran, um ihm ihre Körperwärme zu geben.
»Was tun wir nun mit ihm?«, fragte Hanna nach einem kurzen Moment. »Denkst du, wir können es einfach behalten?«
»Wir sollten im Waisenhaus fragen, was in einem solchen Fall zu tun ist.«
»Ja, das sollten wir.« Einen Augenblick schwiegen beide wieder. »Meinst du, sie können es uns wegnehmen?«, fragte Hanna.
»Wollen wir es denn behalten?«
»Aber natürlich wollen wir es behalten! Du weißt, wie sehr ich mir immer ein Kind gewünscht habe. Und du dir doch auch.« Sie stützte sich auf die Ellbogen und hielt mit der Hand ihr Kinn. Die blonden glatten Haare fielen wie ein Seidentuch auf ihr Kissen. »Außerdem hast du selbst gesagt, dass die Träume in Erfüllung gehen, die man in der ersten Nacht in einem neuen Haus träumt. Und ich habe geträumt, wir haben ein Kind bekommen.«
Carsten lachte leise. Er sah seine Frau liebevoll an. Vielleicht hatte Gott ihnen tatsächlich den langersehnten Nachwuchs geschenkt, wenn auch auf etwas ungewöhnliche Weise.
»Lebt es überhaupt noch?«, fragte er. »Es macht gar keinen Muckser mehr.«
Tatsächlich war es still geworden. Sie schoben ihre Kissen gegen das kunstvoll gedrechselte Kopfende des Bettes und lehnten sich an. Carsten nahm die Lampe zur Hand und hielt sie über das ungewöhnliche Päckchen. Hanna zog Wolldecke und Fell auseinander, bis ein blasses Gesichtchen zum Vorschein kam. Im flackernden Schein der Öllampe konnten sie sehen, wie ein winziger Mund sich weit zu einem herzhaften Gähnen öffnete. Die kleine Nase, von der Kälte noch ein wenig gerötet, kräuselte sich dabei. Die Augen waren geschlossen, ein zarter Flaum auf dem Köpfchen ließ ahnen, dass das Kind einmal kupferrotes Haar haben würde.
»Was ist das?« Hanna zupfte ein Kuvert hervor, dessen Ecke durch das Verschieben der Decke freigelegt worden war. Die beiden sahen einander einige Sekunden an. »Lies du«, sagte sie und reichte Carsten das Schreiben.
Er nahm es ihr ruhig und fast ein wenig feierlich ab, holte ein ordentlich gefaltetes Blatt aus dem Kuvert und las: »›Dies ist meine Tochter Femke.‹« Er ließ das Papier kurz sinken. »Ein Mädchen!«, stellte er mit unüberhörbarer Enttäuschung in der Stimme fest. »›Ich habe sie in einer Nacht mit einem Großbauern empfangen, mit dem ich Geschäfte gemacht habe. Er war ein guter Mensch, doch von Liebe oder gar Heirat war nie die Rede gewesen. Und ich war längst weitergezogen, als ich merkte, dass da ein Kind unter meinem Herzen heranwächst. Es war zu spät, um etwas dagegen zu unternehmen, und ich hätte das auch nicht gekonnt. Doch behalten kann ich meine Tochter auch nicht. Darum habe ich schon vor der Niederkunft in Lübeck nach ehrbaren Menschen gesucht, die sich ihrer annehmen können. Ich hörte, dass Ihnen das Glück eigener Kinder nicht vergönnt sei. Und ich hörte, dass Sie wahrlich gute Menschen sind. So lege ich das Schicksal meiner kleinen Femke in Ihre Hände. Ich bete zu Gott, dass er Sie reich dafür entlohnen möge, dass Sie ihr ein gutes Zuhause geben. Das Einzige, was ich Ihnen als Lohn geben kann, ist das Amulett, das das Kind um den Hals trägt. Es ist ein Familienerbstück und von einigem Wert, doch habe ich es nie angerührt, wenn Hunger und Elend auch noch so groß waren. Die rechtmäßige Besitzerin ist Femke. Möge sie das Schmuckstück tragen, wenn sie eine junge Frau geworden ist. Oder mögen Sie den rechten Zeitpunkt erkennen, wenn es Ihnen in der Not nützen kann.‹«
Hanna und Carsten sahen sich lange an. Hanna rollte eine Träne über die Wange. Dann betrachteten sie das zarte Mädchen, das zufrieden zwischen ihnen schlummerte. Vorsichtig tastete Carsten am Hals der Kleinen entlang und zog eine dünne Lederschnur hervor. Er zog weiter, langsam, um das Kind nicht zu wecken, bis schließlich ein dunkelbrauner Anhänger sichtbar wurde. Im Schein der Flamme, die in der Öllampe züngelte, leuchtete das Schmuckstück geheimnisvoll. Aus der Tiefe des Steins blickte die beiden ein erhabenes metallisch glänzendes Auge an.
»Donnerschlag«, sagte Carsten Thurau.
II
Femke hatte es wirklich bestens getroffen. Sie wuchs behütet und umsorgt auf. Solange sie noch ein Kleinkind war, verwahrte ihre Mutter ihr Amulett für sie. Nur wenn sie weinte und sich nicht beruhigen ließ, holte Hanna den ovalen Bernstein hervor und hielt ihn ihr vor die Nase. Femke griff sofort mit ihren Händchen danach und ließ den Anhänger nicht mehr los. Sie wurde auf der Stelle ruhig und betrachtete ihn minutenlang, bis sie darüber einschlief.
Als sie acht Jahre alt war, nahm ihre Mutter sie mit vor die Tore der Stadt. Sie liefen von dem weiß verputzten Haus in der Glockengießerstraße Nr. 40 hinab bis zum Ufer der Wakenitz. Es war der 3. Juli 1792, der ein warmer Sommertag zu werden versprach. Eine Sensation wartete auf die Bürger Lübecks, und Hanna wollte um keinen Preis, dass ihr Kind das verpasste. Der Franzose Jean-Pierre Blanchard beabsichtigte mit seinem Heißluftballon in die Lüfte zu steigen. Carsten Thurau hatte bei einer Frankreichreise bereits die Gelegenheit gehabt, die Montgolfiere-Brüder bei Versailles mit ihrem Ballon zu sehen. »Solange ich nicht selbst mitfliegen kann, muss ich mir die Dinger auch nicht angucken«, hatte er danach beschlossen.
Also waren Hanna und Femke allein unterwegs, während Carsten sich um eine Ladung Rotwein kümmerte, die eben aus Bordeaux eingetroffen war. Kleine Wellen klatschten an das Ufer der Wakenitz. Zwei Möwen zogen ihre Kreise. Es war ein wundervoller Tag. Als sie das Burgtor erreichten, sahen sie schon von weitem die vielen Schaulustigen, die sich auf dem freien Feld dahinter versammelt hatten. Männer und auch ein paar Frauen und Kinder standen in Grüppchen in respektvollem Abstand von dem Korb und dem daneben auf dem Boden liegenden Ballon. Wer nicht laufen konnte oder mochte, war mit der Kutsche gekommen. Arbeiter, Dienstboten und einfache Markthändler waren kaum zu sehen. Nur wenige konnten ihre Arbeit an einem Sommermorgen ruhen lassen, um ein solches Spektakel zu bestaunen. Wer sich ein paar Minuten stehlen konnte, war gerannt und stand nun keuchend und schwitzend abseits der feinen Lübecker Bürger oder kam kurzerhand auf dem Rücken eines Ackergauls.
»Siehst du, da ist der Ballon«, sagte Hanna und zeigte mit dem Finger in die Richtung.
»Wo denn?« Femke war nicht gerade begeistert. Noch war das riesige Stück Stoff, das ausgebreitet auf dem Rasen lag, auch kaum als das zu erkennen, was es tatsächlich war. Das änderte sich, als Blanchard mit den Vorbereitungen begann. Es fauchte und zischte, eine gigantische Flamme schoss in die Höhe, und Femke machte rasch einen Schritt zurück, um sich hinter den Beinen ihrer Mutter in Sicherheit zu bringen. Ein Raunen ging durch die Menge.
»Wenn Menschen fliegen sollten, dann hätten sie Flügel«, stellte ein Herr mit einem Gehstock in der Hand und einer Melone auf dem Kopf fest.
»Ein Teufelskerl, dieser Franzose«, sagte ein anderer. »Überhaupt, diese Franzosen, erheben sich einfach in die Lüfte.«
Und ein Dritter meinte: »Ich würde auch gern mal Lübeck von oben sehen. Stell sich das einer vor!«
Inzwischen hatte sich der Ballon fast zur vollen Größe aufgebaut. Aus der Gondel, die darunter befestigt war, hörte man Kommandos. Dann war es so weit, und die Helfer am Boden ließen die Seile los, die Korb und Ballon auf der Erde gehalten hatten. Sie rieben sich die geröteten Hände und blickten mit offenen Mündern dem Franzosen im Korb nach, der höher und höher stieg. Ohs und Ahs waren zu hören.
»Ist das nicht zu hoch?«, fragte eine Dame nach einer Weile.
Immer kleiner wurde der Ballon und schwebte majestätisch über das Burgtor hinweg. Einen Moment sah es so aus, als bliebe die Gondel an der Turmspitze von St. Jakobi hängen. Hanna hielt den Atem an. Es ging jedoch alles gut. Blanchard trieb mit seinem Heißluftballon in Richtung Dom weiter. Der Himmel meinte es anscheinend gut mit ihm.
»Na, Femke, war das nicht schön?«, fragte Hanna.
»Hm.« Femke nickte.
»Komm, wir gehen zum Markt. Ich muss noch ein paar Besorgungen machen. Wenn wir Glück haben, sehen wir, wo der Ballon wieder runtergeht. Er soll hinter dem Mühlentor auf einer Wiese landen.«
Dieses Mal nahmen sie den direkten Weg durch die große Burgstraße und dann die Königstraße entlang. Zunächst wurden sie von der Menschenmenge, die ebenfalls auf die andere Seite der Stadt gelangen und den Rest des Spektakels sehen wollte, vorwärts geschoben. Doch dann verlief sich die Masse. Einer bog hier ab, weil er meinte, er könne sehen, wo der Wind das Luftgefährt hintrug, der andere dort. Hanna und Femke hielten auf das Rathaus zu. Dahinter befand sich der Marktplatz. Femke lief artig an der Hand ihrer Mutter. Sie war froh, dass nicht mehr gar so viele Menschen in der Königstraße unterwegs waren. Sie hatte es nicht gern, wenn viele Fremde um sie herum waren. Jetzt hüpfte sie wieder munter über das Kopfsteinpflaster. Plötzlich blieb sie wie angewurzelt stehen. Hanna, die damit nicht rechnen konnte, entglitt die Hand ihrer Tochter.
»Entschuldige, junge Dame, ich wollte dich nicht erschrecken.« Ein Mann, der mit seinem dicken Bauch kugelrund aussah, beugte sich zu Femke hinunter.
»Ist schon gut«, sagte Hanna freundlich. Sie streckte ihrer Tochter die Hand entgegen. »Komm, Femke.«
Doch die Kleine rührte sich nicht von der Stelle, sondern starrte gebannt auf das, was der Mann mit dem mächtigen Bauch, den kurzen grauen Stoppelhaaren und den lustigen runden Schweinsäuglein, die durch einen Zwicker, der auf seiner Nase klemmte, blickten, in den Händen hielt.
»Aha«, sagte er gedehnt, »ich habe dich gar nicht erschreckt. Du willst das hier ansehen.« Er hob die Hand und hielt Femke einen kleinen Elefanten aus Bernstein hin. »Die junge Dame hat Geschmack.« Und an Hanna gewandt verkündete er: »Ich habe noch andere feine Stücke. Kommen Sie nur herein und schauen Sie.«
Femke wollte auf der Stelle loslaufen, doch ihre Mutter hielt sie zurück. »Oh, nein danke. Das ist wirklich sehr nett von Ihnen, aber wir wollen gewiss keinen Bernstein kaufen.«
»Sie brauchen nichts zu kaufen. Ich zeige Ihnen nur das eine oder andere Stück. Ich hatte den Eindruck, die Kleine würde sich freuen.« Seine fleischige Hand tätschelte Femkes kupferrotes Haar, das zu zwei Schnecken aufgedreht war. Sie sah ihre Mutter flehend an.
»Also gut, aber nur ganz kurz.«
Sie betraten das kleine alte Haus mit dem geschwungenen Giebel. Es war dunkel in der erstaunlich geräumigen Diele, in der sich die Werkstatt des Bernsteindrehers befand. Die Augen mussten sich langsam an das schwache Licht gewöhnen. Hanna blinzelte ein wenig.
»Darum gehe ich manchmal vor die Tür«, erklärte der Mann. »Bei Tageslicht sieht man am besten, ob die Form getroffen und der Schliff vollendet ist.«
Der Arbeitsplatz des Mannes war genau gegenüber der Eingangstür vor einem kleinen Fenster. Dort befand sich eine Schale, an der er offenbar gerade arbeitete. Femke stand mit großen Augen davor und berührte das glatte glänzende Material vorsichtig.
»Nicht anfassen, Femke!«
Sofort zog sie die Hand zurück, stellte sich aber auf die Zehenspitzen, um besser sehen zu können.
»Ist schon in Ordnung. Kannst ruhig alles anfassen. Das geht so leicht nicht kaputt«, sagte der Mann. »Nur wenn dir was auf den Steinboden fällt, kann es zerbrechen. Ein bisschen vorsichtig musst du also schon sein.«
Femke sah ihn aus ihren grünen Augen an, den Kopf ein wenig schief gelegt. Dann betastete sie wieder behutsam die Schale.
»Spricht nicht gerade viel, die Kleine, was?«, fragte der Mann.
»Nein, sie ist Fremden gegenüber etwas scheu.«
Er hockte sich vor dem Kind hin. »Ich bin der Herr Delius«, stellte er sich vor. »Peter Heinrich Delius. So, nun bin ich kein Fremder mehr, und du brauchst keine Angst mehr vor mir zu haben. Ja?«
Femke nickte. »Ja«, sagte sie und lächelte.
Nun stellte sich Delius auch Hanna noch einmal in aller Form vor, und sie plauderten ein wenig, während Femke still und zufrieden die verschiedensten Gegenstände betrachtete und befühlte. Ihre Finger zeichneten Bögen und Vertiefungen nach. Höchst konzentriert verglich sie, wie unterschiedlich sich glatt polierte Flächen und die naturbelassenen rauhen anfühlten. Den Ballon hatte sie längst vergessen.
»So, Femke, wir wollen weiter«, sagte Hanna nach einer Weile. »Wir haben auf dem Markt noch einiges zu besorgen.«
»Nur noch ein bisschen«, bettelte Femke.
»Nein, mein Kind, wir haben Herrn Delius schon genug Zeit gestohlen«, beharrte Hanna.
»Ach was, ich habe mich über so netten Besuch gefreut. Kommt nicht oft vor, dass sich zwei so reizende Damen zum alten Einsiedler Hein Delius verirren.« Er zog die Augenbrauen hoch, wodurch der Zwicker von seiner Nase fiel, geradewegs in seine massige Hand. »Vielleicht kommst du mich ja mal wieder besuchen«, schlug er Femke vor.
Sie strahlte. »Gerne! Darf ich, Mutter?«
»Nun, wir werden sehen, ob es passt.«
Femke gab sich mit dieser ausweichenden Antwort nicht zufrieden. »Bitte, bitte, erlaubst du es?«, fragte sie beharrlich.
»Ja, ja, schön«, gab Hanna, der dabei ein wenig unbehaglich zumute war, nach.
Femke und Hein Delius strahlten um die Wette.
»Also dann«, sagte Hanna und war bereits an der Tür.
»Momentchen!«, rief Delius.
Er eilte erstaunlich leichtfüßig zu einer Kommode mit vielen Reihen flacher Schubladen. Darauf lag verschiedenstes Werkzeug ordentlich nach einem System sortiert, das wohl nur der Bernsteindreher selbst kannte. Er öffnete eine der Schubladen, holte ein Kästchen mit unbearbeiteten Bernsteinen verschiedener Größen hervor und kramte darin. »Hm«, machte er, während er den Zwicker wieder auf die Nase klemmte und die Oberlippe zur Nase schob, als ob sie die Augengläser halten sollte. Dann hatte er offenbar gefunden, was er gesucht hatte. »Das ist gut«, stellte er zufrieden fest. Er hockte sich noch einmal vor Femke hin, die erwartungsvoll zu ihm aufgesehen hatte. »Hier, junge Dame, das ist für dich!« Er hielt ihr ein honiggelbes Exemplar hin, dessen Form ganz grob an ein Herz erinnerte.
»Vielen Dank«, sagte Femke höflich und machte einen Knicks.
»Nee, wie drollig. Erkennst du denn auch, was das sein könnte?«
»Ein Herz«, antwortete Femke, ohne zu zögern.
»Ja, genau, ein Herz.« Er stand schnell auf, öffnete ein anderes Schubfach und holte eine kleine Feile hervor. Sie sah aus, als hätte sie bereits reichlich Bernstein abgetragen, und war selbst schon ganz glatt geschliffen. Viel konnte man damit wohl nicht mehr anfangen. Delius reichte sie Femke.
»Aber das Kind ist doch für so etwas noch viel zu klein«, protestierte Hanna. »Und überhaupt, sie ist doch ein Mädchen. Sie wird sich nur verletzen.«
»Ach was!« Er schüttelte den Kopf. »Viel kann mit dem ollen Ding nicht passieren. Lassen Sie sie es versuchen. Wer weiß, vielleicht hat sie Talent.«
Hanna wollte einen weiteren Einwand bringen. Ihr war überhaupt nicht wohl bei dem Gedanken, dass ihre Tochter mit diesem Werkzeug hantierte. Aber sie machte den Fehler, Femke anzusehen. Noch nie hatte sie diesen grünen Augen widerstehen können. Also schwieg sie.
Wieder wandte sich Delius Femke zu. »Du musst ganz vorsichtig damit sein, hörst du? Sonst erlaubt deine Mutter uns nie wieder so etwas.«
»Das werde ich«, versprach sie. Ihre Wangen glühten vor Aufregung.
»Gut. Also, du wirst alles wegraspeln, was die perfekte Form eines Herzens stört. Wenn das zu schwer für dich ist oder du nicht weiterkommst, dann besuchst du mich einfach, und ich helfe dir. Einverstanden?«
Femke nickte eifrig. »Einverstanden!«
Hanna holte ihre Geldbörse hervor und wollte Delius eine Kleinigkeit geben.
»Nee, nee, gute Frau, lassen Sie das mal sein. Ich freue mich, dass die Kleine so viel für den Bernstein übrighat. Noch mehr würde ich mich freuen, wenn sie ein bisschen Spaß dran hätte, damit zu hantieren. Vielleicht hat sie Talent«, wiederholte er.
Femkes Eltern begriffen schnell, dass ihre Tochter nicht nur Freude an der Kunst hatte, sondern auch eine Begabung dafür mitbrachte. Also luden sie zunächst Maler, später immer öfter auch Bildhauer ein, das Mädchen zu unterrichten. Femke genoss im elterlichen Haus eine gute Erziehung und Ausbildung. Ihre Mutter brachte ihr die französische Sprache bei. Immerhin kaufte man in Frankreich den gesamten Wein ein. Ihr Vater unterrichtete sie im Rechnen und in der Buchführung. Er behandelte sie zuweilen wie einen Jungen und schien einfach zu ignorieren, dass er nun zwar ein Kind, aber noch immer keinen Stammhalter, keinen Nachfolger im Geschäft hatte. Auch bestand er darauf, dass Femke ihn und Hanna nach Frankreich begleitete, wenn sie dort die Weingüter des Bordelais bereisten.