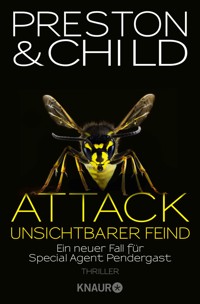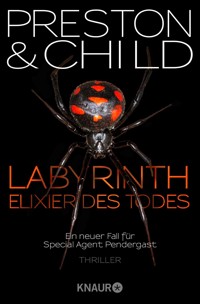9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Douglas Preston will einen schönen Sommer in der Toskana verbringen – doch dann erfährt er von einer spektakulären Mordserie. Die Bestie von Florenz hat sieben Paare brutal ermordet, und trotz langjähriger Polizeiarbeit, unzähligen Verdächtigen und Verurteilungen scheinen die Verbrechen noch nicht aufgeklärt zu sein. Gemeinsam mit dem italienischen Journalisten Mario Spezi beginnt Douglas Preston zu recherchieren. Die beiden decken nicht nur Ermittlungsfehler und Ungereimtheiten der italienischen Rechtsprechung auf, sondern geraten selbst in das Fadenkreuz der Ermittler. Der internationale Bestseller exklusiv im Knaur Taschenbuch: eine faszinierende und schockierende Anatomie des Verbrechens! Die Bestie von Florenz von Douglas Preston · Mario Spezi: Spannung pur im eBook!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 499
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Douglas Preston / Mario Spezi
Die Bestie von Florenz
Aus dem Amerikanischen von Katharina Volk
Knaur e-books
Inhaltsübersicht
Anmerkungen zur deutschen Ausgabe
Zu den italienischen Strafverfolgungsbehörden gehören die Carabinieri, eine militärische Einheit mit entsprechenden Dienstgraden. Sie arbeiten mit der Staatsanwaltschaft zusammen und stellen die wichtigste Polizeipräsenz auf dem Lande dar. Außerdem gibt es noch die »normale« Polizei, die Polizia di Stato oder Staatspolizei (zu der die Kriminalpolizei gehört), und in größeren Städten eine Stadtpolizei, Polizia Municipale, vergleichbar mit dem Ordnungsamt. Die Aufgaben dieser verschiedenen Einheiten überschneiden sich teilweise bzw. zwingen sie zur Zusammenarbeit. Dies soll Machtkonzentration und Korruption verhindern. So kann es zur gleichzeitigen Anwesenheit von »Offizieren« und »Beamten« an Tatorten und bei kriminalistischen Ermittlungen kommen.
Die Zeittafel der Ereignisse, einige Bilder aus den Archiven von Douglas Preston und Mario Spezi und ein Personenverzeichnis befinden sich in einem Anhang am Ende des Buchs.
Meinen Verbündeten bei unserem Italienabenteuer: meiner Frau Christine und meinen Kindern Aletheia und Isaac. Und meiner Tochter Selene, die klugerweise mit beiden Füßen fest in Amerika geblieben ist.
Douglas Preston
Für meine Frau Myriam und meine Tochter Elena,die mir meine Besessenheit verziehen haben.
Mario Spezi
1 BARBARA LOCCI & ANTONIO LO BIANCO • August 1968 • Die Morde der »Sardinien-Spur«
2 STEFANIA PETTINI & PASQUALE GENTILCORE • September 1974 • Borgo San Lorenzo
3 CARMELA DE NUCCIO & GIOVANNI FOGGI • Juni 1981 • Via dell’Arrigo
4 SUSANNA CAMBI & STEFANO BALDI • Oktober 1981 • Campo delle Bartoline
5 ANTONELLA MIGLIORINI & PAOLO MAINARDI • Juli 1982 • Montespertoli
6 HORST MEYER & UWE RÜSCH • September 1983 • Giogoli
7 PIA RONTINI & CLAUDIO STEFANACCI • Juli 1984 • Vicchio
8 NADINE MAURIOT & JEAN-MICHEL KRAVEICHVILI • September 1985 • Scopeti
Einleitung
1969, in dem Jahr, als der Mensch auf dem Mond landete, verbrachte ich einen unvergesslichen Sommer in Italien. Ich war dreizehn Jahre alt. Meine Familie mietete eine Villa an der toskanischen Küste, die auf einem Kalksteinfelsen über dem Mittelmeer lag. Meine beiden Brüder und ich trieben uns den ganzen Sommer lang bei einer archäologischen Ausgrabungsstätte herum und schwammen an einem kleinen Strand im Schatten einer Burg aus dem 15. Jahrhundert, genannt Puccinis Turm, weil der Komponist hier Turandot geschrieben hatte. Wir grillten Tintenfisch am Strand, schnorchelten zwischen den Riffen und sammelten uralte römische Tesserae, die das erodierende Ufer freigab. In einem nahen Hühnerstall fand ich den Rand einer römischen Amphore, zweitausend Jahre alt, mit dem Stempel »SES« und der Abbildung eines Dreizacks versehen – die Archäologen sagten mir, das Stück habe der Familie Sestius gehört, einer der reichsten Kaufmannsfamilien der frühen römischen Republik. In einer stinkenden Bar beobachteten wir auf einem flackernden alten Schwarzweiß-Fernseher, wie Neil Armstrong den Mond betrat, während um uns herum ein Tumult losbrach. Die Hafenarbeiter und Fischer fielen sich in die Arme und küssten sich, Tränen liefen ihnen über die rauhen Gesichter, und sie schrien: »Viva l’America! Viva l’America!«
Von jenem Sommer an wusste ich, dass ich später in Italien leben wollte.
Ich wurde Journalist und Krimiautor. 1999 kehrte ich im Auftrag des Magazins The New Yorker nach Italien zurück. Ich wollte einen Artikel über den mysteriösen Künstler Masaccio schreiben, der mit seinen beeindruckenden Fresken in der Brancacci-Kapelle in Florenz die Renaissance einleitete und im Alter von sechsundzwanzig Jahren starb – angeblich wurde er vergiftet. An einem kalten Februarabend, in meinem Hotelzimmer in Florenz mit Blick auf den Arno, griff ich zum Telefon, rief meine Frau Christine an und fragte sie, was sie von der Idee hielt, nach Florenz zu ziehen. Sie sagte ja. Am nächsten Morgen rief ich einen Immobilienmakler an und begann, mir Wohnungen anzusehen, und zwei Tage später hatte ich das oberste Stockwerk eines Palazzos aus dem 15. Jahrhundert gemietet. Als Schriftsteller konnte ich schließlich überall leben – warum nicht in Florenz?
Während ich in jener kalten Februarwoche durch Florenz streifte, dachte ich schon über den Krimi nach, den ich schreiben würde, wenn wir hierhergezogen waren. Er würde in Florenz spielen und sich um ein verlorenes Gemälde von Masaccio drehen.
Wir zogen also nach Italien. Christine und ich trafen am 1. August 2000 mit unseren Kindern Isaac und Aletheia, fünf und sechs Jahre alt, in Florenz ein. Erst wohnten wir in der Wohnung an der Piazza Santo Spirito, die ich gemietet hatte, und dann zogen wir aufs Land, in einen winzigen Ort namens Giogoli in den Hügeln südlich von Florenz. Dort mieteten wir ein altes Bauernhaus, versteckt an einer Hügelflanke am Ende eines Feldwegs und umgeben von Olivenhainen.
Ich begann mit der Recherche für meinen Roman. Da es ein Krimi werden sollte, musste ich so viel wie möglich über die italienische Polizei und ihre Arbeitsweise bei Ermittlungen in Mordfällen herausfinden. Ein italienischer Freund empfahl mir einen legendären toskanischen Kriminalreporter namens Mario Spezi, der mehr als zwanzig Jahre lang für La Nazione, die Tageszeitung der Toskana und Mittelitaliens, die cronaca nera (»schwarze Geschichte« oder Kriminalreportage) geliefert hatte. »Er weiß mehr über die Polizei als die Polizei selbst«, wurde mir gesagt.
So fand ich mich also im fensterlosen Hinterzimmer des Caffè Ricchi an der Piazza Santo Spirito wieder, und mir gegenüber saß Mario Spezi persönlich.
Spezi war ein Journalist der alten Schule, trocken, klug, zynisch und mit einem starken Sinn für alles Absurde. Ganz gleich, was ein menschliches Wesen tat, und sei es noch so verderbt – nichts konnte diesen Mann überraschen. Er hatte dichtes graues Haar, ein ironisches, angenehmes, wettergegerbtes Gesicht mit klugen braunen Augen, die hinter einer Goldrandbrille lauerten. Er lief in einem Trenchcoat und einem Bogart-Hut herum wie eine Figur aus einem Roman von Raymond Chandler, und er war ein großer Fan des amerikanischen Blues, des film noir und von Philip Marlowe.
Die Kellnerin brachte ein Tablett mit zwei schwarzen Espressi und zwei Gläsern Mineralwasser. Spezi atmete eine Rauchwolke aus, hielt seine Zigarette ein wenig beiseite, kippte den Espresso mit einer scharfen Handbewegung hinunter, bestellte einen weiteren und steckte sich die Zigarette wieder zwischen die Lippen.
Wir begannen uns zu unterhalten, und Spezi sprach sehr langsam, aus Rücksicht auf mein erbärmliches Italienisch. Ich beschrieb ihm den Plot meines Buchs. Eine der Hauptfiguren sollte Offizier bei den Carabinieri sein, und ich bat ihn, mir zu erklären, wie die Carabinieri arbeiteten. Spezi beschrieb mir den Aufbau der Carabinieri, ihre militärischen Ränge, wodurch sie sich von der normalen Polizei unterschieden und wie sie bei Ermittlungen vorgingen, während ich mir Notizen machte. Er versprach, mich mit einem Colonnello der Carabinieri zusammenzubringen, der ein alter Freund von ihm war. Schließlich gerieten wir ins Plaudern über Italien im Allgemeinen, und er fragte mich, wo ich wohnte.
»In einem winzigen Ort namens Giogoli.«
Spezis Augenbrauen schossen förmlich in die Höhe. »Giogoli? Das kenne ich gut. Wo genau?«
Ich nannte ihm die Adresse.
»Giogoli … ein bezauberndes altes Dorf. Es ist für drei Wahrzeichen berühmt. Vielleicht kennen Sie sie schon?«
Ich kannte sie nicht.
Mit leicht belustigtem Lächeln fing er an zu erzählen. Die erste Sehenswürdigkeit war die Villa Sfacciata, wo einer seiner eigenen Vorfahren, Amerigo Vespucci, gelebt hatte. Vespucci war der Florentiner Navigator, Kartograph und Entdecker, der als Erster erkannte, dass sein Freund Christoph Kolumbus nicht eine unbekannte Küste Indiens, sondern einen brandneuen Kontinent entdeckt hatte. Nach ihm, Amerigo (Americus auf Latein), wurde diese Neue Welt benannt. Das zweite Wahrzeichen, fuhr Spezi fort, war ebenfalls eine Villa, genannt I Collazzi, mit einer Fassade, die angeblich von Michelangelo gestaltet worden war; Prinz Charles und Diana hatten Urlaub in dieser Villa gemacht, und dort hatte der Prinz viele seiner Aquarelle der toskanischen Landschaft gemalt.
»Und die dritte Berühmtheit?«
Spezis Lächeln wurde noch breiter. »Das ist der interessanteste Ort von allen. Er liegt direkt vor Ihrer Haustür.«
»Vor unserer Tür liegt nur ein Olivenhain.«
»Genau. Und in diesem Olivenhain hat sich einer der grauenvollsten Morde der italienischen Kriminalgeschichte ereignet. Ein Doppelmord, begangen von unserer Version von Jack the Ripper.«
Als Krimiautor war ich eher fasziniert als bestürzt.
»Ich habe ihm seinen Namen gegeben«, erzählte Spezi. »Ich habe ihn il Mostro di Firenze genannt, die Bestie von Florenz. Ich habe von Anfang an über den Fall berichtet. Bei La Nazione hieß ich bald nur noch der ›Bestiologe‹.« Er lachte, ein plötzliches, unbekümmertes Gackern, und Rauch zischte zwischen seinen Zähnen hervor.
»Erzählen Sie mir von dieser Bestie von Florenz.«
»Sie haben noch nie von ihr gehört?«
»Nein, noch nie.«
»Ist die Geschichte in Amerika denn nicht bekannt?«
»Dort kennt sie kein Mensch.«
»Das überrascht mich. Sie kommt mir vor wie … eine beinahe amerikanische Geschichte. Und sogar Ihr FBI war darin verwickelt – diese Verhaltensforscher, die durch Das Schweigen der Lämmer so berühmt geworden sind und die man heute ›Profiler‹ nennt. Ich habe Thomas Harris sogar bei Gericht gesehen, er hat sich Notizen auf so einem gelben Schreibblock gemacht. Es heißt, er hätte Hannibal Lecter nach dem Vorbild der Bestie von Florenz geschaffen.«
Jetzt war ich wirklich neugierig geworden. »Erzählen Sie mir die ganze Geschichte.«
Spezi kippte seinen zweiten Espresso hinunter, zündete sich noch eine Gauloises an und sprach durch Rauchwolken hindurch. Als er beim Erzählen in Fahrt geriet, holte er ein Notizbuch und einen abgegriffenen goldenen Stift aus der Tasche und begann, die Geschichte grafisch nachzuzeichnen. Der Stift huschte und schoss über das Papier, zeichnete Pfeile und Kreise und Kästchen und gestrichelte Linien, illustrierte die komplexen Verbindungen zwischen den Verdächtigen, den Morden, den Verhaftungen, den Prozessen und den vielen Sackgassen der Ermittlungen. Es war eine lange Geschichte, und während er leise erzählte, füllte sich allmählich die leere Seite seines Notizbuchs.
Ich hörte zu, erst überrascht, dann staunend. Als Krimiautor hielt ich mich für einen Connaisseur finsterer Storys. Ganz sicher hatte ich schon eine Menge davon gehört. Aber während sich die Geschichte der Bestie von Florenz vor mir entfaltete, wurde mir klar, dass sie etwas Besonderes war. Eine Geschichte, die eine ganz eigene Kategorie darstellte. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass der Fall der Bestie von Florenz möglicherweise – vielleicht – die außergewöhnlichste Kriminalgeschichte ist, von der die Welt je gehört hat.
Zwischen 1974 und 1985 wurden sieben Pärchen – insgesamt also vierzehn Menschen – beim Sex in geparkten Autos in den schönen Hügeln rund um Florenz ermordet. Der Fall war zur langwierigsten und teuersten Ermittlung in der italienischen Geschichte geworden. Fast hunderttausend Männer wurden überprüft, mehr als ein Dutzend festgenommen und die meisten von ihnen wieder entlassen, wenn die Bestie erneut zuschlug. Nicht wenige Leben wurden durch Gerüchte und falsche Anschuldigungen ruiniert. Die Florentiner jener Generation, die zur Zeit der Morde an der Schwelle zum Erwachsenwerden stand, erzählen, dass diese Geschichte die Stadt und ihr eigenes Leben verändert hat. Es gab Selbstmorde, Exhumierungen, angebliche Vergiftungen, Körperteile wurden per Post verschickt, Séancen auf Friedhöfen abgehalten und Beweise untergeschoben, es kam zu Prozessen und grausamen Rachefeldzügen seitens der Ankläger. Die Untersuchung des Falls war wie ein bösartiger Tumor, der sich rückwärts durch die Zeit fraß und auswärts in den Raum ausdehnte, bis in verschiedene andere Städte metastasierte und anschwoll mit neuen Ermittlungen, neuen Richtern, Polizisten und Staatsanwälten, noch mehr Verdächtigen, weiteren Festnahmen und noch mehr Leben, die dadurch ruiniert wurden.
Trotz der längsten Mörderjagd in der Geschichte des modernen Italien wurde die Bestie von Florenz nie gefunden. Als ich im Jahr 2000 in Italien ankam, war der Fall nach wie vor ungelöst, die Bestie vermutlich immer noch auf freiem Fuß.
Spezi und ich wurden nach jenem ersten Treffen gute Freunde, und bald faszinierte der Fall mich genauso wie ihn. Im Frühjahr 2001 schickten Spezi und ich uns an, die Wahrheit aufzudecken und den wahren Mörder aufzuspüren. Dieses Buch erzählt die Geschichte dieser Suche, bei der wir schließlich dem Mann begegneten, von dem wir glauben, er könnte die Bestie von Florenz sein.
Im Verlauf der Geschichte wurden Spezi und ich selbst in sie verwickelt. Mir wurde Beihilfe zum Mord vorgeworfen, Beweisfälschung, Meineid und Strafvereitelung. Man drohte mir damit, mich zu verhaften, falls ich je wieder einen Fuß auf italienischen Boden setzen sollte. Spezi erging es noch schlimmer: Ihm warf man vor, er selbst sei die Bestie von Florenz.
Dies ist die Geschichte, die Spezi erzählte.
TEIL 1
Die Geschichte von Mario Spezi
Kapitel 1
Der Morgen des 7. Juni 1981 versprach einen strahlend schönen Tag in Florenz, Italien. Es war ein stiller Sonntag mit blauem Himmel und einer leichten Brise aus den Hügeln, die den Duft von der Sonne gewärmter Zypressen in die Stadt trug. Mario Spezi saß an seinem Schreibtisch in der Redaktion der Nazione, für die er seit mehreren Jahren als Reporter arbeitete, rauchte und las Zeitung. Da trat ein Kollege zu ihm, der normalerweise für das Kriminalressort zuständig war – eine lebende Legende im wahrsten Sinne des Wortes, denn er hatte zwanzig Jahre Berichterstattung über die Mafia überlebt.
Der Mann setzte sich auf Spezis Schreibtischkante. »Heute Morgen habe ich eine kleine Verabredung«, sagte er. »Sie sieht recht gut aus, ist verheiratet …«
»In deinem Alter?«, entgegnete Spezi. »An einem Sonntagmorgen noch vor der Kirche? Ist das nicht ein bisschen übertrieben?«
»Ein bisschen übertrieben? Mario, ich bin Sizilianer!« Er schlug sich auf die Brust. »Ich komme aus dem Land, in dem die Götter geboren wurden. Also, ich hatte gehofft, dass du heute Vormittag für mich übernehmen könntest. Dich ein bisschen im Hauptquartier herumtreiben, falls sich etwas ergibt. Ich habe meine Kontakte bei der Polizei schon angerufen, es ist nichts los. Und wie wir alle wissen« – und dann sprach er den Satz aus, den Spezi nie wieder vergessen würde – »passiert an einem Sonntagmorgen in Florenz nie etwas.«
Spezi verneigte sich und ergriff seine Hand. »Wenn der Pate es befiehlt, werde ich selbstverständlich gehorchen. Ich küsse Ihre Hand, Don Rosario.«
Spezi saß bis gegen Mittag in der Redaktion herum und tat nichts. Dies war der faulste, ereignisloseste Tag seit Wochen. Vielleicht breitete sich deshalb eine vage Befürchtung in ihm aus, die alle Kriminalreporter hin und wieder befällt – dass doch etwas los sein könnte und andere Reporter ihm zuvorkommen würden. Also stieg Spezi in seinen Citroën und fuhr den knappen Kilometer zum Polizeipräsidium, einem uralten, heruntergekommenen Gebäude im ältesten Teil von Florenz. Es war vor langer, langer Zeit einmal ein Kloster gewesen, und die winzigen Büros der Ermittler waren die ehemaligen Zellen der Mönche. Spezi hetzte, immer zwei Stufen auf einmal, die Treppe zum Büro des Leiters der Squadra Mobile hinauf. Die laute, mürrische Stimme von Maurizio Cimmino hallte aus seiner offenen Tür den Flur entlang, und Spezi wurde von Grauen erfasst.
Es war etwas geschehen.
Spezi fand den Chef der mobilen Einheit der Kriminalpolizei in Hemdsärmeln am Schreibtisch vor, nassgeschwitzt, den Telefonhörer zwischen Kinn und Schulter geklemmt. Im Hintergrund plärrte der Polizeifunk – es waren mehrere Polizisten zu hören, die in starkem Dialekt redeten und fluchten.
Cimmino entdeckte Spezi in der Tür und fuhr ihn wütend an. »Herrgott, Mario, schon so schnell? Gehen Sie mir ja nicht auf die Nerven, ich weiß bis jetzt auch nur, dass es zwei sind.«
Spezi tat so, als wüsste er, worum es ging. »Gut. Ich lasse Ihnen Ihre Ruhe. Sagen Sie mir nur, wo sie sind.«
»Via dell’Arrigo, wo auch immer das sein mag, verflucht … irgendwo in Scandicci, glaube ich.«
Spezi rannte die Treppe hinunter und rief vom Münztelefon im Erdgeschoss aus seinen Chefredakteur an. Er wusste zufällig ganz genau, wo die Via dell’Arrigo war: Einem Freund von ihm gehörte die Villa dell’Arrigo, ein spektakuläres Anwesen am oberen Ende der schmalen, gewundenen Landstraße, die ihren Namen trug.
»Fahren Sie da raus, schnell«, sagte sein Chefredakteur. »Wir schicken einen Fotografen.«
Spezi verließ das Polizeipräsidium und raste durch die verlassenen mittelalterlichen Straßen der Stadt und hinaus in die florentinischen Hügel. Um ein Uhr am Sonntagmittag war die gesamte Bevölkerung nach der Kirche zu Hause und versammelte sich am Esstisch zur bedeutendsten Mahlzeit der Woche in einem Land, wo das Essen in famiglia eine heilige Angelegenheit ist. Die Via dell’Arrigo führte einen steilen Hügel empor, zwischen Weinbergen, Zypressen und Hainen uralter Oliven hindurch. Je höher die Straße zu den bewaldeten Kuppen der Valicaia-Hügel anstieg, desto großartiger wurde die Aussicht, bis man über die Stadt Florenz bis zu den Apenninen dahinter blicken konnte.
Spezi entdeckte den Carabinieri-Streifenwagen und hielt dahinter am Straßenrand. Alles war still: Cimmino und seine Einheit waren noch nicht eingetroffen, ebenso wenig der Gerichtsmediziner oder sonst jemand. Der Offizier, der den Tatort bewachte, kannte Spezi gut und hielt ihn nicht auf, als dieser ihn mit einem Nicken begrüßte und an ihm vorbeispazierte. Er ging einen schmalen Trampelpfad durch einen Olivenhain hinab, der an einer einsamen Zypresse endete. Direkt dahinter sah er den Schauplatz des Verbrechens, der noch nicht gesichert oder abgeriegelt worden war.
Die Szene, so erzählte Spezi mir, hatte sich auf ewig in sein Gedächtnis eingebrannt. Die toskanische Landschaft lag unter dem kobaltblauen Himmel vor ihm. Eine mittelalterliche Burg, umrahmt von Zypressen, krönte einen nahen Hügel. In weiter Ferne konnte er durch den frühsommerlichen Dunst die terracottafarbene Kuppel des Duomo über der Stadt Florenz aufragen sehen – das bedeutendste Wahrzeichen der Renaissance. Der Junge auf dem Beifahrersitz schien zu schlafen, den Kopf ans Fenster gelehnt, die Augen geschlossen, das Gesicht entspannt und unbekümmert. Nur ein kleines schwarzes Mal an seiner Schläfe in einer Linie mit einem Loch im gesprungenen Fenster der Fahrertür wies darauf hin, dass hier ein Verbrechen begangen worden war.
Auf dem Boden im Gras lag eine Handtasche aus geflochtenem Stroh, weit geöffnet und falsch herum, als hätte jemand sie durchwühlt und dann weggeworfen.
Er hörte das Zischeln von Schritten im hohen Gras, und der Carabiniere trat neben ihn.
»Die Frau?«, fragte Spezi.
Der Offizier wies mit einem Nicken hinter den Wagen. Die Leiche des Mädchens lag ein Stück entfernt am Fuß einer kleinen Böschung zwischen bunten Wiesenblumen. Auch sie war erschossen worden und lag auf dem Rücken, nackt bis auf eine Goldkette, die ihr zwischen die leicht geöffneten Lippen hochgerutscht war. Ihre blauen Augen waren offen und schienen überrascht zu Spezi aufzublicken. Alles wirkte unnatürlich gelassen, reglos, keine Anzeichen von Angst oder Kampf waren zu sehen – wie ein Schaubild im Museum. Aber da war doch etwas einmalig Grausiges: Der Schambereich unterhalb ihres Bauchs war einfach nicht mehr da.
Spezi drehte sich um und sah den Polizisten hinter sich stehen. Der Mann schien die Frage in Spezis Blick zu begreifen.
»Während der Nacht … waren die Tiere dran … Und die heiße Sonne hat den Rest erledigt.«
Spezi fummelte die Gauloises aus seiner Tasche und zündete sich im Schatten der Zypresse eine an. Er rauchte schweigend auf halbem Wege zwischen den beiden Opfern und rekonstruierte das Verbrechen im Kopf. Die beiden waren offenbar überfallen worden, während sie im Auto miteinander geschlafen hatten. Vermutlich hatten sie vorher in der Disco Anastasia getanzt, einem beliebten Treffpunkt für Teenager unterhalb des Hügels. (Die Polizei würde das später bestätigen.) Es war eine dunkle Neumondnacht gewesen. Der Mörder musste sich lautlos angeschlichen haben; vielleicht hatte er eine Weile zugesehen, wie sie sich liebten, und dann zugeschlagen, als sie am verletzlichsten gewesen waren. Es war ein Verbrechen mit geringem Risiko – ein feiges Verbrechen –, zwei Leute im beengten Raum eines Autos aus nächster Nähe zu erschießen, in einem Augenblick, da sie ihre Umgebung überhaupt nicht wahrnahmen.
Der erste Schuss war für ihn bestimmt gewesen, durch das Autofenster hindurch, und er hatte vielleicht gar nichts mehr von dem Überfall mitbekommen. Ihr Ende war grausamer gewesen; sie musste erkannt haben, was geschah. Nachdem er sie getötet hatte, hatte der Mörder sie vom Auto weggeschleift – Spezi konnte die Spuren im Gras sehen – und sie am Fuß der Böschung liegen lassen. Der Tatort lag schockierend frei, direkt neben einem Fußweg, der parallel zur Straße verlief, völlig offen und aus mehreren Richtungen gut zu sehen.
Spezis Überlegungen wurden von der Ankunft von Hauptkommissar Sandro Federico unterbrochen, der in Begleitung eines Staatsanwalts namens Adolfo Izzo und den Leuten von der Spurensicherung erschien. Federico hatte die typisch römische, lockere Art und gab sich stets nonchalant und leicht amüsiert. Izzo hingegen war auf seinem ersten Posten und erschien gespannt wie eine Feder. Er sprang aus dem Streifenwagen und stürzte auf Spezi los. »Was haben Sie hier zu suchen?«, fragte er zornig.
»Ich arbeite.«
»Sie müssen den Tatort auf der Stelle verlassen. Sie können nicht hier herumstehen.«
»Schon gut, schon gut …« Spezi hatte alles gesehen, was er sehen wollte. Er steckte Stift und Notizbuch ein, stieg in seinen Wagen und fuhr zurück zum Polizeipräsidium. Im Flur vor Cimminos Büro lief er einem Wachtmeister über den Weg, den er gut kannte; sie hatten sich hin und wieder einen Gefallen erwiesen. Der Polizist zog ein Foto aus der Tasche und hielt es ihm hin. »Wollen Sie es haben?«
Das Foto zeigte die beiden Opfer lebendig, Arm in Arm auf einer niedrigen Mauer sitzend.
Spezi nahm es. »Ich bringe es später am Nachmittag zurück, wenn wir es kopiert haben.«
Cimmino nannte Spezi die Namen der beiden Opfer: Carmela De Nuccio, einundzwanzig Jahre alt, hatte für das Modehaus Gucci in Florenz gearbeitet. Der Mann hieß Giovanni Foggi, war dreißig Jahre alt und Angestellter des örtlichen Stromversorgers. Die beiden waren verlobt. Ein Polizist, der an seinem freien Tag einen Sonntagsspaziergang in den Hügeln gemacht hatte, hatte die beiden um halb elf gefunden. Das Verbrechen war kurz vor Mitternacht geschehen, und es gab gewissermaßen einen Zeugen dafür: einen Bauern, der auf der anderen Straßenseite wohnte. Er hatte John Lennons »Imagine« aus einem Auto gehört, das in den Feldern geparkt war. Der Song war mittendrin plötzlich abgebrochen. Er hatte keine Schüsse gehört. Die Schüsse waren aus einer Pistole abgefeuert worden – die zurückgebliebenen Hülsen gehörten zu Geschossen der Winchester-Serie H, Kaliber 22. Cimmino sagte, die beiden Opfer seien sauber und hätten keine Feinde, bis auf den Mann, den Carmela verlassen hatte, als sie Giovanni kennengelernt hatte.
»Es ist beängstigend«, sagte Spezi zu ihm. »Ich habe so etwas hier in der Gegend noch nie gesehen … Und wenn man erst daran denkt, was die Tiere mit ihr gemacht –«
»Welche Tiere?«, unterbrach ihn Cimmino.
»Die Tiere, die in der Nacht an der Leiche waren … die das Mädchen so verstümmelt haben … zwischen den Beinen.«
Cimmino starrte ihn an. »Tiere, von wegen! Der Mörder hat das getan.«
Spezi wurde eiskalt. »Der Mörder? Was hat er getan, auf sie eingestochen?«
Kommissar Cimmino antwortete ihm in besonders nüchternem Tonfall, vielleicht seine Art, das Grauen zurückzudrängen. »Nein, er hat nicht auf sie eingestochen. Er hat ihr die Vulva herausgeschnitten … und sie mitgenommen.«
Spezi verstand nicht sofort. »Er hat ihre Vulva mitgenommen? Wohin?« Sobald er die Frage ausgesprochen hatte, wurde ihm klar, wie dumm sie sich anhörte.
»Sie ist einfach nicht mehr da. Er hat sie eben mitgenommen.«
Kapitel 2
Am nächsten Tag, Montagvormittag um elf Uhr, fuhr Spezi nach Careggi, einem Stadtviertel im Norden von Florenz. Es hatte vierzig Grad im Schatten, und die Luftfeuchtigkeit reichte fast an eine heiße Dusche heran. Smog lag wie ein Leichentuch über der Stadt. Er fuhr eine Nebenstraße voller Schlaglöcher entlang zu einem gelben Gebäude, einer verfallenden Villa, die nun zu einem Klinik-Komplex gehörte. Der Putz bröckelte in tellergroßen Stücken von den Mauern.
Der Empfang der Gerichtsmedizin war ein höhlenartiger Raum, dominiert von einem riesigen Marmortisch, auf dem ein Computer stand, der mit einem weißen Tuch bedeckt war wie ein Leichnam. Der Rest des Tisches war leer. Dahinter stand in einer Nische in der Wand die bronzene Büste einer bärtigen Koryphäe auf dem Gebiet der menschlichen Anatomie, die Spezi streng entgegenblickte.
Eine Marmortreppe führte hinauf und hinunter. Spezi ging nach unten.
Die Treppe führte zu einem unterirdischen Flur, der von summenden Neonröhren erleuchtet und mit Türen gesäumt war. Die Wände waren gekachelt. Die letzte Tür war offen, und das schrille Kreischen einer Knochensäge war zu hören. Ein schwarzes Rinnsal sickerte zur Tür heraus auf den Flur, wo es in einem Abfluss verschwand.
Spezi betrat den offenen Raum.
»Na, wen haben wir denn da!«, rief Fosco, der Assistent des Gerichtsmediziners. Er schloss die Augen, breitete die Arme aus und deklamierte: »Nicht viele finden hierher zu mir …«
»Ciao, Fosco«, sagte Spezi. »Wer ist das?« Er wies mit einem Nicken auf die Leiche auf einem Stahltisch, an der gerade ein Assistent arbeitete. Die kleine Kreissäge hatte soeben das Hirn freigelegt. Auf dem Untersuchungstisch neben dem weißen Gesicht der Leiche stand eine leere Kaffeetasse, umgeben von Krümeln einer soeben verzehrten Brioche.
»Der da? Ein brillanter Gelehrter, ein ehrwürdiger Professor der Academia della Crusca, man stelle sich vor. Aber wie Sie sehen, musste ich eine weitere Enttäuschung verkraften. Ich habe soeben den Schädel geöffnet, und was finde ich darin? Wo ist all seine Weisheit? Pah! Von innen sieht er ganz genauso aus wie der Schädel der albanischen Nutte, den ich gestern geöffnet habe. Vielleicht hielt sich der Professor für besser als sie! Aber wenn ich sie dann aufschneide, stelle ich immer wieder fest, dass sie alle gleich sind. Und beide haben dasselbe Ziel erreicht: meinen Stahltisch. Warum also hat er sich so damit gequält, über so vielen Büchern zu brüten? Pah! Nehmen Sie meinen Rat an, Herr Journalist: Essen Sie, trinken Sie, genießen Sie das Leben …«
Eine höfliche Stimme von der Tür her brachte Fosco zum Schweigen. »Guten Tag, Signor Spezi.« Das war Mauro Maurri, der Gerichtsmediziner selbst, der eher an einen englischen Gentleman vom Lande erinnerte: hellblaue Augen, graues Haar in modischer Länge, eine beigefarbene Strickjacke und Cordhose. »Wollen wir uns nach oben in mein Büro zurückziehen? Dort können wir uns ungestörter unterhalten.«
Das Büro von Mauro Maurri war ein langer, schmaler Raum voller Bücher und Magazine über Kriminologie und forensische Pathologie. Er hielt das Fenster offenbar geschlossen, damit die Hitze nicht hereindrang, und hatte nur eine kleine Lampe auf seinem Schreibtisch eingeschaltet, so dass der Rest seines Büros im Halbdunkel lag.
Spezi nahm Platz, holte eine Packung Gauloises hervor, bot sie Maurri an, der mit einem Kopfschütteln ablehnte, und zündete sich eine an.
Maurri sprach sehr bedächtig. »Der Mörder hat ein Messer oder ein anderes scharfes Instrument benutzt. Es hatte eine Kerbe oder Scharte in der Mitte, vielleicht ein Defekt, vielleicht auch nicht. Es kann eine bestimmte Art Messer gewesen sein, die eine solche Form hat. Ich habe den Eindruck, obwohl ich das nicht beschwören kann, dass es ein Tauchermesser war. Drei Schnitte wurden damit geführt, um das Organ zu entnehmen. Der erste im Uhrzeigersinn, von elf Uhr bis sechs Uhr; der zweite gegen den Uhrzeigersinn, wiederum von elf bis sechs Uhr. Der dritte Schnitt wurde von oben nach unten geführt, um das Organ herauszulösen. Drei saubere, entschlossene Schnitte mit einer extrem scharfen Klinge.«
»Wie Jack.«
»Wie bitte?«
»Jack the Ripper.«
»Ich verstehe, ja. Jack the Ripper. Nein … nicht wie er. Unser Mörder ist kein Chirurg. Auch kein Metzger. Zu dieser Tat waren keinerlei anatomische Kenntnisse erforderlich. Die Ermittler bedrängen mich mit ihren Fragen – ›Ist die Operation gut gemacht worden?‹ Was soll das heißen, ›gut gemacht‹? Wer hätte denn schon jemals eine solche Operation durchgeführt? Sie wurde jedenfalls von jemandem verübt, der nicht zögerte, der vielleicht bestimmte Werkzeuge bei seiner Arbeit verwendet. War das Mädchen nicht in der Lederverarbeitung bei Gucci tätig? Hat sie da nicht ein Schustermesser benutzt? Hat ihr Vater nicht ebenfalls Leder verarbeitet? Vielleicht war es jemand aus ihrem Umfeld … Es muss jemand sein, der sich wirklich auf den Umgang mit einem Messer versteht – ein Jäger oder Tierpräparator … Vor allem aber besaß derjenige Entschlossenheit und eiserne Nerven. Er arbeitete zwar an einer Leiche, aber die war immerhin gerade erst tot.«
»Dr. Maurri«, fragte Spezi, »haben Sie eine Vorstellung davon, was er mit diesem … Fetisch getan haben könnte?«
»Ich flehe Sie an, fragen Sie mich nur das nicht.«
Als der Montagnachmittag in einer ofengleichen, grauen Trübe versank und es sicher schien, dass es an diesem Tag keine weitere Entwicklung in dem Fall geben würde, fand im Büro des Chefs vom Dienst der Nazione eine große Konferenz statt. Der Verleger selbst war anwesend, außerdem der Herausgeber, der Chefredakteur der Nachrichten, mehrere Journalisten und Spezi. La Nazione war die einzige Zeitung, die Informationen über die Verstümmelung der Leiche hatte; die anderen Tageszeitungen wussten nichts davon. Das würde ein exklusiver Knüller werden. Der Chef vom Dienst erklärte, die Einzelheiten des Verbrechens müssten unbedingt in der Schlagzeile erwähnt werden. Der Herausgeber widersprach mit der Begründung, die Details seien zu grausig. Während Spezi seine Notizen laut vorlas, um bei der Klärung dieser Frage zu helfen, platzte ein junger Kriminalreporter in die Besprechung.
»Bitte entschuldigen Sie die Störung«, sagte er, »aber mir ist gerade etwas eingefallen. Ich glaube, es könnte vor fünf oder sechs Jahren einen ähnlichen Mord gegeben haben.«
Der Chef vom Dienst sprang auf. »Das sagen Sie uns jetzt, kurz vor Redaktionsschluss? Wollten Sie vielleicht abwarten, bis das Papier schon in den Druckmaschinen liegt, ehe Ihnen das ›einfällt‹?«
Der Reporter war eingeschüchtert, weil er nicht erkannte, dass der Wutanfall nur Show war. »Es tut mir leid, Chef, der Gedanke ist mir wirklich gerade erst gekommen. Erinnern Sie sich an den Doppelmord in der Nähe von Borgo San Lorenzo?« Er verstummte und wartete auf eine Antwort. Borgo San Lorenzo war ein Ort in den Bergen etwa dreißig Kilometer nördlich von Florenz.
»Na los, raus damit!«, brüllte der Redakteur.
»In Borgo wurde damals ein junges Pärchen ermordet. Sie hatten sich auch in einem geparkten Wagen geliebt. Erinnern Sie sich nicht an den Fall, bei dem der Mörder ihr einen Ast in … in die Vagina gesteckt hat?«
»Doch, ich glaube, ich erinnere mich. Ja, schlafen Sie denn? Bringen Sie mir unsere Akten dazu. Schreiben Sie sofort etwas darüber – die Ähnlichkeiten, die Unterschiede … Na los doch! Was stehen Sie hier noch herum?«
Die Konferenz wurde beendet, und Spezi setzte sich an seinen Schreibtisch, um seinen Artikel über den Besuch in der Gerichtsmedizin zu schreiben. Ehe er damit anfing, las er jedoch den alten Artikel über die Morde in Borgo San Lorenzo durch. Die Ähnlichkeiten waren tatsächlich verblüffend. Die beiden Opfer, Stefania Pettini, achtzehn Jahre alt, und Pasquale Gentilcore, neunzehn, waren in der Nacht des 14. September 1974 ermordet worden – ebenfalls Samstag und eine Neumondnacht. Auch diese beiden waren verlobt gewesen. Der Mörder hatte die Handtasche des Mädchens genommen, sie umgedreht und den Inhalt ausgekippt, genau wie bei der Strohtasche, die Spezi im Gras hatte liegen sehen. Beide Opfer hatten zuvor ebenfalls eine Disco besucht, den Teen Club in Borgo San Lorenzo.
Nach diesem früheren Doppelmord waren Patronenhülsen sichergestellt worden, und in dem Artikel stand, dass es sich um Winchester-Geschosse der Serie H Kaliber 22 handelte, dieselbe Munition wie bei den Arrigo-Morden. Diese Einzelheit war nicht ganz so bedeutsam, wie es auf den ersten Blick scheinen mochte, denn das waren die in Italien am häufigsten verkauften Geschosse dieses Kalibers.
Der Mörder von Borgo San Lorenzo hatte der jungen Frau nicht die Sexualorgane herausgeschnitten. Stattdessen hatte er sie vom Auto weggeschleift und ihren Leichnam mit siebenundneunzig Messerstichen verstümmelt, die sich in einem kunstvollen Muster um ihre Brüste und den Schambereich zogen. Der Mord hatte neben einem Weinberg stattgefunden, und er hatte sie mit einem alten, knorrigen Stück Holz von einem Weinstock penetriert. In keinem der Fälle gab es irgendwelche Hinweise auf sexuellen Missbrauch an den Opfern.
Spezi schrieb den Aufmacher, während der andere Reporter einen kurzen Artikel zu den Morden von 1974 verfasste.
Zwei Tage später kam die Reaktion. Die Polizei hatte den Artikel natürlich auch gelesen und die Patronenhülsen der beiden Doppelmorde vergleichen lassen. Die meisten Handfeuerwaffen, abgesehen von Revolvern, werfen die Hülsen aus, nachdem das Geschoss abgefeuert wurde. Wenn der Schütze sich nicht die Mühe macht, sie einzusammeln, bleiben sie am Tatort zurück. Der Bericht des Polizeilabors war eindeutig: Bei beiden Verbrechen war dieselbe Waffe benutzt worden. Es war eine Beretta, Kaliber 22 Long Rifle, ein Modell, das für Sportschützen konzipiert ist. Kein Schalldämpfer. Das entscheidende Detail war ein kleiner Defekt am Schlagbolzen, der eine unverkennbare Markierung am Rand des Geschosses hinterließ, so einmalig wie ein Fingerabdruck.
Als La Nazione darüber berichtete, gab es eine Sensation. Denn das bedeutete, dass ein Serienmörder in den Florentiner Hügeln herumschlich.
Die darauf folgenden Ermittlungen brachten eine bizarre Subkultur in den bezaubernden Hügeln um Florenz ans Licht, von der die meisten Einwohner der Stadt nichts geahnt hatten. In Italien leben die meisten jungen Leute bei ihren Eltern, bis sie heiraten, und die meisten heiraten recht spät. Daher ist Sex in irgendwo geparkten Autos eine Art Volkssport. Es heißt, dass einer von drei Einwohnern, die heute in Florenz leben, in einem Auto gezeugt wurde. An jedem beliebigen Abend an den Wochenenden drängten sich in den Hügeln um Florenz förmlich die Autos, geparkt in dunklen Straßen, auf Feldwegen, in Olivenhainen und auf den Feldern der Bauern.
Die Ermittler stellten fest, dass sich Dutzende von Voyeuren dort draußen herumtrieben und jene Pärchen beobachteten. In der Gegend nannte man diese Voyeure Indiani, also Indianer, weil sie im Dunkeln umherschlichen. Manche waren mit modernster Technik ausgestattet, darunter Parabol- und Saugnapfmikrofone, Tonbandgeräte und Nachtsicht-Kameras. Die Indiani hatten die Hügel in Zonen eingeteilt, die jeweils von einer Gruppe oder einem »Stamm« beherrscht wurden; die Mitglieder sicherten sich die besten Plätze für ihre heimlich belauschten Vorstellungen. Manche Beobachtungsposten waren hoch begehrt, entweder weil sie die Observation aus nächster Nähe gestatteten oder weil man dort meistens »gute Autos« fand. (Ein »gutes Auto« ist genau das, was man sich darunter vorstellt.) Ein gutes Auto konnte auch eine Geldquelle sein, manche davon wurden an Ort und Stelle regelrecht gehandelt wie an einer abartigen Börse – ein Indiano zog sich mit einer Handvoll Scheinen zurück und überließ einem anderen seinen Posten, der sich dann das Finale anschauen konnte. Wohlhabende Indiani bezahlten oft einen Führer, der sie zu den besten Stellen brachte und das Risiko minimierte.
Dann waren da noch die furchtlosen Leute, die ihrerseits den Indiani nachstellten, eine Subkultur innerhalb einer Subkultur. Auch diese Männer krochen nachts in den Hügeln herum, aber nicht, um Liebespärchen zu beobachten, sondern um Indiani auszuspionieren, ihre Autos, Nummernschilder und andere verräterische Details herauszufinden. Dann erpressten sie die Indiani, indem sie damit drohten, deren nächtliche Aktivitäten ihren Frauen, Familien und Arbeitgebern zu enthüllen. Manchmal wurde ein Indiano in seinem voyeuristischen Genuss durch den Blitz einer nahen Kamera gestört; am nächsten Tag erhielt er dann einen Anruf: »Erinnern Sie sich an den Blitz gestern Nacht im Wald? Das Foto ist gut geworden, Sie sehen darauf großartig aus, und selbst Ihr Cousin zweiten Grades würde Sie sofort erkennen! Übrigens steht das Negativ zum Verkauf …«
Es dauerte nicht lange, bis die Ermittler einen Indiano dingfest machten, der sich zum Zeitpunkt des Doppelmords in der Nähe der Via dell’Arrigo herumgetrieben hatte. Er hieß Enzo Spalletti und fuhr tagsüber einen Krankenwagen.
Spalletti wohnte mit Frau und Kindern in Turbone, einem Dorf außerhalb von Florenz. Es bestand aus einer Ansammlung alter Häuser um eine zugige Piazza und erinnerte ein wenig an einen Ort aus einem Italo-Western. Spalletti war bei seinen Nachbarn nicht sonderlich beliebt. Sie erzählten, er spiele sich auf und täte so, als hielte er sich für etwas Besseres. Seine Kinder, sagten sie, nahmen Tanzstunden, als seien sie die Kinder eines Adligen. Das ganze Dorf wusste, dass er ein Voyeur war. Sechs Tage nach dem Doppelmord holte die Polizei den Krankenwagenfahrer ab. Zu diesem Zeitpunkt hielten die Ermittler ihn allerdings nicht für den Mörder, sondern für einen wichtigen Zeugen.
Spalletti wurde ins Polizeipräsidium gebracht und befragt. Er war ein kleiner Mann mit einem riesigen Schnurrbart, eng stehenden schmalen Augen, einer großen Nase, einem knubbelig hervorstehenden Kinn und einem kleinen Mund, der auf unglückliche Weise an einen Schließmuskel erinnerte. Er sah aus wie ein Mann, der etwas zu verbergen hatte. Erschwerend kam hinzu, dass er die Fragen der Polizei mit einer Mischung aus Arroganz, Ausflüchten und Trotz beantwortete. Seiner Aussage zufolge hatte er an jenem Abend das Haus verlassen, um sich eine Prostituierte zu suchen, die er angeblich am Arno-Ufer auflas, in der Nähe des amerikanischen Konsulats. Ein junges Mädchen aus Neapel in einem roten Kleid. Das Mädchen war in seinen Taurus gestiegen, und er hatte sie in ein Wäldchen in der Nähe der Stelle gefahren, wo die beiden jungen Leute ermordet worden waren. Als sie fertig waren, hatte Spalletti die kleine Prostituierte in Rot dorthin zurückgefahren, wo er sie aufgegabelt hatte.
Die Geschichte war ausgesprochen unglaubwürdig. Erstens war es undenkbar, dass eine Prostituierte freiwillig zu einem Unbekannten ins Auto stieg und sich zwanzig Kilometer weit mitten ins Nirgendwo in einen dunklen Wald fahren ließ. Bei der Befragung wurden zahlreiche Löcher in Spallettis Geschichte aufgetan, doch er blieb stur. Es brauchte sechs Stunden ununterbrochener Vernehmung, bis er endlich weich wurde. Schließlich gab der Krankenwagenfahrer unverändert dreist und selbstsicher zu, was alle bereits wussten – dass er tatsächlich ein Spanner war, dass er am Samstag, den 6. Juni, nachts unterwegs gewesen war und seinen roten Taurus nicht weit vom Tatort entfernt geparkt hatte. »Na und?«, fuhr er fort. »Ich war nicht der Einzige, der in dieser Nacht da draußen Pärchen nachspioniert hat. Wir waren ein ganzer Haufen.« Dann erklärte er, dass er den kupferroten Fiat von Giovanni und Carmela sehr gut kannte: Der Wagen kam oft und war als »gutes Auto« bekannt. Er hatte die beiden mehr als einmal beobachtet. Und er war ganz sicher, dass in der Mordnacht auch andere Leute in der Nähe herumgeschnüffelt hatten. Er war eine Weile mit einem dieser Männer herumgezogen, der das angeblich auch bezeugen konnte. Er nannte der Polizei den Namen Fabbri.
Ein paar Stunden später wurde Fabbri ins Präsidium gebracht und daraufhin befragt, ob er Spallettis Alibi bestätigen konnte. Stattdessen sagte Fabbri aus, dass er etwa anderthalb Stunden lang, um den Zeitpunkt des Mordes herum, nicht mit Spalletti zusammen gewesen war. »Klar«, erzählte Fabbri den Ermittlern, »Spalletti und ich, wir haben uns in der Nacht gesehen. Wir haben uns in der Taverna de Diavolo getroffen, wie immer.« In dem Restaurant sammelten sich oft Indiani, um Plätze zu handeln und Informationen auszutauschen, ehe sie in den Abend hinauszogen. Fabbri fügte hinzu, dass er Spalletti später wiedergetroffen hatte, kurz nach elf Uhr, als Spalletti die Via dell’Arrigo heruntergekommen war. Spalletti musste folglich keine zehn Meter am Tatort vorbeigegangen sein, und das um die vermutete Tatzeit herum.
Es kam noch mehr zutage. Spalletti behauptete steif und fest, dass er direkt nach Hause gefahren sei, nachdem er sich von Fabbri verabschiedet hatte. Aber seine Frau sagte aus, dass ihr Mann noch immer nicht zu Hause gewesen sei, als sie um zwei Uhr morgens zu Bett gegangen war.
Also wandte sich das Verhör wieder Spalletti zu: Wo war er zwischen Mitternacht und mindestens zwei Uhr morgens gewesen? Spalletti hatte keine Antwort darauf.
Die Polizei sperrte Spalletti in das berühmte Florentiner Gefängnis Le Murate (»die Eingemauerten«) und klagte ihn wegen Reticenza oder absichtlichem Verschweigen an, einer Form des Meineids. Die Behörden hielten ihn immer noch nicht für den Mörder, waren aber sicher, dass er wichtige Informationen verschwieg. Ein paar Tage im Gefängnis würden ihn vielleicht zum Reden bringen.
Spezialisten der Spurensicherung machten sich über Spallettis Auto und sein Haus her. Sie fanden einen Brieföffner in seinem Wagen und im Handschuhfach eine Waffe, die man einen scacciacani nannte, einen »Hundeschreck« – eine billige Pistole mit Platzpatronen, mit der man Hunde verscheuchte und die Spalletti über eine Anzeige in einem Pornoheft gekauft hatte. Es waren nirgends Spuren von Blut zu finden.
Sie vernahmen Spallettis Frau. Sie war viel jünger als ihr Mann, ein dickes, ehrliches, einfaches Mädchen vom Lande, und sie gab zu, dass sie wusste, dass ihr Mann ein Spanner war. »So oft«, schluchzte sie, »hat er mir versprochen, damit aufzuhören, aber dann hat er doch wieder angefangen. Und es stimmt, dass er in der Nacht des sechsten Juni rausgegangen ist, um ›sich umzusehen‹, wie er das immer genannt hat.« Sie hatte keine Ahnung, wann ihr Mann zurückgekehrt war, nur, dass es nach zwei Uhr gewesen sein musste. Sie beharrte darauf, dass ihr Mann bestimmt unschuldig sei, dass er ein so schreckliches Verbrechen gar nicht begangen haben könne, weil »es ihn vor Blut graust, und zwar so schlimm, dass er sich bei der Arbeit weigert, aus dem Wagen zu steigen, wenn es einen Autounfall gegeben hat«.
Mitte Juli beschuldigte die Polizei schließlich Spalletti des Mordes.
Nachdem Spezi als Erster über den Mord geschrieben hatte, berichtete er auch weiterhin in La Nazione über den Fall. Seine Artikel waren den Ermittlungen gegenüber skeptisch und wiesen auf die vielen Löcher in der Anklage gegen Spalletti hin – darunter etwa die Tatsache, dass es keinerlei direkten Beweis gab, der ihn mit dem Verbrechen in Zusammenhang brachte. Außerdem war Spalletti keine Verbindung zu dem ersten Mord 1974 in Borgo San Lorenzo nachzuweisen.
Am 24. Oktober 1981 nahm Spalletti in seiner Gefängniszelle die Zeitung in die Hand und las eine Schlagzeile, die für ihn eine große Erleichterung gewesen sein muss:
DER MÖRDER IST WIEDER DA
Junges Pärchen auf Feld brutal ermordet
Indem sie erneut gemordet hatte, hatte die Bestie selbst die Unschuld des krankenwagenfahrenden Spanners bewiesen.
Kapitel 3
Viele Nationen haben einen Serienmörder, der ihre Kultur durch einen Prozess der Negation definiert, der seine Ära veranschaulicht, nicht indem er ihre Werte verkörpert, sondern indem er ihre hässliche Kehrseite offenbart. England hatte Jack the Ripper, geboren in den Nebeln des Dickensschen London, der sich seine Opfer in der vernachlässigten Unterschicht der Stadt suchte, unter den Prostituierten, die in den Elendsvierteln von Whitechapel ums Überleben kämpften. Boston hatte den Boston Strangler, den weltgewandten, gutaussehenden Mörder, der sich in den eleganteren Gegenden der Stadt herumtrieb, ältere Frauen vergewaltigte und ermordete und ihre Leichen in unsagbar obszönen Positionen drapierte. Deutschland hatte den Vampir von Düsseldorf, der mit seinen sadistischen Morden an Männern, Frauen und Kindern den Aufstieg Hitlers zu prophezeien schien. Sein Blutdurst war so gewaltig, dass er noch am Vorabend seiner Hinrichtung die bevorstehende Enthauptung als »Lust, die alle Lust beendet« bezeichnet haben soll. Jeder dieser Mörder verkörperte auf finstere Weise jeweils seine Zeit und Heimat.
Italien hatte die Bestie von Florenz.
Florenz war schon immer eine Stadt der Gegensätze. An einem lauen Frühlingsabend, wenn die untergehende Sonne die ehrwürdigen Paläste am Fluss vergoldet, kann sie einem als eine der schönsten und kultiviertesten Städte der Welt erscheinen. Doch im späten November nach zwei Monaten Dauerregen werden ihre uralten Paläste grau und schmutzig vor Nässe, und die schmalen, gepflasterten Straßen, die nach Abwasserkanälen und Hundekot stinken, sind zwischen grimmigen steinernen Fassaden und überhängenden Dächern eingeschlossen, die das ohnehin schon trübe Licht aussperren. Auf den Brücken über den Arno fließt im unaufhörlichen Regen ein steter Strom schwarzer Schirme dahin. Der Fluss, der im Sommer so zauberhaft wirkt, schwillt zu einer öligen braunen Suppe an, in der abgeknickte Baumstämme, Äste und manchmal auch Tierkadaver herumschwimmen und sich an den von Ammanati entworfenen Brückenpfeilern stauen.
In Florenz gehen das Köstliche und das Grässliche Hand in Hand: Savonarolas Feuer der Eitelkeiten und Botticellis Geburt der Venus, Leonardo da Vincis Skizzenbücher und Niccolò Machiavellis Der Fürst, Dantes Inferno und Boccaccios Dekameron. Auf der Piazza della Signoria, dem Hauptplatz, sind unter freiem Himmel Skulpturen der Renaissance ausgestellt, darunter einige der berühmtesten Statuen von ganz Florenz. Sie bilden eine Galerie des Grauens, eine öffentliche Zurschaustellung von Mord, Vergewaltigung und Verstümmelung, wie sie in keiner anderen Stadt der Welt zu finden ist. Krone der Sammlung ist Cellinis berühmte Bronzestatue des Perseus, der den abgetrennten Kopf der Medusa hochhält wie ein islamistischer Terrorist in einem Propagandavideo – Blut tropft aus ihrem Hals, ihr enthaupteter Körper liegt zu seinen Füßen. Hinter Perseus stellen weitere Statuen legendäre Szenen von Mord, Gewalt und Aufruhr dar, darunter der Raub der Sabinerinnen von Giambologna. Innerhalb der Mauern, die Florenz umschließen, bis zu den Galgen außerhalb, wurden die raffiniertesten und wüstesten Verbrechen begangen, von der schleichenden Vergiftung bis hin zur brutalen, öffentlichen Verstümmelung, Folter und Verbrennung auf dem Scheiterhaufen. Jahrhundertelang sandte Florenz den Glanz seiner Macht über die gesamte Toskana aus, zum Preis schrecklicher Massaker und blutiger Kriege.
Die Stadt wurde 59 n.Chr. von Julius Cäsar gegründet, als Ruhestands-Wohnsitz für Soldaten aus seinen Feldzügen. Sie bekam den Namen Florentia, die »Blühende«. Gegen 250 n.Chr. ließ sich ein armenischer Prinz namens Miniato nach einer Pilgerfahrt nach Rom auf einem Hügel nahe Florenz nieder. Er lebte dort als Einsiedler in einer Höhle, von der er auszog, um den Heiden in der Stadt zu predigen. Im Zuge der Christenverfolgung unter Kaiser Decius wurde Miniato verhaftet und auf dem Marktplatz der Stadt enthauptet, woraufhin (so erzählt die Legende) er seinen Kopf aufhob, ihn sich wieder auf die Schultern setzte und den Hügel hinaufstieg, um in Würde in seiner Höhle zu sterben. Heute steht an dieser Stelle eine der schönsten romanischen Kirchen Italiens, die Basilika San Miniato al Monte, von der aus man über die ganze Stadt bis zu den Hügeln dahinter schauen kann.
1302 wurde Dante aus Florenz verbannt, wovon die Stadt sich nie ganz reinwaschen konnte. Im Gegenzug bevölkerte Dante seine Hölle mit prominenten Florentinern und reservierte die exquisitesten Foltermethoden für sie.
Während des 14. Jahrhunderts wurde Florenz durch den Handel mit Wolltuchen und das Bankwesen reich, und am Ende des Jahrhunderts galt die Stadt als eine der fünf größten in Europa. Zu Beginn des 15. Jahrhunderts erlebte Florenz eine Blütezeit menschlichen Genies, wie es sie in der Menschheitsgeschichte kaum ein halbes Dutzend Mal gegeben hat. Später würde man diese Zeit die Renaissance nennen, die »Wiedergeburt«, die die lange Finsternis des Mittelalters beendete. Zwischen der Geburt Masaccios 1401 und dem Tod Galileos 1642 erfanden Florentiner große Teile der modernen Welt. Sie revolutionierten die Kunst, Architektur, Musik, Astronomie, Mathematik und Navigation. Sie schufen das moderne Bankwesen durch die Erfindung des Kreditwechsels. Der goldene Florin mit der Florentiner Lilie auf der einen und Johannes dem Täufer im Büßerhemd auf der anderen Seite wurde die Münze Europas. Die Stadt ohne Seehafen an einem nicht schiffbaren Fluss brachte brillante Navigatoren hervor, die die Neue Welt erkundeten und kartographierten, und einer von ihnen gab Amerika sogar seinen Namen.
Mehr noch, Florenz erfand die Idee der modernen Welt. Durch die Renaissance schüttelten die Florentiner das Joch des mittelalterlichen Weltbildes ab, in dem Gott im Zentrum des Universums stand und das irdische Dasein nur als dunkle, flüchtige Station auf dem Weg ins herrliche Jenseits galt. Die Renaissance stellte die Menschheit in den Mittelpunkt des Universums und erklärte dieses Leben zum eigentlichen Ereignis. Das Schicksal der abendländischen Zivilisation nahm eine neue Wendung.
Die Florentiner Renaissance wurde zum Großteil von einer einzigen Familie finanziert, den Medici. Sie gelangten in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts unter der Führung von Giovanni di Bicci de’Medici, einem sehr wohlhabenden Florentiner Bankier, zu großem Ansehen. Die Medicis beherrschten hinter den Kulissen die ganze Stadt, dank eines cleveren Systems aus Mäzenatentum, Allianzen und Einflussnahme. Sie waren zwar eine Kaufmannsfamilie, ließen aber von Anfang an viel Geld in die Kunst fließen. Giovannis Urenkel, Lorenzo der Prächtige, verkörperte geradezu den »Renaissancemenschen«. Als kleiner Junge hatte Lorenzo erstaunliche Begabung gezeigt, und er erhielt die beste Erziehung, die für Geld zu haben war. Er tat sich in ritterlichen Turnieren ebenso hervor wie als Falkner, Jäger und Rennpferdezüchter. Frühe Porträts stellen Lorenzo il Magnifico als leidenschaftlich wirkenden jungen Mann mit gerunzelten Brauen, einer großen Nase und glattem Haar dar. Er übernahm die Vorherrschaft über die Stadt nach dem Tod seines Vaters 1469, als er erst zwanzig Jahre alt war. Er scharte Männer wie Leonardo da Vinci, Sandro Botticelli, Filippino Lippi, Michelangelo und den Philosophen Pico della Mirandola um sich.
Lorenzo führte Florenz in ein goldenes Zeitalter. Doch selbst auf dem Höhepunkt der Renaissance vermischten sich in dieser Stadt der Widersprüche Schönheit und Blut, Kultiviertheit und Grausamkeit. 1478 zettelte eine rivalisierende Bankiersfamilie, die Pazzis, eine Verschwörung gegen die herrschenden Medici an. Der Name Pazzi bedeutet wörtlich übersetzt »Verrückte«, und ein Ahnherr hatte ihn sich durch seinen wahnwitzigen Mut verdient, indem er im Ersten Kreuzzug als einer der ersten Soldaten die Mauern Jerusalems überwunden hatte. Den Pazzis widerfuhr außerdem die Ehre, dass Dante gleich zwei Familienmitglieder in die Hölle verbannte und einem von ihnen obendrein ein »hündisches Grinsen« verpasste.
An einem stillen Sonntag im April überfiel eine Mörderbande der Pazzis Lorenzo den Prächtigen und seinen Bruder Giuliano in dem Augenblick, da sie am verletzlichsten waren – während des Hochamts im Dom. Sie töteten Giuliano, doch Lorenzo, der mit mehreren Dolchstichen verletzt wurde, konnte entkommen und sich in der Sakristei einschließen. Die Florentiner waren erbost über diesen Angriff auf ihre Herrscherfamilie und fielen als brüllender Mob über die Verschwörer her. Einer der Anführer, Jacopo de’Pazzi, wurde aus einem Fenster des Palazzo Vecchio erhängt, sein Leichnam anschließend ausgezogen, durch die Straßen geschleift und in den Arno geworfen. Die Familie Pazzi überlebte diesen schweren Rückschlag und gab der Welt wenig später die berühmte »ekstatische Karmeliterin« Maria Magdalena von Pazzi, die im Gebet von der Liebe Gottes besessen wurde und Zeugen mit der stöhnenden, japsenden Schilderung ihrer Visionen beeindruckte. Ein fiktionaler Pazzi erschien wiederum im 20. Jahrhundert, als der Schriftsteller Thomas Harris eine seiner Hauptfiguren in dem Roman Hannibal zu einem Pazzi machte – einen Florentiner Kriminalkommissar, der dadurch berühmt und berüchtigt wird, dass er den rätselhaften Fall der Bestie von Florenz löst.
Der Tod von Lorenzo dem Prächtigen 1492, auf dem Höhepunkt der Renaissance, leitete eine jener blutigen Episoden ein, von denen die Florentiner Geschichte geprägt ist. Ein Dominikanermönch namens Savonarola, der im Kloster San Marco lebte, leistete Lorenzo Beistand an dessen Sterbebett, um wenig später die Familie Medici zu verraten und gegen sie zu predigen. Savonarola war ein seltsam aussehender Mann, in eine braune Mönchskutte gehüllt, charismatisch, derb, plump und muskulös, mit einer Hakennase und Rasputinaugen. In der Kirche San Marco begann er Feuer und Schwefel zu predigen. Er wetterte gegen die Dekadenz der Renaissance, verkündete den Anbruch der Endzeit und berief sich dabei auf seine Visionen und seine direkte Kommunikation mit Gott.
Seine Botschaft kam bei den einfachen Florentinern an, die die protzige Verschwendung und den ungeheuren Reichtum der Renaissance und ihrer Herren, von dem sie selbst nicht viel abbekommen hatten, mit Missbilligung betrachteten. Ihr Unmut wurde von einer Epidemie der Syphilis angestachelt, die aus der Neuen Welt eingeschleppt worden war und sich wie ein verheerender Brand über die ganze Stadt ausbreitete. Dies war eine Krankheit, die man in Europa noch nie gesehen hatte, und sie trat in einer wesentlich schwereren Form auf, als wir sie heute kennen: Der Körper ihrer Opfer war mit eiternden Pusteln bedeckt, die schlaffe Gesichtshaut verlieh einem ein eingefallenes Aussehen, und die Kranken verfielen in tobenden Wahnsinn, ehe der Tod sie erlöste. Es näherte sich das Jahr 1500, was vielen als nette, runde Zahl für den Weltuntergang erschien. In diesem Klima fand Savonarola aufmerksame Zuhörer.
1494 marschierte Karl VIII. von Frankreich in die Toskana ein. Piero der Unglückliche, Nachfolger seines Vaters Lorenzo, erwies sich als arroganter und unfähiger Herrscher. Er kapitulierte und überließ Karl VIII. die Stadt zu erbärmlichen Bedingungen, ohne überhaupt eine anständige Verteidigung zu versuchen, was die Florentiner derart erboste, dass sie die Familie Medici vertrieben und ihre Paläste plünderten. Savonarola, der inzwischen eine große Schar von Anhängern gesammelt hatte, nutzte das Machtvakuum und erklärte Florenz zur »Christlichen Republik« und sich selbst zu deren Oberhaupt. Als Erstes belegte er den homosexuellen und analen Geschlechtsverkehr, unter kultivierten Florentinern beliebt und durchaus gesellschaftlich akzeptiert, mit der Todesstrafe. Missetäter, die dagegen verstießen, und andere Verbrecher wurden regelmäßig auf der Piazza della Signoria verbrannt oder vor den Toren der Stadt erhängt.
Der »verrückte Mönch« von San Marco hatte freie Hand, den religiösen Eifer der einfachen Stadtbevölkerung anzustacheln. Er wetterte gegen die Dekadenz, die Exzesse und den humanistischen Geist der Renaissance. Wenige Jahre später stiftete er die Leute zu seinen berühmten Feuern der Eitelkeiten an. Er schickte seine Gehilfen von Tür zu Tür und ließ sie Gegenstände beschlagnahmen, die er für sündig hielt – Spiegel, heidnische Bücher, Kosmetika, weltliche Noten und Musikinstrumente, Schachspiele, Karten, prächtige Kleidung und weltliche Gemälde. Alles wurde auf der Piazza della Signoria aufgehäuft und verbrannt. Der Künstler Botticelli, der unter Savonarolas Einfluss geriet, warf viele seiner eigenen Gemälde ins Feuer, und wahrscheinlich wurden neben anderen unschätzbaren Meisterwerken der Renaissance auch mehrere Werke von Michelangelo verbrannt.
Unter Savonarolas Herrschaft erlebte Florenz einen wirtschaftlichen Niedergang. Die Endzeit, die er ständig predigte, trat nicht ein. Statt Florenz für seine neu entdeckte Frömmigkeit zu segnen, schien Gott der Stadt den Rücken gekehrt zu haben. Das gemeine Volk, vor allem die Jungen und Untätigen, begannen sich offen seinen Erlassen zu widersetzen. 1497 begann ein Mob junger Männer während einer von Savonarolas Predigten zu randalieren. Der Krawall breitete sich rasch aus und wurde zu einem allgemeinen Aufstand, Tavernen öffneten wieder, das Glücksspiel blühte auf, und endlich kehrten Tanz und Musik in die krummen Gassen von Florenz zurück.
Savonarola entglitt die Kontrolle, er hielt immer wüstere und verdammendere Predigten, und er beging den fatalen Fehler, nun auch die Kirche selbst zu kritisieren. Der Papst exkommunizierte ihn und befahl seine Festnahme und Hinrichtung. Ein gehorsamer Mob überfiel das Kloster von San Marco, rannte sämtliche Türen ein, brachte einige von Savonarolas Ordensbrüdern um und schleifte ihn hinaus auf die Straße. Man beschuldigte ihn einer Vielzahl von Verbrechen, darunter »Irrglaube«. Nachdem man ihn mehrere Wochen lang auf der Streckbank gefoltert hatte, wurde er auf der Piazza della Signoria, eben da, wo er seine Feuer der Eitelkeiten entzündet hatte, ans Kreuz gekettet und verbrannt. Stundenlang wurde das Feuer geschürt, und dann wurden die letzten Überreste zerhackt und mehrmals mit brennenden Zweigen vermischt, damit kein Stück von ihm übrig blieb, das als Reliquie verehrt werden könnte. Seine Asche wurde dann in den allumarmenden, alles verschlingenden Arno gekippt.
Die Renaissance blühte wieder auf. Florenz setzte sein Leben in Blut und Schönheit fort. Aber nichts währt ewig, und im Lauf der Jahrhunderte verlor Florenz allmählich seinen Platz unter den bedeutendsten Städten Europas. Es verkam gewissermaßen zum Provinzstädtchen, berühmt für seine Vergangenheit, aber eher unsichtbar in der Gegenwart, während andere Städte in Italien an Bedeutung gewannen, vor allem Rom, Neapel und Mailand.
Die Florentiner von heute sind berüchtigt für ihre Verschlossenheit und gelten bei anderen Italienern als steif, hochmütig, dünkelhaft, übertrieben förmlich, rückwärtsgewandt und in der Tradition erstarrt. Sie sind nüchtern, pünktlich und fleißig. Tief in ihrem Inneren wissen die Florentiner, dass sie zivilisierter sind als andere Italiener. Sie haben der Welt alles geschenkt, was schön und großartig ist, und damit haben sie genug getan. Jetzt können sie die Türen schließen, sich nach innen wenden und für niemanden mehr zu sprechen sein.
Als die Bestie von Florenz auftrat, begegneten die Florentiner den Morden mit Unglauben, Angst, Grauen und einer Art kranker Faszination. Sie wollten einfach nicht wahrhaben, dass ihre schöne, exquisite Stadt, der steingewordene Geist der Renaissance, die Wiege der abendländischen Zivilisation, ein solches Ungeheuer beherbergen sollte.
Vor allem konnten sie sich nicht mit dem Gedanken abfinden, dass der Mörder einer von ihnen sein könnte.
Kapitel 4
Der Abend des 22. Oktober 1981, ein Donnerstag, war verregnet und ungewöhnlich kühl für die Jahreszeit. Für den folgenden Tag war ein Generalstreik angesetzt – alle Geschäfte, Firmen und Schulen würden aus Protest gegen die Wirtschaftspolitik der Regierung geschlossen bleiben. Daher herrschte an diesem Abend Feierlaune. Stefano Baldi hatte seine Freundin Susanna Cambi zu Hause besucht, mit ihr und ihren Eltern zu Abend gegessen und sie ins Kino ausgeführt. Hinterher parkten sie im Campo delle Bartoline westlich von Florenz. Stefano kannte die Gegend sehr gut, denn er war in der Nähe aufgewachsen und hatte als Kind auf den Feldern gespielt.
Tagsüber wurden die »Bartoline« vor allem von Rentnern besucht, die hier kleine Gemüsegärten anlegten, die frische Luft genossen und sich die Zeit mit Klatsch und Tratsch vertrieben. Nachts herrschte ein ständiges Kommen und Gehen von jungen Pärchen auf der Suche nach ein wenig Ungestörtheit. Und natürlich waren dort auch Spanner unterwegs.
Inmitten der Felder endete ein Weg zwischen Weingärten. Dort parkten Stefano und Susanna. Vor ihnen erhoben sich die gewaltigen, dunklen Höhenzüge der Calvana, hinter ihnen war das Rauschen des Verkehrs auf der Autostrada zu hören. In dieser Nacht waren die Sterne und die schmale Mondsichel hinter dichten Wolken verborgen, die alles in schwere Dunkelheit tauchten.
Um elf Uhr am nächsten Vormittag entdeckte ein älteres Ehepaar, das seinen Gemüsegarten gießen wollte, das schreckliche Verbrechen. Der schwarze VW Golf blockierte den Feldweg, die Fahrertür war geschlossen, das Fenster gesprungen, aber nicht herausgefallen, die Beifahrertür weit offen – ganz genau wie bei den ersten beiden Doppelmorden.
Spezi traf kurz nach der Polizei am Schauplatz ein. Wieder gaben sich Polizei und Carabinieri keine Mühe, den Tatort zu sichern oder auch nur mit Band abzusperren. Alle liefen durcheinander und machten schlechte Witze – Journalisten, Polizisten, Leute von der Staatsanwaltschaft und der Gerichtsmedizin –, Scherze ohne jeden Humor, ein nutzloser Versuch, das Grauen der Szene zu verdrängen.
Kurz nach seiner Ankunft entdeckte Spezi einen Bekannten, einen Colonnello der Carabinieri, der in einer schicken grauen Lederjacke, die gegen die herbstliche Kühle bis zum Hals zugeknöpft war, eine amerikanische Zigarette nach der anderen rauchte. Der Offizier hielt einen Stein in der Hand, den er zwanzig Meter vom Tatort entfernt gefunden hatte. Er hatte die Form einer abgeschnittenen Pyramide, maß etwa sieben Zentimeter Seitenlänge und bestand aus Granit. Spezi erkannte ihn als traditionellen Türstopper, wie man ihn oft in alten toskanischen Landhäusern fand. Während des heißen Sommers wurden diese Steine benutzt, um die Türen im Haus offen zu halten, damit die Luft zirkulieren konnte.
Der Colonnello drehte den Stein in den Händen hin und her und trat auf Spezi zu. »Dieser Türstopper ist der einzige Gegenstand von möglicher Bedeutung, den ich am Tatort finden konnte. Ich nehme ihn als Beweismittel mit, denn mehr habe ich nicht. Vielleicht hat der Mörder ihn benutzt, um die Scheibe einzuschlagen.«
Zwanzig Jahre später sollte dieser banale Türstopper, zufällig in einem Feld aufgelesen, im Mittelpunkt einer neuen und bizarren Ermittlung stehen.
»Sonst nichts, Colonnello?«, fragte Spezi. »Keine Spuren? Der Boden ist nass und ganz weich.«
»Wir haben den Abdruck eines Gummistiefels gefunden, eines Reitstiefels, auf dem Boden an der Reihe Weinreben, die senkrecht zum Weg verläuft, direkt neben dem Golf. Wir haben natürlich einen Abguss davon gemacht. Aber Sie wissen ebenso gut wie ich, dass jeder beliebige Mensch diesen Stiefelabdruck hinterlassen haben kann … genau wie diesen Stein.«
Spezi erinnerte sich daran, dass es seine Pflicht als Journalist war, selbst Beobachtungen zu machen und nicht nur aus zweiter Hand zu berichten. Also ging er sehr widerstrebend ein paar Schritte weiter, um sich das weibliche Opfer anzusehen. Die Leiche der jungen Frau war mehr als zehn Meter weit vom Auto weggeschleift und an einer überraschend ungeschützten Stelle bearbeitet worden, wie schon bei den früheren Morden. Sie lag im Gras, die Arme über Kreuz, mit derselben Verstümmelung wie beim letzten Mal.
Die Opfer wurden vom Gerichtsmediziner Mauro Maurri untersucht, der zu dem Ergebnis kam, dass die Schnitte im Schambereich mit demselben gekerbten Messer geführt waren, das an ein Tauchermesser erinnerte. Er führte aus, dass es wie bei den vorigen Morden keine Hinweise auf eine Vergewaltigung gab, keine Spuren eines Kampfes, kein Sperma. Die mobile Ermittlungseinheit fand Hülsen der Winchester-Serie H, neun auf dem Boden und zwei im Wagen. Es stellte sich heraus, dass alle aus der gleichen Waffe wie bei den früheren Doppelmorden abgefeuert worden waren, denn sie wiesen die unverwechselbare Markierung am Rand auf, die vom Schlagbolzen stammte.