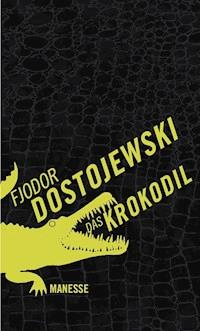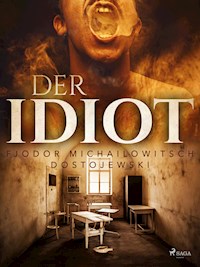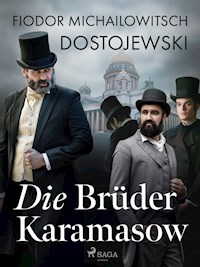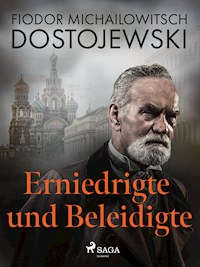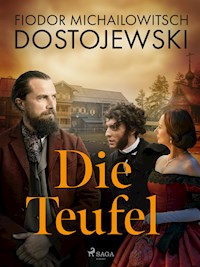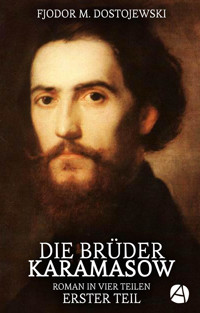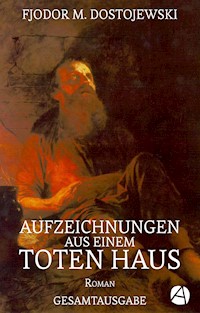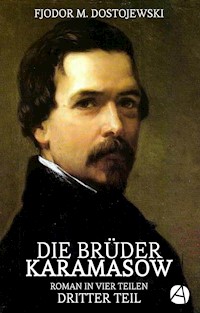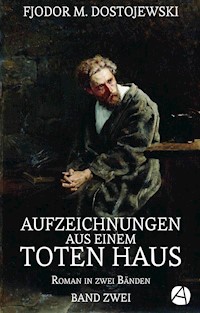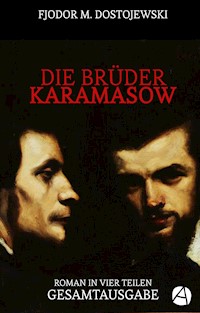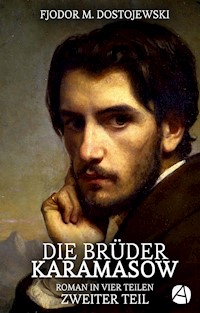
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: apebook Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Die Brüder Karamasow sind so unterschiedlich wie Körper, Geist und Seele. Iwan, ein Atheist und grüblerischer Intellektueller; Dmitri, ein sprunghafter Sensualist und Rivale seines Vaters um die schöne Gruschenka; und Alexej, getrieben von unerschütterlicher Frömmigkeit. In ihrem Schatten steht ihr verstoßener Halbbruder, der in die Knechtschaft gedrängt wurde. Gemeinsam handeln sie, um sich von dem ausschweifenden Patriarchen zu befreien. Dann, in einer einzigen schockierenden Tat, ändert sich das Schicksal der Brüder unaufhaltsam. Die Ermordung des brutalen Großgrundbesitzers Fjodor Karamasow verändert das Leben seiner Söhne unwiderruflich: Dmitri, der Sensualist, der aufgrund der erbitterten Rivalität mit seinem Vater sofort unter Mordverdacht gerät; Iwan, der Intellektuelle, der an den Rand des Zusammenbruchs getrieben wird; der spirituelle Alexej, der versucht, die Risse in der Familie zu kitten; und die schattenhafte Gestalt ihres unehelichen Halbbruders Smerdjakow. “Die Brüder Karamasow” sind Fjodor Dostojewskis tiefgründiges, bahnbrechendes Meisterwerk des psychologischen Realismus, das sich mit den Themen Gott, freier Wille, Glaube, Zweifel und moralische Verantwortung auseinandersetzt. Dostojewskis düsteres Meisterwerk beschwört eine Welt herauf, in der die Grenzen zwischen Unschuld und Korruption, Gut und Böse verschwimmen und der Glaube an die Menschheit auf die Probe gestellt wird. Dies ist der zweite von insgesamt vier Teilen. Die Ausgabe ist ausgestattet mit erläuternden Anmerkungen und einem verlinkten Namensregister.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
FJODOR M. DOSTOJEWSKI
DIE BRÜDER KARAMASOW
ROMAN IN VIER TEILEN UND EINEM EPILOG
ZWEITER TEIL
ÜBERSETZT
VON
HERMANN RÖHL
DIE BRÜDER KARAMASOW wurden im russischen Original zuerst veröffentlicht von Ру́сский ве́стник (Russkiy Vestnik), Sankt Petersburg 1880.
Diese Ausgabe wurde aufbereitet und herausgegeben von
© apebook Verlag, Essen (Germany)
www.apebook.de
1. Auflage 2023
V 1.0
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.d-nb.de abrufbar.
Zweiter Teil
ISBN 978-3-96130-559-9
Buchgestaltung: SKRIPTART, www.skriptart.de
Books made in Germany with
Bleibe auf dem Laufenden über Angebote und Neuheiten aus dem Verlag mit dem lesenden Affen und
abonniere den kostenlosen apebook Newsletter!
Du kannst auch unsere eBook Flatrate abonnieren.
Dann erhältst Du alle neuen eBooks aus unserem Verlag (Klassiker und Gegenwartsliteratur)
für einen kleinen monatlichen Beitrag (Zahlung per Paypal oder Bankeinzug).
Hier erhältst Du mehr Informationen dazu.
Follow apebook!
***
FJODOR M. DOSTOJEWSKI
DIE BRÜDER KARAMASOW
ERSTER TEIL | ZWEITER TEIL | DRITTER TEIL | VIERTER TEIL
Klicke auf die Cover oder die Textlinks!
GESAMTAUSGABE
***
BUCHTIPPS
Entdecke unsere historischen Romanreihen.
Der erste Band jeder Reihe ist kostenlos!
DIE GEHEIMNISSE VON PARIS. BAND 1
MIT FEUER UND SCHWERT. BAND 1
QUO VADIS? BAND 1
BLEAK HOUSE. BAND 1
Klicke auf die Cover oder die Textlinks oben!
Am Ende des Buches findest du weitere Buchtipps und kostenlose eBooks.
Und falls unsere Bücher mal nicht bei dem Online-Händler deiner Wahl verfügbar sein sollten: Auf unserer Website sind natürlich alle eBooks aus unserem Verlag (auch die kostenlosen) in den gängigen Formaten EPUB (Tolino etc.) und MOBI (Kindle) erhältlich!
* *
*
Inhaltsverzeichnis
DIE BRÜDER KARAMASOW. Zweiter Teil
Impressum
ZWEITER TEIL
Viertes Buch
Überspanntheiten
1. Vater Ferapont
2. Beim Vater
3. Er gibt sich mit Schulknaben ab
4. Bei den Chochlakows
5. Überspanntheit im Salon
6. Überspanntheit in der ärmlichen Wohnung
Fünftes Buch
Pro und Kontra
1. Die Verlobung
2. Smerdjakow mit der Gitarre
3. Die Brüder lernen einander kennen
4. Rebellion
5. Der Großinquisitor
6. Ein vorläufig sehr unklares Kapitel
7. Mit einem klugen Menschen ist auch ein kurzes Gespräch von Nutzen
Sechstes Buch
Ein russischer Mönch
1. Der Starez Sossima und seine Besucher
2. Aus dem Leben des in Gott entschlafenen Priestermönchs und Starez Sossima, nach seinen eigenen Worten zusammengestellt von Alexej Fjodorowitsch Karamasow
3. Aus den Gesprächen und Belehrungen des Starez Sossima
Anhang: Namensregister
Eine kleine Bitte
Buchtipps für dich
Kostenlose eBooks
A p e B o o k C l a s s i c s
N e w s l e t t e r
F l a t r a t e
F o l l o w
A p e C l u b
Links
Zu guter Letzt
ZWEITER TEIL
Viertes Buch
Überspanntheiten
1. Vater Ferapont
Am frühen Morgen, noch vor dem Hellwerden, wurde Aljoscha geweckt. Der Starez war aufgewacht und fühlte sich sehr schwach, wünschte aber doch das Bett mit dem Lehnstuhl zu vertauschen. Er war bei voller Besinnung. Sein Gesicht zeugte zwar von großer Ermüdung, war aber klar und fast freudig und der Blick, heiter, freundlich und einladend. »Vielleicht werde ich nicht einmal den heutigen Tag überleben«, sagte er zu Aljoscha. Dann äußerte er den Wunsch, unverzüglich zu beichten und das Abendmahl zu nehmen. Sein Beichtvater war stets Vater Paissi. Nach dem Vollzug der beiden Sakramente begann die Letzte Ölung. Die Priestermönche versammelten sich, die Zelle füllte sich allmählich mit Einsiedlern. Inzwischen war der Tag angebrochen. Auch aus dem Kloster kamen Mönche. Als die heilige Handlung zu Ende war, wünschte der Starez von allen Abschied zu nehmen und alle zu küssen. Da die Zelle sehr eng war, gingen die zuerst Gekommenen wieder hinaus, um anderen Platz zu machen. Aljoscha stand neben dem Starez, der wieder im Lehnstuhl saß. Er redete und sprach Belehrungen aus, soviel er vermochte; seine Stimme war schwach, aber noch ziemlich fest. »So viele Jahre habe ich euch mit Belehrungen versehen und dabei so viele Jahre laut gesprochen, daß es mir förmlich zur Gewohnheit geworden ist, zu reden und redend zu belehren. Es würde mir fast schwerer fallen zu schweigen als zu reden, liebe Väter und lieber Brüder, sogar bei meiner jetzigen Schwäche«, scherzte er und blickte gerührt auf die Umstehenden. Aljoscha erinnerte sich später an dieses und jenes, was der Starez damals gesagt hatte. Obgleich er deutlich sprach und mit einigermaßen fester Stimme, war seine Rede doch ziemlich zusammenhanglos. Er sprach über vieles; er schien vor dem Tod gern noch sagen und aussprechen zu wollen, womit er im Leben nicht fertig geworden war, und zwar nicht nur der Belehrung wegen, sondern auch weil es ihn offenbar drängte, seine Freude und sein Entzücken mit allen und jedem zu teilen und nochmals sein ganzes Herz auszuschütten.
»Liebet einander, ihr Väter!« sprach der Starez, jedenfalls soweit sich Aljoscha später dessen entsann. »Liebet das Volk Gottes! Sind wir doch nicht deswegen heiliger als die Weltlichen, weil wir hierherkamen und uns in diesen Wänden einschlossen, im Gegenteil: Jeder, der hierherkommt, hat schon allein dadurch im stille bekannt, daß er schlechter ist als alle Weltlichen, als alle und jeder auf Erden ... Und je länger er in seiner Zelle lebt, um so fühlbarer muß er sich dessen bewußt werden. Andernfalls hätte er gar nicht zu kommen brauchen. Erkennt er aber, daß er nicht nur schlechter ist als alle Weltlichen, sondern auch allen Menschen gegenüber an allem und jedem Schuld trägt, an allen menschlichen Sünden, die von der ganzen Welt und von einzelnen begangen werden, dann erst wird der Zweck unserer Vereinigung erreicht. Denn wisset, ihr Lieben, daß jeder einzelne von uns an allem und jedem auf Erden Schuld trägt, nicht nur, weil er an der allgemeinen Schuld der Welt teilhat, sondern ein jeder einzeln für alle und für jeden Menschen auf dieser Erde. Dieses Bewußtsein ist die Krone für den Lebenswandel des Mönchs, ja eines jeden Menschen auf Erden. Denn die Mönche sind nicht andere Menschen, sondern nur solche, wie alle Menschen auf Erden es sein sollten. Erst dann wird unser Herz erfüllt sein von jener gerührten, unendlichen, allumfassenden Liebe, die keine Sättigung kennt. Dann wird jeder von euch imstande sein, die ganze Welt durch Liebe zu gewinnen und die Sünden der Welt mit seinen Tränen abzuwaschen. Ein jeder höre auf die Stimme seines Herzens, ein jeder beichte sich selbst unermüdlich. Fürchtet euch nicht vor eurer Sünde, auch wenn ihr euch ihrer bewußt geworden seid; genug, wenn Reue vorhanden ist, aber laßt euch nicht einfallen, Gott Bedingungen zu stellen. Wiederum sage ich euch, seid nicht stolz! Seid nicht stolz gegenüber den Geringen, nicht stolz gegenüber den Großen! Hasset nicht, die euch nicht anerkennen, die euch schmähen, beschimpfen, verleumden! Hasset nicht die Atheisten, die falschen Lehrer, die Materialisten, selbst nicht die Schlechten unter ihnen, geschweige die Guten, denn auch unter ihnen sind viele Gute, besonders in unserer Zeit. Gedenket ihrer in eurem Gebet: ›Rette, Herr, alle, die niemand haben, der für sie betet. Rette auch diejenigen, die nicht zu dir beten wollen!‹
Und fügt sogleich hinzu: ›Nicht in meinem Stolz bitte ich darum, Herr, denn auch ich selbst bin ein schändlicher Mensch, schlimmer als alle und jeder ...‹ Liebet das Volk Gottes, laßt nicht zu, daß Fremdlinge euch die Herde abspenstig machen; denn wenn ihr in Trägheit und geringschätzigem Stolz und vor allem in Eigennutz einschlafet, so werden sie von allen Seiten kommen und euch eure Herde abspenstig machen. Legt dem Volke unermüdlich das Evangelium aus! Wuchert nicht! Liebet nicht Silber und Gold, haltet es nicht in eurem Besitz! Seid gläubig und haltet das Banner fest! Erhebet es hoch!«
Der Starez sprach jedoch weniger zusammenhängend, als hier nach einer späteren Niederschrift Aljoschas wiedergegeben ist. Mitunter hörte er auf zu reden, als müßte er neue Kraft sammeln, und der Atem versagte ihm; aber er befand sich in einer Art von Begeisterung. Man hörte ihm mit Rührung zu, obgleich sich viele über seine Worte wunderten und manches darin dunkel fanden. Später erinnerten sich alle an diese Worte. Als Aljoscha sich zufällig einen Augenblick entfernte, war er überrascht von der allgemeinen Erregung und Erwartung in der Zelle und um sie herum. Die Erwartung trug bei manchen einen fast unruhigen, bei anderen einen feierlichen Charakter. Alle erwarteten, daß sich sofort nach dem Hinscheiden des Starez etwas Großes ereignete. Obwohl diese Erwartung unter gewissen Aspekten beinahe etwas Leichtfertiges hatte, konnten sich ihr selbst die ernstesten und ältesten Mönche nicht entziehen. Am ernstesten war das Gesicht des Priestermönchs Paissi.
Aljoscha hatte sich nur deshalb aus der Zelle entfernt, weil Rakitin ihm einen seltsamen Brief von Frau Chochlakowa aus
der Stadt mitgebracht und ihn durch einen Mönch hatte herausrufen lassen. Diese Dame machte Aljoscha eine interessante Mitteilung, die genau zu der augenblicklichen Lage paßte. Nämlich: Unter den einfachen Frauen, die sich am Vortag vor dem Starez verbeugt und von ihm hatten segnen lassen, sei auch eine namens Prochorowna gewesen, eine Unteroffizierswitwe. Diese habe den Starez gefragt, ob sie für ihren Sohn Wassenka, der dienstlich weit weg nach Sibirien, nach Irkutsk, versetzt worden sei und schon ein Jahr lang nichts von sich habe hören lassen, wie für einen Verstorbenen eine Seelenmesse lesen lassen dürfe. Das habe ihr der Starez als Hexerei streng verboten. Dann aber habe er ihr wegen ihrer Unwissenheit verziehen und – »als ob er im Buch der Zukunft läse«, so wörtlich in dem Brief von Frau Chochlakowa – tröstend hinzugefügt, ihr Sohn Wassja sei zweifellos am Leben und werde entweder selbst bald kommen oder einen Brief schreiben; sie solle nach Hause gehen und darauf warten. »Und soll man es glauben?« fügte Frau Chochlakowa begeistert hinzu. »Diese Prophezeiung ist buchstäblich in Erfüllung gegangen!« Ja mehr als das. Kaum sei die alte Frau zu Hause gewesen, habe man ihr sogleich einen Brief aus Sibirien übergeben. Und damit nicht genug. In diesem unterwegs, in Jekaterinburg, geschriebenen Brief habe Wassja die Mutter benachrichtigt, er sei zusammen mit einem Beamten nach Rußland unterwegs und hoffe in etwa drei Wochen die Mutter umarmen zu können.
Frau Chochlakowa richtete nun an Aljoscha die inständige Bitte, dieses neue »Wunder der Weissagung« unverzüglich dem Abt und der ganzen Brüderschaft mitzuteilen. »Das muß allen, aber auch allen bekannt werden!« rief sie am Schluß des Briefes aus. Der Brief war in Eile geschrieben, jede Zeile verriet die Aufregung der Schreiberin. Doch Aljoscha brauchte der Brüderschaft nichts mehr mitzuteilen, sie wußten es bereits alle. Rakitin hatte nämlich dem Mönch, durch den er Aljoscha herausrufen ließ, außerdem die respektvollste Meldung an Seine Hochehrwürden Vater Paissi aufgetragen, er, Rakitin, habe ihm eine Sache von solcher Wichtigkeit mitzuteilen, daß er sie keinen Augenblick zu verzögern wage, weshalb er für seine Dreistigkeit um Verzeihung bitte. Da der Mönch Rakitins Bitte Vater Paissi eher als Aljoscha ausgerichtet hatte, blieb Aljoscha, als er zurückgekehrt war und den Brief durchgelesen hatte, nichts übrig, als ihn Vater Paissi als Beweisdokument zu übergeben. Und siehe da, selbst dieser finstere, mißtrauische Mann konnte ein gewisses inneres Gefühl nicht verbergen, nachdem er die Nachricht von »dem Wunder« mit zusammengezogenen Augenbrauen gelesen hatte. Seine Augen blitzten, und seine Lippen lächelten in würdevoller Ergriffenheit.
»Werden wir das jemals schauen?« entfuhr es ihm unwillkürlich.
»Werden wir das je schauen, werden wir das je schauen?« wiederholten um ihn herum die Mönche.
Vater Paissi zog erneut die Augenbrauen zusammen und bat alle, wenigstens vorläufig mit niemand darüber zu sprechen, »bis die Sache noch weitere Bestätigung findet. In den weltlichen Dingen steckt viel Leichtfertigkeit, der Fall kann sich auch auf natürliche Weise zugetragen haben«, fügte er vorsichtig, wie zur Erleichterung seines Gewissens, hinzu. Eigentlich glaubte er aber selbst nicht an seinen Vorbehalt, und das merkten auch die Zuhörer sehr wohl. Noch in derselben Stunde wurde »das Wunder« natürlich dem ganzen Kloster und sogar vielen Laien, die zur Liturgie gekommen waren, bekannt.
Den größten Eindruck schien das Wunder auf einen Mönch zu machen, der einen Tag zuvor aus dem Kloster »Zum heiligen Silvester«, einem kleinen Kloster in Obdorsk im hohen Norden, in unser Kloster gekommen war. Er hatte sich am vorigen Tag, neben Frau Chochlakowa stehend, vor dem Starez verbeugt und diesen mit einem Hinweis auf die geheilte Tochter der Dame tief ergriffen gefragt: »Wie machen Sie es nur möglich, solche Taten zu vollbringen?«
Er befand sich ohnehin bereits in einer gewissen ratlosen Verwunderung und wußte nicht recht, was er glauben sollte. Schon am Abend vorher hatte er Vater Ferapont, ebenfalls ein Mönch unseres Klosters, in dessen separater Zelle hinter dem Bienenstand besucht, und diese Begegnung hatte außerordentlich auf ihn gewirkt und ihn zutiefst erschreckt; Vater Ferapont war ein hochbejahrter Mönch, ein großer Faster und Schweiger, ein Gegner des Starez Sossima und des Starzentums überhaupt, das er für eine schädliche und leichtfertige Neuerung hielt. Dieser Gegner war gefährlich, obwohl er fast mit niemand sprach; gefährlich besonders deshalb, weil einige Mitglieder der Brüderschaft derselben Ansicht waren wie er und weil ihn sehr viele Besucher als großen Gerechten und Glaubenseiferer verehrten, wenn sie ihn auch für einen religiösen Irren hielten. Doch gerade dieser religiöse Irrsinn gewann, ihm ihre Sympathie. Zum Starez Sossima ging Vater Ferapont nie. Er wohnte zwar in der Einsiedelei, aber man belästigte ihn nicht sonderlich mit den dort geltenden Geboten, wiederum weil er sich geradezu wie ein religiöser Irrer benahm. Er war mindestens fünfundsiebzig Jahre alt und wohnte hinter den Bienenstöcken der Einsiedelei, in einer alten, halbzerfallenen, hölzernen Zelle in einem Mauerwinkel; sie war bereits im vorigen Jahrhundert für einen anderen großen Faster und Schweiger errichtet worden, für Vater Jona, der es auf hundertundfünf Jahre gebracht hatte und von dessen Taten man sich im Kloster und in der Umgegend noch immer seltsame Geschichten erzählte. Vater Ferapont hatte vor sieben Jahren endlich durchgesetzt, daß auch er in dieser abgelegenen kleinen Zelle, die eigentlich eine einfache Hütte war, wohnen durfte. Die Hütte hatte allerdings Ähnlichkeit mit einer Kapelle, denn sie enthielt viele gestiftete Heiligenbilder, und vor diesen brannten gestiftete Ewige Lämpchen, die zu beaufsichtigen gewissermaßen Vater Feraponts Amt war. Er aß, wie man sagte, und das war, die Wahrheit, in drei Tagen nicht mehr als zwei Pfund Brot, das ihm alle drei Tage der ebenfalls in der Nähe der Bienenstöcke wohnende Imker brachte; auch zu ihm sprach Vater Ferapont selten ein Wort. Diese vier Pfund Brot bildeten zusammen mit dem sonntäglichen Weihbrot, das der Abt dem »Gerechten« regelmäßig nach der Spätmesse sandte, seine ganze Wochennahrung. Das Wasser in seinem Krug aber wurde täglich erneuert. Zum Gottesdienst erschien er nur selten. Verehrer, die ihn besuchten, sahen ihn manchmal den ganzen Tag im Gebet verharren, ohne daß er sich von den Knien erhob oder um sich blickte. Wenn er sich wirklich einmal in ein Gespräch einließ, so sprach er kurz, abgehackt, seltsam und beinahe grob. Es kam jedoch, wenn auch sehr selten, vor, daß er sich vor den Besuchern gesprächig zeigte; meist aber sprach er nur ein seltsames Wort, das dem Besucher ein Rätsel aufgab und das er, allen Bitten zum Trotz, nicht erklärte. Einen geistlichen Rang hatte er nicht, er war nur ein einfacher Mönch. Es ging das sonderbare Gerücht, allerdings nur unter ungebildeten Leuten, Vater Ferapont verkehre mit himmlischen Geistern und spreche nur mit ihnen, deshalb sei er Menschen gegenüber so schweigsam.
Nachdem sich der Mönch aus Obdorsk zu den Bienenstöcken hingefunden hatte, begab er sich nach den Hinweisen des Imkers, auch eines schweigsamen, finsteren Mönchs, in jenen Winkel, wo Vater Feraponts Zelle stand. »Vielleicht wird er mit dir, einem Fremden, reden. Es kann aber auch sein, daß du kein Wort zu hören bekommst«, sagte ihm der Imker im voraus. Der Mönch näherte sich der Zelle, wie er später selbst erzählte, mit großer Furcht. Es war ziemlich spät. Vater Ferapont saß vor der Tür der Zelle auf einem niedrigen Bänkchen. Über ihm rauschte eine mächtige Ulme. Die Abendkühle war bereits fühlbar. Der Mönch aus Obdorsk fiel vor dem »Gerechten« nieder, verbeugte sich bis zur Erde und bat um seinen Segen.
»Willst du, daß ich ebenfalls vor dir niederfalle, Mönch?« sagte Vater Ferapont. »Steh auf!«
Der Mönch erhob sich.
»Segne mich und sei gesegnet! Setze dich neben mich! Woher kommst du?«
Am meisten überraschte den Mönch, daß Vater Ferapont trotz seines zweifellos strengen Fastens und hohen Alters noch recht rüstig schien. Er war groß, hielt sich ungebeugt und hatte ein zwar mageres, aber doch frisches, gesundes Gesicht. Unzweifelhaft besaß er noch erstaunliche körperliche Kraft. Er war von athletischer Konstitution; trotz seines Alters war sein dichtes, früher schwarzes Kopf- und Barthaar noch nicht einmal vollständig ergraut. Seine Augen waren grau, groß und leuchtend, dabei auffallend weit geöffnet. Er trug einen langen rötlichen Bauernrock aus grobem »Sträflingstuch«, wie man früher sagte, und als Gurt einen dicken Strick. Hals und Brust waren nackt. Unter dem Rock hing ein dickes Leinwandhemd hervor, das seit Monaten nicht gewechselt und daher fast schwarz war. Angeblich trug er unter dem Rock dreißig Pfund schwere Büßerketten. Die nackten Füße steckten in alten Stiefeln, die beinahe auseinanderfielen.
»Aus einem kleinen Kloster in Obdorsk, ›Zum Heiligen Silvester‹«, antwortete der fremde Mönch demütig, während er den Einsiedler mit seinen flinken, neugierigen, etwas ängstlichen Äuglein betrachtete.
»Ich habe bei deinem Silvester gewohnt. Ist er gesund?«
Der Mönch stutzte.
»Unvernünftige Menschen seid ihr! Wie haltet ihr die Fasten ein?«
»Unsere Speisenordnung, entsprechend der alten Einsiedlerregel, ist folgende. In den Großen Fasten gibt es montags, mittwochs und freitags weder Mittag- noch Abendessen. Dienstags und donnerstags bekommt die Brüderschaft Weißbrot, Honigtrunk, Brombeeren oder Salzkohl und Haferbrei. Sonnabends Weißkohlsuppe, Nudeln aus Erbsenmehl, Grütze mit Hanfsaft, alles mit Öl. Sonntags gibt es zur Kohlsuppe trockenen Fisch und Grütze. In der Karwoche vom Montag bis Sonnabendabend, sechs Tage lang, Brot und Wasser, nur ungekochte Pflanzenkost, und auch das nur enthaltsam; wenn möglich, sollte man überhaupt nicht alle Tage Nahrung zu sich nehmen. Am Karfreitag wird nichts gegessen, ebenso am folgenden Sonnabend bis zur dritten Stunde, dann genießen wir etwas Brot mit Wasser und trinken eine Tasse Wein. Am Gründonnerstag essen wir Eingemachtes ohne Öl und trinken dazu bisweilen ein wenig Wein; denn laut Konzil zu LaodiceaA26 über den Gründonnerstag ziemt es sich nicht, in den Großen Fasten am Donnerstag der letzten Woche Dispens zu erteilen und so die ganze Fastenzeit zu entehren. So wird es bei uns gehalten. Aber was ist das im Vergleich mit Ihnen, großer Vater«, fügte der Mönch, schon etwas dreister geworden, hinzu. »Denn Sie leben das ganze Jahr, sogar am heiligen Osterfest, von Brot und Wasser, und die Brotmenge, die wir in zwei Tagen verzehren, reicht Ihnen für die ganze Woche. Wahrhaft bewundernswert, diese Enthaltsamkeit.«
»Und die Pfifferlinge?« fragte plötzlich Vater Ferapont.
»Welche Pfifferlinge?« fragte der Mönch erstaunt zurück.
»Ich werde von ihrem Brot abgehen, ich brauche überhaupt kein Brot. Ich werde einfach in den Wald gehen und von Pfifferlingen und Beeren leben. Aber die hier gehen nicht ab von ihrem Brot, sie sind dem Teufel verfallen. Heutzutage sagen die Ungläubigen, so zu fasten habe keinen Sinn. Hochmütig und heidnisch ist dieses Urteil!«
»Ach ja, das ist wahr«, sagte der Mönch seufzend.
»Hast du die Teufel bei ihnen gesehen?« fragte Vater Ferapont.
»Bei wem meinen Sie?« erkundigte sich schüchtern der Mönch.
»Ich war im vorigen Jahr am Pfingstsonntag beim Abt und bin seitdem nicht wieder da gewesen. Dem einen saß ein Teufel an der Brust und versteckte sich unter der Kutte, daß nur die Hörner herausguckten; bei einem zweiten sah einer zur Tasche heraus, seine Augen gingen schnell hin und her, weil er mich fürchtete; bei einem dritten saß einer im Bauch, in dem unsauberen Wanst, bei einem vierten gar hatte sich ein Teufel am Hals festgeklammert, er trug den Teufel und sah ihn nicht.«
»Und Sie ... Sie haben die Teufel gesehen?« fragte der Mönch.
»Ich sage dir ja, daß ich sie gesehen habe, ganz genau habe ich sie gesehen. Als ich vom Abt weggehen wollte, sah ich, wie sich einer hinter der Tür versteckte, ein kräftiger, anderthalb Eilen großer, mit einem dicken und langen schwarzbraunen Schwanz, und mit dem Ende dieses Schwanzes war er in die Spalte der Tür geraten. Ich aber, nicht dumm, schlug plötzlich die Tür zu und klemmte seinen Schwanz ein. Hei, wie er winselte, wie er sich wand! Ich machte dreimal das Zeichen des Kreuzes über ihn, und er verreckte wie eine zerdrückte Spinne. Jetzt ist er jedenfalls da in der Ecke verwest und stinkt, aber die sehen nichts und riechen nichts. Seit einem Jahr gehe ich nicht mehr hin. Nur dir, einem Fremden, erzähle ich es.«
»Furchtbar sind Ihre Worte! Aber wie steht es, großer gerechter Vater«, fragte der Mönch, immer mutiger werdend, »mit
dem ruhmvollen Gerücht über Sie, das sogar in ferne Gegenden gedrungen ist. Sie ständen mit dem Heiligen Geiste in
ständiger Verbindung?«
»Er kommt manchmal herabgeflogen.«
»Wie denn? In welcher Gestalt?«
»Als Vogel.«
»Der Heilige Geist in Gestalt einer Taube?«
»Mal der Heilige Geist, mal der Heiliggeist. Der Heiliggeist ist etwas anderes, der kommt auch in anderer Vogelgestalt, manchmal als Schwalbe, manchmal als Stieglitz und manchmal als Meise.«
»Wie unterscheiden Sie ihn denn von einer Meise?«
»Er spricht.«
»Wie denn, in welcher Sprache?«
»In menschlicher.«
»Was sagt er denn zu Ihnen?«
»Gerade heute verkündete er mir, ein Dummkopf würde mich besuchen und alberne Fragen stellen. Sehr viel, Mönch, verlangst du zu wissen.«
»Furchtbar sind Ihre Worte, gerechtester, heiligster Vater!« sagte der Mönch, den Kopf hin und her wiegend. In seinen ängstlichen kleinen Augen war auch etwas Mißtrauen zu bemerken.
»Siehst du diesen Baum?« fragte Vater Ferapont nach einer Weile.
»Ja, ich sehe ihn, gerechtester Vater.«
»Du meinst, er ist eine Ulme? Nach meiner Meinung ist er etwas anderes.«
»Was denn?« fragte der Mönch, nachdem er eine Weile vergeblich auf eine Erläuterung gewartet hatte.
»Manchmal des Nachts ... Siehst du diese beiden Äste? Des Nachts streckt dort Christus verlangend seine Arme nach mir aus, ich sehe es deutlich und zittere. Furchtbar, oh, furchtbar!«
»Was ist daran so furchtbar, wenn es Christus ist?«
»Er wird mich fassen und hinauftragen.«
»Lebendig?«
»Im Geist und in der Kraft des Elias, hast du davon noch nichts gehört? Er wird mich umarmen und davontragen ...«
Nach diesem Gespräch war der Mönch aus Obdorsk zutiefst verwundert, doch stand er innerlich eher auf seiten des Vaters Ferapont als auf seiten des Vaters Sossima, als er in die Zelle zurückkehrte, die man ihm bei einem der Brüder zugewiesen hatte. Er war vor allem für das Fasten, und deshalb war es für ihn nicht erstaunlich, wenn ein großer Faster wie Vater Ferapont »Wunderbares erschaute«. Seine Worte schienen zwar etwas unverständlich, aber Gott mußte ja wissen, was für ein Sinn darin verborgen lag; bei den um Christi willen Törichten kamen noch ganz andere Worte und Taten vor. An den eingeklemmten Teufelsschwanz wollte er nicht nur im übertragenen, sondern im buchstäblichen Sinne von Herzen gern und bereitwillig glauben. Außerdem hatte er schon früher ein starkes Vorurteil gegen das Starzentum gehabt, das er bis dahin nur vom Hörensagen kannte und auf das Urteil anderer hin für eine schädliche Neuerung hielt. Während seines eintägigen Aufenthaltes im Kloster hatte er auch bereits das heimliche Murren einiger leichtsinniger Brüder bemerkt, die mit dem Starzentum unzufrieden waren. Zudem war er von Natur sehr beweglich und hatte für alles mögliche Interesse. Die große Nachricht von dem neuen »Wunder« des Starez Sossima versetzte ihn deshalb
außerordentlich in Erstaunen. Aljoscha erinnerte sich später, unter den Mönchen, die sich um die Zelle des Starez drängten und zu ihm wollten, war häufig die eifrige, auf alles horchende und nach allem fragende Gestalt des Gastes aus Obdorsk aufgetaucht. Doch hatte er ihn damals wenig beachtet, weil ihn ganz andere Dinge beschäftigten.
Der Starez Sossima, der sich wegen starker Müdigkeit wieder ins Bett gelegt hatte, erinnerte sich auf einmal Aljoschas und wollte ihn sprechen, obwohl ihm schon die Augen zufielen. Als Aljoscha zu ihm kam, traf er beim Starez nur Vater Paissi, den Priestermönch Vater Jossif und den Novizen Porfiri. Der Starez schlug die Augen auf, blickte Aljoscha lange an und fragte plötzlich: »Erwarten dich die Deinigen, lieber Sohn?«
Aljoscha stammelte etwas.
»Bedürfen sie deiner nicht? Hast du gestern jemand versprochen, heute zu ihm zu kommen?«
»Ja, ich habe es versprochen ... dem Vater ... den Brüdern ... und anderen.«
»Siehst du, so geh unter allen Umständen zu ihnen! Sei nicht traurig! Wisse, daß ich nicht sterben werde, bevor ich nicht in deiner Gegenwart mein letztes Wort gesagt habe, und zwar zu dir, dir will ich es als Vermächtnis hinterlassen. Dir, lieber Sohn, weil du mich liebst. Jetzt aber geh zu denen, die dich erwarten!«
Aljoscha gehorchte, ohne zu zögern, allerdings schweren Herzens. Doch das Versprechen des Starez, er werde sein letztes Wort vernehmen, gleichsam als Vermächtnis, tröstete und beglückte ihn. Er wollte sich beeilen und so schnell wie möglich alles in der Stadt erledigen, um bald zurückkehren zu können. Als er mit Vater Paissi die Zelle des Starez verließ, gab dieser ihm noch ein Geleitwort mit auf den Weg, das einen unerwartet starken Eindruck auf ihn machte.
»Sei immer dessen eingedenk, Jüngling«, begann Vater Paissi ohne jede Einleitung, »daß die weltliche Wissenschaft eine große Macht geworden ist und namentlich im letzten Jahrhundert alles kritisiert hat, was uns in den heiligen Büchern Himmlisches vermacht worden ist. Die unbarmherzige Analyse der Gelehrten hat von allem, was früher heilig war, nichts übriggelassen. Sie untersuchten aber nur immer die einzelnen Teile und niemals das Ganze; man muß sogar die Blindheit bewundern, mit der sie dabei verfahren sind. Das Ganze jedoch steht vor ihren eigenen Augen unerschüttert da wie vorher, und die Pforten der Hölle können es nicht überwältigen. Hat es denn nicht neunzehn Jahrhunderte lang gelebt, lebt es nicht auch jetzt noch in den Bewegungen der einzelnen Seelen und denen der Volksmassen? Sogar in den Bewegungen der Seelen jener Atheisten, die alles zerstört haben, lebt es wie vorher, unerschütterlich! Denn auch diejenigen, die sich vom Christentum lossagten und sich dagegen empören, zeigen ihrem eigentlichen Wesen nach denselben Christustypus und blieben dieselben; denn bis jetzt war weder ihre Weisheit noch die Wärme ihres Herzens imstande, für den Menschen und seine Würde ein anderes, höheres Vorbild zu schaffen, als Christus uns vor alters gewiesen hat. Die Produkte aller ihrer Versuche waren nur Mißgeburten. Sei dessen besonders eingedenk, Jüngling! Denn dein hinscheidender Starez hat dich dazu bestimmt, in die Welt hinauszugehen. Vielleicht wirst du, wenn du dieses großen Tages gedenkst, auch meine Worte nicht vergessen, die ich dir von ganzem Herzen mit auf den Weg gebe;
denn du bist noch jung, und die Anfechtungen in der Welt sind schwer – deine Kräfte allein können ihnen nicht widerstehen. Und jetzt geh, du Ärmster!«
Mit diesen Worten segnete ihn Vater Paissi. Als Aljoscha das Kloster verließ und alle diese unerwarteten Worte überdachte, wurde ihm plötzlich klar, daß er in diesem strengen, ihm gegenüber bisher so finsteren Mönch unverhofft einen neuen Freund und liebenden neuen Führer gefunden hatte – beinahe wie vom Starez Sossima auf dem Totenbett vermacht. Vielleicht haben sie das untereinander abgemacht, überlegte Aljoscha. Vater Paissis soeben gehörte unerwartete Belehrung zeugte von dessen gütigem Herzen. Er beeilte sich, den jugendlichen Geist so schnell wie möglich für den Kampf mit den Versuchungen zu wappnen und die ihm anvertraute jugendliche Seele mit der denkbar festesten Rüstung auszustatten.
Konzil zu Laodicea: im 4. Jahrhundert, 352, 364 oder 365
2. Beim Vater
Zuallererst ging Aljoscha zum Vater. Als er sich dem Haus näherte, fiel ihm ein, daß der Vater ihn am Tag vorher dringend gebeten hatte, so hereinzukommen, daß sein Bruder Iwan es nicht merkte. ›Warum?‹ fragte sich Aljoscha jetzt. ›Wenn der Vater mir etwas allein sagen will, warum soll ich denn heimlich hereinkommen? Wahrscheinlich wollte er gestern etwas anderes sagen und traf in der Aufregung nicht den richtigen Ausdruck?‹ Dennoch war er sehr froh, als Marfa Ignatjewna, die ihm öffnete – Grigori war krank und lag im Seitengebäude im Bett –, ihm mitteilte, Iwan Fjodorowitsch sei vor zwei Stunden ausgegangen.
»Und der Vater?«
»Der ist aufgestanden und trinkt Kaffee«, antwortete Marfa Ignatjewna ein wenig trocken.
Aljoscha trat ein. Der Alte saß am Tisch, in Pantoffeln und einem alten Paletot, und sah ohne besondere Aufmerksamkeit, mehr zur Unterhaltung, Rechnungen durch. Er war allein im Hause; Smerdjakow war ausgegangen, um zum Mittagessen einzukaufen. Seine Gedanken waren nicht bei den Rechnungen. Obgleich er zeitig aufgestanden war und ein forsches Wesen herauskehrte, sah er müde und schwach aus. Die Stirn, auf der über Nacht gewaltige blutrote Beulen entstanden waren, hatte er mit einem roten Tuch umwickelt. Auch auf der stark angeschwollenen Nase hatten sich einige, wenn auch unbedeutende, blutunterlaufene Stellen gebildet, die dem ganzen Gesicht einen besonders bösen, gereizten Ausdruck verliehen. Der Alte wußte das und sah den eintretenden Aljoscha unfreundlich an.
»Der Kaffee ist kalt«, rief er. »Ich biete ihn dir gar nicht an. Ich selbst, mein Lieber werde heute nur eine kärgliche Fischsuppe essen, wie in der Fastenzeit, und kann niemand einladen. Warum bist du gekommen?«
»Um mich nach Ihrem Befinden zu erkundigen«, antwortete Aljoscha.
»Aha. Außerdem habe ich dir gestern selbst befohlen, herzukommen. Das alles ist dummes Zeug. Du hast dich umsonst herbemüht. Ich wußte übrigens, daß du gleich angewetzt kommen würdest ...« Er sagte das in sehr feindseliger Stimmung.
Inzwischen war er aufgestanden und betrachtete sorgenvoll seine Nase im Spiegel, vielleicht zum vierzigstenmal seit dem Morgen. Dann mühte er sich, das rote Tuch ordentlicher um die Stirn zu legen.
»Ein rotes macht sich besser, ein weißes erinnert zu sehr an Krankenhaus«, bemerkte er ärgerlich. »Na«, und wie steht es bei dir? Was macht dein Starez?«
»Es geht ihm sehr schlecht, er wird vielleicht heute sterben«, antwortete Aljoscha. Der Vater hörte jedoch gar nicht zu und hatte seine Frage gleich wieder vergessen.
»Iwan ist weggegangen«, sagte er plötzlich. »Er macht seinem Bruder Mitja aus Leibeskräften die Braut abspenstig ... Darum hält er sich hier auch auf«, fügte er boshaft hinzu und starrte Aljoscha mit schiefem Mund an.
»Hat er Ihnen das selbst, gesagt?« fragte Aljoscha.
»Ja, schon längst. Was glaubst du wohl? Schon vor etwa drei Wochen. Er wird doch nicht auch gekommen sein, mir den Hals abzuschneiden? Zu irgendeinem Zweck muß er doch gekommen sein?«
»Was reden Sie da? Wie können Sie nur so etwas sagen!« rief Aljoscha bestürzt.
»Um Geld bittet er mich nicht, das ist richtig, er würde auch keine Kopeke von mir bekommen. Ich beabsichtige, möglichst lange zu leben, mein liebster Alexej Fjodorowitsch, und deshalb brauche ich jede Kopeke. Je länger ich lebe, um so nötiger brauche ich sie«, fuhr er fort, im Zimmer auf und ab gehend, die Hände in den Taschen seines weiten, fettfleckigen, gelben Sommerpaletots. »Jetzt bin ich einstweilen noch ein Mann, erst fünfundfünfzig, aber ich will noch zwanzig Jahre lang meinen Platz als Mann ausfüllen. Wenn ich alt und garstig bin, kommen die Weiber nicht mehr gutwillig, dann brauche ich Geld. Darum spare ich jetzt immer mehr zusammen, immer mehr, und zwar für mich, mein lieber Sohn Alexej Fjodorowitsch, das könnte ihr euch merken! Ich will in meiner Liederlichkeit bis zu meinem Ende weiterleben, das merkt euch. Die Liederlichkeit ist der schönste Genuß, alle Leute schimpfen auf sie, dabei leben sie doch alle liederlich, nur tun sie es heimlich – ich tue es öffentlich. Meine Offenherzigkeit ist auch der Grund, weshalb die anderen über mich herfallen. In dein Paradies, Alexej Fjodorowitsch, will ich gar nicht hinein, für einen ordentlichen Menschen schickt es sich gar nicht, ins Paradies einzugehen, selbst wenn es eins gibt. Nach meiner Ansicht werde ich, sobald ich mal eingeschlafen bin, nicht wieder aufwachen, und nichts wird mehr sein! Erinnert euch meiner, wenn ihr wollt – wollt ihr nicht, so hol euch der Teufel! Das ist meine Philosophie. Gestern hat Iwan hier schöne Reden gehalten, obwohl wir alle betrunken waren. Iwan ist ein Prahlhans, er ist nicht sehr gelehrt und besonders gebildet auch nicht. Er schweigt und lächelt über einen, das ist seine ganze Kunst.«
Aljoscha hörte schweigend zu.
»Warum spricht er nicht mit mir? Und wenn er spricht, so schauspielert er. Er ist ein Schuft, dein Iwan! Gruschenka aber werde ich heiraten, sobald ich nur will. Denn wenn man Geld hat, braucht man nur zu wollen, Alexej Fjodorowitsch! Mit Geld läßt sich alles einrichten. Eben das fürchtet Iwan, deshalb paßt er auf mich auf. Damit ich sie nicht heirate! Deshalb drängt er auch Mitka, Gruschenka zu heiraten. Auf diese Weise will er mich von ihr fernhalten – als ob ich ihm Geld vererbe, wenn ich sie nicht heirate! Andererseits will er sich, wenn Mitka Gruschenka heiratet, dessen reiche Braut nehmen, das ist seine Spekulation! Er ist ein Schuft, dein Iwan!«
»Wie gereizt Sie sind! Das rührt von gestern her. Sie sollten sich hinlegen«, sagte Aljoscha.
»Siehst du, wenn du das sagst«, bemerkte der Alte, als käme ihm dieser Gedanke zum erstenmal, »wenn du das sagst, bin ich dir nicht böse. Auf Iwan wäre ich böse, würde er dasselbe sagen. Nur wenn ich mit dir zusammen war, hatte ich manchmal Augenblicke, in denen ich gut war, sonst bin ich ein ganz schlechter Kerl.«
»Sie sind nicht schlecht, nur Ihre Seele ist entstellt«, sagte Aljoscha lächelnd.
»Hör mal, ich wollte diesen rohen Menschen, den Mitka, heute schon einsperren lassen, und ich weiß auch jetzt noch nicht, wie ich mich entscheide. Zwar ist es heutzutage üblich, den Respekt vor Vater und Mutter für einen überholten Standpunkt zuhalten, doch nach dem Gesetz ist es auch jetzt, glaube ich, noch nicht erlaubt, bejahrte Väter in ihrem eigenen Haus an den Haaren zu ziehen, auf den Boden zu werfen, ihnen mit dem Stiefelabsatz in die Visage zu treten und sich zu rühmen, man werde wiederkommen und sie ganz totschlagen, und das alles vor Zeugen! Ich könnte ihn, wenn ich wollte, sofort einsperren lassen und ihn gehörig in Verlegenheit bringen!«
»Sie wollen ihn also nicht verklagen?«
»Iwan hat mir abgeraten. Ich würde mich ja nicht um Iwans Rat kümmern, aber ich habe da meine eigenen Gedanken.« Zu Aljoscha hinübergebeugt, fuhr er fast flüsternd fort: »Wenn ich ihn einsperren lasse, den Schuft, erfährt sie es und läuft gleich zu ihm. Wenn sie aber heute hört, daß er mich schwachen alten Mann halbtot geschlagen hat, wird sie sich vielleicht von ihm abwenden und mich besuchen ... Siehst du, so ist nun mal ihr Charakter, sie handelt oft nur den Leuten zum Trotz. Ich kenne sie durch und durch! Na, wie ist es, trinkst du nicht einen Kognak? Nimm doch ein bißchen kalten Kaffee, ich gieße dir ein viertel Gläschen Kognak dazu, das bessert den Geschmack, mein Lieber.«
»Nein, danke, nicht nötig. Aber dieses Brötchen werde ich mitnehmen, wenn Sie erlauben«, sagte Aljoscha, nahm ein Dreikopekenbrötchen und steckte es in seine Kuttentasche. »Kognak sollten auch Sie nicht trinken«, sagte er behutsam und schaute dem Alten ins Gesicht.
»Da hast du recht, er reizt nur, anstatt zu beruhigen. Na, nur ein einziges Gläschen ... Ich will mir aus dem Schränkchen gleich mal ...«
Er schloß das »Schränkchen« auf, goß sich ein »GIäschen« ein, trank es aus, schloß das Schränkchen wieder zu und steckte den Schlüssel in die Tasche.
»Und damit basta, von einem Gläschen krepiere ich nicht.«
»Sie sind ja jetzt auch ruhiger geworden«, sagte Aljoscha lächelnd.
»Hm! Dich liebe ich auch ohne Kognak, doch den Schuften gegenüber bin ich auch ein Schuft. Iwan fährt nicht nach Tschermaschnja. Warum? Er will spionieren, ob ich Gruschenka viel gebe, wenn sie zu mir kommt. Alle sind sie Schufte! Und Iwan erkenne ich überhaupt nicht an, ich kenne ihn gar nicht. Wo hat er nur sein Wesen her? Das ist gar nicht unsere Denkungsart. Und dem soll ich etwas hinterlassen? Ich werde überhaupt kein Testament hinterlassen, das könnt ihr euch merken. Und Mitka werde ich zerdrücken wie eine Schabe. Ich zerquetsche die schwarzen Schaben nachts immer mit dem Pantoffel, das knackt nur so, wenn man drauftritt. So wird auch dein Mitka einmal knacken. Ich sage dein Mitka, weil du ihn so liebst. Siehst du, du liebst ihn, aber ich fürchte mich deswegen nicht. Nur wenn Iwan ihn lieben würde – dann hätte ich Angst um mich. Aber Iwan liebt niemanden, er ist von anderer Art als wir. Menschen wie Iwan, mein Lieber, sind anders als wir, sind Staub, der sich erhebt. Wenn aber der Wind bläst, verweht der Staub ... Gestern, als ich dir sagte, du möchtest mich heute besuchen, hatte ich einen dummen Gedanken. Ich wollte durch dich etwas über Mitka erfahren. Nämlich: wenn ich ihm jetzt tausend oder, sagen wir, zweitausend Rubel auszahle, ob er dann wohl, ein Bettler und Lump, wie er ist, bereit wäre, sich von hier wegzuscheren, auf fünf Jahre oder besser auf fünfunddreißig, aber ohne Gruschenka, jetzt und für immer?«
»Ich werde ihn fragen ...«, murmelte Aljoscha. »Wenn es dreitausend wären, würde er vielleicht ...«
»Unsinn! Jetzt brauchst du ihn überhaupt nicht mehr zu fragen, es ist nicht mehr nötig! Ich habe es mir anders überlegt. Mein gestriger Einfall war eine Dummheit. Nichts werde ich geben, gar nichts, ich brauche mein Geld allein!« sagte der Alte und machte eine energische Handbewegung. »Auch ohne das werde ich ihn wie eine Schabe zerquetschen. Sag ihm nichts, sonst macht er sich noch vergebliche Hoffnungen. Und auch du hast jetzt nichts mehr bei mir zu suchen. Mach, daß du wegkommst! Seine Braut Katerina Iwanowna, die er die ganze Zeit ängstlich vor mit verborgen hat, wird die ihn heiraten? Du bist ja wohl gestern bei ihr gewesen?«
»Sie will um keinen Preis von ihm lassen.«
»Na ja, diese Sorte von zartfühlenden Frauen liebt ja gerade solche Männer, die Wüstlinge und Schufte sind. Dumm sind sie, diese blassen Fräulein, das sage ich dir! Na, wenn ich seine Jugend hätte und mein Gesicht von damals – ich sah mit achtundzwanzig besser aus als er jetzt –, würde ich ebensolche Eroberungen machen wie er. Er ist eine Kanaille! Aber Gruschenka bekommt er doch nicht, die soll er nicht haben! Zu Dreck werde ich ihn machen!«
Bei den letzten Worten war er wieder in Wut geraten.
»Mach, daß du wegkommst! Du hast hier nichts mehr zu schaffen«, sagte er barsch.
Aljoscha trat zu ihm, um sich zu verabschieden, und küßte ihn auf die Schulter.
»Warum das?« fragte der Alte erstaunt. »Wir werden uns ja noch wiedersehen. Oder meinst du, wir werden uns nicht mehr wiedersehen?«
»Durchaus nicht. Ich habe es ohne besondere Absicht getan.«
»Na, ich habe auch nur so gefragt ...«, sagte der Alte und sah ihn an. »Hör mal«, rief er ihm nach, »komm bald mal wieder! Zur Fischsuppe. Ich werde Fischsuppe kochen lassen, eine besondere, nicht so wie heute, komm bestimmt! Komm gleich morgen, hörst du, komm morgen!«
Kaum war Aljoscha aus der Tür, ging der Alte wieder zum »Schränkchen« und goß sich noch ein »Gläschen« hinter die Binde.
»Mehr trinke ich jetzt nicht!« murmelte er, räusperte sich, schloß das Schränkchen wieder zu und steckte den Schlüssel in die Tasche. Dann ging er in sein Schlafzimmer und sank kraftlos aufs Bett, wo er im nächsten Augenblick einschlief.