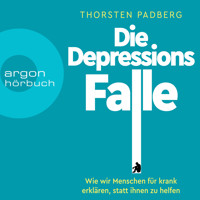19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Es gibt Auswege aus der Depression – auch ohne Medikamente. Warum Antidepressiva keine Lösung und was die Alternativen sind, erklärt der erfahrene Psychotherapeut Thorsten Padberg in einem einfühlsamen Plädoyer. Denn lange schon läuft etwas schief im gesellschaftlichen Umgang mit dem Leid. Wer länger als zwei Wochen trauert, hat eine Depression, heißt es im Diagnoseschlüssel. Doch ist Trauer nicht eine angemessene Reaktion auf den Verlust eines geliebten Menschen? Muss sie wirklich mit Medikamenten und jahrelanger Therapie behandelt werden? In Gesprächen mit Experten und auf Grundlage vieler Studien zeigt Thorsten Padberg, dass Psychopharmaka meist nicht mehr bewirken als ein Placebo. Depressionen haben keine nachweisbaren körperlichen Ursachen, weder Hormone noch Gene oder das Gehirn. Die Ursachen liegen meist im Leben der Betroffenen. Trennung, Tod, Jobverlust lassen uns grübeln, verzweifeln oder trauern. Depressionen haben gesellschaftliche Ursachen, die nicht ignoriert werden dürfen. Betroffene müssen dabei unterstützt werden, ihr Leben wieder in die Hand zu nehmen. Eine aufrüttelnde Botschaft, die sich nicht nur an Psychiater und Therapeuten richtet. Menschen, die von Depressionen betroffen sind, und ihre Angehörigen finden hier neue Perspektiven auf ihr Leid und auf das Leben. Thorsten Padberg will Mut machen mit einer Erkenntnis, die Experten genauso bestätigen wie etliche Fälle aus seiner Praxis: Niemand muss ein Leben lang leiden und Pillen schlucken. »Eine wichtige Recherche, großartig erzählt!« Julia Friedrichs, Autorin von »Working Class«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 377
Ähnliche
Thorsten Padberg
Die Depressions-Falle
Wie wir Menschen für krank erklären, statt ihnen zu helfen
FISCHER E-Books
Inhalt
»Was ist dein Ziel in der Philosophie?
Der Fliege den Ausweg aus dem Fliegenglas zeigen.«
Ludwig Wittgenstein,
Philosophische Untersuchungen, § 309
Das Fliegenglas ist eine Insektenfalle, eine bauchige Flasche aus weißem Glas, die unten mit Honigwasser gefüllt ist. Davon angelockt, gelangt die Fliege durch ein nach innen gewölbtes Loch im Boden in die Flasche, die jedoch nach oben hin verschlossen ist. Das Insekt fliegt nach oben auf das Licht zu. Immer wieder stößt es gegen das Glas. Bis seine Kräfte nachlassen, bis es im Honigwasser ertrinkt. Durch das Loch im Boden, das in die Freiheit geführt hätte, sind inzwischen weitere Fliegen in die Falle geflogen.
Für Julia, die den Ball ins Rollen brachte
Für meine Eltern, die dasselbe schon viel früher taten
Für Christian, der ihn am Laufen hält, immer
Vorbemerkung
Sie haben dieses Buch aufgeschlagen, weil Sie sich mit Depressionen beschäftigen. Sie haben in den Medien von Depressionen gehört. Sie haben gelesen, wie weitverbreitet diese schwere und manchmal lebensgefährliche psychische Krankheit ist. Und Sie haben sich vielleicht gefragt, ob Sie auch selbst davon betroffen sind. Möglicherweise hat Ihr Arzt oder Psychotherapeut Ihnen gesagt, Sie hätten Depressionen. Oder Sie haben zu diesem Buch gegriffen, weil Sie sich um jemanden sorgen, den Sie kennen und lieben, und sich fragen, was diesem Menschen fehlt.
Womöglich haben Sie gehört, dass die Depression schon bald die weltweit häufigste Krankheit sein könnte. Und dass eine enorme Kostenlawine auf die Gesellschaft zurollt, in der Höhe vergleichbar mit den Folgen der Corona-Krise. Die Depression ist wie ein Stein, den man in einen ruhigen See wirft. Sie zieht Kreise, die weit über ihren Auslöser hinausgehen. Neben der Behandlung selbst schlagen Arbeitsausfälle und Produktionsverluste zu Buche. Psychische Erkrankungen sind in Deutschland der zweithäufigste Grund für Krankschreibungen. Im Jahr 2018 verursachten sie hierzulande über 90 Millionen Krankheitstage sowie Produktionsausfälle von mehr als 13 Milliarden Euro.[1] Dazu kommen Belastungen im privaten Umfeld der Betroffenen. Vielleicht werden in der Folge auch die Angehörigen und Freunde depressiv. Deswegen müsse man, so heißt es oft, gegen Depressionen schnellstmöglich etwas unternehmen.
Ich stelle in diesem Buch das Konzept der Depression in seiner jetzigen Form in Frage. Sie werden erfahren, wie es entstand und so lange verändert wurde, bis es eine Form angenommen hat, die sehr schädlich ist. Die Leiden, die wir heute Depressionen nennen, sind schwer, so schwer, dass sie mit dem Tod enden können. Aber es ist selten sinnvoll, unsere Probleme als Krankheiten anzusehen und auch so zu behandeln. Denn die Bewältigung dieser Probleme wird dadurch häufig erschwert. Durch die Idee, Depressionen seien eine Krankheit, ähnlich wie zum Beispiel Diabetes, geraten nicht nur wichtige soziale Faktoren aus dem Blickfeld. Zugleich werden die Möglichkeiten kleiner, mit dem, was uns im Leben belastet, umzugehen.
Wenn depressive Menschen heute behandelt werden, dann meist medikamentös. Diese Maßnahme hat wenig zu ihrer Eindämmung beigetragen. Im Gegenteil. Seit der Einführung von Antidepressiva sind die Diagnosezahlen geradezu viral gegangen, sie haben sich vertausendfacht.[2] Bis zu 80 Prozent aller Depressionen gelten inzwischen als chronisch.[3] Eine erstaunliche Karriere für eine Krankheit, die einmal als »selbstbeschränkend« galt, also von allein ausheilte.[4] Wie ist es dazu gekommen, wenn wir doch wirksame Medikamente haben?
Ich habe als Psychotherapeut dieses Buch geschrieben, um Wege aufzuzeigen, wie wir die Leiden, die wir heute meist »Depressionen« nennen, besser bewältigen können. Es geht nicht darum, die ernste Situation von Menschen, die sich auf der Suche nach Hilfe an ihre Ärzte und Therapeuten wenden, zu verharmlosen. Die Betroffenen haben bei der Bewältigung ihrer Probleme jede Hilfe verdient! Wenn ich im Folgenden für einen anderen Umgang mit depressivem Erleben und für eine andere Form des Denkens über Depressionen plädiere, dann hoffe ich, dass die Betroffenen dies nicht als Entwertung ihres Leidens ansehen. Im Gegenteil. Wir brauchen ein neues, besseres Verständnis dessen, was wir heute so ungenau und wenig hilfreich als Depressionen bezeichnen. Suchen wir also gemeinsam nach Auswegen aus der Depressions-Falle, nach einem echten Ausgang aus dem Fliegenglas Depression.
Ein kurzer Überblick über das Buch
In den letzten Jahren haben viele Psychotherapeuten und Wissenschaftler die Depressionsdiagnose genau unter die Lupe genommen und dabei Erstaunliches entdeckt. Wir dachten, wir kennen den Weg zur Lösung des Depressionsproblems. Doch all unser Wissen zu ihrer Behandlung führt keineswegs zu den gewünschten Ergebnissen. Trotz scheinbar immer besserer Behandlungsmethoden sinkt die Zahl depressiver Menschen nicht.
Wir müssen Depressionen noch einmal neu denken. Und wir sollten mit depressiven Menschen anders umgehen, als wir es in den letzten 50 Jahren getan haben. Depressive haben keine Krankheit wie jene, die mit den üblichen Methoden der Medizin behandelt werden. Depressionen sind ein Leiden völlig anderer Art.
Um Depressionen in ein anderes Licht zu rücken, werde ich die neuesten Entwicklungen auf dem Gebiet der Depressionsforschung darstellen. Ich habe dieses Buch als einen Bericht über meinen eigenen Erkenntnisprozess verfasst. Ich schildere gescheiterte und erfolgreiche Behandlungen aus meiner eigenen Praxis. Meine Hoffnung ist, dass diejenigen, die selbst an Depressionen leiden, durch die Lektüre eine neue Sichtweise auf sich selbst entwickeln, die ihr Leid erträglicher macht. Wir brauchen eine neue Philosophie der Depression, die es leichter macht, sie zu verstehen, sie zu behandeln und zu verhindern.
Neben der Psychologie und der Psychiatrie sind die Neurowissenschaften, die Epidemiologie, die Philosophie, die Geschichtswissenschaften und die Soziologie wichtige Disziplinen, die aktuell dazu beitragen, neue Bilder der Depression zu entwerfen. Bei meinen Recherchen habe ich mit vielen Wissenschaftlern gesprochen, die heute wieder innovativ an Depressionen und ihre Behandlung herangehen. Deren Einsichten will ich mit Ihnen teilen. In meiner Arbeit als Psychotherapeut sehe ich zudem täglich Menschen mit depressiven Symptomen. Ich möchte auch von ihnen erzählen, davon, wie sie ihre Beschwerden bewältigen.
Mit der Depressions-Falle, die diesem Buch den Titel gibt, sind die vielfältigen, auf den ersten Blick verlockenden Möglichkeiten gemeint, mit dem manchmal unerträglichen Leid in unserem Leben umzugehen. Das können Medikamente sein, ungeeignete Therapieversuche, aber auch irreführende Vorstellungen über unser Leiden und Leben. Manche davon erscheinen auf den ersten Blick harmlos oder gar hilfreich. Auf den zweiten Blick erweisen sie sich häufig als Scheinlösungen, die langfristig die Situation sogar noch verschlimmern.
In Kapitel eins geht es um das am weitesten verbreitete Bild von Depressionen, dass sie nämlich Folge eines Ungleichgewichts von Botenstoffen im Gehirn seien. Ich schildere, wie dieses Bild in die Welt gekommen und warum es falsch ist. Die dauerhafte Behandlung von Depressionen mit Medikamenten könnte das Leid sogar verlängern und vergrößern.
Im zweiten Kapitel blicken wir aus historischer Sicht auf Depressionen. Aus einer jahrtausendealten, sehr schweren und sehr seltenen Krankheit wurde vor nicht einmal fünfzig Jahren eine Volkskrankheit, als die Psychiatrie bei der Neubestimmung ihrer Diagnosen einen folgenschweren Fehler machte.
Im dritten Kapitel geht es um die Psychotherapie der Depression. Der Versuch, das Depressionserlebnis zu verstehen, kann in Sackgassen führen. Im Kontrast dazu stelle ich dar, wie in einer gelungenen Therapie Klient und Therapeut hilfreichere Ansätze finden.
Im vierten Kapitel wende ich mich dem Stand der Depressionsforschung in der Genetik und den Neurowissenschaften zu. Ein falsches Verständnis von Depression hat diese Wissenschaften ins Leere laufen lassen. Wird dieses falsche Konzept von Depression öffentlich vermittelt, könnte das dazu beitragen, dass immer mehr Menschen depressiv werden.
Im fünften Kapitel werfe ich einen Blick auf gesellschaftliche Entwicklungen. Nicht nur Faktoren wie Leistungsdruck, Vereinsamung und Arbeitslosigkeit sind dafür verantwortlich, dass Menschen depressiv werden. Ein weiterer Vorwurf richtet sich gegen meinen eigenen Berufsstand: Wenn Psychotherapeuten ein falsches Bild von Depressionen vertreten, könnte das langfristig uns allen schaden.
Im abschließenden sechsten Kapitel werde ich alternative Wege im Umgang mit Depressionen aufzeigen. Wenn Depressionen leichter behandelbar und vermeidbar werden sollen, muss es einen anderen, einen lebensnahen Depressionsbegriff geben. Es ist die Aufgabe von Psychiatrie und Psychologie, für ein solches Konzept zu werben, das im Dienste der Veränderung und Prävention steht. Dazu soll »Die Depressions-Falle« einen Beitrag leisten.
Kapitel 1Die Depression wird prominent: Die medikamentöse Behandlung der Depression
Zu den interessantesten Aspekten des Themas Depression gehört, wie in der Öffentlichkeit über sie gesprochen wird. Wann haben Sie zuletzt von Depressionen gehört? In den Medien, in denen über das »Tabuthema psychische Störungen« berichtet wurde? Von Ihrem Arzt, der Ihnen diese Diagnose mitgeteilt hat? Oder von Freunden, die darunter leiden? Man kann sich heute kaum vorstellen, dass Depressionen noch nach dem Zweiten Weltkrieg als so unbedeutend galten, dass sie in Studien zur psychischen Gesundheit der Bevölkerung nicht einmal erwähnt wurden. Das hat sich grundlegend geändert. »Mental Health Literacy«, die Fähigkeit auch von Laien, psychische Krankheiten zu erkennen und zu verstehen, wird großgeschrieben. Weil es wichtig ist, über psychische Leiden zu sprechen, haben inzwischen viele Prominente aus Politik, Kultur, Sport und der Wissenschaft dazu aufgerufen, psychische Probleme als echte Krankheiten anzuerkennen, und viele von ihnen haben sich zu ihren eigenen Depressionen bekannt.
Im Folgenden geht es darum, was ich als Psychotherapeut erlebte, als ich damit begann, selbst öffentlich beim Thema Depression und ihrer Behandlung durch Antidepressiva mitzureden. Ich entdeckte dabei viele Missverständnisse, Halbwahrheiten und eine ganze Branche, die »Fake News« über Depressionen in die Welt setzt. Dieses öffentliche Bild der Depression, die tatsächliche Wirksamkeit von Antidepressiva und die Frage, was wir wirklich über die biologische Seite der Depression wissen, möchte ich als Erstes zur Diskussion stellen.
Harald Schmidt
Vor mir sitzt Harald Schmidt. Der Harald Schmidt. Aus der Harald Schmidt-Show! Harald Schmidt hat jetzt zwanzig Minuten Zeit für mich, das hat mir seine Pressesprecherin zugesichert. Am Ende wird unser Gespräch schon nach zehn Minuten vorüber sein. Die Zeit drängt, es gibt noch viel mehr Menschen, die mit Harald Schmidt sprechen wollen. Dass ich überhaupt mit ihm reden darf, liegt daran, dass ich für die Magazin-Beilage der Zeit einen Artikel über Depressionen schreibe. Dass es für die Zeit ist, gefällt dem bildungsaffinen Schmidt, der an diesem Tag viel mit Privatsendern wie RTL und SAT1 zu tun hat.
Wir sind im Gewandhaus Leipzig, es ist ein Samstag im Spätsommer. 1200 Menschen sind zum größten deutschen Depressionskongress gepilgert, meist Betroffene. Durch das Auditorium des Gewandhauses hallen Geklapper und dumpfe Schläge. Wir alle haben Trommelstöcke erhalten und schlagen sie in einem Rhythmus aufeinander, der von einer professionellen Truppe auf der Bühne vorgegeben wird. Das macht Spaß, und die Halle klackert energetisch mit. Harald Schmidt ist Eröffnungsredner des Kongresses. »Wir sind natürlich heute Morgen alle extremst lebhaft und sitzen vorne auf der Stuhlkante. Aber es kann noch emotionaler werden«, frotzelt er. Ein ungewöhnlich launiger Einstieg für einen Depressionskongress. Schmidt soll helfen aufzuklären. Über Depression, ihre Ursachen und die Möglichkeiten, sie zu behandeln. Botschafter für die gesellschaftliche Anerkennung der Depression ist seine neue Aufgabe. Eine ehrenhafte Sache für einen Mann, den viele sonst wegen seiner zynischen Kommentare fürchten und lieben. Auch jetzt fällt es ihm schwer, nicht in seine gewohnte Rolle zurückzufallen. Das Saalmikrophon ist falsch eingestellt, zu leise. Als einer der Zuhörer »lauter« ruft, äfft Schmidt ihn nach: »Lauuuter! Lauuuuuuuter!! Ja, das hilft dem Redner.«
Die öffentliche Bibliothek der Wissenschaften
Den Artikel für das Zeit-Magazin, für den ich beim Depressionskongress in Leipzig mit Harald Schmidt spreche, schreibe ich zusammen mit Julia Friedrichs, einer Journalistin, die sich sonst vor allem für gesellschaftspolitische Themen interessiert.[5] Der Text soll all das enthalten, was wir in den letzten beiden Jahren über Depressionen und Antidepressiva gelernt haben. Dabei hatten Prominente zunächst keine Rolle gespielt. Die Geschichte dieses Artikels beginnt im Jahr 2014 mit Fachliteratur an meinem Schreibtisch. Als praktizierender Therapeut ist man oft aus dem Kreislauf der neuesten Forschungsergebnisse ausgeschlossen. Die meisten Wissenschaftsjournale sind teuer und werden deshalb vor allem von Universitäten abonniert. Deshalb ist es gut, dass es inzwischen die Public Library of Science gibt, die Öffentliche Wissenschaftsbibliothek im Internet. Das ist eine Plattform aus den USA, auf der man wichtige wissenschaftliche Veröffentlichungen auch kostenlos lesen kann. Als ich auf den Seiten für Medizin herumsurfe, stoße ich auf einen Artikel zu Antidepressiva. Eigentlich weiß ich alles über Antidepressiva, denke ich. Das war schließlich mehrfach Bestandteil meiner Ausbildung, zunächst im Psychologiestudium, dann während meiner Therapieausbildung. Ich stutze, weil der Text so hohe Abrufzahlen hat. Über 300000 Zugriffe, das ist für eine wissenschaftliche Arbeit ziemlich viel. Was kann an so gut beforschten Medikamenten wie Antidepressiva heute noch so interessant sein? Verfasst wurde der Artikel vom Psychologen Irving Kirsch und seinen Kollegen: »Eingangsschwere in Bezug zum Nutzen von Antidepressiva«, heißt es in der Überschrift in bestem Wissenschaftsenglisch. Zu Deutsch: Es soll darauf geschaut werden, wie gut Antidepressiva bei unterschiedlich schweren Depressionen wirken. Ich klicke auf den Link. Auf mich wartet eine Überraschung.
Wie alle Psychotherapeuten habe ich gelernt, dass man Depressionen gut behandeln kann. Dass in leichten Fällen Psychotherapie allein ausreicht. Dass in mittelschweren Fällen Psychotherapie oder Antidepressiva helfen. Und dass in schweren Fällen beides zusammen gegeben werden muss. Das gilt als gut gesicherte Lehre aus der Forschung. In Deutschland legt die sogenannte Depressions-Leitlinie auf Grundlage dieser Forschung fest, wie Depressionen zu behandeln sind. Ab einem mittleren Schweregrad sind Antidepressiva demnach eine gute Behandlungsmöglichkeit. Allerdings steht im Text von Irving Kirsch etwas anderes.
Irving Kirsch
Was ich in diesem Moment, als ich mich am Schreibtisch auf den neuesten Stand der Forschung bringen will, noch nicht weiß: Auch Irving Kirsch ist prominent – zumindest in Fachkreisen. Bejubelt von den einen, bekämpft von den anderen. Kirsch hat mit der Arbeit, die ich gerade lese, im Jahr 2008 das Vertrauen in die Wirksamkeit von Antidepressiva erschüttert und in den USA eine große Debatte ausgelöst.
Kirsch hat über Jahre die Studien ausgewertet, mit denen sich Pharmafirmen um die Zulassung für ihre Antidepressiva beworben haben. Das Besondere war: Er schaute sich nicht nur die Studien an, die die Pharmafirmen freiwillig veröffentlichten, sondern auch jene, die sie geheim hielten – unter Berufung auf den Freedom of Information Act, ein amerikanisches Recht auf Transparenz, hatte er sich Einblick verschafft. Am Ende verglich er die Patienten, die ein Medikament erhalten hatten, mit denen, die ein Placebo bekommen hatten. Sein Ergebnis: Vielen Patienten ging es nach der Behandlung besser. Allerdings war es in den meisten Fällen egal, ob sie ein echtes Mittel oder eine Zuckertablette geschluckt hatten. Nur bei einer kleinen Gruppe sehr schwer Betroffener übertraf die Wirkung der Medikamente die der Placebos. Über die vielen anderen aber sagt Kirsch seitdem: Es sind nicht die Wirkstoffe in den Antidepressiva, die helfen. Der Erfolg der Pillen ist ein Scheinerfolg.[6]
Fast immer, wenn seither kritisch über Antidepressiva berichtet wird, fällt dabei Kirschs Name. Die Studie war nicht nur deswegen so beeindruckend, weil sie dem überkommenen Wissen widersprochen hatte, dass Antidepressiva ein sehr wirksames Medikament seien. Kirsch traf diese Aussage auch auf Grundlage von bis dahin ungekannten Datenmassen. Erst in seiner Gesamtschau zeigte sich, was vorher verborgen war, weil regelmäßig nur die Erfolgsmeldungen zu Antidepressiva veröffentlicht wurden. Nach einer Auswertung aus dem Jahr 2008 waren von den Studien, die ein positives Ergebnis für Antidepressiva hervorbrachten, 91 Prozent veröffentlicht worden. Von den Studien, in denen die Medikamente nicht überzeugen konnten, wurden dagegen nicht einmal 10 Prozent publiziert. Ein Drittel dieser publizierten Studien waren zudem so formuliert, dass es klang, als hätten die Medikamente sich als wirksam erwiesen, obwohl dies nicht der Fall war.[7] Dass es jetzt durch Kirsch eine Studie gab, die das gesamte den Zulassungsbehörden vorliegende Datenmaterial mittels einer sogenannten Meta-Analyse auswertete, machte seine Arbeit so bedeutsam. Und demnach konnte man mit Zuckerpillen fast genauso viel Licht in das Leben eines Menschen bringen wie mit Antidepressiva.
Wie so viele meiner Kolleginnen und Kollegen verlasse ich mich auf das, was ich in Lehrbüchern gelesen und in Vorlesungen gehört habe. Wieso, frage ich mich an meinem Schreibtisch, weiß niemand von dieser Arbeit, der zu diesem Zeitpunkt größten, die jemals zum Thema Antidepressiva durchgeführt worden ist? Die sollte doch jeder kennen. Und ich beschließe, dafür in den nächsten Wochen zu sorgen.
Für Psychotherapeuten besteht die Möglichkeit, sich über Fachzeitschriften an ihre Kollegen zu wenden. Also verfasse ich einen Text mit dem Titel »Placebo – Neue Erkenntnisse zur Wirkung von Antidepressiva«, in dem ich darlege, dass in den meisten Fällen die Wirkung von Antidepressiva kaum über die einer Zuckerpille hinausgeht. Prominent darin: Kirschs Studie. Ein Abschnitt lautet: »Depressionen gibt es in drei Formen, leicht, mittelschwer und schwer. Die American Psychiatric Association kennt sogar vier Formen, die sich von den Werten der Hamilton Depression Rating Scale (HDRS) ableiten. Ab einem Score größer oder gleich 23 benennt sie zusätzlich die ›sehr schwere Depression‹, eine tiefschwarze Form also.« Nur für diese allerschwersten Depressionsformen ist nach Kirschs Studie belegbar, dass Antidepressiva besser als Placebos gegen Depressionen helfen.
Den Text gebe ich an eine Zeitschrift, die in Deutschland nur einem Fachpublikum bekannt ist, aber von vielen Psychotherapeuten gelesen wird. Da ich in dieser Zeitschrift schon mehrfach veröffentlicht habe, gehe ich davon aus, dass man meinen Text wohlwollend beurteilt und bald publizieren wird. Acht Wochen später weiß ich: Dem ist nicht so.
Die Rückmeldung, die ich erhalte, wird von einer Mitarbeiterin eines Lehrstuhls für Klinische Psychologie verfasst. Man merkt dem Schreiben an, wie sehr sie darum ringt, höflich zu bleiben. Der Text sei gut und flüssig geschrieben, beginnt sie. Leider werde die Forschungslage einseitig und falsch dargestellt. Auch mein Bild von Depressionen sei falsch. Die behandelten Studien hätte ich nicht verstanden. Auch was ein Placebo sei, hätte ich nicht richtig verstanden. Die Behandlungsleitlinien für Depression würden nicht beachtet. Trotzdem macht sie mir ein Angebot. Gerne dürfe ich als langjähriger Autor meine »Meinung« im Journal sagen. Jedoch müsse ich meinen acht Seiten langen Text dafür auf eine einzige kürzen, am besten unter Verzicht auf die – leider falsch dargestellten – Forschungsergebnisse. Man werde meinen Text dann als »Polemik« veröffentlichen. Das Angebot ist vergiftet. Ich lehne dankend ab.
Im Nachhinein komme ich mir naiv vor. Die Behandlungsleitlinien für Depressionen werden von hochrangigen Wissenschaftlern geschrieben, die meisten sind Professoren, ausgewiesene Fachleute auf ihrem Gebiet. Herausgegeben werden sie von 31 Fachverbänden, Arbeitsgemeinschaften, psychiatrischen und psychologischen Berufsverbänden usw. Das ist geballte Fachkompetenz. Und da kommt Thorsten Padberg, Psychotherapeut aus Berlin-Treptow, und will dieses Bollwerk der Wissenschaft mit ein paar Seiten Text erschüttern. Ich stelle mir vor, wie die Redaktion mir einen Aluhut auf mein Autorenbild gemalt hat und mich in einem Ordner zusammen mit Impfgegnern und Chemtrail-Aktivisten abgeheftet hat. Akte geschlossen.[8]
Gleichzeitig habe ich etwas gelernt. Wer neue Informationen in ein seit langem bestehendes Lehrgebäude einbringt, der wird nicht unbedingt freudig begrüßt. Das ganze Gebäude könnte ja in sich zusammenstürzen. Und das wäre in diesem Fall möglicherweise fatal. Denn in Deutschland gibt es, wie überall auf der Welt, eine Menge Menschen, die diese Medikamente mit einem positiven Effekt einnehmen.
Depressionen sind ein sehr häufiges Leiden. Fast 10 Prozent aller Deutschen leiden im Laufe eines Jahres an Depressionen. Bei Frauen ist der Anteil besonders hoch, genauso wie bei den Jüngeren zwischen 15 und 29 Jahren.[9] Die Weltgesundheitsorganisation WHO spricht von 350 Millionen Menschen weltweit. Einige Experten gehen davon aus, dass Depressionen schon 2030 den Spitzenplatz unter den Massenleiden einnehmen werden. Viele Betroffene bitten um Behandlung. Und die einzige schnell verfügbare Therapie sind oftmals Antidepressiva. Sie sind deshalb ein sehr wichtiges Medikament.
Während ich anfange, mich mit dem Thema zu beschäftigen, explodieren die Verordnungszahlen. Im Jahr 1990 wurden in Deutschland noch weniger als 200 Millionen Tagesdosen Antidepressiva verschrieben (eine Tagesdosis ist die durchschnittliche Menge, die von einem Medikament pro Patient pro Tag normalerweise eingenommen wird). Zehn Jahre später waren es schon fast doppelt so viele. Doch dann geht die Verordnungsrallye erst richtig los. 2008, als Kirsch seinen Artikel schreibt, sind es allein in Deutschland ca. 750 Millionen Tagesdosen. 2014, als ich die Studie entdecke, 1,3 Milliarden. Die letzten Zahlen aus dem Jahr 2018 nennen fast 1,5 Milliarden Tagesdosen. Damit könnte man 3,8 Millionen Menschen in Deutschland das ganze Jahr über Tabletten schlucken lassen. Tag für Tag, ohne Unterbrechung.[10] Wollten alle Deutschen ein paar von den verschriebenen Tabletten abhaben, dann würde es bei achtzig Millionen Einwohnern für jede und jeden Einzelnen immerhin für achtzehn Tage ausreichen. In Großbritannien nehmen inzwischen fast 17 Prozent der Bevölkerung im Laufe eines Jahres ein Antidepressivum ein; über ein Fünftel der Frauen schluckt die Tabletten, genauso hoch ist der Anteil bei Menschen über 80 Jahren.[11]2,5 Milliarden Pfund haben die Briten allein von 2011 bis 2020 für Antidepressiva ausgegeben.[12]
In mir wird ein innerer Kritiker wach, der mich in den nächsten Monaten hartnäckig und unablässig begleiten wird und immer wieder dieselbe Frage stellt: Was ist wichtiger? Das Wohlbefinden, das viele durch Antidepressiva finden? Oder das Wissen um den Stand der Forschung über ein bei Depressionen in Wahrheit chemisch fast wirkungsloses Medikament? »Offensichtlich gibt es großes Leid in der Bevölkerung«, meint der Kritiker. »Groß genug, dass ihre Therapeuten und Ärzte sich veranlasst sehen, dieses Leid mit einem Medikament zu behandeln. Und diese Behandlungsoption ist für viele so überzeugend, dass sie sie dankbar annehmen und diese Medikamente über Wochen, Monate oder Jahre einnehmen. Die werden gute Gründe dafür haben, diese Medikamente zu wollen. Mit welchem Recht willst Du Dich da einmischen, nur weil die wissenschaftlichen Daten ihrer Erfahrung nicht entsprechen? Kann es den Betroffenen nicht egal sein, ob es empirische Belege für ihre Therapie gibt? Halten Antidepressiva nicht das, was sie versprechen? Was bringt es den Betroffenen, wenn Du ihnen sagst, dass die Medikamente, die sie schlucken, Effekte in der Größenordnung eines Placebos erzeugen?« Ich finde keine rechte Antwort auf diese Fragen und lege meinen Text erst einmal beiseite. Ich vergesse für eine Weile, was ich über Antidepressiva gelernt habe, und wende mich wieder meiner eigentlichen Aufgabe zu, der Behandlung von Menschen mit psychischen Problemen. Das nächste Mal denke ich über Antidepressiva nach, als Frau Tauch durch meine Tür tritt.
Frau Tauch
Frau Tauch betritt im Sturmschritt meine Praxis. Sie hat meine zögerlich ausgefahrene Hand eingefangen, geschüttelt und mir »Tag auch!« entgegengeschmettert. Sie hat dabei kaum merklich mit dem Kopf genickt und die Augenbrauen hochgezogen. Sie ist ungehalten, weil ich mich nicht schnell genug bei ihr vorgestellt habe. Frau Tauch hat den langen Flur hinter der Eingangstür der Praxis schon fast durchschritten, als ich ihr »Padberg« hinterherrufe. Mein Name trifft sie am Hinterkopf. In meiner Phantasie rollt sie mit den Augen. Am Ende des Flurs schließen zu beiden Seiten Behandlungsräume an. Meiner und der von meiner Kollegin Esta, die heute nicht in der Praxis ist. Jetzt weiß Frau Tauch nicht weiter. Nach rechts oder links? Links oder rechts? Sie schaut mich fragend an und wendet dabei den Kopf hin und her. »Nach links«, sage ich, von meiner üblichen Routine abweichend. Links ist Estas Behandlungszimmer.
Weil es durch Bauarbeiten im Nachbarhaus in meinem Zimmer seit ein paar Tagen zu laut ist, habe ich Frau Tauch in Estas Behandlungszimmer geschickt. Als ich es betrete, hat sie sich schon gesetzt. Sie sitzt im Therapeutensessel, auf Estas Platz. In einer Therapiepraxis sind die Sessel auf der sogenannten therapeutischen Halbschräge ausgerichtet, im 45-Grad-Winkel zueinander. Dadurch kann man sich gut gegenseitig in die Augen schauen, muss es aber nicht. Das ermöglicht Nähe, ohne sie zu erzwingen. Ich nehme ihr gegenüber Platz und schaue von dieser für mich ungewohnten Stelle in ihr Gesicht. Sie sieht wütend aus. Ich habe den geeigneten Moment verpasst, das Richtige zu sagen. Aber da ist noch etwas anderes. Sie war schon ärgerlich, als sie an mir vorbei in die Praxis gestürmt ist.
Frau Tauch ist wirklich wütend. Nicht auf mich – nicht in der Hauptsache –, sondern auf ihren Mann. Ihren Ex-Mann muss es wohl heißen, denn er hat sie vor zwei Wochen verlassen. Hat die Koffer gepackt und ist nach einem letzten Streit aus dem Haus gegangen. Die Wohnung, in der er jetzt wohnt, hatte er heimlich schon vor drei Monaten angemietet. Sie fühlt sich hintergangen, wie ich finde zu Recht. Vorausgegangen waren dem Monate, in denen die beiden eigentlich nur noch gestritten hatten: über die Erziehung der Kinder, darüber, wie der eine mit dem anderen umgeht, wo es in den nächsten Urlaub hingeht und welche der Schwiegereltern dabei besucht werden, über die Farbe einer Obstschüssel für das Wohnzimmer, über die erlahmende Sexualität, darüber, wer die Spülmaschine ausräumen darf. Zumindest Letzteres, fügt Frau Tauch bitter lächelnd an, habe sich mit dem Auszug ja jetzt geklärt. Eigentlich sei das sogar schon seit Jahren so gegangen, Jahre, in denen sie sich immer schwächer, immer schwerer gefühlt habe. Sie erzählt, wie sie unter der Belastung als Mutter, Hausfrau und halbtags in einer kleinen Postannahmestelle immer müder geworden sei, aber trotzdem immer den Gedanken hatte, dass es sich am Ende gelohnt haben wird. Dass alles besser werden wird. Wenn die Kinder »aus dem Gröbsten raus« sind, wenn sie und ihr Mann wieder mehr Zeit füreinander haben. Und dass sie jetzt sehr, sehr stark das Gefühl habe, nicht mehr weiterzuwissen. All das sprudelt in kaum mehr als fünf Minuten aus ihr heraus. Fünf Minuten, in denen ich versuche, mit ihr Schritt zu halten, eine Rolle in unserem Austausch zu finden, das Gespräch irgendwie so zu strukturieren, dass es sich am Ende für sie gelohnt hat, mit mir zu sprechen. Wer kann ihr jetzt helfen, wie reagieren die Kinder – und vor allem: Wie kann ich ihr in dieser schwierigen Situation beistehen?
Als Therapeut weiß man oft erst dann, was man eigentlich gefragt hat, wenn man die Antwort hört. Weil es darauf ankommt, wie der Klient die Frage verstanden hat, weniger darauf, wie sie gemeint war. Und in diesem Sinne ist das, was ich gerade frage, ganz, ganz großer Mist. Frau Tauch reagiert zunehmend einsilbig auf meine Versuche, mir ein Bild davon zu verschaffen, was ihr fehlt und was ich tun könnte, um sie zu unterstützen. Sie nutzt die therapeutische Halbschräge jetzt immer öfter, um an mir vorbeizuschauen. Nach zwanzig Minuten dreht sie den Spieß um und fragt nun ihrerseits: »Wie werden Sie mich denn nun behandeln? Werden Gespräche reichen, oder brauche ich auch Antidepressiva?« Dieselbe Regel, dass man erst weiß, was man gefragt hat, wenn man die Antwort hört, gilt natürlich auch für Frau Tauch. Sie hat aus ihrer Sicht eine einfache und naheliegende Frage gestellt. Ich aber zögere: »Das kann ich noch nicht sagen.« Offenbar ist mir die Frage zu schwer. Damit hat Frau Tauch nicht gerechnet, und ihre Augenbrauen heben sich noch ein Stück weiter nach oben.
Aus meiner Sicht hat Frau Tauch eine sehr ernsthafte Krise zu bewältigen. Eine Trennung gehört zu den leidvollsten Erfahrungen, die ein Mensch machen kann. Dazu kommt noch die Unsicherheit bezüglich ihrer Zukunft. Wie wird es mit den noch minderjährigen Kindern weitergehen? Wenn sie mehr arbeiten muss, wer passt dann auf sie auf? Wo soll sie hin mit all ihrer Wut auf ihren Mann, der sich so hinterrücks verabschiedet hat? Wenn all dies ausgestanden ist, wird sie einen neuen Partner finden? Oder überhaupt einen wollen? Ich weiß in diesem Moment noch nichts über sie, weiß nicht, welchen Rückhalt sie hat: Familie, Freunde, Arbeit? Wie ist sie früher mit Krisen umgegangen, welche Vorwürfe macht sie sich vielleicht heimlich?
Ich stelle mir vor, wie sie zu Hause sitzt und ihr Blick über die kleinen Dinge schweift, die ein gemeinsames Leben ausmachen. Die Fotos, die man in glücklicheren Augenblicken geschossen hat und die jetzt in kleinen Rahmen in der Wohnung aufgestellt sind. Die Möbel, die man gemeinsam ausgesucht hat. Wie sie an die kleinen Gesten denkt, die sie mit ihrem Mann ausgetauscht hat, die Routinen, die sie entwickelt haben: das gemeinsame Frühstück, wer einkauft, wer wann morgens ins Bad geht. Welche Wissenschaft in diesen Dingen steckt, damit sie genau so gelingen, dass Menschen über Jahre als Familie zusammenleben können. Wie sie versucht hat, all dies am Laufen zu halten, auch wenn es dafür selten Applaus gibt. Weil diese Dinge im Dazwischen stattfinden, wo sie schnell übersehen werden. Wie Mann und Kinder sie für selbstverständlich genommen haben, eben weil sie so anstrengungslos erscheinen müssen. Wie im Ballett, wo hinter jeder getanzten Figur ein enormer Kraftaufwand steckt, den man nicht sieht und auch nicht sehen soll. Und wie wertlos und vergeblich ihr das alles plötzlich erscheinen muss.
All dies geht mir durch den Kopf, vielleicht ein paar Momente zu lang. Als ich Frau Tauch wieder anschaue, hat sich ihr Blick an einem Punkt rechts von mir festgefressen. Im Regal hinter mir stehen Gesellschaftsspiele: Vier gewinnt, Das Spiel des Lebens, Die 100 besten Spiele für Zwischendurch. Ich bin in Estas Behandlungszimmer, sie ist auch Kinder- und Jugendtherapeutin. Mein Gespräch mit Frau Tauch läuft erschreckend schlecht, und mir schießt der Gedanke durch den Kopf, sie könnte meinen, dass ich unser Gespräch gleich unterbrechen werde, um stattdessen mit ihr eine Runde »Mensch, ärgere dich nicht« zu spielen. Und dann wird sie tatsächlich ungehalten: »Wissen Sie überhaupt, wie man Depressionen behandelt?!« Sie hat Depressionen, und das weiß sie besser und schneller als ich.
Eine meiner Aufgaben als Psychotherapeut ist es, in der Therapie eine Atmosphäre zu schaffen, die es den Klienten möglich macht, sich zu öffnen, mit mir gemeinsam etwas zu erarbeiten, das ihnen dabei hilft, ihr Leben wieder lebenswert zu machen. Daran scheitere ich an diesem Tag auf ganzer Linie. Ich scheitere, weil die Klientin, die vor mir sitzt, verständlicherweise gern jetzt und sofort Erleichterung möchte und mir nicht schnell genug etwas dazu einfällt. Und was wäre in einer solchen Situation schon genug? Aber ich scheitere auch an einer Kluft, die sich zwischen uns auftut. Während ich noch dabei bin, mir ein Bild zu machen, mir die genauen Bedingungen ihres Lebens und Leidens anzuschauen, hat Frau Tauch sich bereits selbst eine Diagnose gestellt: Depressionen. Sie ist psychisch krank. Wir spielen sozusagen verschiedene Spiele: Ich will ihr helfen, ihr ein Angebot machen, das zu ihrem Leben und Leiden passt. Sie will einfach nur geheilt werden: mit Worten und mit Medikamenten.
Der US-amerikanische Psychotherapeut Gary Greenberg hat einmal geschrieben, dass Klienten früher wenig Interesse an ihren Diagnosen hatten. Wenn sie zum Psychotherapeuten gingen, dann weil sie Probleme hatten, weil sie unglücklich waren oder unter Rückschlägen litten. Das habe sich inzwischen geändert. Heute kämen sie mit Diagnosen in die Praxis, darunter prominent: die Depression. Und er hat auch eine Erklärung dafür gefunden: »Nachdem man ein halbes Jahrhundert lang flächendeckend mit den Botschaften [der Pharmaindustrie] bombardiert wurde, ist es so gut wie unmöglich, in längeren Phasen der Traurigkeit nicht auch Depressionen in Betracht zu ziehen.«[13] Die Pharmaindustrie hat dazu eine klare Botschaft unter das Volk gebracht, die einfacher nicht sein könnte: Das Seelenleiden Depression, so haben wir alle gelernt, ist eine körperliche Krankheit, eine Störung des Stoffwechsels zwischen unseren Nervenzellen. Und natürlich muss auch Frau Tauch annehmen, dass jetzt, wo es ihr so schlecht geht, etwas mit ihrem Nervensystem durcheinandergeraten ist. Dass durch all den Ärger in den letzten Monaten und Jahren eine Störung in ihrem Gehirn entstanden ist. Sie könnte auf diese Idee gekommen sein, als sie über Depressionen in den Medien gelesen hat, so etwa wenn der Psychiater Professor Florian Holsboer als Depressionsexperte im Spiegel sagt: »Die Wechselwirkung zwischen Veranlagung und äußerer Ursache führt [bei einer Depression] zur Stoffwechselstörung im Hirn.«[14] Und wenn es auf den ersten Blick auch etwas unheimlich erscheinen mag, wenn etwas im eigenen Gehirn nicht mehr richtig funktioniert, macht es doch zugleich Hoffnung. Denn wenn es gilt, einen außer Rand und Band geratenen Transmitterhaushalt wieder ins Gleichgewicht zu bringen, kann man dafür Medikamente einnehmen. Leider erschwert es zugleich das Gespräch mit jemandem wie mir, der sich zuerst mit den Details im Leben seines Gegenübers auseinandersetzen möchte.
Serotonin im Fokus
Das Bild von Depressionen als Folge einer Stoffwechselstörung im Gehirn ist eines der erfolgreichsten Bilder der Psychiatrie, sozusagen das Flaggschiff unter den psychiatrischen Erklärungsmodellen. Keines hat sich weiter in der Bevölkerung verbreitet, keines hat unser Bild von Depressionen stärker geprägt.[15] Und keines hat mehr dazu beigetragen, in unvorstellbaren Massen Medikamente zu verkaufen. Es ist ein einfaches, plausibles Bild, das gut zur Erklärung unserer Leiden taugt. Eine Pharmafirma erklärt auf ihrer Website, wie man sich diese Störung vorstellen soll: »So wie ein Kuchenrezept festlegt, wie viel Mehl, Zucker und Backpulver man nehmen muss, braucht auch Ihr Gehirn ein fein austariertes chemisches Gleichgewicht, um optimal zu funktionieren.«[16] Das scheint plausibel zu erklären, warum es uns in manchen Phasen so schlecht geht: In der neuronalen Rührschüssel in unserem Schädel ist die richtige Mischung von Neurotransmittern durcheinandergeraten. Dabei immer wieder im Fokus: Serotonin, das in den Medien manchmal auch als das »Glückshormon« bezeichnet wird. Es soll hauptsächlich dafür verantwortlich sein, wie wir uns fühlen. Das Seelenleiden Depression, so lernen wir, ist eine körperliche Krankheit, eine Stoffwechselstörung. In der Tageszeitung USA Today findet Tipper Gore, die Ehefrau des ehemaligen US-Vizepräsidenten Al Gore, für ihr eigenes Leiden einen dazu passenden Vergleich: »Es war ohne Zweifel eine klinische Depression, und ich brauchte Hilfe, um diese zu überwinden. Wie ich erfahren habe, braucht das Gehirn eine bestimmte Menge Serotonin. Wenn dieses fehlt, ist das so, als ob das Benzin ausgeht.«[17]
Stellen wir uns also die Kommunikation zwischen Nervenzellen so vor wie die zwischen zwei Menschen, die miteinander sprechen. Eine Nervenzelle äußert etwas, das dann von der anderen Nervenzelle aufgenommen wird. Serotonin wandert wie eine Nachricht von der einen Zelle zur anderen durch den synaptischen Spalt. Bei Menschen kommt es zu einer Störung, einer kommunikativen Blockade, wenn die ganze Zeit nur einer redet oder den Gesprächsstoff für sich behält. Genauso ist es, wenn eine der Zellen Serotonin zu schnell wieder aufnimmt und zu wenig Botenstoff bei der anderen Zelle ankommt. Es entsteht ein chemisches Ungleichgewicht, aufgrund dessen man sich depressiv fühlt.
Als eine solche stolpernde Reizweiterleitung analog zu einem stockenden Gespräch erklärt jedenfalls Forest Pharmaceuticals, Hersteller des Antidepressivums Escitalopram, in den FAQs auf seiner Website Depressionen. Durch den Serotoninmangel komme es zu den typischen Symptomen einer Depression: Niedergeschlagenheit, Motivationsverlust, Gefühlsarmut, Energiemangel. »Niemand kann (…) das matte Glühen eines depressiven Gehirns sehen und danach noch vernünftigerweise daran zweifeln, dass das körperliche Zustände sind, nicht irgendein schwer zu fassendes Seelenleiden«, schreibt die Wissenschaftsjournalistin Rita Carter, deren Bücher der Öffentlichkeit die Erkenntnisse der Hirnforschung nahebringen.[18] Auch die Deutsche Depressionsliga, die Organisation, auf deren Kongress ich mit Harald Schmidt geredet habe, erläutert die Krankheit auf diese Weise. Depressionen könnten »biochemisch vor allem über einen gestörten Hirnstoffwechsel erklärt werden«, heißt es in einer Broschüre des Verbandes. Sie würden durch eine »Fehlfunktion« von Botenstoffen wie Serotonin verursacht.
Und eine Lösung für die »Volkskrankheit« Depression ist auf diese Weise auch gefunden: mehr Serotonin. Wir bekommen es durch Medikamente. Wir nennen sie: Antidepressiva. Ihre bekannteste Klasse trägt als Namen den Zungenbrecher Selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, kurz SSRI. Wenn in einem depressiven Gehirn der Serotoninspiegel zu niedrig ist, dann sorgen diese Medikamente dafür, dass er wieder ansteigt. Es ist dann das genau richtige Medikament. Es passt wie der Schlüssel ins Schloss. Iris Hauth, bis 2016 Präsidentin der in Deutschland enorm wichtigen Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde, fasst es für die Hörer von Deutschlandfunk Kultur so zusammen: »Wir wissen heute, dass bei Depressionen bestimmte Botenstoffe, vorwiegend das Serotonin und das Noradrenalin, nicht in ausreichender Konzentration da sind. Das ist auch der Ansatz der Medikamente, dass wir Serotonin-Wiederaufnahmehemmer geben, die dafür sorgen, dass die Konzentration dieser beiden Botenstoffe sich erhöht und damit gegen die depressive Stimmung wirken.«[19] Eine klare Sache.
Die Prominenz wird depressiv
Depression, einst Thema in geflüsterten Gesprächen hinter den Türen von Arztpraxen und psychiatrischen Kliniken, ist zu einem Allgemeinplatz geworden. Sie wurde prominent, als deutlich wurde, dass viele sich in den ihr zugeschriebenen Symptomen wiederfinden können: Die Müdigkeit, die Interesselosigkeit, die Verzweiflung und die unendliche Schwere, die Depressionen ausmachen, erkennen viele an sich selbst. Und sie wurde mit einem Krankheitskonzept verknüpft, das aus der Medizin bekannt ist: Depressionen sind dann vergleichbar mit jeder anderen Krankheit. »Warum sollte die Psyche gesünder sein als der Rest des Körpers?«, fragte etwa der Professor für Klinische Psychologie Hans-Ulrich Wittchen in der Zeitschrift Psychologie Heute. Und je prominenter die Depression wurde, desto mehr zeigte sich: Auch die Prominenz ist depressiv. »Ich war wehrlos. In meinem Körper liefen chemische Prozesse ab, die ich nicht beeinflussen konnte«, beschreibt die Skirennläuferin Lindsey Vonn ihre Depression. Und: »Ich bin zum Glück sehr bald zum Arzt gegangen. Er hat mich mit Medikamenten behandelt.« Die Sängerin Lady Gaga weiß: »Ich habe ein chemisches Ungleichgewicht in meinem Kopf, das mich depressiv macht.«[20] In »Drüberleben«, dem vielgelobten Roman der Bloggerin Kathrin Weßling, sagt die Hauptfigur Ida über sich: »Ich bin ein menschlicher Verkehrsunfall.« Sie geht in eine Klinik. Dort bringt man ihr bei, was ihr die Lust am Leben nahm: »… kein Schicksal, keine Bestimmung«, schreibt Weßling, »nur ein bisschen Serotonin, das fehlt.« Die Schauspielerinnen Halle Berry und Brooke Shields litten daran, der Rapper Eminem schluckte Antidepressiva. Gleich drei Charakteren aus der Serie Die Sopranos – Tony, Livia und AJ – wurde die Einnahme von Antidepressiva ins Drehbuch geschrieben. Die Schauspielerin Lorraine Bacco, die in der Serie Tony Sopranos Psychiaterin spielt, nahm die Medikamente im wirklichen Leben.[21]
Auch immer mehr Sportler outen sich als depressiv, sogar in der Disziplin, die als eine der letzten Domänen wahrer Männlichkeit gilt: dem Fußball. Wie gefährlich eine Depression ist, sah die Öffentlichkeit, als im November 2009 in allen Zeitungen über den Suizid eines Menschen geschrieben wurde, der scheinbar alles hatte, was er im Leben brauchte. Der Nationaltorhüter Robert Enke hatte sich das Leben genommen. In einem aufwendig produzierten Podcast werden später das Leben und die Leidensgeschichte des beliebten Fußballers nachgezeichnet. Schon im Trailer heißt es, im Podcast kämen auch Menschen zu Wort, »die dafür kämpfen, dass diese teuflische Krankheit als eben das gesehen wird, was sie ist: eine Krankheit«. Darauf folgt ein O-Ton: »Depression kann jeden treffen, auch jemand, der erfolgreich und ansonsten gesund ist, und eine gute Partnerschaft hat.« Der Experte, der hier zu Wort kommt, ist ein Professor aus Leipzig, mit dem auch Julia und ich bald unsere Erfahrungen machen werden: Ulrich Hegerl, Psychiater und Depressionsexperte. Die Hörer lernen hier, dass Depressionen eher selten echte Auslöser im Leben haben, höchstens Anlässe. Wenn die Umwelt an Depressionen beteiligt ist, dann als Trigger, als etwas, das eine Entwicklung anstößt, die im Grunde aber schon vorher angelegt war. Weil Depressionen eben wesentlich auf eine Stoffwechselstörung im Gehirn zurückgehen. Professor Florian Holsboer, der auch schon die Depressionen des FC-Bayern-Fußballers Sebastian Deisler behandelt hatte, erklärt im Spiegel zum Tod von Enke: »Dopamin und Serotonin strömen durchs Gehirn. In Robert Enkes Gehirn war dieser Mechanismus vermutlich seit Monaten wieder gestört. Dagegen hilft es nicht, Bälle zu halten, Beifall und Liebe zu empfangen.« Und: »Depression ist eine organische Erkrankung und nichts, wofür man sich schämen muss. Sie unterscheidet sich nicht so wesentlich vom Meniskusabriss, wie man in der ruppigen Fußballwelt vielleicht denkt.«[22]
Das ist eine Erklärung, mit der viele gut leben können. Die Betroffenen, weil sie eine einleuchtende Erklärung für ihr Befinden bekommen. Und die Ärzte und Therapeuten, weil sie dadurch eine schnell verfügbare Behandlungsform zur Hand haben. Depression, das ist kein Lebensproblem. Depression, das ist die Krankheit mit dem Serotoninproblem. Es gibt nur einen Haken. Vermutlich stimmt dies alles so nicht.
Mit ganz viel Schub ins Sommerblau
Serotonin ist ein Neurotransmitter, der nicht nur im Gehirn vorkommt, sondern im ganzen Körper. Es ist Bestandteil des Blutserums und regelt dort die Spannung, den Tonus, der Blutgefäße. In den 1960er Jahren zog Serotonin als Heilmittel für die Psyche zum ersten Mal Aufmerksamkeit auf sich, als Psychiater auf der Suche nach Medikamenten waren, die ihren schwersten Fällen helfen sollten: den schizophren Erkrankten. Sie probierten dabei auch eine Substanz aus, die später den Namen Imipramin erhielt. Sie erhöhte die Verfügbarkeit von Serotonin und Noradrenalin im Körper. Das Ergebnis war aber genau das Gegenteil dessen, was sich die Mediziner von einem Heilmittel für Psychotiker erhofft hatten. Statt Halluzinationen zu lindern, steigerte es sie, so dass die Betroffenen noch agitierter wurden. Einer der beteiligten Forscher, der britische Pharmakologe Alan Broadhurst, erinnert sich, wie eine der Testpersonen »zur größten Beunruhigung der Einwohner in ihrem Nachthemd lauthals singend in ein nahegelegenes Dorf radelte. Das war nicht unbedingt Werbung für die lokale Psychiatrie.« Imipramin hatte also keinen Heileffekt auf Schizophrenie – dafür eine unerwünschte Nebenwirkung: Die damit Behandelten waren zu gut drauf. Vielleicht ließ sich das für eine andere Patientengruppe nutzen? »Wenn der flache Affekt von Schizophrenen durch das Medikament bis zur Hypomanie gesteigert werden konnte, konnte man damit nicht auch die Stimmung Depressiver steigern?«, schildert Pharmakologe Broadhurst die damals angestellten Überlegungen.[23] Wenn nicht depressive Menschen übermäßig gute Laune von der Substanz bekamen, dann würden Depressive aufgrund dieser Wirkung mit dem Medikament ungefähr in der Mitte landen, dachte man. Und tatsächlich erbrachten die ersten Tests die erhofften Ergebnisse. Depressive fühlten sich nach Einnahme von Imipramin besser.
Wie so viele andere Medikamente auch, ist Imipramin also ein Zufallsprodukt. Die zugrunde liegende Substanz ist eigentlich ein Antihistaminikum, ein Mittel gegen Allergien. In der Forschung werden diese Substanzen mit nüchternen Code-Nummern gekennzeichnet. Imipramin wurde unter dem Kürzel G22350 geführt. Die fast schon lyrische Qualität, die manchen dieser Entdeckungen innewohnt, geht mit dem Code allerdings verloren. Denn das Antihistaminikum, aus dem G22350 entwickelt wurde, ist zugleich ein Farbstoff: Sommerblau. Blau macht glücklich!
Ähnlich poetisch verhielt es sich auch mit der zweiten Substanzklasse, deren energetisierende Wirkung man schließlich zur Behandlung von Depressionen nutzte. Ursprünglich war es ein Raketentreibstoff. Auch hier gab es zuerst das Medikament, und die dazu passende Krankheit fand sich erst später. Man entdeckte, dass dieses Mittel Menschen – metaphorisch gesprochen – zurück ins Leben schießen konnte. Von der giftigen Wasserstoff-Stickstoff-Verbindung Hydrazin, mit der die Deutschen ihre V2-Raketen angetrieben hatten, gab es nach dem Zweiten Weltkrieg Restbestände. Hydrazin wurde als Heilmittel ausprobiert, allerdings zunächst nicht wegen seiner psychoaktiven Eigenschaften, sondern für Tuberkulose. Als das Medikament in ersten Tests verabreicht wurde, zeigte sich eine unerwartete Nebenwirkung: Den Tuberkulosepatienten ging es vor allem psychisch besser. Bis heute gibt es Fotos, auf denen mit Hydrazin behandelte Patienten beschwingt durch die Klinikgänge tanzen. Auch hier waren die Behandelten deutlich glücklicher, als sie sein sollten. Als man Hydrazin später an Labortieren ausprobierte, wurden diese zudem hyperaktiv. Und so kam der Psychiater Nathan Kline auf die Idee, diese aktivierende Wirkung für die Behandlung Depressiver zu nutzen. Wie er schrieb, wollte er ihre »Traurigkeit und melancholische Schwere lindern (…), das Schlafbedürfnis mindern und die Ermüdung hinauszögern (…), den Appetit und das sexuelle Verlangen steigern«.[24] Kline ging noch einen Schritt weiter: Eigentlich könne man mit diesem Mittel jedermanns Leistung im Alltag verbessern, erklärte er am Rande eines Kongresses einem Reporter der