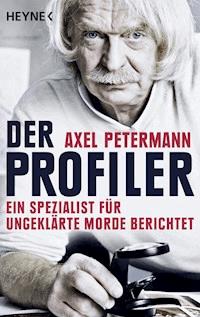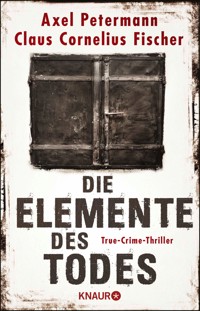6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Kiefer Larsen
- Sprache: Deutsch
Ein True-Crime-Thriller um den Fall eines Serienmörders, der das Morden zur Kunst erhoben hat – Schlaf raubend authentisch »Du bemerkst mich nicht – dabei habe ich dich längst auserwählt: Ich beobachte dich. Ich sehe nachts durch dein Fenster. Ich folge dir auf der Straße. In die Tiefgarage. In den Fahrstuhl. Ich kann einfach nicht anders; ich muss dir nahe sein. Wenn meine Fantasien nach dir rufen, muss ich nicht einmal an deiner Tür klingeln. Denn dann habe ich bereits aufgehört, dir zu folgen. Ich gehe einfach in deine Wohnung, lege mich in dein Bett, rieche an deiner Wäsche, esse aus deinem Kühlschrank. Ich bin bereits da, wenn du nach Hause kommst. Ich bin da, um dir meine Träume zu schenken – immer wieder, bis du alles willst, was ich auch will. Weil du sonst zu früh sterben musst, doch das weißt du noch nicht. Erst ganz am Ende musst du sterben, weil ich dich töten werde ...« In seinem zweiten True-Crime-Fall bekommt es Hauptkommissar Kiefer Larsen mit einem perfiden Serienmörder zu tun, der exakte Diagramme vom Realisieren seiner Fantasien zeichnet, um die Emotionen bei seinen Morden immer wieder erleben zu können und seine Lust am Töten maximal zu steigern.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 628
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Claus Cornelius Fischer / Axel Petermann
Die Diagramme des Todes
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
»Angst: 5 Grad. Es war kein Entsetzen oder Grauen gewesen, nur ein kurzes Aufflackern. Er malte ein kleines Messer in sein Diagramm. Kampf: 10 Grad. Stiche in Bauch, Brust, Gesicht: 24 Grad. Ein winziges Messer folgte dem vorangegangenen, einige höher, andere tiefer, wie die Noten einer Partitur. Sie sahen aus, als würden sie tanzen, auf und nieder hüpfen wie diese Wasserfontänen vor den großen Hotels in Las Vegas, die hochschossen und wieder in sich zusammenfielen. So hatte er es sich vorgestellt, die Erfüllung seiner Fantasien. Sein Blut schäumte, sein Puls raste, und die Messer tanzten.«
»Nichts für schwache Nerven.« Stern.de überDie Elemente des Todes
Inhaltsübersicht
Motto
Ihr
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
Epilog
If you took all the girls I knew
When I was single
And brought them all together for one night
I know they’d never match my sweet imagination …
– Paul Simon, Kodachrome
Ihr könnt mir alles nehmen: meine Familie, meine Freunde, alles, was ich besitze – nicht aber meine Fantasien.
– Jeffrey Dahmer (Serienmörder, 1960–1994)
Die in diesem Buch geschilderten Ereignisse haben sich in den 90er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts in Bremen und Umgebung ereignet. Die Identität des Täters und die Namen der Opfer wurden ebenso verändert wie die meisten Schauplätze, um die Unschuldigen zu schützen und die Ruhe der Toten nicht zu stören. Dialoge und andere Äußerungen sind sinngemäß wiedergegeben. Nicht verändert wurden das Grauen der Morde und die eisige Kälte des Bösen.
Ihr
Mir passiert ja nichts. Das denkt ihr alle. Ihr zieht eure schönen Schuhe an und nehmt die Handtasche und natürlich den Mantel, vielleicht ist es kalt draußen. Dann verlasst ihr die Wohnung und denkt, mir passiert schon nichts. Es ist ja gar nicht kalt, denkt ihr. Ihr habt keine Angst. Ihr begegnet mir, aber ihr achtet nicht auf mich. Ihr wisst nicht, was den anderen passiert ist.
Denen vor euch.
Niemand weiß es wirklich. Nur ich. Ihr hört nie auf zu sterben, in meinen Zeichnungen. Die Diagramme helfen mir, mich zu erinnern, bis die Erinnerungen nicht mehr stark genug sind. Dann gehe ich wieder auf die Suche, bis aus den »ihr« ein »du« wird. Wenn ich vor dir stehe und die Lust auf neue Erinnerungen zu mir zurückkehrt.
Du siehst mich, und auf einmal hast du Angst. Aber jetzt ist es zu spät. Jetzt habe ich das Messer schon in der Hand. Siehst du es? Ein außergewöhnliches Instrument, nützlich in vielerlei Hinsicht. Es ist ohne Fehl, und doch wirft es nie den ersten Stein. Es wandert in manch finsterem Tal, aber glaubst du, es kennt Furcht? Es braucht keine Batterie, nicht Wind noch Sonnenenergie. Und vor allem ist es taub für Heulen und Zähneknirschen. Ja, jetzt siehst du es. Gut, dass du einen Mantel angezogen hast, denn plötzlich wird dir kalt.
Plötzlich wird dir entsetzlich kalt.
Du denkst, ich will dich töten. Aber das will ich gar nicht. Keine von euch. Ich will nicht einmal, dass du frierst. Komm, wir gehen in deine Wohnung. Da will ich mit dir leben, in deiner Wohnung. Ich will meine Träume mit dir teilen – immer wieder, mit jedem Schnitt ein bisschen mehr. Und langsam, weil du sonst zu früh sterben musst. Erst ganz am Ende wirst du tot sein.
Aber vorher …
Ich beobachte dich. Ich sehe nachts durch dein Fenster. Ich folge dir auf der Straße. In die Tiefgarage. In den Fahrstuhl. Ich kann einfach nicht anders. Wenn es wieder so weit ist, muss ich nicht einmal an deiner Tür klingeln. Ich muss nicht warten, bis du öffnest. Denn dann habe ich aufgehört, dir zu folgen.
Dann gehe ich schon vor dir.
Ich gehe einfach in deine Wohnung. Ich gehe hinein, wenn du nicht da bist, und ich bin da, wenn du nach Hause kommst. Ich bin da, um meine Träume mit dir zu teilen.
Robert Melzer, Mein Leben
1
Sabine
Bis zu diesem Tag, einem Freitag im Mai, war Sabine ein glücklicher Mensch gewesen, und sie dachte, das würde immer so bleiben. Solange sie denken konnte, hatte das Glück sie begleitet, und es war sogar gewachsen, jeden Tag ein bisschen, wie eine Perle in einer Muschel, auf die von morgens bis abends die Sonne schien. Ihr Vater sagte, eine Perlmuschel lebt im Wasser, tief unten, das Sonnenlicht erreicht sie kaum, aber das war Sabine egal. Glück war einfach Glück, selbst auf dem Meeresboden; die Schalen der Muschel tarnten und schützten es. Dabei wusste sie, dass es nicht viele Menschen gab, die so eine Perle in sich trugen und dazu noch von ihrem Vater eine Wohnung geschenkt bekamen, so wie sie zum fünfundzwanzigsten Geburtstag vor vier Wochen. Eine Muschel für die Muschel, hatte er gesagt, ganz dicht am Wasser.
An diesem Mittwoch fuhr Sabine gegen 0:30 Uhr in ihrem gelben Morris Mini Cooper in die Tiefgarage der umgebauten Lagerhalle am Alten Hafen, in der sich ihre neue Wohnung befand. Sie hatte keine Angst vor schlecht beleuchteten Tiefgaragen oder dunklen Kellern oder einsamen Straßen nach Einbruch der Nacht, einfach, weil sie vor gar nichts Angst hatte. Nicht einmal der Umstand, dass bisher erst ein Drittel der großen Studios und Apartments mit Blick auf die Hafenanlagen bewohnt war, flößte ihr Furcht ein. Im Gegenteil, sie genoss die Ruhe. Sie war gern allein, so wie jetzt, als sie den Mini auf ihren Parkplatz mit der Nummer 9 steuerte.
Neun war ihre Glückszahl, obwohl es sich ja eigentlich um eine Ziffer handelte. Sie schaltete die Scheinwerfer aus, und die mit reflektierender gelber Farbe an die Betonwand gemalte Nummer erlosch. Die laute Musik aus dem Radio des Cabrios hallte in dem fast leeren Parkdeck, Prince mit When doves cry. Sabine blieb noch ein paar Sekunden hinter dem Steuer sitzen, bis der Song aufhörte. Dann schaltete sie auch das Radio aus.
Die Stille wurde jetzt nur noch unterbrochen vom Summen der blassen Leuchtstoffröhren an der Garagendecke. Eine der Röhren flackerte unregelmäßig, obwohl sie eigentlich noch neu sein mussten. Aus einem Rohr an der Wand neben der Zufahrtsrampe tropfte Wasser. Die meisten anderen Parkplätze waren leer bis auf sechs oder sieben Wagen – ein Jaguar, zwei Porsche, ein BMW Cabrio und noch zwei, deren Marke Sabine nicht kannte.
Sie griff nach der Mappe auf dem Beifahrersitz. Plötzlich spürte sie ein Kribbeln zwischen den Schulterblättern. Ein Schauer lief ihr über den Rücken, wie manchmal, wenn sie im Freibad ganz oben auf dem Sprungturm stand und hinunter auf das blaue funkelnde Viereck des Schwimmbeckens schaute. Ihre erste eigene Ausstellung als Künstlerin in einer wirklich angesehenen Galerie war ein Erfolg!
Sie stieg aus und nahm die Mappe mit den neuen Zeichnungen vom Beifahrersitz. Der Galerist, in dessen Räumen die Ausstellung stattfand, hatte sie gebeten, für einen reichen Sammler exklusiv eine Handvoll kleiner Tuschskizzen vom verlassenen Hafengelände anzufertigen. Der Sammler hatte angeregt, die Skizzen noch mit Farbkreide oder vielleicht sogar Watercolor zu Pop-Art-Motiven aufzublasen, als Kontrast zum Schwarz und Weiß der Entwürfe. Aber sie hatte eine bessere Idee, nicht so retro, kein kopierter Warhol oder Lichtenstein.
Sie ging zur Rampe, um das Garagentor zu schließen. Die Zufahrt wurde von zwei Lampen beleuchtet, die an alte Schiffslaternen erinnerten. Der Himmel war klar und tiefblau, voller Sterne. Eine schlaflose Silbermöwe mit schneeweißen Flügeln schwebte lautlos unter dem Mond dahin wie ihr eigener Geist, dem Wasser entgegen. Was man von da oben alles sehen konnte, und wie weit weg es war: der Hafen, die rostigen Skelette der letzten Kräne, der Fluss, die Kais und die Lagerhallen.
Die ganze Welt lag unter einem, auch die neue Wohnanlage, die hier am Wasser gebaut wurde, Legohäuser, weiße Betonquader mit bodentiefen Fenstern, modern und sauber, wie Sabine es gernhatte – sauber und übersichtlich, alles andere auf Möwendistanz, der ganze Rest. Hier hört dich keiner schreien, hatte Regine, ihre beste Freundin, bei ihrem ersten Besuch gesagt. Und Sabine hatte gelacht, weil sie nie schrie, wäre ja noch schöner.
Sie zog an der Kette, die das Rolltor in Gang setzte, wartete aber nicht, bis es sich schloss. Stattdessen wandte sie sich ab und ging zur Eisentür, die zum Treppenhaus führte. Als sie an einem der Stützpfeiler vorbeikam, bemerkte sie einen nassen Fleck über dem reflektierenden Leitstreifen und darunter die glitzernden Scherben einer zerbrochenen Wodkaflasche.
Die Kellertür war unverschlossen. Sie zog sie auf, hielt sie mit der linken Schulter offen und tastete mit der rechten Hand nach dem Lichtschalter an der Wand dahinter. Sie hörte ein Klicken, aber sonst geschah nichts. Bis zum Fahrstuhl waren es nur ein paar Schritte, die sie im Dunkeln zurücklegte. Sie drückte auf den Rufknopf. Der Knopf leuchtete auf, und mit einem fernen Ruck setzte sich die Liftkabine in Bewegung. Ein leises Surren ertönte, als der Lift langsam abwärtsglitt.
Sie lauschte. Hinter der Tür zu den Kellerräumen am anderen Ende des kahlen Gangs vernahm sie ein dumpfes Scheppern, leise und nur kurz. Als kippte etwas gegen eine Wand. Darauf folgte ein Scharren, näher und weniger gedämpft. Es war nicht mehr hinter der Tür, es war die Tür selbst. Sie öffnete sich einen Spalt und blieb so, fiel nicht wieder zu.
Sabine konnte nicht sehen, was sich hinter dem Spalt befand. Sie glaubte, jemand atmen zu hören, rsch, rsch, rsch. Aber dann dachte sie, dass es sich vielleicht um das Geräusch einer Waschmaschine handelte, deren Trommel sich langsam drehte. Obwohl es dafür eigentlich zu spät war, fast Viertel vor eins.
Die Tür bewegte sich einen Zentimeter, schwang weiter auf, noch weiter, dann wieder zurück, bevor Sabine dahinter etwas erkennen konnte. »Ist da jemand?«, fragte sie. Mit der Mappe unter dem linken Arm ging sie auf die Tür zu, gerade als der Lift im Kellergeschoss hielt. Durch das kleine Fenster in der Fahrstuhltür fiel ein Lichtkeil in den Gang. Das Surren erstarb. Sabine blieb stehen, kramte ihre Schlüssel aus der Tasche und kehrte um.
Ein erstickter Laut drang aus der Waschküche, lang gezogen, wie ein mechanisch verzerrtes Stöhnen. Es kam ihr vor, als hörte sie ihren Namen irgendwo in diesem Röcheln. Sie erstarrte. »Ist da jemand?«
Rsch, rsch, rsch. Nein, das war keine Waschmaschine, keine Wäsche, die sich in Seifenlauge drehte. Es waren Atemzüge, die nicht wie Atem klangen. Sabine starrte auf den schwarzen Spalt, der jetzt breiter wurde, nicht langsam wie bisher, sondern schnell, mit einem Ruck. Eine Gestalt tauchte auf, schien aus dem Spalt zu schnellen. Kein Mensch. Ein Wesen aus einem Science-Fiction-Film, schwarz, mit einem Insektenkopf.
Reglos starrte Sabine die Gestalt an. Ein Jux, dachte sie, jemand spielt dir einen Streich. Gleich fängt die Person an zu lachen, und dann musst du auch lachen. »Sabi…«, sagte die Gestalt. Es klang fast wie die Stimme eines Menschen, versetzt mit dem mechanischen Röcheln, und als sie näher kam und in das Licht des Fahrstuhls geriet, erkannte Sabine, dass es kein Science-Fiction-Wesen war, kein Alien mit einem Insektenkopf, sondern ein Mensch mit einer Maske und einer großen Ledertasche in der linken Hand.
»Sabine …«, sagte die Stimme noch einmal, ganz deutlich. Es war eine Männerstimme, und der Mann war jetzt so nah, dass sie ihn riechen konnte, Schweiß und Wodka und dazu Kunststoff, das Material der Gasmaske, die er trug, den schwarzen Gummianzug. Dicht vor ihr blieb er stehen, starrte sie nur an durch die Plexiglasaugen der Maske.
Rsch. Rsch. Rsch.
Renn, sagte eine Stimme in ihr, eine Stimme, die sie noch nie in ihrem Leben vernommen hatte. Renn weg, das ist kein Jux! Aber sie konnte sich nicht bewegen. Wie in einem Albtraum stand sie da, als wäre sie gelähmt. Sie presste die Mappe mit den Zeichnungen an den Oberkörper.
»Wer sind Sie?« Sie merkte, dass ihre Stimme zitterte. Wie früher, fuhr es ihr durch den Kopf, als ich klein war, wenn ich etwas angestellt hatte. Papa kam und – »Woher wissen Sie meinen Namen?« Reden, dachte sie, einfach weiterreden, so wie du früher immer geredet hast, wenn Papa mit dir böse war. Plötzlich erkannte sie, dass sie gar nicht immer glücklich und furchtlos gewesen war. »Was wollen Sie von mir?«
»Halt den Mund.« Rsch, rsch. »Nicht reden. Wir gehen in deine Wohnung.« Der Mann griff hinter sich, seine rechte Hand verschwand, und als sie wieder zum Vorschein kam, schimmerte etwas darin, glitt durch das Licht aus dem Fahrstuhl. Ein Messer, mit einer langen, schimmernden Klinge. Sabine erstarrte. Das Blut schien aus ihrem Herzen zu stürzen, mit einem kalten Ruck. »Ich wollte oben auf dich warten«, sagte die mechanische Stimme, »aber du hast ein neues Schloss, ich bin nicht reingekommen.«
Renn!
Sie ließ die Mappe fallen, versetzte dem Mann einen Stoß und rannte zu der Stahltür hinter sich. Sie hatte sie fast erreicht, als er ihren Arm zu fassen bekam und sie gegen die Wand schleuderte. Ihr Kopf prallte gegen den Beton. Sie verspürte einen heftigen Schmerz, hinter der Stirn und in den Zähnen.
»Das war dumm«, sagte der Mann mit seiner verzerrten Stimme. »Mach das nicht!« Er bückte sich zu seiner Tasche, die jetzt dicht beim Fahrstuhl auf dem Boden lag. Der Reißverschluss war halb offen. Aus dem Bauch der Tasche quoll etwas hervor, das aussah wie ein Trainingsanzug, daneben lagen ein Paar Handschellen und eine Art Schwert. »Das ist für oben in deiner Wohnung«, sagte er.
Sabine stieß sich von der Wand ab, warf sich gegen den Mann. Er taumelte zurück. Sie stürzte zum Fahrstuhl, in die offene Kabine. Im Spiegel an der Kabinenwand sah sie ihr Gesicht, aber sie erkannte sich nicht, sah nur eine Frau mit angstverzerrten Zügen. Sah, wie die Frau hektisch die Knöpfe drückte, nicht einen, alle. Dann wurde der Kopf der Frau zurückgerissen, an den Haaren, so heftig, dass ihr Genick knackte. Ein Blitz schoss ihr bis unter die Schädeldecke. Die Gasmaske mit dem stumpfen Rüssel tauchte über ihrer Schulter auf, rsch, rsch, rsch im Spiegel, jetzt schnell und keuchend, dicht an ihrem Ohr.
Sie versetzte dem Mann einen Tritt mit der Ferse, aber er schrie nicht einmal. Sie versuchte, sich loszureißen. Sie packte den Rüssel der Gasmaske und zerrte daran, zog und zerrte mit aller Kraft. Plötzlich gab es einen Ruck, und etwas riss an der Maske, und dann hielt sie den Rüssel in der Hand. Der Mann stieß einen Laut aus, ein Knurren. Jetzt sah sie sein Gesicht, gerötet und verschwitzt und irgendwie flach, ohne Konturen. Im nächsten Moment presste er ihr die Klinge gegen die Kehle. Sie sah die Klinge im Spiegel, und sie sah ihren Hals, und sie spürte den scharfen Schnitt, bevor sie auch das Blut sah, alles in dem von ihrem Atem beschlagenen Spiegel: die Faust mit dem Messer, ihren Hals und sein Gesicht, das sie kannte.
»Du?«, rief sie. »Warum tust du das?!«
Er antwortete nicht, schüttelte nur den Kopf, unwillig.
»Warum?«
»Damit du«, er keuchte, »damit du mich spürst.« Er presste die Klinge noch fester gegen ihre Kehle. »Ich will – du sollst wissen, dass ich da bin.«
»Du tust mir weh!«
Seine Augen begegneten ihrem Blick im Spiegel, hielten ihn fest. »Muss es ja«, stieß er hervor, »muss ja wehtun.« Abrupt drückte er sein formloses Gesicht an ihren Nacken, als wollte er nicht, dass sie ihn weiter ansah, während er sie das erste Mal schnitt. Es war ja nur ein kleiner Schnitt, der erste.
First cut is the deepest.
Sie dachte an die Möwen.
2
Robert, ein halbes Jahr vorher
Robert stand am Fenster und sah Mariona aus dem Haus gehen, und wie jedes Mal fragte er sich, ob sie wiederkommen würde. Sie ging schnell, mit diesem entschlossenen Gang, den sie immer hatte, wenn sie nichts wie weg wollte. Sie drehte sich nicht um, das tat sie schon lange nicht mehr. Ganz am Anfang war sie manchmal stehen geblieben oder hatte einen kurzen Blick zurückgeworfen. Ich sollte sie nicht einfach so gehen lassen, dachte er. Ich sollte irgendetwas sagen. Du gehst jetzt nicht einfach weg!, so was. Oder einfach die Tür abschließen und den Schlüssel in die Tasche stecken.
Aber dann knallte sie ihm wieder eine oder trat nach ihm. Sie wusste, dass sie alles mit ihm machen konnte, weil sie stark war, wild. Er tat, was sie wollte; sie brauchte bloß mit dem Finger zu schnippen. Sie konnte ihm wehtun. Sie war nicht sehr intelligent, nicht so intelligent wie er, aber gerissen genug, um seine Schwäche zu spüren. Manchmal sah sie ihn an, und ihr Blick drang ihm direkt ins Herz. Bis sich da ein richtig taubes Gefühl ausbreitete, wo sie ihn verletzt hatte. Sie hatte ihm schon lange keinen Kuss mehr gegeben, wie früher. Oder gesagt, bis heute Abend dann, Robby.
Sie ging jetzt schneller, wie erleichtert, als sie auf die Bushaltestelle zuschritt. Ihr halblanges Haar wippte, eine Woge in Blond, die Hüften in den engen Jeans schwangen hin und her. Fast konnte er die Absätze ihrer Cowboystiefel auf dem Asphalt klappern hören. Die Fransen an den Ärmeln ihrer Wildlederjacke flatterten, als sie auf ihre Swatch schaute, die sie mit dem Zifferblatt nach unten trug.
Wenn ich nicht bald Geld auftreibe, wird sie irgendwann nicht mehr wiederkommen, dachte er. Oder wenn sie erfährt, dass ich gar nicht beim Arbeitsamt war. Dann wird sie auch nicht mehr wiederkommen. Dann bleibt sie einfach bei einem ihrer Typen und schickt jemand, der ihre Sachen abholt. Ich will nicht wieder allein sein. Ich muss unbedingt an Geld kommen, egal wie.
Zuerst fielen ihm Papa und Mama ein, wie immer. Aber von denen konnte er nichts mehr erwarten, da war er erst vor zwei Wochen gewesen. Papa hatte ihm einen Fünfziger gegeben und gesagt, das war das letzte Mal. Ich will erst dein Semesterzeugnis sehen oder was ihr da heutzutage habt. Seine Mutter hatte danebengestanden und genickt. Dein Vater hat ganz recht, du erzählst nie etwas, dafür haben wir dich nicht aufs Gymnasium geschickt und bis zum Abitur durchgefüttert. Papa hätte ihm bestimmt mehr gegeben, wenn sie nicht da gewesen wäre. Aber sie hatte die Hand auf dem Portemonnaie, und seit einigen Jahren ging sie nachts auch nicht mehr aus. Wahrscheinlich brauchten sie ihr ganzes Geld für Alkohol, Papa jedenfalls.
Es hatte noch nicht wieder angefangen zu schneien. Die Straßen waren trocken, nur ein Rest von Raureif lag auf dem Asphalt. Er konnte etwas rumfahren und gucken, erst mal nur so. Um diese Zeit gingen die Leute zur Arbeit. Ihn interessierten nur die Frauen – Sekretärinnen, Verkäuferinnen, Studentinnen. Er fuhr durch die Straßen und sah, wo sie wohnten, in welchen Häusern. Sie kamen heraus und gingen zur Arbeit, und abends kamen sie wieder, kehrten allein heim. Er konnte sie beobachten. Sehen, ob sie allein blieben, allein lebten.
Er ging ins Schlafzimmer und zog sich fertig an, sonst sah ihn noch jemand in Unterhose und Unterhemd am Fenster stehen wie so einen arbeitslosen Alki. Er fand es wichtig, dass man auf sich achtete. Das Schlafzimmer war klein – die ganze Wohnung war klein, billig und wirklich winzig – und dunkel, weil sie die Jalousie nie hochzogen. Mariona schmiss ihre Sachen immer irgendwohin, aufs Bett oder auf den Stuhl vor der Heizung oder unten in den Schrank. Das Bett war rund, wie ein Schlauchboot, weil Mariona gesagt hatte, ich zieh nur zu dir, wenn du ein Wasserbett anschaffst, so eins wie in Miami Vice.
Er hatte sein Konto bis zum Anschlag überzogen, und in den ersten Wochen war sie richtig nett gewesen, hatte alles mit ihm gemacht, was er wollte. Wie die Mädchen in den Anzeigen hinten in der Zeitung. Es war die schönste Zeit in ihrer Beziehung gewesen, ein paar Wochen lang. Rings um das Bett war ein Leuchtschlauch drapiert, sodass es fast wie eine Kultstätte aus einem alten Science-Fiction-Film wirkte, Barbarella oder so. Jetzt roch das Zimmer muffig, ungelüftet, und es war kalt.
Neben dem Schrank stand sein alter Reisekoffer, daneben lag Marionas Rucksack, immer halb gepackt, damit sie sofort wegkonnte. In seinem Koffer war nichts, nur alter Krimskrams, das japanische Schwert und das Bild der heiligen Rosa. Das Schwert gehörte eigentlich im Wohnzimmer an die Wand, über dem Sofa, aber Mariona hatte gesagt, dass sie es da nicht haben wollte und auch nicht im Flur oder im Schlafzimmer. Deswegen lag es jetzt bei Rosa im Koffer, was irgendwie auch passte, weil die ja eine Märtyrerin gewesen war und den Tod durch das Schwert gefunden hatte. Die Bilder von Märtyrerinnen und Märtyrern, gefoltert, aus vielen Wunden blutend, hatten Robert schon im Religionsunterricht erregt. Die geschundenen Körper und das Blut. Da hatte er zum ersten Mal diese Unruhe verspürt, das Quecksilber in seinen Adern.
Er zog sich an, Jeans und das rot-schwarz karierte Hemd von gestern, das noch nach Zigarettenrauch roch. Die Stiefel standen im Flur, und da hing auch der Schimanski-Parka mit den Schlüsseln für den Renault 4 in der Tasche. Der R4 sprang erst nach dem dritten Versuch an. Danach lief der Motor rund, nur der Tank war fast leer. Die Frontscheibe war dreckig. Robert ließ die Wischblätter einmal hin und her schaben, aber die Düse für das Wasser war wohl verstopft. Die Heizung funktionierte auch nicht. Er fuhr bis zur Ampel, wo er warten musste. Er sah zu, wie die Leute vor ihm über die Straße gingen, blass, noch nicht ganz wach, aber doch zielstrebig, jeder für sich, die Gesichter versiegelt von der Kälte.
Die Kinder mit den Schulranzen interessierten ihn nicht, die Männer mit den Aktentaschen auch nicht. Nur die Frauen. Sie gingen meistens schneller als die Männer, und fast immer trugen sie etwas: Handtaschen, Rucksäcke, Einkaufstüten. Sie waren auch bunter, ihre Kleidung, die geschminkten Gesichter. Er versuchte zu erraten, was sie für eine Arbeit hatten, womit sie den ganzen Tag über beschäftigt waren. Friseuse war immer das Erste, was ihm einfiel, weil Mariona in einem Friseursalon arbeitete. Dann kam Verkäuferin im Supermarkt, danach Kellnerin, schließlich Angestellte bei der Post oder einer Bank; keine Barfrauen oder Nutten, die schliefen noch.
Es war ein grauer, verhangener Morgen, und alle Autos hatten ihre Scheinwerfer eingeschaltet. Als die Ampel auf Grün sprang, bog Robert nach rechts ab. Eine Zeit lang fuhr er neben einer Straßenbahn her. Die Fenster waren erleuchtet, aber beschlagen, sodass er die Leute darin nicht sehen konnte. Hinter der nächsten Kreuzung gab es einen von diesen neuen Mobilfunkläden, die jetzt überall aus dem Boden schossen. Dann kam eine Filiale der Sparkasse, das neonrote S über dem Eingang wirkte wie eine gezackte Schnittwunde in der schmutzigen Luft.
Mariona hatte ihr Gehaltskonto bei der Sparkasse. Als Robert an sie dachte, kriegte er wieder Angst, dass sie ihn verlassen könnte. Ohne einen richtigen Baum mit Lametta und Goldkugeln und Geschenke für meine Eltern wird das ein Scheißweihnachten, hatte sie gestern Abend gesagt – ein richtig beschissenes Fest, und das ist deine Schuld! Ich bin verrückt nach ihr, dachte er. Der Gedanke war so intensiv, dass er die Worte sehen konnte, aus denen er geformt war: Ich bin verrückt nach ihr. Und dann dachte er: Ich wünschte, ich wäre mutig genug, eine Bank zu überfallen. Aber das bin ich nicht.
Eine Frau in einem schwarzen Mantel stand am Geldautomaten und holte gerade ihre EC-Karte aus der Geldbörse. Ihre Handtasche hing offen in der rechten Armbeuge. Sie schob die Karte in den Schlitz und tippte ihre Geheimzahl ein. Robert konnte nicht sehen, wie viel Geld aus dem Automaten kam. Sie steckte es ein und wandte sich in die Gegenrichtung, verschwand aus seinem Rückspiegel. Er fand sowieso, dass sie nicht dem entsprach, was er sich vorstellte.
Er verspürte eine Unruhe in sich aufsteigen, ein vertrautes Flimmern, als wäre sein Blut plötzlich dünnflüssiger. Heißer. Er fuhr weiter, und nach einer halben Stunde, in der er fünf mögliche Kandidatinnen erspäht hatte, bekam er Hunger. Er beschloss, umzukehren und zu frühstücken. Sein Platz gleich vor dem Haus war noch frei. Er parkte ein, und als er den Zündschlüssel abzog, konnte er seinen gefrorenen Atem von der Innenseite der Frontscheibe kratzen.
Etwas Geld hatte er noch, nicht viel, aber für ein paar Flaschen Bier reichte es, vielleicht sogar für einen halben Liter Wodka. Im Erdgeschoss war ein Edeka, der Eingang lag aber um die Ecke. Um diese Zeit herrschte da noch nicht viel Betrieb, nur ein paar alte Leute mit Einkaufswagen und ein halbes Dutzend Schüler mit dunkler Haut. Aus verborgenen Lautsprechern rieselte Weihnachtsmusik, Jingle Bells, dabei waren es noch drei Wochen bis Heiligabend.
Bei den Spirituosen nahm Robert eine Flasche Moskovskaja aus dem Regal und legte sie in den Korb zu den Bierflaschen aus der Getränkeabteilung. Dann fiel ihm ein, dass er noch etwas zum Üben mitnehmen könnte, damit er sich nicht so unvorbereitet fühlte, wenn es so weit war. Irgendwas, das außen fest und innen weich war, eine Melone vielleicht oder ein Laib Brot. Nur um zu gucken, wie sich das anfühlte, wie viel Kraft man brauchte. Graubrot mit einer richtigen Kruste oder ein rohes Huhn – Fleisch und Haut, wo man reinstechen konnte. Er ging zu den Kühltruhen und legte noch ein tiefgefrorenes Huhn in den Korb. Wenn er es in einem Suppenteller auf die Heizung stellte, war es aufgetaut, bevor er sich am Nachmittag auf den Weg machte. Er konnte einen Film in den Videorekorder schieben und sich mit dem Wodka in Stimmung bringen, während das Huhn auf der Heizung lag und taute.
Als er an der Kasse stand, war das kitzelnde, flirrende Gefühl in seinem Bauch so stark, dass es sich anfühlte, als wäre es lebendig. Als lebte etwas in ihm und drehte sich langsam, wie eine Spirale, und dabei wurde es größer und größer. Mit dem Spiralgefühl im Bauch stieg er in den Fahrstuhl nach oben in den zweiten Stock. Es hörte nicht auf, als er die Wohnung betrat, und auch nicht, während er das belegte Brötchen aß, das er unten in der Wurstabteilung gekauft hatte. Er zog die Morgenpost aus dem Zeitungsstapel im Flur und setzte sich an den Küchentisch. Der Stuhl knarrte unter seinem Gewicht, denn er wog mehr als die meisten Menschen, weil er so groß war. Groß und schwer, aber schwach. Er würde nie so stark sein wie Mariona; jemand, der mit einem einzigen Blick dafür sorgen konnte, dass einem das Blut aus dem Herz stürzte.
Er schlug die hinteren Seiten der Zeitung auf, da, wo die ganzen Anzeigen waren, von Monique oder Vanessa, Michelle, Natalie, Vera und vielen anderen, manche mit Bild, obwohl man nie wusste, wie sie dann wirklich aussahen. Unter den Namen stand meistens, was sie anboten, und manchmal auch, von wann bis wann sie arbeiteten und die Telefonnummer, unter der man sie erreichen konnte.
GISELA, 19, ROTE HAARE, WILL DICH VERWÖHNEN, DEIN TRAUM WIRD WAHR, AUCH ANAL –
Mit dem Kugelschreiber malte er einen Kreis um den Namen und dann um die Telefonnummer. Er konzentrierte sich auf Nummern, die mit 32 anfingen. Das war in der Nähe des Bahnhofs, wo er sich auskannte und mit dem Wagen hinfahren konnte. Außerdem war es weit genug entfernt, sodass er wohl niemand begegnete, der ihn kannte.
STEFANIE, 24, RASSIGE BRÜNETTE MIT SUPERTITTEN, WARTET AUF DICH, UM DICH ZU VERWÖHNEN! GV, NATURSEKT, FRANZÖSISCH –
Auch hier malte er einen Kreis um die Telefonnummer.
SOFIA, 21, BLOND VON KOPF BIS FUSS, LUST OHNE GRENZEN, ALLES IST ERLAUBT, WAS DIR GEFÄLLT, AUCH PAARE. 15 BIS 24 UHR, ANRUFBEANTWORTER ODER LIVE –
Es war noch zu früh; selbst wenn sie schon arbeiteten, hatten sie noch nicht genug verdient. Die ganze Mühe musste sich schließlich lohnen, und wenn sie kein Geld in der Wohnung hatten, konnte er es gleich lassen, egal, was er sich sonst noch vorstellte. Er kreiste auch Sofias Telefonnummer ein.
Er hatte schon früher bei Nutten angerufen, deswegen wusste er, dass manchmal nur ein Anrufbeantworter am anderen Ende war: Hallo, du hast Monique erreicht. Aber manchmal gingen sie auch gleich selbst an den Apparat. Monique, sagten sie dann, oder Tanja oder Vanessa – egal, es war ja sowieso nicht ihr richtiger Name –, hallo, was kann ich für dich tun?
Es waren mindestens dreißig oder vierzig kleine Anzeigen, die ganze Seite war voll damit. Ich warte bis zum Nachmittag, dachte er. Oder ich rufe jetzt schon an und verabrede mich für später, sonst sind sie vielleicht ausgebucht, wenn ich so weit bin. Auf alle Fälle musste er sich vorher anmelden, damit sie auch da war, wenn er vor der Tür stand und klingelte. Er überlegte, kreiste noch eine Telefonnummer ein. Er hasste es, Entscheidungen treffen zu müssen, dies oder das, falsch oder richtig.
Er drückte den Knopf oben am Kugelschreiber, raus, rein, raus, rein. Er legte den Kuli auf die Zeitung, schob ihn weiter, von dem Papier auf das blau-weiß karierte Wachstuch, mit dem der Tisch bedeckt war. Er entdeckte einen kleinen Tintenfleck am linken Daumen und eine gerötete Stelle neben dem Nagelbett. Die Haut war rissig; es tat weh, wenn man daran knabberte, aber es musste sein. Manchmal war es gut, wenn etwas wehtat. Er blätterte ein paar Seiten weiter, bis zu den Kinoanzeigen. Er sah sich gern Plakate an, auf denen Frauen gefoltert wurden, Hexen, bis aufs Blut gequält, solche Filme. Die Frauen knieten halb nackt und mit Ketten gefesselt in einer Zelle oder im Wüstensand, den Kopf verzweifelt nach hinten geworfen, ein Messer an der nackten Kehle. So wie auf dem Plakat in seinem alten Kinderzimmer.
Er stellte sich vor, er wäre es, der ihnen das Messer an die Kehle hielt. Er stellte sich ihre Angst vor, wie sie ihm ausgeliefert waren und alles tun mussten, was er wollte. Er stieß den Stuhl zurück, lief durch die Wohnung, von der Küche ins Wohnzimmer und von dort ins Schlafzimmer. Das Telefon stand im Flur auf einer dunkelgrünen Ikea-Kommode. Er blieb davor stehen und starrte es an, als könnte es die Entscheidung für ihn treffen, Monique oder Sofia. Oder Stefanie. Plötzlich klingelte es. Er zuckte zusammen und nahm den Hörer ab. »Hallo?«
»Ist die Mariona da?«, fragte eine Männerstimme, Straßenlärm im Hintergrund.
»Nein.«
»Wann kann ich sie denn erreichen?«
»Weiß ich nicht. Irgendwann.«
»Sie sind der Student, was?«
»Welcher Student?«
»Sie hat gesagt, sie wohnt mit einem Studenten zusammen.«
»Nein. Ich bin ihr – sie ist meine Freundin.«
Der Mann schwieg.
»Soll ich ihr etwas ausrichten?«, fragte Robert. »Ich kann ihr sagen, dass Sie angerufen haben, wenn Sie mir Ihren Namen –«
»Sie hat nicht erzählt, dass sie einen Freund hat«, sagte der Mann.
Robert spürte, wie sich sein Magen verkrampfte. Es geht also wieder los, dachte er. »Kennen Sie sie aus dem Ali Baba?«
»Sagen Sie ihr, dass der Richy angerufen hat, ja?«
»Okay, ja«, meinte Robert, aber da klickte es schon; der Mann hatte aufgelegt. Robert stand da, Hörer in der Hand, und sein Gesicht brannte. Er merkte, dass ihm die Knie zitterten. Er stellte sich den Anrufer vor: breite Schultern, nackenlange Haare, vielleicht noch ein Schnauzbart und eine Baseballkappe, Schirm nach hinten gedreht. Im Ali Baba, Marionas Stammpinte, wimmelte es von solchen Typen. Sie machte mit jedem von denen rum, sogar wenn er dabei war, nur um ihn ihre Macht spüren zu lassen. Außer wenn sie was von ihm wollte. Wenn er ihr was spendieren sollte, dann war sie anders; dann gab sie sich ein bisschen Mühe.
Sie sagte nicht, ich wohne bei meinem Freund. Sie sagte, ich wohne mit einem Studenten zusammen. Auf einmal verspürte er eine unkontrollierte Wut, die durch seine Brust fegte und ihm in den Kopf schoss wie eine Stoßwelle.
Er ging in die Küche und holte den Wodka aus dem Kühlschrank. Die Flasche fühlte sich kalt an, aber als er sie an den Mund setzte, war der Wodka immer noch zu warm. Er warf ein paar Eiswürfel in ein Wasserglas und füllte es dann mit Moskovskaja auf. Nach einem weiteren Schluck nahm er die Zeitung mit zum Telefon. Monique. Er wählte die Nummer, die unter dem Namen stand, und merkte, wie sein Herz schneller schlug.
Am anderen Ende erklang das Freizeichen, einmal, zweimal, dreimal. Niemand da, dachte er enttäuscht. Beim vierten Klingeln wurde abgehoben, und eine helle Stimme – fast so hell wie die eines Kindes – sagte: »Hallo, hier ist Monique.«
Er räusperte sich. »Ja, hallo, ich – ich rufe wegen Ihrer Anzeige an, in der Zeitung.«
»Und was kann ich für dich tun?« Sie klang wie eine Katze, als würde sie schnurren. Er konnte sie atmen hören, und als sie weiterredete, lispelte sie sogar ein bisschen, als wäre sie genauso aufgeregt wie er. »Möchtest du mich besuchen kommen?«
»Ja.«
»Meine Adresse steht in der Anzeige. Wann willst du denn kommen? Jetzt gleich?«
»Nein, jetzt noch nicht. Später. Heute Nachmittag.«
»Warte, ich schau mal schnell in meinen Terminkalender.« Ein Rascheln am anderen Ende, erst nah, dann weiter weg, dann wieder nah. »Wäre dir 16 Uhr recht? Oder 17?«
»17 Uhr«, sagte er. Dann hatte er noch genug Zeit, um in die richtige Stimmung zu kommen.
»Verrätst du mir noch, wie du heißt?«
»Robert.« Wie Robert De Niro, der Typ aus Taxi Driver.
»Hast du besondere Vorlieben, Robert?«
»Vorlieben? Ich weiß nicht …«
»Magst du es zärtlich oder etwas härter? Willst du, dass ich es dir mit der Hand mache oder mit dem Mund, oder willst du ihn mir so richtig reinstecken?«
»Ich weiß nicht, zärtlich vielleicht.«
»Ist eine Frage des Preises«, sagte sie. »Am besten kommst du erst mal her, und dann finden wir heraus, wie du es gern magst. 17 Uhr. Du musst bei Wilhelm klingeln.«
»Gut. Also, bis dann, ja?«
»Ja, bis dann, Robert.« Sie lachte leise und legte auf, und da dachte er, das Lachen wird dir noch vergehen. Er sah die Worte so deutlich vor sich, wie er Ich bin verrückt nach ihr gesehen hatte. Er guckte auf seine Uhr. Noch nicht mal ganz zwölf. Er ging zurück in die Küche und sah nach dem Huhn auf der Heizung. Es war noch halb gefroren. Er holte ein Messer aus der Schublade mit dem Besteck, aber vorher brauchte er noch einen Wodka.
3
Wilhelm, Wilhelm, Wilhelm …« Er zog den rechten Handschuh aus und rieb mit dem Daumenballen über die von der Kälte beschlagenen Klingelschilder, bis er die Namen lesen konnte. Da – Wilhelm, dritter Stock. Er holte tief Luft und klingelte. Ein paar Sekunden später knisterte die Gegensprechanlage. »Ja?«
»Robert«, sagte er.
Der Türöffner schnarrte. Robert drückte gegen den kalten Kugelgriff und betrat das Treppenhaus. Fast im selben Moment ging das Licht an. Er zog auch den zweiten Handschuh aus und stopfte beide in die linke Parkatasche zu den Autoschlüsseln, denn in der rechten steckte das Messer. Er hatte es in Zeitungspapier gewickelt, damit die Klinge nicht durch den Stoff der Jacke drang.
Es gab einen Fahrstuhl, doch Robert nahm lieber die Treppe. Die Wände des Treppenhauses waren in milchigem Gelb gestrichen, die Stufen schwarz gekachelt. Sie führten nach oben und nach unten, in den Keller oder zu einer Tiefgarage. Vielleicht gab es auch noch eine Hintertür, überlegte Robert, einen möglichen Fluchtweg über den Hof. Einige Stockwerke über ihm wurde eine Tür geöffnet. Er hatte sich nicht überlegt, wie sie wohl aussehen würde, das Gesicht, die Haarfarbe oder was sie anhatte. Er hatte zwei Flaschen Bier und fast die ganze Flasche Wodka getrunken, und jetzt schlug sein Herz nicht mal halb so schnell wie heute Vormittag, als sie telefoniert hatten. Er spürte es überhaupt nicht, fast als hätte er gar keins; als wäre es irgendwo in seinem Parka versteckt statt in seiner Brust.
Monique stand im Türrahmen. Er blinzelte die Kälte weg, die alles etwas unscharf machte. Er sah nur eine Silhouette: ein schlanker Körper – schwarzer BH mit rotem Spitzenbesatz, schwarzer Slip, dazu noch schwarze Strapse –, die Arme verschränkt, eine Hüfte an den Türrahmen gelehnt. Dahinter der Korridor, von schwachem Licht erfüllt. Es war nicht mal violett wie in manchen Filmen, wenn da einer zu einer Nutte ging. »Ich bin Monique«, sagte sie. »Du bist pünktlich. Ich mag es, wenn Männer pünktlich sind.«
Sie hatte blondes Haar, kurz und glatt wie Schnittlauch. Ihr Gesicht war nicht besonders hübsch, schmale blaue Augen, der Mund glänzte wie mit rotem Lack bemalt. Ihr Hals war schlank. Die Brüste wirkten selbst in den schwarzen Körbchen nicht sehr groß. Von dem BH hing noch eine Art Leibchen aus schwarzer Seide bis zum Bauchnabel runter, damit man nicht alles auf einmal sehen konnte. Sie trug High Heels, und als sie vor ihm durch den Flur ging, klackten ihre Absätze auf dem dunklen Linoleumboden. Mit einer kleinen Geste aus dem linken Handgelenk deutete sie auf eine in die Wand gedübelte Garderobe. »Du kannst deine Jacke da an den Haken hängen. Und zieh bitte die Schuhe aus.«
Das Zimmer am Ende des Flurs hatte keine Tür, nur einen Vorhang aus bemalten Holzperlen. Monique teilte ihn mit einer Hand. Robert sah eine graue Couch mit einem Haufen bunter Seidenkissen, einen runden Glastisch und eine niedrige Kommode, auf der ein weißer Philips-Fernseher stand. In der Kommode bewahrt sie bestimmt das Geld auf, dachte er, in einer der Schubladen. Vielleicht auch in der Kochnische, in der Brotdose oder in einer leeren Teekanne.
Aus dem Raum drang leise Musik, Gitarre und Synthesizer, wie in einem Hotelfahrstuhl. An der Decke hing eine große weiße Kreppkugel, in der eine 40-Watt-Birne brannte, höchstens 45 Watt, vielleicht weniger. In einer Ecke stand ein Gummibaum in einer Hydrokultur. Ein weißer Flokatiteppich bildete eine flauschige Brücke von der Couch zu dem großen französischen Bett neben dem Fenster. Auf dem Bett lag eine pinkfarbene Tagesdecke. Die Lamellen der Jalousie waren halb geschlossen.
»Soll ich das Licht ausmachen?«, fragte Monique.
»Weiß nicht«, sagte Robert. Er zog seine Schuhe nicht aus und behielt auch den Parka an. »Meinetwegen.«
»Weißt du denn schon, wie du es haben möchtest?«
»Kommt auf den Preis an«, sagte er, damit sie keinen Verdacht schöpfte. »Was kostet eine einfache Nummer?«
»Mit Reinstecken oder nur mit der Hand?«
»Mit Reinstecken.«
»Achtzig ganz ausgezogen. Mit Körperküssen –«
»Okay«, sagte er. »Darf ich mal kurz ins Bad?«
Sie deutete auf eine angelehnte Tür neben der Garderobe. »Aber ohne Schuhe«, sagte sie noch einmal.
»Alles klar«, sagte er. Er bückte sich und fummelte ein bisschen an den klammen Schnürsenkeln herum, dann ging er ins Bad, ohne die Schuhe auszuziehen. Er schloss die Tür hinter sich und blieb einen Moment einfach so stehen und betrachtete sich im Spiegel über dem Waschbecken. Er war blass, nur auf seinen Wangen lag ein roter Schimmer, wie bei einem Clown im Zirkus. Sein Haar glänzte nass, dunkelbraune Strähnen, die ihm in die Stirn hingen. Er war betrunken, aber er fühlte sich nicht so.
Er wartete auf das flimmernde Quecksilbergefühl in seinem Blut, das Kitzeln in seiner Brust. Warum werde ich nicht wütend?, dachte er. Wie sie wohl wirklich heißt? Vielleicht Monika. Es tut mir leid, Monika. Ich weiß nicht, wie ich sonst an Geld kommen soll. Ich habe noch nie jemand getötet, nicht mal zugeschlagen habe ich, auch nicht in der Schule oder sonst wo. Nur Mariona habe ich mal eine verpasst, weil sie nicht aufgehört hat, mich zu triezen, als ich schlafen wollte. Danach habe ich mich geschämt. Ob ich mich nachher auch schämen werde?
Ich kann immer noch zurück, dachte er. Ich kann rausgehen und sagen, dass ich kein Geld habe oder dass sie doch nicht mein Typ ist, ich steh nicht so auf blond. Er stellte sich vor, wie sie sich dann aufregte, wie sie wütend wurde und auf ihn losging, mit diesem Keifen, das die Stimmen der Frauen in solchen Momenten kriegten, dann verpiss dich doch, du Versager, du Memme, du armseliger Wichser, du elendiger –
Genau wie Mariona im Ali Baba, wenn sie zu viel getrunken hatte und sie ihn einfach loswerden wollte, weil sie auf einen von den anderen Gästen scharf war.
Er griff in die rechte Parkatasche, holte das in Zeitungspapier gewickelte Fleischmesser heraus und packte es aus. Solinger Stahl, 1a-Qualität. Die Klinge schimmerte, das Papier ließ er einfach fallen. Das Messer lag gut in der Hand, der Griff war aus schwarzem Plastik, mit Vertiefungen für die Finger. Damit hatte er zu Hause geübt – die Klinge in das aufgetaute Huhn gerammt, durch die gelbliche Haut ins Fleisch darunter und sogar durch die Knochen –, um auf das Gefühl vorbereitet zu sein. Da! Besser als ein Brotlaib, hatte er gedacht. Da, da! Das Huhn war feucht und immer noch ein bisschen kalt gewesen, und es hatte fast gar nicht geblutet. Da und da und da! Anschließend hatte er das Messer abgespült und das Huhn in den Kühlschrank gelegt, weil er am Abend bestimmt hungrig sein würde.
Er blickte nicht noch einmal in den Spiegel. Ich gehe jetzt einfach raus und mache es, dachte er. Das war der letzte Gedanke, an den er sich später erinnerte, danach war alles weg. Er umklammerte den Griff des Messers so fest, dass es fast wehtat, und verließ das Bad.
»Ich bin hier!«, rief Monique.
4
Larsen
Es war eins von den Häusern, in denen ein Mensch sterben und sehr lange tot auf dem Boden liegen konnte, ohne dass irgendjemand sich über den ununterbrochen laufenden Fernseher in der Nachbarwohnung oder den überquellenden Briefkasten im Eingangsbereich wunderte. In diesen Häusern konnte ein Mensch ermordet werden und dabei verzweifelt um sein Leben kämpfen, und erst wenn der Geruch im Treppenhaus so intensiv wurde, dass keinem der anderen Mieter mehr eine natürliche Ursache dafür einfiel, kam jemand auf die Idee, die Polizei zu rufen.
Es gab so viele von diesen Häusern in der Stadt, dass Hauptkommissar Kiefer Larsen ihre Fassade schon vor sich sah, wenn nur sein Telefon klingelte und jemand eine ermordete Prostituierte meldete. Er sah die Fassade und das Treppenhaus und die Tür der Wohnung, und als er bei dem Haus eintraf, sah er auch die Namen auf den Klingelschildern und erkannte sie wieder: Sarah Herbst und Rosy Sommer, Tanja Tulpe, Monique Wilhelm. Sie nannten sich Modelle, und keine arbeitete unter ihrem richtigen Namen. Stattdessen bevorzugten sie Jahreszeiten, Blumen oder Farben, manchmal auch Männernamen, in den Anzeigen und an den Türen.
Der Kriminaldauerdienst hatte Larsen vor einer halben Stunde angerufen, und jetzt stieg er langsam die Treppe zum dritten Stock hinauf und erkannte sogar den Geruch, der all diesen Häusern zu eigen war. Seine Gummisohlen quietschten auf den von den Abdrücken zahlloser nasser Schuhe übersäten Stufen. Er überlegte, ob die des Täters dabei waren oder ob der Mörder den Lift benutzt hatte. Ich wäre gelaufen, dachte er, vorher und nachher. Die Beleuchtung im Treppenhaus war schwach, und bei einer zufälligen Begegnung reichte es, den Kopf zu senken, um sein Gesicht zu verbergen. Im Fahrstuhl mit seinem hellen Licht prägten sich selbst Kleinigkeiten schnell ein. Larsen entdeckte keine Blutspuren an den Wänden oder auf den Stufen, aber damit hatte er auch nicht gerechnet.
Im dritten Stock saß ein Mann auf dem Treppenabsatz. Er trug schmutzige Sneakers, Jeans und eine gefütterte Lederjacke. Zu seinen Füßen hatten sich zwei kleine Wasserlachen gebildet. Er hatte den Kopf in beide Hände gestützt, die Handballen verbargen das halbe Gesicht. Das braune Haar fiel ihm in feuchten Strähnen über die Finger. Als er Larsen kommen hörte, blickte er auf. Auch seine Augen schimmerten feucht. »Eines Tages musste es so kommen«, sagte er mit erstickter Stimme. »Ich habe immer gewusst, dass es eines Tages so kommen würde. Aber sie hat mir ja nicht geglaubt.«
»Larsen, Kripo«, stellte er sich vor. »Sind Sie mit der Toten verwandt?«
»Monika ist meine Frau.« Er rieb sich die Augen mit den Daumenballen. »Ich bin ihr Mann. Armin Wilhelms … Sie liegt da drin. Sie ist … sie sieht schrecklich aus … man muss sie doch zudecken! Wir haben mit dem Abendessen auf sie gewartet, aber sie ist nicht gekommen. Tommy hat sie dann angerufen, weil sie schon lange zu Hause sein wollte. Tommy kriegt es schnell mit der Angst. Sie ist nicht ans Telefon gegangen, und ihr Anrufbeantworter war auch nicht eingeschaltet.«
»Tommy ist Ihr Sohn?«, fragte Larsen.
»Ja. Er ist – er ist erst sieben. Seine Schwester … Er hat noch eine Schwester – Friederike –, die ist vier. Wie sollen sie denn jetzt – ohne ihre Mutter – ohne Monika … Warum wird sie denn nicht zugedeckt?«
»Gehen Sie nicht weg«, sagte Larsen. »Ich bin gleich wieder bei Ihnen. Ich sorge dafür, dass sie zugedeckt wird.«
Ein Beamter der Schutzpolizei stand neben der offenen Tür zu Monique Wilhelms Apartment. Er tippte mit zwei Fingern einen Gruß an den Schirm der Uniformkappe und trat zur Seite, um Larsen in den erleuchteten Flur des Apartments zu lassen. »Behalten Sie den Mann im Auge«, sagte Larsen leise und holte Notizblock und Stift aus der Innentasche seines Dufflecoats. »Bringen Sie ihm ein Glas Wasser. Ich will nachher noch mit ihm reden.«
An der Wohnungstür bemerkte er dunkelrote Flecken neben dem Knauf. Er warf einen Blick auf die Innenseite und entdeckte auch dort rote Kontaktspuren, wahrscheinlich Blut von der Hand des Täters. Nichts an den Wänden, nichts auf dem Boden. An der Garderobe rechter Hand hing eine schwarze, nietenbesetzte Lederjacke, deren Taschen nach außen gekehrt waren und ebenfalls Blutspuren aufwiesen. Darunter lag eine offene Damenhandtasche; der Inhalt war verstreut wie die Spielsachen eines unordentlichen Kindes. Aus dem Raum am Ende des Flurs drangen Stimmen von mehreren Männern und einer Frau. Die Frau war Mareike Jung. Eine der Männerstimmen gehörte Torsten Lenz, Olaf Sundermann eine andere, die übrigen erkannte Larsen nicht.
Warum sind sie nicht still?, dachte er. Am liebsten wäre er jetzt allein gewesen, nur er und die Leiche des Opfers, in absoluter Stille, umgeben von Schweigen. Sie war da und wartete auf ihn, genau wie der Mörder, dem er nie mehr so nahkommen würde wie in diesem Moment am Tatort. Mit dem Block in der Hand betrat er das Zimmer am Ende des Flurs, und die Gespräche verstummten. Die Perlenstränge des Vorhangs klirrten noch einige Sekunden gegeneinander.
Die Lamellenjalousie war heruntergelassen. Die Lampe an der Decke brannte nicht, nur die Stehlampe neben dem Bett spendete schummriges Licht. Es war ein Prostituierten-Studio wie aus dem Katalog eines Einrichtungshauses – Wohnen & Arbeiten im Rotlichtviertel – mit einer Kochnische, einem WC und einer Duschkabine. Alles diente einem Zweck, nichts war Luxus. Allerdings hätte man bei den Abbildungen im Katalog wahrscheinlich auf das Blut verzichtet, ebenso auf die junge Frau, die tot auf dem weißen Flokati vor dem großen Bett (2 x 2 Meter, pinkfarbener Überwurf) lag.
Das Blut war überall. Ein großer Fleck auf dem Teppich. Eine Lache auf dem Linoleumboden. Spritzer auf dem Bettgestell, dem Tisch, dem Fernseher. Blutspuren fanden sich auch auf dem Glastisch, der Sitzfläche der Couch und der geweißelten Wand dahinter. Blutige Kontaktspuren – wischartig – vermutlich von Händen oder blutigen Textilien, notierte Larsen. Auffällige Tropfenbildung. Durch Stiche bedingte Abschleuderspuren (bis zur Decke) von blutiger Tatwaffe. Schwach blutige Schleifspur auf Teppich führt von Couch zum circa zwei Meter entfernten Körper der Toten.
Sie muss sich verzweifelt gewehrt haben, dachte er.
Die Spurensicherung hatte bereits mit der Arbeit begonnen und kleine Tafeln mit Ziffern und Zahlen in konzentrischen Kreisen um die Leiche aufgestellt. Der Körper der Frau war etwas verdreht, sie lag halb auf dem Rücken, halb auf der Seite. Die Beine waren angezogen, beide Arme vor dem Körper verschränkt. Etwa einen Meter siebzig groß, schätzte Larsen, Gewicht um die sechzig Kilo. Schlank, sportliche Figur. Blonde, kurze Haare. Der Kopf war zur Seite gekippt. Der Mund stand offen. Die Lippen waren blutverkrustet, ein Schneidezahn war abgebrochen. Die Blutlache auf dem Boden, in der Monika Wilhelms lag, war groß, fast einen halben Meter auf einen halben Meter, und an den Rändern bereits eingetrocknet. Der weiße Hirtenteppich unter ihrem Körper hatte viel davon aufgesogen, aber nicht alles.
»Der Täter hat wahllos auf sie eingestochen, wie ein Irrer«, sagte Sundermann leise. »Brust, Bauch, Hals, Arme, Hände – und dann der Kopf … sehen Sie sich den Kopf an …«
Der schwarze BH des Opfers war zwischen den Körbchen durchtrennt worden, doch der Stoff klebte an ihren blutverkrusteten Brüsten. Das halb zerfetzte Seidenleibchen wies mehrere Einstiche auf. Die Strapse waren noch immer straff gespannt. Den Slip hatte der Täter bis zu den Knien heruntergezogen. Auf dem Slip und den ebenfalls schwarzen Strümpfen darunter konnte man strahlenförmig angeordnete Blutstropfen sehen.
Multiple Schnitte und Stiche im Bauch- und Brustbereich, notierte Larsen und dachte, mindestens fünfundzwanzig, außerdem aktive und passive Abwehrverletzungen an beiden Händen mit zahlreichen Stichen in der Hohlhand. Offenbar hatte das Opfer versucht, dem Täter in die Klinge zu greifen, um den Angriff abzuwehren. Dazu sieben Stiche im rechten Oberarm und der rechten Schulter. Auf dem linken Arm deutlich erkennbare Blutantragungen. Linke Brust und Herzregion mit circa zehn Stichverletzungen, darunter Wunden mit schwalbenschwanzförmiger Ausbildung. Tatwaffe fehlt. Vermutlich einschneidiges Messer. Knapp über dem Bauchnabel horizontale Schnittverletzungen (drei, die längste circa 40 cm, alle kaum unterblutet). In gleicher Höhe am Rücken ebenfalls oberflächlicher, bogenförmiger Schnitt, fast genauso lang.
Der Kopf war beinahe abgetrennt worden. Tiefe, weit klaffende Schnitte führten an der Vorderseite des Halses von Ohr zu Ohr und reichten offensichtlich bis zur Wirbelsäule. Unterhalb der Kehle gab es weitere strichförmige Verletzungen, als hätte der Täter sie dort nur versuchsweise ritzen wollen.
»Das Schlimmste ist, dass ihr Mann sie so gefunden hat«, sagte Mareike.
Für ein paar Sekunden sah Larsen alles mit den Augen von jemandem, dem die Tote etwas bedeutete, der sie vielleicht sogar geliebt hatte – das Apartment, die Spuren des Kampfes, den leblosen Körper. Das Schlachtfeld, auf dem der Täter ein Leben beendet hatte. Er prägte sich jedes Detail ein, um sich später, wenn er auf den Tatortfotos damit konfrontiert wurde, besser daran erinnern zu können, was es bei ihm ausgelöst hatte, in dem Moment, als er die Anwesenheit des Mörders noch spürte. Er prägte es sich ein, und zur Sicherheit notierte er alles noch einmal in Stichpunkten auf seinem Block:
Rote Tulpen in umgefallener Blumenvase auf der runden Glasplatte des Couchtischs; vom Wasser aus der Vase aufgeweichte Illustrierte Stern, Hörzu; Messingständer mit zu drei Vierteln heruntergebrannter Kerze; Gläser auf der Kommode; Flaschen mit Selters, Rotkäppchen-Sekt und Smirnoff-Wodka, teilweise angebrochen; darüber an der Wand ein halbes Dutzend Gerten und Peitschen.
Er notierte, dass die Schubladen der Kommode aufgezogen waren und dass auf dem Boden davor eine leere Geldkassette lag, umgeben von Papieren, auf denen Blut klebte. Er hielt fest, dass die Schiebetüren des Kleiderschranks geöffnet waren; dass die Kleider, wahllos herausgerissen, davor einen kleinen Haufen bildeten. Er registrierte, dass der Fernseher ausgeschaltet war, im Radio aber leise Musik lief. Er notierte sogar den eingeschalteten Sender – Hansawelle von Radio Bremen. Über der Sessellehne liegt ein Hausmantel aus schwarzer Seide, schrieb er, sorgfältig abgelegt, nicht hingeworfen.
Auf dem rechten Arm der Toten befand sich ein Dildo, ebenfalls mit blutigen Griffspuren. Auch das schrieb er auf. Und er schrieb auf, dass neben ihr ein Tastentelefon (cremefarben) mit zerschnittener Schnur stand. Der Hörer steckte fast bis zur Hälfte in der Vagina von Monika Wilhelms.
Das Schlimmste ist, dass ihr Mann sie so gefunden hat.
Larsen legte Block und Stift auf die Kommode und beugte sich über den Körper, um seine Temperatur zu prüfen. Die Haut fühlte sich schon kalt an. Er drehte den Körper, bis er die Leichenflecke erreichen konnte, die sich mittlerweile an der Unterseite gebildet hatten. Mit dem Daumen drückte er auf das verfärbte Gewebe. Unter dem Druck wurde es blassweiß, doch als er losließ, nahm die Haut rasch wieder das dunkelviolette Rot der Flecken an. Danach versuchte er, Hände und Beine der Leiche zu bewegen. Die Totenstarre hatte sich schon im ganzen Körper ausgebildet.
Sechs bis acht Stunden, dachte er, maximal neun. Zeitpunkt des Todes also spätestens – er konsultierte seine Armbanduhr – 17 Uhr. Bevor er seinen Block zuklappte, schrieb er noch: Neben Bett weiße Wollsöckchen und braune Mokassins, kein Blut. Wohnung weitgehend durchsucht. Nirgendwo Geld, nur die leere Kassette.
»Wo sind ihre Schuhe?«, fragte er und sah zu Mareike auf. »Glaubst du, sie hat ihre Freier barfuß empfangen? So wie sie sonst angezogen war?«
Mareike sah sich um. An der Wand neben dem Perlenvorhang standen mehrere Paare – Stilettos, High Heels, Stiefel mit verschieden hohen Stulpen, aus Leder oder Lackleder, rot, schwarz, einige mit Metallnoppen –, alle in Reih und Glied. »Vielleicht hatte sie keine Zeit mehr, die passenden Schuhe anzuziehen.«
»Oder er hat sie ihr ausgezogen und mitgenommen«, warf Lenz ein. »Als Souvenir oder eine Art Trophäe.«
Vom Treppenhaus drang Lärm herein, ein Mann schrie etwas, das sich wie »Das ist doch Scheiße!« anhörte. Ein anderer redete beruhigend auf ihn ein. Kurz herrschte Stille, dann fing der erste wieder an. Es klang wie das Bellen eines Hundes. Larsen sagte: »Das ist ihr Mann, ich rede mit ihm. Deckt sie zu.« Ohne ein weiteres Wort verließ er den Raum und ging ins Treppenhaus, wo Armin Wilhelms völlig außer sich auf und ab ging. »Entschuldigen Sie, dass Sie warten mussten, Herr Wilhelms.«
Wilhelms bewegte sich mit großen Schritten auf ihn zu. Sein Gesicht war gerötet und verquollen. In der Hand hielt er ein leeres Wasserglas, das er Larsen vorwurfsvoll entgegenstreckte. »Ich darf nicht rein zu Monika, und nach Hause, wo meine Kinder warten, darf ich auch nicht! Seit einer Stunde werde ich hier festgehalten und –«
»Sie dürfen sofort gehen«, sagte Larsen. »Es tut mir leid, was mit Ihrer Frau passiert ist, und ich bin genauso erschüttert wie Sie über das, was ich da drinnen gesehen habe.« Der Täter hat uns in gewisser Weise zu Verwandten gemacht, dachte er. Durch den Mord an der Frau hat er ein Band zwischen diesem Mann und mir geknüpft, zwischen uns dreien, das erst zerreißt, wenn ich ihn gefasst habe. »Können Sie mir sagen, ob heute etwas anders war als sonst? Als Monika zur Arbeit gegangen ist, kam sie Ihnen da verändert vor? Oder hat sie etwas gesagt, zum Beispiel einen besonderen Kunden erwähnt, auf den sie sich freute oder der ihr unangenehm war?«
»Nein. Sie war wie immer.«
»Sie hatte auch keinen zusätzlichen Termin – einen außerhalb ihrer normalen Tätigkeit?«
»Was denn für einen Termin?«
»Arzt. Gesundheitsamt. Anwalt. Zuhälter. So was in der Art?«
»Monika hatte keinen Zuhälter.« Er versuchte, Haltung anzunehmen, Würde auszustrahlen. »Sie war schließlich Dolmetscherin, oder?«
Larsen nickte. »Hat sie irgendwann in letzter Zeit mal etwas erwähnt, dass sie verfolgt worden wäre – jemand, der ihr auf der Straße nachgegangen ist oder sie telefonisch belästigt hat?«
»Nein. Das hätte sie mir gesagt.«
»Gut, dann können Sie jetzt gehen. Entschuldigen Sie bitte, dass wir Sie aufgehalten haben. Es kann sein, dass wir noch weitere Fragen an Sie haben, deswegen möchten wir Sie bitten, sich zu unserer Verfügung zu halten.«
»Wann können wir die Monika – also, die Kinder und ich –«
»Sie erhalten von uns Bescheid.«
Wilhelms sah sich um, als wüsste er nicht, was er mit dem leeren Wasserglas machen sollte. »Ja, also … dann …«
Larsen nahm ihm das Glas aus der Hand und reichte es dem Kollegen von der Schutzpolizei. »Sollen wir Sie nach Hause bringen?«, fragte er.
»Nee, lassen Sie mal … Ich schaff das schon.« Wilhelms schüttelte den Kopf, als glaube er selbst nicht, was er eben gesagt hatte. Dann ging er langsam die Treppe hinunter, sehr aufrecht, Stufe für Stufe, ohne sich am Geländer festzuhalten.
Als Larsen wenig später das Haus verließ und die Berbenstraße entlangging, dachte er nicht mehr an den Ehemann. Er dachte über den Täter nach und darüber, dass er es nicht nur auf das Geld abgesehen hatte. Der zerschnittene Büstenhalter, der in die Scheide gerammte Telefonhörer, die Art und Menge der Stiche und Schnitte besagten, dass der Mörder etwas ausdrücken wollte. Er wollte sich durch die Tat selbst verwirklichen.
Ich muss herausfinden, worauf es ihm ankam, dachte Larsen; was ihm wichtig war. Zu jedem Schloss gibt es einen Schlüssel, und den werde ich finden, weil er ja irgendwo sein muss. Und wenn ich den Schlüssel habe, ist es nur noch eine Zeitfrage, bis ich auch weiß, wer das Schloss entworfen hat. Bloß einen Zeitvorsprung, sagte er in Gedanken zu dem Täter, mehr hast du in diesem Augenblick nicht. Aber die Zeit ist auf meiner Seite, das wirst du noch merken. Die Zeit arbeitet immer für mich.
5
Robert
Es war nicht so gewesen, wie er es sich vorgestellt hatte. Nichts davon. Er versuchte, sich an alles zu erinnern, immer wieder, aber er hatte Mühe, die Einzelheiten in die richtige Reihenfolge zu bringen – was genau geschehen war von dem Moment an, als er aus dem Bad gekommen war.
Es klappte einfach nicht.
Es war nicht wie in einem Film, wo ein Bild auf das andere folgte. Er ließ sich auch nicht mittendrin anhalten oder langsamer abspielen, damit er das Bild genauer betrachten konnte. Der große Bogen fehlte, und nicht nur das, auch manche Einzelheiten, bestimmte Augenblicke. Sie waren manchmal da – und im nächsten Moment verschwunden. Dann wieder fiel ihm ein Detail ein, aber er wusste nicht mehr, an welche Stelle es gehörte.
Er versuchte, all die verschiedenen Einzelheiten zu einem Film zusammenzusetzen, den er sich so ansehen konnte, wie er eigentlich sein sollte. Wie ein Cutter im Schneideraum einer Filmproduktion, der auch nur die Bilder hatte und keine Gefühle. Die Gefühle fehlten ihm am meisten: die Lust, der Rausch, die Erfüllung.
Sie fehlten, weil er sie nicht verspürt hatte. Er hatte erwartet, dass es sich so anfühlen würde wie in seiner Fantasie, wenn er sich auf das Wasserbett legte und spürte, wie sein Schwanz steif wurde. Wenn er sich ausmalte, wie er auf eine Frau einstach und sie winselte, bevor er wieder zustach. Und ein Bild führte zum nächsten, und dann wuchs seine Erregung mit jedem Stich, jedem Schrei. Aber in Moniques Apartment war alles viel zu schnell passiert; es war vorbei gewesen, bevor er es genießen konnte.
Er hatte sofort zugestochen, durch das schwarze Leibchen und dann durch die Haut und die Muskeln. Als die Klinge des Messers in den Bauch der Frau gedrungen war, hatte er ganz deutlich den kurzen Ruck gespürt, den Widerstand der Muskulatur. Der Griff war ihm fast aus der Hand gerutscht, weil er in Gedanken schon beim Blut gewesen war. Er hatte sich mehr auf das Blut konzentriert als auf das Bauchfell und deswegen das Messer nicht fest genug gehalten.
Bloß dass zuerst gar kein Blut gekommen war. Die Klinge steckte im Bauch der Frau fest, und er hatte daran gezogen und das Messer wieder herausgerissen, und auch da kam noch kein Blut.
Es lag an dem Stoff, dachte er. Der schwarze Stoff sog das Blut auf. Das Leibchen wurde nass, es hinderte das Blut daran, aus der Wunde zu schießen, wie er es erwartet hatte. Nur die Klinge war ein bisschen rot verschmiert, als hätte er sich mit dem Messer ein Marmeladenbrot bereitet. Er konnte sich an das Geräusch erinnern, das Reißen der Seide, das Durchtrennen der Haut und den stumpfen Laut, mit dem die Klinge dann unterhalb der Rippen stecken geblieben war. Aber vielleicht verwechselte er das mit dem überraschten Keuchen der Frau, das fast wie ein Rülpsen klang oder ein unterdrücktes Husten. Er war überrascht gewesen, dass sie nicht schrie, nicht beim ersten Zustechen.
Genau genommen hat sie gar nicht richtig geschrien, dachte er; nicht so, wie die Frauen in den Filmen immer schreien. Erst bei den nächsten Stichen, als das Blut gekommen war. Vielleicht war es der Anblick des Blutes gewesen, das aus ihren Wunden schoss, sobald er das Messer wieder herausgezogen hatte. Die Erkenntnis, dass es ihr Blut war, das auf seine Hand spritzte.