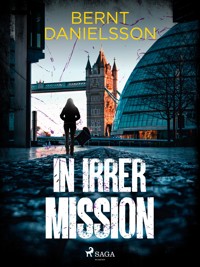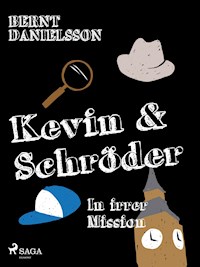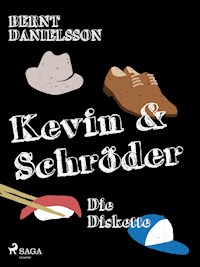Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Lindhardt og Ringhof
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Kevin & Schröder
- Sprache: Deutsch
Bei dem Jugendkrimi "Die Diskette" handelt es sich um den zweiten Teil der beliebten Krimi-Geschichten rund um das Detektivduo Kevin & Schröder von Schriftsteller Bernt Danielsson. Nach ihrem ersten Fall verabredet sich nach einiger Zeit das ungleiche Team zum Essen bei Schröder. Auch Lena war eigentlich eingeladen, doch anstelle der jungen Frau taucht ein kleiner Inder mit roter Pudelmütze auf und es soll sich dabei nicht um das letzte merkwürdige Ereignis an diesem Abend handeln...-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 256
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bernt Danielsson
Die Diskette
Übersezt von Regine Elsässer
Saga
Die Diskette
Übersezt von Regine Elsässer
Titel der Originalausgabe: Kevin & Schöder. Disketten
Originalsprache: Schwedischen
Coverbild/Illustration: Shutterstock
Copyright © 1995, 2021 Bernt Danielsson und SAGA Egmont
Alle Rechte vorbehalten
ISBN: 9788726922127
1. E-Book-Ausgabe
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit der Zustimmung vom Verlag gestattet.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - ein Teil von Egmont, www.egmont.com
1 Frohe Feiertage
„Für dich“, sagte meine Mutter. „Irgendeine Lena.“
Ich schluckte meinen Kaffee viel zu schnell und bekam einen äußerst peinlichen Hustenanfall.
„Lena?“ sagte mein Vater spitz. „Ist ja ganz schön was los hier, mein Gott. Was ist denn mit der anderen passiert?“
„Red keinen Unsinn“, sagte ich hustend und stand vom Sofa auf. Ich versuchte verzweifelt, wieder einen klaren Hals zu kriegen, und ging hinaus in den Flur. Ich nahm den Hörer auf, schluckte mehrmals und schnappte nach Luft, bis ich schließlich ein Art „Hallo?“ rausbrachte.
„Bist du es, Kevin?“ fragte eine Stimme, die ich nie vergessen werde, und wenn ich 97einhalb Jahre alt werden sollte. Es war die schönste Stimme, die ich je gehört hatte, und sie gehörte jemandem, dem ich, unglaublich aber wahr, das Leben gerettet hatte. Hustend und räuspernd sagte ich so etwas wie ja.
„Wie geht es? Hast du dich verschluckt?“
„Ja, genau“, sagte ich, und plötzlich hatte das Serviceteam der Rohrreinigungsabteilung den Fehler gefunden, der Husten war weg, und mein Hals wurde wieder klar und rein. „Hallo“, sagte ich und war froh, wieder meine normale Stimme zu haben.
„Frohe Feiertage, das sagt man doch. Wie waren die Weihnachtstage bei dir?“ fragte sie.
„Danke, halt so“, antwortete ich. Es hätte nicht viel gefehlt, und ich hätte mich auch noch verbeugt.
„Das klingt ja nicht besonders enthusiastisch.“
„Mir liegt nicht besonders viel an Weihnachten“, sagte ich.
„Also genau wie Schröder.“
„Wie geht es ihm eigentlich?“ fragte ich und merkte, daß ich ein bißchen sauer klang. Um ehrlich zu sein, ich war es auch, vor allem weil er seit fast drei Monaten nichts von sich hatte hören lassen. Das letzte Mal, als ich ihn sah, wurde er von zwei kräftigen Männern in weißen Arztkitteln durch den Ambulanzeingang des Danderyd Krankenhauses getragen, und ich hatte gedacht, er würde sich melden, wenn er sich wieder erholt hatte. Aber die Zeit verging, und ich hörte keinen Ton.
Sobald mein zermatschtes Knie wieder einigermaßen geheilt war und ich kleinere Spaziergänge schaffte, humpelte ich zu der Kreuzung, wo Mister Raymond Schröder mich und mein Moped mit seiner schrottreifen Dodge-Ram-Karre demoliert hatte. Nach einigem Suchen fand ich in den entlaubten und stacheligen Büschen doch tatsächlich meinen Walkman und die Kopfhörer. Sie waren natürlich beide hinüber, aber die John-Vollem-Kassette hatte überlebt.
Lena rief ein paar Wochen später einmal an, und wir redeten lange – ich weiß noch jedes Wort. Nachdem sie sich versichert hatte, daß es mir gut ging und mein verletztes Knie auf dem Weg der Besserung war, erzählte sie etwas vage von dieser Gangstermafia BEDA, aber ich hab nicht wirklich was davon verstanden, nicht viel mehr, als ich schon wußte.
Sie machte mir sehr deutlich, daß sie mit mir am liebsten nicht eingehender über ihre Arbeit sprechen wollte oder konnte – wie sie sagte. Ich glaube, sie hat hauptsächlich deshalb angerufen, um zu kontrollieren, daß ich mein Versprechen hielt und niemandem etwas erzählte. Sie richtete Grüße aus von Schröder und sagte, daß wir uns „bald“ treffen und zusammen essen müßten. Seither: kein Ton.
Ich war mit meinem total nigelnagelneuen Piaggiomoped ein paarmal abends an Schröders Häuschen vorbeigefahren, aber es war immer dunkel, und Bogart (wie er allen Ernstes seine Schrottschüssel nannte) stand auch nicht davor.
Dann war die Zeit nur so verflogen – unheimlich viel zu lernen im Endspurt vor den Weihnachtsferien, jede Menge albernen Streß mit einem Mädchen namens Martina (von der hatte auch mein Vater gesprochen) und dann an Weihnachten nach London zu den Großeltern. Das klingt vielleicht sehr spannend, aber Weihnachten ist in England genauso öde und anstrengend wie zu Hause. Für etwas war die Reise allerdings gut – sie half mir, von den allerschlimmsten alptraumhaften Erinnerungen an jene hektischen Oktobertage mit Schröder wegzukommen. Ich war sogar schon über Lena „hinweggekommen“ – obwohl ich noch ziemlich oft von ihr träumte, das muß ich zugeben. Ausgesprochen merkwürdige Träume, die ich nie irgend jemandem erzählen könnte.
„Doch“, sagte Lena und lachte. „Ihm geht es gut. Ich soll von ihm grüßen.“
„Er hätte ja mal anrufen können“, brummte ich beleidigt.
„Hast du ihn denn angerufen?“ fragte sie, und da ließ ich mich auf den kleinen, lederbezogenen Hocker plumpsen und sagte nichts mehr, denn ich hatte ihn natürlich nicht angerufen. „Na, ist ja auch egal“, sagte sie. „Manchmal ist es einfach so – die Zeit verrinnt irgendwie. Und man muß sich auch nicht eine Menge unnötiger „du mußt“ anziehen – davon hat man ja eh schon reichlich. Aber wie auch immer: Jetzt soll endlich dieses Essen steigen, das ich dir im Herbst versprochen habe, als kleines Dankeschön für deine Hilfe. Auch wenn ich dir nie richtig werde danken können – du hast mir ja tatsächlich das Leben gerettet.“
„Na ja“, sagte ich, als ob das gar nichts Besonderes gewesen wäre, aber gleichzeitig schauderte es mich heftig bei dem Gedanken daran, wie ich die nicht geladene Smith-&-Wesson-Knarre auf das Walroß geschleudert hatte, weil der mit seinem Gewehr auf Lena zielte.
„Und was wurde aus diesem Typ vom Verfassungsschutz unten in München?“ fragte ich.
„Das erzähl ich dir später. Ich will nicht am Telefon darüber reden, weißt du ...“
„Nee“, sagte ich und kam mir wieder mal so blöd vor, und außerdem war ich dankbar, daß wir nur telefonierten. Hört das denn nie auf, daß ich so unmöglich bin? dachte ich. Man sollte doch meinen, daß ich schon aus so was rausgewachsen bin. Oder schlage ich meinem Vater nach? Wenn das so ist, wird es wohl nie so weit kommen. Wunderbare Zukunftsaussichten ... „Paßt dir Freitag? So gegen sieben?“
„Doch, sicher. Bei dir zu Hause?“
„Nein, bei Schröder. Er hat versprochen zu kochen – und darüber kannst du nur froh sein, denn ich tauge auf diesem Gebiet nicht viel.“
„Also gut“, sagte ich und versuchte, nicht so enttäuscht zu klingen, wie ich mich fühlte.
„Gut“, sagte sie und lachte auf diese besondere Art, es klingt fast so wie eine schnurrende Katze. Mein Ohr wurde ganz warm, und ich bekam ein glühend heißes Gesicht.
Nachdem wir tschüs gesagt und aufgelegt hatten, blieb ich neben dem Telefon sitzen. Ich weiß nicht, woran ich dachte – an alles und nichts wahrscheinlich. In meinem Kopf wirbelten Gedankenfetzen, Überlegungen, John-Vollem-Stücke und Erinnerungen durcheinander. Und dann dachte ich plötzlich auch an Martina, schob den Gedanken jedoch ärgerlich beiseite und holte statt dessen das peinlich glitzernde Erinnerungsbild an Lena hinter dem Steuer des weißen Porsche hervor, draußen vor unserem Haus, an einem dunklen Abend im letzten Herbst.
„Was bist du nur für ein verdammt blöder Eimer!“ dachte ich mit Schröders höhnischer, rauher Stimme.
Mein Blick blieb an einem der Bilder an der Flurwand hängen – Schröder hatte an einem Oktobermorgen vor ungefähr hundert Jahren befunden, daß sie „absolut scheußlich“ seien. Ehrlich gesagt, ich muß ihm immer mehr recht geben. Ich habe sogar schon meiner Mutter vorgeschlagen, sie abzuhängen. „Aber das geht nicht, das mußt du verstehen, die Großmutter würde sonst sehr traurig werden“, hatte sie gesagt und mich richtig empört angeschaut. „Aber sie kommt doch höchstens einmal im Jahr her“, hatte ich gesagt, „und dann können wir sie ja wieder aufhängen.“ Aber dafür hatte sie keinerlei Verständnis.
Aus dem Wohnzimmer klang aufgesetztes Gejohle und Discomusik aus dem Fernseher. Es klang genauso bescheuert, wie es immer klingt, wenn sie versuchen einen „Jugendfilm“ zu drehen. Mein Vater lachte hingerissen – bestimmt benahm sich jemand daneben. So was findet er lustig.
„War das eure Aushilfslehrerin?“ fragte meine Mutter, als sie mit der Kaffeekanne an mir vorbeiging.
Ich nickte und brummte ein Ja. Als Lena vor einigen Monaten angerufen hatte, war meine Mutter auch am Apparat gewesen – ich weiß nicht, wie sie es macht, aber sie ist immer zuerst am Telefon –, und ich hatte behauptet, Lena sei eine Aushilfslehrerin.
„Hast du sie auch nach Weihnachten noch?“
„Ich weiß nicht“, sagte ich und dachte angestrengt nach. Ich mußte mir was einfallen lassen. Wir hatten vor, übers Wochenende zu den anderen Großeltern nach Västervik zu fahren. Und wenn ich bisher schon keine Lust gehabt hatte, mitzukommen, so hatte ich jetzt noch weniger Lust dazu. „Sie – sie macht einen Rundruf in unserer Klasse“, sagte ich.
Meine Mutter blieb in der Türöffnung zum Wohnzimmer stehen und schaute mich fragend an.
„Sie macht ein ... Fest. Jetzt am Freitag. Für unsere Klasse“, sagte ich und wich ihrem Blick aus.
„Mitten in den Ferien?“
„Ja, genau.“ Ich nickte. „Sie zieht ... ähm ... sie zieht um, ins Ausland. Und sie möchte, daß wir uns noch mal treffen, bevor sie abreist. Sie war ganz toll und ...“
„Aber sind denn nicht die meisten von euch verreist?“ fragte meine Mutter und ließ ihren Blick gleichzeitig zerstreut ins Wohnzimmer wandern und zum Fernseher, wo ein Mann sich gerade einem Mädchen näherte, das in einem schlecht erleuchteten Zimmer auf dem Bett lag.
„Nee, sie hat die meisten erreicht. Und es kommen auch alle“, log ich. „Kann ich nicht auch zu Hause bleiben? Ich finde es da unten sowieso sterbensöde, absolut nichts los und – tja, ich würde wirklich auch gerne auf das Fest gehen“, sagte ich bittend und holte meine zuckersüße „Mamas-guter-Junge-Stimme“ hervor. (Sie fällt meistens drauf rein.)
„Tja ... aber ruft sie nicht ein bißchen sehr spät an? Ich meine, heute ist schließlich Mittwoch. Sonst hätten wir ja auch erst nächstes Wochenende fahren können und ...“
„Ja, aber ...“ unterbrach ich sie, ohne zu wissen, was ich sagen sollte.
„Natürlich kannst du zu Hause bleiben“, sagte mein Vater vom Sofa aus und rettete mich völlig unerwartet.
„Aber ...“ wollte meine Mutter protestieren.
„Der Kaffee wird kalt“, sagte ich schnell.
„Was? Ach so. Ja, ja, dann bleib meinetwegen hier. Aber wo wohnt sie denn?“ fragte meine Mutter dann noch unruhig.
„Gleich da hinten“, sagte ich und zeigte mit der einen Hand in eine ungefähre Richtung. „Beim Hagbyvägen.“
Da wurde sie sofort wieder ruhiger. „Ach so, aber sieh zu, daß du auch wieder ordentlich nach Hause kommst und ...“
„Es ist doch erst am Freitag“, sagte ich seufzend. „Und ich kann inzwischen wirklich auf mich aufpassen.“
„Wie bitte? Ach so. Ja, natürlich. Aber wir sprechen morgen noch einmal darüber“, sagte sie und ging ins Zimmer.
„Willst du dir nicht den Film anschauen?“ fragte mein Vater, ohne den Blick vom Fernseher zu wenden.
„Das Buch war hundertmal besser“, sagte ich und lief die Treppe hoch.
Ich ging in mein Zimmer, stellte mich ans Fenster und starrte auf die Straße. Große, nasse Schneeflocken segelten durch das Januardunkel herab, wurden kurz vom Schein der Straßenlampe erleuchtet, bevor sie landeten und auf dem schwarzen Asphalt schmolzen. Ich stand ziemlich lange am Fenster, meine Gedanken ließen in der hundertsiebenundzwanzigsten Wiederholung die Ereignisse jener hektischen Tage vor ein paar Monaten ablaufen.
Was war denn überhaupt passiert?
Nachdem Schröder mich angefahren hatte, war alles so fürchterlich schnell gegangen – plötzlich war ich in lauter alptraumartige Situationen geraten, Schröder raste mit mir durch die Gegend, und wir versuchten herauszubekommen, was mit Lena geschehen war. Da glaubten wir noch, daß sie freie Journalistin wäre, die auf unerklärliche Weise verschwunden war.
Es stellte sich heraus, daß Lena keineswegs Journalistin war, sondern das nur als Deckmantel benutzte. In Wirklichkeit war sie so eine Art Geheimpolizistin, die irgendeiner Gangstermafia auf der Spur war. Die operierte unter dem Namen BEDA und war, nach außen gesehen, eine ganz normale Finanzierungsfirma, aber Lena hatte herausbekommen, was sie in Wirklichkeit machten, und als sie zu viel über ihre finsteren Machenschaften wußte, wurde sie gekidnappt. Aber Lena war nicht blöd und hatte alle wichtigen Informationen ausgesprochen pfiffig versteckt. Außerdem hatte sie alles in einer Art Code niedergeschrieben und dann auch noch den Codeschlüssel versteckt.
Es hätte richtig böse ausgehen können, weil Schröder sich blöderweise vom Walroß hatte an der Nase rumführen lassen, der behauptet hatte, Lenas Kollege Roger zu sein. Aber in Wirklichkeit war er ein gemeiner „Torpedo“, der wiederum von so einem Schurken angestellt worden war, der seinerseits die Macht bei BEDA an sich reißen wollte.
Ehrlich gesagt habe ich nicht richtig verstanden, wie alles zusammenhing, aber am Schluß habe ich doch tatsächlich Lena das Leben gerettet, indem ich das Walroß mit der Knarre außer Gefecht setzte. Aber zuvor hatte Schröder mich gezwungen, auf einer rostigen Leiter fünf Stockwerke hochzuklettern, ich wäre beinahe runtergefallen, und dann hat er mich auch noch dazu gebracht, ein Boot zu klauen ...
„Schröder, die Knallerbse“, sagte ich schließlich vor mich hin, aber so sehr ich mich auch bemühte, ich konnte nicht verhindern, daß ich mich einigermaßen darauf freute, ihn und Chandler wiederzusehen.
Und natürlich auch Lena ...
2 Hijiki, Wakame & Miso
Chandler stieß drinnen im Haus ein kurzes, explosionsartiges Bellen aus, als ich schließlich nach ewigem Suchen und Fummeln den Klingelknopf gefunden hatte, denn Schröder hatte natürlich kein Licht vor der Tür angemacht.
Nachdem meine Eltern endlich aus dem Haus waren, hatte ich einen wunderbaren Freitag verbracht, obwohl ich doch auch fand, daß die Zeit ziemlich langsam verging. Aber zwei Videofilme, ein Stapel alter Comichefte aus der Sammlung meines Vaters und eine Tüte Zimtschnecken hatten da Abhilfe geschaffen. Ich hatte mich gefühlt wie vor Jahren, als ob ich noch neun oder zehn Jahre alt wäre, und außerdem war es genau das richtige Wetter für diese Art von Beschäftigung gewesen: den ganzen Tag dunkel und Schneeregen. Irgendwie wünschte ich mir, daß ich mich immer so fühlen könnte, und gleichzeitig fand ich es auch peinlich und würde es nie vor meinen Klassenkameraden zugeben – oder gar vor Martina. Sie versuchte immer, so „erwachsen“ zu sein und würde bestimmt sagen, daß ich endlich aus diesem „kindischen Benehmen herauswachsen“ müßte – manchmal hatte ich den Eindruck, daß dies nur ein Beweis dafür war, wie kindisch sie eigentlich noch war. Dann fand ich auch wieder, daß sie völlig recht hatte.
Chandler polterte die Treppe runter und kratzte mit der Pfote innen an der Tür, immer noch wütend bellend.
„Schnauze, Chandler!“ brüllte Schröder von oben und kam mit lauten Schritten die Treppe runtergetrampelt. Innen wurde Licht angemacht, und ich hörte, wie er am Schloß herumfuhrwerkte und mehrmals laut fluchte, bis endlich die Tür mit einem lauten Knall aufging und mich beinahe umgeworfen hätte.
„Konbanwa!“ rief er mit einem breiten Grinsen und verbeugte sich tief.
„Was hast du gesagt?“
„Konbanwa – das ist guten evening auf japanisch. Ist das nicht unser Kevin, der Held?! Höchstselbst. Ja verdammt – lange her! Komm rein, mein Junge. Aber was hast du dich denn so vollgefressen über Weihnachten! Du bist ja richtig fett geworden. Nix gut. Überhaupt nix gut. In schwedischem Weihnachtsessen ist nur jede Menge schädliches Zeugs.“
„Es war englisches Weihnachtsessen“, murmelte ich.
„Noch schlimmer!“
Ich hatte, vorsichtig gesagt, gemischte Gefühle, als ich wieder in Schröders Hütte trat. Es kribbelte irgendwie unten im Bauch, und ich konnte nicht entscheiden, ob es Unlust, Unruhe oder eine Art Freude war. Aber wie ich es auch drehte und wendete, irgendwie war das überwiegende Gefühl, daß ich mich freute, wieder da zu sein. Es war genau wie mit Schröder selbst – von dem Moment an, als ich ihn das erste Mal getroffen hatte, hatte ich versucht, mich davon zu überzeugen, das einzig Vernünftige wäre zu kapieren, daß er das größte Knallblättchen des Jahrhunderts war, und sich dann in größtmöglicher Entfernung von ihm aufzuhalten. Aber irgendwo tief drinnen (so weit drinnen, daß ich manchmal das Gefühl hatte, die wirklich wichtigen Gefühls- und Gedankenzentren sind im Bauch und keineswegs im Kopf lokalisiert) mochte ich ihn einfach gern, wie sehr ich auch das Gegenteil versuchte.
„Du solltest draußen Licht machen, damit man was sieht“, brummte ich und zog die Tür hinter mir zu, nicht ohne ein hastigen Blick auf ihn zu werfen.
Er sah aus wie immer. Die gleichen struppigen, dunklen, kleingelockten Haare, das gleiche breite Grinsen, er schien sogar den gleichen Dreitagebart wie beim letzten Mal zu haben. Über einem schmutzigen Hemd mit einer Art Südseemotiv in Rot, Gelb, Grün und Lila trug er eine unglaublich verkleckerte Küchenschürze, auf der stand „NEVER STOP THE ACTION“ – und ich erinnerte mich, daß er damals, als er seine „Gymnastikübungen“ gemacht hatte, ein T-Shirt mit dem gleichen Text getragen hatte. Ob das wohl auch auf seinem Bademantel steht, dachte ich. Und auf seinen Unterhosen? Würde mich überhaupt nicht wundern, antwortete ich mir in Gedanken und versuchte, die Tür zuzumachen, aber wie ich auch zog, es ging nicht, sie schien irgendwie nicht in den Türrahmen zu passen.
„Man soll keinen Strom verschwenden“, sagte er fröhlich. „Wart, ich mache die Tür zu. Offenbar bin ich der einzige, der das kann. Ich versteh gar nicht, daß das so schwer sein soll.“ Er drückte die Klinke herunter, drehte am Schloß, so daß der Schließkloben ins Schloß fuhr, dann zog er die Tür heftig zu und ließ gleichzeitig die Klinke los. „So, geht doch ganz einfach!“
„Ist Lena noch nicht da?“ fragte ich.
„Nee, aber don‘t worry, mein Junge. Sie kommt. Ich muß nach dem Essen sehen. Mach das Licht aus, wenn du raufgehst“, sagte er und rannte die Treppe hoch.
Chandler blieb unten, legte sich auf den Fußabstreifer und blickte mich mit seinen traurigen Augen an, als ich mir die Handschuhe auszog.
Die Halle sah auch aus wie damals. Ich hatte den Eindruck, als ob noch genauso viele kaputte oder reparaturbedürftige Schuhe herumlagen. Aber zwischen aufgeplatzen Holzschuhen und einzelnen, verdreckten Stiefeln thronten ein Paar ochsenblutrote Schuhe mit knallgelben Schnürsenkeln mitten unter der Deckenlampe. Sie waren frisch geputzt, hatten dicke Gummisohlen und waren mit einer Art Lammfell gefüttert. Offenbar hatte er sie gerade neu gekauft. An den Wänden standen natürlich jede Menge umgedrehte Bilder – oder Spannrahmen, wie es wohl richtig heißt.
Aus dem oberen Stockwerk war metallisches Klappern zu hören, Schröder fluchte ausgiebig, verstummte plötzlich und sang dann mit grölender Stimme: „The summerwind, came blowing in, from across the sea!“
Auf den zwei untersten Brettern des Bücherregals quetschten sich immer noch jede Menge Exemplare von Schröders eigenem Roman „Guten Tag, guten Tag“. Ich hatte nur die erste Seite gelesen, aber das hatte mir völlig gereicht, ich hatte sofort eingesehen, daß ich es nie schaffen würde, ihn ganz zu lesen, und schon gar nicht, ihn zu verstehen. Jetzt kam mir plötzlich, daß ich doch noch einen Versuch hätte machen sollen. Es könnte ja sein, daß Schröder mich fragt, wie ich ihn gefunden hätte, und das wäre peinlich. Aber vielleicht hatte er vergessen, daß er mir das Buch geschenkt hatte.
„Und wie geht es dir?“ fragte ich Chandler. Er hob den Kopf und blinzelte mich mit seinen kleinen, schwarzen Augen an, die hinter dem langen, strubbeligen Fell glänzten. Er brachte ein irgendwie jaulendes Geräusch heraus, aber es war nicht möglich, festzustellen, ob er damit meinte, es ginge ihm gut, oder ob er sagen wollte, das Leben mit Schröder sei schon ziemlich beschwerlich. Ich zog Lederjacke und Schal aus und legte sie auf einen von den Bilderstapeln.
„Da-da-dada, da-dada – it lingered there, touched your hair and walked with me!“ grölte er von oben.
Ob ich wohl auch die Schuhe ausziehen sollte? Sie waren ziemlich durchgeweicht, weil Schröder auf dem Gartenweg natürlich keinen Schnee geräumt hatte. Ich hatte mich durch zentimeterdicken Schneematsch zum Haus durchkämpfen müssen. Mein Moped hatte ich unten in der Einfahrt an Bogart, die Schrottlaube, gelehnt.
Andererseits war ich nicht sicher, ob ich Lust hatte, in Schröders Wohnung mit meinen neuen, weißen Weihnachtssocken rumzulaufen. Ich suchte mir aus dem Schuhwirrwarr auf dem Boden ein Paar mit Farbe verkleckerte, schwarze chinesische Pantoffeln heraus. Sie waren zwar ein paar Nummern zu groß, paßten aber trotzdem recht gut.
„Hast du immer noch keine Ahnung von Sinatra?“ rief er aus der Küche.
Chandler trottete mir hinterher, als ich die gewundene Treppe hochging und in Schröders kombiniertes Atelier-Bibliotheks-Wohnzimmer kam.
Auch hier sah fast alles aus wie beim letzten Mal – die Staffelei stand immer noch an den beiden großen Fenstern, und das Parkett drumherum war noch verkleckster mit allen möglichen Farben. Die Bücher in den Regalen an der einen Längswand waren weder abgestaubt noch geordnet worden, und natürlich standen überall große Stapel mit Bildern. Bestimmt ein paar hundert, dachte ich. Und alle waren groß, mindestens eineinhalb Meter hoch. Und genau wie vor ein paar Monaten stand kein einziges Bild mit der Bildseite nach vorne, sondern sie waren gegen die Wand gelehnt, die ihrerseits weiß angestrichen und völlig kahl war.
Aber in der Mitte des großen Zimmers auf dem Boden stand etwas, was es damals nicht gegeben hatte – ein Unmenge von Prozellanschälchen, quadratischen Tellern und becherartigen Gefäßen. Sie waren verteilt auf etwas, das aussah wie eine große, zehn Zentimeter dicke, schwarz angestrichene Spanplatte. Ich hatte keine Zeit, nachzudenken, was es sein könnte, weil Schröder mit einem Tablett aus der Küche kam, auf dem noch einmal vier Schalen mit Deckel standen.
„Toll, nicht?“ Er grinste zufrieden und ließ eine brennende Zigarette im Mundwinkel wippen.
„Was ist das?“ fragte ich verwirrt.
Er schaute mich lange an und schüttelte dann den Kopf. „Ja, Kevin, verdammt, du bist auch noch ganz der alte! Was ist das?! Ha, ha, das ist ein Eßtisch, das sieht man doch. Was hast du denn gedacht – ein Rauschenberg vielleicht?“ Er blies mir den Rauch ins Gesicht, und ich machte schnell einen Schritt zur Seite.
„Rausch – was?“ fragte ich.
„Rauschenberg. Der Künstler. Vom dem die Ziege mit dem Autoreifen im Modernen Museum ist, die kennst du doch hoffentlich?“
„Ähm, nein ...“ murmelte ich. „Aber warum hat er denn keine Beine?“
Schröder ließ sich auf die Knie nieder und stellte die Schalen neben die quadratischen Teller. Er unterbrach sein Tun und schaute mich an, nahm einen tiefen Zug aus seiner Zigarette und blies den Rauch an die Decke.
„Heute bist du wirklich lustig, Kevin! Siehst du denn nicht, daß dies ein japanischer Eßtisch ist? Wir werden japanese essen, Mister! Und da muß man auf dem Boden sitzen, sonst schmeckt es nicht so gut. Frag mich nicht, warum, es ist einfach so. Es hat vielleicht etwas mit der Größe der Japaner zu tun, was weiß ich. Wie auch immer, man setzt sich mit gekreuzten Beinen auf so etwas“, sagte er und zeigte auf einen Stapel schwarzer, kissenähnlicher Teile, die an der Wand aufgestapelt waren.
„Essen wir auch mit Stäbchen?“ Ich kicherte und fand mich richtig lustig.
„Selbstverständlich“, sagte er so ernst, daß mir das Kichern im Halse stecken blieb. „Natürlich benützen wir hashis.“
„Hashis?“
„Stäbchen. So heißen die auf japanisch. Setz dich, damit ich dich anschauen kann. Wie geht es dir? War ganz schön was los da draußen in Djursholm, damals vor ein paar Monaten. Kannst du dich noch daran erinnern?“
Als ob ich das jemals vergessen könnte, dachte ich und holte mir so ein Kissen. Ich setzte mich zögernd an den Tisch, verschob das Kissen so, daß ich mich an die Wand neben dem offenen Kamin lehnen konnte. Ich schaute erstaunt die Schälchen an – ich hatte noch nie so viele verschiedene Schälchen auf einmal auf einem Tisch gesehen. Schröder grinste mich erwartungsvoll an. „Ähm, tja ...“ murmelte ich zögernd. „Doch, es geht mir ganz gut.“
„Hast du noch Tore im Handball geschossen?“
Ich nickte. „Vorgestern haben wir gegen Bergshamra gespielt. Und wir haben wieder gewonnen, mit fünf Toren, drei davon habe ich gemacht.“
„Und wie geht es deinem verdammten Knie?“ Er grinste und drückte die Zigarette in einem der kleinsten Schälchen aus.
„Gut, jetzt wieder gut. Aber es war richtig ...“ fing ich an, wurde aber sofort von Schröder unterbrochen:
„Wart einen Moment, ich muß nach dem Hijiki sehen.“
„Hi-was?“
„Hijiki. Meeresalgen. Verteufelt gut. Und gesund. Ja, Kevin, heute abend wirst du das exquisiteste japanische Essen bekommen, nicht einmal die Japaner sind ohne weiteres in der Lage, so zu kochen.“
„Ich habe nicht gewußt, daß du ... ähm ... auch japanisch kochen kannst.“
„Na selbstverständlich. In diesem Punkt bin ein richtiger Japanexperte. Ich bin doch dort gewesen.“
„In Japan?“ fragte ich erstaunt.
„Ja sicher.“ Er nickte. „Ich habe drei Ausstellungen gehabt. In Tokio, Osaka und Beppu. War ein phantastischer Durchbruch, wirklich, sowohl künstlerisch als auch ökonomisch. Die kleinen Gelbhäute haben heutzutage ja reichlich Kohle.“
„Bist du denn lange dort gewesen?“
„Na ja, zwei Wochen und drei Tage, um genau zu sein“, sagte er.
„Und in so kurzer Zeit bist du Experte im Kochen geworden?“ fragte ich grinsend.
„Wenn man so ein schlaues Kerlchen wie ich ist, dann braucht man nicht länger. Ich meine im Unterschied zu den normalen Touris. Du weißt schon, wen ich meine. Die fliegen mit Charter nach Saint Emillion und fragen den Kellner im ersten besten Restaurant, ob sie eine Karaffe Rioja Tinto kriegen können.“
Ich verstand überhaupt nicht, was er meinte, und vermutlich sah man mir das auch an.
„Ja, oder die nach London kommen und im Pub ein Pint Becks bestellen. Aber ist ja auch egal, wie spät ist es eigentlich?“
„Viertel nach sieben“, sagte ich.
„Verfluchte Lena. Früher war sie die Pünktlichkeit in Person“, sagte er und ging weg.
Ich nahm die kleine schwarze Schale, in der immer noch seine Kippe glimmte und stinkenden Rauch verbreitete, und folgte ihm. Verblüfft blieb ich in der Türöffnung stehen.
Da drinnen herrschte das reine Inferno. Auf den vier Kochplatten standen Töpfe, in denen es köchelte. Es zischte, und Dampf stieg aus den kleinen Luftlöchern der Deckel. Die Ablage daneben war vollgestellt mit Flaschen, Gläsern, Schachteln und jeder Menge verschiedenfarbiger Plastiktüten. Auf einer stand Wakame, und auf einer lilafarbenen, die auf den Boden gefallen war, stand Hijiki. Auf dem rotweiß gestreiften Teppich vor dem Herd lagen ganz viele kleine schwarze, wurmähnliche Dinger, die eigentlich ziemlich eklig aussahen.
Schröder hatte den Kühlschrank aufgemacht und suchte mit fahrigen Bewegungen in dem Chaos da drinnen. „Wo ist verdammt noch mal das Miso?“ knurrte er.
Ich stellte den Aschenbecher auf die Spüle, zog den einen Stuhl am Küchentisch heraus und setzte mich. „Du?“ fragte ich.
„Was ist?“
„Weißt du eigentlich, wie das mit diesem Schurken weitergegangen ist?“
„Mit welchem?“
„Na du weißt schon, der in München. Dieser Ex-Geheimdiensttyp, der Boß von BEDA, den Lenas Kollegen noch am gleichen Tag festnehmen wollten?“
Er schob einige große Plastikflaschen beiseite, die aussahen wie Ein-Liter-Cola-Flaschen.
„Ich hätte nichts gegen ein Glas Cola“, sagte ich.
Er erstarrte am ganzen Körper und sein Kopf drehte sich langsam zu mir um.
„Cola?! Coca-Cola?! Ich soll so ekliges Imperialistengesöff in meinem Kühlschrank haben?!“
„Aber was ist es dann?“
„Japanisches Soja natürlich. Yamasha und Kikkiumans Usukuchi.“
Er schob vier weiße Plastikbehälter, die übereinander standen, beiseite. „Miso, Miso, Miso – jetzt wollen wir mal sehen. Also, ich weiß zwar nicht, was passiert ist oder wer sich blamiert hat, aber das Ganze ging voll in die Hose, und dieser Typ konnte im letzten Moment entkommen. Und dann gab es jede Menge Probleme, sowohl hier oben in Stockholm als auch unten in Deutschland, während ich in Japan war. Aber es ist bestimmt besser, wenn Lena das selbst erzählt. Sofern sie überhaupt etwas erzählen kann, sie hat ja Schweigepflicht. Und ich natürlich auch.“
„Was?“
„Ja, als Arzt.“
„Wann warst du in Japan?“ fragte ich schnell, damit er nicht wieder einen Haufen Quatsch erzählen konnte, daß er Arzt sei und so.
„Im Dezember“, sagte er. „Yeah! Da ist es! Aber ich war zuerst unten in Dänemark. Auf Jylland. Ich bin sofort hingefahren, nachdem ich diesen verdammten Idioten im Krankenhaus entkommen war, gleich einige Tage nach dem großen Walroßdesaster.“
„Was hast du dort gemacht?“
„Ich wollte malen wie der Teufel, übers Leben nachdenken und mich gleichzeitig ein bißchen erholen – aber das ging alles nicht“, sagte er und knallte die Kühlschranktür zu.
„Nee, nee“, sagte ich und versuchte, meiner Stimme einen verärgerten Unterton zu geben.
Er blieb plötzlich stehen und hatte eine Plastiktüte mit irgendeiner weißen Paste in der Hand. Ich fand, es sah ungefähr wie Marzipan aus. Er schaute mich ernst an. „Ja, ja, ich weiß, – ich hätte anrufen sollen. Aber ... ich hatte kein Telefon, verstehst du. Ich wohnte direkt am Meer, in einer riesigen Scheune mit Plumpsklo. Aber ich habe an dich gedacht, jeden Tag. Wie es dem guten Kevin wohl geht, dachte ich. Und dann habe ich wirklich einmal angerufen, als ich aus Japan zurückkam.“
„Da war ich bestimmt in England“, sagte ich. „Bei meinen Großeltern.“
„Ich habe sogar ganz oft angerufen“, fuhr er eifrig fort und wühlte in der übervollen Spülschüssel, bis er schließlich einen Löffel gefunden hatte. „Und ich habe schon angefangen, mir Sorgen zu machen, als nie jemand antwortete.“ Er betrachtete kritisch den Löffel und roch an ihm. „Ist nur alter Bornier-Senf“, konstatierte er und hob den Deckel von einem der Töpfe. Ich werde jetzt nur das Hijiki, das in Sesamöl geschmort wurde, mit etwas Miso abschmecken, dann ist das Meisterwerk fertig.“
„Miso?“
„Ha! Das reinste Wunder in der Küche, mein Junge, was heißt schon Bouillon – pah! Knorr kann sich am Schwanz ziehen. Das ist was, mein Junge! Die Japaner haben nämlich eine ganze Menge in ihren kleinen gelben Köpfen, das kann ich dir sagen.“
„Aber was ist es denn?“
„Ähm, ich, also, es ist ...“ Er drehte die Plastiktüte um und las: „Es ist Marukura Organic wajt Miso. Tsultured Rajs änd Sojabin ...“
„Cultured“, korrigierte ich mit übertriebener englischer Aussprache und merkte im gleichen Moment, daß er seine Aussprache natürlich genauso übertrieb. Ich spürte, wie mir heiß im Gesicht wurde, und ärgerte mich wahnsinnig über mich, weil ich rot wurde. „Laß mich lieber selbst lesen“, sagte ich schnell.
„Sei nicht so giftig, mein Junge! Ich kann schließlich nichts dafür, daß ich keine englische Mutter habe – da ist es schließlich keine Kunst. Und für Tomatenmark habe ich in meiner Küche keine Verwendung, damit das klar ist.“
Ich wollte mir gerade etwas richtig Gemeines als Antwort ausdenken, als es an der Tür klingelte und Chandler laut zu bellen anfing.
„Ah, jetzt kommen sie“, rief Schröder. Geh runter, und mach ihnen auf.“
„Kommen sie?“
„Ja, Lena und Norling.“
„Norling?“
„Ja, erinnerst du dich nicht mehr an den alten Jörgen? Den Maler Klecksel? Den wir besucht haben? Lenas Onkel? Sie wollte ihn auf dem Weg hierher abholen – beziehungsweise auf dem Umweg. Ich werde dem Alten mal ein paar Bilder zeigen, damit er weiß, wie Bilder auszusehen haben.“
Natürlich erinnerte ich mich an den total durchgedrehten Künstler Norling – und ich konnte mir sehr gut vorstellen, wie es werden würde, wenn er und Schröder gleichzeitig loslegten. Diese Art von Abendessensgesellschaft wollte mir nicht so recht gefallen. Ein Glück, daß Lena auch dabei ist, dachte ich.
„Jetzt geh schon runter, und mach auf! Du bleibst hier, Chandler!“