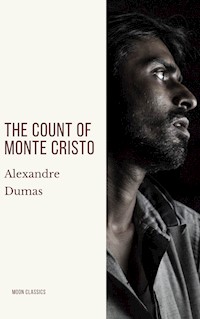Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: nexx classics – WELTLITERATUR NEU INSPIRIERT
- Sprache: Deutsch
Im Jahr 1625 zieht der junge d’Artagnan nach Paris, um sich der Garde der berühmten Musketiere anzuschließen. Schnell gewinnt er die Freundschaft der drei unzertrennlichen Musketiere Athos, Porthos und Aramis. Getreu ihrem Motto »Einer für alle, alle für einen« verteidigen sie ihre Königin gegen die Intrigen des Kardinals Richelieu. Dumas' historischer Roman verbindet historische Ereignisse mit fiktiven Abenteuern und zählt nach wie vor zu den populärsten und spannendsten der Weltliteratur.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alexandre Dumas
Die drei Musketiere
Band 1
Impressum
Cover: Gemälde "Musketiere in altdeutscher Stube" von K. Vollmar
Covergestaltung: nexx verlag gmbh, 2015
ISBN/EAN: 9783958702240
Rechtschreibung und Schreibweise des Originaltextes wurden behutsam angepasst.
www.nexx-verlag.de
Die drei Geschenke des Herrn d'Artagnan
Am ersten April-Montag des Jahres 1625 schien es im Marktflecken Meung so drunter und drüber zu gehen, als ob über Nacht die Hugenotten gekommen wären, um ein Bollwerk wie La Rochelle daraus zu machen. Zahlreiche Spießbürger hatten, als sie Weiber auf der Flucht durch die Hauptstraße sahen und Kinder auf den Schwellen schreien hörten, nichts Eiligeres zu tun, als sich den Kürass (Brustharnisch) umzuschnallen und sich durch eine Muskete oder Partisane ein gewichtigeres Aussehen zu geben und zum Gasthof Zum Freimüller zu rennen, vor dem sich ein dichter Haufen versammelte, der wild lärmte und sich mit jeder Minute verstärkte. Damals war solche Panik keine Seltenheit, und es verstrich kaum ein Tag, ohne dass in der oder jener Stadt ein solcher Vorfall in der Ortschronik zu verbuchen war. Gab es doch hohe Herren vom Adel, die fortwährend Händel miteinander hatten; lag doch der König in ständiger Fehde mit dem Kardinal, und hatte doch Spanien erst eben wieder Frankreich den Krieg erklärt. An Diebsgesindel und Bettelvolk war kein Mangel, und Hugenotten, Wölfe und Lakaien-Pack sorgten auch dafür, dass das Land nicht zur Ruhe kam. Die Bürgerschaft schlug sich mit dem Diebsgesindel, den Wölfen und dem Lakaien-Pack herum, erhob die Waffen zuweilen wider die Herren vom Adel und wider die Hugenotten, nur selten einmal wider den König, niemals aber wider den Kardinal und die Spanier. Aus dieser Gepflogenheit ergab sich demzufolge, dass die Meunger Philister, als sie an besagtem April-Montag Spektakel hörten, ohne weder die gelb und rote Standarte, noch die Livree des Herzogs von Richelieu zu sehen, sich eilig zum Gasthof »Zum Freimüller« begaben.
Dort konnte ein jeglicher die Ursache dieses Lärmens sehen und kennenlernen, die niemand anders war als ein junger Mensch – ein Don Quichotte von 18 Jahren, ohne Panzer und Beinschienen, aber in einem wollenen Wams, dessen blaue Farbe sich in eine unbestimmbare Schattierung von Weinhefe und Himmelblau verwandelt hatte; mit länglichem, braunem Gesicht, hervorspringenden Backenknochen als Merkmal von Pfiffigkeit, stark entwickelten Kiefern, dem untrüglichen Kennzeichen eines Gascogners, auch wenn er kein mit einer Feder geschmücktes Barett aufhatte. Das war bei dem jungen Mann jedoch der Fall; außerdem hatte er ein offenes, kluges Auge und eine Hakennase, und war von Figur für einen Jüngling zu groß, für einen ausgewachsenen Mann aber zu klein. Wäre nicht der lange Degen gewesen, der ihm am Wehrgehänge baumelte und ihm beim Gehen wider die Waden, beim Reiten wider das Fell seines Gaules schlug, so hätte ihn ein schwach geübtes Auge für einen unterwegs befindlichen Gutspächtersohn gehalten.
Unser junger Mann war aber beritten, und sein Gaul hatte ebenfalls ein so merkwürdiges Aussehen, dass er auf den ersten Blick in die Augen fiel: es war nämlich ein Klepper, der wenigstens seine zwölf bis vierzehn Jahre auf dem gelblichen Fell hatte, mit einem Stummel von Schweif ohne Haare, aber mit Beinen voller Schwären; ein Klepper, der beim Laufen den Kopf bis zu den Knien hinunterbaumeln ließ, immerhin aber noch gut und gern seine acht Meilen am Tag machte. Leider aber steckten die trefflichen Eigenschaften dieser Rosinante so tief unter ihrer absonderlichen Haut und hinter ihrem wackligen Trott, dass zu einer Zeit, wo jedermann mit Pferden Bescheid wusste, ihr Auftreten in Meung, kaum dass sie zum Tor herein war, ein so unliebsames Aufsehen machte, dass es nicht ohne Rückwirkung auf den Reiter selbst bleiben konnte.
Und für den jungen d'Artagnan – denn so hieß der Don Quichotte dieser wiedererstandenen Rosinante – war dieses Aufsehen umso peinlicher, als er sich über den lächerlichen Anstrich, den ihm als einem so stattlichen Kavalier ein solcher Gaul geben musste, durchaus nicht im unklaren war. Wusste er doch recht gut, dass ein solcher Gaul unter Brüdern seine zwanzig Livres, wenn auch knapp, wert war, während andrerseits die Worte, die dieses Geschenk begleitet hatten, sich jeglicher Schätzung entzogen... »Mein lieber Sohn«, hatte der gascognische Edelmann gesagt, der des Jünglings Vater war, »dies Pferd hat das Licht der Welt vor nunmehr dreizehn Jahren im Haus deines Vaters erblickt und hat seitdem einen Bestandteil von dessen festem Inventar gebildet: ein Grund also für dich, ihm deine Liebe zu schenken! Verkaufe es niemals, sondern lass' es in Ruhe und Ehren alt werden und zu seinen Vätern eingehen. Ziehst du mit ihm ins Feld, dann gehe rücksichtsvoll mit ihm um wie mit einem greisen Diener. Und wenn du«, sprach Herr d'Artagnan weiter, »einmal die Ehre hast, bei Hofe zu erscheinen – eine Ehre, auf die dir übrigens dein alter Adel ein Anrecht gibt – dann halte auch du den Namen, der von deinen Ahnen fünfhundert Jahre lang in Ehren geführt worden ist, in Ehren für dich wie für die Deinigen. Darunter verstehe ich nicht allein deine Verwandten, sondern auch deine Bekannten und Freunde. Lass' nie etwas auf dir sitzen, außer von Seiten des Kardinals und des Königs. Allein durch seinen Mut – verstehe mich recht – nur durch seinen Mut kann es heute ein Edelmann zu etwas bringen. Wer auch nur eine Sekunde bebt, lässt vielleicht den Köder sich entwischen, den ihm das Glück just während dieser Sekunde hinhielt. Du bist jung und sollst tapfer werden aus zweierlei Gründen: erstens, weil du ein Gascogner, und zweitens, weil du mein Sohn bist. Fürchte nicht die Gelegenheiten und gehe keinem Abenteuer aus dem Wege! Den Degen zu führen, habe ich dich gelehrt; du hast eine Kniebeuge von Eisen und einen Handschuh von Stahl; schlage dich bei jeglichem Anlass; schlage dich umso eifriger, als der Zweikampf verboten ist und es demgemäß doppelt so viel Mut erheischt, sich zu schlagen. Mehr als fünfzehn Taler kann ich dir nicht mitgeben, lieber Sohn, außer meinem Pferd und den eben vernommenen Ratschlägen. Die Mutter wird dir noch das Rezept zu einer bestimmten Salbe beifügen, das sie von einer Zigeunerin bekommen hat und das die wunderbare Eigenschaft besitzt, jede Wunde zu heilen, außer solchen, die das Herz betreffen. Ziehe aus Allem den rechten Nutzen, und lebe glücklich und lange! – Ein Wort noch! Ein Beispiel will ich dir noch vor Augen halten, nicht mein eigenes, denn ich bin niemals bei Hofe gewesen und habe die Religionskriege bloß als Freiwilliger mitgemacht – aber vom Herrn von Tréville lass' dir erzählen, der früher mein Nachbar war und die Ehre gehabt hat, als kleines Kind mit unserm König Ludwig XIII., den Gott erhalten möge, zu spielen! Hin und wieder geschah es, dass ihre Spiele zu Kämpfen ausarteten, in denen der König nicht immer der Stärkere war. Die Prügel, die der König dann bekam, setzten Herrn von Tréville bei ihm in Respekt und weckten in seinem königlichen Herzen ein Gefühl von Freundschaft für ihn. Herr von Tréville hat sich auf seiner ersten Reise nach Paris fünfmal mit andern duelliert; seit dem Tod des hochseligen Königs bis zur Volljährigkeit des jungen Königs, die Kriege und Belagerungen nicht gerechnet, weitere siebenmal; und von der Volljährigkeit Seiner jetzt regierenden Majestät bis zum heutigen Tag vielleicht hundertmal!... Und heute ist er trotz aller Erlasse, Verordnungen und Verurteilungen Hauptmann der Musketiere. Das ist, mein Sohn, eine Cäsaren-Legion, vor der Seine Majestät der König gewaltigen Respekt, und seine Eminenz der Kardinal gewaltige Furcht hat, wie man im Land weiß. Obendrein bekommt Herr von Tréville im Jahr bare zehntausend Taler, ist also ein hoher Herr. Angefangen hat er wie du; suche ihn mit diesem Schreiben auf und mache es wie er, damit es dir so gut gehe wie ihm!«
Damit schnallte der alte Herr d'Artagnan seinem Sohn seinen eigenen Degen um, küsste ihn zärtlich auf beide Wangen und gab ihm seinen Segen. Als der Sohn das väterliche Zimmer verließ, gab die Mutter ihm das berühmte Salbenrezept, das er, wenn er nach den eben gehörten Ratschlägen zu handeln vorhatte, wahrscheinlich sehr oft brauchen musste.
Dieser Abschied wurde länger und zärtlicher als der erste, woraus aber nicht gefolgert werden darf, als ob Herr d'Artagnan keine Liebe zu seinem Sohn, dem einzigen Sprössling aus seiner Ehe, im Herzen getragen hätte: aber er war ein Mann und hätte es für seiner unwürdig gehalten, viel Rührung zu zeigen. Frau d'Artagnan dagegen war nicht bloß Frau, sondern in weit höherem Grade noch Mutter und schämte sich demgemäß der Tränen nicht... und zum Lobe des jungen Herrn d'Artagnan muss hier gesagt werden, dass er es zwar an Anstrengungen, fest zu bleiben, wie es sich für einen künftigen Musketier schickte, nicht fehlen ließ, der Natur aber doch nicht standhalten konnte, sondern auch zu weinen anfing, und dass es ihm schwer genug wurde, wenigstens den kleineren Teil seiner Tränen hinunterzuschlucken. Ausgerüstet mit den drei väterlichen Geschenken: den fünfzehn Talern, dem Gaul und dem Brief für Herrn von Tréville, machte sich der junge Mann am nämlichen Tag auf den Weg; die guten Ratschläge waren ihm, wie man begreifen wird, dreingegeben worden. Mit solcher Wegzehrung stellte also der junge Herr d'Artagnan in moralischer und physischer Hinsicht ein getreues Konterfei des Cervantesschen Helden dar: und während der edle Don Quichotte Windmühlen für Riesen und Schafherden für Armeen hielt, fasste der edle d'Artagnan jedes Lächeln als einen Schimpf und jeden Blick als eine Herausforderung auf. Hieraus folgte, dass er von Tarbes bis Meung die Faust unentwegt geballt hielt und wenigstens zehnmal am Tag damit an den Degenknopf schlug. Indessen fuhr die Faust kein einziges Mal unter eine Kinnlade und der Degen kein einziges Mal aus der Scheide, wiewohl es an spöttischen Blicken auf die Rosinante, die er ritt, wahrlich nicht fehlte. Da aber über ihre Weichen ein Degen von stattlicher Größe herniederhing und über diesem Degen ein Auge, mehr wild als stolz, funkelte, verbissen sich die Passanten das Lachen oder gaben sich, wenn ihre Lachlust ihrer Klugheit ein Schnippchen schlug, alle Mühe, nach Art der Masken des Altertums bloß mit der einen Gesichtsseite zu lachen. – Bis er den Fuß in den unglückseligen Marktflecken Meung setzte, wurde d'Artagnan in seinem hohen Selbstgefühl und seiner heiklen Empfindlichkeit nicht gekränkt. Als er aber am Tor des Freimüllers sich anschickte, von seiner Rosinante zu steigen, ohne dass sich weder Wirt noch Kellner noch Hausknecht sehen ließ, um ihm den Steigbügel zu halten, richtete d'Artagnan den Blick zu einem Fenster des Hauses hinüber und gewahrte dort einen Edelmann von stattlicher Figur und stolzer Haltung, dessen Gesicht aber von einigen Runzeln gefurcht war, im Gespräch begriffen mit zwei Personen, die ihm voll Ehrerbietung zuzuhören schienen. Wie es seinem ganzen Wesen nach nicht anders möglich war, meinte d'Artagnan natürlich, es sei von ihm die Rede und horchte. Diesmal hatte er sich auch nur halb geirrt, denn nicht um ihn, sondern um seine Rosinante drehte sich das Gespräch. Der Edelmann schien seiner Zuhörerschaft sämtliche Eigenschaften des Tieres herzuzählen, und da, wie schon gesagt, alles in Ehrfurcht vor ihm erstarb, erschallte jeden Augenblick eine richtige Lachsalve. Da aber schon ein etwas höhnisch verzogener Mund genügte, um den jungen Mann in Zorn zu setzen, kann man sich denken, welche Wirkung solche maßlose Heiterkeit auf ihn hervorbrachte.
Immerhin wollte sich d'Artagnan zunächst über die Physiognomie des ihm unbekannten frechen Menschen klarwerden, der sich derart über ihn lustig machte, und maß ihn mit dem stolzesten seiner Blicke. Da sah er, dass er einen Mann von 40-45 Jahren vor sich hatte, mit schwarzen, durchdringenden Augen, bleichem Teint, scharfgeschnittener Nase, schwarzem, gezwirbeltem Schnurrbart, in veilchenblauem Wams und gleichfarbiger Hose mit ebensolchen Schnüren. Von irgendwelchem anderen Zierrat war an seiner Tracht nichts zu sehen. Wams und Hose waren wohl noch neu, sahen aber aus, als seien sie von langem Tragen in einem Reisesack arg zerknüllt. D'Artagnan machte all diese Wahrnehmungen mit dem schnellen Blick des scharfen Beobachters und ohne Frage durch eine instinktive Empfindung getrieben, als müsse dieser Unbekannte auf die künftige Gestaltung seines Lebens einen großen Einfluss haben.
Aber im selben Augenblick brach das Gelächter wieder in verstärktem Maße los, und diesmal konnte d'Artagnan nicht länger im Zweifel sein, dass es darauf abgesehen war, ihn zu beleidigen. Ohne sich länger zu besinnen, rückte er sein Federbarett tief in die Augen und legte mit einer Miene, wie er sie bei vornehmen Herren beobachtet, die rechte Hand auf den Knauf seines Degens, während er die linke in die Seite stemmte. Leider wuchs mit jedem Schritt, den er auf den Fremden zu machte, sein Zorn, so dass er statt der würdigen Ansprache, die er sich vorgenommen hatte, mit einer derben Grobheit herausplatzte, die er durch eine grimmige Gebärde noch arg verschärfte.
»He, Sie da!« rief er, »kommen Sie doch mal hinter Ihrem Fensterladen vor und sagen Sie mir, warum Sie lachen. Wir wollen dann zusammen lachen.«
Der Edelmann ließ den Blick langsam vom Gaul zum Reiter gleiten, als brauche er eine gewisse Zeit, um zu verstehen, dass diese absonderliche Rede wirklich ihm gelte. Als er dann erkannte, dass von einem Irrtum keine Rede mehr sein könne, zogen sich seine Brauen zusammen, aber es verging noch eine geraume Weile, bis er mit einem Spott und einer Frechheit, die sich unmöglich schildern ließe, dem jungen d'Artagnan erwiderte: »Mit Ihnen, Herr, rede ich nicht!« – »Aber ich rede mit Ihnen!« schrie der Jüngling, außer sich über diese Mischung von Frechheit und guten Manieren, von Beachtung und Missachtung.
Noch einen Augenblick lang maß ihn der Unbekannte mit seinem geringschätzigen Lächeln, dann trat er vom Fenster zurück und langsamen Schrittes aus der Gaststube vor d'Artagnan hin, dicht neben seine Rosinante. Seine Ruhe und Ironie erhöhten die Lustigkeit der Umstehenden in nicht geringem Maße, zumal er ihnen noch allerhand Bemerkungen zuwarf. D'Artagnan zog, als er ihn auf sich zukommen sah, seinen Degen fußlang aus der Scheide.
»Wenn der Gaul in seiner Jugend kein Fuchs war, so ist er es doch jetzt,« sagte der Unbekannte wieder zu seinen Bekannten am Fenster, ohne sich um d'Artagnans Grimm irgendwie zu kümmern. »In der Botanik ist die Farbe ja zu Hause, aber bei Pferden sieht man sie nur selten.« – »Ihr seid auch einer, der wohl über ein Ross, nicht aber über seinen Herrn zu lachen wagt!« rief der grimmige Nebenbuhler Trévilles. – »Ich lache nicht oft, Herr,« erwiderte der Unbekannte, »wie Sie mir ja schon am Gesicht ansehen können; aber mein Recht, zu lachen, wenn's mir gefällt, lasse ich mir nicht schmälern.« – »Und ich,« schrie d'Artagnan, »ich dulde nicht, dass man lacht, wenn's mir missfällt!« – »Ist das Ihr Ernst, Herr?« erwiderte der Unbekannte mit weit größerer Ruhe noch als bisher, »na, Sie haben ja vollkommen Recht!« Damit drehte er sich auf den Hacken um, um durch das große Tor in die Gastwirtschaft zurückzutreten. Dort sah d'Artagnan ein frisch gesatteltes Pferd stehen. Aber er war nicht der Mann danach, jemanden laufen zu lassen, der sich frech über ihn lustig gemacht hatte, sondern riss seinen Degen ganz aus der Scheide und schickte sich an, hinter dem andern herzurennen. »Heda, Ihr! Hübsch kehrtgemacht, damit ich Euch nicht eins hinten aufbrenne!« – Der andere aber drehte sich wieder herum und maß den Jüngling mit einem Blick, aus dem Staunen und Verachtung in gleichem Maße sprachen. »Mir eins aufbrennen?« wiederholte er... »aber geht, geht, mein Lieber! Bei Euch scheint's hier oben nicht ganz richtig zu sein!« und dabei zeigte er spöttisch auf die Stirn... Dann aber fuhr er halblaut, wie zu sich selbst, fort: »Schade, schade! Das wäre doch was für Seine Majestät, die überall nach Rekruten für Ihre Musketiergarde sucht!«
Aber noch hatte er nicht ausgeredet, als d'Artagnan einen so grimmigen Stoß nach ihm führte, dass er ohne einen schnellen Sprung zur Seite wahrscheinlich zum letzten Mal in seinem Leben gespottet hätte. Er sah nun, dass die Sache ernst wurde, zog seinen Degen, salutierte dem Gegner und legte sich aus. Im selben Augenblick aber fielen die beiden Männer, die mit ihm am Fenster gestanden hatten, gemeinsam mit dem Wirt mit Stöcken, Schaufeln und Schüreisen über d'Artagnan her, was dem Auftritt im Handumdrehen ein so völlig anderes Gesicht gab, dass d'Artagnans Widersacher mit der größten Seelenruhe den Degen wieder einsteckte und aus einem Teilnehmer, zu welcher Rolle für ihn nur wenig gefehlt hatte, ein Zuschauer wurde, während d'Artagnan sich mit allen Kräften seiner neuen Feinde zu erwehren suchte.
»Hol der Teufel diese Gascogner!« brummte der Unbekannte durch die Zähne: »Setzt ihn wieder auf seinen orangefarbigen Gaul und lasst ihn sich scheren, wohin er will!« – »Was er aber nicht früher tun wird, als bis er dir Feigling den Degen zwischen die Rippen gejagt hat!« schrie d'Artagnan, indem er sich, so gut es ging, Luft zu machen suchte. – »Schon wieder eine solche gascognische Großmäuligkeit!« antwortete der Edelmann; »meiner Treu, diese Gascogner sind unverbesserlich! Da er's nicht anders will, spielt ihm nur weiter auf! Wenn ihm die Puste ausgeht, wird er's schon sagen.«
Aber er wusste nicht, mit was für einem Dickschädel er's zu tun hatte, denn d'Artagnan kam es nie in den Sinn, um Pardon zu betteln. Die Schlägerei dauerte also noch ein paar Sekunden; schließlich entfiel aber d'Artagnan der von einem Stockhieb zertrümmerte Degen, während ihn selbst ein anderer Schlag vor die Stirn traf und zu Boden streckte.
Das war der Augenblick, wo alle Bürger des Marktfleckens den Schauplatz der Handlung erreichten. Der Gastwirt, unliebsames Aufsehen fürchtend, trug den Verletzten mit seinen Kellnern in die Küche und sorgte dort für angemessene Pflege. Der Edelmann seinerseits war auf seinen Platz am Fenster zurückgetreten und hielt mit Ungeduld die zusammengelaufene Menge im Auge, über deren Anwesenheit er lebhaften Verdruss zu empfinden schien... »Na, was macht denn dieser wilde Bär?« fragte er den zur Tür hereintretenden Wirt. – »Oh, Ihre Exzellenz sind doch heil und gesund?« fragte der Wirt. – »Jawohl, vollkommen heil und gesund, mein lieber Wirt, aber Sie hören doch, dass ich mich nach dem jungen Raufbold erkundige.« – »Mit dem geht's besser«, versetzte der Wirt, »er liegt in tiefer Ohnmacht.« – »Wirklich?« – »Vorher aber hat er noch einmal seine ganze Kraft zusammengerafft, um nach Ihnen zu schreien und Sie herauszufordern.« – »Ist der Kerl denn der Teufel in Person?« – »Keineswegs, Exzellenz«, versetzte mit verächtlicher Grimasse der Wirt, »denn während seiner Ohnmacht haben wir ihn durchsucht und in seinem Bündel weiter nichts als ein Hemd und in seinem Beutel nur elf Taler gefunden, was für ihn aber kein Hindernis war, zu rufen, ehe er in Ohnmacht sank, dass er's Ihnen, wenn der Vorfall in Paris passiert wäre, sofort heimgezahlt hätte, und dass die Sache Sie aber, wenn er Sie hier wieder träfe, noch teurer zu stehen käme.« – »Demnach ist es irgendein verkappter Prinz von Geblüt«, sagte der Unbekannte kalt. – »Ich gebe Ihnen bloß Kenntnis davon«, sagte der Wirt, »damit Sie auf Ihrer Hut sind.« – »Und hat er in seinem Zorn niemand genannt?« – »Oh doch! Er hat auf seine Tasche geklopft und gerufen: Nun, wir werden ja sehen, was Herr von Tréville über solchen, seinem Schutzbefohlenen angetanen Schimpf denken wird.« – »Herrn von Tréville hat er genannt?« fragte der Unbekannte, »und dabei auf die Tasche geklopft?... Ei, ei, mein lieber Wirt, Ihr habt doch sicher nicht unterlassen, während er in Ohnmacht lag, seine Tasche zu visitieren? Was hat er denn drin gehabt?« – »Einen Brief an Herrn von Tréville, Hauptmann der Musketiere.« – »Wirklich?« – »Wie ich Ihnen zu sagen die Ehre habe, Exzellenz!«
Der Wirt gehörte nicht zu den überklugen Leuten und merkte infolgedessen nicht, welche Änderung seine Worte in dem Gesicht des Edelmannes hervorriefen, während dieser sich jetzt vom Fenstersims entfernte, auf das er sich bisher mit dem Arm gestützt hatte, und wie jemand, den ein unruhiges Gefühl beschleicht, die Stirn in Falten legte... »Schwerenot!« brummte er zwischen den Zähnen, »sollte mir Tréville diesen Burschen auf den Hals geschickt haben? Er ist noch sehr jung; aber ein Degenstoß bleibt ein Degenstoß, mag er von einem Alten oder von einem Jungen kommen, und gegen Kinder ist man weniger misstrauisch als gegen andere Leute. Es ist schon mancher große Plan an einem kleinen Hindernis gescheitert.« – Darauf versank der Unbekannte in minutenlanges Sinnen. »Sagt mal, Wirt«, wandte er sich dann an diesen, »werdet Ihr mich von diesem Rasenden erlösen, oder nicht? So mir nichts, dir nichts kann ich ihn nicht umbringen, und doch«, setzte er mit einer Miene voll kalter Drohung hinzu, »ist er mir lästig... Wo steckt er jetzt?« – »In der Stube meiner Frau, im ersten Stock; sie verbindet ihn.« – »Sind seine Sachen und sein Mantelsack noch bei ihm?« fragte der Unbekannte. »Das Wams hat er nicht ausgezogen?« – »Das ist im Gegenteil alles unten in der Küche... Aber da dieser junge Tropf Exzellenz unbequem ist...« – »Gewiss ist er das, denn er verursacht in Eurem Gasthof ein Ärgernis, das allen rechtlichen Leuten zuwider sein muss. Geht hinauf, macht mir die Rechnung und ruft meinen Lakai.« – »Was? Exzellenz wollen uns schon verlassen?« – »Sie wissen das doch, denn ich habe Euch nicht umsonst geheißen, mein Pferd zu satteln... Ist man etwa meinem Befehl nicht nachgekommen?« – »Oh doch, und wie Exzellenz sehen können, steht Ihr Ross, gesattelt und bepackt, unter dem großen Tor.« – »Gut! besorgt das Weitere, wie ich befohlen habe.« – »Hm!« brummte der Wirt in den Bart, »sollte er sich etwa gar vor dem Jungen fürchten?«
Aber aus dem Auge des Unbekannten traf ihn ein gebieterischer Blick, und sogleich verließ er mit tiefer Verbeugung die Stube.
»Mylady darf dieser Wicht nicht sehen,« sprach der Unbekannte zu sich, »und sie muss jeden Augenblick kommen, denn eigentlich sollte sie schon da sein... Auf alle Fälle ist's klüger, ich reite ihr entgegen. Wenn ich bloß dahinterkommen könnte, was in diesem Brief an Tréville steht!«... Der Unbekannte begab sich in die Küche. Der Wirt machte sich inzwischen klar, dass den unbekannten Herrn nichts weiter als die Anwesenheit des jungen Raufboldes aus seinem Gasthof vertreibe, und war zu seiner Frau hinaufgegangen. In ihrer Stube hatte er d'Artagnan im Vollbesitz seiner Besinnung angetroffen. Er säumte nicht, ihm zu verstehen zu geben, dass ihm sehr leicht die Polizei über den Hals kommen dürfte, weil er Händel mit einem Herrn vom hohen Adel gesucht hätte, denn seiner Meinung nach konnte der Unbekannte nichts anderes sein, und so bestand er darauf, dass d'Artagnan trotz der Schwäche, die ihn von neuem befiel, von seinem Lager aufstünde und seines Weges weiterzöge... D'Artagnan, noch im Zustand halber Betäubung, ohne Wams und den Kopf mit einer Binde umwickelt, stand also auf und schickte sich an, die Treppe hinunterzuschleichen. Das erste aber, was ihm, als er an der Küche vorbeikam, in die Augen fiel, war sein Widersacher, der auf dem Tritt einer schweren, mit zwei kräftigen normannischen Pferden bespannten Kutsche stand und gemütlich mit einer Dame von etwa zwanzig Jahren sich unterhielt, deren Kopf von dem Kutschenschlag gleichsam umrahmt erschien. Wir haben schon bemerkt, dass d'Artagnan die Fähigkeit besaß, ein Gesicht mit einem Blick abzuschätzen, und so erkannte er auch jetzt im Nu, dass die Dame jung und schön war, und ihre Schönheit stach ihm umso schärfer in die Augen, als ihre Art in den südlichen Landstrichen, wo er bislang sein Leben zugebracht, völlig unbekannt und fremd war. Es war nämlich eine blasse, blonde Dame mit langen Locken, die ihr tief über die Schultern herabfielen, und großen, blauen, schmachtenden Augen, rosigen Lippen und Händen, weiß wie Alabaster. Die Dame befand sich in lebhafter Unterhaltung mit dem Unbekannten.
»Eminenz befehlen mir also...«, sagte sie. – »Auf der Stelle nach England zurückzukehren und durch Eilboten zu melden, ob der Herzog London verlassen hat.« – »Und meine weiteren Instruktionen?« fragte die schöne Reisende. – »Befinden sich in dieser Schatulle, die Sie jedoch erst öffnen dürfen, wenn Sie den Kanal hinter sich haben.« – »Gut! und was werden Sie tun?« – »Nach Paris zurückkehren.« – »Ohne den unverschämten Burschen zu züchtigen?«
Der Unbekannte schickte sich bereits zu einer Antwort an; aber gerade, als er den Mund dazu öffnete, schoss d'Artagnan, der alles mit angehört hatte, über die Schwelle... »Der unverschämte Bursche wird die anderen züchtigen«, rief er, »und hoffentlich drückt sich derjenige, der zunächst an die Reihe kommt, nicht wieder wie das erste Mal.« – »Drückt sich?« wiederholte der Unbekannte, die Stirn runzelnd. – »Nein, in Gegenwart einer Dame wird er es sich wohl nicht getrauen!« – »Bedenken Sie«, rief die Dame, als sie den Edelmann blankziehen sah, »dass die geringste Verzögerung alles gefährden könnte!« – »Sie haben Recht«, rief der Edelmann, »reisen Sie also ab, ich werde folgen.« Er nickte der Dame noch einmal zu und schwang sich auf sein Ross.
Im Galopp jagten Reiter und Karosse nach verschiedenen Richtungen davon...
»He, he! Ihre Zeche!« schrie der Wirt, dessen Respekt vor dem Reisenden sogleich auf den Nullpunkt sank, als dieser weg ritt, ohne zu bezahlen. – »Tolpatsch, bezahle!« rief der Reiter, ohne in seinem Galopp nachzulassen, seinem Lakai zu, der dem Wirt ein paar Silbermünzen vor die Füße warf und seinem Herrn nachsprengte. – »Ha, die feige Memme!« schrie d'Artagnan, seinerseits hinter dem Lakai herjagend; »der Halunke! Der Bastard von einem Edelmann!« Aber um solche Erschütterung auszuhalten, war der Verwundete noch zu schwach, und kaum hatte er zehn Schritte gemacht, da schlug er mit dem Ruf: »Halunke! Halunke!« mitten auf der Straße hin.
»Ein feiger Wicht ist er freilich!« brummte der Wirt, der zu d'Artagnan trat und sich durch diese Schmeichelei in besseres Licht bei dem Jüngling zu setzen suchte. – »Jawohl, feige, sehr feige!« lallte d'Artagnan, »aber sie – sie ist schön!« – »Wer? sie?« fragte der Wirt. – »Mylady«, lallte d'Artagnan, worauf er wieder in Ohnmacht sank. – »Das schert mich nicht«, sagte der Wirt, »zwei bin ich los, aber der da bleibt mir ja, und sicherlich für ein paar Tage... Um elf Taler will ich ihn jedenfalls erleichtern.« – Und elf Taler waren es gerade noch, die d'Artagnan in seinem Beutel hatte...
Der Wirt hatte auf elf Tage zu je einem Taler gerechnet, aber diese Wirtsrechnung ohne seinen Gast gemacht, denn am andern Morgen, schon vor fünf Uhr, erhob sich d'Artagnan von seinem Lager, begab sich in die Küche, ließ sich, außer einigen anderen Ingredienzen, deren Verzeichnis nicht auf uns gekommen ist, Wein, Öl und Rosmarin geben und mischte dies alles nach dem Rezept seiner Mutter zu der berühmten Wundsalbe, mit der er sich seine zahlreichen Blessuren einrieb, um hierauf seine Binden selbst zu erneuern. Die Zigeunersalbe tat denn auch die Wirkung, dass er sich abends außer aller Gefahr befand und am andern Morgen fast ausgeheilt war. Als er aber den Rosmarin, das Öl und den Wein – das einzige, was er von dem Wirt entnommen hatte, bezahlen wollte, und in seinen Beutel griff, fand er wohl noch die elf Taler drin, aber nicht mehr das väterliche Schreiben an Herrn von Tréville.
Der Jüngling begann mit unsäglicher Geduld nach dem Brief zu suchen und wandte alle Taschen wohl zwanzigmal um, wühlte in Mantelsack und Börse wohl eine Viertelstunde lang; aber der Brief fand sich nirgends mehr vor... und nun verfiel er in den dritten Wutanfall, der ihm fast eine neuerliche Anwendung von Rosmarin usw. aufgedrungen hätte; denn als der Wirt sah, dass der junge Hitzkopf wieder herumzurasen anfing und alles im Haus kurz und klein zu schlagen drohte, hatte er sich im Nu mit einem Spieß, die Frau mit einem Besenstiel bewaffnet, während seine Kellner zu den nämlichen Stöcken griffen, mit denen dem unwirschen Patron schon tags vorher das Fell verbläut worden war.
»Mein Brief!« schrie dieser, »mein Brief! Gottes Blut, oder ich spieße euch alle miteinander auf wie Krammetsvögel!«
Leider setzte sich der Ausführung dieser Drohung ein Umstand entgegen, und zwar der, dass sein Degen bei dem ersten Geplänkel entzweigeschlagen worden war. Das aber hatte er in seinem Grimm vergessen, und so sah er sich denn, als er nun blankziehen wollte, im Besitz eines bloßen Degenstumpfes von 8 bis 10 Zoll Länge, den der Wirt vorsorglich in die Scheide geschoben, während er das andere Stück auf die Seite gebracht hatte, in der Absicht, sich einen Bratspieß daraus zu machen. Nichtsdestoweniger hätte sich unser rasender Roland durch diese Enttäuschung wohl kaum abhalten lassen, seine Absicht auszuführen; der Wirt war aber zu der Einsicht gekommen, dass die von dem Reisenden erhobene Forderung durchaus recht und in Ordnung war... »Ja, wo ist denn Euer Brief?« sagte er, seinen Spieß senkend. – »Ja, wo ist der Brief?« schrie d'Artagnan... »Ihr müsst nämlich wissen, dass der Brief an Herrn von Tréville gerichtet war, und wenn er sich nicht wiederfindet, nun, dann wird ihn dieser schon zu suchen wissen!«
Diese Drohung schüchterte den Wirt vollständig ein. Nach dem König und dem Kardinal war Herr von Tréville der Mann, dessen Name von den Soldaten und Bürgern vielleicht am allerhäufigsten genannt wurde. Freilich war ja noch Pater Joseph da; dessen Name wurde immer nur leise geflüstert, so groß war der Schrecken, den die »graue Eminenz«, wie man allgemein den Famulus des Kardinals nannte, allen Leuten in Frankreich einflößte. Der Wirt warf also seinen Spieß weg und hieß die Frau den Besenstiel beiseite stellen, die Kellner die Stöcke aus den Händen legen, während er sich selbst daranmachte, den in Verlust geratenen Brief zu suchen... »War denn in dem Brief irgendwas Kostbares?« fragte er, nachdem er eine Weile vergeblich gesucht hatte. – »Gottes Blut! das will ich meinen!« rief der Gascogner, denn er versprach sich von dem Brief ja die beste Aussicht für seine Lebenslaufbahn... »Er barg doch mein ganzes Vermögen!« – »In spanischen Wertpapieren?« fragte der Wirt voll Unruhe. – »In Anweisungen auf die königliche Privatschatulle«, versetzte d'Artagnan, denn er rechnete ja zufolge dieser Empfehlung auf eine Anstellung im königlichen Dienst und meinte deshalb, volle Berechtigung zu solcher freilich etwas gewagten Rede zu haben, ohne sich damit einer Lüge schuldig zu machen.
»Schwerenot!« rief der Wirt, ganz außer sich. – »Aber aufs Geld kommt's in diesem Fall gar nicht so sehr an«, nahm d'Artagnan wieder das Wort, mit der ihm als Gascogner eigentümlichen Großtuerei; »bloß auf den Brief! den Brief! Lieber hätte ich tausend Pistolen verloren als den Brief!«
Plötzlich kam dem Wirt, der sich zu allen Geiern wünschte, als er trotz allem Suchen den Brief nicht fand, ein Gedanke... »Der Brief ist ja gar nicht verloren!« rief er. – »So?« machte d'Artagnan. – »Nein, verloren nicht, gestohlen ist er Euch!« – »Gestohlen? von wem?« – »Von dem Edelmann von gestern, denn er war ja in der Küche, wo Euer Wams lag; war allein dort, und ich möchte darauf wetten, dass er, und kein andrer, Euch den Brief gestohlen hat.« – »Meint Ihr?« erwiderte d'Artagnan, ohne sich für diese Ansicht besonders erwärmen zu können, denn er wusste doch recht gut, dass an dem Brief nichts war, was jemandes Habsucht hätte reizen können.
Immerhin fragte er: »So? Ihr habt also auf diesen unverschämten Menschen Verdacht?« – »Ich bin meiner Sache sogar ganz sicher«, erwiderte der Wirt, »denn als ich ihm gesagt hatte, Ihr seiet an Herrn von Tréville mit einem Schreiben empfohlen, also dessen Schützling, da verlor er mit einem Mal die Ruhe und fragte, ob ich wüsste, wo der Brief sei, ging auch gleich darauf in die Küche hinunter, denn dass dort Euer Wams läge, wusste er.« – »Nun, dann ist er auch der Spitzbube«, versetzte d'Artagnan; »ich werde mich beim Herrn von Tréville beschweren, und der wird sich beim König beschweren.« Darauf zog er großartig seine Börse, nahm zwei blanke Taler heraus und gab sie dem Wirt, der ihn mit dem Hut in der Hand bis zur Tür begleitete. Dann bestieg er wieder seine gelbe Rosinante, die ihn ohne jeden weiteren Unfall bis an das Tor Saint-Antoine von Paris brachte. Dort verkaufte er die Rosinante um drei bare Taler, was immer noch ein guter Preis war. Und der Rosskamm sagte auch, er bezahle dieses schwere Stück Geld bloß deshalb, weil ihm die absonderliche Farbe des Gaules imponiere...
D'Artagnan betrat also Paris zu Fuß, mit seinem Bündel unterm Arm und lief ziemlich lange herum, bis es ihm glückte, eine seinen mageren Geldmitteln angemessene Stube zu finden. Endlich fand er sie in der unfern von dem Luxemburg-Palais gelegenen Rue des Fossoyeurs, bezahlte einen Teil der Miete voraus und quartierte sich ein. Er flickte sein Wams und nähte an die Beinkleider die Borte, die seine fürsorgliche Mutter von einem noch fast neuen Anzug seines Vaters abgetrennt und ihm mit in sein Bündel gesteckt hatte.
Hierauf machte er einen Gang auf den Kai der Waffenschmiede, um sich an seinen Degenknauf eine neue Klinge machen zu lassen, fragte sich zum Louvre durch und erkundigte sich bei dem ersten Musketier, den er unterwegs traf, zum Palais des Herrn von Tréville, das in der Nähe der von ihm gemieteten Dachstube, in der Rue du Vieux-Colombier, lag. Dies schien ihm ein Umstand, den er als günstige Vorbedeutung für den glücklichen Erfolg seiner Reise auffasste. Durchaus zufrieden mit seinem Verhalten im Marktflecken Meung, ohne Kummer wegen der Vergangenheit, voll Vertrauen auf die Gegenwart und voll Hoffnung für die Zukunft, legte er sich in sein Bett und schlief den Schlaf des Gerechten, und zwar, ganz noch wie es Brauch und Sitte ist in der Provinz, bis in die neunte Morgenstunde. Da erst erhob er sich, wischte sich die Augen, wusch und kämmte sich und machte sich auf den Weg zum Palais des Herrn von Tréville, der nach der Schätzung seines Vaters der drittmächtigste Mann im Königreich Frankreich war.
Im Vorzimmer des Herrn von Tréville
Herr von Troisvilles, wie sich seine Familie noch in der Gascogne nannte, oder, wie er sich jetzt in Paris zu nennen liebte, Herr von Tréville, hatte seine Laufbahn nicht anders angefangen als d'Artagnan, nämlich ohne einen Sou Vermögen, aber mit jenem Vorrat von Kühnheit, Geist und festem Willen, der dem ärmsten gascognischen Landjunker ein reicheres Erbe in der Zukunft sichert als dem reichsten Edelmann im Perigord oder Berry in die Wiege gelegt wird. Seine verwegene Tapferkeit und sein noch unverschämteres Glück in einer Zeit, wo es Hiebe förmlich hagelte, hatte ihn so geschwind auf die oberste Sprosse jener steilen Leiter, die man Hofgunst nennt, geführt, dass man meinen konnte, er habe immer vier Sprossen auf einmal genommen.
Er war der Freund des Königs und bei ihm umso besser angeschrieben, als sein Vater schon Heinrich IV. in all seinen Kriegen treu gedient hatte, trotzdem er klingenden Lohn eigentlich niemals empfangen, denn unter Heinrich IV. war bekanntlich Geld immer das wenigste, sondern mit einem Wappen abgespeist worden war: einem goldenen Löwen in rotem Feld mit der Devise: »Treu und stark«. Viel Ehre, aber wenig Geld hieß es eben damals schon wie heute.
Daher war es denn gekommen, dass der berühmte Kamerad des großen Heinrich bei seinem Heimgang seinem Sohn außer seinem Degen und Wappen nichts hinterließ. Aber dieses Doppelerbe im Verein mit einem fleckenlosen Namen hatte Herrn von Tréville den Weg zum Haus des jugendlichen Prinzen erschlossen, wo er mit seinem Degen so gute Dienste tat und seinem Wappenspruch so treu blieb, dass Ludwig XIII., der eine der besten Klingen schlug, zu sagen pflegte, wenn sich ein Freund von ihm duellieren wolle, so rate er ihm, erst ihn selbst und dann Tréville, wenn nicht gar diesen noch vor ihm, zum Sekundanten zu nehmen.
Ludwig XIII. hatte übrigens eine Vorliebe für Tréville. In jenen unglücklichen Zeitläufen war man lebhaft bemüht, sich mit Männern vom Schlage Trévilles zu umgeben. »Stark«, die zweite Hälfte des Trévilleschen Wappenspruches, konnten viele Edelleute für sich in Anspruch nehmen; nur wenige aber die erste: »treu«. Zu ihnen gehörte Tréville, einer jener seltenen Menschen, die folgsam und klug sind wie ein Hund, dabei blinde Tapferkeit, schnellen Blick, lose Hand und die Augen scheinbar nur dazu haben, um aufzupassen, ob der König Ursache zur Unzufriedenheit mit einem seiner Untertanen habe. Bisher hatte es Tréville schließlich noch an der Gelegenheit dazu gefehlt; aber er lauerte darauf und gelobte sich, sie beim Schopf zu fassen, sobald sie ihm in greifbare Nähe käme. Darum machte der König Herrn von Tréville zum Hauptmann seiner Musketiere, die für Ludwig XIII., was Hingebung und Treue, oder vielmehr Fanatismus angeht, dasselbe bedeuteten wie für Ludwig XI. seine schottische Leibgarde.
Der Kardinal seinerseits stand in dieser Hinsicht hinter dem König nicht zurück. Sobald er merkte, mit welch stattlicher Leibgarde sich Ludwig XIII. umgab, wollte dieser andere oder vielmehr erste König von Frankreich gleiches für sich haben. Er nahm sich also auch Musketiere wie jener, und nun erlebten es die Zeitgenossen dieser beiden mächtigen Nebenbuhler, dass jeder von ihnen in allen Provinzen Frankreichs, ja auch in allen möglichen fremden Ländern auf ständiger Suche nach Männern war, die in dem Ruf standen, eine gute Klinge zu schlagen. Daraus ergab sich, dass Richelieu und Ludwig XIII. sich oft, wenn sie bei ihrer Schachpartie saßen, über Wert und Vorzüge ihrer Dienstmänner herumstritten. Jeder brüstete sich mit der Führung und dem Mut der seinen, und während sie laut gegen Duelle und Krawalle predigten, hetzten sie im stillen dazu und wurmten sich niederträchtig, wenn ihren Leuten eins ausgewischt wurde, freuten sich aber unmäßig, wenn sie andern eins ausgewischt hatten.
Tréville hatte seinen Herrn bei seiner schwachen Seite zu fassen gewusst, und dieser Geschicklichkeit verdankte er die lange und beständige Gunst eines Königs, der nicht den Ruf eines treu zu seinen Freunden haltenden Mannes hinterlassen hat. Er verstand sich ausgezeichnet auf die Kriegstechnik jenes Zeitalters, in dem der Soldat, wenn nicht auf Feindes-, so doch auf Landeskosten lebte; seine Soldaten bildeten eine richtige Satansgarde, die nur er in Disziplin zu halten vermochte. Außer Rand und Band, trieben sie sich in den Kneipen und Schenken und anderen öffentlichen Lokalen umher, randalierten und ließen ihre Degen auf dem Pflaster klirren, rempelten die Leute an und lagen mit den Kardinalsmusketieren in ständiger Fehde. Hin und wieder geschah es wohl, dass einer von ihnen sein Leben lassen musste, weit öfter aber, dass sie andere ums Leben brachten; im ersteren Fall durften sie rechnen, bedauert und gerächt zu werden, im letzteren, nicht im Kerker zu vermodern, denn ihr Kommandant war ja da und unterließ es in keinem Fall, sie für sich zurückzufordern.
Herr von Tréville hatte diesen mächtigen Hebel in erster Reihe für den König und für Freunde des Königs angesetzt – in zweiter Linie jedoch auch für sich persönlich und seine Freunde. Aber in keiner aus jener Zeit auf uns gekommenen Schrift ist etwas darüber zu finden, dass er sich jemals für Geld zu irgendeiner ehrwidrigen Handlung hätte bereitfinden lassen. So sehr er zu Intrigen neigte, so ist er doch immer Ehrenmann geblieben. Der Hauptmann der Musketiere war also gefürchtet, vergöttert und geliebt, und von den zweihundert kleinen Zirkeln, die neben denen des Königs und des Kardinals in Paris noch ihre Rolle spielten, war derjenige des Herrn von Tréville, wenn nicht der gesuchteste, so doch einer der gesuchtesten.
Der Hof seines in der Rue du Vieux-Colombier gelegenen Palastes hatte Ähnlichkeit mit einem Kriegslager, und zwar zur Sommerszeit von sechs Uhr, zur Winterszeit von acht Uhr morgens an. Fünfzig bis sechzig Musketiere waren dort immer in Bewegung, scheinbar, um die Stärke der Besatzung recht imposant zu machen, wohl aus demselben Grunde auch immer in voller Kriegsrüstung und immer zu allen Schand- oder andern Taten bereit. Auf einer der großen Treppen seines Palastes, deren Raum unsern jetzigen Baumeistern zum Bau eines ganzen Hauses reichen würde, stiegen Pariser Bittgänger, die etwas zu ergattern strebten, Edelleute aus der Provinz, die in die Musketierrolle aufgenommen sein wollten, und buntscheckiges Lakaienvolk, das von seiner Herrschaft an Herrn von Tréville etwas auszurichten hatte, herauf und hinab. Im Vorzimmer saßen auf langen, rings an den Wänden herumlaufenden Bänken »die Erwählten«, nämlich solche, die eingeladen oder kommandiert waren. Vom frühen Morgen bis zum späten Abend summte es hier wie in einem Bienenstock, während Herr von Tréville in seinem anstoßenden Kabinett Besuche empfing, Klagen anhörte, Befehle erteilte und, wie der König auf seinem Balkon im Louvre, sich bloß an das Fenster zu begeben brauchte, wenn ihn mal die Lust anwandelte, Menschen und Waffen zu sehen.
An dem Tag, da d'Artagnan sich vorstellte, befand sich eine stattliche Versammlung in diesem Vorzimmer: stattlich zumal für einen eben aus der Provinz in Paris abgestiegenen Landjunker, wenn er auch aus der Gascogne war, deren Bewohner sich bekanntlich nicht so leicht imponieren lassen. Hatte man das mit dicken Nägeln beschlagene Haupttor passiert, so geriet man mitten unter eine Schar Bewaffneter, die sich im Hof drängten, stießen, stritten, wohl auch zusammen ein Spielchen machten. Durch dieses Gewühl arbeitete sich d'Artagnan klopfenden Herzens, während er seinen langen Degen gegen die mageren Beine drückte und die Hand am Rand seines Filzhuts hielt, mit jenem halben Lächeln des verlegenen Provinzlers, der so recht nach etwas aussehen will.
Hatte er eine Gruppe hinter sich, dann atmete er jedes Mal auf! Aber es entging ihm nicht, dass man sich umdrehte und ihm nachsah, und zum ersten Mal in seinem Leben kam sich unser d'Artagnan, der bislang von sich eine ziemlich gute Meinung gehabt hatte, recht albern vor.
Auf der Treppe wurde es noch schlimmer, denn da standen Weiber umher und schwatzten über allerhand, was bei Hofe passiert war... War er auf der Treppe rot geworden, so fing es ihn aber im Vorzimmer zu frösteln an, denn in seiner gascognischen Einbildungskraft meinte er, für jede Zofe ein verführerisches Objekt darzustellen, und als er nun inne wurde, dass man sich um ihn wenig oder gar nicht bekümmerte, sondern nur alle möglichen politischen Fragen durchhechelte, sich nebenbei gar noch über das Privatleben des Kardinals unterhielt, da kostete es ihn nicht wenig Überwindung, den Fuß nicht rückwärts zu setzen; wie konnte man, da doch so viele hochgestellte Personen schon deshalb bestraft worden waren, noch immer wagen, über König und Kardinal auf solche Weise loszuziehen? Wie konnten Musketiere so keck sein, sich über den hohen Rücken und die Säbelbeine eines so hochgestellten Mannes zu mokieren, den ihm sei Vater als ebenso mächtig wie der König genannt hatte? Ja, sogar von seiner Maitresse, der Frau von Aiguillon, wurde ganz laut gesprochen, und er war doch Kardinal! Das waren Dinge, die dem jungen Menschen, der noch nie die Provinz verlassen hatte, tatsächlich über den Horizont gingen, die ihm als geradezu grause Unmöglichkeiten erschienen. Eins fiel ihm indessen dabei auf: dass nämlich, wenn in diesem Gerede über den Kardinal der Name des Königs fiel, plötzlich Stillschweigen eintrat, gerade, als wenn den losen Mäulern ein Knebel zwischen die Zähne gedrängt worden wäre. Und nun kam es ihm so vor, wie wenn man sich gewissermaßen vor ihm in Acht nehmen zu müssen meinte, als wenn man zu dem Privatkabinett des Herrn von Tréville doch nicht das rechte Vertrauen hätte. Immer aber fiel dann wieder irgendeine lose Anspielung auf Seine Eminenz, und dann wurde wieder gelacht nach Herzenslust, und alles, was er tat und getan hatte, wurde durchgehechelt, bewitzelt und verspottet.
Wie man sich denken kann, gewann es d'Artagnan nicht über sich, an solcher Unterhaltung sich auch nur mit einem Wort zu beteiligen; er hielt aber die Augen offen, spitzte die Ohren und gab sich alle Mühe, von allem, was um ihn her vorging, nicht das Geringste zu verlieren, denn trotz aller Zuversicht auf die ihm vom Vater gegebenen Winke und Ratschläge hatte er doch die Empfindung, als dürfe er nicht so ohne weiteres über all diese Dinge, so unerhört sie ihm auch vorkamen, den Stab brechen. Es blieb auch nicht aus, dass man ihn mit Fragen behelligte, was er hier suche, denn von der ganzen Schar Höflinge, die sich hier herumdrückten, war er keinem einzigen bekannt, und er wurde hier ja auch zum ersten Mal gesehen. D'Artagnan nannte sich nun mit aller Bescheidenheit, stützte sich auf seine Eigenschaft als Franzose und Gascogner und ersuchte den Diener, an den er daraufhin gewiesen wurde, Herrn von Tréville seine Anwesenheit zu melden, mit der Bitte, ihm eine kurze Audienz zu gewähren, was ihm, sobald sich Zeit und Gelegenheit dazu fände, gönnerhaft gnädig bewilligt wurde.
D'Artagnan hatte sich mittlerweile von seiner ersten Beklommenheit einigermaßen befreit und fand nun Muße, Kostüme und Gesichter ein bisschen zu studieren. Im Mittelpunkt der lebhaftesten Gruppe stand ein Musketier, der durch lange Figur, stolze Miene und wunderliches Kostüm die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich lenkte. Er trug im Augenblick nicht die Musketier-Uniform, wozu er übrigens in jener Zeit beschränkterer Freiheit, aber unbeschränkterer Unabhängigkeit auch keineswegs gezwungen war, sondern einen himmelblauen, schon ziemlich verschossenen und zerschlissenen, prall sitzenden Oberrock, darüber ein prächtiges, reich mit Gold gesticktes, lebhaft glitzerndes Wehrgehänge, das aber, wie auch der lange Degen, durch einen von den Schultern niederwallenden roten Mantel halb verdeckt wurde.
Dieser Musketier war gerade von der Wache gekommen, beschwerte sich über einen garstigen Schnupfen, der ihn nie mehr verlassen wolle, und hustete ein paarmal recht affektiert. Deshalb hatte er auch den Mantel umgehangen, wie er nicht ermangelte, seiner Umgebung gegenüber zu bemerken, und während er das große Wort führte und geringschätzig den Schnurrbart kräuselte, bewunderte jedermann, und d'Artagnan nicht am wenigsten, das gestickte Wehrgehänge.
»Was denn?« sagte der Musketier, »es wird eben Mode! Albern ist's ja, das weiß ich, aber Mode. Verbraucht muss doch auch das Geld werden, das man mal erbt.« – »Ach, Porthos!« rief einer aus der sich um ihn drängenden Menge, »mach uns bloß nicht weiß, du hättest väterlicher Noblesse dies Wehrgehänge zu verdanken. Hast's doch sicher von der verschleierten Dame, mit der ich dich letzten Sonntag am Saint-Honoré-Tor gesehen habe?« – »Nein, auf Ehre! Auf Edelmannswort! Ich hab's gekauft, hab's mit meinem eigenen Geld bezahlt!« erwiderte der als Porthos angesprochene Musketier. – »Ja doch«, rief ein anderer Musketier, »gerade wie ich die neue Börse da auch mit dem Geld bezahlt habe, das mir meine Liebste in die alte getan hat!« – »Ihr könnt mir's glauben«, erwiderte Porthos, »dass ich zwölf Pistolen dafür berappt habe. Nicht wahr, Aramis?« setzte er hinzu, indem er sich an einen andern Musketier wandte, der zu ihm in krassem Gegensatz stand.
Er war nämlich ein junger Mann von höchstens zweiundzwanzig bis dreiundzwanzig Jahren, mit harmlosem, weichlichem Gesicht, schwarzen, aber milden Augen und rosigen Wangen, die von einem Samthauch überflogen waren, wie ihn Pfirsiche zur Herbstzeit haben. Auf seiner Oberlippe zog ein zierliches Schnurrbärtchen eine gerade Linie; seine Hände schienen Scheu vor dem Herabhängen zu haben, weil dann die Adern schwellen könnten, und zeitweilig kniff er sich in die Ohren, um sie bei zarter, durchsichtiger Färbung zu halten. Es war seine Gewohnheit, wenig und langsam zu sprechen, viel Komplimente zu machen, still vor sich hin zu lachen, damit seine schönen Zähne sichtbar wurden, auf die er, wie auf seine ganze Person, die größte Sorgfalt zu verwenden schien. Der Aufforderung seines Kameraden entsprach er durch ein zustimmendes Nicken, das alle Zweifel betreffs des Wehrgehänges aus der Welt schaffte. Die Bewunderung dieses Gegenstandes dauerte also fort; es wurde aber nicht mehr darüber gesprochen, und die Unterhaltung wandte sich anderen Dingen zu.
»Was denkt ihr über die Geschichte, die Chalais' Stallmeister auftischt?« fragte wieder ein anderer Musketier, ohne sich an eine bestimmte Person der Anwesenden zu richten. »Was für eine Geschichte ist denn das?« fragte Porthos anmaßend. – »Er will in Brüssel Rochefort, den bösen Geist des Kardinals, als Kapuziner gesehen haben; und in dieser Verkleidung soll der vermaledeite Rochefort Herrn de Laigues an der Nase herumgeführt haben.« – »Der Esel verdiente es nicht besser«, sagte Porthos; »aber ist's denn wahr?« – »Mir hat's Aramis erzählt«, erwiderte der Musketier. – »Was du sagst!« – »Aber, Porthos, du weißt's doch recht gut«, versetzte Aramis, »ich hab's dir ja gestern selbst erzählt. Doch reden wir nicht weiter davon!« – »Reden wir nicht weiter davon! Das meinst du!« versetzte Porthos. »Pest! Du bist flink mit deinen Konsequenzen. Ha! Der Kardinal lässt einen Edelmann ausspionieren, lässt seine Briefschaften durch einen Verräter, Banditen, Galgenvogel mausen, macht Chalais mit Hilfe dieses Spions und auf Grund dieser Briefschaften einen Kopf kürzer unter dem blöden Vorwand, er habe den König umbringen und den Bruder des Königs mit der Königin verheiraten wollen! Kein Mensch fand den Schlüssel zu diesem Rätsel. Du kommst gestern Abend dahinter, und während wir alle miteinander baff über diese Affäre sind, sagst du: Reden wir nicht mehr davon.«
»Nun, dann reden wir doch darüber«, versetzte Aramis geduldig, »wenn du es so haben willst.« – »Dieser Rochefort«, rief Porthos, »hätte mit mir, wäre ich Stallmeister des armen Chalais, einen harten Stand haben sollen!« – »Und du hättest eine trübe Viertelstunde mit dem roten Herzog!« erwiderte Aramis. – »Ha! mit dem roten Herzog?... Bravo, dem roten Herzog, bravo!« nickte Porthos und klatschte in die Hände. »Roter Herzog ist ausgezeichnet, das Wort bringe ich in die Mode, mein Lieber, verlass' dich darauf! Ist das ein geistvoller Patron, dieser Aramis! Schade, schade, dass du nicht bei deinem Beruf geblieben bist! Hättest doch einen brillanten Abbé abgegeben!« – »Oh, aufgeschoben ist nicht aufgehoben!« versetzte Aramis. »Du weißt doch, Porthos, dass ich noch immer mein theologisches Studium fortsetze.« – »Und er wird's auch durchsetzen«, antwortete Porthos, »früher oder später, denn er ist ganz der Kerl danach!« – »Und eher früher als später«, meinte Aramis. – »Bloß eins wartet er noch ab«, meinte ein anderer Musketier, »um die Entscheidung zu treffen und wieder in die Soutane zu kriechen.« – »Und was wartet er ab?« fragte ein anderer. – »Dass die Königin Frankreichs Krone einen Erben beschert!« – »Spottet nicht darüber, ihr Herren!« rief Porthos; »zum Glück ist die Königin noch in dem Alter, das zu können!« – »Es heißt, der Herr von Buckingham sei in Frankreich«, versetzte Aramis mit ironischem Lächeln, das diesen anscheinend harmlosen Worten einen recht ärgerlichen Nebensinn lieh. – »Aramis«, sagte Porthos, »diesmal bist du auf dem Holzweg, denn deine Sucht, geistreich zu sein, lässt dich über das Ziel hinausschießen. Hörte dich Herr von Tréville, so möchtest du schön angehen!« – »Lies mir bloß nicht die Leviten, Porthos!« rief Aramis, in dessen sanften Augen es wie ein Blitz aufleuchtete. – »Mein Lieber, sei Musketier oder Abbé, eins oder das andere, aber nicht beides!« versetzte Porthos. »Weißt du, erst gestern noch hat Athos gesagt, du fräßest aus jeder Raufe... Oh, sei nicht böse deshalb, mein Lieber, denn das hätte wahrlich keinen Sinn! Du weißt ja, was zwischen dir, Athos und mir gilt. Lauf du zu Madame von Aiguillon und mach ihr den Hof, auch zur Kusine der Madame von Chevreuse, bei der du ja einen großen Stein im Brett haben sollst. Du meine Güte, brauchst dein Glück nicht an die große Glocke zu hängen, kümmert sich ja niemand um dein Geheimnis. Man weiß doch, dass du verschwiegen bist. Aber da du einmal glücklicher Besitzer dieser Tugend bist, so bringe sie zur Geltung in betreff Ihrer Majestät. Mag sich mit König und Kardinal befassen, wer Lust hat und wie es ihm beliebt; aber die Königin ist geheiligt, und wenn auf sie die Rede kommt, dann darf es nur im guten sein!«
»Porthos, du bist anmaßend wie Narziss, das muss man sagen«, erwiderte Aramis. »Dass ich Moral nicht vertrage, außer sie wird von Athos gepredigt, ist dir bekannt. Von dir aber muss ich sagen, dass du, um in dieser Hinsicht anzutreten, ein viel zu schönes Wehrgehänge hast. Abbé werde ich sein, wenn's mir passt; bis dahin bin ich Musketier, und in dieser Eigenschaft sage ich, was mir behagt, und im Augenblick behagt's mir, dir zu verstehen zu geben, dass du mir zu nahe trittst.« – »Aramis!« – »Porthos!« – »Heda, ihr Herren, ihr Herren!« erklang es um sie her. – »Herr von Tréville erwartet Herrn d'Artagnan!« unterbrach der Lakai den Lärm, indem er die Tür öffnete, und inmitten allgemeiner Stille durchschritt der junge Gascogner das Vorzimmer und trat ein bei dem Hauptmann der Musketiere, sich von ganzem Herzen gratulierend, dass er diesem wunderlichen Zwist noch kurz vor seinem Ablauf entwischte.
Die Audienz
Herr von Tréville befand sich gerade in sehr schlechter Stimmung, unterließ es jedoch nicht, den jungen Mann, der sich vor ihm bis zur Erde verneigte, höflich zu begrüßen, und lächelte über die Komplimente des Jünglings, die ihm seine Jugend und Heimat ins Gedächtnis riefen: eine doppelte Erinnerung, die jedem Menschen, gleichviel in welchem Alter, das Herz wieder jung macht. Aber fast zur gleichen Zeit machte er einen Schritt zum Vorzimmer hin und winkte d'Artagnan mit der Hand, als wenn er ihn bitten wollte, ihn erst die andern abfertigen zu lassen, bevor er sich ihm widme. Dann rief er dreimal hintereinander, jedes Mal die Stimme verstärkend, dass sie alle Phasen vom Befehlston bis zum Ton des Ärgers und Zorns durchlief: »Athos! Porthos! Aramis!«
Die beiden Musketiere, die auf die beiden letzten Namen hörten, verließen auf der Stelle die Gruppen, bei denen sie standen, und traten auf das Kabinett zu, dessen Tür sich hinter ihnen schloss, sobald sie die Schwelle überschritten hatten. Ihre Haltung, obwohl sie weit entfernt von Ruhe war, weckte durch ihre zugleich Würde und Untertänigkeit bekundende Ungezwungenheit d'Artagnans Bewunderung, der in diesen beiden Menschen Halbgötter, in ihrem Vorgesetzten aber einen mit all seinen Blitzen bewaffneten Jupiter erblickte.
Als die Tür sich hinter den beiden Musketieren geschlossen, als das Summen, das im Vorzimmer herrschte und dem der dreimalige Namensaufruf augenscheinlich neue Nahrung gegeben, wieder angehoben, als endlich Herr von Tréville drei-, viermal, schweigsam und mit finsteren Brauen, das Kabinett in seiner vollen Länge durchschritten hatte, jedes Mal an Porthos und Aramis vorbeigehend, die stumm und starr dastanden wie bei der Parade, machte er plötzlich ihnen gegenüber halt und rief, sie vom Kopf bis zu den Füßen mit zornigem Blick messend: »Wissen Sie, meine Herren, was mir der König gesagt hat, und zwar gestern Abend – wissen Sie das, meine Herren?« – »Nein«, antworteten sie nach kurzer Pause, »nein, Herr, wir wissen es nicht.« – »Sie erweisen uns aber hoffentlich die Ehre, es uns mitzuteilen«, setzte Aramis hinzu, im höflichsten Ton der Welt und einer höchst anmutigen Verbeugung. – »Dass er von jetzt ab seine Musketiere aus der Leibgarde des Herrn Kardinal nehmen werde!« – »Aus der Garde des Herrn Kardinal, und warum?« fragte Porthos lebhaft. – »Weil er wohl eingesehen hat, dass sein saurer Wein durch Mischung mit einem guten Tropfen aufgefrischt werden muss.«
Die beiden Musketiere wurden rot bis hinter die Ohren. D'Artagnan wusste nicht, wie er daran war, und wäre am liebsten hundert Fuß unter die Erde gesunken.
»Jawohl«, fuhr Herr von Tréville fort, sich in Feuer redend, »und Seine Majestät hatte Recht, denn, auf Ehre: die Musketiere spielen bei Hofe eine traurige Rolle. Der Herr Kardinal hat erst gestern mit einer Beileidsmiene, die mich sehr verdrossen hat, beim Spiel Seiner Majestät erzählt, dass diese vermaledeiten Musketiere vorgestern – diese Teufelsbrut, und eine hämische Ironie legte er in diese Worte, die mich schier außer mir brachte – diese Bratspießhelden, sagte er noch und schielte mich dabei mit seinen Tigerkatzenaugen an – sich in der Rue Pérou in einer Schenke herumgetrieben hätten, und dass eine Runde seiner Leibgarde – ich habe wirklich gemeint, er wolle mir ins Gesicht lachen – sich genötigt gesehen, diese Skandalmacher zu arretieren... Mord und Brand! Davon müssen Sie doch etwas wissen? Musketiere verhaften. Leugnen Sie nicht! Sie sind mit dabei gewesen, Sie sind erkannt worden, der Kardinal hat Sie namhaft gemacht!... Mich trifft die Schuld, niemand als mich, weil ich meine Mannschaft rekrutiert habe! Sagen Sie mal, Aramis, wozu, Sackerment! haben Sie mich gebeten, Sie in die Kasacke zu stecken, da Sie sich doch vorzüglich für die Soutane eigneten? Und Sie, Porthos, haben Sie ein so schönes goldenes Und Athos? Ich sehe ja Athos nicht! Wo steckt er?«