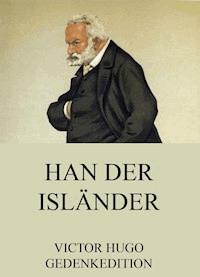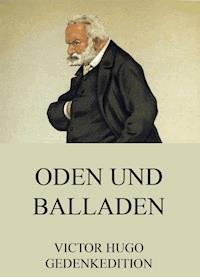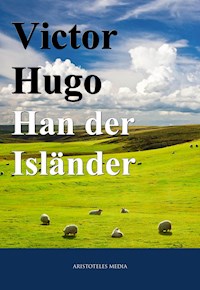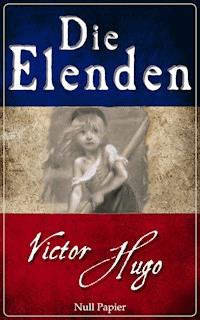
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Klassiker bei Null Papier
- Sprache: Deutsch
Vollständige Überarbeitung der ersten Übersetzung von 1910 Victor Hugo beendete dieses Meisterwerk, das zu den wichtigsten Werken der französischen Literatur gehört, im Jahre 1862, als er im Exil weilte. Es schildert das bedrückende Dasein der Unterschicht, der Elenden, der Verzweifelten, der Menschen, denen man selbst eine zweite Chance verwehrt. Der Roman trug durch seine Themen- und Sprachwahl wesentlich zur Herausbildung der realistischen Literatur im 19. Jahrhundert bei. Kein anderer Autor von Weltrang hatte es zuvor gewagt, in seinen Texten zu fluchen oder die Lebensumstände der Geschundenen so drastisch darzustellen. Hauptperson ist der Ex-Häftling Jean Valjean, der es dank eines mildtätigen Bischofs schafft, in eine normale und sogar erfolgreiche Existenz zurückzukehren. In seiner neuen Identität setzt er alles daran, die todkranke Arbeiterin Fantine und deren kleine Tochter Cosette zu retten. Doch holt ihn seine Vergangenheit ein; der Polizeiinspektor Javert lässt ihn nicht in Frieden, er will Valjean unbedingt wieder hinter Gittern sehen. Dieses Geschehen bildet den Rahmen für zahlreiche Nebenhandlungen und ausführliche Schilderungen der damaligen Missstände, mit einem Detailreichtum, wie es in der europäischen Literatur sonst nur Charles Dickens vermochte. Der Stoff war Grundlage für zahlreiche Verfilmungen, verschiedene Theaterstücke und ein Musical, die letzte Adaption erblickte 2012 mit Hugh Jackman in der Rolle des Valjean und Russell Crowe als Inspektor Javert das Licht der Welt. »Die Entlassung bedeutete noch nicht die Freiheit. Kommt man aus dem Zuchthaus heraus, so hat man damit noch nicht die Verurteilung abgeschüttelt.« Null Papier Verlag
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 2194
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Victor Hugo
Die Elenden - Les Misérables
Überarbeitung der Erstübersetzung
Victor Hugo
Die Elenden - Les Misérables
Überarbeitung der Erstübersetzung
(Les Misérables)Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected]Übersetzung: Jürgen Schulze, Dr. G. A. Volchert 5. Auflage, ISBN 978-3-954185-62-7
null-papier.de/newsletter
Inhaltsverzeichnis
Über dieses Buch
Über den Autor
Über diese Fassung
Erster Teil – Fantine
Erstes Buch. Ein Gerechter
Zweites Buch. Der Fehltritt
Drittes Buch. Im Jahre 1817
Viertes Buch. In schlechten Händen
Fünftes Buch. Dem Abgrund zu
Sechstes Buch. Javert
Siebentes Buch. Der Fall Champmathieu
Achtes Buch. Der Rückschlag
Zweiter Teil – Cosette
Erstes Buch. Waterloo
Zweites Buch. Der Orion
Drittes Buch. Das eingelöste Versprechen
Viertes Buch. Das Gorbeausche Haus
Fünftes Buch. Eine stumme Meute
Sechstes Buch. Das Kloster Petit-Picpus
Siebentes Buch. Eine Parenthese
Achtes Buch. Die Kirchhöfe nehmen, was man ihnen gibt
Dritter Teil – Marius
Erstes Buch. Ein Atom von Paris
Zweites Buch. Ein Mann von altem Schrot und Korn
Drittes Buch. Großvater und Enkel
Viertes Buch. Die Freunde des A-B-C
Fünftes Buch. Die Vorteile des Unglücks
Sechstes Buch. Die Zusammenkunft zweier Sterne
Siebentes Buch. Patron-Minette
Achtes Buch. Der böse Arme
Vierter Teil – Eine Idylle und eine Epopöe
Erstes Buch. Ein wenig Geschichte
Zweites Buch. Eponine
Drittes Buch. In der Rue Plumet
Viertes Buch. Hilfe, die von unten ausgeht und von oben ankommt
Fünftes Buch. Schlechter Anfang, gutes Ende
Sechstes Buch. Der kleine Gavroche
Siebentes Buch. Die Gaunersprache
Achtes Buch. Freud und Leid
Neuntes Buch. Wohin?
Zehntes Buch. Am 5. Juni 1832
Elftes Buch. Eine Winzigkeit, die sich mit dem Orkan verbrüdert
Zwölftes Buch. Corinthe
Dreizehntes Buch. Marius unter den Insurgenten
Vierzehntes Buch. Die Großtaten der Verzweiflung
Fünfzehntes Buch. Die Rue de l’ Homme-Armé
Fünfter Teil – Jean Valjean
Erstes Buch. Eine Schlacht zwischen vier Wänden
Zweites Buch. Das Innere des Lewiathan
Drittes Buch. In den Regionen des Kots
Viertes Buch. Javert gerät aus seinem Geleise
Fünftes Buch. Enkel und Großvater
Sechstes Buch. Eine schlaflose Nacht
Siebentes Buch. Der letzte Tropfen des Kelches
Achtes Buch. Es nachtet schwärzer
Neuntes Buch. Durch Nacht zum Licht
Nachtrag
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Klassiker bei Null Papier
Alice im Wunderland
Anna Karenina
Der Graf von Monte Christo
Die Schatzinsel
Ivanhoe
Oliver Twist oder Der Weg eines Fürsorgezöglings
Robinson Crusoe
Das Gotteslehen
Meisternovellen
Eine Weihnachtsgeschichte
und weitere …
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
Über dieses Buch
Victor Hugo beendete dieses Meisterwerk, das zu den wichtigsten Werken der französischen Literatur gehört, im Jahre 1862, als er im Exil weilte. Es schildert das bedrückende Dasein der Unterschicht, der Elenden, der Verzweifelten, der Menschen, denen man selbst eine zweite Chance verwehrt.
Der Roman trug durch seine Themen- und Sprachwahl wesentlich zur Herausbildung der realistischen Literatur im 19. Jahrhundert bei. Kein anderer Autor von Weltrang hatte es zuvor gewagt, in seinen Texten zu fluchen oder die Lebensumstände der Geschundenen so drastisch darzustellen.
Hauptperson ist der Ex-Häftling Jean Valjean, der es dank eines mildtätigen Bischofs schafft, in eine normale und sogar erfolgreiche Existenz zurückzukehren. In seiner neuen Identität setzt er alles daran, die todkranke Arbeiterin Fantine und deren kleine Tochter Cosette zu retten. Doch holt ihn seine Vergangenheit ein; der Polizeiinspektor Javert lässt ihn nicht in Frieden, er will Valjean unbedingt wieder hinter Gittern sehen.
Dieses Geschehen bildet den Rahmen für zahlreiche Nebenhandlungen und ausführliche Schilderungen der damaligen Missstände, mit einem Detailreichtum, wie es in der europäischen Literatur sonst nur Charles Dickens vermochte.
»Die Elenden ist ein Buch der Nächstenliebe, ein aufpeitschender Mahnruf an eine selbstgefällige Gesellschaft, die sich nicht um die ewigen Gebote der Brüderlichkeit kümmert.« (Charles Baudelaire)
Der Stoff war Grundlage für zahlreiche Verfilmungen, verschiedene Theaterstücke und ein Musical, die letzte Adaption erblickte 2012 mit Hugh Jackman in der Rolle des Valjean und Russell Crowe als Inspektor Javert das Licht der Welt.
»Die Entlassung bedeutete noch nicht die Freiheit. Kommt man aus dem Zuchthaus heraus, so hat man damit noch nicht die Verurteilung abgeschüttelt.«
Über den Autor
Die Folgen der Revolution beschäftigen Frankreich, als Victor Hugo am 26. Februar 1802 in Besançon geboren wird, zwei Jahre, zwei Monate und zwei Tage nach der Verabschiedung der Konsulatsverfassung, die Napoleon Bonaparte praktisch zum rechtmäßigen Alleinherrscher aller Franzosen bestimmte.
Der junge Royalist
In dieser gesellschaftspolitisch aufgeladenen Atmosphäre wächst der jüngste Sohn von Sophie Trébuchet und General Joseph Léopold Sigisbert Hugo auf. Prägende Kindheitserfahrungen dürften sowohl das unharmonische Verhältnis der Eltern sein als auch das Fehlen fester Bezugspersonen, weil Vater Hugo selten daheim ist und die Mutter ihr Herz einem anderen Mann schenkt.
Victor Hugo
Victor beteiligt sich früh an Dichterwettbewerben und gründet als Jugendlicher eine royalistische Literaturzeitschrift, die er gemeinsam mit seinen Brüdern betreibt. Zu jener Zeit, im Alter von 17 Jahren, nimmt er ein Jurastudium in Paris auf, wo er gleichzeitig Zutritt zu den städtischen Literaturkreisen findet. Im Jahr 1820 erhält er seine erste Gratifikation für die »Ode sur la mort du duc de Berry«. Zwei Jahre später erscheint sein erster Gedichtband, dessen vollkommen royalistische Haltung ihm eine jährliche Pension von 1000 Francs einbringt.
Literat und Politiker
Seine literarischen Erfolge sind groß genug, um dem hoffnungsfrohen Schriftsteller ein bescheidenes Auskommen zu ermöglichen. Privat sind die frühen 1820er Jahre eine Zeit des Erwachsenwerdens, als Victor Hugo die junge Adèle Foucher zur Frau nimmt. Sie schenkt ihm fünf Kinder, von denen nur die jüngste Tochter ihren Vater überleben wird.
Mit Glück und Unglück der Familie geht der literarische Aufstieg Hugos einher, dem es gelingt, seinen Lieben eine vorerst genügsame Existenz zu erarbeiten, als er für sein 1823 veröffentlichtes Romandebüt »Han d’Islande« Bezüge von jährlich 2000 Francs bekommt. Im folgenden Jahr kündigen sich zarte Knospen eines Gesinnungswandels an, als er in den Kreis der Romantiker um Charles Nodier aufgenommen wird. Noch bleibt Hugo der Royalist, als der er aufgewachsen ist, ab 1826 vollzieht er einen radikal erscheinenden Gesinnungswandel zum Liberalen. Schon ab 1827 gilt Victor Hugo als maßgeblich für die romantische Literatur, zwei Jahre später erscheinen seine zunächst gemäßigten, später eindeutig regimekritischen Romane und Dramen.
Das Jahr 1833 kennzeichnet einen neuen Lebensabschnitt Hugos, als die Schauspielerin Juliette Drouet zu seinem neuen privaten Glück wird. Spätestens seit 1838 ist der Schriftsteller ein wohlhabender Mann, denn ein Verlag erwirbt für eine stattliche Summe sämtliche Rechte an Hugos Werken. Fünf Jahre später wird der Autor zum Mitglied der Académie française gewählt, 1845 schließlich ernennt ihn »Bürgerkönig« Louis-Philippe zum Pair. Seine Kollegen im Oberhaus verunsichert der Autor durch liberale Stellungnahmen, die von einem konservativen Abgeordneten in dieser Weise nicht zu erwarten sind.
Sein unabhängiges Denken trägt ihm im Jahr 1852 Verhaftung und anschließende Verbannung ein, als er gegen den Staatsstreich Bonapartes demonstriert. Sein Exil in Saint Peter Port nutzt der missliebige Schriftsteller, um »Napoléon le Petit« aus der Ferne zu attackieren und um sozialkritische Schriften zu verfassen. Im Jahr 1871, Napoléon III. ist gestürzt und die Dritte Republik ausgerufen, kehrt Hugo nach Paris zurück, wo er 1876 in den Senat gewählt wird. Als er 1885 stirbt, ist der leidenschaftliche Literat und Homo politicus eine intellektuelle Institution Frankreichs. Victor Hugo wird in der zum Panthéon umgewidmeten Kirche der Heiligen Genoveva in einem Ehrengrab beigesetzt.
Bedeutung und Schaffen des Monsieur Hugo
Die Trauer der Franzosen um ihren Nationalschriftsteller – seine Bedeutung ist mit derjenigen Goethes für Deutschland vergleichbar – war enorm, das Bedürfnis überwältigend, ihn angemessen zu ehren. Die Pariser Kirche St. Genoveva war bereits während der Revolutionsjahre zum Panthéon umgewidmet, später erneut geweiht und nun, anlässlich Hugos Bestattung, wieder zur Ehrenhalle ernannt worden. Der Autor war nach einem Schlaganfall im Jahr 1878 weniger aktiv gewesen als zuvor, dennoch galt er zum Zeitpunkt seines Todes als lebende Legende, als eine der bedeutsamsten Berühmtheiten seiner Zeit.
Das lag selbstverständlich an seinem mutigen politischen Engagement einerseits, andererseits besaß Hugo gewaltigen kulturellen Einfluss: In den späten 1820er Jahren, als er stilistisch und politisch gewissermaßen erwachte, prägte er sowohl Theater als auch Literatur der Romantik, als deren Kopf er seit 1827 galt. Unter anderem löste sein Stück »Hernani« bei der Premiere im Jahr 1830, heftige Auseinandersetzungen im Publikum aus.
Eines der bekanntesten Werke Hugos ist der im folgenden Jahr veröffentlichte historische Roman »Notre-Dame de Paris« (Der Glöckner von Notre-Dame), der viel mehr ist als das heute häufig aufgegriffene Liebesdrama um den verkrüppelten Quasimodo und seine schöne Esmeralda. Bei der unglücklichen Verehrung Quasimodos für die angebliche Zigeunerin handelt es sich lediglich um einen der vielen Handlungsstränge, die Hugo erst am Ende zusammenführt. Das Buch ist gleichermaßen sozial- und regimekritisch; darüber hinaus spricht es kulturelle Werte an, die seinerzeit kaum Beachtung fanden, indem es sich beispielsweise für den Erhalt historischer Bausubstanz einsetzt. Der Roman stieß bereits kurz nach Erscheinen auf außerordentlichen Anklang, Schriftstellerkollegen würdigten ihn als epochal – Lamartine erklärte Hugo gar zum »Shakespeare des Romans«.
Wie kein Zweiter verstand es Victor Hugo, dieser zutiefst politische Literat, Privates mit Gesellschaftlichem zu verknüpfen. Auch in »Notre-Dame de Paris« schlägt sich sein persönliches Fühlen nieder, wenn er einen seiner Protagonisten ins Unglück stürzt, indem er ihn verheiratet: Der Autor selbst verlor seine erste Gattin an einen Freund und Schriftsteller-Kollegen, der Affäre stand er hilflos duldend gegenüber. Erst nachdem er seine neue Lebensgefährtin Juliette Drouet kennenlernte, wich die Bitterkeit wieder aus seinen Schriften.
Nach der Julirevolution von 1830 verfasste Hugo zunächst extrem kritische Werke. Nachdem er aber den »Bürgerkönig« Louis-Philippe persönlich kennengelernt hatte, verlor sich diese Distanz vorerst. Anfangs musste der Literat damit leben, dass Stücke verboten wurden, »Le roi s’amuse« (Der König amüsiert sich) aus dem Jahr 1832 beispielsweise. Die weniger aufrührerischen oder gänzlich unkritischen Werke der folgenden Jahre, »Lucrèce Borgia«, »Marie Tudor«, »Angelo« und »Ruy Blas« wurden hingegen öffentlich goutiert. Gleichzeitig schrieb Hugo mehrere Gedichtbände, in denen sich nicht selten Persönliches niederschlug. Das änderte sich ab 1848 und während der Jahre des Exils auf Jersey und Guernsey, denn hier entstanden sowohl bissige politische Gedichte als auch das im Jahr 1862 vollendete »Les Misérables« (Die Elenden), woran der Autor bereits seit 1847 gearbeitet hatte. In gewisser Weise fließen in diesem Buch die Persönlichkeitsanteile des großen Franzosen wie in einem Schmelztiegel ineinander: sein kritischer Verstand, seine Urteilskraft und seine Fähigkeit zur Anteilnahme.
Über diese Fassung
Zwei dicke Bände, mit zusammen mehr als 1500 Seiten in Frakturschrift, um 1910 erstmalig veröffentlicht, formten die erste Veröffentlichung von Die Elenden auf dem deutschen Markt.
Natürlich kann man diese Originalübersetzung nicht ohne Überarbeitung veröffentlichen, zu schwer, zu holperig wäre der Lesegenuss. Daher habe ich es mir erlaubt, den Text einem Deutsch anzupassen, wie es ein heutiger Leser erwarten darf.
»Rhätsel« wird zu »Rätsel«, »Capitel« zu »Kapitel«, »Discussion« zu »Diskussion«. Dazu gibt es dutzende Korrekturen der direkten Rede oder der willkürlichen – zumindest für uns ungewohnten – Apostrophierung.
Als eine französische Geschichte, habe ich natürlich die geläufigsten Ausdrücke belassen: »Tricot« bleibt »Tricot«, wird nicht zu »Trikot«; ebenso überleben »Courtisane«, »Flacon«, »Couleur«, »Cousin« usw.
Aber manche missglückte Ur-Übersetzung wurde von mir korrigiert: Das »Büffet« wurde wieder zu dem auch in Deutschland gebräuchlichen »Buffet«.
Dazu kommen noch einige erklärende Fußnoten für hübsche Wörter, die ich einfach nicht ersetzen wollte, wie das anheimelnde »interpellieren« oder der »Oheim«, der ja auch bei uns durch den profaneren »Onkel« ersetzt wird.
Wenn es Sie interessieren sollte, wie ein E-Book erzeugt wird, so können Sie hier eine kleine Geschichte aus meiner Werkstatt lesen: http://null-papier.de/story
Ich hoffe, Sie haben Freude an dieser Geschichte.
Jürgen Schulze
Erster Teil
Fantine
So lange kraft der Gesetze und Sitten eine soziale Verdammnis existiert, die auf künstlichem Wege, inmitten einer hoch entwickelten Zivilisation, Höllen schafft und noch ein von Menschen gewolltes Fatum zu dem Schicksal, das von Gott kommt, hinzufügt; so lange die drei Probleme des Jahrhunderts, die Entartung des Mannes durch das Proletariat, die Entsittlichung des Weibes infolge materieller Not und die Verwahrlosung des Kindes, nicht gelöst sind; so lange in gewissen Regionen eine soziale Erstickung möglich sein wird, oder in anderen Worten und unter einem allgemeineren Gesichtspunkt betrachtet, so lange auf der Erde Unwissenheit und Elend bestehen werden, dürften Bücher wie dieses nicht unnütz und unnötig sein.
Erstes Buch. Ein Gerechter
I. Myriel
Im Jahre 1815 war Charles François Bienvenu Bischof von Digne. Er zählte damals fünfundsiebzig Jahre und hatte sein hohes Amt seit 1806 inne.
Letzterer Umstand steht eigentlich in keiner wesentlichen Beziehung zu dem Inhalt unserer Erzählung, aber vielleicht ist es nicht überflüssig, – wäre es auch nur der Genauigkeit wegen – hier zu berühren, was über ihn bei seiner Ankunft in der Diözese erzählt und gemutmaßt wurde. Was man von einem Menschen sagt, spielt ja, gleichviel ob es wahr oder falsch ist, in seinem Leben oft eine ebenso wichtige Rolle wie seine Taten und Handlungen. Myriel war der Sohn eines Parlamentsrats der Stadt Aix, gehörte also zu dem Beamtenadel. Man erzählte sich, sein Vater, der ihm sein Amt vererben wollte, habe ihn schon, als er erst achtzehn oder zwanzig Jahre alt war, verheiratet, wie dies bei dem Parlamentsadel gebräuchlich war. Trotz dieser Heirat hätte aber Charles Myriel viel von sich reden gemacht. Er war gut gewachsen, wenn auch von kleiner Statur, hielt sehr auf sein Äußeres, hatte feine Manieren und viel Geist und brachte den ersten Abschnitt seines Lebens mit weltlichen Zerstreuungen und Liebesabenteuern hin.
Da brach die große Revolution von 1789 aus, und als bald wurden auch die Familien des Parlamentsadels in den Strudel hineingerissen und dezimiert, aus dem Lande gejagt, verfolgt, auseinander gesprengt. Auch Charles Myriel emigrierte gleich zu Anfang der Revolution nach Italien. Hier starb seine Frau an einer Brustkrankheit, an der sie schon seit Jahren gelitten hatte. Kinder hatten sie nicht. War es der Zusammenbruch der alten Weltordnung, der Niedergang seiner Familie, die Dramen des Schreckensjahres 1793, die den Emigrierten aus der Ferne noch entsetzlicher erschienen als sie in Wirklichkeit waren, kurz, waren es die äußerlichen Umwälzungen, die ihn der Welt und ihren Freuden entfremdeten? Oder traf mitten in dem Strudel seiner Vergnügungen ihn persönlich ein Unglück, das die tiefsten Tiefen seines Herzens aufwühlte und seinem Denken eine andere Richtung wies? Diese Fragen wusste niemand zu beantworten; nur so viel stand fest, dass er, aus Italien zurückgekehrt, Priester war.
Im Jahre 1804 war Myriel Pfarrer von Brignolles, wo er ein sehr zurückgezogenes Leben führte. Zu dieser Zeit, kurz nach Napoleons Kaiserkrönung, kam er einmal behufs Erledigung eines Amtsgeschäftes nach Paris und musste unter anderem auch dem Kardinal Fesch seine Aufwartung machen. Während nun unser wackerer Pfarrer im Vorzimmer wartete, kam zufällig auch der Kaiser um den Kardinal, seinen Oheim,1 zu besuchen. Ihm fiel ein gewisser Ausdruck von Neugierde auf, mit dem die Augen des Pfarrers ihm folgten, und, sich umwendend, fragte er barsch:
»Wer ist denn der gute Mann, der mich so ansieht?«
»Majestät, sagte Myriel, sehen einen guten, und ich einen großen Mann. Beide Teile können profitieren.«
Der Kaiser fragte nachher den Kardinal sofort nach dem Namen dieses Pfarrers, und kurze Zeit darauf erfuhr Myriel zu seiner großen Verwunderung, dass er auf den Bischofssitz von Digne berufen sei.
Im Übrigen wusste niemand, ob an den Gerüchten, die über Myriels Vorleben in Umlauf waren, etwas Wahres sei. Nur wenige hatten seine Familie gekannt.
Selbstredend ging es Myriel wie jedem Neuangekommenen in jeder Kleinstadt, wo jedermann einen Mund zum Reden, aber nur Wenige ein Hirn zum Denken haben. Er musste die Leute reden lassen, obgleich und weil er Bischof war. Was man sich über ihn erzählte, waren nur Reden, nur leeres Wortgeklingel, und als er neun Jahre in Digne residiert hatte, war all der Klatsch, der anfangs alle kleinen Geister in dieser kleinen Stadt in große Aufregung versetzt hatte, der Vergessenheit anheimgefallen. Niemand wagte mehr davon zu sprechen, niemand ihn zu gehässigen Zwecken auszubeuten.
Myriel brachte nach Digne ein altes Fräulein namens Baptistine, mit, die seine Schwester und zehn Jahre jünger war als er. Die ganze Dienerschaft der beiden Geschwister bestand in einer Magd desselben Alters wie Fräulein Baptistine, namens Frau Magloire, die ehedem nur die »Magd des Herrn Pfarrers« gewesen und nun zugleich als Kammerfrau des Fräulein Baptistine und als Wirtschafterin Sr. Bischöflichen Gnaden fungierte.
Fräulein Baptistine war eine hoch gewachsene, blasse, hagere Dame von sanftem Wesen, eine Verkörperung alles dessen, was ein weibliches Wesen achtungswert macht; denn auf Ehrfurcht Anspruch machen darf jawohl nur das Weib, das Mutter ist. Hübsch war sie nie gewesen, aber da ihr ganzes Leben mit Werken frommer Liebestätigkeit ausgefüllt worden war, so war jetzt über ihre äußere Erscheinung eine Art lichter Klarheit ausgegossen, etwas, das man die Schönheit des Gemüts nennen kann. Was in ihrer Jugend Magerkeit gewesen, hatte sich jetzt zu engelhafter Durchsichtigkeit verklärt. Sie war mehr Seele noch als jungfräuliches Weib, gleichsam ein Schatten mit so viel Körper, dass man ihm noch ein Geschlecht beilegen konnte; ein wenig Stoff, der einen lichten Glanz einhüllte. Dazu große Augen, die sie immer zur Erde gesenkt hielt, als suche diese Seele einen Vorwand noch hienieden zu verweilen.
Frau Magloire war eine kleine, dicke Alte, die immer keuchte, weil sie sich im Hause tüchtig tummelte, und zweitens, weil sie engbrüstig war.
Als Myriel seinen Einzug in Digne hielt, wurde er mit den üblichen hohen Ehrungen, gemäß den kaiserlichen Dekreten, laut denen die Bischöfe im Range unmittelbar den Brigadegenerälen folgen, in dem bischöflichen Palast installiert. Der Maire und der Präsident machten ihm zuerst ihre Aufwartung, und er seinerseits besuchte zuerst den General und den Präfekten. Dann, nachdem die Installation vollzogen war, wartete die Stadt, wie ihr neuer Bischof seines Amtes walten würde.
Onkel <<<
II. Herr Myriel wird der Herr Bischof Bienvenu
Der bischöfliche Palast in Digne lag neben dem Hospital. Es war ein großes, schönes Gebäude, das zu Anfang des 18. Jahrhunderts von Henri Puget, Doktor der Theologie und 1712 Bischof von Digne, errichtet worden war. Alles in diesem wahrhaft fürstlichen Schloss war in großem Stile angelegt: die Wohnzimmer des Bischofs, die Säle, die Kammern, der große Ehrenhof nebst den Wandelgängen, die sich, von altflorentinischen Arkaden überwölbt, um ihn herumzogen, die mit herrlichen Bäumen bepflanzten Gärten. In dem Speisesaal, einer langen und prachtvollen Galerie, die im Erdgeschoss belegen war und sich nach den Gärten hinaus öffnete, hatte einst Henri Puget sieben hohe Würdenträger der Kirche feierlichst bewirtet. Die Bildnisse dieser sieben ehrfurchtgebietenden Prälaten schmückten den Saal, und das denkwürdige Datum, der 29. Juli 1714, war mit goldnen Buchstaben auf einer weißen Marmortafel eingegraben.
Das Hospital war ein enges, niedriges, einstöckiges Haus mit einem kleinen Garten.
Drei Tage nach seiner Ankunft besichtigte der Bischof das Hospital. Nach Beendigung der Visitation ließ er sofort den Direktor zu sich bescheiden.
»Herr Direktor, redete er ihn an, wie viel Patienten haben Sie gegenwärtig?«
»Sechsundzwanzig, Ew. Bischöfliche Gnaden.«
»Soviel habe ich auch gezählt«, bemerkte der Bischof.
»Die Betten«, hob der Direktor wieder an, »stehen recht dicht aneinander.«
»Das ist mir auch aufgefallen.«
»Statt Säle haben wir nur Stuben, die schwer zu lüften sind.«
»Das scheint mir auch so.«
»Und fällt einmal ein Sonnenstrahl in den Garten, so ist er zu klein, die vielen Rekonvaleszenten zu fassen.«
»Das habe ich mir auch gesagt.«
»Wenn Epidemien umgehen, wie z.B. dieses Jahr der Typhus und vor zwei Jahren Friesel und Schweißfieber, haben wir bisweilen an die hundert Kranke und wissen dann nicht, wo wir mit ihnen hin sollen.«
»Der Gedanke ist mir auch in den Sinn gekommen.«
»Aber allen diesen Übelständen ist nun einmal nicht abzuhelfen«, sagte der Direktor. »Man muss sich fügen.«
Dieses Zwiegespräch fand in dem Speisesaal des Erdgeschosses statt.
Der Bischof schwieg einen Augenblick und wandte sich dann wieder an den Direktor mit der hastigen Frage:
»Herr Direktor, wie viel Betten, meinen Sie, würde wohl dieser Saal allein schon fassen?«
»Der Speisesaal Ew. Bischöflichen Gnaden?« rief der Direktor in maßlosem Erstaunen.
Der Bischof überschaute den Saal und schien mit den Augen Messungen anzustellen.
»Zwanzig Betten würden hier wohl Platz finden«, flüsterte er leise, als spreche er für sich. Dann, zu dem Direktor gewendet, fuhr er laut fort:
»Ich will Ihnen was sagen, Herr Direktor. Es liegt offenbar ein Irrtum vor. Ihr seid sechsundzwanzig Menschen in fünf bis sechs winzigen Zimmerchen. Unserer sind hier drei, und wir haben Platz für sechzig. Da liegt ein Irrtum vor, sage ich Ihnen noch einmal. Sie haben meine Wohnung, und ich die Ihrige. Geben Sie mir mein Haus wieder. Sie gehören hierhin.«
Am folgenden Tage waren die sechsundzwanzig armen Kranken in dem Palast des Bischofs untergebracht und der Bischof in das Krankenhaus übergesiedelt.
Myriel hatte, da seine Familie durch die Revolution ruiniert war, kein Vermögen. Seine Schwester bezog eine Leibrente von fünfhundert Franken, die seiner Zeit im Pfarrhause für ihre persönlichen Bedürfnisse ausgereicht hatten. Myriel erhielt vom Staate als Bischof ein Gehalt von fünfzehn Tausend Franken. Über diese Summe verfügte Myriel laut einer von ihm selber aufgestellten Rechnung, deren Original uns vorliegt, ein für alle Mal folgendermaßen:
Ausgaben für meinen Haushalt.
-
-
Für das kleine Seminar
1500
Franken
Für die Missionskongregation
100
〃
Für die Lazaristen zu Montdidier
100
〃
Für das Seminar der auswärtigen Missionen in Paris
200
〃
Für die Kongregation des Heiligen Geistes
150
〃
Für die religiösen Anstalten im Heiligen Lande
100
〃
Für die Frauenvereine zur Unterstützung armer Wöchnerinnen
300
〃
Für den Verein in Arles außerdem noch
50
〃
Für die Verbesserung der Gefängniseinrichtungen
400
〃
Zur Unterstützung und Befreiung Gefangener
500
〃
Für die Befreiung von Familienvätern aus dem Schuldgefängnis
1000
〃
Zuschuss zu den Gehältern der armen Schullehrer der Diözese
2000
〃
Für das Getreidemagazin der Oberalpen
100
〃
Für die Kongregation der Damen von Digne, Manosque und Sisteron zur Erteilung von unentgeltlichem Unterricht an bedürftige Mädchen
1500
〃
Für die Armen
6000
〃
Für meine persönlichen Ausgaben
1000
〃
-
-
--------
Summa
15.000
Franken
An dieser Einrichtung »seines sogenannten Haushaltes« änderte er nichts, so lange er den Bischofssitz zu Digne inne hatte.
Dieser Anordnung unterwarf sich auch Fräulein Baptistine ohne den geringsten Widerspruch. Für diese fromme Dame war Myriel nicht allein ihr Bruder, sondern auch ihr Bischof, ein Freund, den die Natur ihr zugesellt, und ein Vorgesetzter, den die Kirche ihr übergeordnet hatte. Sie brachte ihm nur Liebe und Ehrfurcht entgegen. Allen seinen Worten pflichtete sie bei; was er tat, hieß sie gut. Nur die Magd, Frau Magloire, murrte ein wenig. Hatte doch, der Herr Bischof, – wie aus der oben angeführten Rechnung erhellt,– sich nur tausend Franken vorbehalten, was mit Fräulein Baptistines Pension fünfzehn Hundert Franken jährlich ergab. Mit diesen fünfzehn Hundert Franken bestritten die beiden Frauen und der alte Herr ihren ganzen Lebensunterhalt.
Und wenn ein Dorfpfarrer nach Digne kam, brachte es der Bischof noch fertig ihn anständig zu bewirten, dank Frau Magloires großer Sparsamkeit und Fräulein Baptistines weiser Haushaltungskunst. Eines Tages – er war damals seit etwa drei Monaten in Digne – sagte der Bischof: »Meine Einkünfte wollen doch gar nicht recht zulangen!«
»Das wollte ich meinen! rief Frau Magloire. Wenn Bischöfliche Gnaden sich wenigstens noch das Geld auszahlen ließen, das Ihnen das Departement als Vergütung für Equipage1 und Reiseunkosten schuldig ist. Die Vorgänger Ew. Bischöflichen Gnaden haben’s doch immer so gehalten!«
»In der Tat, Sie haben recht, Frau Magloire«, stimmte ihr der Bischof bei und reichte ein Gesuch bei der Stadtverwaltung ein.
Der Generalrat zog auch das Gesuch in Erwägung und warf einen Posten von dreitausend Franken jährlich aus, als Vergütung der Unkosten, die der Herr Bischof für seine Equipage in der Stadt und für seine Reisen mit der Post zu bestreiten habe.
Natürlich erhoben die Freidenker ein Zetergeschrei und ein Senator namentlich, ein ehemaliges Mitglied des Rates der Fünfhundert, der dem Staatsstreich vom 18. Brumaire zugestimmt und von Napoleon ein bei Digne gelegenes großes Gut als Dotation erhalten hatte, erließ an den Kultusminister Bigot de Préameneu einen entrüsteten Schreibebrief, dem wir folgende Zeilen entnehmen:
»Wozu eine Equipage in einer Stadt, die keine viertausend Einwohner hat? Und Unkosten für Rundreisen? Was sollen denn solche Rundreisen für einen Zweck haben? Und wie reist man denn per Post in einem Gebirgslande? Wir haben hier ja überhaupt keine Chausseen. Man reist hier nur zu Pferde. Kaum dass die Brücke über die Durance bei Chateau-Arnoult ein Ochsenfuhrwerk tragen kann! Aber so sind die Priester alle! Geldgierig und geizig. Der hier hat sich Anfangs auf den Heiligen ausgespielt. Jetzt macht er’s wie die anderen. Er muss in einer Equipage fahren und in einer Postkutsche reisen! Er braucht Luxus wie die Bischöfe des alten Regime. O über dieses Pfaffengeschmeiß! Glauben Sie nur, Herr Graf, ehe uns der Kaiser die Schwarzröcke nicht vom Halse schafft, werden die Zustände nicht besser. Nieder mit dem Papst! (Frankreich stand damals mit Rom auf gespanntem Fuße). Ich für mein Teil bin dafür, dass Cäsar allein regiert. U.s.w. U.s.w.«
Desto mehr freute sich Frau Magloire.
»So ist’s recht, sagte sie zu Fräulein Baptistine. Se. Bischöfliche Gnaden haben bis jetzt nur für andere gesorgt, aber schließlich haben Sie doch endlich auch an sich denken müssen. Die Armen sind nun versorgt, und die dreitausend Franken bleiben für uns. Es war auch Zeit, dass wir was kriegten!«
An dem Abend desselben Tages stellte der Bischof wieder eine Rechnung auf und gab sie seiner Schwester. Sie lautete folgendermaßen:
Unkosten für Equipage und Amtsreisen.
-
-
Zu Bouillon für die Kranken unseres Hospitals
1.500
Franken
Für den Frauenverein zu Arles
250
〃
Für den Frauenverein zu Draguignan
250
〃
Für die Findelkinder
500
〃
Für die Waisenkinder
500
〃
-
-
--------
Summa
3.000
Franken
Das war Myriels Budget.
Was die Nebeneinkünfte anbelangt, die Einnahmen für Abkauf von Aufgeboten, für Dispensationsscheine, Nottaufen, Predigten, Einweihungen von Kirchen und Kapellen, Hochzeiten u.s.w., so trieb der Bischof diese Gelder von den Reichen mit umso größerer Strenge ein, da er sie sämtlich den Armen zuwandte.
Nach Verlauf einer kurzen Zeit flossen ihm denn auch Liebesgaben in reicher Menge zu. Begüterte und Bedürftige, alle klopften an Myriels Tür, die einen um Spenden bei ihm zu hinterlegen, die anderen um sie in Empfang zu nehmen. Aber so beträchtliche Summen ihm auch durch die Hände gingen, so fand er sich doch nicht veranlasst seine Lebenshaltung in irgend einem Punkte zu ändern und sich außer dem Notwendigen auch Überflüssiges zu gestatten.
Im Gegenteil. Da in der menschlichen Gesellschaft allzeit unten mehr Elend als oben Wohltätigkeitssinn vorhanden ist, so war alles schon weggegeben, ehe er es bekommen hatte, so fiel alles wie ein Tropfen auf einen heißen Stein. Man konnte ihm noch so viel Geld geben, nie hatte er etwas. In solchen Fällen gab er noch mehr von dem Seinigen her.
Der dankbare Instinkt des Volkes wählte denn auch unter den Vornamen, die sein Bischof dem Brauche gemäß in seinen Erlassen und Hirtenbriefen vollständig aufzählte, denjenigen heraus, der einen bedeutungsvollen Sinn darbot. Die armen Leute nannten ihn nur den Bienvenu (Willkommen, Segensreich). Wir wollen diesem Beispiel folgen und ihn gelegentlich gleichfalls so nennen. Ihm selber sagte übrigens diese neue Bezeichnung zu. »Der Name gefällt mir«, ließ er sich vernehmen. »Er mildert, was der Titel Bischöfliche Gnaden zu Stolzes hat.«
Dass diese Schilderung, die wir hier entwerfen, die Wahrscheinlichkeit für sich habe, wagen wir nicht zu behaupten, wohl aber ist sie der Wahrheit gemäß.
Gepäck <<<
III. Ein tüchtiger Arbeiter findet viel zu tun
Der Bischof hatte zwar seine Equipage in Almosen umgewandelt, bereiste aber gleichwohl fleißig seinen Amtssprengel, was mit erheblichen Strapazen verbunden war. Die Diözese Digne ist ein Land mit wenig Ebenen und viel Bergen, dabei fast ohne Chausseen, wie schon erwähnt. Sie umfasst zweiunddreißig Pfarreien, einundvierzig Vikariate und zweihundert fünfundachtzig Filialkirchen. Dies alles zu bewältigen, erheischte keine geringe Summe von Arbeitskraft, die aber unser Bischof aufzubringen verstand. War der betreffende Ort in der Nachbarschaft gelegen, so ging er zu Fuß; in den ebenen Gegenden fuhr er in einer Halbkutsche, im Gebirge ritt er auf einem Maultier. Die beiden Frauen begleiteten ihn gewöhnlich, außer wenn die Strapazen das billige Maß überstiegen. In diesem Fall reiste er allein.
Eines Tages ritt er in Senez, einer alten Bischofsstadt, auf einem Esel ein. Ein anderes Transportmittel hatte er wegen der starken Ebbe, die in seiner Börse aufgetreten war, nicht genehmigen können. Als er nun von seinem Esel abstieg, maß ihn der Bürgermeister, der sich zu seinem Empfange vor dem Bischofspalais eingefunden, mit Blicken, aus denen tiefe sittliche Entrüstung sprach, und einige Vorübergehende, die ihrer Kleidung nach zu urteilen den besseren Ständen angehörten, blieben stehen und lachten.
»Meine Herren, sagte der Bischof, ich kann mir das Motiv Ihres Unwillens denken: Sie finden es anmaßlich, dass ein armer Priester sich des Reittieres Jesu Christi bedient. Ich versichere Sie aber, ich tue es aus Not, nicht aus Eitelkeit.«
Wohin er auch bei einer solchen Rundreise kam, stets zeigte er sich milde und nachsichtig gegen seine Untergebenen und in seinen Predigten schlug er vorzugsweise einen gemütlichen Gesprächston an. Weither geholte Gründe und Beispiele liebte er nicht. Dagegen ermahnte er die Leute an einem Ort sich die Bewohner eines anderen, benachbarten, zum Vorbild zu nehmen. Wo man hart gegen die Bedürftigen war, sagte er z.B.: »Nehmt Euch Eure Nachbarn in Briançon zum Vorbild. Sie haben den Armen, den Witwen und Waisen die Erlaubnis erteilt, ihre Wiesen drei Tage vor den anderen abmähen zu lassen und reparieren ihnen ihre Häuser, wenn sie baufällig geworden sind, unentgeltlich. Deshalb hat aber auch der liebe Gott das Land gesegnet, denn volle hundert Jahre lang ist daselbst kein Mord vorgekommen.«
Zu Leuten, die bei der Ernte zu genau verfuhren, sagte er. »Seht Euch mal an, wie sie’s in Embrun machen. Hat ein Familienvater Söhne beim Militär oder Töchter, die in der Stadt dienen, und kann er wegen Krankheit oder aus einem anderen Hinderungsgrunde die Einbringung seiner Ernte nicht besorgen, so empfiehlt ihn der Pfarrer der Gemeinde, dann kommen am Sonntag alle Leute aus dem Dorfe, die Männer, die Frauen, die Kinder, mähen ihm sein Getreide und schaffen es ihm, Korn und Stroh, in seine Scheune.« – Zu den Familien, die wegen Geld- und Erbschaftsangelegenheiten uneinig waren sagte er: »Schaut mal, wie sie’s in Devolny anfangen. Es ist das eine raue Gebirgsgegend, wo man den Gesang der Nachtigall kaum einmal in fünfzig Jahren zu hören bekommt. In diesem Lande also gehen die Söhne, wenn der Vater stirbt, in die Fremde, und überlassen das Erbe ihren Schwestern, damit diese sich verheiraten können.« – In den Kantonen, wo viel prozessiert wurde, sagte er: »Nehmt Euch die braven Bauern in Queyras zum Vorbild. Es sind ihrer dreitausend Seelen, und die Leute leben dort einträchtig, als bildeten sie eine kleine Republik für sich. Richter und Exekutor gibt’s dort nicht. Der Schulze besorgt da alles. Er veranlagt die Steuern, schätzt jeden ein, wie er’s vor seinem Gewissen verantworten kann, schlichtet unentgeltlich Streitigkeiten, teilt Erbschaften ohne Honorar zu fordern, fällt Urteilssprüche ohne den Leuten Unkosten zu verursachen, und er findet Gehorsam, weil er ein gerechter Mann ist und unter einfachen Leuten lebt.« In den Dörfern, wo kein Schullehrer war, verwies er wieder auf das Beispiel der Bauern in Queyras: Wisst Ihr, wie die’s machen? »Da ein Dorf mit nur zwölf bis fünfzehn Häusern nicht immer die Mittel besitzt einen Magister zu ernähren, so tun sich die Bewohner des ganzen Tales zusammen und halten sich Schulmeister. Die gehen von Dorf zu Dorf und geben hier acht, dort zehn Tage lang Unterricht. Diese Magister finden sich ein, wo Jahrmarkt ist, und ich habe selber welche gesehen. Sie sind an den Schreibfedern, die sie in einer Schnurschleife am Hute tragen, zu erkennen. Die nur Unterricht im Lesen erteilen, haben eine Feder; die im Lesen und Rechnen unterrichten, zwei; die Lesen, Rechnen und Latein lehren, drei. Diese letzteren sind große Gelehrte. Aber welche Schande unwissend zu sein! Ahmt den Leuten in Queyras nach.«
In dieser eindringlichen und väterlichen Ausdrucksweise pflegte er mit den Leuten zu reden. Und die Ermanglung von Beispielen erfand er Gleichnisse, hob deutlich das hervor, worauf es an kam, und brauchte wenig Redensarten, aber desto mehr bildliche Wendungen, wie Jesus Christus, dessen Beredsamkeit zu Herzen ging, weil sie aus dem Herzen kam.
IV. Übereinstimmung von Taten und Worten
Im Gespräch war er leutselig und heiter. Er passte sich dem Verständnis der beiden Frauen an, die bei ihm lebten. Lachen konnte er so herzlich wie ein Schulknabe.
Frau Magloire nannte ihn gern Hoher Herr. Eines Tages nun erhob er sich von seinem Sessel, um ein Buch zu holen, konnte es aber, da es auf einem oberen Regal lag und er zu kleiner Statur war, nicht langen. Da rief er Frau Magloire: »Bringen Sie mir doch einen Stuhl. Die Hoheit des hohen Herrn reicht nicht bis an das Brett da.«
Eine entfernte Verwandte von ihm, die Gräfin von Lô, ließ es sich selten entgehen, in seiner Gegenwart die »Hoffnungen« ihrer drei Söhne ausführlich aufzuzählen, nämlich all die Glücksgüter und Vorteile, die sie von reichen alten Verwandten binnen voraussichtlich kurzer Zeit erben würden. Der jüngste Sohn erwartete von einer Großtante ein Jahreseinkommen von nicht weniger als hunderttausend Franken; dem zweiten musste der Herzogstitel seines Oheims zufallen; der Älteste hatte Anwartschaft auf die Pairie seines Großvaters. Diesen unschuldigen und verzeihlichen Prahlereien der zärtlichen Mutter hörte meistenteils der Bischof mit musterhaftem Stillschweigen zu. Bei einer Gelegenheit indes hing er seinen eigenen Gedanken nach, während die Gräfin sich in weitschweifigen Erörterungen aller dieser Sukzessionen und »Hoffnungen« erging. Plötzlich brach sie ungeduldig ab und fragte ärgerlich: »Aber, Vetter, woran denken Sie denn?« »An einen sonderbaren Ausspruch, versetzte er, der, wenn ich nicht irre, sich in den Werken des heil. Augustin findet: Setzet Eure Hoffnung auf Den, dem niemand sukzediert.«1
Ein anderes Mal, als er eine Todesanzeige mit einem langatmigen Verzeichnis der Würden des Verstorbenen und der Adelstitel aller Verwandten desselben erhalten hatte, rief er aus: »Was für einen starken Rücken Freund Hein haben muss, dass man ihm soviel gewichtige Titel aufpacken kann, und wie gescheit die Menschen sind, da sie sogar in einem Grabe Gelegenheit zur Befriedigung ihrer Eitelkeit finden!«
Er verstand auch zu spotten, in harmloser Weise, aber fast immer mit einem ernsten Hintergedanken. So kam einmal während der Fastenzeit ein junger Vikar nach Digne und hielt eine recht beredte Predigt über die Mildtätigkeit. Er forderte die Reichen auf den Armen zu geben, um der Hölle zu entgehen, deren Schrecknisse er ihnen in den grellsten Farben ausmalte, und sich das Himmelreich zu erobern, das er als überaus lieblich und erstrebenswert hinstellte. Diese Schilderung machte auf einen seiner Zuhörer, der im Handel zwei Millionen zusammengerafft hatte, einen so nachhaltigen Eindruck, dass er von seiner Gepflogenheit niemals Almosen zu geben abließ und von der Zeit an jeden Sonntag an der Kirchentür eine kleine Kupfermünze für sechs Bettlerinnen spendete. Eines Tages nun, als er wieder diesen Akt hochherziger Mildtätigkeit vollzog, sah ihn der Bischof und bemerkte lächelnd zu seiner Schwester: »Sieh mal, da kauft sich Herr Geborand für einen Sou ewige Seligkeit.«
Handelte es sich um Mildtätigkeit, so ließ er sich selbst durch eine abschlägige Antwort nicht abschrecken und verstand es mit einer treffenden, geistreichen Entgegnung den Widerspenstigen anderen Sinnes zu machen. Einmal sammelte er in einer Gesellschaft für die Armen. Unter den Anwesenden befand sich der Marquis von Champtercier, ein reicher alter Geizhals, der das Kunststück fertig gebracht hatte zugleich ultraroyalistisch und ultravoltairianisch gesinnt zu sein. Denn es hat auch solche Käuze gegeben. Als der Bischof zu ihm gelangt war, berührte er ihn am Arm und sagte: »Herr Marquis, Sie müssen mir etwas geben.« Der Marquis wandte sich um und antwortete trocken: »Bischöfliche Gnaden, ich habe schon meine Armen.« »Dann geben Sie mir die«, entgegnete der Bischof.
Eines Tages hielt er im Dom folgende Predigt: »Teuerste Brüder, liebe Freunde, es gibt in Frankreich 1.320.000 Bauernhäuser mit nur drei, 1.817.000 mit zwei Öffnungen, der Tür und einem Fenster, und endlich 346.000 Hütten mit einer einzigen Öffnung, der Tür. Schuld daran ist etwas, das man die Tür- und Fenstersteuer nennt. Denkt Euch nun arme Familien, alte Frauen, kleine Kinder in solchen Behausungen und stellt Euch vor, was für Fieber, was für Krankheiten da herrschen müssen! Gott schenkt, das Gesetz verkauft den Menschen die Luft. Ich klage das Gesetz nicht an, aber Gottes Güte preise ich. In den Departements Isére, Bar, Ober- und Unteralpen haben die Landleute nicht einmal Schubkarren und tragen den Dünger auf dem Rücken; keine Talglichter, und brennen Kienspäne oder mit Harz bestrichene Stricke. So macht man es in dem ganzen Ober-Dauphiné. Das Brot backen sie auf ein halbes Jahr und heizen den Backofen mit getrocknetem Kuhmist. Im Winter zerschlagen sie dies Brot mit der Axt und lassen es vierundzwanzig Stunden in Wasser weichen, um es essen zu können. Seid barmherzig, liebe Brüder; bedenkt, wie viel Elend Euch umgibt!«
Als geborner Provenzale war es ihm leicht geworden sich mit allen südfranzösischen Dialekten gründlich vertraut zu machen. Das gefiel dem gemeinen Volk sehr und trug nicht wenig dazu bei, dass er seine Gedanken dem Verständnis aller näher bringen konnte. Er war in der Hütte und im Gebirge zu Hause. Er verstand es, die erhabensten Dinge mittels der trivialsten Redewendungen auszudrücken, und da er Jedermanns Sprache redete, so fand er auch Mittel und Wege seinen Ideen Eingang in Jedermanns Herz zu schaffen.
Übrigens benahm er sich gleich gegen die Vornehmen und Geringen.
Nie übereilte er sich mit Verdammungsurteilen, sondern zog stets die Umstände in Erwägung. »Erst wollen wir uns den Weg ansehen, pflegte er zu sagen, den das Vergehen entlang gekommen ist.«
Als »Exsünder«, wie er sich im Scherz nannte, trug er keine Strenge zur Schau und lehrte mit großem Freimut und ohne seine Stirn nach Art der Tugendhelden in finstere Falten zu legen, Grundsätze, die man in folgenden Worten zusammenfassen könnte:
»Der Mensch ist ein Geist, der mit Fleisch bekleidet ist. Dieses Fleisch ist eine Last und eine Versuchung. Der Mensch trägt es und gibt ihm nach.«
»Er soll es im Auge behalten, es zurückdrängen, es niederhalten und ihm nur im äußersten Notfall willfahren. Solch ein Gehorsam kann mit Schuld behaftet sein, aber solch eine Schuld findet Vergebung. Wer so nachgibt, fällt, aber auf die Knie und kann sich mit Gebet loskaufen.«
»Ein Heiliger zu sein ist die Ausnahme, ein Gerechter zu sein ist die Regel. Irret, fehlet, sündiget, aber seid Gerechte.«
»So wenig Sünde wie möglich, lautet das Gesetz für den Menschen. Gar nicht zu sündigen ist das Ideal des Engels. Alles Irdische ist der Sünde unterworfen. Wir können uns von ihr ebenso wenig frei machen wie von dem Gesetz der Schwere.«
Hörte er ein allgemeines Zetergeschrei, sah er die große Menge ein hastiges Tadelsvotum abgeben, so spottete er: »Hier liegt gewiss eine Sünde vor, die jedermann begeht. Sonst würden die Heuchler es nicht so eilig haben zu protestieren, um den Verdacht von sich abzulenken.«
Gegen die Frauen und die Armen, auf denen mit ihrer ganzen Wucht die menschliche Gesellschaft lastet, war er nachsichtig: »An den Vergehen der Frauen, der Kinder, des Gesindes, der Schwachen, der Bedürftigen und Unwissenden sind die Männer, die Eltern, die Herrschaften, die Starken, Reichen und Gelehrten Schuld.«
Ferner: »Die Unwissenden belehret, so gut Ihr es vermöget; die Gesellschaft ist zu tadeln, dass sie nicht den öffentlichen Unterricht unentgeltlich erteilen lässt; sie ist verantwortlich für die Finsternis, der sie die Entstehung gibt. Ist eine Seele umnachtet, so schleicht sich die Sünde in sie hinein. Nicht derjenige ist der Schuldige, der die Sünde begeht, sondern der die Nacht geschaffen hat.«
Man sieht, er hatte eine absonderliche und eigene Art die Dinge zu beurteilen. Ich habe ihn stark in Verdacht, dass er diese Gedanken dem Evangelium entnommen hatte.
Eines Tages war er gerade zugegen, als in einer Gesellschaft von einem Kriminalprozess gesprochen wurde, der damals die Gerichte beschäftigte. Ein armer Mensch hatte sich aus Liebe zu einer Frau und zu dem Kinde, das sie ihm geboren, der Falschmünzerei schuldig gemacht, da er sie auf andere Weise vor dem Hungertode nicht zu bewahren wusste. Dieses Verbrechen wurde damals noch in Frankreich mit der Todesstrafe geahndet. Die Frau war bei dem ersten Versuch ein von dem Manne fabriziertes Geldstück in Umlauf zu setzen, verhaftet worden, aber Beweise um sie einer Schuld zu überführen, hatte man nicht. Sie allein konnte gegen ihren Liebhaber aussagen und durch ein Geständnis seine Verurteilung ermöglichen. Sie leugnete aber aufs hartnäckigste. Da hatte der Staatsanwalt einen gescheiten Einfall. Er legte der Unglücklichen geschickt ausgewählte Bruchstücke aus Briefen des Mannes vor und brachte sie auf diese Weise zu dem Glauben, sie habe eine Nebenbuhlerin, mit der er sie hintergehe. Da klagte sie, getrieben von sinnloser Eifersucht, ihren Geliebten an, und lieferte die nötigen Beweise. Nun war der Mann verloren und nächster Tage sollte ihm, samt seiner Mitschuldigen in Aix der Prozess gemacht werden. Dieser Vorfall also bildete den Gegenstand der Unterhaltung, und alle bezeigten das höchste Entzücken über die Schlauheit des Staatsanwalts. Dadurch, dass er die Eifersucht ins Spiel gezogen, auf die Rachsucht der gekränkten Eitelkeit spekuliert, habe er der Wahrheit und Gerechtigkeit zum Siege verholfen. Allen diesen Lobeshebungen hörte der Bischof bis zu Ende schweigend zu. Dann fragte er:
»Vor welches Gericht werden die beiden gestellt werden?«
»Vor die Assisen.«
»Und der Staatsanwalt?«
Wir müssen hier noch einen anderen tragischen Vorfall erwähnen, der sich in Digne zutrug. Es wurde ein Mann wegen Mordes zum Tode verurteilt, ein Unglücklicher, der nicht gerade ein gebildeter Mann, aber auch nicht ganz unwissend war, und der sich als Akrobat und öffentlicher Schreiber sein Brot auf den Jahrmärkten verdiente. Der Prozess erregte große Sensation. An dem Tage vor der Hinrichtung wurde der Gefängnisgeistliche krank, und da man einen Priester brauchte, der den armen Sünder auf seinem letzten Gange begleiten sollte, so schickte man nach dem Stadtgeistlichen. Dieser aber weigerte sich, wie es heißt, mit rücksichtsloser Deutlichkeit: »Das geht mich nichts an«, ließ er sich vernehmen, »ich werde es bleiben lassen, mich mit dem Hanswurst zu befassen. Außerdem bin ich selber krank, und es ist überhaupt nicht mein Beruf.« Seine Äußerungen wurden dem Bischof hinterbracht, und dieser sagte: »Der Herr Pfarrer hat recht. Es ist nicht sein Beruf. Aber es ist der meinige.«
Er begab sich auch unverzüglich in das Gefängnis, ließ sich in die Zelle des »Hanswurstes« führen, redete ihn mit seinem Namen an, ergriff seine Hand und sprach zu ihm. Den ganzen Tag blieb er bei ihm, versagte sich Essen, Trinken und Schlaf, betete zu Gott für die Seele des Verurteilten und ermahnte den Unglücklichen seines Seelenheils zu gedenken. Er predigte ihm die besten Wahrheiten, nämlich die einfachsten. Er sprach mit ihm wie ein Vater, ein Bruder, ein Freund; und kehrte den Bischof nur hervor, um ihn zu segnen. Er unterwies ihn, indem er ihn beruhigte und tröstete. Der Mann sah seinem letzten Augenblick mit Verzweiflung entgegen. Der Tod war ihm ein Abgrund, an dessen Rand er schaudernd zurückbebte. Er war nicht so roh, dass er völlig stumpf hätte sein können. Seine Verurteilung hatte ihn bis in sein Innerstes erschüttert und gewissermaßen jene Schranke hie und da niedergerissen, die das Geheimnis der Dinge unseren Blicken entzieht, und die wir das Leben nennen. Durch die Breschen blickte er ohne Unterlass über diese Welt hinaus und sah nur Finsternis. Der Bischof aber zeigte ihm ein Licht.
Am anderen Tag als der arme Sünde geholt wurde, war der Bischof gegenwärtig. Er ging neben ihm und zeigte sich den Augen der Menge im violetten Mantel, mit dem Bischofskreuze am Halse neben einem mit Stricken gefesselten Verbrecher.
Er stieg mit ihm auf den Karren, stieg mit ihm auf das Schaffot. Der Delinquent, der tags zuvor niedergedrückt und verzweifelt gewesen, sah gefasst aus. Er hatte das Gefühl, dass seine Seele Erlösung gefunden und bald mit ihrem Gott vereinigt sein werde. Der Bischof umarmte ihn und sagte in dem Augenblick, als das Fallmesser der Guillotine herabstürzen sollte: »Wen Menschen töten, den lässt Gott wiederauferstehen; wen seine Brüder verjagen, der findet den Vater. Bete, glaube, gehe in das ewigen Leben ein: der Vater ist da, dich aufzunehmen.« Als er vom Schaffot wieder herunterstieg, lag in seinem Blick ein Etwas, vor dem die Menge ehrfurchtsvoll zurückwich. Man wusste nicht, was man mehr bewundern solle, die Blässe oder die Heiterkeit seines Antlitzes. In der bescheidnen Wohnung angelangt, die er scherzend seinen Palast nannte, sagte er zu seiner Schwester: »Ich habe ein feierliches Hochamt gehalten.«
Da das Erhabenste oft am wenigsten Verständnis findet, so legten manche Leute das Verhalten des Bischofs als Affektation2 aus. Freilich nur Leute aus den besseren Ständen. Das Volk, das Werke der rechten Frömmigkeit nicht missdeutet, war gerührt und bewunderte seinen Bischof.
Was den Bischof anbetrifft, so hatte ihn der Anblick aufs heftigste erschüttert, und es währte lange, ehe er diesen Eindruck verwand.
Das Schaffot weckt in der Tat, wenn man es vor sich aufgerichtet sieht, in der Fantasie unheimliche Gedanken und Bilder. Man kann gleichgültig denken über die Todesstrafe, sich jedes Urteils enthalten, Ja und Nein sagen, so lange man die Guillotine nicht mit Augen gesehen hat; ihr Anblick aber bringt eine mächtige Erschütterung in unserm geistigen Inneren hervor und zwingt zur Parteinahme. Die einen bewundern sie dann, wie de Maistre, die anderen verfluchen sie, wie Beccaria. Die Guillotine ist das körperlich gewordene Gesetz, ihr Name ist Rache; sie ist nicht neutral und gestattet nicht, dass man neutral bleibt. Nichts Geheimnisvolleres als der Schauer, der uns bei ihrem Anblick durchzuckt! Alle sozialen Probleme richten um das Fallmesser ihre Fragezeichen auf. Die Guillotine ist eine Vision. Sie ist kein Gerüst, keine Maschine, kein Mechanismus aus Holz, Eisen, Stricken! Sie gleicht einem beseelten, der Tätigkeit fähigen Wesen. Es ist, als sehe, als höre diese Maschine, als habe sie einen Verstand, als seien dieses Holz, dieses Eisen, diese Stricke mit Willen begabt. Die durch ihre Gegenwart geängstigte Fantasie zeigt sie uns als einen Unhold, der mit Bewusstsein handelt. Die Guillotine beteiligt sich an der Tötung, die der Henker vollzieht; sie verschlingt, frisst Menschenfleisch und säuft Blut. Die Guillotine ist ein von dem Richter und dem Zimmermann fabriziertes Ungetüm, ein Gespenst, das sich fortwährend aus dem Tode ein scheußliches Leben schafft.
Deshalb war auch bei dem Bischof der Eindruck ein fürchterlicher und nachhaltiger; am Tage nach der Hinrichtung und viele Tage später sah er niedergedrückt aus. Die Seelenheiterkeit, die noch auf dem Schaffot bis zu einer gewaltsamen Höhe angewachsen war, hatte ihn verlassen; ihn peinigte das Phantom der sozialen Gerechtigkeit. Er, der sonst auf seine Handlungen mit ungetrübter Seelenruhe zurückzublicken pflegte, schien sich dies Mal Vorwürfe zu machen. Zeitweise stellte er halblaut traurige Betrachtungen an. Einen solchen Monolog belauschte eines Abends seine Schwester und behielt ihn in ihrem Gedächtnis: »Nein, so schauerlich hatte ich es mir nicht vorgestellt. Es ist Unrecht den Blick so fest auf das göttliche Gesetz zu heften, dass man die menschlichen Gesetze darüber vergisst. Den Tod zu geben hat Gott allein das Recht: Warum befassen sich also die Menschen damit, da ihnen der Tod doch etwas Unbekanntes ist?«
Mit der Zeit wurden diese Eindrücke schwächer und erloschen vielleicht ganz. Nur fiel es auf, dass der Bischof es seitdem vermied über den Richtplatz zu gehen.
Zu jeder Stunde durfte man Myriel zu Kranken und Sterbenden rufen. Er war sich klar darüber, dass einem solchen Rufe zu folgen die dringendste und wichtigste Obliegenheit seines Amtes war. Zu Witwen und Waisen ging er von selber: Sie brauchten ihn nicht erst zu sich zu bitten. Er vermochte es Stunden lang neben einem Mann, der eine geliebte Frau, bei der Mutter, die ihr Kind verloren, zu sitzen und zu schweigen. Ebenso aber, wie er zu schweigen verstand, erpasste er auch richtig den Augenblick, wo es zu reden galt. Und welch ein Trostspender war er! Nicht dadurch suchte er den Schmerz zu verdrängen, dass er verlangte, man solle ihn der Vergessenheit anheimgeben; nein, er bestrebte sich ihn zu vertiefen und zu läutern, indem er zu hoffen lehrte. Er sprach: Achtet wohl darauf, wie ihr nach den Toten hinseht. Denket nicht an das, was verweslich ist. Blicket fest hin, so werdet Ihr den lebendigen Glanz dessen, den Ihr beweint, droben schauen. Er kannte die Heilkraft des Glaubens, beruhigte die Verzweifelten, indem er sie auf die Geduld und die Ergebung in das Unabwendbare verwies, und lehrte den Schmerz, der auf ein Grab blickt, zu dem Himmel emporschauen.
nachfolgen, in jemandes Rechte eintreten <<<
affektiertes Benehmen <<<
V. Der Bischof Bienvenu trägt seine Sutanen zu lange
Myriels häusliches Leben bewegte sich innerhalb derselben Gedankenwelt wie seine Amtstätigkeit. Die freiwillige Armut, in welcher der Herr Bischof von Digne beharrte, wäre wohl für jeden, der ihn hätte beobachten können, ein würdevolles und anmutendes Schauspiel gewesen.
Wie alle alten Leute und wie die meisten Denker schlief er nur wenig. Dafür aber ziemlich fest. Des Morgens gab er sich eine Stunde religiösen Betrachtungen hin, dann las er die Messe entweder im Dom oder in seinem Hause. Nach der Messe nahm er sein Frühstück ein, das aus Roggenbrot und Milch bestand. Dann arbeitete er.
Ein Bischof ist ein sehr beschäftigter Mann. Er muss täglich den Bistumssekretär und beinahe täglich seine Großvikare empfangen. Er hat Kongregationen zu kontrollieren, Privilegien zu erteilen, alle neuen Erscheinungen auf dem Gebiete der geistlichen Literatur zu prüfen, wie Mess- und Gebetsbücher, Katechismen u.s.w., Erlasse zu schreiben, Predigten zu autorisieren, Einigkeit zu stiften zwischen Pfarrern und Dorfschulzen, mit Geistlichen und mit den staatlichen Behörden zu korrespondieren. Kurz tausenderlei Geschäfte.
Die Zeit, die ihm diese vielen Geschäfte, seine Amtsverrichtungen und sein Brevier übrig ließen, widmete er in erster Linie den Armen, den Kranken und Unglücklichen; die Zeit, die ihm dann noch blieb, widmete er der Arbeit. Bald grub er dann in seinem Garten, bald las und schrieb er. Beide Arten von Arbeit schienen ihm gleichwertig, denn der Verstand, so lautete sein Wahrspruch, bedarf ebenso sehr der Pflege und Bearbeitung wie ein Garten.
Gegen Mittag, wenn schön Wetter war, ging er aus, aufs Land oder in die Stadt, und trat dabei oft in ärmliche Häuser ein. Die Leute sahen ihm dann gern nach, wie er allein vor sich hin ging, in tiefes Nachdenken versunken, auf seinen langen Stock gestützt, in seinem dick wattierten Rock, violetten Strümpfen, groben Schuhen und mit seinem flachen Hute, von dessen drei Ecken drei goldne Quasten herabhingen.
Sein Erscheinen wurde überall freudig begrüßt, als bringe er sozusagen, Licht und Wärme mit. Die Kinder und die Greise kamen auf die Türschwelle, wie sie zu tun pflegten, wenn sie sich des Sonnenscheins erfreuen wollten. Er erteilte seinen Segen, und sie wünschten ihm Glück und Segen. Jedem, der etwas bedurfte, zeigte man sein Haus.
Hier und da blieb er stehen, sprach mit den Kindern und lächelte ihren Müttern zu. So lange er Geld hatte, besuchte er die Armen; hatte er keins mehr, so ging er zu den Reichen.
Da ihm seine Sutanen recht lange vorhalten mussten, und er dies die Leute nicht allzu sehr merken lassen wollte, trug er bei seinen Gängen in der Stadt immer nur seinen dicken wattierten Rock, der ihm im Sommer manchmal recht lästig wurde.
Zu Hause angelangt, speiste er zu Mittag. Dieses Mahl glich dem Frühstück.
Um halb neun nahm er mit seiner Schwester die Abendmahlzeit ein, wobei Frau Magloire hinter ihnen stand und sie bediente. Es war ein ausnehmend frugales Mahl. Wenn jedoch der Bischof einen seiner Pfarrer zu Besuch hatte, benutzte Frau Magloire die gute Gelegenheit, um Se. Bischöfliche Gnaden mit einem vorzüglichen Fisch oder einem delikaten Stück Wild zu regalieren. Jeder Pfarrer war ihr ein willkommener Vorwand ihren Herrn zu einer Abweichung von seiner strengen Diät zu verleiten, denn für gewöhnlich kam nur in Wasser gekochtes Gemüse und Suppe mit Öl auf den Tisch. Deshalb hieß es auch in der Stadt: »Wenn der Bischof nicht mit einem Pfarrer speist, isst er wie ein Trappist.«
Nach dem Abendessen plauderte er eine halbe Stunde mit Baptistine und Frau Magloire; dann zog er sich auf sein Zimmer zurück und schrieb wieder, bald auf einzelne Blätter, bald an den Rand eines Folianten. Er war sehr belesen und besaß wissenschaftliche Bildung, Er hat auch fünf bis sechs merkwürdige Manuskripte hinterlassen, u.a. eine Abhandlung über den Vers im 1. Buch Moses: »Im Anfang schwebte der Geist Gottes über den Wassern.« Er verglich mit diesem Text drei Varianten, eine arabische: »Die Winde Gottes wehten;« die des Flavias Josephus: »Ein Wind von oben blies auf die Erde«, und die chaldäische Paraphrase des Onkelos: »Ein Wind kam von Gott und blies auf die Oberfläche der Gewässer.« In einer anderen Dissertation prüft er die theologischen Werke des Bischofs Hugo von Ptolemais, Urgroßonkel dessen, der dieses Buch schreibt, und wies nach, dass dieser Bischof der Verfasser der verschiednen im vorigen Jahrhundert unter dem Pseudonym Barleycourt veröffentlichten Abhandlungen sei.
Bisweilen schweifte sein Geist, während er irgend ein Buch vor sich hatte, von dem Inhalt desselben ab und überließ sich tiefsinnigen Betrachtungen, von denen er nur abließ um das Resultat seines Nachdenkens in dem Buche selbst niederzuschreiben. Natürlich standen derartige Aufzeichnungen oft in gar keiner Beziehung zu dem Buche, das sie enthielt. So lautet z.B. der Titel eines seiner Quartanten: Korrespondenz des Lord Germains mit den Generälen Clinton, Cornwallis und den Admirälen der Amerikanischen Station. Versailles, Verlag von Poincot, und Paris, Verlag von Pissot, Ouai des Augustins. In diesem Buche haben wir folgende von dem Bischof niedergeschriebene Zeilen gefunden:
»O Du, der Du bist!«
»Der Prediger Salomo nennt dich die Allmacht, die Bücher der Makkabäer den Schöpfer, die Epistel an die Epheser die Freiheit, Baruch die Unendlichkeit, die Psalmen Weisheit und Wahrheit, Johannes das Licht, das Buch der Könige Herr, der Exodus die Vorsehung, der Leviticus die Heiligkeit, Esra die Gerechtigkeit, die Schöpfung Gott, der Mensch Vater; Salomo heißt dich den Erbarmer, und dies ist der schönste unter Deinen Namen.« –
Gegen neun Uhr abends begaben sich die beiden Frauen in ihre Zimmer im ersten Stock und ließen ihn bis zum anderen Morgen im Erdgeschoss allein.
Hier müssen wir eine genaue Beschreibung der Wohnung unseres Bischofs einschalten.
VI. Von wem er sein Haus bewachen ließ
Das Haus, das er bewohnte, bestand, wie schon erwähnt, aus einem Erdgeschoss und einem einzigen Stockwerk. Drei Räume im Erdgeschoss, drei Schlafzimmer im ersten Stock, darüber der Boden. Hinter dem Hause ein fünfundzwanzig Ouadratruten großer Garten. Die beiden Frauen hatten den ersten Stock inne, unten wohnte der Bischof. Das erste Zimmer, das auf die Straße hinausging, diente als Speisesaal, das zweite als Schlaf- und das dritte als Betzimmer. In dieses Betzimmer konnte man nur gelangen, wenn man durch das Schlafzimmer ging, und dieses war nur durch den Speisesaal hindurch zugänglich. In dem Betzimmer war noch ein Alkoven, wo die von dem Bischof zu Gaste gebetnen Landgeistlichen schliefen.
Die ehemalige Apotheke des Hospitals, ein an das Haus angebautes und im Garten gelegenes Gebäude, enthielt jetzt die Küche und Vorratskammer.
Außerdem befand sich im Garten noch ein Stall, der früher die Küche des Hospitals gewesen war, und in dem der Bischof zwei Kühe hielt. Wie viel Milch diese auch geben mochten, die Hälfte davon schickte er regelmäßig jeden Morgen den Kranken des Hospitals. »Das ist der Zehnt, den ich zahle«, pflegte er zu sagen.
Sein Schlafzimmer war ziemlich groß und schwer erheizbar. Da das Holz in Digne sehr teuer ist, so war er auf den Gedanken geraten sich in dem Kuhstall einen Bretterverschlag machen zu lassen. In diesem Raum, den er seinen Wintersalon nannte, brachte er, wenn es sehr kalt war, den Abend zu.
In diesem Wintersalon, sowie in dem Speisezimmer waren keine anderen Möbel, als ein viereckiger Tisch aus weißem Holz und vier Strohstühle. In dem Speisezimmer stand allerdings noch ein altes rosa angestrichnes Buffet. Aus einem eben solchen mit weißen Obertischtüchern und falschen Spitzen behangenen Buffet, hatte der Bischof den Altar gemacht, der in seinem Betzimmer prangte.
Seine reichen Beichttöchter und die frommen Frauen in Digne hatten oft Geld aufgebracht, um Sr. Bischöflichen Gnaden einen schönen neuen Altar für das Betzimmer zu verehren; dieses Geld hatte er auch angenommen und den Armen zugewendet. Der schönste Altar, entschuldigte er sich, ist die Seele eines getrösteten Unglücklichen, der dem Herrn dankt.
In dem Betzimmer standen zwei Betstühle aus Stroh und in seinem Schlafzimmer ein Armsessel gleichfalls mit Strohsitz. Hatte er zufällig sieben bis acht Besucher zugleich zu empfangen, den Präfekten, oder den General, oder den Stab des Regiments, das die Garnison von Digne bildete, oder Schüler des kleinen Seminars, so sah man sich genötigt die Sessel und Stühle aus dem Wintersalon, dem Betzimmer, dem Schlafgemach zusammenzuholen. Auf diese Weise konnte man elf Stühle aufbringen.
Es kam aber auch vor, dass Zwölf zugleich kamen. Dann verdeckte der Bischof die Verlegenheit dadurch, dass er sich mit seinen Gästen stehend unterhielt.
Allerdings besaß er noch einen Stuhl in dem Alkoven, aber der Sitz war entzwei und es fehlte ein Bein, sodass man ihn an die Wand lehnen musste, wenn man sich darauf setzen wollte. Desgleichen hatte noch Fräulein Baptistine in ihrem Zimmer eine sehr große Bergére, aus Holz, die vor Zeiten vergoldet gewesen und mit Pekingseide überzogen war, aber die hatte man durch das Fenster in das erste Stock hinaufwinden müssen, weil die Treppe zu schmal war. Sie konnte also nicht zur Aushilfe gebraucht werden, wenn es an Stühlen fehlte.
Fräulein Baptistines sehnlichster Wunsch wäre gewesen, Salonstühle u. Canapee aus gelbem Utrechter Samt mit Rosetten geschmückt und aus Mahagoniholz, das in Form eines Schwanenhalses geschnitzt war, anschaffen zu können. Aber das hätte mindestens fünfhundert Franken gekostet, und da sie in fünf Jahren Summa Summarum nur zweiundvierzig und einen halben Franken zu diesem Zweck hatte sparen können, so gab sie den Gedanken auf. Wer erreicht denn je sein Ideal?
Etwas Einfacheres kann man sich nicht vorstellen, als das Schlafzimmer des Bischofs: eine Glastür nach dem Garten; ihr gegenüber das Bett: ein eisernes Hospitalbett mit einem Himmel aus grüner Serge; im Schatten des Bettes, hinter einem Vorhang, Toilettengegenstände, die noch die feinen Gewohnheiten des ehemaligen Weltmannes verrieten; zwei Türen, die eine in der Nähe des Kamins, die andere nach dem Betzimmer; ein großer Bücherschrank; ein marmorartig angestrichner Kamin aus Holz, wo gewöhnlich kein Feuer brannte mit zwei eisernen Feuerböcken; über dem Kamin ein kupfernes, ehemals versilbertes Kruzifix, das auf schäbigem Sammet befestigt und von einem früher vergoldeten Holzrahmen umgeben war. In der Nähe der Glastür ein großer Tisch mit Tintenfass, unordentlich hingeworfnen Papieren und dicken Büchern. Vor dem Tisch der Strohsessel. Vor dem Bett ein dem Betzimmer entlehnter Betstuhl.
Neben dem Bett hingen auf jeder Seite zwei Porträts in ovalen Rahmen. Kleine Inschriften mit Goldbuchstaben zeigten an, dass das eine Porträt den Abt von Chaliot, Bischof von Saint-Claude, das andere den Abt Tourteau, Generalvikar von Agde, Abt von Grand-Champ, von dem Zisterzienser Orden, darstelle. Diese Porträts hatte der Bischof, als er in dem Hospital Wohnung nahm, in dem ehemaligen Krankenzimmer vorgefunden und sie dort hängen lassen. Waren es doch Bildnisse von Priestern, die vielleicht dem Hospital Schenkungen gemacht hatten, zwei genügende Gründe die Portraits zu behalten. Alles, was er von diesen Prälaten wusste, war, dass der König sie an demselben Tage, dem 27. April 1785, in ihre Ämter eingesetzt hatte. Diese Notiz hatte der Bischof, als Frau Magloire die Bilder eines Tages heruntergenommen hatte, um sie abzustäuben, auf einem vergilbten, auf der Rückseite des einen Portraits aufgeklebten Stückchen Papier gefunden.
Am Fenster hing ein Vorhang aus grobem Wollstoff, der schließlich so alt wurde, dass, um keinen neuen anschaffen zu müssen, Frau Magloire sich genötigt sah, mitten drin eine große Naht zu machen. Diese Naht bildete ein Kreuz, und der Bischof machte oft darauf aufmerksam, mit den Worten; »Wie gut sich das ausnimmt!«
Alle Schlafzimmer ohne Ausnahme waren wie Kasernenstuben und Hospitalsäle, weiß getüncht. Indessen fand, wie weiterhin ausführlicher erzählt werden soll, Frau Magloire unter den gestrichenen Tapeten in Baptistinens Zimmer Malereien vor. Das Gebäude war nämlich, ehe es als Hospital benutzt wurde, Rathaus gewesen und aus jener Zeit stammte diese Verzierung des Zimmers. Der Fußboden in den Schlafkammern bestand aus roten Ziegeln, die allwöchentlich gewaschen wurden und war vor den Betten mit Strohmatten belegt. Im Übrigen herrschte in diesem Hause, wo zwei Frauen walteten, von oben bis unten die peinlichste Sauberkeit. Dies war der einzige Luxus, den der Bischof gestattete: ›Das entzieht den Armen nichts‹, sagte er.