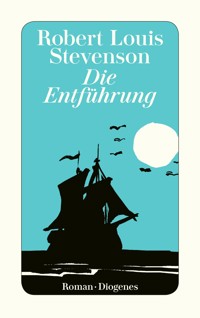
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
David Balfour wird nach dem Tod seiner Eltern entführt: Sein Oheim will ihn aus dem Weg räumen. Das Schiff Covenant, auf dem David als Sklave in die amerikanischen Kolonien verschleppt werden soll, erleidet aber Schiffbruch. Flucht und Verfolgung bestimmen auch danach Davids Leben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 397
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Robert Louis Stevenson
Die Entführung
Die Abenteuer des David Balfour von Shaw
Roman
Aus dem Englischen von Curt Thesing
Diogenes
Widmung
Mein lieber Charles Baxter,
Solltest Du jemals diese Geschichte lesen, so wirst Du Dir wahrscheinlich zahlreichere Fragen stellen, als ich zu beantworten Lust hätte: zum Beispiel, wie es kommt, daß der Appiner Mord in das Jahr 1751 fällt; durch welchen Zauber die Torraner Felsen in die Nähe der Insel Earraid gerückt sind, und weshalb der gedruckte Prozeßbericht sich so hartnäckig über David Balfour ausschweigt? Das sind freilich Nüsse, die zu knacken auch über meine Kraft geht. Falls Du mich jedoch über die Frage nach Alans Schuld oder Unschuld zur Rede stellen solltest, glaube ich, daß ich die Lesart des vorliegenden Textes vertreten könnte. Du wirst finden, daß die Appiner Überlieferungen bis auf den heutigen Tag klar zugunsten Alans sprechen. Wenn Du Dich erkundigst, wird man Dir sogar sagen, daß die Nachkommen »des Anderen«, der den Schuß abfeuerte, auch heute noch im Lande ansässig sind. Aber jenes Anderen Namen wirst Du trotz eifrigsten Nachforschens nicht erfahren; denn der Hochländer schätzt ein Geheimnis sowohl um der Sache selbst willen wie um des anheimelnden Reizes, den ihm die Geheimhaltung gewährt. Ich könnte noch mancherlei anführen, was diesen oder jenen Punkt recht fertigen oder seine Unhaltbarkeit beweisen würde; es ist indes ehrlicher, sogleich zu bekennen, wie wenig es mir hierbei auf Genauigkeit ankommt. Dieses Buch ist nicht für den Lernenden geschrieben, sondern will an Winterabenden im Schulzimmer gelesen werden, wenn die Aufgaben beendet sind und die Stunde des Schlafengehens sich naht; und der ehrliche Alan, der seinerzeit ein recht grimmiger Feuerfresser war, verfolgt in seiner neuen Gestalt keinen gefährlicheren Zweck, als irgendeines jungen Herrn Aufmerksamkeit von seinem Ovid abzulenken, um ihn auf kurze Zeit in die Hochlande und in das vergangene Jahrhundert zu entführen und ihn zusammen mit einigen fesselnden Gestalten als Begleiter seiner Träume ins Bett zu schicken.
Was nun gar Dich selbst betrifft, mein lieber Charles, so verlange ich nicht einmal, daß Dir diese Geschichte gefällt. Vielleicht wird sie aber, wenn er älter ist, Deinem Sohne gefallen; alsdann wird es ihn vielleicht freuen, seines Vaters Namen auf dem Schmutztitel zu finden; und inzwischen freut es mich, ihn dorthin zu setzen in Erinnerung an viele glückliche und einige traurige Tage (die indes heute vielleicht eine nicht weniger freundliche Erinnerung sind). Für mich ist es ein merkwürdiges Gefühl, sowohl aus räumlicher wie zeitlicher Entfernung auf jene vergangenen Abenteuer unserer Jugend zu blicken; noch merkwürdiger muß es für Dich sein, der Du heute noch auf den nämlichen Straßen wandelst und morgen vielleicht schon die Tür des »Speculative Club« öffnen wirst, wo man uns allmählich Scott und Robert Emmet und dem geliebten und berüchtigten Macbean an die Seite zu stellen beginnt. Oder vielleicht gehst Du an dem Winkel des Hofes vorbei, wo die große L.J. R.-Gesellschaft ihre Sitzungen abhielt und auf den Sitzen von Burns und seinen Genossen ihr Bier trank. Ich glaube Dich im Geiste zu sehen, wie Du bei hellem Tageslicht dort umherschweifst und mit Deinen leiblichen Augen die Plätze betrachtest, die Deinem Gefährten heute nur noch als ein Teil der Szenerie seiner Träume erscheinen. Wie müssen in den Pausen gegenwärtiger Geschäftigkeit vergangene Zeiten in Deiner Erinnerung widerhallen! Laß ihr Echo nicht gar zu oft ertönen, ohne einige freundliche Gedanken an Deinen Freund
R.L.S.
Skerryvore,
Bournemouth.
Erstes Kapitel Ich begebe mich auf meine Reise nach dem Hause Shaw
ICH BEGINNE DIE GESCHICHTE MEINER ABENTEUER mit einem bestimmten Morgen zu Anfang des Monats Juni im Jahre des Heils 1751, als ich zum letztenmal den Schlüssel aus der Tür meines Vaterhauses zog. Die Sonne rötete gerade die Gipfel der Berge, während ich den Weg hernieder schritt, und als ich das Pfarrhaus erreichte, schlugen die Amseln in den Fliederbüschen des Gartens, und der Nebel, der während der Morgendämmerung über dem Tale geschwebt hatte, begann sich zu heben und dahinzuschwinden.
Mr. Campbell, der Pfarrer von Essendean, erwartete mich bereits an der Gartenpforte, der treffliche Mann! Er erkundigte sich, ob ich schon gefrühstückt hätte; und als er hörte, daß mir nichts mangelte, ergriff er meine Rechte mit seinen beiden Händen und schob sie freundlich unter seinen Arm.
»Schön, Daviebub,« sagte er, »ich werde dich bis zur Furt geleiten, um dich auf deinen Weg zu bringen.« Und schweigend gingen wir vorwärts.
»Tut es dir leid, Essendean zu verlassen?« fragte er mich nach einer kleinen Weile.
»Warum, Herr?« erwiderte ich. »Wüßte ich nur, wohin ich mich wenden oder was aus mir werden soll, würde ich’s Euch ehrlich sagen. Essendean ist sicherlich ein guter Ort, und ich bin dort sehr glücklich gewesen; doch ich bin ja noch nie irgendwo anders hingekommen. Seit Vater und Mutter beide tot sind, werde ich ihnen in Essendean nicht näher sein als im Königreich Ungarn; und um die Wahrheit zu gestehen, wenn ich glaubte, ich hätte dort, wohin mich mein Weg führt, Aussicht, mich zu verbessern, ich würde freudig gehen.«
»Wirklich?« fragte Mr. Campbell. »Ausgezeichnet, Davie. Dann ist es jetzt für mich an der Zeit, dir deine Zukunft vorauszusagen, wenigstens soweit ich das vermag. Als deine Mutter dahingegangen war, und dein Vater (der würdige, christliche Mann) seiner Auflösung entgegenzukränkeln begann, übergab er meiner Obhut einen gewissen Brief, der, wie er sagte, dein Erbe enthielte. ‘Wenn ich erst gegangen bin’, erklärte er, ‘und das Haus aufgelassen und der Hausrat verkauft ist’ (und das, Davie, ist ja inzwischen geschehen), ‘legt diesen Brief in die Hände meines Jungen und schickt ihn auf den Weg zum Haufe Shaw, nicht fern von Cramond. Das ist der Ort, von dem ich stamme,’ sagte er, ‘und es ziemt sich, daß mein Sohn dorthin zurückkehrt. Er ist ein strammer Bursche’, sagte dein Vater, ‘und ein zielbewußter, und ich zweifle nicht, daß er sicher hinkommen und überall, wohin er sich auch wendet, wohlgelitten sein wird’.«
»Das Haus Shaw?« rief ich. »Was hat mein armer Vater mit dem Hause Shaw zu schaffen?«
»Hm,« meinte Mr. Campbell, »wer könnte darüber etwas Sicheres sagen? Doch der Name jener Familie, Daviebub, ist der gleiche Name, den auch du trägst – Balfour von Shaw: ein altes, ehrenwertes, reputables Haus, wenn auch vielleicht in letzter Zeit etwas heruntergekommen. Auch war dein Vater ein gelehrter Mann, wie es seiner Stellung entsprach; nie leitete jemand mit besserem Recht eine Schule. Auch sein Benehmen und seine Redeweise waren keineswegs die eines gewöhnlichen Dominus; daher war es mir (wie du dich noch erinnern wirst) stets eine Freude, wenn er im Pfarrhause mit dem Adel zusammentraf; und die Edelleute aus meinem eigenen Geschlecht, die Campbells von Kilremet, die Campbells von Dunswire, die Campbells von Minch und andere, alles wohlangesehene Herren, freuten sich seiner Gesellschaft. Um dir endlich alle Einzelheiten dieser Sache zu unterbreiten, hier ist das Brieftestament selbst, von der eigenen Hand unseres dahin gegangenen Bruders adressiert.«
Damit übergab er mir den Brief, der folgende Aufschrift trug: »Zu Händen von Ebenezer Balfour, Esquire von Shaw, dem dieser Brief in seinem Hause Shaw von meinem Sohne David Balfour übergeben werden soll.« Mein Herz schlug heftig angesichts dieser großartigen Aussichten, die sich so plötzlich vor mir, einem Burschen von sechzehn Jahren, dem Sohne eines armen Landdominus im Walde von Ettrick eröffneten.
»Mr. Campbell,« stammelte ich, »und wenn Ihr an meiner Stelle wäret, würdet Ihr gehen?«
»Natürlich,« entgegnete der Pfarrer, »natürlich würde ich gehen, und zwar ohne Verzug. Ein flinker Bursche wie du müßte Cramond (das nahe bei Edinburgh liegt) in zwei Wandertagen erreichen. Und wenn es schlecht zu schlecht kommen sollte, und dein hochgestellter Verwandter (was ich aber nicht an nehmen möchte, bist du doch von seinem Blute), dir die Tür weiset, brauchst du ja nur die zwei Tage zurückmarschieren und an der Tür des Pfarrhauses klopfen. Doch ich will eher hoffen, daß man dich, wie es dein armer Vater prophezeit hat, wohl aufnehmen wird; und du mit der Zeit, was weiß ich, noch ein großer Mann wirst. Und jetzt, Daviebub,« schloß er, »liegt es mir sehr am Herzen, diese Abreise zu sichern und dich rechtermaßen gegen die Gefahren der Welt zu wappnen.«
Er schaute sich nach einem bequemen Sitze um, er blickte unter einer Birke am Wegrande einen großen, flachen Stein, ließ sich mit ganz lang gezogener ernster Oberlippe auf ihm nieder und breitete, da die Sonne jetzt zwischen den Gipfeln zweier Hügel auf uns niederbrannte, zum Schutze sein Taschentuch über seinen Dreispitz. Mit emporgehobenem Zeigefinger fing er dann an, mich zunächst vor einer erklecklichen Anzahl Ketzereien zu warnen, zu denen ich gar keine Neigung verspürte, und drang in mich, eifrig im Gebete zu verharren und die Bibel zu lesen. Als er geendet hatte, entwarf er mir ein Bild von dem großen Hause, das mein Bestimmungsort war, und riet mir, wie ich mich seinen Bewohnern gegenüber benehmen sollte.
»Sei nachgiebig, Davie, in allen nebensächlichen Dingen«, sagte er. »Denke stets daran, daß du, obwohl edelgeboren, nur eine Landerziehung genossen hast; mach’ uns keine Schande, Davie, mach’ uns keine Schande! Zeige dich in jenem großen, vornehmen Hause mit all seinen Domestiken, hohen und niedrigen, so freundlich, so umsichtig, so schnell im Begreifen und so zurückhaltend im Gespräch wie nur irgendeiner. Was den Schloßherrn anbetrifft – sei stets eingedenk, daß er der Herr ist; mehr sage ich nicht: Ehre, wem Ehre gebührt. Es ist eine Freude, einem Gutsherrn zu gehorchen; oder sollte es wenigstens für die Jugend sein.«
»Schön, Herr Pfarrer,« entgegnete ich, »so soll es sein, und ich verspreche Euch, ich werde versuchen, es so zu halten.«
»Gut gesprochen«, erwiderte Mr. Campbell herzlich.
»Und jetzt, zu der Hauptsache, oder (um einen Scherz zu machen) zu der Nebensache. Ich habe hier ein kleines Paket, das vier Dinge enthält.« Während er sprach, zog er mit ziemlicher Mühe das Päckchen aus der Tasche seines Rockschoßes. »Von diesen vier Dingen ist das erste dein gesetzmäßiger Anteil: das erbärmliche bißchen Geld für deines Vaters Bücher und Hausgerät, die ich (wie ich schon zu Anfang erklärte) in der Absicht gekauft habe, sie mit Nutzen an den neuen Dominus wiederzuveräußern. Die anderen drei Sachen sind kleine Gaben von Mrs. Campbell und mir, und wir würden uns freuen, wenn du sie annehmen wolltest. Der erste Gegenstand ist rund, und er wird dir wahrscheinlich zunächst die größte Freude bereiten; aber, Daviebub, er ist nur ein Tropfen Wasser im Meere; nur einen Schritt wird er dir vorwärts helfen und vergehen mit dem Morgen. Der zweite, der flach und rechteckig und mit Schriftzügen bedeckt ist, wird dein ganzes Leben dir zur Seite stehen wie ein guter Wanderstab und ein sanftes Kissen in Krankheitsfällen für dein Haupt; und endlich der letzte, der eckig ist, wird dich, das ist mein frommer Wunsch, in ein besseres Land geleiten.«
Mit diesen Worten stand er auf, nahm seinen Hut ab und betete eine kleine Weile laut in den rührendsten Ausdrücken für den jungen Menschen, der hinaus in die Welt zieht; dann schloß er mich plötzlich in seine Arme und küßte mich herzhaft, hielt mich auf Armeslänge von sich und betrachtete mich mit einem Gesicht, in dem die Sorgen kämpften; und dann wandte er sich ab, rief mir ein Lebewohl zu und eilte in einem Juckeltrab den Weg zurück, den wir gekommen waren. Manchem hätte sein Verhalten lächerlich erscheinen können, doch mir war nicht nach Lachen zumute. Solange er zu sehen war, folgte ich ihm mit meinen Blicken; aber er verlangsamte seinen Schritt keinen Augenblick und blickte auch nicht einmal zurück. Da wurde es mir klar, welchen Kummer ihm meine Abreise bereitete, und mein Gewissen schalt mich scharf und schwer, daß ich meinerseits so überglücklich war, diese stille Landschaft zu verlassen, um nach einem großen, geschäftigen Hause zu reisen, zu geachteten Personen von Stand, die meines Namens und meines Blutes waren.
»Davie, Davie,« dachte ich, »hat man je so schwarze Undankbarkeit gesehen? Kannst du alte Gunstbezeigungen und alte Freunde beim bloßen Flüstern eines Namens vergessen? Pfui, pfui! Schäme dich!«
Und ich ließ mich auf dem Steine nieder, den der gute, alte Mann soeben verlassen hatte, und öffnete das Päckchen, um die Art der Geschenke kennenzulernen. Über den Gegenstand, den er als eckig bezeichnet hatte, war ich nie sehr im Zweifel gewesen; und richtig, es war eine Bibel, klein genug, um sie in einer Plaidfalte bei sich zu tragen. Was er als rund bezeichnet hatte, erwies sich als ein Shillingstück, und der dritte Gegenstand, der mir so wundersam mein ganzes Leben lang in gefunden und kranken Tagen helfen sollte, war ein kleines Stückchen groben, gelben Papiers, auf dem mit roter Tinte folgendes geschrieben stand: »Rezept zur Herstellung von Maiglöckchenwasser. Man nehme die Blüten von Maiblumen, setze selbige mit spanischem Weine an und trinke davon, wie die Gelegenheit es erfordert, ein oder zwei Teelöffel. Es verleiht denen, die sie verloren haben, die Sprache wieder. Es ist gut gegen die Gicht; es tröstet das Herz und stärkt das Gedächtnis; und die Blüten, in ein Glas getan, das wohlverschlossen sein muß, und einen Monat lang in einen Ameisenhaufen gestellt, werden einen Trank ergeben, der von den Blumen stammt und der in einer Phiole aufzubewahren ist: selbiger ist gut für Gesunde und Kranke, einerlei ob Mann oder Weib.«
Darunter stand in des Pfarrers eigener Handschrift: »Gleicherweise für Verrenkungen zum Einreiben: und für die Kolik, einen großen Löffel voll stündlich.« Wahrlich, ich mußte lachen. Aber es war ein etwas wehmütiges Lachen, und ich war froh, mein Bündel am Ende meines Wanderstabes zu befestigen und über die Furt zu setzen, und kletterte dann auf der anderen Seite den Hügel hinauf. Gerade als ich die grüne Fahrstraße erreichte, die weit durch die Heide führt, erblickte ich zum letztenmal die Kirche von Essendean, die Bäume um den Pfarrhof und die großen Ebereschen auf dem Friedhofe, in deren Schatten Vater und Mutter ruhten.
Zweites Kapitel Ich erreiche das Ziel meiner Reise
AM VORMITTAG DES ZWEITEN TAGES GELANGTE ich auf den Gipfel eines Hügels und sah das weite Land sich vor mir bis zur Meeresküste dehnen, und inmitten dieser abfallenden Ebene rauchte auf einem langgestreckten Kamme gleich einem Hochofen die Stadt Edinburgh. Eine Fahne wehte von dem Schlosse, und in der Bucht kreuzten Schiffe oder lagen dort vor Anker, und so fern sie auch noch waren, konnte ich doch alles klar unterscheiden. Dieser Anblick trieb mir mein bäurisches Herz fast in die Kehle.
Nach kurzer Zeit gelangte ich zu einem Haufe, in dem ein Schäfer lebte, und erhielt dort eine ungefähre Beschreibung der Wegrichtung und der Umgebung von Cramond; auf diese Weise fragte ich mich von einem zum andern durch, über Coleton, westlich der Hauptstadt, bis ich endlich auf die Glasgower Heerstraße gelangte. Und dort erblickte ich zu meiner größten Freude und Verwunderung ein Regiment, das beim Klange der Querpfeifen im Gleichschritt marschierte; an der Spitze ein alter, rotgesichtiger General auf grauem Pferde, während eine Kompagnie Grenadiere mit ihren Bärenmützen den Nachtrab bildete. Der Anblick der Rotröcke und der Klang dieser lustigen Musik ließen mein Herz vor Lebenslust schwellen. Eine kleine Strecke weiter sagte man mir, daß ich mich in der Gemeinde Cramond befände, und ich begann bei meinen Nachforschungen den Namen des Hauses Shaw zu erwähnen. Dieser Name schien alle, bei denen ich mich nach dem Wege erkundigte, in Staunen zu versetzen. Zuerst glaubte ich, die Einfachheit meiner Erscheinung und mein bäurischer Anzug, ganz bedeckt mit dem Staub der Landstraßen, paßten wohl schlecht zu der Großartigkeit des Ortes, der mein Ziel war. Nachdem aber zwei oder vielleicht auch drei mir den gleichen Blick und die gleiche Antwort geschenkt hatten, kam es mir allmählich in den Sinn, daß an den Shaws selbst irgend etwas Befremdendes sein müsse.
Um diese Befürchtungen, wenn möglich, irgendwie zum Schweigen zu bringen, änderte ich die Art meiner Fragen und, als ich einen ehrlich aussehenden Burschen erblickte, der, auf der Deichsel seines Wagens sitzend, die Landstraße entlang gefahren kam, erkundigte ich mich, ob er je von einem Hause sprechen gehört hätte, das man als das Haus Shaw bezeichne.
Er zügelte sein Pferd und blickte mich genau so an wie die anderen.
»Gewiß,« sagte er, »warum?«
»Ist es ein großes Haus?«
»Zweifellos. Das Haus ist ein großes, mächtiges Haus.«
»Hm,« meinte ich, »aber die Leute, die darin wohnen?«
»Leute?« rief er. »Bist du verrückt? Dort gibt’s gar keine Leute – was man so Leute nennt.«
»Was?« fragte ich. »Nicht Mr. Ebenezer?«
»O ja«, entgegnete der Mann. »Der Gutsherr wohnt da. Ganz sicher, wenns der ist, mit dem du zu tun hast. Was ist denn wohl dein Anliegen, Kerlchen?«
»Man machte mir Hoffnung, ich würde dort eine Stellung erhalten«, entgegnete ich und blickte so bescheiden wie nur möglich drein.
»Was!« schrie der Fuhrmann in so scharfem Tone, daß selbst sein Pferd zusammenschreckte. »Nun, Kerlchen,« fügte er hinzu, »mich geht ja die Sache nichts an, du scheinst mir ein braver Bursche zu sein, und wenn du ein Wort von mir annehmen willst, halte dich dem Hause Shaw fern.«
Der Nächste, der mir über den Weg lief, war ein lustiger, kleiner Kerl mit einer schönen, weißen Perücke, dem ich gleich ansah, daß er ein Bader auf seinem Kundengang war. Und da ich wußte, daß Barbiere große Klatschmäuler sind, fragte ich ihn geradeheraus, was für eine Art Mann Mr. Balfour von Shaw eigentlich wäre.
»Puh, puh, puh!« rief der Barbier. »Überhaupt kein Mann! Ganz und gar kein Mann!« Und schlau fing er an, mich auszuholen, was ich dort zu tun hätte. Aber ich war ihm in dieser Hinsicht mehr als über, und er ging zu seinem nächsten Kunden nicht klüger, als er gekommen war.
Welchen Schlag das meinen Illusionen versetzte, kann ich gar nicht beschreiben. Je unbestimmter die Anschuldigungen waren, um so weniger behagten sie mir, ließen sie doch der Phantasie ein weites Feld. Was konnte das nur für ein großes Haus sein, daß das ganze Dorf zusammenzuckte und einen anstarrte, wenn man sich nur nach dem Wege dorthin erkundigte? Was mochte der Herr nur für ein Mensch sein, daß sein schlechter Ruf so längs der ganzen Landstraße verbreitet war? Hätte eine Wegstunde mich wieder nach Essendean zurückgebracht, ich würde mein ganzes Abenteuer im Stich gelassen haben und wäre zu Mr. Campbell zurückgeeilt. Da ich aber nun schon einmal so weit gekommen war, hielt mich die Scham ab, mein Vorhaben aufzugeben, bis ich der Sache nicht auf den Grund gekommen wäre. Selbstachtung verpflichtete mich, die Geschichte durchzuführen. Und so wenig wie ich den Klang dessen, was ich hörte, liebte, und so sehr ich auch anfing, meinen Wanderschritt zu verlangsamen, fuhr ich dennoch fort, weiter nach meinem Wege zu fragen und vorwärts zu marschieren.
Es war kurz vor Sonnenuntergang, da begegnete mir ein derbes, dunkelhäutiges, sauertöpfisches Weib, das einen Hügel herabgestampft kam, und als ich ihr meine gewöhnliche Frage vorgelegt hatte, machte sie scharf kehrt, begleitete mich auf den Gipfel zurück, den sie soeben verlassen hatte, und wies auf eine Gruppe von Gebäulichkeiten, die ganz isoliert auf einer Wiese im Grunde des nächsten Tales standen. Die Landschaft in der Umgebung war freundlich, in sanften Wellen verlaufend, lieblich bewässert und bewaldet, und die Ernte schien mir wunderbar gesegnet. Das Haus selbst jedoch machte fast den Eindruck einer Ruine. Kein Weg führte zu ihm; kein Rauch stieg aus den Schornsteinen auf, auch war nichts da, was einem Garten glich. Mein Herz wollte mir stehenbleiben. »Das!« rief ich.
Ein boshaft zorniger Ausdruck zuckte über des Weibes Gesicht. »Das ist das Haus Shaw!« schrie sie. »Blut erbaute es; Blut verhinderte die Vollendung; Blut wird es vernichten! Sieh her!« rief sie wieder. – »Ich speie auf den Boden und pfeife darauf! Trostlos sei sein Fall! Wenn du den Gutsherrn siehst, sage ihm, was du jetzt hörst; sage ihm, das Janet Clouston heute zum zwölfhundertundneunzehnten Male die Verdammnis auf ihn und sein Haus herabbeschworen hat, auf Scheunen und Stall, Menschen, Gäste und Herren, Weib, Fräulein und Kind. – Verdammt, verdammt, verdammt sei ihr Untergang!«
Und mit einem Sprung wandte sich das Weib, dessen Stimme sich geisterhaft zu einer Art Singsang erhoben hatte, und war verschwunden. Ich stand da, wo sie mich verlassen hatte, mit gesträubtem Haar. In jenen Zeiten glaubte man noch an Hexen und zitterte bei einem Fluche; und dieser, der glatt wie ein böses Omen auf meinen Weg fiel, um mich zurückzuhalten, bevor ich noch mein Ziel erreicht hatte, stahl mir das Mark aus den Knochen.
Ich setzte mich nieder und blickte starr auf das Haus von Shaw. Je länger ich herabschaute, desto freundlicher erschien mir die Landschaft: überall Hagedornsträucher in voller Blüte; die Wiesen punktiert mit Schafen; ein großer Schwarm Krähen am Himmel; und alles kündete einen fruchtbaren Boden und gutes Klima; doch das elende Bauwerk inmitten wollte mir durchaus nicht gefallen. Während ich so dasaß am Grabenrande, schritten Bauersleute von den Feldern heimkehrend an mir vorüber; aber mir fehlte der Mut, ihnen einen guten Abend zu wünschen. Endlich ging die Sonne unter, und jetzt sah ich direkt gegen den gelben Himmel eine leichte Rauchwolke aufsteigen, wie mir schien, nicht viel stärker als der Rauch einer Kerze; aber sie war doch wenigstens da und bedeutete Feuer und Wärme und Kochen und irgendeinen lebenden Insassen, der das Feuer entzündet haben mußte; das tröstete wunderbar mein Herz – besser, davon war ich überzeugt, als eine ganze Flasche des Maiglöckchenwassers, auf das Mr. Campbell so große Stücke hielt.
Ich machte mich daher längs eines über die Wiesen auf mein Ziel zu führenden, nur undeutlich erkennbaren Pfades auf den Weg. Als einziger Zugang zu einem bewohnten Ort war er wirklich sehr undeutlich; doch ich sah keinen anderen. Bald führte er mich zu Steinpfeilern und einem dachlosen Pförtnerhaus daneben, am First mit einem Wappenschild geschmückt. Es war klar, das sollte der Haupteingang werden, aber er war nie vollendet worden. An Stelle eines schmiedeeisernen Tors hatte man ein paar Gatter mit Strohseilen befestigt; auch keine Spur einer Parkmauer oder einer Allee war zu erblicken, nur dieser eine Pfad, dem ich folgte, führte rechts an den Pfeilern vorüber in Windungen zu dem Hause hin.
Je mehr ich mich dem Gebäude näherte, um so trostloser wurde sein Anblick. Es machte den Eindruck des Flügels eines Hauses, das nie fertig geworden war. In den oberen Stockwerken stand das Innere weit offen, und das unvollendete Mauerwerk der Stufen und Treppen zeichnete sich gegen den Himmel ab. Zahlreiche Fenster waren unverglast, und Fledermäuse flogen wie Tauben in einem Taubenschlag aus und ein. Nacht hatte angefangen sich herabzusenken, als ich das Gebäude erreichte; und in drei der unteren Fenster, die sehr hoch über dem Boden lagen und eng und fest vergittert waren, tauchte das flackernde Licht eines kleinen Feuers auf.
War das das Schloß, zu dem ich hingehen sollte? Waren das die Mauern, in denen ich neue Freunde finden und in denen meine große Laufbahn ihren Anfang nehmen sollte? Aus meines Vaters Hause in Essen-Waterside schimmerten das Feuer und die glänzenden Lichter meilenweit ins Land, und die Türen standen jedem Bettler offen.
Vorsichtig schlich ich vorwärts, und als ich herankam und lauschte, hörte ich jemand mit Tellern klappern und ein leises, trockenes, heftiges Hüsteln, das ruckweise hervorbrach; aber kein Laut eines Gespräches ließ sich vernehmen, und kein Hund schlug an.
Soviel ich in dem Zwielicht wahrnehmen konnte, bestand die Tür aus einer mächtigen Holzplatte, ganz mit Nägeln beschlagen, und zagen Herzens zog ich meine Hand unter meinem Rock hervor und klopfte schüchtern. Dann stand ich und wartete. Im Hause wurde es totenstill; eine ganze Minute verstrich, nichts rührte sich außer den Fledermäusen über mir. Ich klopfte noch einmal und lauschte wieder. Inzwischen hatten sich meine Ohren so an die Stille gewöhnt, daß ich innerhalb des Hauses das Ticken der Uhr hören konnte, wie sie langsam die Sekunden zählte. Aber wer sonst sich in dem Hause befinden mochte, verhielt sich mäuschenstill und mußte sogar den Atem angehalten haben.
Ich war unschlüssig, ob ich nicht fortlaufen sollte; aber der Zorn gewann die Oberhand, und anstatt fortzueilen, fing ich an, mit Händen und Füßen gegen die Tür zu donnern und laut Mr. Balfours Namen zu rufen. Ich war noch in voller Tätigkeit, da vernahm ich das Husten unmittelbar über meinem Kopfe, und, als ich zurücksprang und hinaufsah, erblickte ich den Kopf eines Mannes mit einer großen Nachtmütze in einem Fenster des ersten Stockes und die glockenförmige Mündung einer Hakenbüchse.
»Sie ist geladen«, sagte eine Stimme.
»Ich bin mit einem Briefe an Mr. Ebenezer Balfour von Shaw hierhergekommen«, entgegnete ich. »Ist er zu Hause?«
»Von wem ist der Brief?« fragte der Mann mit der Donnerbüchse.
»Das tut nichts zur Sache«, sagte ich, denn ich fing an, sehr zornig zu werden.
»Gut«, lautete die Antwort. »Ihr könnt ihn auf die Türschwelle legen. Und dann schert Euch zum Teufel!«
»Das werde ich nicht tun«, rief ich. »Ich werde ihn, wie mir aufgetragen wurde, Mr. Balfour eigenhändig überreichen. Es ist ein Empfehlungsschreiben.«
»Ein Was?« rief die Stimme scharf.
Ich wiederholte, was ich gesagt hatte.
»Wer seid Ihr denn eigentlich?« kam nach einer längeren Pause die nächste Frage.
»Ich brauche mich meines Namens nicht zu schämen«, sagte ich. »Ich heiße David Balfour.«
Bei diesen Worten merkte ich deutlich, daß der Mann erschrak, denn ich hörte, wie das Gewehr rasselnd auf dem Fenstersims ausschlug, und erst nach einer sehr langen Pause ertönte mit einer seltsam veränderten Stimme die nächste Frage:
»Ist dein Vater tot?«
Ich war darüber so erstaunt, daß mir die Stimme versagte und ich nur dastehen und den Menschen anstarren konnte.
»Ja«, fuhr der Mann fort. »Er wird tot sein, kein Zweifel. Und das ist wohl der Grund, warum du an meiner Tür herumlungerst.« Wieder eine Pause, dann meinte er feindselig: »Na gut. Junge, ich werde dich einlassen«, und er verschwand vom Fenster.
Drittes Kapitel Ich mache die Bekanntschaft meines Onkels
BALD LIESS SICH EIN GEWALTIGES RASSELN VON Ketten und Riegeln vernehmen, vorsichtig wurde die Tür geöffnet und, sobald ich die Schwelle überschritten hatte, wieder hinter mir geschlossen.
»Geh’ in die Küche und rühr’ nichts an«, sagte die Stimme, und während der Hausbewohner sich damit beschäftigte, die Verteidigungsvorrichtungen der Tür in Ordnung zu bringen, tastete ich mich vorwärts und betrat die Küche.
Das Feuer brannte ziemlich hell und zeigte mir den kahlsten Raum, den ich wohl je gesehen habe. Ein halbes Dutzend Schüsseln stand auf den Regalen; der Tisch war zum Nachtessen mit einem Topf Hafergrütze, einem Hornlöffel und einem Krug Dünnbier bestellt. Außer den bezeichneten Gegenständen befand sich nichts weiter in dem großen, gewölbten, leeren Gemach als längs der Wände fest verschlossene Truhen und in einem Winkel ein Eckschrank mit einem Hängeschloß. Sobald die letzte Kette vorgelegt war, kam der Mann mir nach. Er war ein jämmerliches, gebeugtes, schmalschultriges, lehmgesichtiges Geschöpf; sein Alter mochte zwischen Fünfzig und Siebzig schwanken. Seine Nachtmütze war aus Flanell und ebenso der Schlafrock, den er statt Rock und Weste über einem zerfetzten Hemde trug. Schon seit langem hatte er sich nicht rasiert. Was mir jedoch das größte Unbehagen bereitete, ja mich sogar erschreckte, war, daß er mich nicht einen Moment aus den Augen ließ, mir aber auch nie offen ins Gesicht blickte. Welche Stellung er nach Geburt oder von Beruf einnahm, war mehr, als ich erraten konnte. Am ehesten hätte ich ihn für einen alten, unbrauchbaren Dienstboten gehalten, dem man gegen Kostgeld die Obhut dieses großen Hauses anvertraut hatte.
»Hast du Hunger?« fragte er mich und hob dabei seinen Blick bis zur Höhe meines Knies. »Kannst dort das bißchen Hafergrütze essen.«
Ich sagte, ich befürchte, es wäre sein eigenes Essen. »O,« meinte er, »ich kann sehr gut ohne welches auskommen; aber das Bier will ich trinken, es feuchtet meine Kehle an.« Er leerte den Krug etwa zur Hälfte, doch selbst während er trank, hielt er noch immer ein Auge auf mich gerichtet; dann streckte er plötzlich seine Hand aus, »Laß den Brief sehen«, sagte er dabei.
Ich erklärte, der Brief wäre für Mr. Balfour, nicht für ihn.
»Und wer denkst du wohl, bin ich?« fragte er. »Gib mir Alexanders Brief!«
»Ihr kennt meines Vaters Namen?«
»Wär’ merkwürdig, wenn ich den nicht kennen sollte,« erwiderte er, »war er doch mein leiblicher Bruder, und so wenig du auch mich und mein Haus und meine Hafergrütze zu lieben scheinst, Davie, mein Junge, bin ich doch dein leiblicher Onkel und du mein richtiger Neffe. Gib mir also den Brief und setz’ dich nieder und fülle deinen Napf.«
Wäre ich einige Jahre jünger gewesen, ich glaube, ich hätte vor Scham, Kummer und Enttäuschung Tränen vergossen. Auch so vermochte ich kein Wort herauszubringen, weder ein gutes, noch ein schlechtes, sondern gab ihm den Brief und machte mich mit so geringem Appetit, wie ihn nur je ein junger Mensch verspürte, über seine Hafergrütze.
Inzwischen beugte sich mein Onkel über das Feuer und drehte den Brief immer wieder in seiner Hand hin und her.
»Weißt du, was darin steht?« fragte er plötzlich.
»Ihr seht doch selbst, Sir,« entgegnete ich, »daß das Siegel nicht erbrochen ist.«
»Ja,« sagte er, »aber was führt dich hierher?«
»Ich sollte den Brief überbringen«, sagte ich.
»Na, na,« meinte er schlau, »wirst dir doch auch irgendwelche Hoffnungen gemacht haben, he?«
»Ich gestehe, Sir,« entgegnete ich, »daß ich wirklich, als man mir sagte, ich hätte reiche Verwandte, die Hoffnung nährte, sie würden mir im Leben weiterhelfen. Aber ich bin kein Bettler; von Euch verlange ich keine Gunstbezeigung, und ich wünsche keine, die nicht von Herzen kommt. Denn so arm, wie ich auch scheine, besitze ich doch selbst Freunde, denen es eine Freude sein wird, mir beizustehen.«
»Na, na,« sagte Onkel Ebenezer, »geh’ mir nur nicht gleich an den Kragen, werden uns schon noch gut verstehen, und, Davie, mein Bürschchen, wenn du genug von der Grütze hast, möcht’ ich wohl selbst noch ein wenig nehmen. Ja,« fuhr er fort, sobald er mich um Stuhl und Löffel gebracht hatte, »das ist ein feines, bekömmliches Süppchen – ein großartiges Gericht, Hafergrütze.« Er murmelte ein kurzes Tischgebet und fiel über das Essen her. »Dein Vater liebte Essen sehr, erinnere ich mich noch. Er war ein herzhafter, wenn auch kein großer Esser; doch was mich betrifft, ich konnte nie mehr als höchstens am Essen nippen.« Er nahm einen Schluck Dünnbier, und das erinnerte ihn wahrscheinlich an die Pflichten der Gastfreundschaft, denn seine nächsten Worte lauteten: »Wenn du Durst hast, Wasser findest du hinter der Tür.«
Auf diese Worte fand ich keine Antwort, sondern stand steif auf meinen beiden Füßen und blickte mit gewaltigem Zorn im Herzen auf meinen Onkel herab. Er dagegen fuhr fort zu essen wie ein Mann, dem die Zeit auf den Nägeln brennt, dabei schoß er verstohlene, scharfe Blicke bald auf meine Schuhe, bald aufmeine selbstgestrickten Strümpfe. Nur ein einziges Mal, als er gewagt hatte, ein wenig höher zu schauen, trafen sich unsere Augen, und kein Dieb, der mit seiner Hand in eines anderen Mannes Tasche ertappt wird, hätte ein schlechteres Gewissen verraten können. Das gab mir zu denken. Ich fragte mich, ob seine Ängstlichkeit allzulanger Entfremdung jeder menschlichen Gesellschaft entstamme, und ob sie nicht vielleicht nach einiger Zeit vergehen und mein Onkel sich in einen ganz anderen Menschen verwandeln würde. Aus diesen Gedanken wurde ich durch seine scharfe Stimme aufgeschreckt.
»Ist dein Vater schon lange tot?«
»Drei Wochen, Sir«, entgegnete ich.
»Er war ein verschlossener Mann, der Alexander – ein verschlossener, schweigsamer Mann. Er schwätzte nie viel, als er jung war. Er wird wohl nie viel von mir gesprochen haben?«
»Bevor Ihr mir es selbst erzähltet, Sir, wußte ich überhaupt nicht, daß er einen Bruder hatte.«
»Ach Gott, ach Gott,« versetzte Ebenezer. »Wohl auch nichts vom Hause Shaw, he?«
»Nicht einmal den Namen kannte ich, Sir.«
»Ist das zu glauben!« rief er. »Ein merkwürdiger Mann!« Trotzdem schien er außerordentlich befriedigt, doch ob über sich selbst, ob über mich oder über dieses Verhalten meines Vaters, war mehr, als ich zu erraten vermochte. Sicher jedoch war, daß der Widerwille oder die Abneigung, die er zunächst gegen meine Person empfunden hatte, allmählich schwand. Plötzlich sprang er auf, kam quer durch das Zimmer hinter mich und versetzte mir einen Klaps auf die Schulter. »Werden schon noch sein miteinander auskommen!« rief er. »Ich bin nur froh, daß ich dich einließ. Und jetzt, marsch ins Bett.«
Zu meiner Überraschung zündete er weder Lampe noch Kerze an, sondern ging in den dunklen Korridor, tastete sich schwer atmend seinen Weg eine Treppe hinauf und hielt vor einer Tür, die er aufschloß. So gut ich konnte, stolperte ich hinter ihm drein und blieb ihm dicht auf den Fersen. Er hieß mich eintreten, denn dies wäre mein Zimmer. Ich tat nach seinem Geheiß, aber nach wenigen Schritten schon blieb ich stehen und ersuchte ihn um ein Licht, um mich zu Bett zu legen.
»Ach was!« meinte Onkel Ebenezer, »der Mond scheint ja hell.«
»Weder Mond noch Sterne, Sir. Es ist stockdunkel«, widersprach ich. »Ich kann nicht einmal das Bett sehen.«
»Dummes Zeug, dummes Zeug«, sagte er. »Lichter in einem Haus, das ist eine Sache, mit der ich nicht einverstanden bin. Vor Feuer hab’ ich schreckliche Angst. Und jetzt ‘Gute Nacht’, Davie, mein Junge.« Und ehe ich noch Zeit hatte, eine weitere Einwendung zu machen, schlug er die Tür zu, und ich hörte, wie er sie von außen verschloß.
Ich wußte nicht, ob ich lachen oder weinen sollte. Das Zimmer war so kalt wie ein Brunnen, und das Bett, als ich endlich meinen Weg dorthin getastet hatte, so feucht wie ein Torfmoor; aber glücklicherweise hatte ich mein Bündel und mein Plaid mitgenommen; ich wickelte mich in das Letztere, legte mich im Schutz der großen Bettstatt auf den Boden nieder und schlief sofort ein.
Beim ersten Strahl des Tages öffnete ich meine Augen und fand mich in einem großen, mit gepreßtem Leder tapezierten und mit reichgeschnitzten Möbeln ausgestatteten Zimmer, das durch drei breite Fenster erhellt wurde. Vor zehn oder vielleicht zwanzig Jahren mußte es ein Raum gewesen sein, so angenehm, sich darin schlafen zu legen oder in ihm aufzuwachen, wie es sich ein Mensch nur wünschen konnte. Aber Feuchtigkeit, Schmutz und Nichtgebrauch und Mäuse und Spinnen hatten seitdem ihr schlimmes Werk verrichtet. Außerdem war eine Anzahl Fensterscheiben zerbrochen; dies war übrigens für das ganze Haus so charakteristisch, daß ich glaube, mein Onkel muß zu irgendeiner Zeit einer Belagerung seitens seiner erbosten Nachbarn standgehalten haben – vielleicht mit Janet Clouston an deren Spitze.
Inzwischen war die Sonne strahlend aufgegangen; und da es in diesem elenden Gemach sehr kalt war, klopfte und rief ich, bis mein Gefängniswärter kam und mich herausließ. Er führte mich zur Rückseite des Hauses, wo sich ein Ziehbrunnen befand, und forderte mich auf, »wenn ich wolle, dort mein Gesicht zu waschen«. Als das geschehen war, suchte ich auf eigene Faust meinen Weg zur Küche zurück, wo er Feuer angezündet hatte und damit beschäftigt war, Hafergrütze zu kochen. Auf dem Tisch befanden sich zwei Näpfe und zwei Hornlöffel, aber wieder nur ein einziges Maß Dünnbier. Vielleicht hatten meine Augen etwas erstaunt auf dieser Anordnung geruht, und vielleicht hatte mein Onkel das bemerkt; denn wie in Beantwortung meines Gedankens hub er an zu reden und fragte, ob ich auch gerne Ale trinken möchte – so nannte er nämlich das Dünnbier.
Ich sagte ihm, daß ich zwar daran gewöhnt wäre, daß er sich aber keine Umstände machen sollte.
»Nein, nein,« versetzte er, »was recht ist, werde ich dir nicht verweigern.«
Er holte ein zweites Gefäß vom Küchenbrett; statt jedoch frisches Bier abzuzapfen, goß er zu meiner größten Überraschung genau die Hälfte aus dem einen Becher in den andern. In dieser Handlung lag eine Art von Noblesse, die mir die Rede verschlug. War mein Onkel auch bestimmt ein Geizhals, so gehörte er doch zu jener rassereinen Sorte, die dieses Laster fast respektierlich macht.
Nachdem wir unsere Mahlzeit beendet hatten, schloß Onkel Ebenezer eine Schublade auf, entnahm ihr eine Tonpfeife und ein Stück Preßtabak, von dem er eine Pfeife voll abschnitt, bevor er ihn wieder wegschloß. Dann setzte er sich in die Sonne neben eines der Fenster und rauchte schweigend. Von Zeit zu Zeit schweiften seine Blicke über mich hin und er schoß eine seiner üblichen Fragen ab. Einmal erkundigte er sich: »Und deine Mutter?« und als ich ihm gesagt hatte, daß sie gleichfalls tot wäre, »ja, ja, sie war ein hübsches Mädchen!« Dann, wieder nach einer langen Pause: »Wer sind eigentlich deine Freunde?« Ich erzählte ihm, daß es verschiedene Herren des Namens Campbell wären. In Wahrheit war es freilich nur ein einziger, und zwar der Herr Pfarrer, der je die leiseste Notiz von mir genommen hatte; aber ich hatte allmählich das Empfinden, daß mein Onkel meine Stellung allzuleicht auffaßte, und da ich ganz allein auf ihn angewiesen war, wünschte ich nicht, daß er mich für gänzlich hilflos hielte.
Er schien sich diese Antwort zu überlegen und meinte dann: »Davie, mein Junge, du hast dich schon an die richtige Stelle gewandt, als du zu deinem Onkel Ebenezer kamst. Ich habe einen starken Familiensinn und will dir dein Recht zukommen lassen. Aber während ich so vor mich hinrauche, muß ich mir erst selbst überlegen, was wohl das Geeignetste für dich sein mag – ob Jurisprudenz oder Theologie oder vielleicht gar die Armee: die Armee lieben junge Leute am meisten – ich wünsche jedenfalls nicht, daß die Balfours einer Sippe Hochlandscampbells nachstehen, und ich möchte dich ersuchen, sein deinen Mund zu halten. Keine Briefe, keine Botschaften, überhaupt kein Wort zu irgend jemandem, sonst – da ist die Tür.«
»Onkel Ebenezer,« erwiderte ich, »ich habe keinen Grund, anzunehmen, daß Ihr es anders als gut mit mir meint. Trotzdem möchte ich, daß Ihr wißt, daß ich auch meinen Stolz besitze. Ich habe Euch nicht aus eigenem Antriebe aufgesucht, und wenn Ihr mir noch einmal die Tür weist, nehme ich Euch beim Wort.« Das schien ihn schwer zu ärgern. »Dummes Zeug«, sagte er. »Kein törichter Stolz, Bürschchen, kein törichter Stolz! Gedulde dich einen Tag oder zwei. Ich bin kein Hexenmeister, kann deine Zukunft nicht aus dem Boden eines Grütznapfes lesen. Aber laß mir nur einen Tag oder zwei Zeit und sage nichts, zu niemandem; und ganz sicher werde ich das Richtige für dich finden.«
»Sehr schön,« entgegnete ich, »und genug davon. Wenn Ihr mir weiterhelfen wollt, so wird mich das bestimmt sehr freuen, und ich werde herzlich dankbar sein.«
Ich hatte den Eindruck (allzufrüh freilich), daß ich die Oberhand über meinen Onkel gewann, und ich sagte daher rasch, daß mein Bett und Bettzeug gelüftet und an der Sonne getrocknet werden müßten; denn nichts würde mich dazu bewegen, in solch’ einem dumpfen Loche zu schlafen.
»Ist dies dein oder mein Haus?« fragte er mit einer spitzen Stimme und brach dann plötzlich ab. »Nein, nein,« fuhr er dann fort, »es war ja nicht so gemeint. Was mein ist, ist auch dein, Davie, mein Junge, und was dein auch mein. Blut ist dicker als Wasser, und es gibt niemanden außer dir und mir, der den Namen trägt.« Dann schwatzte er über die Familie und ihre einstige Größe und über seinen Vater, der angefangen hatte, das Haus zu erweitern, und über sich selbst, der den Bau als sündige Verschwendung eingestellt hatte, und das brachte mich darauf, ihm Janet Cloustons Botschaft auszurichten.
»Diese Vettel!« schrie er. »Zwölfhundertundneunzehnmal – das heißt jeden Tag, seitdem ich dieses Weibsbild ‘raussetzen ließ. Bei Gott! Ich werde sie über glühendem Torf rösten lassen, eher habe ich keine Ruhe! Eine Hexe – eine richtige Hexe! Ich mach’ mich auf und werde mit dem Gerichtsschreiher darüber sprechen.«
Bei diesen Worten öffnete er eine Truhe und nahm einen zwar sehr alten, aber gut erhaltenen blauen Rock nebst Weste und einen recht anständigen Biberhut, beide ohne Borten, heraus. Hastig zog er die Sachen an, holte einen Stock vom Küchenschrank, verschloß wieder alles sorgfältig und wollte schon fortgehen, als ein Gedanke ihn zurückhielt.
»Ich kann dich nicht allein in dem Hause lassen«, sagte er. »Ich muß dich aussperren.«
Das Blut schoß mir ins Gesicht. »Wenn Ihr mich aussperrt,« sagte ich, »wird es das Letztemal sein, daß Ihr mich in Freundschaft seht.«
Er wurde sehr blaß und zog seine Lippen ein. »Dies ist nicht die rechte Art,« entgegnete er und blickte finster in die eine Ecke auf den Boden. »Dies ist nicht die rechte Art, dir meine Gunst zu gewinnen, David.«
»Herr Oheim,« entgegnete ich, »bei aller Achtung für Euer Alter und unser verwandtschaftliches Blut schätze ich Eure Gunst doch nicht so hoch, um dafür meine Ehre zu verkaufen. Ich wurde zur Selbstachtung erzogen. Und wäret Ihr auch zehnmal der einzige Onkel und der einzige Familienangehörige, den ich auf der Welt besitze, um einen solchen Preis würde ich Eure Zuneigung doch nicht erkaufen wollen.«
Onkel Ebenezer schritt zum Fenster und blickte eine Weile hinaus. Ich sah, wie er zitterte und sich wand, wie ein Mann in Krämpfen. Als er sich jedoch umdrehte, lag ein Lächeln auf seinem Gesicht.
»Schön, schön,« meinte er, »wir müssen tragen und ertragen. Ich werde nicht ausgehen. Das ist alles, was ich darüber sagen will.«
»Onkel Ebenezer,« erwiderte ich, »ich verstehe diese Sache nicht. Ihr behandelt mich wie einen Dieb. Es ist Euch verhaßt, mich in diesem Hause zu haben. Mit jedem Wort und in jeder Minute zeigt Ihr mir das. Unmöglich könnt Ihr mich gerne haben. Was mich anbetrifft, ich habe zu Euch gesprochen, wie ich nie vermeinte, daß ich zu irgendeinem Menschen sprechen würde. Warum versucht Ihr mich zurückzuhalten? Laßt mich fortgehen – laßt mich zu den Freunden, die ich habe, und die mich lieben, zurückkehren!«
»Nein, nein, nein, nein«, sagte er eindringlich. »Ich hab’ dich aufrichtig gern, wir werden schon noch gut miteinander auskommen. Schon um der Ehre des Hauses willen könnte ich dich nicht den Weg zurückgehen lassen, den du gekommen bist. Bleibe ruhig hier, sei ein guter Junge. Wenn du erst ein Weilchen hier gewesen bist, wirst du finden, daß wir uns gut verstehen.«
»Schön, Herr Oheim,« sagte ich, nachdem ich mir die Sache eine zeitlang schweigend überlegt hatte, »ich werde eine Weile hier bleiben. Es ist gerechtfertigter, daß mir von meinem eigenen Blut weitergeholfen wird als von Fremden. Und falls wir uns nicht verstehen sollten – ich werde jedenfalls mein Bestes tun, daß die Schuld nicht an mir liegt.«
Viertes Kapitel Ich laufe große Gefahr im Hause Shaw
FÜR EINEN SO SCHLIMMEN ANFANG VERLIEF der Tag weiterhin recht günstig. Zum Mittagessen gab es wieder kalte Hafersuppe und zum Nachtmahl heiße Hafersuppe: Hafersuppe und Dünnbier, so lautete meines Onkels Speisezettel. Er sprach nur wenig, und das Wenige in der gleichen Weise wie vorher: nach langem Stillschweigen schoß er eine Frage auf mich los, und wenn ich versuchte, die Unterhaltung mit ihm auf meine Zukunft zu lenken, wich er mir immer wieder aus. In einem Zimmer unmittelbar neben der Küche, das er mir zu betreten gestattete, fand ich eine große Anzahl Bücher, lateinische sowohl wie englische, in die ich mich während des ganzen Nachmittags mit großem Genusse vertiefte. Weiß Gott, die Zeit verstrich mir in dieser guten Gesellschaft so rasch, daß ich schon anfing, mich fast mit meinem Aufenthalte in Shaw auszusöhnen. Nur der Anblick meines Onkels und dieser seiner Augen, die Katz’ und Maus mit mir spielten, erregte immer wieder meinen Argwohn. Noch eine andere Sache, die ich entdeckte, gab mir zu denken. Das war eine Widmung auf dem Schmutztitel eines Volksbuches (einer Schrift von Patrick Wolker), offenbar von meines Vaters Hand herrührend, die folgendermaßen lautete: »Meinem Bruder Ebenezer zu seinem fünften Geburtstage.« Was mich stutzig machte, war folgendes: da mein Vater bekanntlich der jüngere Bruder war, mußte ihm entweder ein seltsamer Irrtum unterlaufen sein, oder er mußte diese Zeilen – in ausgezeichneter, klarer, männlicher Handschrift – noch vor seinem fünften Lebensjahre geschrieben haben.
Ich versuchte, mir diese Sache aus dem Kopfe zu schlagen; aber obwohl ich zahlreiche interessante Autoren herunternahm, alte und neue, Geschichte, Poesie und Erzählungen, diese Eintragung in meines Vaters Handschrift wich nicht aus meinem Sinn; und als ich endlich in die Küche zurückging und mich wieder zu Hafersuppe und Dünnbier niedersetzte, war das erste, was ich zu Onkel Ebenezer äußerte, die Frage, ob mein Vater schon sehr frühzeitig lesen und schreiben gelernt hätte.
»Alexander? Keineswegs!« lautete die Antwort. »Ich war viel fixer, ich war ein aufgeweckter Bursche, als ich jung war. Ja, ich konnte genau so zeitig lesen wie er.«
Das verblüffte mich noch stärker. Ein Gedanke schoß mir durch den Kopf, und ich fragte, ob er und mein Vater Zwillinge gewesen wären.
Da fuhr er von seinem Stuhl auf, und der Hornlöffel entfiel seiner Hand. »Was bringt dich auf diese Frage?« rief er, packte mich vorne am Rock und blickte mir diesmal gerade in die Augen: seine eigenen, klein und hell und glänzend wie die eines Vogels, glitzerten und blinzelten seltsam.
»Was meint Ihr?« erkundigte ich mich ganz ruhig, denn ich war erheblich stärker als er und ließ mich nicht so leicht einschüchtern. »Nehmt Eure Hände von meinem Rock; das ist keine Art, sich zu benehmen.«
Mein Onkel riß sich anscheinend mit aller Gewalt zusammen. »Zum Henker, David, mein Junge«, sagte er, »du sollst zu mir nicht von deinem Vater sprechen. Darin liegt der Mißgriff!« Eine Weile saß er da und zitterte und blinzelte in seine Schüssel: »Er war der einzige Bruder, den ich je hatte«, fügte er hinzu, aber aus seiner Stimme klang keine Herzlichkeit. Dann hob er seinen Löffel auf und fing noch immer zitternd wieder zu essen an.
Diese letzten Worte, sein Handgreiflich werden, die plötzliche Zärtlichkeitsäußerung meinem toten Vater gegenüber gingen so völlig über mein Begriffsvermögen, daß sich Furcht wie Hoffnung in mir regten; einerseits kam mir der Gedanke, mein Onkel sei vielleicht geistesgestört und könnte gefährlich werden; andererseits erinnerte ich mich (ganz ungewollt und sogar etwas verängstigt) einer Geschichte, einer alten Ballade, die ich von den Landleuten singen gehört hatte, von einem armen Burschen, der der rechtmäßige Erbe war, und von einem ruchlosen Blutsverwandten, der versuchte, ihm sein Eigentum vorzuenthalten. Denn warum sollte mein Onkel einem Verwandten gegenüber, der, fast ein Bettler, an seine Türe kam, eine derartige Rolle spielen, wenn er in seinem innersten Herzen nicht irgendeinen Grund hatte, diesen Verwandten zu fürchten?
Aus diesem zwar nicht klar bewußten, aber trotzdem fest in meinem Herzen haftenden Gefühle heraus begann ich erst seine heimlichen Blicke nachzuahmen; gleich Katze und Maus saßen wir so an dem Tisch, jeder den anderen verstohlen beobachtend. Kein weiteres Wort, schlimm oder gut, hatte er mir zu sagen, sondern war ganz damit beschäftigt, irgend etwas Geheimes wieder und wieder in seinem Kopfe herumzuwälzen. Und je länger wir saßen, und je eifriger ich ihn beobachtete, desto gewisser wurde es mir, daß dieses Etwas für mich ungünstig wäre.
Sobald mein Onkel die Schüssel geleert hatte, holte er, genau wie am Morgen, eine einzige Pfeife voll Tabak hervor, trug einen Stuhl in die Herdecke und saß eine Zeitlang, den Rücken mir zugekehrt, rauchend dort. »Davie,« begann er endlich, »ich habe nachgedacht.« Dann machte er eine Pause und fuhr fort: »Ich besitze ein klein wenig Geld, das ich dir, bevor du noch geboren wurdest, so halb und halb zugesagt habe, – deinem Vater, zugesagt. O, nicht rechtsverbindlich, verstehst du; nur so ’n Gentlemengeschwätz beim Wein. Schön. Ich legte es, das bißchen Geld, gesondert an – es war ein großer Verlust, aber Versprechen ist Versprechen – und es ist bis heute angewachsen auf eine Summe von rund – von ganz genau« – hier machte er wieder eine Pause und stotterte – »von ganz genau vierzig Pfund.« Diese letzten Worte stieß er mit einem Seitenblick über seine Schulter hervor; und im nächsten Augenblick fügte er, fast mit einem Aufstöhnen, hinzu: »Schottisch!«
Ein Pfund Schottisch ist das gleiche wie ein englischer Schilling. Der Unterschied, den er, dank dieses zweiten Gedankens, machte, war daher beträchtlich; ich konnte auch mit völliger Klarheit erkennen, daß die ganze Geschichte eine Lüge war, zu irgendeinem Zweck erdacht, den zu ergründen ich mir vergeblich den Kopf zerbrach. Und ich machte nicht einmal den Versuch, den spöttischen Unterton, in dem ich antwortete, zu verbergen:
»O, Onkel, denkt noch einmal nach; Pfund Sterling, glaube ich!«
»Ja, das sagte ich ja«, erwiderte mein Onkel. »Pfund Sterling, und falls du eine Minute zur Tür hinausgehen willst, nur um nachzusehen, wie heute die Nacht ist, werde ich das Geld für dich heraussuchen, und dann ruf ich dich wieder herein.«





























