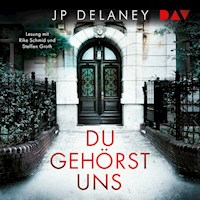9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein Mann, zwei Frauen, ein tödliches Spiel.
Der spannende Psycho-Thriller vom internationalen Bestsellerautor – voller überraschender Twists und packend bis zum Schluss!
Die Geschwister Finn und Jess sind vom plötzlichen Tod ihres Vaters nicht sonderlich betroffen. Kontakt zu ihm hatten sie ohnehin nicht. Nun erben sie seine heruntergekommene Finca auf Mallorca. Der einzige Haken: Die neue Frau ihres Vaters lebt noch dort. Finn fliegt auf die Insel, um die Sache möglichst schnell zu klären. Seine Überraschung ist groß, als er ein luxuriöses Anwesen vorfindet – und neben seiner Stiefmutter auch Roze, deren atemberaubend schöne Tochter. Hals über Kopf verliebt Finn sich in sie. Er will alles dafür tun, dass sie gemeinsam auf der Finca bleiben können. Doch dann beginnt die Polizei, Fragen zum Unfalltod seines Vaters zu stellen, und auch Finn wird unsicher. Welche dunklen Geheimnisse verbergen die beiden Frauen? Was hat es mit dieser Finca auf sich?
»Geheimnisvoll und so spannend, dass man sich schon fast für paranoid hält!« Alex Michaelides
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 338
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Ein traumhafter Landsitz. Ein Mann zwischen zwei Frauen. Ein Todesfall. Und eine Frage: Wer ist das nächste Opfer?
Der neue spannende Psycho-Thriller vom internationalen Bestsellerautor – voller überraschender Twists und packend bis zum Schluss!
Als die Geschwister Finn und Jess vom Tod ihres Vaters erfahren, sind sie nicht sonderlich betroffen. Die Scheidung ihrer Eltern liegt lange zurück, und Kontakt zum Vater, der nach Mallorca auswanderte und ein unkonventionelles Althippie-Leben führte, hatten sie ohnehin nicht. Nun erben sie seine heruntergekommene Finca, mitten in den idyllischen Hügeln der Mittelmeerinsel. Der einzige Haken: Ruensa, die neue Frau ihres Vaters, die dort noch lebt. Finn fliegt nach Mallorca, um die Sache möglichst schnell und sauber zu klären. Seine Überraschung ist groß, als er ein luxuriös renoviertes Anwesen vorfindet und die atemberaubende Roze, die erwachsene Tochter seiner Stiefmutter. Hals über Kopf verliebt sich Finn in die geheimnisvolle und so verletzlich wirkende Roze und will alles dafür tun, dass sie auf der Finca – und bei ihm – bleiben kann. Doch dann beginnt die Polizei, Fragen zum vermeintlichen Unfalltod seines Vaters zu stellen, und auch Finn wird unsicher. Welches dunkle Geheimnis aus ihrer Vergangenheit verbergen die beiden Frauen? Sind sie wirklich die hilflosen Opfer, die unverschuldet in diese Situation geraten sind? Oder wollen sie die Finca für sich – koste es, was es wolle?
JP Delaney wurde mit seinem ersten Thriller »The Girl Before« weltweit zum Star: Der Roman erschien in 45 Ländern und stand an der Spitze der internationalen Bestsellerlisten. Seitdem setzt JP Delaney mit seinen genialen Ideen und rasanten Romanen neue Standards im Thriller-Genre.
»Geschickt spielt Delaney mit Vorahnungen, Doppeldeutigkeiten und dem, was im Verborgenen liegt. Eine wahre Freude für jede*n Thriller-Leser*in!« Sunday Times
»Wieder ein grandioser Thriller von diesem First-Class-Autor!« Daily Mail
www.penguin-verlag.de
JP DELANEY
DIE ERBIN
SIE WILL, WAS DIR GEHÖRT. DER PREIS DAFÜR IST DEIN LEBEN.
Thriller
Aus dem Englischen von Sibylle Schmidt
Die Originalausgabe erschien 2023 unter dem Titel The New Wife bei Quercus, London.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung des urheberrechtlich geschützten Inhalts dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
PENGUIN und das Penguin Logo sind Markenzeichen von Penguin Books Limited und werden hier unter Lizenz benutzt.
Copyright © der Originalausgabe 2023 by JP Delaney
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2024 Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Ulla Mothes
Umschlaggestaltung: bürosüd unter Verwendung eines Motivs von mauritius images/Peter Winkler – Sichtachse Fotografie
Satz: satz-bau Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-30009-8V003
www.penguin-verlag.de
In ländlichen Teilen von Mallorca findet man immer noch Johannisbrotbäume, zwischen denen große Netze gespannt sind, zum Himmel hin offen. Das sind trampes, Singvogelfallen. Wilderer bestreichen auch Baumäste mit Leim; wenn Drosseln und andere kleine Zugvögel darauf landen, bleiben sie kleben. Nach stundenlangem Kampf sterben sie vor Erschöpfung und werden am nächsten Morgen von den Ästen gepflückt.
Roze hatte mir einmal erzählt, dass in Albanien etwas Ähnliches gemacht wird. Dort benutzt man allerdings »Nebelnetze« – sie werden so genannt, weil die Fäden so fein sind, dass die Vögel sie entweder nicht sehen oder für harmlose Spinnweben halten. Das Ziel ist jedoch das Gleiche: den Vogel zu fangen, bevor er merkt, was mit ihm geschieht. Und so ist es letztlich sein Kampf, sich zu befreien, der den Vogel das Leben kostet.
Der Leim und das Netz. Zwei Arten der Jagd. Aber in beiden Fällen merkt das Opfer erst, dass es gejagt wird, wenn es schon zu spät ist.
1
Beginnen wir mit dem Tod des Alten Dreckskerls, denn so fing alles an. Oder, genauer gesagt, mit dem Anruf von Jess, die mir davon berichtete.
»Sitzt du gerade?«, fragte sie, als ich abnahm.
»Ich liege im Bett. Passt das auch?«
»Das gibt’s doch nicht. Ich bin schon seit Stunden auf.«
Ich hörte, wie sie nebenbei herumrumorte, offenbar irgendwas im Haushalt erledigte. »Du wolltest ja unbedingt Kinder«, sagte ich trocken.
»Sagt der selbstgefällige Single. Also jedenfalls: Ich weiß nicht genau, ob es ein Anlass für Beileid oder für Glückwünsche ist, aber ich habe Neuigkeiten. Halt dich fest. Dad ist gestorben.«
Ich brauchte einen Moment, bis ich das kapiert hatte. »Im Ernst?«, sagte ich schließlich. »Wie ist das passiert?«
»Ist offenbar zusammengebrochen. Beim Aufschichten eines Feuers.«
»Ohne betrunken zu sein?«
»Hmm.« Ein Schweigen entstand, als Jess überlegte. »Ja, vermutlich schon, während er betrunken Äste verbrennen wollte«, sagte sie dann.
»Von wem hast du es erfahren?«
»Die Ehefrau hat mich angerufen. Ruensa.« Jess sprach den Namen mit rollendem R aus.
Ich setzte mich auf. Trotz allem kam es mir unpassend vor, im Liegen über den Tod meines Vaters zu sprechen. »In welchem Zustand war sie?«
»Na ja, es ist schon vor fast einer Woche passiert. Meine Nummer war auf seinem Handy gespeichert, aber Ruensa kannte seinen PIN-Code nicht, deshalb hat es so lange gedauert, bis sie mich kontaktieren konnte. War wohl alles ziemlich schlimm – der Krankenwagen konnte den steilen Weg nicht rauffahren, deshalb mussten sie ihn mit der Trage den Hang runterschleppen. Als sie die Klinik in Palma erreichten, war er schon tot.«
»Klingt furchtbar.« Dann kam mir ein Gedanke. »Sollten wir an der Beerdigung teilnehmen? Hat sie gesagt, wann die ist?«
»Hat bereits stattgefunden. Du weißt ja, wie die da sind – das geht immer schnell. Ruensa hat sich sehr dafür entschuldigt. Ich habe ihr gesagt, wir seien natürlich traurig, die Bestattung versäumt zu haben, hätten aber Verständnis.« Jess’ Tonfall war trocken.
»Empfindest du das so?«
»Ob ich traurig darüber bin? Nein, bin ich nicht. Abgesehen von allem anderen wäre das bestimmt auch etwas seltsam gewesen, oder? Die dritte Ehefrau des Vaters erst bei seiner Bestattung kennenzulernen.«
Jess und ich waren nicht zur Hochzeit eingeladen gewesen, einer standesamtlichen Trauung vor etwas über einem Jahr in Palma. Wir hatten beide nicht einmal gewusst, dass unser Vater wieder eine feste Beziehung eingegangen war. Und wahrscheinlich hätten wir so oder so nicht teilnehmen wollen, da wir beide ihn schon seit Langem gemieden hatten. Mit Jess hatte er noch alljährlich Weihnachten telefoniert, aber ich hatte auf seine Anrufe nicht reagiert.
»Aber wir sollten ihr zumindest schreiben«, sagte ich. »Also ich mache das auf jeden Fall.«
»Okay. Hey, das bedeutet, dass wir jetzt reich sind.« Jess hörte sich betont beiläufig an.
»Wohl schon, ja. Lieber Himmel, ich hätte nie gedacht, dass das jetzt so schnell geht.«
»Du willst wohl eher nicht dort leben?«
»Auf der Finca?« Ich schnaubte. »Da schneide ich mir eher die Hand mit einem rostigen Filetiermesser ab.«
»Geht mir auch so.«
Danach trat ein längeres Schweigen ein. Ich spürte aber auch ohne Worte, was Jess jetzt dachte. Unsere Gespräche verliefen oft so sprunghaft, als würden wir ständig den Faden verlieren, folgten aber dennoch einem tiefer liegenden Gedankengang. Kinder aus Scheidungsfamilien sind sich häufig sehr nah. Aber Kinder, die aus so extremen Verhältnissen stammen wie wir, fühlen sich meist noch enger verbunden.
»Also verkaufen wir – vermieten kommt nicht infrage«, sagte Jess schließlich. »Und was ist mit der Ehefrau? Meinst du, sie weiß, dass sie das Anwesen nicht kriegt?«
»Warum sollte sie so was haben wollen? Es ist doch völlig runtergekommen. Aber er wird ihr das bestimmt gesagt haben, denke ich.«
»Glaubst du? Ich meine, man sagt ja eher nicht so nebenbei: ›Ach, übrigens bin ich so ein versoffener irrer alter Geizkragen, dass ich nach meiner ersten Ehe keinen Unterhalt zahlen wollte und meine Kinder deshalb die Finca erben?‹ Und vergiss nicht, dass er auch noch ein totaler Feigling war.« Jess schwieg wieder einen Moment. »Ich vermute eigentlich, dass man sie erst darüber in Kenntnis setzen muss.«
Jetzt versank ich eine Weile in Schweigen. Weil ich meine Schwester zwar liebe, sie aber manchmal ziemlich hart und materialistisch finde. Ich weiß allerdings, dass das eine Folge unserer Kindheit ist. Der Lebensstil unserer Eltern war so chaotisch gewesen, dass manchmal außer einem Teller Haschkekse nichts zu essen im Haus war; dass wir nicht zur Schule gebracht wurden, weil im Künstlerdorf Deià eine spontane Strandparty stattfand; dass zum Frühstück wildfremde Leute aus den oberen Zimmern auftauchten. Da ist es dann kein Wunder, wenn man sich nach Stabilität und einem bürgerlichen Leben sehnt. Und Jess hatte diesen Weg hundertprozentig eingeschlagen – sie war mit einem Banker verheiratet und hatte ihre Kinder bereits für eine Privatschule angemeldet.
»Wir sollten aber schon einen angemessenen Zeitraum abwarten«, sagte ich entschieden, um das Thema abzuschließen. »Ich finde, es gehört sich nicht, sie zu drängen.«
»Aber was ist mit Hausbesetzern?«, sprach Jess weiter, als hätte ich nichts gesagt. »Hast du dir diesen Link mal angeschaut?«
»Habe ich, ja.« Vor etwa einem Monat hatte Jess mir einen Bericht darüber geschickt, wie auf Mallorca Hausbesetzer leer stehende Ferienhäuser übernahmen. Aufgrund der schwerfälligen spanischen Justiz hatten die rechtmäßigen Besitzer kaum Handhabe, um die Hausbesetzer schnell wieder zu vertreiben. Ich hatte mich damals etwas verwundert gefragt, warum Jess mir den Artikel geschickt hatte. Aber vielleicht hatte sie da bereits über die Zukunft der Finca unseres Vaters nachgedacht.
Oder unserer Finca, wie es jetzt aussah.
»Also sollte man auch nicht zu lange abwarten«, fuhr Jess fort, »sonst kann sie womöglich vorerst einfach bleiben. Ich denke, du solltest hinfliegen, unser Beileid aussprechen und gleichzeitig höflich klarstellen, dass das Anwesen uns gehört.«
»Nicht dein Ernst, Jess, oder?«
»Wieso? Du kannst ja die Emissionen von deinem Flug kompensieren, wenn du willst. Außerdem würde es dir guttun, mal rauszukommen.«
»Ach so? Wieso das denn?«, erwiderte ich spitz, aber darauf ging Jess nicht ein.
»Ist schön auf Mallorca um diese Jahreszeit. Die Orangenbäume blühen«, sagte sie stattdessen.
»Na klar. Und auf der Finca stinkt es nach fauligen Orangen und wurmigen Oliven, und es wimmelt nur so von riesigen Ratten und Baummardern.« Ich erinnerte mich plötzlich, in welchem Zustand das Anwesen gewesen war, als ich es zum letzten Mal erlebt hatte: das Haus baufällig, mit einem riesigen Loch im Dach und verrotteten Fensterläden, die Orangen- und Olivenhaine eine einzige Wildnis aus Pampasgras, Oleandersträuchern und verfaulenden Früchten. Es war ein imposantes und wunderschönes Anwesen – ein possessió, wie die Mallorquiner so etwas nennen, eine Villa mit Ländereien, in etwa entsprechend einem englischen Herrenhaus –, hoch oben in den Bergen gelegen. Aber es war bereits mehrere Jahrzehnte unbewohnt gewesen, als unsere Eltern dort eingezogen waren, und viele notwendige Reparaturarbeiten hatte man nie ausgeführt. Anfänglich gab es nicht einmal Strom; unser Vater hatte sich jahrelang damit gebrüstet, dass wir »autark« leben würden, als sei es eine Entscheidung für diesen Lebensstil und nicht einfach dem Mangel an Finanzkraft und Organisation geschuldet. Dann kam der Tourismusboom auf Mallorca, und eine Zeit lang verdiente unser Vater nicht schlecht mit dem Verkauf seiner Gemälde. Aber zuerst verpulverte er viel Geld für Drogen, dann für Brandy. Die Drogen wirkten sich nicht sonderlich negativ auf sein Schaffen aus, der Alkohol dagegen massiv. Und als meine Mutter – eine sanfte, träumerische Person, die sich nie gegen meinen Vater durchsetzen konnte – endlich die Reißleine zog und mit uns nach England zurückkehrte, hatte er schon jahrelang kein Gemälde mehr verkauft.
»Du könntest auch den Anwalt beauftragen, der Ehefrau die Lage schon mal zu erklären«, schlug Jess jetzt vor. »Wenn du dann vor Ort bist, kannst du ganz ungeniert die Rolle des lange verschollenen Stiefsohns spielen und betroffen kondolieren.«
»Dir ist schon klar, dass du ganz schön kaltherzig bist, oder?«
»Ich werde keinesfalls heucheln, ich hätte ihn gerngehabt. Und geliebt schon gar nicht.« Sie blieb einen Moment stumm. »Ich habe ihm ein einziges Mal gesagt: ›Pa, ich hab dich lieb.‹ Da muss ich etwa elf gewesen sein. Weißt du, was die Reaktion war?«
»Nichts Nettes, vermute ich mal.«
»Er sagte: ›Ach, sei doch nicht so scheißbürgerlich.‹«
Mir fiel ein, dass ich eine ähnliche Erfahrung gemacht hatte, als ich meinen Vater ungeschickt zu umarmen versucht hatte. Er war zurückgewichen und hatte angewidert gesagt: Sei nicht so ein Weichei.
Wer glaubt, dass Hippies für Frieden, Liebe und Toleranz standen, kannte Jimmy Hensen nicht. Obwohl er streng genommen auch keiner war – eher ein chaotischer, zügelloser, selbst ernannter Bohemien. Aber viele Leute hatten ihn angesichts seines Lebensstils und des bunten Völkchens, mit dem er sich umgab, für einen Hippie gehalten, bis sie durch seine gehässigen, bösartigen Bemerkungen eines Besseren belehrt worden waren.
»Und das ist übrigens ein weiterer Grund, warum du die Reise machen solltest und nicht ich«, fügte Jess hinzu. »Du kommst besser mit dieser ganzen Gefühlsduselei klar als ich.«
Ich seufzte. Das war auf jeden Fall zutreffend. »Was wissen wir denn über die Frau?«, fragte ich. »Sie ist Tai-Chi-Lehrerin, oder?«
»Du bist nicht mehr auf dem aktuellen Stand – das war doch die davor. Ruensa ist Haushälterin. Die beiden haben sich kennengelernt, weil sie als Putzhilfe bei ihm anfing.«
»Dad hatte eine Putzhilfe?«
»Wunder über Wunder, oder? Wer weiß, vielleicht ist das Anwesen gar nicht mehr so verwahrlost wie früher.«
»Hm. Als ich das letzte Mal dort war, hätte Putzen dem Dach auch nicht mehr geholfen.«
»Übrigens«, fuhr Jess fort, »sah es mit der Liebe wohl nicht so rosig aus. Bei mir sind mal ein paar Textnachrichten gelandet, die wohl für sie bestimmt waren. Da hat er sie als Schlampe beschimpft. Und war eindeutig betrunken.«
»Na super.« Je länger ich darüber nachdachte, desto weniger wollte ich mit der ganzen Angelegenheit zu tun haben. Tatsächlich fand ich Jess’ Vorschlag, die Abwicklung Tomàs zu überlassen, dem befreundeten Anwalt, der den Vertrag über die Finca mit unseren Eltern geregelt hatte, sehr vernünftig. Aber meine Schwester wollte sich eindeutig durchsetzen, und ich wusste aus Erfahrung, dass es nicht sinnvoll war, ihr in dieser Phase zu widersprechen.
»Es wird bestimmt gut«, sagte sie jetzt. »Und ist doch auch stimmig, dass wir sie mal treffen, zumindest einmal. Ich habe ihr gesagt, dass einer von uns diese Woche vorbeikommt, um zu kondolieren. Habe aber bereits angekündigt, dass vermutlich du das sein wirst, weil ich die Kinder habe.«
»Besten Dank auch, Schwester. Gut gemacht.« Meine Bemerkung über Jess’ Kaltherzigkeit war noch halb im Scherz gewesen. Aber jetzt war ich wirklich wütend darüber, wie sie mich in diese Situation hineinmanipuliert hatte.
»Willst du das Haus haben oder nicht?«, versetzte sie. »Ich habe vorhin mal den Preis von unsanierten Fincas auf Mallorca gegoogelt. Man kriegt ein Vermögen dafür – sogar baufällige werden für eine halbe Million gehandelt. Überleg dir mal, was du mit deiner Hälfte von dem Geld anfangen könntest. Und es ist ja nicht gerade so, dass wir von Mum sonst irgendwas bekommen hätten.«
Ich antwortete nicht, sah mich aber unwillkürlich in meinem Zimmer in der kleinen Wohnung um, die ich mir mit zwei Mitbewohnern teilte. Natürlich sah es Jess ähnlich, dass sie sich darüber informierte, wie viel unser Erbe wert war. Die Wahrheit war aber auch, dass der Verkauf der Finca die einzige Chance für mich war, mir in London eine bessere Unterkunft leisten zu können. Unsere Mutter war weit vor der Zeit an Krebs gestorben; weil sie aber vorher wieder geheiratet hatte, war ihr kleines Erbe an ihren neuen Mann gefallen. Als der auch nicht lange danach verstarb, erbten seine leiblichen Kinder. Ich hatte versucht, mir etwas anzusparen, was aber angesichts meiner Studienschulden und ausgereizten Kreditkarten immer weniger machbar erschien.
Plötzlich kam mir in den Sinn, dass Jess und ich jetzt Waisen waren. Ganz allein auf der Welt, was anders gewesen war, als unser Vater noch existierte. Es war ein verwirrendes und beunruhigendes Gefühl.
»Gut, ich werde mich mal dort blicken lassen«, sagte ich schließlich. »Mal hören, was für Pläne die Frau hat. Aber Tomàs soll vorher die ganzen juristischen Sachen geklärt haben.«
»Feigling«, bemerkte Jess, hörbar zufrieden, dass sie ihren Willen bekommen hatte.
»Wie hat sie sich am Telefon angehört?«, fragte ich, um nicht zu sagen: Worauf muss ich mich einstellen?
»Keine Sorge – sie wirkte nicht völlig aufgelöst oder so. Ernst natürlich, aber … ruhig, würde ich sagen. Sie war sogar sympathisch, kam mir viel weniger abgedreht vor als seine ganzen früheren Frauen. Bodenständiger irgendwie.«
»Mir tut sie ja leid. Ist echt eine Scheißsituation für sie.«
»Ach, komm runter. Sie war mit dem Alten Dreckskerl verheiratet und hat bestimmt inzwischen gemerkt, dass es ihr ohne ihn besser geht. Genau wie wir.« Sie hielt inne. »Na ja, auf andere Art, aber du weißt schon, wie ich das meine.«
Wenn ich jemandem erzähle, dass ich die ersten fünfzehn Jahre meines Lebens auf Mallorca verbracht habe, bekomme ich meist zu hören, das müsse doch traumhaft gewesen sein. Manche haben vielleicht sogar von den Leuten aus der Musik- und Literaturszene gehört, mit denen meine Eltern verkehrten, oder von dem anrüchigen Aristokraten, der eine Affäre mit einem weniger bekannten Mitglied des britischen Königshauses gehabt hatte. Aber da lagen die goldenen Jahre der Freigeister, die den simplen Lebensstil der spanischen Bauern leben wollten, schon Jahrzehnte zurück, und die älteren britischen Auswanderer, die damit prahlten, den Maler Joan Miró oder den Schriftsteller Robert Graves noch gekannt zu haben, verzapften – bei genauerer Überprüfung der zeitlichen Zusammenhänge – Unsinn. Das Zentrum der Gegenkultur war damals das alte Fischerdorf Deià, wo Graves gelebt hatte, und das war bereits unbezahlbar, als meine Eltern auf Mallorca eintrafen. Deshalb fuhren sie weiter die Küste entlang, bis sie Cauzacs entdeckten, ein kleines Dorf hoch oben an einem Berg nahe der Küste. Mein Vater wollte wegen des Lichts hoch oben wohnen, aber die Finca war damals auch extrem günstig zu haben. Das Land dort erwies sich dann als wesentlich steiniger und weniger fruchtbar als weiter unterhalb, und der Plan, Selbstversorger zu sein, schwand bald ebenso dahin wie die angelegten Terrassen, die von der Wildnis zurückerobert wurden. Und obwohl wir von der Finca aus direkt auf das Dorf blickten, das nur einen Katzensprung entfernt war, musste man eine Viertelstunde fahren, um es zu erreichen, oder eine halbe Stunde Fußmarsch auf einem steilen, gewundenen Pfad in Kauf nehmen.
Deshalb hielten Jess und ich uns früher hauptsächlich bei anderen Aussteigern auf – deren Kinder Namen wie Harmony, Zen, Felicity oder Sky abgekriegt hatten; auch in unseren Ausweisen steht nicht Jess und Finn – und zögerten immer den Moment hinaus, in dem wir den steilen Aufstieg antreten mussten. Wir waren natürlich Außenseiter in der mallorquinischen Dorfschule, aber es gab immerhin eine ganze Bande von uns, und wir bekamen von den Müttern immer etwas zu futtern, auch wenn es nur Pa amb oli war, älteres geröstetes Brot mit dem Fruchtfleisch einer Tomate, Olivenöl und vielleicht ein bisschen Sobrasada, mallorquinischer Streichwurst.
Mein Vater war aber auch ein sehr charmanter Mann. Das kam noch nicht zur Sprache, weil meine Erinnerungen an ihn vor allem von seinen Mängeln als Vater und Ehemann geprägt sind. (Womit nicht gemeint ist, dass er untreu war – meine Eltern führten, wie viele der sogenannten »Künstlertypen«, eine offene Ehe.) Frauen beteten ihn an, und er vergötterte sie, bis er ihrer überdrüssig wurde. Er hatte sich von irgendwoher etliche Dashikis beschafft, farbenfrohe afrikanische Hemden – heutzutage empfinde ich diese unreflektierte kulturelle Aneignung als Anlass zum Fremdschämen –, und sogar als seine lange Mähne weiß geworden war, gab er eine buchstäblich malerische Gestalt ab, wenn er an der Staffelei stand oder bei einer Vernissage in Palma eine Ansprache hielt. Da er sich einen kindlichen Geist bewahrt hatte, konnte man auch Spaß mit ihm haben – vorausgesetzt, er war nüchtern. Aber da er nicht bereit war, irgendwelche Grenzen zu akzeptieren, erkannte er auch nicht, dass Kinder welche brauchen. Wir lernten nicht einmal eine einzige Sprache richtig – zu Hause sprachen wir Englisch, in der Schule Katalanisch und im Dorf Mallorquinisch; Jess tat sich besonders schwer mit dieser Situation und konnte sich deshalb lange in keiner Sprache richtig verständigen.
Nachdem wir wieder in England lebten, war ich nur noch ein paarmal auf Mallorca gewesen. Die zweite Ehefrau wollte nichts mit uns zu tun haben, und mein Vater war zu egomanisch, um eine Beziehung mit uns aufrechtzuerhalten. Unsere Mutter redete anfänglich davon, das kulturelle Erbe unserer Herkunft pflegen zu wollen. Aber letztlich war der Lebensstil unserer Eltern gar nicht von der mallorquinischen Kultur geprägt gewesen, und als unsere Mutter erneut heiratete, wollte sie diesen Teil ihres Lebens ebenso vergessen wie wir. Deshalb bestand für mich das einzige Vermächtnis meiner ersten fünfzehn Lebensjahre aus einem EU-Pass, einer Neigung zum Stottern, wenn ich nach dem richtigen Wort suchte, und einem Dokument, das besagte, dass mein Vater nach der Trennung von meiner Mutter lebenslanges Wohnrecht auf der Finca hatte, die nach seinem Tode an uns übergehen werde. Diese auf Mallorca übliche Nießbrauchregelung, usufructo, war vertraglich festgelegt worden von Tomàs, dem Anwaltsfreund meiner Mutter, als ihm zu Ohren gekommen war, dass der Alte Bastard sich geweigert hatte, ihr auch nur einen Penny zu geben, wenn sie ihn – mitsamt uns – verlassen würde. Ich glaube, Tomàs musste damals sogar unsere Flüge bezahlen.
Und nun würde ich also zurückkehren. Meinen Äußerungen gegenüber Jess zum Trotz empfand ich eine Spur von Neugier. Nicht auf die dritte Gattin – ich wusste bereits, wie sie sein würde, da mein Vater sich immer wieder den gleichen Typ Frau gesucht hatte: Auch wenn sie als Haushaltshilfe arbeitete, würde sie sonnengebräunt sein und sich für Yoga und den ganzen anderen narzisstischen Wellness-Quatsch interessieren, zu dem die einstige Gegenkultur inzwischen mutiert war. Nein, ich war vielmehr gespannt auf das Anwesen. Dort nahm alles vor fünfzehn Jahren eine verheerende Wendung, und nun kehrte ich zurück, um die Finca zu übernehmen.
2
Aber ich hatte es nicht eilig, trat die Reise erst am Samstag nach dem Telefonat mit Jess an. Meine beruflichen Verpflichtungen hinderten mich an nichts, denn ich war als selbstständiger Webentwickler für ein IT-Unternehmen tätig, für das ich auch aus dem Ausland arbeiten konnte. Mir ging es vor allem darum, der Frau meines Vaters Zeit zu lassen.
Oder vielmehr der Witwe. Ich musste mir jetzt auch angewöhnen, sie beim Namen zu nennen und nicht einfach nur »die Frau« zu denken.
Außerdem wollte ich, dass Tomàs, der Anwalt, ausreichend Zeit hatte, um Ruensa zu informieren. Ich hatte nicht die geringste Absicht, unangekündigt vor der Haustür zu stehen und zu verkünden, dass es jetzt unsere Tür sei – was Jess auch sagen mochte. Das wäre nicht nur unsensibel gewesen, sondern hätte auch einen Konflikt erzeugen können. Und ich hoffte sehr, heftige Emotionen meiden zu können, sowohl Zorn als auch Trauer.
Tomàs schätzte die Lage als unproblematisch ein. »Es ist ja nicht ungewöhnlich, dass ein Mann, der ein weiteres Mal heiratet, per Testament seinen leiblichen Kindern das Haus vererbt«, erklärte er, als ich ihn anrief. »Und hier verhält sich das nicht wesentlich anders. Ich werde ihr kondolieren und dabei möglichst taktvoll versuchen herauszufinden, inwieweit sie Bescheid weiß.«
»Vielen Dank, Tomàs.«
»Ihr müsst allerdings damit rechnen, dass es bis zur Testamentseröffnung einige Zeit dauern wird. Das Testament muss zunächst von einem Gerichtsübersetzer übertragen und mit einer Apostille beglaubigt werden. Danach müssen die Dokumente angefertigt und unterzeichnet werden, und die Steuerbehörde muss in den Verkauf einwilligen … ich vermute, der gesamte Vorgang wird mehrere Monate in Anspruch nehmen.«
»Kannst du das alles für uns regeln, damit wir nicht vor Ort sein müssen?«
»Natürlich – ich kann Dokumente vorbereiten, mit denen ihr mir eine Vollmacht ausstellt. Die müssen allerdings bei einem spanischen Notar unterschrieben werden. Aber ich kann bereits mit den Vorbereitungen beginnen.« Als er weitersprach, klang seine Stimme herzlich. »Ich freue mich darauf, dich wiederzusehen. Komm in mein Büro, dann essen wir zusammen zu Mittag und bringen uns auf den neuesten Stand.«
»Sehr gerne.«
Tomàs war für Jess und mich wie eine Art Onkel. In unserer Kindheit waren ständig Menschen bei uns aufgetaucht und schnell wieder verschwunden – Freunde, Affären, Schnorrer, Bewunderer. Manche blieben ein paar Wochen, andere ein paar Monate. Ein paar wenige lebten sogar länger auf der Finca, kochten Marmelade aus unserem Obst, die sie auf Bauernmärkten verkauften, boten Henna-Tattoos an oder Ähnliches, bis mein Vater die Leute satthatte und wegschickte. Dann verabschiedeten sich einige von uns Kindern, die wir uns an sie gewöhnt hatten, aber durchaus nicht alle. Tomàs war eine der wenigen Konstanten in unserem Leben gewesen – ein kultivierter, weltläufiger Anwalt, der die Künstlerszene von Mallorca anregend fand, aber auch ein enger Freund meiner Mutter wurde. Ich gehe davon aus, dass sie irgendwann auch mal etwas miteinander hatten, da ohnehin jeder mit jedem schlief. Aber er war auch ein einfühlsamer Zuhörer und einer der wenigen, die praktische Ratschläge geben konnten.
Deshalb war ich mir sicher, dass er sein Wort halten und sich im Gespräch mit Ruensa taktvoll benehmen würde. Dennoch war mir unbehaglich zumute, als ich kurz vor dem Abflug einen Anruf von einer mir unbekannten spanischen Nummer bekam.
»Hola?«, meldete ich mich zögernd.
Eine wohlklingende Frauenstimme sagte: »Spreche ich mit Finn?«
»Ja, ich bin Finn.«
»Hier ist Ruensa – Jimmys Frau. Passt es gerade?«
Ich warf einen Blick auf meine Uhr. Noch vierzig Minuten bis zum Boarding; das war ein weiteres Ergebnis unserer chaotischen Kindheit – Jess und ich erschienen überall lächerlich früh. »Ja, kein Problem.«
»Ich habe deine Nummer von deiner Schwester bekommen – ich hoffe, das ist okay für dich. Sie hat mir gesagt, du seist auf dem Weg nach Mallorca.«
»Genau.« Ruensa hatte einen Akzent, den ich nicht zuordnen konnte – skandinavisch vielleicht.
»Dann hoffe ich sehr, dass du vorhast, während deines Aufenthalts auf der Finca Síquia zu wohnen«, sagte sie.
»Ich habe mir eigentlich ein Zimmer gebucht …«, begann ich.
»Also nein, bitte wirklich nicht. Jimmy wäre entsetzt, wenn er das hören würde.« Die Vorstellung, dass mein Vater sich auch nur den geringsten Gedanken über meine Unterkunft machen würde, war beinahe komisch, aber ich äußerte mich nicht dazu. »Es ist ja euer Anwesen«, fügte Ruensa hinzu. »Und selbst wenn es nicht so wäre, würden wir dich auf keinen Fall im Hotel wohnen lassen.«
»Das ist sehr nett.« Das hörte sich ganz so an, als wisse sie Bescheid über die Nießbrauchregelung, was mich enorm erleichterte. Ich musste Ruensa also nicht selbst damit konfrontieren. Auch wenn Jess etwas anderes zu glauben schien, kam ich nämlich gar nicht gut mit Konflikten zurecht. Vielleicht ein klein bisschen besser als sie, weil ich mehr Gespür für die Gefühle anderer hatte.
Dann fügte ich hinzu: »Und, Ruensa … das hatte ich längst gesagt haben wollen: mein herzliches Beileid.«
Ein kurzes Schweigen entstand. »Er fehlt mir schrecklich«, sagte sie schließlich. »Ich weiß, dass er nicht so ein guter Vater war, und er hatte deshalb auch furchtbare Schuldgefühle. Ich habe immer wieder versucht, ihn zu ermutigen, dass er euch hierher einlädt. Und ich glaube, es war nur seine Scham, die ihn davon abgehalten hat. Diese Versäumnisse bereue er am meisten, hat er oft gesagt. Und dass er früher so viel getrunken hat. Deshalb weiß ich auch, wie viel es ihm bedeuten würde, dass du bei uns wohnst.«
Ich zog erstaunt die Augenbrauen hoch. Wenn mein Vater sich nicht auf wundersame Weise in einen vollkommen anderen Menschen verwandelt hatte, waren diese Verhaltensweisen höchst unwahrscheinlich für ihn. »Wenn das so ist, komme ich natürlich sehr gerne. Aber nur für ein paar Tage. Ich muss in Palma einige Dokumente unterzeichnen und fliege dann gleich wieder nach London zurück.«
»Dann sollten wir so viel Zeit wie möglich zusammen verbringen«, sagte Ruensa entschieden. »Und wir können die Asche deines Vaters gemeinsam verstreuen … ich dachte mir, vielleicht am Torre del Verger, den Ort hat dein Vater sehr geliebt. Es wäre schön, wenn jemand aus der Verwandtschaft dabei ist.« Sie hielt inne. »Ehrlich gesagt … ich versuche mich so gut es geht abzulenken. Du wirst es also aushalten müssen, dass ich dich umsorge.«
Wir machten noch ein bisschen Small Talk, verabschiedeten uns dann. Ich dachte über das Wort »Verwandtschaft« nach. Erwartete Ruensa womöglich weiteren Kontakt, nachdem mit dem Anwesen alles geregelt war? Darauf legte ich keinerlei Wert. Abgesehen von Rachel, einer entfernten Cousine, die zurückgezogen in Cornwall lebte, und Jess’ eigener Familie hatten wir keine Verwandtschaft, und das war uns beiden auch sehr recht so.
Aber Hauptsache, mit der Finca war bereits alles geklärt. Jetzt musste nur noch eine Absprache getroffen werden, wie lange Ruensa noch bleiben konnte. Da ich großzügig sein wollte, dachte ich mir, bis alle rechtlichen Schritte geregelt waren und das Haus zum Verkauf stand – aber vielleicht konnte sich Tomàs auch darum kümmern.
Eine Bemerkung ging mir noch durch den Kopf. Ruensa hatte gesagt: würden wir dich auf keinen Fall im Hotel wohnen lassen. Mit »wir« hatte sie bestimmt sich und meinen Vater gemeint, wie das nach Partnerverlust oft passierte; man hatte sich noch nicht daran gewöhnt, allein zu sein.
Ich holte mir einen Kaffee, der scheußlich schmeckte. Zwanzig Minuten später wurde mein Flug aufgerufen, und ich stellte mich gerade in der Schlange an, als ich noch einen Anruf mit einer spanischen Vorwahl bekam.
»Spreche ich mit Mr Hensen?«, hörte ich eine Männerstimme, als ich mich meldete.
»Ja.«
»Mr Hensen, ich bin Subinspector Parera von der Policía Nacional in Palma. Mein Beileid zum Verlust Ihres Vaters.«
»Danke«, sagte ich, während ich beunruhigt überlegte, weshalb ich von der Polizei angerufen wurde.
»Mr Hensen, wir müssen abklären, ob im Falle des Ablebens Ihres Vaters eine offizielle Untersuchung notwendig ist. Deshalb muss ich Ihnen einige Fragen –«
»Was meinen Sie mit ›offizielle Untersuchung‹?«, fragte ich überrascht.
»Wenn jemand unter vermeidbaren Umständen zu Tode gekommen ist, wird immer die Polizei eingeschaltet«, erklärte Parera. »Gegenwärtig sammeln wir noch die notwendigen Informationen. Haben Sie zehn Minuten für mich?«
Ich schaute auf die Schlange vor mir, die sich langsam Richtung Boarding-Schalter bewegte. »Im Moment eher ungünstig, ich steige gleich in mein Flugzeug.«
Ein kurzes Schweigen entstand. »Darf ich fragen, wohin Sie fliegen?«
»Nach Mallorca.«
»Einen Moment bitte.« Ich hörte gedämpftes Murmeln, als er die Hand auf den Hörer legte, um mit jemandem zu sprechen. Dann sagte er: »Könnten Sie dann vielleicht persönlich vorbeikommen? Montag um elf Uhr, würde das passen? Das Revier befindet sich in Palma an der Carrer de Simó Ballester.«
»Das wäre möglich, ja.«
»Gut. Bis dahin.«
Vermeidbare Umstände. Ich hatte keine Ahnung, was das bedeuten sollte, würde mich aber bis Montag gedulden müssen, um es zu erfahren. Jess hatte einen Defibrillator erwähnt und dass der Alte Dreckskerl kollabiert sei, weshalb ich von einem Herzinfarkt ausgegangen war. Vielleicht meinte der Subinspector mit »vermeidbar« besoffen? Ruensa hatte sich angehört, als hätte mein Vater weniger getrunken – oder es zumindest versucht. Aber bei seinem Alkoholkonsum wäre er auf jeden Fall von einem hohen Niveau gestartet. In unserer Kindheit war der Haufen leerer Flaschen hinter dem Haus so hoch, dass wir ihn »Puig Veterano« nannten, Veterano-Berg, nach dem einheimischen Brandy.
Ich schrieb schnell an Jess:
Mit Ruensa geredet. Ich wohne auf der Finca! Und die Polizei will mit mir über Todesumstände vom AD sprechen.
Zuerst kam keine Antwort. Dann, als wir auf die Startbahn rollten und ich gerade mein Handy ausschalten wollte, trafen in kurzer Folge zwei Nachrichten ein:
Finca: gut!
Polizei: Ha! Vielleicht hat die neue Frau ihn umgebracht?
3
Reine Luftlinie ist Cauzacs nur etwa vierzig Kilometer vom Flughafen in Palma entfernt, aber dazwischen befindet sich die Serra de Tramuntana, ein Gebirgszug, der sich entlang der Nordküste von Mallorca erstreckt wie ein tausend Meter hoher Wall. Man muss den Puig de Galatzó umrunden, den höchsten Punkt im Westen der Insel, und zwar auf einer extrem schmalen Küstenstraße, die jede Menge atemberaubende Ansichten für Instagram-Fotos bietet, aber mit ihren Haarnadelkurven und steilen Abgründen nichts für schwache Nerven ist.
Ich hatte mir einen kleinen Renault Captur gemietet, der zwar Allradantrieb hatte, sich aber wie ein Spielzeugauto anfühlte, als ich vorsichtig damit durch die Serpentinen fuhr. Beschleunigen … bremsen … schalten … wieder beschleunigen … Ab und zu sah ich Gänsegeier über den hoch aufragenden Kalksteinfelsen schweben; manchmal musste ich wegen entgegenkommender Busse oder Lastwagen an den Rand fahren oder hinter Radfahrern herschleichen, die mich mit ihren stromlinienförmigen Helmen an Ameisen erinnerten. Ansonsten gab es in diesem nördlichen Teil der Insel wenig Anzeichen von Leben, bis auf hie und da ein Fischerboot auf dem Meer. Vieles wies dagegen auf Tod und Sterben hin: Die Pinienwälder waren in den letzten Jahren durch Waldbrände verwüstet worden, am Straßenrand ragten kohlschwarze verstümmelte Bäume auf wie Grabsteine.
Cauzacs konnte ich bereits sehen, bevor ich dort eintraf – ein paar Häuser, die sich an einen Berghang zu klammern schienen. Ober- und unterhalb des Dorfes hatte man Terrassen für Gemüseanbau angelegt, sodass der untere Teil des Bergs geschichtet war wie eine Hochzeitstorte. Es gab hier eine Tradition, der zufolge jeder Sohn eine weitere Terrasse auf dem Land seines Vaters anlegen sollte. Was jedoch bei der Finca Síquia schon seit Generationen vernachlässigt worden war. Die Terrassen waren verwahrlost, und nicht nur bei unserem Anwesen – vielerorts waren die Schichten der Hochzeitstorte zu Geröllhalden geworden. Seit meinem letzten Besuch hier hatten sich solche wüsten Stellen ebenso vermehrt wie die verbrannten Waldgebiete, was die Berglandschaft trostlos und morbide wirken ließ.
Doch im Dorf schien sich wenig verändert zu haben. Noch immer die Handvoll kleiner Hotels, die dann außerhalb der Saison nur als Cafés und Bars genutzt wurden. Dieselbe Bäckerei, die gleichen rot-weiß getigerten Katzen, die durch die menschenleeren Straßen streiften, die gleiche gedrungene Mallorca-Dogge, die bellend mein Auto verfolgte, als ich die Carrer de sa Síquia hinauffuhr.
Ich sah eine staubige Hufeisennatter, etwa einen Meter lang, die sich am linken Straßenrad entlangschlängelte; eine ungiftige Schlangenart, im Gegensatz zu den Kapuzennattern, denen wir auf der Finca häufig begegnet waren. Wenn wir früher eine entdeckt hatten, bestand Jess darauf, dass ich das Tier erledigte, weil sie Schlangen verabscheute. Und unsere Eltern waren wohl auch dafür, obwohl sie immer predigten, man solle im Einklang mit der Natur leben. Jetzt bemerkte ich amüsiert, dass die Schlange tatsächlich schneller war als ich, weil der kleine Wagen sogar im zweiten Gang Mühe hatte, die extreme Steigung zu bewältigen.
Gäste hatten oft bezweifelt, dass sie das Anwesen überhaupt mit dem Auto erreichen konnten. Immer wieder hatte zimperliche Hippies auf halber Strecke beinahe der Mut verlassen. Gleich außerhalb des Dorfes führte diese schmale unbefestigte Straße an einer Kreuzung in einen Pinienwald hinein. Auf den ersten Blick sah sie malerisch und gut befahrbar aus; erst nach einer Weile wurde man mit den absurd engen Kurven, der bedrohlichen Steigung und dem steinigen Boden konfrontiert. Doch da ich mich mit dem Terrain auskannte, geriet der Renault zwar gelegentlich ins Rutschen, rollte aber nie rückwärts.
Und dann kam das Haus in Sicht.
An den Ort zurückzukehren, an dem man aufgewachsen ist, fühlt sich immer wie eine Zeitschleife an, und ich spürte auf Anhieb jede Menge widersprüchliche Gefühle – Vertrautheit, Abscheu, Heimweh und Wehmut. Vor allem aber eine Art Trauer über all das unnötige Unheil, das hier angerichtet worden war.
Erstaunt stellte ich fest, dass das Dach repariert war, und erinnerte mich wieder an Jess’ Worte: Wer weiß, vielleicht ist das Anwesen gar nicht mehr so verwahrlost wie früher. Bei meinem letzten Besuch hier hätte ich keinen Pfifferling mehr für die Finca gegeben. Aber vielleicht hatte die dritte Ehe meines Vaters tatsächlich bewirkt, dass er hier für Ordnung gesorgt hatte.
Ich hielt an der Gebäudeseite, stieg aus und steuerte über die Veranda auf die Tür zu, durch die wir immer das Haus betreten hatten. Und wenn mich schon das reparierte Dach überrascht hatte, kam ich jetzt aus dem Staunen gar nicht mehr heraus. Der Ausblick auf die hellgrauen in der Sonne glimmenden zerklüfteten Berggipfel, die sich nach Osten und Westen erstreckten, war immer schon fantastisch gewesen – aber mehr eben auch nicht. Die Plantage der Finca war damals in meiner Kindheit völlig verwildert gewesen, ein Dickicht, das fast bis zum Haus reichte. Als Kind stellte ich mir immer vor, dass die betagten Olivenbäume, knorrig und stämmig von jahrzehntelangem Beschneiden, alte Frauen seien, durch Magie für immer erstarrt. Wenn die Olivenfruchtfliegen ihre Eier in die ungeernteten Oliven legten, kam es mir vor, als schwirrten sie um das zerzauste wirre Haar der Greisinnen herum.
Aber seit meinem letzten Aufenthalt hier hatte sich das Gelände vollkommen verändert. Das Gestrüpp aus Pampasgras und Oleander war verschwunden, die Oliven waren abgeerntet, die Bäume gut gepflegt. Wo früher Unkraut gewuchert hatte, sah ich jetzt frisch geharkte Erde. Auch die Orangen waren allesamt gepflückt worden, bis auf die spät reifenden Navelorangen, die dick und rund an den Ästen hingen. Die Avocadobäume waren schwer von Früchten, die Feigen säuberlich beschnitten, die Kakteen entfernt. Und neben dem Haus leuchteten gelb die Zitronen am Baum, glänzend und gesund und nicht faulig und überreif, wie ich sie in Erinnerung hatte.
In der Ferne sah ich einen kleinen Traktor, der rückwärts auf einen Mandelbaum zufuhr, am Steuer eine Gestalt in einem blauen Overall. Der Alte Dreckskerl hatte also wahrhaftig jemanden für die Plantage angestellt.
Und das waren noch lange nicht alle Überraschungen, die mich erwarteten. In der Zeit, als mein Vater noch malte, hatte er das kleine Steinhaus, in dem früher die Olivenpresse stand, als Atelier genutzt. Nicht weit entfernt davon befand sich direkt am Rande des steilen Abhangs eine cisterna, ein alter Bewässerungstank. An besonders heißen Tagen tauchten wir Kinder Arme und Beine in das dunkle kühle Wasser, obwohl es darin vor warzigen Kröten wimmelte. Inzwischen war aus der einstigen Zisterne ein Infinity-Swimmingpool geworden. Der Boden leuchtete azurblau, das glasklare Wasser glitzerte in der Sonne.
Nicht nur, dass es meinem Vater gar nicht ähnlich sah, einen Swimmingpool anzulegen – er hatte sich immer verächtlich darüber ereifert, dass so etwas ein Symbol für Mallorcas Abstieg vom authentischen Künstlerrefugium zum Massentourismusziel sei: Schau dir diese Idioten an. Wozu braucht man einen Scheißpool, wenn man das Meer hat? Sondern auch die Kosten … diese Neuerungen mussten Zehntausende Euro gekostet haben. Woher hatte er so viel Geld?
Oh, nein. Ich stöhnte innerlich, als mir der Gedanke kam, dass er womöglich Geld geheiratet, mit seinem Charme eine reiche Witwe bezirzt hatte, um wie die Made im Speck zu leben.
Doch dann fiel mir ein, dass Jess gesagt hatte, Ruensa sei seine Haushaltshilfe gewesen. Warum sollte sie putzen, wenn sie reich war?
Nun, das würde ich wohl in Kürze erfahren. »Hallo?«, rief ich durch die offene Tür. »Hola?«
Stille.
Ich trat ins Haus. Auch hier war alles verändert. Linker Hand in der hohen Küche waren die alten Hackblöcke gesäubert und aufgehellt worden, die Dielen ausgebessert und abgeschliffen. Die Wände – früher bedeckt mit den schrecklichen erotischen Fresken meines Vaters – leuchteten himmelblau, die Decke war ockergelb gestrichen worden – eigentlich eine schräge Farbkombination, die aber angenehm wirkte. Von dem Deckenbalken, der sich durch den ganzen Raum zog, hingen Schnüre mit getrockneten Ramallet-Tomaten, der wichtigsten Zutat von Pa amb oli. Der Gesamteindruck ließ mich an teure Wohnzeitschriften denken – ein mediterranes Traumhaus zum Verkriechen vor der Welt.
»Finn?«, hörte ich jemanden hinter mir sagen.
Ich drehte mich um. Sie war die Treppe heruntergekommen, stand jetzt im Flur und lächelte mich erwartungsvoll an – eine zierliche dunkelhaarige Frau Anfang fünfzig. Ich hatte mir bereits überlegt, wie ich sie begrüßen sollte, und mich für Händeschütteln entschieden, vielleicht mit angedeuteten Wangenküssen. Aber Ruensa umarmte mich herzlich. Erst als sie mich wieder losließ, konnte ich sie genauer ansehen.
»Du musst Ruensa sein …«, begann ich.
»Bitte nenn mich Ru«, unterbrach sie mich. »Du siehst deinem Vater so ähnlich!«
Das überraschte mich, mir waren noch nie Ähnlichkeiten aufgefallen. »Tut mir sehr leid, dass wir uns erst unter solchen Umständen kennenlernen.«
Sie winkte mit einer schnellen, fast schroffen Handbewegung ab, wollte darüber eindeutig nicht sprechen. »Du bist hier, das ist die Hauptsache. Willkommen zurück in der Finca Síquia!«
»Die kaum wiederzuerkennen ist …«
Sie lächelte stolz. »Gefällt es dir?«
»Alles sieht unglaublich toll aus.«
Sie sah sich um. »Die Farben hat natürlich Jimmy ausgesucht. Er hatte das absolute Auge dafür. Ich habe ihn dazu veranlasst zu entrümpeln. Als ich herkam, war das Anwesen eine Müllhalde! Aber wir haben es geschafft, das zu ändern.«
Ruensa strahlte Energie aus, sprach lebhaft, begleitet von temperamentvollem Nicken und Lächeln. Ihre Gesten waren kraftvoll; als sie auf die Wände zeigte, wirbelte sie herum wie eine Ballerina, und als sie sich mir wieder zuwandte, machte sie so große Augen, als wolle sie mich in ein wundervolles Geheimnis einweihen.
»Es ist sehr nett, dass du mich beherbergst«, sagte ich. »Ich hätte wirklich in ein Hotel gehen können.«
Sie rümpfte die Nase und winkte ab. »Ich habe dich in der caseta untergebracht, dem Gästehaus. Ist dir das recht?«
»In der caseta? Wo früher die Olivenpresse stand?«
Sie lächelte angesichts meines Erstaunens. »Ja, aber da sieht es jetzt ganz anders aus. Komm.«
Am einstigen Atelier meines Vaters angekommen schob Ruensa die Tür auf. Dank des Tors an der gegenüberliegenden Seite war der Raum immer hell gewesen, doch zuletzt hatten nur rostiges Gartengerät und halb fertige Leinwände dort herumgestanden. Das einstige Tor war inzwischen durch ein bodentiefes Fens