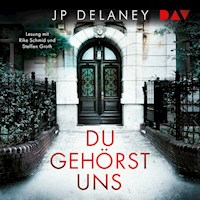8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
»Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich nicht allein bin. Manchmal glaube ich, dass dieses Haus mich beobachtet. Etwas muss hier geschehen sein. Etwas Schreckliches.«
Nach einem Schicksalsschlag braucht Jane dringend einen Neuanfang. Daher überlegt sie nicht lange, als sie die Möglichkeit bekommt, in ein hochmodernes Haus in einem schicken Londoner Viertel einzuziehen. Sie kann ihr Glück kaum fassen, als sie dann auch noch den charismatischen Besitzer und Architekten des Hauses kennenlernt. Er scheint sich zu ihr hingezogen zu fühlen. Doch bald erfährt Jane, dass ihre Vormieterin im Haus verstarb – und ihr erschreckend ähnlich sah. Als sie versucht, der Wahrheit auf den Grund zu gehen, erlebt sie unwissentlich das Gleiche wie die Frau vor ihr: Sie lebt und liebt wie sie. Sie vertraut den gleichen Menschen. Und sie nähert sich der gleichen Gefahr.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 453
Ähnliche
Das Buch
Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich nicht allein bin. Manchmal glaube ich, dass dieses Haus mich beobachtet. Etwas muss hier geschehen sein. Etwas Schreckliches.
Nach einem Schicksalsschlag braucht Jane dringend einen Neuanfang. Daher überlegt sie nicht lange, als sie die Möglichkeit bekommt, in ein hochmodernes Haus in einem schicken Londoner Viertel einzuziehen. Sie kann ihr Glück kaum fassen, als sie dann auch noch den charismatischen Besitzer und Architekten des Hauses kennenlernt. Er scheint sich zu ihr hingezogen zu fühlen. Doch bald erfährt Jane, dass ihre Vormieterin im Haus verstarb – und ihr erschreckend ähnlich sah. Als sie versucht, der Wahrheit auf den Grund zu gehen, erlebt sie unwissentlich das Gleiche wie die Frau vor ihr: Sie lebt und liebt wie sie. Sie vertraut den gleichen Menschen. Und sie nähert sich der gleichen Gefahr.
Der Autor
THE GIRL BEFORE ist der erste Psychothriller JP Delaneys. Zuvor veröffentlichte Delaney unter anderen Namen bereits einige Romane, die die Bestsellerliste eroberten. THE GIRL BEFORE erscheint im Januar 2017 in den USA und England und insgesamt in 35 Ländern. Die Verfilmung durch den bekannten Hollywood-Regisseur und Oscar-Preisträger Ron Howard ist bereits in Planung.
Besuchen Sie uns auf www.penguin-verlag.de und Facebook.
JP DELANEY
THE GIRL
SIE WAR WIE DU. UND JETZT IST SIE TOT.
BEFORE
THRILLER
Aus dem Englischen von Karin Dufner
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2017 unter dem Titel
»The Girl Before« bei Ballantine Books, New York.
PENGUIN und das Penguin Logo sind Markenzeichen
von Penguin Books Limited und werden
hier unter Lizenz benutzt.
Copyright © 2017 by JP Delaney
The translation is published by arrangement with Ballantine Books, an imprint of Random House, a division of Penguin Random House LLC.
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2017 by Penguin Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Die Zitate auf S. 25 und S. 283 stammen aus: Truman Capote, Breakfast at Tiffany’s, Penguin Classics. Das Zitat auf S. 270 stammt aus: Hilaire Belloc, Cautionary Tales for Children, Duckworth.
Umschlaggestaltung: Hafen Werbeagentur, Hamburg, nach einem Entwurf von Carlos Beltrán
Umschlagmotiv: © GG Archard / Gallery Stock
Redaktion: Susann Rehlein ES Herstellung: MO
Umsetzung eBook: Greiner & Reichel, Köln
ISBN 978-3-641-20939-1 V005
www.penguinverlag.de
[Wir] dürfen […] sagen, der Analysierte erinnere überhaupt nichts von dem Vergessenen und Verdrängten, sondern er agiere es. Er reproduziert es nicht als Erinnerung, sondern als Tat, er wiederholt es, ohne natürlich zu wissen, dass er es wiederholt.
– Sigmund Freud,Erinnern, Wiederholen und Durcharbeiten
1. Liste alle Dinge auf, die in deinem Leben unverzichtbar sind.
Damals: Emma
Es sei eine reizende kleine Wohnung, verkündet der Makler in einem Tonfall, der beinahe als echte Begeisterung durchgehen könnte. Zentral gelegen. Und da sei auch noch das zur Wohnung gehörige Stückchen Dach. Man könne es in einen Dachgarten verwandeln, das Einverständnis des Vermieters natürlich vorausgesetzt.
Nett, stimmt Simon zu, wobei er meinem Blick ausweicht. Ich wusste, dass die Wohnung nichts taugt, sobald ich sie betreten und das zwei Meter lange Stück Dach unter einem der Fenster gesehen hatte. Sie weiß es auch, möchte es aber dem Makler noch nicht sagen, zumindest nicht sofort, um nicht unhöflich zu wirken. Vielleicht hofft er sogar, dass ich beim Gequatsche des Mannes schwach werde. Der Makler ist Simon sympathisch: dynamisch und engagiert. Vermutlich liest er die Zeitschriften, für die Simon arbeitet. Die beiden haben schon über Sportereignisse gefachsimpelt, noch ehe wir die Treppe hinauf waren.
Und hier hätten wir ein recht geräumiges Schlafzimmer, sagt der Makler. Mit ausreichend …
Das bringt nichts, unterbreche ich das Theater. Die Wohnung ist nicht die richtige für uns.
Der Makler zieht die Augenbrauen hoch. Angesichts des momentanen Wohnungsmarkts darf man nicht zu wählerisch sein, sagt er. Bis heute Abend ist sie vermietet. Fünf Besichtigungen heute, und dabei haben wir sie noch nicht einmal auf unserer Website.
Sie ist nicht sicher genug, entgegne ich knapp. Gehen wir?
Alle Fenster haben Schlösser, erwidert er. Es ist ein Sicherheitsschloss an der Tür. Natürlich könnten Sie auch eine Alarmanlage einbauen, falls Sicherheit Ihnen ein Anliegen ist. Ich denke, der Vermieter würde nichts dagegen haben.
Er ignoriert mich und wendet sich nur noch an Simon. Ihnen ein Anliegen ist. Genauso gut hätte er: Oh, Ihre Freundin dramatisiert wohl gern?, sagen können.
Ich warte draußen, sage ich und gehe schon mal vor.
Offenbar hat der Makler bemerkt, dass er ins Fettnäpfchen getreten ist, denn er fügt hinzu: Falls das Viertel das Problem ist, sollten Sie sich vielleicht weiter im Westen umschauen.
Haben wir bereits, antwortet Simon. Doch das übersteigt unser Budget. Wenn man von den Buden absieht, die die Größe einer Schuhschachtel haben.
Er versucht, sich nicht anmerken zu lassen, dass er genervt ist. Aber allein die Tatsache, dass er das für nötig hält, macht mich noch wütender.
Wir hätten da noch eine Zweizimmerwohnung in Queens Park, sagt der Makler. Ein bisschen heruntergekommen, aber …
Die haben wir schon besichtigt, erwidert Simon. Allerdings fanden wir, dass sie zu nah an dieser Sozialbausiedlung liegt. Sein Tonfall verrät, dass wir eigentlich sie heißen soll.
Oder da gäbe es noch eine im dritten Stock in Kilburn, die gerade auf den Markt …
Die kennen wir auch schon. Neben einem der Fenster befindet sich ein Fallrohr.
Der Makler blickt ihn verdattert an. Jemand könnte daran hinaufklettern, erklärt Simon.
Tja, die Saison hat ja gerade erst angefangen. Wenn Sie vielleicht noch ein wenig warten.
Offenbar ist der Makler zu dem Schluss gekommen, dass wir seine Zeit vergeuden. Auch er nähert sich unauffällig der Tür. Ich kann mich ja draußen auf den Treppenabsatz stellen, damit er mir nicht zu nahe kommt.
Wir haben unsere alte Wohnung bereits gekündigt, höre ich Simon sagen. Er senkt die Stimme. Schauen Sie, mein Lieber, bei uns wurde eingebrochen. Vor fünf Wochen. Zwei Männer sind bei uns eingedrungen und haben Emma mit einem Messer bedroht. Sie können sich vorstellen, dass sie ein bisschen nervös ist.
Oh, sagt der Makler. Wenn jemand so etwas mit meiner Freundin machen würde, keine Ahnung, was ich täte. Wissen Sie, die Chancen stehen vielleicht nicht sehr hoch, aber … Er beendet den Satz nicht.
Ja?, erwidert Simon.
Hat jemand im Büro die Folgate Street Nummer 1 erwähnt?
Ich glaube nicht. Ist da gerade etwas frei geworden?
Nein, nicht direkt.
Der Makler wirkt unsicher, ob er das Thema weiterverfolgen soll.
Aber sie ist zu vermieten?, beharrt Simon.
Im Grunde ja, erwidert der Makler. Und es ist ein fantastisches Haus. Absolut fantastisch. Ein himmelweiter Unterschied zu diesem hier. Nur, dass der Vermieter … ihn als eigen zu bezeichnen, wäre noch milde ausgedrückt.
Welches Viertel?, erkundigt sich Simon.
Hampstead, antwortet der Makler. Nun, eher Hendon. Doch es ist eine sehr ruhige Gegend.
Em?, ruft Simon.
Ich gehe wieder hinein. Wir könnten sie doch mal anschauen, sage ich. Wir sind ja schon auf halbem Wege.
Der Makler nickt. Ich fahre rasch ins Büro, sagt er, und suche die Unterlagen heraus. Offen gestanden habe ich sie schon lange niemandem mehr gezeigt. Die Wohnung passt nicht unbedingt zu jedem. Aber ich glaube, für Sie könnte sie genau das Richtige sein. Verzeihung, ich wollte nichts Falsches gesagt haben.
Heute: Jane
»Das ist die letzte.« Die Maklerin, die Camilla heißt, klopft mit den Fingern auf das Lenkrad ihres Smart. »Also wäre es wirklich an der Zeit, dass Sie sich entscheiden.«
Ich seufze auf. Die Wohnung, die wir gerade besichtigt haben, befindet sich in einem heruntergekommenen Wohnblock in der West End Lane und ist die einzige, die ich mir leisten kann. Ich hatte mir schon fast eingeredet, dass sie in Ordnung ist. Die sich wellende Tapete habe ich ebenso ignoriert wie die Küchendünste aus der Wohnung darunter, das winzige Schlafzimmer und den Schimmel im nicht zu belüftenden Bad – bis ich hörte, dass es ganz in der Nähe läutete, eine altmodische Handglocke. Im nächsten Moment hallte Kinderlärm durch die Wohnung. Als ich ans Fenster trat, stellte ich fest, dass ich auf eine Schule hinunterschaute. Ich hatte Blick in einen Raum, der offenbar von einer Kindergartengruppe genutzt wurde. Die Fenster waren mit ausgeschnittenen Häschen und Gänsen dekoriert. Ein Schmerz durchfuhr mich.
»Ich glaube, die ist nicht das Richtige«, brachte ich gerade noch heraus.
»Wirklich?« Camilla wirkte überrascht. »Liegt es an der Schule? Die Vormieter meinten, ihnen habe es gefallen, spielende Kinder zu hören.«
»Allerdings nicht so gut, dass sie geblieben wären.« Ich drehe mich um. »Gehen wir?«
Auf der Rückfahrt in ihr Büro legt Camilla eine lange taktische Pause ein. »Da Ihnen nichts, was wir heute besichtigt haben, zugesagt hat, sollten wir uns vielleicht überlegen, Ihr Budget zu erhöhen«, sagt sie schließlich.
»Leider gibt es an meinem Budget nichts zu rütteln«, entgegne ich trocken und schaue aus dem Fenster.
»Dann müssen Sie möglicherweise weniger wählerisch sein«, erwidert sie spitz.
»Wegen der letzten Wohnung. Es gibt … persönliche Gründe, aus denen ich nicht neben einer Schule wohnen kann. Noch nicht.«
Ihr Blick geht zu meinem nach der Schwangerschaft noch ein wenig schlaffen Bauch, und ihre Augen weiten sich, als bei ihr der Groschen fällt. »Oh«, sagt sie. Camilla ist doch nicht so dumm, wie sie aussieht, wofür ich sehr dankbar bin. Ich brauche es nicht auszusprechen.
Und außerdem ist sie offenbar zu einer Entscheidung gelangt.
»Wissen Sie, da gäbe es noch eine Wohnung. Eigentlich dürfen wir sie ohne ausdrückliche Erlaubnis des Eigentümers nicht zeigen, aber hin und wieder tun wir es doch. Manche Leute sind erschrocken, ich persönlich finde, das Haus ist ein Traum.«
»Ein Traumhaus bei meinem Budget? Wir sprechen hier doch nicht etwa von einem Hausboot, oder?«
»Nein, ganz im Gegenteil. Ein modernes Gebäude in Hendon. Ein ganzes Haus – nur ein Schlafzimmer, allerdings jede Menge Platz. Der Eigentümer ist Architekt. Genau genommen ist er sogar sehr berühmt. Kaufen Sie manchmal bei Wanderer?«
»Wanderer …« In meinem früheren Leben, als ich noch Geld und einen ordentlichen, gut bezahlten Job hatte, habe ich ab und zu im Wanderer-Shop in der Bond Street vorbeigeschaut, einem beängstigend minimalistisch eingerichteten Laden, in dem einige wenige astronomisch teure Kleider auf Steinplatten ausgelegt waren wie Jungfrauen zur Opferung. Die Verkäuferinnen trugen alle schwarze Kimonos. »Hin und wieder. Warum?«
»Monkford gestaltet alle ihre Filialen aus. Er ist ein Techno-Minimalist, oder so ähnlich. Jede Menge versteckte Technik, aber sonst absolut roh.« Sie wirft mir einen Blick zu. »Ich sollte Sie warnen, einige Leute finden seinen Stil ein wenig … karg.«
»Damit kann ich leben.«
»Und …«
»Ja?«, hake ich nach, als sie nicht fortfährt.
»Es handelt sich um kein gewöhnliches Vermieter-Mieter-Verhältnis«, fügt sie zögernd hinzu.
»Und das heißt?«
»Ich denke«, erwidert sie, blinkt und wechselt auf die linke Fahrspur, »dass wir uns die Wohnung erst ansehen sollten, um festzustellen, ob Sie sich in sie verlieben. Danach erkläre ich Ihnen, wo der Haken ist.«
Damals: Emma
Okay, das Haus ist wirklich ungewöhnlich. Umwerfend, atemberaubend, unglaublich. Es ist nicht in Worte zu fassen.
Von der Straße aus war nichts davon zu ahnen. Zwei Reihen großer Durchschnittshäuser, die vertraute Kombination aus viktorianischem rotem Backstein und Panoramafenstern, wie man sie überall in North London sieht, erstreckten sich den Hügel hinauf in Richtung Cricklewood wie ein Scherenschnitt, jedes identisch mit seinem Nachbarn. Nur die Eingangstüren und die kleinen bunten Fenster darüber unterschieden sich.
An der Straßenecke befand sich ein Zaun. Dahinter konnte ich ein niedriges, kleines Gebäude erkennen, einen kompakten Würfel aus hellem Stein. Einige horizontal verlaufende, scheinbar willkürlich verteilte Glasschlitze waren der einzige Hinweis darauf, dass es sich tatsächlich um ein Haus handelte und nicht um einen überdimensionalen Briefbeschwerer.
Wow, sagt Simon zweifelnd. Ist es das wirklich?
In der Tat, erwidert der Makler gut gelaunt. Folgate Street Nummer 1.
Er führt uns zur Seite des Anwesens, wo eine Tür exakt abschließend in die Mauer eingelassen ist. Es scheint keine Klingel zu geben – ich bemerke auch weder einen Türknauf noch einen Briefkasten oder ein Namensschild. Keinerlei Hinweis darauf, dass hier jemand lebt.
Wer wohnt derzeit hier?, erkundige ich mich.
Momentan niemand. Er macht Platz, damit wir eintreten können.
Und warum war nicht abgeschlossen?, frage ich und weiche ängstlich zurück.
Der Makler grinst selbstzufrieden. War es, erwidert er. Auf meinen Smartphone befindet sich ein digitaler Schlüssel. Eine App kontrolliert alles. Ich muss nur von unbewohnt auf bewohnt umschalten. Dann funktioniert die Sache automatisch. Die Sensoren im Haus empfangen den Code und lassen mich rein. Wenn ich ein digitales Armband tragen würde, bräuchte ich nicht einmal das Telefon.
Sie wollen mich wohl auf den Arm nehmen, sagt Simon ehrfürchtig und starrt auf die Tür. Angesichts seiner Reaktion würde ich am liebsten laut loslachen. Für Simon, den Computerfreak, ist ein Haus, das man per Telefon steuern kann, etwa so wie Ostern und Weihnachten auf einmal.
Ich trete in eine winzige Vorhalle, die kaum größer ist als ein Wandschrank. Da sie zu klein ist, um gemütlich dort herumzustehen, nachdem der Makler mir gefolgt ist, gehe ich einfach unaufgefordert weiter.
Nun bin ich es, die »wow« ausruft. Es ist wirklich beeindruckend. Riesige Fenster, die Blick auf einen kleinen Garten und eine hohe Steinmauer bieten, sorgen dafür, dass der Raum lichtdurchflutet ist. Er ist zwar nicht groß, wirkt aber so. Wände und Fußböden bestehen aus dem gleichen hellen Stein. Rillen unten an den Wänden lassen einen glauben, dass sie schweben. Und alles ist leer. Nicht unmöbliert – in einem Nebenzimmer bemerke ich einen Steintisch, einige nach Designer aussehende, ziemlich coole Stühle und ein langes, tiefes, mit einem dicken cremefarbenen Stoff bezogenes Sofa. Doch sonst gibt es keine Blickfänger. Keine Türen, keine Schränke, keine Bilder, keine Fensterrahmen, keine für mich erkennbaren Steckdosen, keine Lampenaufhängungen und – ich schaue mich verdattert um – nicht einmal Lichtschalter. Und obwohl sich das Haus weder verlassen noch unbewohnt anfühlt, liegt absolut nichts herum.
Wow, wiederhole ich. Meine Stimme klingt eigenartig gedämpft. Mir wird klar, dass ich nichts von draußen von der Straße höre. Der ständige Londoner Geräuschpegel, Straßenverkehr, Gerüstbauarbeiten oder Autoalarmanlagen, ist verschwunden.
Das sagen die meisten Leute, stimmt der Makler zu. Entschuldigen Sie, ich will nicht lästig sein, doch der Vermieter besteht darauf, dass wir die Schuhe ausziehen. Könnten Sie …
Er bückt sich, um sein eigenes auffälliges Schuhwerk aufzuschnüren. Wir folgen seinem Beispiel. Und dann, als hätte ihm die karge und kahle Leere des Hauses die Sprache verschlagen, läuft er einfach nur auf Socken hin und her. Offenbar ist er genauso verwirrt wie wir, während wir uns umschauen.
Heute: Jane
»Wunderschön«, sage ich. Von innen ist das Haus elegant und durchgestylt wie eine Galerie. »Einfach wunderschön.«
»Nicht wahr?«, stimmt Camilla mir zu. Sie reckt den Hals, um die kahlen Wände zu betrachten, die aus cremefarbenem Stein bestehen. Sie ragen hoch hinauf in die gewölbeartige Decke. Die obere Etage erreicht man über die verrückteste, minimalistischste Treppe, die mir je untergekommen ist. Sie wirkt wie in eine Klippe eingemeißelt: geschwungene Stufen aus ungeschliffenem Stein, ohne Geländer oder eine andere sichtbare Möglichkeit, sich festzuhalten. »Ganz gleich, wie oft ich auch herkomme, es verschlägt mir immer wieder die Sprache. Das letzte Mal war ich mit einer Gruppe von Architekturstudenten hier. Das ist übrigens eine der Bedingungen: Sie müssen das Haus alle sechs Monate Besuchern zugänglich machen. Doch die sind stets sehr gesittet. Es ist nicht so, als würden einem die Touristen Kaugummi auf den Teppich spucken.«
»Und wer wohnt jetzt hier?«
»Niemand. Es steht schon seit einem knappen Jahr leer.«
Ich spähe ins nächste Zimmer. Falls Zimmer der richtige Ausdruck für einen frei schwebenden Raum ohne Tür ist. Auf einem langen steinernen Tisch steht eine Vase mit Tulpen. Ihre blutroten Blüten bilden einen drastischen Kontrast zu all dem hellen Stein. »Und woher kommen dann die Blumen?« Ich gehe hinüber und berühre den Tisch. Kein Staub. »Und wer macht hier so gründlich sauber?«
»Jede Woche kommt eine Putzkraft von einer spezialisierten Reinigungsfirma. Das ist eine weitere Bedingung – Sie müssen sie weiterbeschäftigen. Die Firma kümmert sich auch um den Garten.«
Ich nähere mich dem bis zum Boden reichenden Fenster. Garten ist ein wenig übertrieben. Eigentlich ist es eher ein Hof, eine etwa sieben mal fünfzehn Meter große eingemauerte Fläche, gepflastert mit dem gleichen Stein wie der Boden, auf dem ich gerade stehe. Ein kleiner, länglicher Rasen, beängstigend exakt und so kurz geschoren wie auf einem Golfplatz, grenzt an die hintere Mauer an. Blumen gibt es keine. Alles Lebendige und sämtliche Farben fehlen. Kleine Kreise aus grauem Kies entdecke ich noch.
Als ich mich wieder in den Raum wende, denke ich, dass das ganze Haus einfach mehr Farbe und Wärme braucht. Ein paar Teppiche, ein wenig Menschlichkeit, dann wäre es wirklich wunderschön, so wie einer Wohnzeitschrift entstiegen. Zum ersten Mal werde ich von leichter Aufregung ergriffen. Habe ich endlich Glück gehabt?
»Tja, das hört sich recht vernünftig an«, sage ich. »War das alles?«
Camilla lächelt verhalten. »Wenn ich eine der Bedingungen sage, heißt das, eine der klarsten. Wissen Sie, was eine Nutzungsbeschränkung ist?«
Ich schüttle den Kopf.
»Das ist eine Rechtsvorschrift, die auf ewig für eine Immobilie gilt, etwas, das sich selbst beim Verkauf des Hauses nicht aufheben lässt. Normalerweise wird sie auf Nutzungsrechte angewendet – ob das Haus kommerziell genutzt werden darf und so weiter. Bei diesem Haus sind diese Bedingungen Teil des Mietvertrags, sie sind nicht verhandelbar und können auch nicht geändert werden. Es ist ein ausgesprochen strenger Vertrag.«
»Wovon genau reden wir?«
»Im Grunde genommen handelt es sich um eine Liste von Geboten und Verboten. Nun, zum Großteil sind es Verbote. Keine Veränderungen irgendwelcher Art, sofern nicht vorab genehmigt. Keine Teppiche. Keine Bilder. Keine Zimmerpflanzen. Keine Bücher …«
»Keine Bücher! Das ist doch lächerlich!«
»Keine Anpflanzungen im Garten. Keine Vorhänge …«
»Und wie kriegt man das Zimmer ohne Vorhänge dunkel?«
»Die Fenster sind lichtsensitiv. Sie verdunkeln sich, wenn es draußen dunkel wird.«
»Also keine Vorhänge. Sonst noch etwas?«
»Oh, ja«, erwidert Camilla, ohne auf meinen sarkastischen Ton zu achten. »Insgesamt gibt es etwa zweihundert Klauseln. Doch es ist die letzte, die die meisten Probleme verursacht.«
Damals: Emma
… keine Lampen außer denen, die schon da sind, sagt der Makler. Keine Wäscheleinen. Keine Papierkörbe. Rauchen verboten. Keine Glasuntersetzer oder Platzdeckchen. Keine Sofakissen, keine Deko-Objekte, keine Möbel zum Selbstzusammenbauen …
Das ist geisteskrank, empört sich Si. Was gibt ihm das Recht dazu?
Er hat tatsächlich mehrere Wochen damit verbracht, die IKEA-Möbel in unserer alten Wohnung zusammenzuschrauben, weshalb sie ihn mit demselben Stolz erfüllen, als hätte er sie eigenhändig aus frisch geschlagenen Bäumen geschnitzt.
Ich habe Ihnen ja gesagt, dass es ein schwieriges Objekt ist, sagt der Makler achselzuckend.
Ich blicke hinauf zur Decke. Apropos Lampen, sage ich. Wie schaltet man sie ein?
Das brauchen Sie nicht, erwidert der Makler. Das Haus verfügt über Ultraschallsensoren. Sie sind gekoppelt mit einem Modul, das die Lichtverhältnisse denen draußen anpasst. Es ist die gleiche Technologie, die dafür sorgt, dass sich nachts Ihre Autoscheinwerfer einschalten. Dann wählt man mit der App die gewünschte Stimmung aus. Produktiv, friedlich, verspielt und so weiter. Im Winter wird sogar zusätzliche UV-Strahlung beigegeben, damit Sie nicht depressiv werden. Wie bei einer Lichttherapie.
Ich merke Simon an, dass ihn all das begeistert. Offenbar ist das Recht des Architekten, IKEA-Möbel zu verbieten, plötzlich kein Thema mehr.
Natürlich gibt es eine Fußbodenheizung, fährt der Makler fort, der offenbar spürt, dass er ihn an der Angel hat. Sie bezieht die Wärme aus einer Wärmepumpe direkt unter dem Haus. Außerdem sind alle Fenster dreifach verglast – das Haus ist so effizient, dass es sogar Energie an die Stadtwerke abgibt. Sie werden niemals wieder eine Heizkostenrechnung bezahlen.
Das ist, als würde man Simon einen Porno vorlesen. Und die Sicherheit?, wende ich in scharfem Ton ein.
Alles im selben System, entgegnet der Makler. Sie können es zwar nicht sehen, doch in die Außenmauer ist eine Alarmanlage eingebaut. Alle Räume verfügen über Sensoren, dieselben, die auch die Lichter einschalten. Und das System ist klug. Es lernt, wer Sie sind und wie Ihr Tag normalerweise abläuft. Jede andere Person wird Ihnen gemeldet, um sicherzugehen, dass sie auch autorisiert ist.
Em?, ruft Simon. Du musst dir diese Küche anschauen. Er ist in den seitlich gelegenen Raum geschlendert, den mit dem Steintisch. Anfangs ist mir nicht klar, wie er ihn überhaupt als Küche erkannt hat. Längs der Wand verläuft eine Arbeitsfläche aus Stein. An einem Ende befindet sich etwas, was möglicherweise ein Wasserhahn sein könnte, ein schlankes Stahlrohr, das aus dem Stein ragt. Bei der flachen Mulde darunter könnte es sich um die Spüle handeln. Am anderen Ende gibt es eine Reihe von vier kleinen Löchern. Als der Agent mit der Hand darüber wedelt, schießt sofort eine heiße, zischende Flamme empor.
Ta-da, verkündet er. Der Herd. Der Architekt bevorzugt das Wort Refektorium anstelle von Küche. Er grinst, als wolle er zeigen, wie dämlich er das findet.
Als ich genauer hinschaue, entdecke ich schmale Rillen zwischen den Wandpaneelen. Ich drücke auf eines, und der Stein öffnet sich – nicht mit einem Klicken, sondern mit einem gemächlichen pneumatischen Seufzer. Dahinter liegt ein sehr kleiner Schrank.
Ich zeige Ihnen das Obergeschoss, sagt der Makler.
Die Treppe besteht aus einer Reihe von in die Wand eingelassenen, nicht abgesicherten Steinplatten. Natürlich zu gefährlich für Kinder, warnt er und marschiert voran. Passen Sie auf, wo Sie hintreten.
Lassen Sie mich raten, sagt Simon. Geländer und eine Treppenabsicherung stehen auch auf der Verbotsliste.
Und Haustiere, ergänzt der Makler.
Das Schlafzimmer ist genauso kahl wie der Rest des Hauses. Das Bett ist eingebaut, ein heller Steinquader mit einem aufgerollten Futon. Außerdem ist das Badezimmer nicht abgetrennt, sondern nur eine Nische, verborgen hinter einer weiteren Wand, sodass es nicht einsehbar ist. Doch während die Leere unten so steril wirkt wie in einem Krankenhaus, ist die Atmosphäre hier oben ruhig, ja, beinahe gemütlich.
Wie eine Luxus-Gefängniszelle, stellt Simon fest.
Ich sagte ja bereits, dass es nicht jedermanns Geschmack entspricht. Doch für die richtige Person …
Als Simon auf ein Stück Wand neben dem Bett drückt, schwingt ein weiteres Paneel auf. Dahinter befindet sich ein Kleiderschrank. Kaum genug Platz für ein Dutzend Garnituren.
Eine der Regeln lautet, dass niemals etwas auf dem Boden herumliegen darf, erläutert der Makler hilfsbereit. Alles muss sofort weggeräumt werden.
Simon verzieht das Gesicht. Woher soll das jemand wissen? Wie wird das überprüft?
Regelmäßige Kontrollen stehen ebenfalls im Mietvertrag. Außerdem muss die Reinigungskraft sofort die Hausverwaltung informieren, falls gegen eine der Regeln verstoßen wird.
Kommt nicht infrage, protestiert Simon. Das ist ja, als wäre man wieder im Internat. Ich werde nicht dulden, dass mich jemand ausschimpft, weil ich meine schmutzigen Hemden nicht aufhebe.
Ich bemerke etwas. Seit ich dieses Haus betreten habe, hatte ich keine einzige Panikattacke. Es ist so von der Außenwelt abgeschnitten, so abgeschirmt, dass ich mich absolut sicher fühle. Mir kommt eine Stelle aus meinem Lieblingsfilm in den Sinn. Die Stille und der stolze Eindruck. Hier kann dir nichts Schlechtes geschehen.
Natürlich ist das Haus ein Traum, fährt Simon fort. Wenn diese ganzen Regeln nicht wären, wären wir vermutlich interessiert. Aber wir sind ziemlich schlampig. Ems Seite des Schlafzimmers sieht aus, als wäre gerade eine Bombe hochgegangen.
Tja, wenn das so ist, erwidert der Makler mit einem Nicken und sieht mich an.
Mir gefällt es, platze ich heraus.
Wirklich? Simon klingt überrascht.
Es ist anders, aber … irgendwie ergibt es doch Sinn, oder? Wenn man etwas derartig Unglaubliches gebaut hat, kann ich verstehen, dass es auch ordentlich bewohnt werden soll, so, wie man es geplant hat. Weshalb hätte man sich die Mühe sonst machen sollen? Und es ist fantastisch. So etwas habe ich noch nie gesehen, nicht einmal in Zeitschriften. Wir könnten doch auch ordentlicher werden, oder? Wenn das der Preis dafür ist, in so etwas wohnen zu dürfen?
Na ja, okay, erwidert Simon zweifelnd.
Dir gefällt es doch auch?, hake ich nach.
Wenn es dir gefällt, liebe ich es, antwortet er.
Nein, sage ich. Magst du es wirklich? Es wäre eine große Veränderung. Ich würde nicht wollen, dass wir es tun, wenn du nicht einverstanden bist.
Der Makler beobachtet uns amüsiert und wartet ab, wie diese kleine Debatte ausgehen wird. Und es läuft wie immer bei uns. Ich habe eine Idee, Simon überlegt es sich, und irgendwann stimmt er dann zu.
Du hast recht, Em, sagt Simon zögernd. Etwas Besseres finden wir nicht. Und wenn wir einen Neuanfang wollen – das hier wäre eindeutig mehr Anfang, als bloß in eine normale Zweizimmerwohnung zu ziehen, oder?
Er wendet sich an den Makler. Wie also machen wir jetzt weiter?
Ah, erwidert der Makler. Jetzt wird es richtig spannend.
Heute: Jane
»Und die letzte Klausel lautet wie …?«
»Sie wären überrascht, wie viele Leute sich trotz all der Einschränkungen für das Haus interessieren. Doch die letzte Hürde ist, dass der Architekt ein Vetorecht hat. Letztlich ist er es, der dem Mieter zustimmen muss.«
»Meinen Sie, persönlich?«
Camilla nickt. »Falls es überhaupt so weit kommt. Es gibt ein ausführliches Bewerbungsformular. Und natürlich müssen Sie unterscheiben, dass Sie die Regeln gelesen und verstanden haben. Wenn das erfolgreich absolviert ist, werden Sie zu einem persönlichen Gespräch dorthin auf der Welt eingeladen, wo er sich gerade aufhält. In den letzten Jahren bedeutete das Japan – er baute einen Wolkenkratzer in Tokio. Gerade ist er in London. Doch normalerweise spart er sich die Mühe. Wir kriegen einfach eine E-Mail, in der steht, dass der Bewerber abgelehnt ist. Ohne Begründung.«
»Und wer findet Gnade vor seinen Augen?«
Sie zuckt die Achseln. »Selbst wir im Büro können kein Muster erkennen. Obwohl uns aufgefallen ist, dass Architekturstudenten es nie schaffen. Und es ist eindeutig nicht nötig, dass sie schon einmal in einem solchen Haus gewohnt haben. Ansonsten können wir nur mutmaßen.«
Ich schaue mich um. Wenn ich dieses Haus gebaut hätte, was für Bewohner würde ich mir dafür wünschen?, frage ich mich. Wonach würde ich die Bewerbung eines Mietinteressenten bewerten?
»Ehrlichkeit«, sage ich zögernd.
»Verzeihung?« Camilla mustert mich verdattert.
»Dieses Haus vermittelt mir nicht nur, dass es gut aussieht, sondern auch, wie viel Herzblut hineingeflossen ist. Das heißt, es lässt eindeutig keine Kompromisse zu und ist in mancherlei Hinsicht sogar ein wenig abweisend. Aber dieser Mensch hat alles, seine gesamte Leidenschaft, in etwas gesteckt, das hundertprozentig seinen Wünschen entsprechen sollte. Es verfügt über – gut, das ist ein hochtrabendes Wort – Integrität. Ich glaube, er sucht nach Menschen, die es genauso ehrlich bewohnen, wie er es geplant hat.«
Wieder zuckt Camilla die Achseln. »Sie könnten recht haben.« Ihr Tonfall deutet an, dass sie das bezweifelt. »Also wollen Sie sich darum bemühen?«
Im Grunde meines Herzens bin ich ein vorsichtiger Mensch. Ich fälle nur selten Entscheidungen, ohne sie gründlich zu überdenken, die verschiedenen Möglichkeiten gegeneinander abzuwägen und mich über die Vor- und Nachteile kundig zu machen. Also erschreckt es mich ein wenig, als ich mich »ja, unbedingt« sagen höre.
»Gut.« Camilla klingt ganz und gar nicht überrascht, aber wer würde auch nicht in einem solchen Haus wohnen wollen? »Kommen Sie mit ins Büro. Ich suche Ihnen die Bewerbungsformulare heraus.«
Damals: Emma
1. Liste alle Dinge auf, die in deinem Leben unverzichtbar sind.
Ich greife zum Stift und lege ihn wieder weg. Eine Liste aller Dinge, die ich behalten möchte, würde die ganze Nacht in Anspruch nehmen. Doch dann denke ich weiter nach. Das Wort unverzichtbar strahlt mir von der Seite entgegen. Was ist denn eigentlich unverzichtbar? Meine Kleider? Seit dem Einbruch lebe ich praktisch in zwei Paar Jeans und einem alten schlabberigen Pulli. Natürlich würde ich gern einige Kleider und Röcke mitnehmen; ein paar schicke Jacken, meine Schuhe und Stiefel, doch alles andere würde ich nicht vermissen. Unsere Fotos? Die sind alle online gespeichert. Die halbwegs wertvollen Schmuckstücke haben die Einbrecher mitgenommen. Unsere Möbel? Darunter befindet sich kein Stück, das in der Folgate Street 1 nicht geschmacklos und deplatziert wirken würde.
Mir dämmert, dass diese Frage bewusst so formuliert wurde. Indem man mir den Gedanken eingepflanzt hat, dass eigentlich gar nichts unverzichtbar ist, ertappe ich mich bei der Frage, ob ich nicht alle Sachen, den ganzen Kram, abstreifen könnte wie eine alte Haut.
Vielleicht zielen DIE REGELN, wie wir sie inzwischen nennen, ja genau darauf ab. Möglicherweise steckt nicht einfach nur dahinter, dass der Architekt ein Zwangsneurotiker ist, der befürchtet, wir könnten sein schönes Haus ruinieren. Es könnte ein Experiment sein. Ein Wohnexperiment.
Was mich und Si vermutlich zu Laborratten macht. Nur, dass mich das eigentlich nicht stört. Offen gestanden will ich verändern, wer ich bin – wer wir sind –, und ich weiß, dass ich das ohne Hilfe nicht schaffe.
Insbesondere, wer wir sind.
Si und ich sind seit der Hochzeit von Saul und Amanda vor vierzehn Monaten zusammen. Ich kenne die beiden aus dem Büro. Sie sind ein paar Jahre älter als ich, und außer ihnen kannte ich kaum jemanden auf der Feier. Simon war Sauls Trauzeuge, die Hochzeit war wunderschön und romantisch, und zwischen uns hat es sofort gefunkt. Aus Trinken und Reden wurde inniges Tanzen, und wir tauschten unsere Nummern aus. Wie sich später herausstellte, wohnten wir in derselben Pension und, na ja, eins führte zum anderen. Was habe ich getan?, dachte ich am nächsten Tag. Offensichtlich handelte es sich um einen weiteren spontanen One-Night-Stand, ich würde ihn nie wiedersehen und mich billig und benutzt fühlen. Doch das Gegenteil war der Fall. Si rief mich an, sobald er zu Hause war, und dann wieder am nächsten Tag. Und am Ende der Woche waren wir zum großen Erstaunen unserer Freunde ein Paar. Insbesondere zum Erstaunen seiner Freunde. Er arbeitet in einem absoluten Macho-Umfeld, in dem eine feste Freundin beinahe als Makel gilt. In den Zeitschriften, für die Si schreibt, werden Mädchen als »Puppen«, »scharfe Bräute« und »niedliche Schlampen« bezeichnet. Seite um Seite ist mit Unterwäschemodels gefüllt, obwohl es in den Artikeln zumeist um die neueste Computertechnologie geht. Falls der Bericht von, sagen wir mal, Mobiltelefonen handelt, hat ein Mädchen in Unterwäsche das Gerät in der Hand. Geht es um Laptops, trägt sie immer noch Unterwäsche, hat aber eine Brille auf der Nase und tippt etwas in die Tastatur. Würde der Artikel Unterwäsche behandeln, hätte sie vermutlich gar nichts mehr an, sondern würde die Dessous schwenken, als wären sie ihr gerade vom Leib gerutscht. Wenn die Zeitschrift eine Party gibt, erscheinen die Models etwa in der gleichen Bekleidung, in der sie auch im Blatt abgelichtet werden. Und dann werden die Fotos von dieser Party ebenfalls in der Zeitschrift gebracht. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Und Simon hat mir von Anfang an gesagt, dass es auch nicht sein Ding sei. Einer der Gründe, warum er mich möge, sei, dass ich so ganz anders sei als diese Mädchen, nämlich echt.
Wenn man sich auf einer Hochzeit kennenlernt, beschleunigt das die erste Phase einer Beziehung enorm. Wir gingen gerade ein paar Wochen miteinander, als Simon mich fragte, ob ich bei ihm einziehen wolle. Das erstaunte die Leute ebenfalls – normalerweise bedrängt die Frau ja den Mann, weil sie entweder heiraten oder das nächste Stadium einläuten möchte. Vielleicht liegt es daran, dass Simon ein wenig älter ist als ich. Er sagt immer, er habe gewusst, dass ich die Richtige sei, sobald er mich gesehen habe. Das hat mir gleich an ihm gefallen: Er wusste, was er wollte, und in diesem Fall wollte er mich. Allerdings bin ich nie auf den Gedanken gekommen, mich zu fragen, ob ich auch wollte und ob er mir ebenso viel bedeutete wie ich ihm. Und vor Kurzem, nach dem Einbruch und der Entscheidung, aus seiner alten Wohnung auszuziehen und uns zusammen etwas Neues zu suchen, wurde mir allmählich klar, dass es Zeit für mich ist, eine Entscheidung zu fällen. Das Leben ist zu kurz, um es in der falschen Beziehung zu verbringen.
Sofern es die falsche ist.
Ich grüble darüber nach und kaue geistesabwesend am Ende meines Kugelschreibers herum, bis er zersplittert und ich spitze Plastikteile im Mund habe. Eine meiner schlechten Angewohnheiten, genau wie Nägelkauen. Vielleicht gehört das auch zu den Dingen, die ich in der Folgate Street 1 endlich lassen werde. Möglicherweise wird mich das Haus zu einem besseren Menschen machen und Ordnung und Disziplin in mein Lebenschaos bringen. Ich werde mich in einen Menschen verwandeln, der sich Ziele setzt, Listen aufstellt und alles auf die Reihe kriegt.
Ich wende mich wieder dem Formular zu, fest entschlossen, meine Antwort so knapp wie möglich zu halten, um zu beweisen, dass ich es kapiert habe, dass ich verstanden habe, worauf der Architekt hinauswill.
Und dann erkenne ich, wie die richtige Antwort lautet.
Ich lasse die Zeilen einfach frei. So leer, karg und perfekt wie das Innere von Folgate Street 1.
Später gebe ich Simon das Formular und erkläre ihm, was ich getan habe. Und was ist mit meinen Sachen, Em?, entgegnet er. Was ist mit der Sammlung?
Die Sammlung besteht aus etlichen über die Jahre mühevoll erstandenen NASA-Souvenirs, in Kartons unter dem Bett befindlich. Vielleicht könnten wir die einlagern, schlage ich vor, hin- und hergerissen zwischen Amüsement – weil wir uns tatsächlich darüber streiten, ob Schrott von eBay, signiert von Buzz Aldrin oder Jack Schmitt, uns tatsächlich daran hindern könnte, in das unbeschreiblichste Haus zu ziehen, das wir je gesehen haben – und Wut, da Simon ernsthaft in Erwägung zieht, seine Astronauten wären wichtiger als das, was mir zugestoßen ist.
Eine Kabine in einem Self-Storage-Laden ist nicht unbedingt das, was ich mir dafür vorgestellt habe, Babe, entgegnet er.
Aber es sind nur Dinge, Si. Und Dinge sind doch nicht wirklich von Bedeutung, oder?
Ich spüre, dass ein weiterer Streit im Anzug ist, die vertraute Wut steigt an die Oberfläche. Schon wieder, würde ich am liebsten brüllen, hast du mir weisgemacht, du würdest etwas unternehmen. Und wenn es hart auf hart kommt, versuchst du immer, dich zu drücken.
Natürlich spreche ich es nicht aus. So viel Wut steckt dann doch nicht in mir.
Carol Younson, die Therapeutin, zu der ich seit dem Einbruch gehe, sagt, Wut sei ein gutes Zeichen. Sie bedeute, dass ich mich nicht unterkriegen lasse, oder so ähnlich. Leider richtet sich meine Wut stets nur gegen Simon. Das ist offenbar auch normal. Die Personen, die einem am nächsten stünden, bekämen am meisten ab.
Okay, okay, sagt Simon rasch. Die Sammlung wird eingelagert. Aber da könnten noch einige andere Dinge sein …
Ich habe bereits einen seltsamen Beschützerinstinkt für die wundervolle Leerstelle hinter meiner Antwort entwickelt. Lass uns einfach alles wegschmeißen, sage ich ungeduldig. Von vorne anfangen. So, als flögen wir in den Urlaub, und die Fluggesellschaft müsste uns das ganze Gepäck ersetzen.
In Ordnung, erwidert er. Aber ich merke ihm an, dass er das nur sagt, damit ich nicht sauer werde. Er geht zum Spülbecken und fängt demonstrativ an, sämtliche schmutzigen Tassen und Teller abzuwaschen, die ich dort gestapelt habe. Ich weiß, dass er glaubt, ich würde das nicht schaffen. Dass ich nicht genug Selbstdisziplin habe, ein nicht von Krimskrams überquellendes Leben zu führen. Ich ziehe das Chaos förmlich an, sagt er immer. Aber genau deshalb will ich es tun. Ich will mich neu erfinden. Und dass ich es mit jemandem versuche, der meint, mich zu kennen, und es mir nicht zutraut, macht mich ärgerlich.
Ich glaube, dass ich dort schreiben könnte, füge ich hinzu. In dieser Ruhe. Du ermutigst mich doch schon seit Jahren, ein Buch zu schreiben.
Er brummt etwas, nicht sehr überzeugt.
Oder vielleicht fange ich einen Blog an, füge ich hinzu.
Ich lasse mir die Idee durch den Kopf gehen und beleuchte sie aus allen Winkeln. Ein Blog wäre ziemlich cool. Ich könnte ihn Ich, die Minimalistin nennen. Meine Reise in den Minimalismus. Oder einfach nur Mini Miss.
Ich bin Feuer und Flamme und überlege mir, wie viele Follower ein Blog über den Minimalismus wohl anziehen würde. Vielleicht würde er sogar Werbekunden anlocken. Ich könnte meinen Job aufgeben und die Sache zu einem Lifestyle-Journal im Bestsellerformat machen wie Emma Matthews.
Würdest du dann all die anderen Blogs, die ich für dich eingerichtet habe, schließen?, fragt er. Die Andeutung, dass ich die Sache nicht ernsthaft betreiben würde, ärgert mich. Es stimmt, dass London Girlfriend nur vierundachtzig Follower hat und Liebesromanluder lediglich achtzehn. Doch ich hatte nie genug Zeit, um wirklich etwas zu schreiben.
Ich wende mich wieder dem Bewerbungsformular zu. Schon nach der ersten Frage streiten wir uns. Es sind noch vierunddreißig weitere übrig.
Heute: Jane
Ich blättere das Bewerbungsformular durch. Einige der Fragen sind ziemlich merkwürdig. Ich kann ja noch verstehen, dass er wissen will, welche Sachen ich mitbringen oder was ich an der Einrichtung verändern möchte, aber was ist mit:
23. Würdest du dich selbst opfern, um zehn unschuldige Fremde zu retten?
24. Was, wenn es zehntausend Fremde wären?
25. Machen dicke Menschen dich (a) traurig, (b) ärgerlich?
Mir wird klar, dass ich vorhin das Wort Integrität richtig verwendet habe. Bei diesen Fragen handelt es sich um eine Art psychometrischen Test. Allerdings ist Integrität ein Begriff, der bei Immobilienmaklern nur selten zum Einsatz kommt. Kein Wunder, dass Camilla mich so verdattert angestarrt hat.
Vor dem Ausfüllen google ich »The Monkford Partnership«. Als ich die Website anklicke, erhalte ich ein Bild von einer nackten Wand. Es ist eine wunderschöne Wand aus hellem Stein mit einer glatten Oberfläche, allerdings nicht sonderlich informativ.
Als ich weiterklicke, erscheinen zwei Wörter:
Projekte
Kontakt
Ich wähle »Projekte« aus, und auf dem Bildschirm ist eine Liste zu sehen.
Wolkenkratzer, Tokio
Monkford Building, London
Wanderer Campus, Seattle
Strandhaus, Menorca
Kapelle, Brüggen
The Black House, Inverness
Folgate Street 1, London
Wenn ich die Gebäude anklicke, erscheinen nur weitere Bilder, kein Text. Lediglich Fotos der Bauwerke. Alle sind absolut minimalistisch und mit derselben Liebe zum Detail erbaut, und zwar aus den gleichen hochwertigen Materialien wie Folgate Street 1. Auf den Fotos ist kein einziger Mensch zu sehen. Auch sonst nichts, was auf Bewohner hinweist. Die Kapelle und das Strandhaus sind beinahe austauschbar: massive Quader aus hellem Stein und großen Glasscheiben. Nur die Aussicht ist jeweils eine andere.
Ich schaue auf Wikipedia nach.
Edward Monkford (geb. 1980) ist ein britischer Techno-Architekt und Anhänger der minimalistischen Ästhetik. Im Jahr 2005 gründete er mit dem Datenspezialisten David Thiel und zwei weiteren Teilhabern The Monkford Partnership. Gemeinsam sind ihnen Durchbrüche auf dem Gebiet der Domotik gelungen. Sie haben intelligente Gebäude geschaffen.
Für gewöhnlich übernimmt Monkford Partnership stets nur einen einzigen Auftrag zu einer Zeit. Deshalb ist die Liste ihrer bisherigen Projekte absichtlich kurz gehalten. Derzeit arbeiten sie an ihrem bis jetzt ehrgeizigsten Projekt: New Austell, eine Ökostadt mit zehntausend Wohneinheiten im Norden von Cornwall.
Ich gehe die Auszeichnungen durch. Die Architectural Review bezeichnet Monkford als »trotziges Genie«, während das Smithsonian Magazine ihn »Großbritanniens einflussreichsten Stagnationsarchitekten« nennt, »einen wortkargen Selbstdarsteller, dessen Arbeiten ebenso unansehnlich wie tiefgreifend sind«.
Ich klicke auf »Privates«.
2006, als Monkford noch weitgehend unbekannt war, heiratete er Elizabeth Mancari, ebenfalls Mitglied der Monkford Gruppe. 2007 kam ihr Sohn Max zur Welt. Mutter und Kind wurden während der Bauarbeiten an Folgate Street 1 (2008–2011) bei einem Unfall getötet, ein Haus, das eigentlich als Familienwohnsitz und Demonstrationsobjekt für die Qualitäten des jungen Unternehmens hätte dienen sollen. Einige Kommentatoren bezeichnen diese Tragödie und Edward Monkfords darauffolgendes einjähriges Sabbatical in Japan als das prägende Moment, das hinter dem kompromisslosen minimalistischen Stil steht, durch den sich das Unternehmen einen Namen gemacht hat.
Nach seiner Rückkehr verwarf Monkford seine ursprünglichen Pläne für Folgate Street 1 – damals noch eine Baustelle – und begann noch einmal ganz von vorn. Das auf diese Weise entstandene Haus hat einige bedeutende Preise gewonnen, einschließlich eines Stirling Prize des Royal Institute of British Architects.
Ich lese den Text noch einmal. Also stand am Anfang dieses Hauses ein Todesfall. Genau genommen zwei, doppelte Trauer. Fühle ich mich vielleicht deshalb dort so zu Hause? Gibt es eine Verbindung zwischen diesen kargen Räumen und dem, was ich verloren habe?
Unwillkürlich wandert mein Blick zu dem Koffer am Fenster. Einem Koffer voller Babysachen.
Mein Baby ist gestorben. Mein Baby ist gestorben, und dann, drei Tage später, wurde es geboren. Sogar jetzt noch schmerzt mich dieser schreckliche Verstoß gegen die Natur, die beiläufige Umkehrung der Ordnung der Dinge, mehr als alles andere.
Dr. Gifford, der behandelnde Gynäkologe, war, obgleich kaum älter als ich, derjenige, der mir in die Augen sah und mir erklärte, mein Baby müsse auf natürlichem Wege zur Welt kommen. Das Risiko einer Infektion und weiterer Komplikationen plus die Tatsache, dass ein Kaiserschnitt einen schweren chirurgischen Eingriff darstelle, bedeute, dass dieser in Fällen von Totgeburten nicht angeboten werde. Angeboten – dieses Wort hat er benutzt. Als wäre ein per Kaiserschnitt geborenes Baby, auch wenn es tot war, eine Art Geschenk wie ein Obstkorb in einem Hotelzimmer. Allerdings würden sie per Tropf die Wehen einleiten, fügte er hinzu, damit die ganze Sache so schnell und schmerzlos wie möglich abliefe.
Aber ich will nicht, dass es schmerzlos ist, dachte ich. Ich will, dass es wehtut und dass am Ende ein lebendiges Baby dabei herauskommt. Ich ertappte mich bei der Frage, ob Dr. Gifford wohl Kinder hatte. Ja, beschloss ich. Ärzte heirateten jung, zumeist Berufskolleginnen. Außerdem war er viel zu sympathisch, um nicht selbst eine Familie zu haben. Am Abend würde er nach Hause gehen und seiner Frau bei einem Bier vor dem Abendessen von seinem Tag erzählen. Er würde Wörter wie Tod im Mutterleib, ausgetragene Schwangerschaft und vielleicht ziemlich hart benutzen. Dann würde seine Tochter ihm zeigen, was sie in der Schule gemalt hat, und er würde sie küssen und ihr sagen, dass sie toll sei.
An den angespannten und verkrampften Gesichtern des medizinischen Personals erkannte ich, dass eine derartige Situation selbst für sie schreckliche Seltenheit hatte. Doch während sie sich ein wenig hinter ihre Professionalität flüchten konnten, war ich gleichzeitig überwältigt und wie betäubt von dem Gefühl, versagt zu haben. Als sie mich an den mit Hormonen gespickten Tropf anschlossen, damit es endlich losging, hörte ich die Schreie einer anderen Frau, ein Stückchen weiter in der Entbindungsstation. Nur, dass diese Frau das Krankenhaus mit einem Baby verlassen würde, nicht mit einer Überweisung an einen Trauertherapeuten. Mutterschaft. Ein seltsames Wort, wenn man darüber nachdachte. Würde ich je im wahren Sinne als Mutter betrachtet werden? Oder gab es einen anderen Ausdruck für das, was aus mir werden würde? Ich hatte bereits post partum aufgeschnappt anstelle von postnatal.
Als sich jemand erkundigte, ob der Vater kontaktiert werden sollte, schüttelte ich den Kopf. Kein Vater. Nur meine Freundin Mia, kreidebleich vor Trauer und Sorge, während all unsere sorgfältig zurechtgelegten Geburtspläne – Duftkerzen, Wasserbecken und einen iPod voller Jack Johnson und Bach – in einem nüchternen Strom medizinischer Aktivitäten versanken, so als hätte ich mich in der Illusion gewiegt, dass alles in bester Ordnung wäre, dass ich alles unter Kontrolle hätte, dass eine Geburt kaum anstrengender wäre als eine Wellness-Behandlung oder eine besonders heftige Massage. Kein Kampf um Leben und Tod, bei dem ein solches Ergebnis durchaus möglich, wenn nicht gar zu erwarten wäre. Ein Fall von zweihundert, sagte Dr. Gifford. In einem Drittel der Fälle würden die Gründe nie ermittelt. Dass ich in Topform und gesund war – vor der Schwangerschaft hatte ich jeden Tag Pilates gemacht und war mindestens einmal pro Woche gejoggt –, spielte keine Rolle. Mein Alter auch nicht. Manche Babys starben eben einfach. Ich würde kinderlos sein, und die kleine Isabel Margaret Cavendish würde nie eine Mutter haben. Ein Leben würde niemals stattfinden. Als die Wehen einsetzten, atmete ich ein wenig Gas ein, und Schreckensbilder machten sich in meinem Kopf breit, viktorianische Krüppelgestalten in mit Formaldehyd gefüllten Gläsern standen mir vor Augen. Ich schrie auf und spannte die Muskeln an, obwohl die Hebamme mir sagte, es sei noch nicht so weit.
Doch danach – als ich Leben geschenkt hatte oder den Tod oder wie man das auch immer nennen soll – war alles seltsam friedlich. Offenbar lag das an den Hormonen, demselben Mix aus Liebe, Glück und Erleichterung, den jede junge Mutter fühlt. Sie war völlig ruhig und entspannt, und ich hielt sie in meinen Armen und sprach zu ihr. Sie roch nach Rotz, Körperflüssigkeiten und sauberer neuer Haut. Ihre warmen kleinen Fäuste schlossen sich locker um meinen Finger, so wie bei jedem Baby. Ich empfand … Glückseligkeit.
Die Hebamme nahm sie mir weg, um Gipsabdrücke ihrer Hände und Füße für meine Erinnerungsschachtel anzufertigen. Dieses Wort hatte ich noch nie zuvor gehört, sodass sie es mir erklären musste. Ich würde eine Schuhschachtel bekommen, die eine Haarlocke von Isabel, ihr Wickeltuch, einige Fotos und die Gipsabdrücke enthielt. Wie ein kleiner Sarg. Erinnerungen an einen Menschen, den es nie gegeben hatte. Als die Hebamme die Gipsabdrücke zurückbrachte, sahen sie aus wie Bastelarbeiten aus dem Kindergarten. Rosafarbener Gips für die Hände, blauer für die Füße. In diesem Moment wurde mir endgültig klar, dass es keine Bastelarbeiten und keine Bilder an den Wänden geben würde. Keine Entscheidung, welche Schule sie besuchen sollte. Keine zu klein gewordene Schuluniform. Ich hatte gerade ein Baby verloren. Ein Kind, einen Teenager, eine Frau.
Inzwischen waren ihre Füße und auch ihr übriger Körper kalt. Als ich in meinem Zimmer am Waschbecken die letzten Gipsreste zwischen ihren Zehen herausspülte, fragte ich die Hebamme, ob ich sie für eine Weile mit nach Hause nehmen dürfe. Die Hebamme musterte mich zweifelnd und meinte, das sei doch ein wenig seltsam, oder? Aber ich könne sie hier im Krankenhaus so lange im Arm halten, wie ich wollte. Ich erwiderte, sie könnten sie wegbringen.
Als ich danach durch einen Tränenschleier den grauen Londoner Himmel betrachtete, fühlte ich mich, als wäre mir ein Körperteil amputiert worden. Zurück zu Hause, wich die tiefe Trauer einer Art Benommenheit. Wenn Freunde mich erschrocken und mitfühlend auf meinen Verlust ansprachen, wusste ich natürlich, was sie meinten. Und dennoch empfand ich ihre Worte als tödlich zutreffend. Andere Frauen waren siegreich gewesen, hatten gewonnen beim Poker mit Natur, mit Fortpflanzung und Genen. Ich nicht. Ich, die stets so tüchtig, erfolgreich und leistungsstark gewesen war, hatte verloren. Ich stellte fest, dass sich Trauer nicht so anders anfühlte als eine Niederlage.
Und dennoch war auf sonderbare Weise alles fast so wie zuvor. Wie vor der kurzen und zivilisierten Liaison mit meinem Kollegen im Genfer Büro. Eine Affäre, die sich in Hotelzimmern und gesichtslosen Restaurants mit perfektem Service abspielte. Bis ich morgens anfing, mich zu übergeben, und mir – anfänglich mit Grauen – dämmerte, dass ich womöglich nicht so gut aufgepasst hatte wie gedacht. Nach den schwierigen Telefonaten und E-Mails und seinen diskreten Hinweisen auf Entscheidungen und Arrangements und schlechtes Timing entstand allmählich ein völlig anderes Gefühl. Das Gefühl, das Timing könne ja doch richtig gewesen sein. Selbst wenn diese Affäre nicht zu einer festen Beziehung führen sollte, eröffnete sie mir, vierunddreißig und ledig, eine Möglichkeit. Mein Verdienst konnte leicht zwei Menschen ernähren. Und die PR-Agentur, für die ich tätig war, war stolz auf ihre großzügigen Leistungen für Mütter. Ich würde nicht nur fast ein ganzes Jahr freinehmen können, um für mein Baby da zu sein, sondern man garantierte mir bei meiner Rückkehr sogar flexible Arbeitszeiten.
Meine Arbeitgeber waren ebenso hilfsbereit, als ich ihnen von meiner Totgeburt berichtete. Sie boten mir unbegrenzte Krankheitstage an. Immerhin hatten sie die Erziehungszeit ja schon eingeplant. Und so saß ich allein in einer Wohnung, in der alles sorgfältig für ein Kind vorbereitet war: die Wiege von Kuster, der allerneueste Bugaboo, der handgemalte Fries aus Zirkusszenen entlang der Wand. Den ersten Monat verbrachte ich damit, Muttermilch auszudrücken und sie in die Spüle zu kippen.
Der Beamtenstaat versuchte zwar, mich zu schonen, tat es jedoch letztlich nicht. Ich stellte fest, dass eine Totgeburt im Gesetz nicht vorgesehen ist: Eine Frau in meiner Lage muss den Tod und die Geburt gleichzeitig anmelden, eine juristische Grausamkeit, die mich noch immer wütend macht, wenn ich daran denke. Eine Beerdigung fand statt – wieder eine rechtliche Vorschrift, doch ich hatte ohnehin eine gewollt. Eine Grabrede für ein Leben, das nie stattgefunden hat, ist schwierig, aber wir taten unser Bestes.
Psychologische Beratung wurde angeboten und angenommen. Aber tief in meinem Herzen wusste ich, dass sie nichts nützen würde. Ich musste einen Berg der Trauer erklimmen, und alle Gespräche würden mir dabei nicht weiterhelfen. Ich musste wieder zur Arbeit. Als klar wurde, dass ich erst in einem Jahr wieder in meinen Job würde zurückkehren können – offenbar konnte man eine Schwangerschaftsvertretung nicht so einfach wieder loswerden –, kündigte ich und nahm eine Teilzeitstelle bei einem Verein an, der sich der Erforschung von Totgeburten verschrieben hatte. Das hieß, dass ich mir meine alte Wohnung nicht mehr leisten konnte. Doch ich wollte ohnehin umziehen. Selbst wenn ich die Wiege und die Kinderzimmertapete loswurde, würde es stets die Wohnung bleiben, in der Isabel fehlte.
Damals: Emma
Etwas hat mich geweckt.
Ich weiß sofort, dass es nicht Betrunkene vor der Dönerbude draußen sind und auch keine Prügelei auf der Straße oder ein Polizeihubschrauber, denn an die bin ich inzwischen so gewöhnt, dass ich sie kaum noch wahrnehme. Ich hebe den Kopf und lausche. Ein Poltern und dann noch mal.
Jemand ist in unserer Wohnung.
In letzter Zeit hat es in dieser Gegend einige Einbrüche gegeben, und ich spüre, wie sich mein Magen ängstlich zusammenkrampft. Da fällt es mir wieder ein. Simon ist unterwegs, auf Kneipentour mit der Firma, und ich bin ins Bett gegangen, ohne auf ihn zu warten. Die Geräuschkulisse weist darauf hin, dass er zu viel getrunken hat. Hoffentlich duscht er, bevor er ins Bett kommt.
Anhand der Geräusche von der Straße, beziehungsweise deren Nichtvorhandensein, kann ich die Uhrzeit einigermaßen schätzen. Kein Aufheulen von Motoren, wenn die Wagen an den Ampeln beschleunigen. Keine zuknallenden Autotüren vor der Dönerbude. Ich taste nach meinem Telefon und spähe auf die Uhr. Obwohl ich meine Kontaktlinsen nicht drin habe, erkenne ich, dass es 2:41 Uhr ist.
Simon kommt den Flur entlang, zu betrunken, um daran zu denken, dass die Diele vor dem Bad immer knarzt.
Alles okay, rufe ich. Ich bin wach.
Seine Schritte stoppen vor der Tür. Ich weiß, dass du was getrunken hast, füge ich hinzu, um ihm zu zeigen, dass ich nicht sauer bin.
Gedämpfte Stimmen. Geflüster.
Das heißt, er hat jemanden mitgebracht. Irgendeinen betrunkenen Kollegen, der den letzten Zug in die Vorstadt nicht mehr erwischt hat. Was ziemlich ärgerlich ist. Ich habe morgen – genau genommen, heute – viel zu tun. Und Simons verkatertem Kollegen ein Frühstück zu servieren, ist nicht Teil des Plans. Falls es doch dazu kommt, wird Simon natürlich der Charme in Person sein, mich Babe und wunderschön nennen und seinem Kumpel erzählen, dass ich fast Model geworden wäre, weshalb er der glücklichste Mann der Welt ist. Und ich gebe wieder einmal nach und komme zu spät zur Arbeit. Wäre nicht das erste Mal.
Dann sehen wir uns später, rufe ich, ein wenig verärgert. Wahrscheinlich packen sie jetzt die X-Box aus.
Plötzlich keine Schritte mehr.
Inzwischen wirklich sauer, schwinge ich die Beine über die Bettkante – für einen Kollegen bin ich sittsam genug bekleidet, ein altes T-Shirt und Boxershorts – und reiße die Schlafzimmertür auf.
Allerdings bin ich nicht so schnell wie die Gestalt auf der anderen Seite, der dunkel gekleidete Typ mit der Sturmhaube, der plötzlich seine Schulter hart gegen die Tür rammt, sodass ich rückwärts taumele. Ich schreie auf – wenigstens glaube ich das. Es könnte auch nur ein Keuchen sein, denn Angst und Schock schnüren mir die Kehle zu. Da in der Küche Licht brennt, sehe ich ein Aufblitzen, als er sein Messer hebt. Es ist ein winziges Messer, kaum größer als ein Kugelschreiber.
Seine Augen heben sich von der dunklen Wolle der Sturmhaube ab. Sie weiten sich bei meinem Anblick.
Wow!, sagt er.
Hinter ihm erkenne ich eine zweite Sturmhaube und ein weiteres Augenpaar, das ängstlicher dreinblickt. Lass es, Bruder, sagt der Zweite. Einer der Eindringlinge ist weiß, der andere schwarz, doch sie sprechen denselben schwarzen Slang.
Chill mal, erwidert der Erste. Irre, oder?
Er hebt das Messer, bis es dicht vor meinem Gesicht schwebt. Her mit dem Telefon, du reiche Schlampe.
Ich erstarre.
Doch dann bin ich schneller als er. Ich greife hinter mich. Er glaubt, dass ich mein Telefon hole, doch in Wirklichkeit greife ich nach meinem eigenen Messer, dem großen Fleischmesser aus der Küche, das auf meinem Nachttisch liegt. Der Griff gleitet glatt und schwer in meine Hand. Mit einer fließenden Bewegung wirble ich damit herum, und es fährt in den Bauch dieses Mistkerls, genau unterhalb des Brustkorbs. Es dringt mühelos ein. Kein Blut, denke ich, als ich es herausziehe und noch einmal zusteche. Anders als in Horrorfilmen spritzt noch immer kein Blut. Das macht es leichter. Ich stoße das Messer in seinen Arm, dann in seinen Unterleib und zuletzt noch ein bisschen tiefer, dahin, wo seine Eier sind. Ich bohre es brutal in seine Lenden. Als er in sich zusammensackt, mache ich einen Schritt über ihn hinweg und wende mich der zweiten Gestalt zu.
Und jetzt du, sage ich zu ihm. Du warst dabei, und du hast ihn nicht gestoppt. Du kleines Arschloch. Ihm das Messer in den Mund zu rammen ist so einfach, wie einen Brief einzuwerfen.
Dann wird alles dunkel, und ich wache schreiend auf.
Das ist normal, meint Carol Younson. Absolut normal. Es ist sogar ein gutes Zeichen.
Selbst jetzt in dem Wohnzimmer, wo sie ihre Therapiesitzungen abhält, zittere ich noch am ganzen Leib. Irgendwo draußen mäht jemand den Rasen.
Was soll daran gut sein?, frage ich benommen.
Carol Younson nickt wieder. Das tut sie oft, eigentlich immer, wenn ich etwas sage, so als wolle sie mir mitteilen, dass sie normalerweise die Fragen ihrer Patienten nicht beantwortet und nur für mich eine Ausnahme macht. Für jemanden, der so gut mitarbeitet, solche ausgezeichneten Fortschritte macht, vielleicht sogar kurz vor dem Durchbruch steht, wie sie am Ende jeder Sitzung sagt. Da sie mir von der Polizei empfohlen wurde, muss sie fähig sein. Doch offen gestanden wäre es mir lieber, wenn sie diese Schweine erwischen würden, anstatt Visitenkarten von Therapeuten zu verteilen.
Ihre Fantasie, ein Messer zu haben, könnte ein Hinweis darauf sein, dass ihr Unbewusstsein Ihnen mitteilt, es wolle die Kontrolle über die Ereignisse gewinnen, fährt sie fort.
Wirklich?, erwidere ich. Ich ziehe die Füße an. Obwohl ich keine Schuhe anhabe, bin ich nicht sicher, ob das auf Carol Younsons makellos sauberem Sofa erlaubt ist. Andererseits denke ich, dass ich für meine fünfzig Pfund auch etwas erwarten kann. Handelt es sich um dasselbe Unbewusste, das beschlossen hat, dass ich mich an nichts erinnern darf, nachdem ich mein Smartphone ausgehändigt hatte? Hätte es mir nicht einfach sagen können, wie dämlich es war, kein Messer neben dem Bett liegen zu haben?