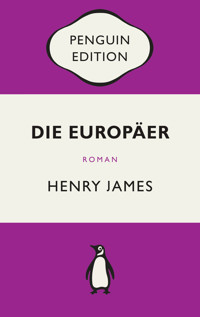
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Penguin Edition
- Sprache: Deutsch
Eine raffinierte Beziehungskomödie im kulturellen Spannungsfeld zwischen der Alten und der Neuen Welt
Das vielleicht amüsanteste Buch des begnadeten Stilisten Henry James
Was unterscheidet Europäer von Amerikanern? In seiner leichtfüßigen Komödie bringt Henry James Frauen und Männer von beiden Seiten des Atlantiks miteinander ins Gespräch und dann unter die Haube.
Ohne Geld, aber im Vertrauen auf eine gute Partie reisen Baronin Eugenia Münster und ihr Bruder Felix Young nach Neuengland. Mit Adelstitel und Charme umgarnen die beiden rasch ihre Verwandtschaft, den Onkel samt seinen drei erwachsenen Kindern. In wechselnden Paarungen konkurrieren Temperamente und Vorstellungen der Alten Welt mit Werten und Moral der Neuen. Wer sich am Ende an wen bindet, entscheidet sich nach einem quirligen Reigen transatlantischer Beziehungen, der einen neuen Blick auf beide Kontinente und nicht zuletzt auf den großen Autor selbst ermöglicht.
Für seine eleganten, doch oft irritierend komplexen Romane berühmt, zeigt sich Henry James in diesem Fundstück als lustvoller Matchmaker mit Tiefgang.
PENGUIN EDITION. Zeitlos, kultig, bunt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 308
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Große Emotionen, große Dramen, große Abenteuer – von Austen bis Fitzgerald, von Flaubert bis Zweig. Ein Bücherregal ohne Klassiker ist wie eine Welt ohne Farbe.
Henry James (1843–1916) wurde in New York geboren, verbrachte jedoch die meiste Zeit seines Lebens auf Reisen und in Europa. Dessen klassischer Literatur, insbesondere aus Russland und Frankreich, galt seine höchste Wertschätzung. Seinen Ruf als Meister der psychologischen Erzählkunst erschrieb er sich mit zwanzig Romanen und über hundert Erzählungen.
«Ich kenne keinen besseren, intimeren Kenner der Abgründe des menschlichen Herzens als Henry James … Großartig zu lesen, es ist ein wirklich leichtes, zugängliches Buch.»
Denis Scheck, SWR lesenswert
«Die ehrbare Kraft der Neuen Welt trifft auf die laszive Verfeinerung der Alten Welt: Henry James erzählt federleicht eine kleine transatlantische Ethnologie. Jedes Klischee sitzt!»
Ijoma Mangold, Die Zeit
«Ein glänzend geschriebenes Buch!»
Elke Heidenreich, SRF Literaturclub
«Die Neuübersetzung lässt das vorletzte Jahrhundert geradezu postmodern erscheinen … Henry James gehört zu den Postmodernen und ist deshalb unser höchst lebendiger Zeitgenosse.»
Jochen Schimmang, Frankfurter Allgemeine Zeitung
Henry James
DIE EUROPÄER
Roman
Aus dem Englischen übersetzt von Andrea Ott
Nachwort von Gustav Seibt
Die Originalausgabe erschien 1878
unter dem Titel «The Europeans».
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung des urheberrechtlich geschützten Inhalts dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2015/2023 der deutschsprachigen Ausgabe by Manesse Verlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Regg Media in Adaption der traditionellen Penguin Classics Triband-Optik aus England
Umsetzung eBook: Greiner & Reichel GmbH, Köln
ISBN 978-3-641-30926-8V001
www.penguin-verlag.de
1
Ein schmaler Friedhof im Herzen einer betriebsamen, gleichgültigen Großstadt ist, betrachtet aus den Fenstern eines düsteren Gasthofs, zu keiner Zeit ein anregender Anblick, und das Bild gewinnt auch nicht, wenn sich über die verschimmelten Grabsteine und trübseligen Baumschatten ein schwerer, nasser, wenig erquickender Schnee gelegt hat. Wenn zudem laut Kalender, allem trüben, eisigen Nieselregen zum Trotz, der wonnigliche Frühling bereits sechs Wochen alt ist, mangelt es der Szenerie, wie jedermann zugeben muss, nicht an deprimierenden Details. Und genauso empfand das an einem zwölften Mai vor über dreißig Jahren auch eine Dame, die im besten Hotel der altehrwürdigen Stadt Boston am Fenster stand und hinaussah. Sie stand dort seit einer halben Stunde – allerdings mit Unterbrechungen, denn von Zeit zu Zeit drehte sie sich um und durchmaß das Zimmer mit ruhelosen Schritten. Im Kamin erzeugte ein rotglühendes Feuer eine kleine, bläuliche Flamme, und vor dem Feuer saß an einem Tisch ein junger Mann, der eifrig mit einem Bleistift zugange war. Er hatte einige Bögen Papier in lauter gleichförmige, kleine Rechtecke geschnitten und bedeckte diese nun offenbar mit Zeichnungen – seltsamen Gestalten. Er arbeitete rasch und konzentriert, wobei er manchmal den Kopf zurücklegte, sein Bild auf Armeslänge vor sich hin hielt und unablässig ein leises, heiter klingendes Summen und Pfeifen von sich gab. Die Dame streifte ihn im Vorbeigehen; ihre reich besetzten Röcke waren sehr ausladend. Für seine Arbeit hatte sie nie einen Blick übrig, sah nur ab und zu, wenn sie vorbeikam, in einen Spiegel über dem Toilettentisch am anderen Ende des Zimmers. Dann blieb sie kurz stehen, kniff sich links und rechts in die Taille oder hob ihre Hände – die weich und hübsch waren – mit einer halb liebkosenden, halb zurechtrückenden Bewegung zu ihrer vielfach verschlungenen Haartracht empor. Ein aufmerksamer Beobachter hätte annehmen können, dass ihr Gesicht in diesen Sekunden oberflächlicher Selbstprüfung seine Schwermut vergaß, doch kaum näherte sich die Frau wieder dem Fenster, verriet ihre Miene, dass sie alles andere als erfreut war. Und in der Tat bot das, worauf ihr Blick fiel, wenig Grund zur Freude. Der Schneeregen schlug gegen die Fensterscheiben; die Grabsteine auf dem Friedhof sahen aus, als wendeten sie sich schutzsuchend ab. Ein hohes Eisengitter trennte sie von der Straße, und diesseits des Gitters trampelte eine Schar von Bostonern im feuchten Schnee herum. Viele blickten auf und dann wieder zu Boden; anscheinend warteten sie auf etwas. Von Zeit zu Zeit näherte sich ein seltsames Gefährt der Stelle, an der sie standen, ein Gefährt, wie es die Dame am Fenster, die doch mit allerlei menschlichen Erfindungen vertraut war, noch nie gesehen hatte: ein riesiger, niedriger, in leuchtenden Farben bemalter und augenscheinlich mit bimmelnden Glöckchen verzierter Omnibus, der unter heftigem Rattern, Stoßen und Kreischen von zwei auffallend kleinen Pferden durch eine Art von Furchen im Pflaster gezogen wurde. Sobald er eine bestimmte Stelle erreicht hatte, stürzten sich die Leute vor dem Friedhof, zumeist Frauen mit Taschen und Paketen, geschlossen auf ihn – eine Bewegung, die an das Gerangel um Plätze in einem Rettungsboot auf hoher See erinnerte – und wurden von seinem riesigen Inneren verschluckt. Dann fuhr das Rettungsboot – oder der «Rettungswagen», wie ihn die Dame am Hotelfenster unsicher bezeichnete – holpernd und klingelnd auf seinen unsichtbaren Rädern davon, und der Steuermann (der Mann am Lenkrad) wies ihm vom Bug aus unsinnigerweise den Weg. Dieses Schauspiel wiederholte sich alle drei Minuten, und immer gab es reichlich Nachschub an drängelnden Frauen in Mänteln mit Handtaschen und Bündeln. Jenseits des Friedhofs zeigten sich Reihen kleiner roter Backsteinhäuser von ihrer freundlichen, familiären Gartenseite. An deren Ende, gegenüber dem Hotel, ragte ein hoher hölzerner, weiß bemalter Kirchturm in das neblige Schneetreiben. Die Dame am Fenster betrachtete ihn eine Weile; aus nur ihr selbst bekannten Gründen hielt sie ihn für das hässlichste Gebilde, das sie je gesehen hatte. Sie verabscheute ihn, sie verachtete ihn, er versetzte sie in eine Gereiztheit, die in keinem Verhältnis zu irgendeinem vernünftigen Motiv stand. Sie hatte gar nicht gewusst, dass ihr Kirchtürme so nahegingen.
Sie war nicht hübsch, aber ihr Gesicht war äußerst interessant und ansprechend, selbst wenn es Verwirrung und Gereiztheit ausdrückte. Sie war auch nicht mehr ganz jung; obwohl schlank, besaß sie außerordentlich wohlgeformte Rundungen – eine Andeutung von Reife und gleichzeitig Beweglichkeit – und trug ihre dreiunddreißig Jahre, wie eine zartgliedrige Hebe einen randvollen Weinkelch tragen mochte. Ihr Teint war müde, wie die Franzosen sagen,1 ihr Mund groß, ihre Lippen waren ein wenig voll, ihre Zähne unregelmäßig, und ihr Kinn war eher gewöhnlich geformt. Sie hatte eine breite Nase, und wenn sie lächelte – und sie lächelte ständig –, hoben sich die Falten beiderseits der Nase etwas weit nach oben, bis zu ihren Augen. Diese Augen waren gleichwohl bezaubernd: grau, strahlend, flink, freundlich und intelligent. Sie hatte eine sehr niedrige Stirn, der einzig hübsche Gesichtszug, und ihr volles, krauses, dunkles Haar war fein onduliert und immer auf eine Weise geflochten, die an eine südländische oder asiatische, jedenfalls sehr fremdländische Frau denken ließ. Sie besaß eine große Sammlung von Ohrringen, die sie abwechselnd trug, und die ihr orientalisches oder exotisches Aussehen noch zu betonen schienen. Einmal hatte jemand etwas Schmeichelhaftes über sie geäußert, man hatte ihr davon erzählt, und kein Kompliment hatte ihr jemals mehr Freude gemacht: «Eine hübsche Frau», hatte ein Mann gesagt, «aber sie hat unschöne Gesichtszüge.» – «Von ihren Gesichtszügen weiß ich nichts», hatte ein kluger Beobachter geantwortet, «aber sie trägt ihren Kopf wie eine hübsche Frau.» Man kann sich vorstellen, dass sie ihren Kopf von da an immer so vorteilhaft trug.
Schließlich wandte sie sich vom Fenster ab und schlug die Hände vor die Augen. «Es ist zu schrecklich!», rief sie. «Ich fahre zurück, ich fahre zurück!» Sie warf sich in einen Sessel vor dem Kamin.
«Warte noch ein bisschen, liebes Kind», sagte der junge Mann sanft und zeichnete weiter auf seine Papierschnipsel.
Die Dame streckte einen Fuß vor; er war sehr klein, und auf dem Slipper saß eine riesige Rosette. Diese Verzierung starrte sie eine Weile an, dann blickte sie auf das glühende Bett aus Steinkohle im Kamin. «Hast du jemals etwas so Abscheuliches wie dieses Feuer gesehen?», fragte sie. «Hast du jemals etwas gesehen, das so … so affreux2 ist wie … wie das alles hier?» Sie sprach ein makelloses Englisch, aber wie sie dieses französische Epitheton3 aussprach, ließ erkennen, dass sie es gewohnt war, französische Epitheta zu verwenden.
«Ich finde das Feuer sehr hübsch», antwortete der junge Mann mit einem kurzen Blick darauf. «Diese kleinen blauen Zungen, die auf der roten Glut tanzen, sind doch äußerst malerisch. Sie sehen aus wie das Feuer im Labor eines Alchemisten.»
«Du bist zu gutmütig, mein Lieber», erklärte seine Gefährtin.
Der junge Mann hielt eine Zeichnung in der ausgestreckten Hand und legte den Kopf schief. Seine Zunge fuhr sachte über die Unterlippe. «Gutmütig: ja; zu gutmütig: nein.»
«Du zerrst an meinen Nerven», sagte die Dame und blickte auf ihren Schuh.
Er begann seine Zeichnung zu überarbeiten. «Du meinst wohl, du bist enerviert.»
«Nun … ja», antwortete seine Gefährtin mit einem kleinen, bitteren Lachen. «Das ist der schwärzeste Tag meines Lebens – und du weißt, was das heißt.»
«Warte bis morgen», erwiderte der junge Mann.
«Ja, wir haben einen großen Fehler gemacht. Sollte das heute noch in Frage stehen, so morgen bestimmt nicht mehr. Ce sera clair, au moins!4»
Der junge Mann schwieg ein paar Sekunden und zog seinen Bleistift übers Papier. Dann behauptete er: «Es gibt keine Fehler.»
«Sehr richtig – für Menschen, die nicht klug genug sind, sie wahrzunehmen. Seine eigenen Fehler nicht zu erkennen – das wäre ein glückliches Leben», fuhr die Dame fort und blickte immer noch auf ihren hübschen Fuß.
«Liebste Schwester», sagte der junge Mann, immerfort konzentriert zeichnend, «du hast mir gerade zum ersten Mal erklärt, dass ich nicht klug bin.»
«Nun, deiner eigenen Theorie zufolge kann ich das nicht als Fehler bezeichnen», antwortete seine Schwester beziehungsvoll.
Der junge Mann lachte hell und erfrischend. «Du zumindest bist ziemlich klug, liebste Schwester», sagte er.
«Das war ich nicht, als ich dir dies hier vorgeschlagen habe.»
«War es denn dein Vorschlag?», fragte der Bruder.
Sie wandte den Kopf und starrte ihn kurz an. «Möchtest etwa du dir das als Verdienst anrechnen?»
«Wenn du möchtest, nehme ich die Schuld auf mich», sagte er und blickte mit einem Lächeln auf.
«Ich weiß», erwiderte sie nach einem Weilchen, «du machst keinen Unterschied zwischen Dein und Mein. Du hast keinen Sinn für Besitz.»
Wieder lachte der junge Mann fröhlich. «Wenn das heißt, dass ich nichts besitze, hast du recht.»
«Mach keine Witze über deine Armut», sagte die Schwester. «Das ist genauso vulgär, wie wenn man damit prahlt.»
«Meine Armut! Ich habe gerade eine Zeichnung fertiggestellt, die mir fünfzig Franc einbringt!»
«Voyons»,5 sagte die Dame und streckte die Hand aus.
Er fügte noch ein paar Striche hinzu, dann gab er ihr die Skizze. Sie betrachtete sie, spann aber den Gedanken von vorher weiter. «Wenn eine Frau dich fragen würde, ob du sie heiraten möchtest, würdest du sagen: ‹Natürlich, meine Liebe, mit Vergnügen!› Dann würdest du sie heiraten und wärst aberwitzig glücklich. Und nach drei Monaten würdest du zu ihr sagen: ‹Weißt du noch, jener gesegnete Tag, an dem ich dich bat, die Meine zu werden?›»
Der junge Mann war vom Tisch aufgestanden und reckte ein wenig die Arme. Er ging zum Fenster. «Das ist die Beschreibung eines charmanten Naturells», sagte er.
«O ja, du hast ein charmantes Naturell, darin sehe ich unser Kapital. Wenn ich davon nicht überzeugt gewesen wäre, hätte ich niemals gewagt, dich in dieses schreckliche Land zu bringen.»
«Dieses komische Land, dieses herrliche Land!», rief der junge Mann und brach in lautes Lachen aus.
«Wegen der Frauen, die in den Omnibus klettern?», fragte seine Gefährtin. «Was ist daran so reizvoll?»
«Ich glaube, drinnen sitzt ein sehr gut aussehender Mann», sagte der junge Mann.
«In jedem Omnibus? Sie fahren zu Hunderten vor, und die Männer in diesem Land kommen mir überhaupt nicht ansehnlich vor. Was die Frauen angeht – so viele auf einmal habe ich seit der Klosterschule nicht gesehen.»
«Die Frauen sind sehr hübsch», befand ihr Bruder, «und die ganze Szene ist sehr unterhaltsam. Ich muss sie zeichnen.» Er ging rasch zum Tisch zurück und griff nach seinen Utensilien – einem kleinen Zeichenbrett, einem Blatt Papier und drei oder vier Stiften. Mit diesen Sachen ausgestattet, stellte er sich wieder ans Fenster, blickte hinaus und führte mühelos und geschickt seinen Bleistift. Während er arbeitete, zeigte sein Gesicht ein strahlendes Lächeln. Strahlend ist tatsächlich das richtige Wort für dieses helle Leuchten. Er war achtundzwanzig Jahre alt, klein, zart und wohlproportioniert. Er ähnelte seiner Schwester auffallend, sah aber besser aus: Er war blond, wirkte offen und geistreich, hatte feine Züge und einen kultivierten, dabei keineswegs abgeklärten Gesichtsausdruck, warme blaue Augen, fein gezeichnete, übertrieben gewölbte Brauen (wenn Damen auf die Brauen ihres Liebsten Sonette schrieben, würden sich seine gut als Sujet für ein solches Gedicht eignen) und einen hellen Schnurrbart, der sich wie vom Lüftchen eines ständigen Lächelns bewegt nach oben schnörkelte. Seine Physiognomie hatte etwas Gütiges und zugleich Pittoreskes. Sie war jedoch, wie ich schon angedeutet habe, nicht im Geringsten abgeklärt. In diesem Punkt war das Gesicht des jungen Mannes außergewöhnlich: Es wirkte nicht abgeklärt und weckte doch starkes Vertrauen.
«Achte darauf, dass du viel Schnee draufbringst», sagte seine Schwester. «Bonté divine,6 was für ein Land!»
«Ich werde das Blatt ganz weiß lassen und nur die kleinen, schwarzen Gestalten hineinsetzen», antwortete der junge Mann lachend. «Und ich nenne es – wie heißt dieser Vers bei Keats? – ‹Der Maienmitte erstes Kind›7!»
«Ich kann mich nicht erinnern», sagte die Dame, «dass Mama mir jemals erzählt hätte, es sei hier so gewesen.»
«Mama hat dir nie etwas Unangenehmes erzählt. Und es ist ja auch nicht jeden Tag so. Du wirst sehen, morgen haben wir herrliches Wetter.»
«Qu’en savez-vous?8 Morgen reise ich ab.»
«Wohin denn?»
«Irgendwohin, nur weg von hier. Zurück nach Silberstadt. Ich werde an den Fürsten schreiben.»
Der junge Mann drehte sich kurz um und sah sie an, den Stift noch in der Luft. «Liebe Eugenia», murmelte er, «warst du auf See so glücklich?»
Eugenia stand auf, sie hielt noch immer die Zeichnung in der Hand, die ihr Bruder ihr gegeben hatte. Es war eine kühne, ausdrucksstarke Skizze einer Gruppe von verängstigten Passagieren an Deck eines Dampfers, die sich zusammendrängten und aneinanderklammerten, während das Schiff aus furchterregender Schieflage in ein Wellental kippte. Es war sehr gekonnt gezeichnet und von tragikomischer Kraft. Eugenia warf einen Blick darauf und verzog angewidert das Gesicht. «Wie kannst du nur so hässliche Szenen zeichnen? Am liebsten würde ich es ins Feuer werfen!» Sie schleuderte das Papier beiseite. Der Bruder beobachtete in aller Ruhe, wohin es flog. Es flatterte auf den Boden, und er ließ es dort liegen. Sie trat ans Fenster und kniff sich in die Taille. «Warum machst du mir keine Vorwürfe, warum beschimpfst du mich nicht?», fragte sie. «Dann wäre mir vielleicht wohler. Warum sagst du nicht, du hasst mich, weil ich dich hierhergebracht habe?»
«Weil du es nicht glauben würdest. Ich bewundere dich, liebe Schwester! Ich bin sehr gern hier, und der Ausblick ist reizvoll.»
«Ich weiß nicht, was mich gepackt hat. Ich habe den Kopf verloren», fuhr Eugenia fort.
Der junge Mann strichelte weiter vor sich hin. «Es ist offensichtlich ein höchst merkwürdiges und interessantes Land. Da wir einmal hier sind, habe ich vor, mich daran zu erfreuen.»
Seine Gefährtin wandte sich mit einem ungeduldigen Schritt ab, machte aber sofort wieder kehrt. «Gute Laune ist zweifellos etwas Großartiges», sagte sie, «aber du hast für meinen Geschmack zu viel davon, und ich kann nicht erkennen, was sie dir bisher genutzt hätte.»
Der junge Mann blickte sie mit großen Augen und gehobenen Brauen an, lächelte und tippte sich mit dem Stift an die hübsche Nase. «Sie hat mich glücklich gemacht!»
«Das ist wohl das Mindeste; sonst hat sie aber rein gar nichts bewirkt. Du hast dein Leben lang dem Schicksal bereits für die kleinsten Gunstbeweise gedankt, deshalb hat es sich nie für dich angestrengt.»
«Ein bisschen schon, da es mir doch eine so wunderbare Schwester geschenkt hat.»
«Ich meine es ernst, Felix. Du vergisst, dass ich älter bin als du.»
«Dann eben eine so ältliche Schwester!», versetzte Felix lachend. «Ich hatte gehofft, wir hätten die Ernsthaftigkeit in Europa gelassen.»
«Ich würde mir wünschen, dass du hier zu ihr findest. Denk daran, du bist fast dreißig Jahre alt und weiter nichts als ein unbekannter Bohemien – der mittellose Mitarbeiter einer Illustrierten.»
«Unbekannt zugegeben, aber keineswegs der Bohemien, für den du mich hältst. Und mittellos schon gar nicht! Ich habe hundert Pfund in der Tasche. Und ich habe einen Vertrag über fünfzig Zeichnungen und möchte all unsere Verwandten und deren Verwandte porträtieren, zu hundert Dollar pro Kopf.»
«Du besitzt keinen Ehrgeiz», sagte Eugenia.
«Aber du, liebe Baronin», erwiderte der junge Mann.
Die Baronin schwieg einen Moment und sah hinaus auf den vom Schneeregen verdunkelten Friedhof und die ruckelnden Pferdebahnen. «Ja, ich besitze Ehrgeiz», sagte sie schließlich. «Und mein Ehrgeiz hat mich an diesen entsetzlichen Ort gebracht!» Sie blickte um sich – der Raum hatte etwas unanständig Nacktes, Bett und Fenster hatten keine Vorhänge – und stieß einen leisen, leidenschaftlichen Seufzer aus. «Armseliger Ehrgeiz!», rief sie. Dann warf sie sich auf das Sofa, das neben ihr an der Wand stand, und barg ihr Gesicht in den Händen.
Der Bruder zeichnete immer weiter, rasch und geschickt. Nach einer Weile setzte er sich neben sie und zeigte ihr seine Zeichnung. «Findest du nicht, dass das für einen unbekannten Bohemien ziemlich gut ist?», fragte er. «Ich habe schon wieder fünfzig Franc aus dem Ärmel geschüttelt.»
Eugenia warf einen Blick auf das kleine Bild, das er ihr auf den Schoß gelegt hatte. «Ja, es ist sehr gekonnt», sagte sie. Gleich darauf fuhr sie fort: «Meinst du, unsere Verwandten tun so etwas?»
«Tun was?»
«Steigen in diese Dinger ein und sehen dann so aus?»
Felix überlegte. «Ich weiß es wirklich nicht. Wir werden es schon erfahren.»
«Nein, das ist bei reichen Leuten ausgeschlossen!», sagte die Baronin.
«Bist du so sicher, dass sie reich sind?», fragte Felix leichthin.
Seine Schwester wandte sich langsam um und sah ihn an. «Herr im Himmel!», murmelte sie. «Du kannst vielleicht Sachen sagen!»
«Es wäre sicher wesentlich erfreulicher, wenn sie reich wären», erklärte Felix.
«Glaubst du, ich wäre jemals hierhergekommen, wenn ich nicht wüsste, dass sie reich sind?»
Der junge Mann setzte dem etwas gebieterischen Blick der Schwester seinen eigenen fröhlichen, zufriedenen entgegen. «Ja, es wäre auf jeden Fall erfreulicher», wiederholte er zustimmend.
«Mehr erwarte ich nicht von ihnen», sagte die Baronin. «Ich rechne nicht damit, dass sie klug sind oder freundlich – jedenfalls am Anfang – oder vornehm oder interessant. Aber ich bestehe unbedingt darauf, dass sie reich sind.»
Felix legte den Kopf an die Rückenlehne des Sofas und blickte eine Weile auf den vom Fenster eingerahmten länglichen Himmelsfleck. Es hatte aufgehört zu schneien; ihm schien, als hellte sich der Himmel allmählich auf. «Ich rechne schon damit, dass sie reich sind», sagte er schließlich, «und mächtig und klug und freundlich und vornehm und interessant und überhaupt wunderbar! Tu vas voir.9» Er beugte sich vor und küsste seine Schwester. «Schau!», fuhr er fort. «Noch während meiner Worte hat sich der Himmel golden verfärbt, ein gutes Omen! Es wird noch ein schöner Tag.»
Und tatsächlich, innerhalb von fünf Minuten hatte sich das Wetter geändert. Die Sonne brach durch die Schneewolken und sprang ins Zimmer der Baronin. «Bonté divine», rief die Dame, «was für ein Land!»
«Lass uns ausgehen und die Leute beobachten», sagte Felix.
Kurz darauf brachen sie auf. Es war warm und hell geworden; die Sonne hatte das Pflaster getrocknet. Sie schlenderten aufs Geratewohl durch die Straßen, betrachteten die Passanten und die Häuser, die Geschäfte und die Fahrzeuge, den blitzblauen Himmel und die schlammigen Kreuzungen, die eilenden Männer und die schlendernden Mädchen, die leuchtend roten Backsteine und die hellgrünen Bäume, diese ganze ungewöhnliche Mischung aus Eleganz und Schäbigkeit. Von einer Stunde zur anderen hatte der Tag etwas Frühlingshaftes bekommen; selbst durch das Gewimmel auf den Straßen wehte ein Geruch nach Erde und Blüten. Felix war höchst angetan. Er hatte es ein komisches Land genannt, und mittlerweile lachte er über alles, was er sah. Man könnte sagen, die amerikanische Zivilisation präsentierte sich ihm als ein Gespinst aus famosen Witzen. Es waren wirklich außerordentlich gute Witze, und die Heiterkeit des jungen Mannes hatte etwas Erfreuliches und Anregendes. Er besaß einen Sinn für das sogenannte Pittoreske, und dieser erste Blick auf demokratische Lebensformen weckte in ihm dieselbe Aufmerksamkeit, die er auch den Bewegungen eines lebhaften jungen Menschen mit strahlender Miene geschenkt hätte. Er hätte diese Aufmerksamkeit deutlich, wenn auch höflich zum Ausdruck gebracht, und im vorliegenden Fall hätte Felix als ein unverzagter junger Exilant gelten können, der noch einmal die Lieblingsorte seiner Kindheit aufsucht. Immer wieder blickte er in das grelle Blau des Himmels, in die funkelnde Luft, auf die zusammenhanglosen, vielfältigen Farbflecke.
«Comme c’est bariolé!»,10 sagte er zu seiner Schwester in jener Fremdsprache, zu der es sie offenbar beide gelegentlich auf rätselhafte Weise drängte.
«Ja, das ist wirklich bariolé», antwortete die Baronin. «Ich mag diese Farben nicht, sie tun mir weh.»
«Sie zeigen, wie es ist, wenn Gegensätze aufeinandertreffen», erwiderte der junge Mann. «Anstatt in den Westen zu gelangen, sind wir offenbar nach Osten gereist. Wie hier der Himmel an die Giebel grenzt, das ist genau wie in Kairo; und die roten und blauen Firmenschilder, die quer über allem hängen, erinnern an mohammedanischen Zierrat.»
«Die jungen Frauen sind jedenfalls keine Mohammedanerinnen», sagte seine Gefährtin. «Man kann nicht gerade behaupten, dass sie ihr Gesicht verhüllen. Ich habe noch nie etwas so Dreistes gesehen.»
«Gott sei Dank verhüllen sie es nicht!», rief Felix. «Sie sind ungewöhnlich hübsch.»
«Ja, die Gesichter sind oft hübsch», sagte die Baronin, eine sehr kluge Frau. Sie war zu klug, um nicht genau und scharf zu beobachten. Sie umfasste den Arm ihres Bruders fester als sonst, sie war nicht so heiter gestimmt wie er. Sie sprach wenig, nahm aber vieles in sich auf und dachte darüber nach. Sie war ein wenig aufgeregt; sie spürte, dass sie auf der Suche nach dem Glück tatsächlich in ein fremdes Land gekommen war. Erst einmal empfand sie eine Menge Ärger und Missfallen; die Baronin war ein sehr empfindlicher, heikler Mensch. Früher hatte sie aus Spaß und in glanzvoller Gesellschaft häufig einen Jahrmarkt in einer Provinzstadt besucht. Jetzt hatte sie den Eindruck, auf einen Riesenjahrmarkt geraten zu sein – der Spaß und die Streitereien waren genau dieselben. Sie merkte, dass sie abwechselnd lächelte und zurückzuckte. Das Schauspiel als solches war kurios, aber von einem Augenblick zum nächsten konnte man angerempelt werden. Die Baronin hatte noch nie so viele Menschen herumspazieren sehen, hatte sich noch nie inmitten so vieler unbekannter Menschen aufgehalten. Aber nach und nach spürte sie, dass dieser Jahrmarkt eine ernstere Angelegenheit war. Sie ging mit ihrem Bruder in einen großen öffentlichen Park, der ihr sehr schön erschien, wunderte sich aber, als sie keine Kutschen sah. Der Nachmittag neigte sich dem Ende zu. Das wilde, kräftige Gras und die schlanken Baumstämme wurden vergoldet von den waagrecht einfallenden Sonnenstrahlen – vergoldet wie mit eben erst geschürftem Gold. Es war eigentlich die Stunde, in der die Damen ausfuhren, um frische Luft zu schnappen und mit leicht geneigtem Sonnenschirm an einem Fußgängerspalier vorbeizurollen. Hier jedoch bemerkte Eugenia keinerlei Anzeichen für diesen Brauch, und das erschien ihr umso merkwürdiger, als sich neben einer breiten, belebten Straße höchst verlockend eine reizvolle Allee aus sehr anmutigen, ausladenden Ulmen dahinzog, auf der das prosaische Zufußgehen auch unter den wohlhabenderen Mitgliedern der Bourgeoisie offenbar mehr und mehr um sich griff. Unsere Freunde bogen in diese Promenade mit ihrem schönen Licht ein, und wieder bemerkte Felix eine Menge hübscher Mädchen und machte seine Schwester darauf aufmerksam. Dies war jedoch überflüssig; die Baronin hatte die reizenden jungen Damen schon gemustert.
«Ich habe das sichere Gefühl, dass unsere Cousinen auch so aussehen», sagte Felix.
Das hoffte die Baronin ebenfalls, sprach es jedoch nicht aus. «Sie sind sehr hübsch, aber es sind nur junge Mädchen. Wo sind die Frauen – die dreißigjährigen Frauen?»
«Die dreiunddreißigjährigen, meinst du?», wollte ihr Bruder schon fragen, denn er verstand nicht nur, was sie sagte, sondern wusste oft auch, was unausgesprochen blieb. Stattdessen bewunderte er lauthals die Schönheit des Sonnenuntergangs, während die Baronin, die gekommen war, ihr Glück zu suchen, überlegte, dass es recht vorteilhaft für sie war, wenn es sich bei den Personen, mit denen sie sich messen musste, nur um junge Mädchen handelte. Der Sonnenuntergang war prächtig; sie blieben stehen, um zuzuschauen. Felix erklärte, er habe noch nie ein so hinreißendes Wechselspiel der Farben erlebt. Auch die Baronin fand es herrlich und genoss alles vielleicht umso mehr, als ihr bewusst wurde, welch staunende Aufmerksamkeit sie bei einigen gut aussehenden Passanten erregte, denen die vornehme, apart gekleidete Dame von exotischer Erscheinung auffiel, die da an einer Bostoner Straßenecke auf Französisch die Schönheiten der Natur bewunderte. Eugenias Stimmung hob sich. Sie überließ sich einer Art gelassener Heiterkeit. Sie war gekommen, ihr Glück zu suchen, und es ließ sich offenbar ohne große Mühe finden. In der prächtigen Reinheit des Abendhimmels lag ein Versprechen, im sanften, unaufdringlichen Blick der Vorübergehenden die Andeutung einer Art natürlicher Leichtigkeit aller Dinge.
«Du fährst nicht zurück nach Silberstadt, nicht wahr?», fragte Felix.
«Nicht morgen», sagte die Baronin.
«Und du schreibst auch nicht an den Fürsten?»
«Ich werde ihm schreiben, dass ihn hier offenbar niemand kennt.»
«Das wird er nicht glauben», sagte der junge Mann. «Ich rate dir, lass ihn in Ruhe.»
Felix selbst war weiterhin bester Laune. Wiewohl er in malerischen Städten mit uralten Sitten und Gebräuchen aufgewachsen war, entdeckte er in der kleinen puritanischen Metropole viel Lokalkolorit. Noch am selben Abend verkündete er seiner Schwester nach dem Dinner, er werde am nächsten Tag früh aufbrechen, um die Verwandten aufzusuchen.
«Du bist sehr ungeduldig», sagte Eugenia.
«Das ist nur natürlich», sagte er, «nachdem ich heute all diese hübschen Mädchen gesehen habe. Wenn sich die Cousinen auch als so hübsch erweisen, ist es umso besser, wenn man sie bald kennenlernt.»
«Vielleicht sind sie aber nicht so hübsch», sagte Eugenia. «Wir hätten Empfehlungsbriefe mitbringen sollen – adressiert an andere Leute.»
«Die anderen Leute wären nicht unsere Verwandten.»
«Deswegen müssen sie nicht schlechter sein», antwortete die Baronin.
Der Bruder blickte sie mit hochgezogenen Brauen an. «Der Meinung warst du aber nicht, als du mir vorgeschlagen hast, wir sollten hierherfahren und mit unseren Verwandten Freundschaft schließen. Du fandest, dazu dränge einen doch die natürliche Zuneigung, und als ich mehrere Gegenargumente anführte, meintest du, die Stimme des Blutes müsse alles übertönen.»
«An das alles erinnerst du dich?», fragte die Baronin.
«Lebhaft! Es hat mich sehr gerührt.»
Sie wanderte im Zimmer auf und ab wie schon am Vormittag, dann hielt sie inne und sah ihren Bruder an. Offenbar wollte sie etwas sagen, besann sich aber und ging weiter. Ein Weilchen später sagte sie dann etwas anderes, eine Art Erklärung, warum sie ihren früheren Gedanken unterdrückt hatte. «Du wirst immer ein Kind bleiben, lieber Bruder.»
«Man sollte meinen, dass Sie, Madam, tausend Jahre alt sind», antwortete Felix lachend.
«Das bin ich auch – manchmal», sagte die Baronin.
«Dann ziehe ich also los und setze unsere Verwandtschaft von der Ankunft einer so außerordentlichen Persönlichkeit in Kenntnis. Sie werden sofort kommen und dir ihre Aufwartung machen.»
Wieder durchmaß Eugenia das Zimmer der Länge nach, dann blieb sie vor ihrem Bruder stehen und legte ihm die Hand auf den Arm. «Sie dürfen nicht kommen und mich besuchen», sagte sie. «Das darfst du nicht zulassen. Meine erste Begegnung mit ihnen soll nicht so ablaufen.» Und als Antwort auf seinen fragenden Blick fuhr sie fort: «Du gehst hin, siehst dir alles an und erzählst von uns. Dann kommst du zurück und berichtest mir, wer sie sind und was sie sind, wie viele, welchen Geschlechts und jeweils wie alt – alles. Achte darauf, dass du jede Einzelheit wahrnimmst, du musst mir die Örtlichkeit, das Drum und Dran und – wie soll ich sagen? – die Inszenierung beschreiben können. Dann werde ich sie zu einer mir gelegenen Zeit, einer mir gelegenen Stunde und unter den von mir gewählten Umständen aufsuchen. Ich werde mich vorstellen, werde vor ihnen auftreten!», sagte die Baronin, ihre Absicht diesmal mit einer gewissen Offenheit formulierend.
«Und welche Nachricht soll ich ihnen überbringen?», fragte Felix, für den alle Anordnungen seiner Schwester unanfechtbar waren.
Sie musterte ihn kurz, seine Miene, aus der charmante Wahrheitsliebe sprach, und erwiderte mit jener Unanfechtbarkeit, die er bewunderte: «Sag, was du willst. Erzähle meine Geschichte so, wie es dir am … natürlichsten erscheint.» Und sie hielt ihm die Stirn zum Kuss hin.
2
Der nächste Tag war strahlend schön, wie Felix prophezeit hatte. So wie erst der Winter schlagartig zum Frühling geworden war, hatte sich nun der Frühling schlagartig zum Sommer gewandelt. Dies bemerkte auch das junge Mädchen, das aus einem großen, schlichten Haus mitten auf dem Land trat und durch den großzügigen Garten schlenderte, der das Haus von einer schlammigen Landstraße trennte. Die blühenden Sträucher und regelmäßig angeordneten Pflanzen badeten in einer Fülle von Licht und Wärme; der durchlässige Schatten der großen Ulmen – es waren herrliche Bäume – schien von Stunde zu Stunde dichter zu werden, und die ihr zutiefst vertraute Stille trug willig das Läuten einer fernen Kirchenglocke herüber. Das junge Mädchen lauschte der Glocke, war aber nicht für den Kirchgang gekleidet. Sie war barhäuptig und trug ein weißes Musselinmieder mit einer bestickten Einfassung, der Rock des Kleides war aus farbigem Musselin. Die junge Dame war etwa zwei- oder dreiundzwanzig Jahre alt, und wiewohl eine junge Person ihres Geschlechts, die an einem Sonntagmorgen im Frühling barhäuptig in einem Garten spazieren geht, von Natur aus kein unangenehmer Anblick sein kann, hätte man diese unschuldige Sabbatschänderin nicht gerade als hübsch bezeichnet. Sie war groß und blass, dünn und ein wenig linkisch, das blonde Haar fiel vollkommen glatt herab, und die dunklen Augen wirkten merkwürdigerweise gleichzeitig stumpf und ruhelos und entsprachen damit natürlich so gar nicht dem Idealbild der «schönen Augen», die wir uns immer strahlend und ruhig vorstellen. Die Türen und Fenster des großen Hauses standen weit offen, um den reinigenden Sonnenschein einzulassen, und er legte sich in großzügigen Flecken auf den Boden der breiten, hohen Veranda, die der Villa an zwei Seiten vorgebaut war – einer Veranda, auf der symmetrisch angeordnet Schaukelstühle mit Strohgeflecht und ein halbes Dutzend jener kleinen, zylindrischen Hocker aus grünem und blauem Porzellan standen, die auf eine Beziehung der Bewohner zum fernöstlichen Handel schließen lassen. Es war ein altes Haus – alt insofern, als es achtzig Jahre zählte. Es war aus Holz erbaut, in sauberem, hellem, verblasstem Grau gestrichen und an der Eingangsseite in regelmäßigen Abständen mit flachen, weiß lackierten Holzpilastern verziert. Diese Pfeiler schienen eine Art klassischen Giebel zu tragen, den in der Mitte ein großes, dreigeteiltes Fenster mit verwegen geschnitztem Rahmen und in den beiden Winkeln verglaste runde Öffnungen zierten. Eine große weiße Tür, ausgestattet mit einem auf Hochglanz polierten Messingklopfer, präsentierte sich der ländlich wirkenden Straße, zu der ein breiter, mit abgetretenen und zerbrochenen, aber blitzsauberen Ziegeln gepflasterter Weg führte. Hinter dem Wohnhaus lagen Wiesen und Obstgärten, eine Scheune und ein Teich, und gegenüber, ein Stückchen die Straße hinunter, stand ein kleineres, weiß gestrichenes Haus mit grünen Fensterläden, einem kleinen Garten auf der einen Seite und einem Obstgarten auf der anderen. All dies leuchtete in der Morgenluft, weshalb einem die schlichten Details des Bildes so deutlich ins Auge sprangen wie die einzelnen Posten einer Rechnung.
Nun kam eine zweite junge Dame aus dem Haus, ging über die Veranda hinunter in den Garten und trat zu dem erwähnten jungen Mädchen. Diese zweite junge Dame war ebenfalls dünn und blass, aber älter; sie war kleiner und hatte dunkles, weich fallendes Haar. Ihre Augen glichen nicht denen der anderen, sie waren beweglich und blank, aber keineswegs ruhelos. Sie trug eine Strohhaube mit weißen Bändern und einen langen, roten indischen Schal, der ihr vorn bis zu den Füßen reichte. In der Hand hielt sie einen kleinen Schlüssel.
«Gertrude», sagte sie, «bist du ganz sicher, dass du nicht zur Kirche gehen willst?»
Gertrude sah sie kurz an, riss von einem Flieder einen kleinen Zweig ab, roch daran und warf ihn weg. «Ich bin mir niemals einer Sache ganz sicher!», antwortete sie.
Die andere junge Dame blickte an ihr vorbei zu dem fernen Weiher, der schimmernd zwischen seinen langgezogenen, föhrenbestandenen Ufern lag. Dann sagte sie sehr leise: «Das ist der Schlüssel zum Esszimmerschrank. Es ist besser, du nimmst ihn, falls jemand etwas haben möchte.»
«Wer sollte etwas haben wollen?», fragte Gertrude. «Ich bin allein im Haus.»
«Es könnte jemand kommen», sagte ihre Gefährtin.
«Meinst du Mr. Brand?»
«Ja, Gertrude. Vielleicht möchte er ein Stück Kuchen.»
«Ich mag keine Männer, die immer Kuchen essen!», erklärte Gertrude und zupfte an dem Fliederbusch.
Ihre Gefährtin warf ihr einen Blick zu, dann sah sie auf den Boden. «Ich glaube, Vater erwartet, dass du in die Kirche kommst. Was soll ich ihm sagen?»
«Sag, ich habe arge Kopfschmerzen.»
«Wäre das die Wahrheit?», fragte die Ältere und blickte wieder geradeaus zum Weiher.
«Nein, Charlotte», sagte die jüngere Dame schlicht.
Charlotte verlagerte ihren sanften Blick auf das Gesicht ihrer Gefährtin. «Ich habe den unguten Eindruck, du bist ruhelos.»
«Ich fühle mich wie immer», erwiderte Gertrude im selben Tonfall wie eben.
Charlotte wandte sich ab, blieb aber noch einen Moment stehen. Dann schaute sie an ihrem Kleid nach unten. «Findest du nicht, dass mein Schultertuch irgendwie zu lang ist?», fragte sie.
Gertrude ging halb um sie herum und besah sich das Schultertuch. «Ich glaube, du trägst es nicht richtig», sagte sie.
«Wie soll ich es denn tragen, Liebes?»
«Ich weiß nicht. Anders. Du musst es anders über die Schultern legen, um die Ellbogen. Es muss von hinten anders aussehen.»
«Wie denn?», fragte Charlotte.
«Das kann ich nicht beschreiben», sagte Gertrude und zupfte den Schal hinten ein wenig nach außen. «Bei mir selbst könnte ich es schon machen, aber ich kann es nicht erklären.»
Mit einer Bewegung der Ellbogen straffte Charlotte wieder, was die Berührung ihrer Gefährtin gelockert hatte. «Gut, irgendwann musst du es mir einmal zurechtlegen. Jetzt spielt es keine Rolle. Im Grunde finde ich ohnehin», fügte sie hinzu, «dass es keine Rolle spielt, wie man von hinten aussieht.»
«Ich würde sagen, das spielt sogar die größere Rolle», befand Gertrude. «Da siehst du nämlich nicht, wer dich beobachtet. Du bist nicht auf der Hut. Du kannst nicht versuchen, hübsch auszusehen.»
Charlotte fand diese Erklärung höchst bedenklich. «Ich finde nicht, dass man überhaupt versuchen sollte, hübsch auszusehen», erwiderte sie ernst.
Ihre Gefährtin schwieg. Dann sagte sie: «Na ja, wahrscheinlich hilft es sowieso nicht viel.»
Charlotte sah sie kurz an, dann gab sie ihr einen Kuss. «Ich hoffe, es geht dir besser, wenn wir zurückkommen.»
«Aber es geht mir bestens, liebe Schwester!», sagte Gertrude.
Charlotte ging den breiten Ziegelweg zum Gartentor hinunter; ihre Gefährtin schlenderte langsam zum Haus zurück. Am Törchen kam Charlotte ein junger Mann entgegen, ein großer, blonder junger Mann mit einem Zylinder und Zwirnhandschuhen. Er sah gut aus, wenn er auch ein wenig zu beleibt war. Er lächelte freundlich.
«Oh, Mr. Brand!», rief die junge Dame.
«Ich wollte nachsehen, ob Ihre Schwester nicht in die Kirche gehen will», sagte der junge Mann.
«Sie sagt, sie geht nicht, aber ich bin sehr froh, dass Sie gekommen sind. Ich glaube, wenn Sie ein wenig mit ihr reden würden …» Charlotte senkte die Stimme. «Sie wirkt so unruhig.»
Mr. Brand lächelte aus großer Höhe auf die junge Dame herab. «Ich werde mich sehr gern mit ihr unterhalten. Dafür würde ich fast jedem Gottesdienst fernbleiben, mag er noch so fesselnd sein.»
«Das müssen Sie selbst wissen», sagte Charlotte leise, als könnte ein Einverständnis mit diesem Angebot gefährlich sein. «Aber ich komme noch zu spät.»
«Ich wünsche Ihnen eine angenehme Predigt», sagte der junge Mann.
«O ja, Mr. Gilman ist immer angenehm», antwortete Charlotte. Und sie machte sich auf den Weg.
Mr. Brand trat in den Garten, und als Gertrude das Törchen ins Schloss fallen hörte, drehte sie sich um und schaute ihn an. Ein paar Sekunden sah sie zu, wie er herankam, dann wandte sie sich ab. Doch fast sofort hielt sie wieder inne und stellte sich ihm. Er nahm den Hut ab und wischte sich im Näherkommen die Stirn. Dann setzte er den Hut wieder auf und streckte ihr die Hand entgegen. Ohne den Hut sah man, dass seine Stirn sehr breit und glatt war und das Haar üppig, aber ziemlich farblos. Die Nase war zu groß, der Mund und die Augen waren zu klein, trotzdem war er, wie gesagt, ein ansehnlicher junger Mann. In seinen kleinen, reinblauen Augen lag ein unwiderstehlich sanfter, ernster Ausdruck; er war allem Anschein nach, wie man so sagt, ein Ausbund an Tugend. Während er näher kam, stand das junge Mädchen auf dem Gartenweg und blickte auf seine Zwirnhandschuhe.
«Ich hatte gehofft, Sie würden in die Kirche gehen», sagte er. «Ich wollte Sie begleiten.»
«Ich bin Ihnen sehr verbunden», antwortet Gertrude. «Ich gehe nicht in die Kirche.»
Sie hatte ihm die Hand gegeben, und er hielt sie einen Moment fest. «Haben Sie einen besonderen Grund dafür?»
«Ja, Mr. Brand», sagte das junge Mädchen.
«Darf ich fragen, welchen?»
Sie sah ihn lächelnd an, und in ihrem Lächeln lag, wie ich schon angedeutet habe, eine gewisse Stumpfheit. Doch mischte sich in diese Stumpfheit etwas Süßes, Vieldeutiges. «Weil der Himmel so blau ist!», sagte sie.





























