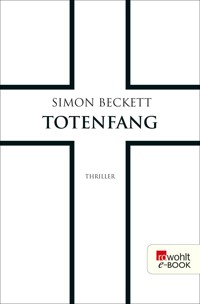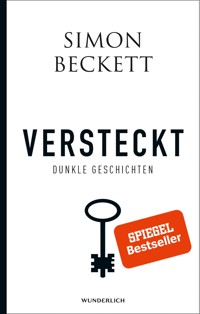9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Krimi
- Serie: David Hunter
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Nur Fledermäuse verirren sich noch nach St. Jude. Das stillgelegte Krankenhaus im Norden Londons, seit Jahren verlassen und heruntergekommen, soll in Kürze abgerissen werden. Doch dann wird auf dem staubigen Dachboden eine Leiche aufgefunden, eingewickelt in eine Plastikhülle. Die Leiche, das sieht Dr. David Hunter sofort, liegt schon seit langer Zeit hier. Durch das trockene und stickige Klima ist der Körper teilweise mumifiziert. Als der forensische Anthropologe sie näher untersucht, stellt er fest, dass es sich um eine Frau handelt. Eine schwangere Frau. Beim Versuch, die Tote zu bergen, entdeckt die Polizei ein fensterloses Krankenzimmer, das nicht auf den Plänen verzeichnet ist. Warum wusste niemand von der Existenz dieses Raumes? Und warum wurde der Eingang zugemauert, obwohl dort nach wie vor Krankenbetten stehen? Betten, in denen noch jemand liegt…
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 574
Ähnliche
Simon Beckett
Die ewigen Toten
Thriller
Aus dem Englischen von Karen Witthuhn und Sabine Längsfeld
Über dieses Buch
Es war ein guter Sommer für Dr. David Hunter. Als forensischer Berater der Polizei ist er endlich wieder gefragt, und auch mit seiner Freundin Rachel läuft es bestens. Einzig ihre bevorstehende Abreise zu einem Forschungsaufenthalt in Griechenland trübt die Stimmung.
Ausgerechnet an ihrem letzten gemeinsamen Abend kommt der Anruf: Die Polizei hat unter dem Dach eines stillgelegten Krankenhauses im Norden Londons eine Leiche aufgefunden, eingewickelt in eine Plastikhülle. Das Krankenhaus St. Jude, seit Jahren verlassen und heruntergekommen, soll in Kürze abgerissen werden, um in der gentrifizierten Gegend Baugrund zu schaffen.
Die Leiche, das sieht der forensische Anthropologe sofort, liegt schon seit langer Zeit auf dem verwinkelten Dachboden von St. Jude. Durch das staubige und stickige Klima ist der Körper teilweise mumifiziert. Als Hunter die Leiche näher untersucht, stellt er fest, dass es sich um eine Frau handelt. Eine schwangere Frau.
Beim Versuch, die Tote zu bergen, bricht der Boden des baufälligen Hauses ein, wobei ein Polizist in das darunterliegende Stockwerk fällt, in ein Krankenzimmer, das nicht auf den Plänen verzeichnet ist. Warum wusste niemand von der Existenz dieses Raumes? Und warum hat jemand den Eingang zugemauert, obwohl dort nach wie vor Krankenbetten stehen? Betten, in denen noch jemand liegt …
Je tiefer David Hunter in die Vergangenheit des Krankenhauses eindringt, desto mehr düstere Geheimnisse kommen ans Licht. Und bald ist klar, dass St. Jude noch lange nicht sein letztes Opfer gefordert hat.
«Becketts Psychothriller sind so unglaublich spannend, dass man mit klopfendem Herzen dasitzt und bei jedem kleinsten Geräusch aufschreckt.» Stern.de
«Ein höchst spannender Thriller, dessen fein ausgeklügelte Dramaturgie die Geschichte schlüssig trägt.» Hamburger Abendblatt
«Simon Beckett ist einer der zurzeit spannendsten Krimiautoren.» HR Online
«Einfach grandios! Simon Becketts Thriller machen süchtig.» BILD am Sonntag
Vita
Simon Beckett ist einer der erfolgreichsten englischen Thrillerautoren. Seine Serie um den forensischen Anthropologen David Hunter wird rund um den Globus gelesen: «Die Chemie des Todes», «Kalte Asche», «Leichenblässe», «Verwesung» und «Totenfang» waren allesamt Bestseller. «Die ewigen Toten», Teil 6 der Reihe, erreichte Platz 1 der Bestsellerliste, ebenso wie sein atmosphärischer Psychothriller «Der Hof». Simon Beckett ist verheiratet und lebt in Sheffield.
Karen Witthuhn übersetzt nach einem ersten Leben im Theater seit 2000 Theatertexte und Romane, u.a. von Simon Beckett, D.B. John, Ken Bruen, Sam Hawken, Percival Everett, Anita Nair, Alan Carter und George Pelecanos. 2015 und 2018 erhielt sie Arbeitsstipendien des Deutschen Übersetzerfonds.
Sabine Längsfeld übersetzt bereits in zweiter Generation Literatur verschiedenster Genres aus dem Englischen in ihre Muttersprache. Zu den von ihr übertragenen AutorInnen zählen Anna McPartlin, Sara Gruen, Glennon Doyle, Malala Yousafzai, Roddy Doyle und Simon Beckett.
Für meinen Vater, Frank Beckett, der die Dinge immer in die richtige Perspektive gebracht hat.
Juli 1929–April 2018
Kapitel 1
Die meisten Menschen glauben zu wissen, wie Verwesung riecht. Sie denken, der Geruch wäre markant, unverwechselbar, der faulige Gestank des Grabes.
Sie irren sich.
Der Verwesungsvorgang ist kompliziert. Bis aus einem einst lebendigen Organismus ein Skelett wird, bis nichts als trockene Knochen und Mineralien bleiben, spielen sich komplexe biochemische Prozesse ab. Einige der dabei entstehenden Gase werden vom menschlichen Geruchssinn als widerwärtig wahrgenommen, doch sie sind nur ein Teil des olfaktorischen Menüs. Ein verwesender Körper produziert Hunderte von flüchtigen organischen Verbindungen, jede mit eigenen Merkmalen. Viele davon – besonders jene, die etwa nach der Hälfte des Verwesungsprozesses auftreten und mit Fäulnis und Aufblähung einhergehen – sind für die Nase tatsächlich nur schwer zu ertragen. Dimethyltrisulfide beispielsweise erinnern an vergammelten Kohl. Buttersäure und Trimethylamin riechen nach Erbrochenem und altem Fisch. Eine andere Substanz, Indol, stinkt, wenn sie hochkonzentriert ist, nach Fäkalien. Doch in geringeren Mengen hat Indol einen zarten, blumigen Duft, der von Parfümherstellern sehr geschätzt wird. Hexanal, ein Gas, das in den frühen wie den späteren Verwesungsstufen auftritt, ähnelt frisch gemähtem Gras, und Butanol duftet nach herbstlichen Blättern.
Der Geruch von Verwesung kann all diese Noten enthalten, er ist komplex wie edler Wein. Und da der Tod voller Überraschungen ist, kann er sich mitunter auch auf ganz andere Weise ankündigen.
«Passen Sie auf, wo Sie hintreten, Dr. Hunter», warnte DI Whelan, der vor mir herging. «Ein Schritt neben die Platten, und Sie brechen durch die Decke.»
Das brauchte er mir nicht zu sagen. Ich duckte mich unter einem niedrigen Balken hindurch und setzte meine Schritte behutsam. Der große Dachboden war wie eine Sauna, die Hitze des Tages staute sich unter dem Schieferdach. Durch die Maske vor meinem Gesicht bekam ich kaum Luft. Das Gummiband der Kapuze an meinem Schutzanzug schnitt mir in die Haut, und meine Hände in den engen Nitril-Handschuhen waren feucht und heiß. Als ich mir den Schweiß aus den Augen wischen wollte, rieb ich ihn erst richtig hinein.
Der riesige Dachboden des alten Krankenhauses erstreckte sich vor mir in alle Richtungen und verlor sich jenseits der Lichtkegel der aufgestellten Lampen in tiefer Dunkelheit. Aus Aluminiumplatten hatte man einen Laufsteg gelegt, der sich unter unserem Gewicht bog und schwankte.
Ich hoffte bloß, die Dachbalken darunter waren stabil genug.
«Kennen Sie diesen Teil von London?», fragte Whelan über die Schulter hinweg. Der Dialekt des Detective Inspector verriet, dass seine Wurzeln eher im hohen Norden lagen als hier – näher an der Tyne als an der Themse. Er war ein bärtiger, untersetzter Mann in den Vierzigern, dessen dickes graues Haar bei unserer Begrüßung verschwitzt und platt gedrückt gewesen war. Jetzt war sein Gesicht hinter der Maske kaum noch zu sehen.
«Nicht wirklich.»
«In diese Gegend kommt man nicht ohne guten Grund. Und dann nur, wenn sich’s nicht vermeiden lässt.» Er bückte sich unter einem schrägen Dachbalken hindurch. «Vorsicht mit dem Kopf.»
Ich machte es ihm nach. Trotz der Laufstege kamen wir nur langsam voran. Über unseren Köpfen verliefen kreuz und quer Balken, wer sich nicht tief genug bückte, stieß sich den Kopf, während sich in Knöchelhöhe alte Leitungen um die Dachträger wanden, die einem unvorsichtig gesetzten Fuß leicht zur Falle werden konnten. Hier und da ragten scheinbar willkürlich eingebaute, rußgeschwärzte Ziegelschornsteine vor uns auf und versperrten den direkten Weg, sodass die Platten um sie herum hatten gelegt werden müssen.
Ich wischte mir eine Spinnwebe aus dem Gesicht. Wie zerrissene Theatervorhänge hingen sie schmutzverklebt von den Dachbalken. Alles hier oben war von Staub überzogen, die früher gelbe Isolierung zwischen den Trägern hatte sich in eine dreckige, braune Matte verwandelt. Staubpartikel wirbelten durch die Luft, glänzten in dem hellen Licht. Meine Augen juckten, trotz der Maske schmeckte ich Staub im Mund.
Als über mir etwas durch die Luft schoss – ich fühlte es mehr, als dass ich es sah –, duckte ich mich. Erkennen konnte ich in der Dunkelheit nichts. Ich verbuchte es unter Einbildung und konzentrierte mich wieder darauf, wohin ich meine Füße setzte.
Ein Stück vor uns kündigte ein Lichtkreis unser Ziel an. Unter grellen Flutlampen standen um einen Schornstein herum weißgekleidete Gestalten auf einer Insel aus Trittplatten. Leises Gemurmel drang zu uns herüber, von den Masken gedämpft. Ein Tatortermittler machte Fotos von etwas, das auf dem Boden lag.
Whelan hielt vor der Gruppe an. «Ma’am? Der forensische Anthropologe ist da.»
Eine Gestalt wandte sich mir zu. Der über der Maske sichtbare Teil des Gesichts war gerötet und glänzte vor Schweiß. Ob in dem sackartigen Schutzanzug ein Mann oder eine Frau steckte, wäre schwer zu sagen gewesen, wenn ich es nicht bereits gewusst hätte, denn wir arbeiteten nicht zum ersten Mal zusammen. Jetzt sah ich auch, dass die Gruppe um einen in Plastik eingewickelten Gegenstand herumstand, einem zusammengerollten Teppich ähnlich. An einem Ende war die Plastikplane teilweise abgezogen.
Darunter karamellfarbene Haut, straff über die Wangenknochen gezogen, und leere Augenhöhlen. Das Gesicht einer Mumie.
Derart abgelenkt bemerkte ich den niedrigen Dachbalken erst, als ich mir daran heftig den Schädel stieß und mir auf die Zunge biss.
«Vorsicht», sagte Whelan.
Eher verlegen als verletzt rieb ich mir den Kopf. Toller Einstieg. Ein halbes Dutzend Augenpaare sah mich über Masken hinweg ausdruckslos an. Nur die von Whelan angesprochene Frau amüsierte sich, wie die Lachfältchen um ihre Augen verrieten.
«Willkommen im St. Jude», sagte Detective Chief Inspector Sharon Ward.
Zwölf Stunden zuvor war ich aus einem Albtraum aufgewacht, hatte kerzengerade im Bett gesessen und nicht gewusst, wo ich war. Automatisch hatte ich die Hand auf den Bauch gelegt und erwartet, klebriges Blut zu spüren. Doch meine Haut war trocken, nur eine lange verheilte Narbe war zu fühlen.
«Alles in Ordnung?»
Rachel stützte sich auf den Ellbogen und legte besorgt die Hand auf meine Brust. Durch die schweren Vorhänge sickerte Tageslicht in ein Zimmer, das langsam erkennbare Formen annahm.
Ich nickte und atmete tief ein und aus. «Tut mir leid.»
«Wieder ein schlimmer Traum?»
Erinnerungen an Blutspritzer und ein in der Sonne glitzerndes Messer blitzten in mir auf. «Nicht allzu schlimm. Habe ich dich geweckt?»
«Mich und alle anderen.» Sie lächelte über meinen Gesichtsausdruck. «War nur Spaß. Du hast dich hin und her geworfen, laut warst du nicht. War es wieder derselbe Traum?»
«Ich kann mich nicht erinnern. Wie spät ist es?»
«Kurz nach sieben. Ich wollte gerade aufstehen und Kaffee kochen.»
Die Überreste meines Albtraums klebten immer noch wie kalter Schweiß an mir, als ich die Beine aus dem Bett schwang. «Lass nur, ich mache das.»
Ich zog mich an und schloss sanft die Zimmertür hinter mir. Sobald ich allein im Flur war, verflog mein Lächeln. Ich atmete tief durch und versuchte, die Nachwehen des Traums abzuschütteln. Das ist nicht die Realität.
Diesmal nicht.
Im Haus regte sich noch nichts, die frühmorgendliche Ruhe vor einem neuen Tag. Das schwere Ticken einer Standuhr durchbrach die Stille, als ich leise die Treppe hinunterstieg. Der dicke Teppich des Flurs wurde von Schieferfliesen abgelöst, angenehm kühl unter meinen bloßen Füßen. In der Luft hing noch die Wärme des gestrigen Tages, aber die Steinwände des alten Hauses hielten ansonsten die Hitze des Altweibersommers ab.
Ich setzte Kaffee auf, dann holte ich mir ein Glas Wasser, ging damit zum Fenster und trank mit Blick auf den Garten und die grünen Felder. Aus einem unwirklich blauen Himmel strahlte die Sonne herab. In der Ferne grasten Schafe, daneben lag ein kleines Waldstück, die Blätter an den Bäumen waren bereits rötlich eingefärbt, bald würden sie fallen. Die Landschaft sah wie ein Kalenderfoto aus, an einem solchen Ort konnte nichts Schlimmes geschehen.
Das hatte ich von anderen Orten auch gedacht.
Jason hatte diesen Zweitwohnsitz als Cottage bezeichnet. Verglichen mit seinem Haus in London, einer riesigen Villa in Belsize Park, mochte das stimmen, war aber eine ziemliche Untertreibung für dieses weitläufige, alte, aus honigfarbenen Cotswold-Steinen gebaute Haus mit Reetdach, das sich gut auf der Titelseite einer Zeitschrift gemacht hätte. Es lag am Rand eines hübschen Dorfes, dessen Pub einen Michelin-Stern vorweisen konnte und dessen enge Hauptstraße jedes Wochenende von Range Rovern, diversen Mercedes-Modellen und BMWs verstopft war.
Als Jason und Anja uns zu einem langen Wochenende einluden, hatte ich zunächst befürchtet, es könnte unbehaglich werden. Die beiden waren vor dem Tod meiner Frau und meiner Tochter meine engsten Freunde gewesen. Ich hatte Kara bei ihnen auf einer Party kennengelernt, sie waren Alice’ Paten geworden, ich war Patenonkel ihrer Tochter Mia. Ich war froh, dass die beiden sich nun mit Rachel so gut verstanden, aber gelegentlich ein gemeinsamer Drink oder ein Abendessen waren etwas anderes, als mehrere Tage miteinander zu verbringen. Rachel und ich hatten uns erst in diesem Jahr kennengelernt, bei einer traumatischen Mordermittlung in den Küstenmarschen von Essex. Ich machte mir Sorgen, dass es seltsam werden könnte, sie mit zu Freunden aus meinem alten Leben zu nehmen, dass sie sich wegen meiner gemeinsamen Vergangenheit mit Jason und Anja ausgeschlossen fühlen könnte.
Aber alles war gutgegangen. Wenn sich doch ab und an ein merkwürdiges Gefühl von Fremdheit einstellte und sich das alte Leben beunruhigend über das neue zu legen schien, dann hielt das nie lange an. Wir hatten das Wochenende mit langen Spaziergängen über die Felder der Cotswolds, ausgedehnten Mittagessen im Pub und entspannten Abenden verbracht. Es war in jeder Hinsicht eine idyllische Zeit gewesen.
Bis zu dem Albtraum.
Hinter mir hatte der Kaffee zu blubbern begonnen und füllte die Küche mit seinem Duft. Ich schenkte gerade zwei Tassen ein, als ich die Treppe knarren hörte. Jemand kam mit schweren Schritten nach unten, und ich wusste ohne mich umzudrehen, dass es Jason war.
«Morgen.» Verschlafen und zerknautscht kam er in die Küche geschlurft. «Du bist früh auf.»
«Ich habe gedacht, ich koche schon mal Kaffee. Hoffe, das ist okay.»
«Solange ich was davon abkriege.»
Er ließ sich auf einen Stuhl an der Kücheninsel plumpsen und unternahm den halbherzigen Versuch, den Frotteebademantel um seinen massigen Körper zu wickeln, gab aber rasch auf. Dunkles, fellähnliches Brusthaar zog sich bis zur Rasierlinie an seinem Hals hoch. Das stoppelige Gesicht und dünner werdende Haupthaar schienen zu einem anderen Körper zu gehören.
Er nahm den Kaffee mit einem dankbaren Grunzen entgegen. Wir kannten uns seit unserer Zeit als Medizinstudenten, lange bevor mein Leben eine ganz andere Richtung genommen hatte. Anstatt Arzt zu werden, hatte ich mich für eine Karriere als forensischer Anthropologe entschieden, die zwischendurch oft turbulent gewesen war, während aus Jason ein erfolgreicher Orthopäde geworden war, der sich einen Zweitwohnsitz in den Cotswolds leisten konnte. Auch in jüngeren Jahren war er nie ein Morgenmensch gewesen, nichts hatte das geändert. Schon gar nicht der Wein vom Vorabend.
Er trank einen Schluck Kaffee und verzog das Gesicht. «Du hast vermutlich keinen Tipp gegen Kater?»
«Trink nicht so viel.»
«Guter Witz.» Er nahm einen weiteren Schluck. «Wann wollt ihr losfahren, Rachel und du?»
«Erst heute Nachmittag.»
Wir waren in meinem «neuen» Auto aus London gekommen, einem gebrauchten, aber verlässlichen Allradwagen, und mussten erst am Abend zurück sein. Aber der Hinweis, dass das Wochenende fast vorbei war – und der Gedanke an den nächsten Tag –, verursachten in mir ein hohles Gefühl.
«Wann fliegt Rachel morgen?», fragte Jason, als hätte er meine Gedanken gelesen.
«Am späten Vormittag.»
Er musterte mich. «Mit dir alles in Ordnung?»
«Klar.»
«Es ist nur für ein paar Monate. Das werdet ihr überstehen.»
«Ich weiß.»
Er betrachtete mich einen Moment länger, ließ es aber dabei bewenden. Mit einem Stöhnen ging er zu einer Schublade und nahm eine Schachtel Paracetamol heraus. Seine fleischigen Finger drückten routiniert zwei Tabletten aus der Folie.
«Verdammt, mein Kopf», sagte er, holte eine Flasche Mineralwasser aus dem Kühlschrank und öffnete sie. Er spülte die beiden Tabletten hinunter und warf mir einen säuerlichen Blick zu. «Spar’s dir.»
«Ich habe kein Wort gesagt.»
«Brauchst du auch nicht.» Er machte eine Geste. «Na los, raus damit.»
«Wozu? Ich kann dir nichts sagen, was du nicht selber weißt.»
Bereits als Student war Jason ein Mann mit großem Appetit gewesen. Doch jetzt war er in ein Alter gekommen, in dem die Maßlosigkeit ihren Tribut forderte. Schon früher war er korpulent gewesen, hatte seitdem noch mehr zugenommen, das Gesicht war aufgedunsen und hatte eine ungesunde Farbe. Aber da wir unsere Freundschaft nach mehreren Jahren gerade erst wieder aufleben ließen, hielt ich es für unangemessen, das Thema anzusprechen. Ich war froh, dass er es nun von sich aus tat.
«Bei der Arbeit herrscht viel Druck.» Er zuckte die Achseln und starrte aus dem Fenster. «Budgetkürzungen, Wartezeiten. Das reine Chaos. Manchmal denke ich, du hast es richtig gemacht, als du damals gegangen bist.»
Ich sah mich in der wunderschön eingerichteten Küche um. «Allzu schlecht hast du es nicht getroffen.»
«Du weißt, was ich meine. Alles in allem treibe ich es wohl hin und wieder etwas zu heftig, aber ich nehme ja kein Kokain oder so.»
«Dafür sind deine Patienten sicher dankbar.»
«Zumindest sind sie nicht tot.»
Das Geplänkel schien ihn zu beleben. Er rieb sich den Bauch und ging zum Kühlschrank.
«Lust auf ein Sandwich mit gebrutzeltem Schinkenspeck?»
Nach dem Mittagessen machten Rachel und ich uns auf den Weg. Jason hatte einen Sonntagsbraten aufgetischt, eine zarte, perfekt zubereitete Rinderlende, und Anja hatte zum Nachtisch eine Meringue gebacken. Hinterher bestand sie darauf, dass wir etwas mitnahmen, auch von dem Fleisch.
«Dann müsst ihr nicht einkaufen gehen», beharrte sie, als ich ablehnen wollte. «Ich kenne dich, David. Sobald Rachel weg ist, denkst du nicht mehr ans Essen oder nimmst, was gerade im Kühlschrank ist. Du kannst nicht nur von Omelette leben.»
«Ich lebe nicht nur von Omelette.» Nicht mal in meinen eigenen Ohren klang ich besonders überzeugend.
Anja lächelte milde. «Dann kannst du ja ruhig was mitnehmen.»
Auf der Rückfahrt nach London waren Rachel und ich sehr still. Es war ein herrlicher Abend, die Hügel der Cotswolds schimmerten grün und golden, die Bäume verfärbten sich rotbraun, der Herbst nahte. Doch der Gedanke an ihre Abreise am nächsten Tag verdarb uns die Freude.
«Es sind nur drei Monate», sagte Rachel plötzlich, als würde sie einen Dialog fortsetzen. «Und Griechenland ist nicht weit weg.»
«Ich weiß.»
Weit genug, fand ich, aber ich wusste, was sie meinte. Im Sommer hatte sie schon die Chance ausgeschlagen, in ihren alten Job als Meeresbiologin in Australien zurückzukehren. Sie war geblieben, um mit mir zusammen zu sein, daher konnte ich mich über die zeitlich begrenzte Forschungsstelle im ägäischen Meeresschutzgebiet kaum beklagen.
«Es sind nur vier Stunden Flug. Du kannst jederzeit vorbeikommen.»
«Rachel, es ist alles gut. Wirklich.» Wir hatten besprochen, dass sie sich ohne Ablenkung auf die Arbeit konzentrieren sollte. «Das ist dein Beruf, du musst das machen. Wir sehen uns in ein paar Wochen wieder.»
«Ich weiß. Aber ich hasse den Abschied.»
Mir ging es genauso. Meine Vermutung war, dass Jason und Anja – vor allem wohl Anja – uns übers Wochenende eingeladen hatten, um uns vom Trennungsschmerz abzulenken.
Das war jetzt nicht mehr möglich. Rachel durchsuchte die wenigen CDs, die ich im Auto hatte. «Wie wäre es damit? Jimmy Smith, The Cat?»
«Vielleicht lieber was anderes.»
Sie gab die Suche schnell auf und stellte das Radio an. Für den Rest der Fahrt überdeckte eine Sendung über Alpakazucht das Schweigen. Die Felder gingen in Vorortsiedlungen über, dann folgten die hohen Betonklötze und Backsteinbauten der Stadt. Ich widerstand dem Drang, zu meiner alten Wohnung in East London zu fahren. Schon seit dem frühen Sommer wohnte ich dort nicht mehr, trotzdem war es seltsam, woanders hinzufahren.
Ich bog in eine von Bäumen gesäumte, stille Seitenstraße ab und fuhr an weiß getünchten Villen inmitten grüner Gärten vorbei, auf einen modernen Wohnblock zu, der hier wie hineingebeamt wirkte. Ballard Court, in den siebziger Jahren errichtet, war ein zehnstöckiges Gebäude aus Ecken, Kanten und Beton, in dessen Rauchglasfenstern sich eine abgetönte Version des Abendhimmels spiegelte. Ein bedeutendes Werk des Brutalismus, wie mir gesagt worden war, tatsächlich hatte es etwas ziemlich Brutales an sich, fand ich.
Vielleicht wollte ich mich deshalb nicht an das Leben dort gewöhnen.
Ich hielt am Tor und gab den Code ins Keypad ein. Während das Tor sich langsam aufschob, schaute ich ohne Begeisterung an den gestaffelten Balkons entlang nach oben, bis ich merkte, dass Rachel mich musterte.
«Was ist?»
«Nichts.» Doch ihr Mund war zu einem halben Lächeln verzogen.
Hinter dem Tor musste ich erneut warten, bis die Tür zur Tiefgarage aufging, und fuhr auf den mir zugeteilten Parkplatz. Nachdem ich einmal versehentlich an falscher Stelle geparkt hatte, war ich von der Verwaltung schriftlich verwarnt worden.
Ballard Court hatte viele Regeln.
Wir nahmen den Aufzug in den fünften Stock. Am Haupteingang gab es eine Rezeption mit Concierge, doch da nur Bewohner Zugang zur Tiefgarage hatten, fuhren die Aufzüge direkt zu den Stockwerken hoch. Die Tür glitt auf, dahinter lag der breite Korridor mit den nummerierten Teakholztüren. Ich fühlte mich dort immer an ein Hotel erinnert, ein Eindruck, den der leichte Pfefferminzgeruch, der permanent in der Luft zu hängen schien, verstärkte.
Unsere Schritte hallten über den Marmorboden. Ich schob die schwere Tür meines Apartments auf, ließ Rachel eintreten, langsam schwang die Tür hinter uns zu und fiel mit einem leisen Klick ins Schloss. Der mit Teppich ausgelegte Flur führte in die große Küche, hinter einem Türbogen folgte ein offenes Wohn- und Esszimmer, in dem derselbe schallschluckende Teppich wie im Flur verlegt worden war, farblich perfekt auf die Terrakottafliesen in der Küche abgestimmt. An den Wänden hingen abstrakte Gemälde, und in dem mokkafarbenen Ledersofa konnte man ertrinken. Ein sehr schönes Apartment und nicht zu vergleichen mit der bescheidenen Erdgeschosswohnung, in der ich vorher gewohnt hatte.
Ich hasste es.
Jason hatte das Ganze eingefädelt. Ein Arztkollege aus seinem Krankenhaus war für ein halbes Jahr nach Kanada gegangen und wollte seine Wohnung nicht leerstehen lassen. Aber über einen Makler wollte er sie auch nicht vermieten, und da ich – widerwillig – aus meinem alten Zuhause hatte ausziehen müssen, fand Jason, wir würden uns gegenseitig einen Gefallen tun. Die Miete war lächerlich niedrig, vermutlich hatte Jason damit ebenfalls etwas zu tun, auch wenn er es vehement abstritt. Lange hatte ich gezögert, bis Rachel sich zu Wort meldete. In meiner alten Wohnung wäre ich nicht sicher, hatte sie argumentiert, und ihre grünen Augen hatten wütend gefunkelt. Ich war dort schon einmal angegriffen worden und fast gestorben: Wollte ich wirklich die Empfehlung der Polizei ignorieren und aus irgendeinem trotzigen Stolz heraus mein Leben aufs Spiel setzen?
Sie hatte recht.
Vor einigen Jahren hatte mich eine Frau namens Grace Strachan mit einem Messer angegriffen, fast wäre ich vor meiner eigenen Haustür verblutet. Eine psychotische Gewalttäterin, die mich für den Tod ihres Bruders verantwortlich machte. Danach war sie verschwunden und nie wieder gesehen worden. Die Wunden waren nur langsam verheilt – vor allem die psychischen –, doch im Laufe der Zeit hatte ich zu glauben begonnen, dass die Gefahr vorüber wäre. Ein dermaßen labiler Mensch hätte nie ohne fremde Hilfe so lange von der Bildfläche verschwinden können. Irgendwann war ich sicher gewesen, dass sie nicht mehr lebte oder zumindest nicht mehr im Land war. Sondern irgendwo, wo sie keine Gefahr darstellte.
Dann vor ein paar Monaten, als ich mich wegen einer Mordermittlung in Essex aufhielt, hatte die Polizei nach einem versuchten Einbruch in meiner Wohnung einen Fingerabdruck von ihr sichergestellt. Wie lange er schon dort gewesen war, ließ sich nicht ermitteln, eventuell war er nach dem Messerangriff übersehen worden. Doch es war genauso gut möglich, dass Grace zurückgekehrt war, um mich zu töten.
Trotzdem war ich nur widerwillig ausgezogen. Zu der Wohnung selbst hatte ich keine große emotionale Verbindung – Graces Mordversuch und eine gescheiterte Beziehung prägten die Erinnerungen an die Zeit dort –, doch ich wollte selbst entscheiden, wann ich auszog. So fühlte es sich nach Flucht an.
Am Ende überzeugten mich weder der Rat der Polizei noch irgendein spät einsetzender Überlebenswille. Sondern die Tatsache, dass auch Rachel sich in der Wohnung aufhielt.
Ich setzte nicht nur mein Leben aufs Spiel.
Also zog ich um nach Ballard Court, wo ich nicht gemeldet war und dessen Sicherheitssysteme, elektronischen Türen und Tiefgarage Rachel und die Polizei beruhigten. Wenn Grace Strachan wirklich wieder da war, wenn sie irgendwie herausbekommen hatte, dass ich noch lebte, würde es ihr sehr schwerfallen, mich zu finden, und erst recht, an mich heranzukommen.
Seit dem Fingerabdruck hatte es jedoch keine Spur mehr von ihr gegeben. Anfänglich hatte die Polizei meine Wohnung überwacht, die leerstand, weil ich sie weder verkaufen noch vermieten wollte, solange die Möglichkeit bestand, dass jemand dort zu Schaden kam. Aber im Laufe der Wochen waren die Maßnahmen zurückgefahren worden. Inzwischen war ich überzeugt, dass alles nur falscher Alarm gewesen war, und hatte beschlossen, zurück in mein Erdgeschoss zu ziehen, sobald meine Zeit im sicheren, aber seelenlosen Ballard Court abgelaufen war. Ich musste Rachel meinen Entschluss noch mitteilen, fand aber, dafür wäre später noch Zeit. Ich wollte uns den letzten Abend nicht verderben.
Das übernahm jemand anders.
Während wir das Abendbrot vorbereiteten und fest entschlossen so taten, als wäre nichts, klingelte mein Handy. Die Abendsonne schien golden durchs Fenster und warf lange Schatten. Ich hatte nicht mit einem Anruf gerechnet und keine Ahnung, wer mich am Sonntagabend sprechen wollte. Als ich zum Handy griff, zog sie eine Augenbraue hoch, sagte aber nichts. Auf dem Display stand Sharon Ward.
Ich sah Rachel an. «Es ist beruflich», sagte ich. «Ich muss da nicht drangehen.»
Ihr Lächeln zog Fältchen um ihre Augenwinkel, doch bevor sie sich abwandte, sah ich etwas in ihrem Blick, das ich nicht lesen konnte.
«Doch, musst du», sagte sie.
Kapitel 2
Die meisten Menschen finden meinen Beruf vermutlich seltsam, geradezu makaber. Ich verbringe mehr Zeit mit den Toten als mit den Lebenden und untersuche Verwesung und Zerfall, um menschliche Überreste zu identifizieren und zu verstehen, was sie in diesen Zustand gebracht haben könnte.
Das ist eine oft düstere, aber wichtige Tätigkeit, und als ich Wards Namen auf meinem Display las, wusste ich sofort, was das zu bedeuten hatte. Bei unserer ersten Zusammenarbeit war sie noch Detective Inspector gewesen, damals war – buchstäblich auf meiner Türschwelle – ein Körperteil abgelegt worden. Aber vor kurzem war sie zur DCI befördert worden und leitete eines der Mordermittlungsteams der Metropolitan Police. Wenn sie am Sonntagabend anrief, dann nicht, um mit mir zu plaudern.
Dass mich das kaum beunruhigte, zeigte, wie sorglos ich geworden war. Ward war es gewesen, die mich vor einigen Monaten informiert hatte, dass der Fingerabdruck in meiner Wohnung von Grace Strachan stammte. Seitdem hatte sie mich über den Fortgang der Fahndung auf dem Laufenden gehalten. Oder vielmehr über deren Stillstand. Es wäre mir nicht in den Sinn gekommen, dass sie jetzt aus anderen als beruflichen Gründen anrufen könnte.
Und so war es auch. Auf dem Dachboden eines ehemaligen Krankenhauses in Blakenheath in North London war eine Leiche gefunden worden. Das alte Gebäude stand seit Jahren leer und wurde von Drogenabhängigen und Obdachlosen als Unterschlupf genutzt. Die unbekannte Person war schon seit einiger Zeit tot, der schlechte Zustand der Leiche machte die Anwesenheit eines forensischen Anthropologen erforderlich. Ob ich vorbeikommen und einen Blick darauf werfen könnte?
Ich sagte zu.
Natürlich hatte ich den letzten Abend mit Rachel anders verbringen wollen. Schließlich würden wir uns drei Monate lang nicht sehen. Aber sie fand, lieber sollte ich arbeiten gehen, als dass wir beide voller Abschiedsschmerz durch die Wohnung schlichen. «Mach schon», sagte sie, «lass sie nicht warten.»
Während ich zum St. Jude fuhr, wurde aus der Dämmerung Dunkelheit. Ich kannte Blakenheath nicht, aber die Straßen waren geprägt vom typischen multikulturellen Mix der meisten Londoner Stadtteile. Imbisse und Läden mit Schildern in westindischen, asiatischen und europäischen Sprachen drängten sich neben heruntergekommenen, vergitterten und verrammelten Gebäuden. Davon gab es immer mehr, je weiter ich rausfuhr, bis die Laternen irgendwann nur noch tote Straßen erhellten. Dann traf ich auf eine parallel zur Straße verlaufende Mauer, darauf ein altes Eisengeländer, zwischen dessen Streben hindurch Äste ragten. Ich vermutete einen Park, bis ich den Eingang erreichte. Über zwei hohen steinernen Pfosten wölbte sich ein verrosteter Torbogen aus Eisen, auf dem in großen, verschnörkelten Buchstaben St. Jude’s Royal Infirmary stand. An der Mauer daneben war auf einem einsamen, ausgefransten Banner die Botschaft Rettet das St. Jude zu lesen.
Neben dem Tor hielt eine junge Polizistin Wache. Ich nannte meinen Namen und wartete, bis sie mich überprüft hatte. «Folgen Sie einfach dem Weg», sagte sie.
Als ich durch den Torbogen fuhr, fiel das Licht meiner Scheinwerfer auf eine große Tafel mit einem Plan des Krankenhausgeländes, so verblichen, dass kaum etwas zu erkennen war. Der Eindruck eines Parks war gar nicht so falsch gewesen. Die Außenmauer war hinter hohen Bäumen verborgen, vermutlich hatten früher zwischen den Krankenhausgebäuden Grünflächen gelegen. Jetzt war dort Ödland. Die Gebäude waren abgerissen worden, mit Unkraut bewachsene Haufen aus Ziegelsteinen und Beton zeigten an, wo sie gestanden hatten.
Es kam mir vor, als würde ich durch eine ausgebombte Stadt fahren, düster und verlassen. Nur meine Scheinwerfer verdrängten die Finsternis. Das Licht der umliegenden Straßen wurde durch die dichten Bäume und die hohe Mauer abgeschirmt, das Gelände wirkte dadurch viel entlegener, als es eigentlich war. Ich umrundete einen dunklen Schutthaufen und sah Polizeiwagen und Transporter vor dem Hauptgebäude parken. Viktorianisch, drei Stockwerke, in der Mitte führte eine breite Treppe herab. Trotz der vernagelten Fenster in den verwitterten Steinwänden und des jämmerlichen Gesamteindrucks verströmte das Gebäude eine gewisse Erhabenheit. Verzierungen schmückten die Mauerbrüstungen, der Portikus wurde von geriffelten Säulen gestützt. Aus dem schwarzen Dach ragte die eckige Silhouette eines Uhrenturms empor.
Wieder nannte ich meinen Namen und wurde zu einem Polizeianhänger geschickt, um Schutzkleidung in Empfang zu nehmen. Wards stellvertretender Ermittlungsleiter erwartete mich an der Treppe zum Haupteingang und stellte sich als Jack Whelan vor. Die große, graffitiverschmierte Flügeltür stand weit offen. Drinnen war es kalt und klamm und roch nach Feuchtigkeit, Schimmel und Urin. Im ehemaligen Foyer waren Flutlampen aufgestellt worden, die den stockfleckigen, bröckelnden Wandverputz und auf dem Boden liegenden Müll beleuchteten. An einer Seite befand sich ein Glaskasten, darüber ein Schild, Notärztliche Ambulanz.
Bierdosen, leere Flaschen und die verkohlten Reste eines Feuers zeigten, dass das Krankenhaus noch Besucher hatte. Meine Schritte hallten hohl auf der sich um einen Lichtschacht windenden Treppe. Auf jedem Absatz stand eine Lampe, staubige Schilder wiesen die Richtung zu Röntgen, Endoskopie, EKG und anderen lange verwaisten Abteilungen.
«Typisch Krankenhaus», sagte Whelan, kurz nach mir außer Atem im obersten Stock angekommen. «Falls man beim Reinkommen nicht krank war, hat spätestens die Treppe einen umgebracht.»
Wir betraten einen langen Korridor, der durch weitere Lampen erleuchtet wurde. Hinter den in die schweren Türen rechts und links eingelassenen Glasfenstern war nichts als Finsternis zu sehen. Unter unseren Füßen knirschte es, an manchen Stellen war Putz aus der maroden Decke gebrochen, und die Holzbalken waren entblößt. Wenigstens lagen hier nicht mehr so viele leere Dosen und Flaschen, aber es war auch ein weiter Weg hier hoch, den man nicht grundlos antrat.
Die Reihe der Lampen zog sich zu einer ausziehbaren Aluminiumleiter, die im Vergleich zu der armseligen Umgebung unpassend neu wirkte. Sie führte zu einer rechteckigen Zugangsluke in der Decke, von dort war quer durch den Dachboden ein Laufsteg gelegt worden, bis zu der Stelle, an der Ward und ihr Team warteten.
Und an der die Leiche lag, die ich jetzt betrachtete, während ich mir den vom Zusammenstoß mit dem Balken schmerzenden Schädel rieb.
«Wir können gleich anfangen», sagte Ward. «Kennen Sie Professor Conrad?»
Ja, allerdings nur dem Namen nach. Conrad war als forensischer Rechtsmediziner in seinem Bereich schon lange etabliert gewesen, als ich in meinem gerade anfing, und wegen seines Jähzorns allgemein gefürchtet. Jetzt war er über sechzig, schien aber keineswegs altersmilde geworden zu sein. Als er mich über die Maske hinweg betrachtete, waren die buschigen, grauen Augenbrauen in ein Stirnrunzeln eingebettet.
«Schön, dass Sie da sind.»
Seine trockene, nasale Stimme ließ schwer einschätzen, ob das ein Vorwurf sein sollte oder nicht. Erneut schien es mir, als würde ich aus dem Augenwinkel in den dunklen Schatten des Dachbodens eine Bewegung wahrnehmen, doch ich ignorierte es. Ich hatte mich für heute schon lächerlich genug gemacht.
Ward sah mich mit hochgezogener Augenbraue an. «Gut, da jetzt alle da sind, legen wir am besten gleich los. Also, rückt zusammen.»
Sie verpasste dem neben ihr stehenden Kriminaltechniker einen unsanften Stoß. Man machte mir Platz. Die Trittplatten waren um die Leiche herum gelegt worden und boten eine Plattform zum Arbeiten. Doch die Dachbalken und der Schornstein schränkten die Bewegungsfreiheit ein, und unter den Lampen wurde es schnell heiß.
«Das Krankenhaus wurde vor Jahren geschlossen, seitdem sind nur noch Obdachlose und Drogensüchtige hier gewesen», sagte Ward, als ich eine Position suchte, um besser sehen zu können. «Bis vor ein paar Monaten die Abrissarbeiten begannen, wurde hier ziemlich viel gedealt, es könnte sich also um eine tödliche Überdosis oder eine tätliche Auseinandersetzung handeln, die vertuscht werden sollte.»
Beides nicht ungewöhnlich. Ich betrachtete das ausgetrocknete, halb im Plastik versunkene Gesicht. «Wer hat die Leiche gefunden, jemand vom Abrisstrupp?»
Sie schüttelte den Kopf. «Die haben den Dachboden überprüft, sind aber wohl nicht so weit reingegangen. Nein, es war einer von den Fledermausschützern. Wollte den Dachboden begutachten und hat mehr gefunden als erhofft.»
«Fledermäuse?»
«Anscheinend eine ganze Kolonie von Langohren.» Sie klang amüsiert. «Sie stehen unter Artenschutz, wir sollten sie also nach Möglichkeit nicht stören.»
Ich warf einen Blick in die Dunkelheit. Also hatte ich mir die Bewegungen doch nicht eingebildet.
«Der Bauunternehmer will alles plattmachen und einen großen Bürokomplex bauen», fuhr Ward fort. «Es gab heftigen Widerstand von Seiten der Anwohner, die Fledermäuse sind also nur das letzte Glied in einer ganzen Kette von Verzögerungen. Die Gegner sind natürlich entzückt, weil der Abriss des St. Jude nun in letzter Minute aufgeschoben wurde. Bis die Fledermäuse umgesiedelt werden können, oder was immer man mit solchen Tieren macht, ist das Bauvorhaben erst einmal gestoppt.»
«So faszinierend das alles auch sein mag, ich habe hierfür eine Verabredung zum Abendessen abgesagt», ließ sich Conrad vernehmen. «Ich wäre froh, wenn ich nicht die ganze Nacht hier verbringen müsste.»
Ohne den finsteren Blick wahrzunehmen, den Ward ihm zuwarf, ging er neben der Leiche steif in die Hocke. Ich kniete mich ihm gegenüber hin. Das Gesicht in dem Plastik war zerknittert wie Pergament und umgeben von einem Heiligenschein aus dünnem Haar. Die Augenhöhlen waren leer, von Nase und Ohren nur Stummel übrig. Unter den starken Geruch des Dachbodens nach Staub und altem Holz mischte sich aus der Plane heraus ein anderer, süßlicher.
«Eindeutig schon eine ganze Weile tot», sagte Conrad, als würde er übers Wetter reden. «Vollständig mumifiziert, wie es aussieht.»
Nicht ganz, dachte ich, behielt es aber erst mal für mich.
«Ist das normal?» Ward klang skeptisch. Der Rechtsmediziner hatte sie entweder nicht gehört oder nicht hören wollen.
«Das kann passieren», antwortete ich für ihn. Vom Säuregehalt in einem Moor bis hin zu extremer Hitze konnte es verschiedene Gründe für eine natürliche Mumifizierung geben. Ich sah mich in der dunklen Weite des Dachbodens um, ein leichter Lufthauch bewegte die Spinnweben in der Nähe. «Es herrschen ziemlich ideale Bedingungen für eine Mumifizierung. Sie merken ja, wie heiß es hier oben ist, und trocken wird es auch im Winter noch sein. Diese großen, alten Dachböden sind gut durchlüftet, und der ständige Luftstrom zieht die Feuchtigkeit raus.»
Während ich sprach, öffnete Conrad die Plane weiter und legte Schultern und Brustkorb frei. Die Leiche lag auf dem Rücken, war leicht verdreht und in die Falten der Plane geschmiegt wie ein Vogel ins Nest. Noch waren Bauch und Unterkörper verhüllt, aber es war klar, dass dieser Mensch nicht groß gewesen war. Die Leiche trug nur ein zerlumptes gelbes T-Shirt, das von bei der Verwesung entstandenen Fäulnisflüssigkeiten verfärbt war. Aus den kurzen Ärmeln ragten Arme und Hände heraus, die nur noch aus Sehnen und Knochen bestanden. Wie im Gesicht war die Haut so vertrocknet, dass sie wie gegerbtes Leder aussah.
«Die Hände scheinen in Position gebracht worden zu sein», sagte Ward. Die klauenartigen Hände lagen über der knochigen Brust gekreuzt, als würde die Leiche in einem Sarg liegen anstatt auf einer Plastikplane. «Dafür muss sich jemand Zeit genommen haben. Es deutet auf Reue oder zumindest Respekt hin. Vielleicht hat der Täter sie gekannt.»
Sie? Ich sah Ward überrascht an. Außer der geringen Körpergröße wies nichts darauf hin, dass es sich um eine Frau handelte, und angesichts des Zustands der Leiche konnte es Tage dauern, das herauszufinden. Wenn wir nicht irgendetwas fanden, das ihre Identität preisgab.
«Die Verwendung des weiblichen Pronomens ist ein bisschen voreilig, solange wir das Geschlecht nicht nachgewiesen haben, meinen Sie nicht?», fragte Conrad mit einem herablassenden Blick in Wards Richtung.
Sogar hinter der Maske war zu erkennen, dass sie rot anlief. Es konnte ein Versprecher gewesen sein, der einer leitenden Ermittlerin jedoch nicht hätte unterlaufen dürfen. Sie versuchte, ihren Fehler zu überspielen. «Können Sie eine ungefähre Einschätzung des Todeszeitpunkts geben?»
Ohne aufzusehen erwiderte der Rechtsmediziner: «Nein, kann ich nicht. Vielleicht haben Sie nicht zugehört, als ich sagte, der Körper sei mumifiziert.»
Jetzt wirkte Ward ebenso wütend wie verlegen. Doch Conrad hatte recht. Wenn ein Körper dermaßen ausgetrocknet ist, werden alle weiteren physischen Veränderungen so verlangsamt, dass sie kaum mehr wahrnehmbar sind. Es gibt Fälle natürlicher Mumifizierung, bei denen die menschlichen Überreste Hunderte von Jahren oder sogar noch länger konserviert wurden.
«Kaum denkbar, dass jemand hier oben eine Leiche versteckt hat, solange das St. Jude noch in Betrieb war», sagte Whelan und füllte das peinliche Schweigen. «Das muss nach der Schließung passiert sein.»
«Wann war die Schließung?», fragte ich.
«Vor zehn, elf Jahren. Hat ziemlich viel Wirbel ausgelöst.»
«Gut, das ist eine Obergrenze, hilft uns aber nicht weiter», sagte Ward. «Was ist die kürzeste Zeit, in der ein Körper so mumifiziert werden kann? Sind weniger als zehn Jahre denkbar?»
«Unter den richtigen Bedingungen schon», sagte ich. «Ich würde vermuten, zumindest diesen und den letzten Sommer muss der Körper hier gelegen haben. Es gibt kaum Geruch, trotz der Hitze, das sagt mir, dass die Mumifizierung schon seit einiger Zeit abgeschlossen ist.»
«Großartig. Wir haben es also mit einem Todeszeitpunkt zu tun, der irgendwo zwischen vor fünfzehn, sechzehn Monaten und zehn Jahren liegt. Das macht es wirklich leichter.»
Dagegen konnte ich wenig sagen, also ließ ich es. Conrad faltete die Plane weiter zurück. Das steife Plastik war verdreckt, mit Zement- oder Gipsstaub überzogen und mit blauen Farbklecksen verschmiert. Mich interessierte eher das, was fehlte und hätte da sein müssen. Doch dann zog der Rechtsmediziner die Plane vom Unterkörper herunter, und alle anderen Details gerieten in Vergessenheit.
Die Beine der Leiche waren leicht gebeugt und zur Seite gedreht. Unter dem kurzen Jeansrock, der ebenfalls Verwesungsflecken aufwies, schienen fast nur noch Knochen zu liegen. Das T-Shirt war hochgezogen und unter der Brust gerafft, sodass der Bauch frei lag. Oder was davon übrig war. Die Bauchhöhle war von unterhalb der Rippen bis zum Schambein aufgerissen. Die inneren Organe waren so geschrumpft und zersetzt, dass sie nicht zu erkennen waren.
Doch nicht das war es, was alle hatte verstummen lassen. In der Bauchhöhle lag etwas, das wie kleine, bleiche Äste aussah. Bei dem Anblick spürte ich, wie sich mir das Herz zusammenzog, und dass Ward scharf den Atem einsog, sagte mir, dass auch sie es erkannt hatte.
«Da müssen Ratten dran gewesen sein», kommentierte einer der Tatortermittler und reckte den Hals, um besser sehen zu können. «Sieht aus, als wäre eine da drin gestorben.»
«Red keinen Mist. Und zeig ein bisschen Respekt», fuhr Whelan ihn böse an.
«Was? Ich habe doch nur …»
«Das ist ein Fötus.» Ward sprach leise. «Sie war schwanger.»
Whelan warf dem unglücklichen Polizisten einen Blick zu, der für später nichts Gutes versprach. «Sieht aus, als hätten Sie recht damit, dass es eine Frau ist, Ma’am.»
Das stimmte, auch wenn Ward es nicht gewusst haben konnte. «Wie alt ist der Fötus?»
«Der Größe und Entwicklung nach sechs oder sieben Monate», sagte ich.
Conrad hatte unseren Austausch ignoriert. Er wandte sich von der Bauchhöhle ab, als wäre das, was dort lag, nicht weiter bedeutsam. «Die Schwangerschaft ist hilfreich», murmelte er, eher an sich als an andere gerichtet. «Wenn sie im gebärfähigen Alter war, schränkt das alles etwas ein. Vollständig bekleidet, Unterwäsche noch vorhanden, keine Anzeichen von sexuellem Missbrauch. Obwohl das natürlich noch zu untersuchen ist.»
«Sie hat nicht viel an. Keine Jacke, nur ein T-Shirt und einen Rock», merkte Ward an. «Keine Strumpfhose, was darauf hindeutet, dass sie im Sommer gestorben sein könnte.»
Whelan hob die Schultern. «Oder sie wurde irgendwo getötet, wo geheizt war, und dann hierhergebracht. Meine Frau trägt drinnen nie einen Pulli, nicht mal im Winter. Dreht einfach die Heizung hoch und überlässt mir die Rechnungen.»
Ward war wieder über die Leiche gebeugt. «Was ist mit dem, ähm, dem Bauch? Können das Ratten gewesen sein, oder ist es eine Verletzung?»
«Fragen Sie mich das nach der Obduktion», sagte Conrad. Aber dann schnaubte er nachdenklich. «Ratten würden sich eher über eine offene Wunde hermachen, möglicherweise hatte sie eine Stichverletzung. Aber wir sollten keine voreiligen Schlüsse ziehen. Außerdem sind an der Kleidung keine Blutflecke sichtbar, wenn es also eine Wunde gab, hat sie nur wenig geblutet.»
Er hatte recht. Auf den ersten Blick konnte man leicht vermuten, dass es sich um irgendeine grauenhafte Verletzung handelte, aber ich wusste, welche Tricks die Natur draufhatte. Im Moment war ich mir nur in einer Sache sicher.
«Sie wurde bewegt.»
Alle sahen mich an. Ich hatte nicht vorgehabt, es so unvermittelt auszusprechen, aber das winzige Skelett im Bauch seiner Mutter hatte mich mehr berührt als gedacht.
«Sie lag vorher woanders», fuhr ich fort. «Und wurde erst nach der Mumifizierung an diese Stelle gebracht.»
Conrad schnaufte widerwillig. «Ja, Sie haben recht.»
«Sind Sie sicher?», fragte Ward.
Ich nickte. «Die Knochen des Fötus sind durcheinandergeraten, und zwar mehr, als wenn Aasfresser am Werk gewesen wären. Das lässt vermuten, dass sie heftigen Bewegungen ausgesetzt waren, als im Körper keine schützende Flüssigkeit mehr vorhanden war.»
«Der Körper wurde in Plastik eingerollt», sagte Whelan. «Vielleicht ist es dabei passiert?»
«Das bezweifle ich, nicht in dem Ausmaß. Und wenn der Körper von Anfang an in Plastik eingewickelt gewesen wäre, hätte keine Mumifizierung stattgefunden. Dann hätte sich Feuchtigkeit gebildet, und die Überreste wären ganz normal verwest. In dem Fall wäre die Plane mit Flüssigkeit verschmiert, wie die Kleidung.»
«Also ist sie erst mumifiziert und wurde dann in die Plane eingewickelt?», fragte Ward noch mal nach.
«So muss es gewesen sein. Und dann sind da noch die hier.» Ich zeigte auf ein paar dunkle, reiskornähnliche Punkte in den Falten der Kleidung. «Es müssten viel mehr Hüllen von Schmeißfliegenlarven vorhanden sein. Wenn die Leiche die ganze Zeit hier gelegen hätte, wären sie überall verteilt.»
Ward runzelte die Stirn. «Gäbe es hier oben überhaupt Fliegen? Es ist stockdunkel, wie sollten die was sehen?»
«Brauchen sie nicht, sie folgen dem Geruch.» Es war ein verbreiteter Irrglaube, dass Schmeißfliegen im Dunkeln nicht aktiv wären. «Das sind vermutlich schwarzblaue Schmeißfliegen. Die laufen zur Not zu Fuß zu einem toten Körper, wenn es zum Fliegen zu dunkel ist.»
«Das ist mal eine lustige Vorstellung.» Whelan verzog das Gesicht.
Ward warf ihm einen irritierten Blick zu. «Warum sind da überhaupt Fliegen, wenn die Leiche mumifiziert ist? Würde sie das nicht abhalten?»
«Nicht, wenn zuerst noch die Verwesung eingesetzt hatte», sagte ich. «An den Flecken auf der Kleidung sieht man, dass das der Fall war, bevor der Körper ausgetrocknet und mumifiziert ist.»
Fliegen konnten verwesende sterbliche Überreste aus bis zu einer Meile Entfernung riechen und schossen dann auf das Ziel zu, um in Augen, Nase und allen anderen Öffnungen, die sie finden konnten, Eier abzulegen. Und auch wenn das Fehlen von Blutflecken an der Kleidung der Frau vermuten ließ, dass es keine größeren Verletzungen gegeben hatte, so hätte schon eine kleine Wunde die Fliegen angelockt. Sie hätten Eier gelegt, möglicherweise innerhalb von Minuten, noch bevor die Ratten kamen. Einmal geschlüpft, hätten die gierigen Larven sich von dem toten Gewebe ernährt, die ursprüngliche Wunde vergrößert und den Kreislauf aus Fressen und Vermehrung fortgesetzt. Bis die Überreste zu trocken und damit uninteressant waren.
Wards Stirn war immer noch gerunzelt. «Sie wollen also sagen, sie wurde woanders getötet und dann hierhergebracht?»
«Nicht unbedingt.» Ich warf Conrad einen Blick zu, um zu sehen, ob er vielleicht antworten wollte. Aber er hatte sich schon wieder der Leiche zugewandt. «Wo auch immer der Körper zuerst gelegen hat, müssen fast identische Bedingungen geherrscht haben. Trocken, gute Luftzufuhr und heiß genug, damit die Mumifizierung schnell einsetzt.»
«Denken Sie, die Leiche war die ganze Zeit hier oben und wurde nur innerhalb des Dachbodens bewegt?», fragte Ward.
«Das halte ich für möglich, ja.»
«Das ergibt keinen Sinn.» Whelan klang verärgert. «Wozu denn? Wenn jemand befürchtete, dass die Leiche gefunden werden könnte, warum hat er sie dann nicht ganz woanders hingebracht? Und warum warten, bis sie mumifiziert ist, bevor man sie wegträgt?»
«Das weiß ich nicht», gab ich zu. «Aber ich denke, man sollte den Rest des Dachbodens nach Schmeißfliegenhüllen absuchen.»
«Gut, das machen wir.» Ward beobachtete den Rechtsmediziner. Er schenkte unserer Unterhaltung keine Aufmerksamkeit, beugte sich vor, um die vor dem Körper gefalteten Hände der Leiche zu untersuchen. «Haben Sie etwas gefunden, Professor Conrad?»
«An den Fingerspitzen sind beträchtliche Verletzungen. Einige könnten von Nagetieren stammen, aber nicht alle, glaube ich.»
«Darf ich mal sehen?», fragte ich.
Er lehnte sich zurück. Angesichts des Zustands der Leiche ließ sich nur sehr schwer abschätzen, welche Schäden nach und welche vor dem Tod entstanden waren. Einige der ausgetrockneten Finger waren von kleinen Zähnen angeknabbert worden, und in der ersten Verwesung hatten die Fingernägel sich zu lösen begonnen. Doch die Finger selbst wirkten aufgerissen, die Nägel waren abgebrochen und gesplittert, einer fehlte gänzlich.
«Ich glaube nicht, dass dafür Ratten verantwortlich sind. Es sieht so aus, als wäre zumindest ein Teil davon entstanden, als sie noch lebte», sagte ich.
«Sie meinen, sie wurde gefoltert?»
«Sie stellen ständig Fragen, die wir unmöglich beantworten können», sagte Conrad gereizt. Seine Knie knackten, als er sich erhob. «Ich habe genug gesehen. Wenn die Hände eingepackt sind, können Sie den Körper in die Leichenhalle bringen. Ich glaube, es lässt sich mit Sicherheit sagen …»
Er brach ab, als über seinem Kopf ein Schatten vorbeischoss, mit einem flatternden Geräusch wie von einem Daumenkino. Die Fledermaus war sofort wieder verschwunden, doch sie hatte den Rechtsmediziner so erschreckt, dass er nach hinten stolperte und mit den Armen ruderte, als sein Fuß von den Trittplatten abrutschte. Mit einem trockenen Knirschen brach er durch den dünnen Boden, die dreckigen Isolationsschichten verwandelten sich in eine riesige Staubwolke, als sein Bein darin versank. Whelan schaffte es, Conrads Handgelenk zu packen, und eine Sekunde lang glaubte ich, er hätte ihn. Dann gab, begleitet von einem lauten Krachen von Holz und Gips, ein Stück des Bodens nach, und Conrad verschwand.
Kapitel 3
«Zurück! Alle zurück!», schrie Ward keuchend.
Die Luft war voller Staub und glitzernder Glasfaserteilchen. Alle husteten, die Papiermasken schützten kaum gegen den giftigen Dunst. Meine Augen brannten, ich schaute hinunter in den Abgrund, der sich so plötzlich aufgetan hatte. Eine der Lampen war umgekippt, als die Trittplatte wegbrach, der Lichtstrahl fiel in die Dunkelheit unter uns.
«Das gilt auch für Sie.» Ward schob sich an mir vorbei und vorsichtig dichter an das Loch heran. Zerrissene Isolierungsmatten hingen an zersplitterten Balken, die wie Speere hervorragten.
«Professor Conrad! Wie geht es Ihnen?», rief sie.
Keine Antwort. Das Gebäude war alt, die Decken hoch. Hoch genug, um sich bei einem Sturz alle Knochen zu brechen, selbst wenn nicht noch Holzbalken und Metallplatten auf einen herunterkrachten.
«Stehen Sie da nicht dumm rum, gehen Sie nach unten und sehen Sie nach, ob er sich was getan hat!», blaffte Ward die Polizisten an der Einstiegsluke an, die daraufhin losstürmten.
«Die Dachbalken müssen brüchig sein», sagte Whelan. «Ma’am, Sie sollten wirklich …»
Ward nickte und wandte sich widerwillig von dem Loch ab. «Okay, alle raus hier! Schön langsam, einer nach dem anderen, und geht nicht zu dicht zusammen. Los, los!»
Hustend bewegten wir uns in einer krummen Reihe über die Platten, die bebten und sich unter unseren Tritten bogen. Ich war froh, als ich die Leiter erreicht hatte. Nach der staubigen Hitze auf dem Dachboden fühlte sich der Abstieg in den kühlen Korridor wie ein Eintauchen in erfrischendes Wasser an. Ward und Whelan kamen als Letzte. Sie kletterte schnell die Leiter herab, der DI folgte.
«Holt sofort Sanitäter!», befahl sie, drängte sich zwischen den Menschen in Schutzanzügen hindurch, die um die Leiter herumstanden, und sah sich nach den beiden Polizisten um, die sie auf die Suche nach Conrad geschickt hatte. «Wo zum Teufel stecken Greggs und Patel?»
Am anderen Ende des langen Korridors entstand Bewegung. Eine junge Polizistin kam mit einer Taschenlampe in der Hand aus einer Tür. Sie wirkte verstört.
«Hier, Ma’am.»
Ward wehrte die Wasserflasche ab, die man ihr hinhielt, und ging auf die Polizistin zu. «Wie geht es ihm?»
Die junge Frau schüttelte den Kopf und blinzelte nervös. «Ähm, ich weiß nicht …»
«Sie wissen es nicht? Oh, zum … Los, aus dem Weg!»
Sie schob die junge Frau grob zur Seite und rannte in das Krankenzimmer. «Dort ist er nicht, Ma’am.»
«Wo zum Henker ist er dann?»
«Wir, ähm, wir können ihn nicht finden.»
«Was soll das heißen, Sie können ihn nicht finden? Er kann sich ja nicht in Luft aufgelöst haben!»
Ein weiteres Licht tauchte in der Dunkelheit des Flurs auf, der Lichtpunkt kam wackelnd auf uns zu, es war der andere Polizist, der sich auf die Suche gemacht hatte.
«Von diesem Korridor hier gehen noch weitere ab», sagte er außer Atem. «Wir haben die Station abgesucht, von der wir dachten, sie läge unter der Stelle, wo er eingebrochen ist, und gerade bin ich noch in der daneben gewesen, aber er ist nirgends zu finden.»
«Er wird ja kaum einfach davonspaziert sein, nach so einem Sturz!»
«Nein, ich meine, vielleicht doch, aber …» Der Polizist zögerte unbehaglich. «Ich kann in der Decke kein Loch finden.»
«Dann haben Sie offensichtlich an der falschen Stelle gesucht. Geben Sie mir die.» Ward riss ihm die Taschenlampe aus der Hand und wandte sich an Whelan. «Jack, ich will, dass dieser gesamte Gang abgesucht wird. Jedes einzelne Zimmer. Und wo bleiben die verdammten Sanitäter?»
«Sind auf dem Weg, Ma’am.»
Whelan begann, die Suchaktion zu organisieren. Ich wollte mich anschließen, aber er schüttelte den Kopf. «Sie nicht, Dr. Hunter. Bei allem Respekt, aber wir haben bereits einen Forensik-Experten verloren. Solange wir nicht sicher sind, dass hier nicht noch mehr einbricht, bleiben Sie hier.»
Ich merkte, dass Widerworte sinnlos waren, und blieb frustriert am Fuß der Leiter stehen, während die anderen davoneilten, die Lichtkegel ihrer Taschenlampen huschten kreuz und quer durch die Dunkelheit. Als das Rufen und die Schritte sich entfernten und leiser wurden, schaute ich hoch zur Einstiegsluke. Auch wenn Whelan gesagt hatte, ich sollte hierbleiben, konnte ich nicht einfach nichts tun.
Ich kletterte so weit die Leiter hoch, bis mein Kopf und meine Schultern im Dachboden waren. Immer noch lag Staub in der Luft, der im Licht der Lampen aussah wie Rauchschwaden. Unten hallten die Rufe der suchenden Polizisten durch die Gänge. Anscheinend hatten sie den Rechtsmediziner noch immer nicht gefunden, und ich sah jetzt, dass es gar nicht so leicht werden würde, ihn zu orten. Von der Luke bis zu der Stelle, an der Conrad eingebrochen war, waren es etwa dreißig Meter, und das Stockwerk unter dem offenen Dachboden war völlig anders angelegt. Offenbar war es ziemlich schwierig, in dem Labyrinth aus Stationen, Fluren, Büros und Wartezimmern herauszufinden, wo Conrad aufgekommen war.
Trotzdem hätten sie ihn inzwischen eigentlich gefunden haben müssen. Ich lauschte den Rufen der Suchenden und verharrte angespannt auf der Leiter. Kommt schon, warum dauert das so lange? Es waren bereits etliche Minuten vergangen, seit Conrad eingebrochen war. Sollte er offene Wunden davongetragen haben, könnte er verbluten, während alle herumrannten und ihn suchten.
«Professor Conrad!», rief ich.
Mein Ruf verhallte. Ich wollte gerade die Leiter hinuntersteigen und mich entgegen Whelans Anweisung an der Suche beteiligen, als ich ein Geräusch zu hören meinte. Ich hielt inne und horchte. Alles blieb still. Aber es hatte nicht nach dem Suchtrupp geklungen.
Sondern wie ein Stöhnen.
«Professor Conrad! Hören Sie mich?»
Nichts. Ich starrte in das Licht, das die Lampen in die Dunkelheit des Dachbodens rissen. In diesem Jahr hatte ich bereits einmal hilflos zusehen müssen, wie ein Mann starb. Ich wachte immer noch mit dem Gedanken daran auf, und die Vorstellung, so etwas ein zweites Mal erleben zu müssen, war unerträglich.
Also los.
Ich kletterte auf den Dachboden. Behutsam testete ich, ob die Trittplatten mich trugen, aber sie wirkten halbwegs solide. Wenn ich nicht wie Professor Conrad danebentrat, sollte es halten.
Hoffte ich.
Der Dachboden hatte schon unheimlich gewirkt, als noch andere Menschen dort waren. Jetzt, da ich allein war, war er noch gruseliger. Das helle Licht entlang des Laufstegs ließ die Schatten dahinter umso tiefer erscheinen. Ich hielt die Augen auf, um nicht von Fledermäusen überrascht zu werden wie Conrad, aber die scheuen Kreaturen zeigten sich nicht. Der ganze Lärm und Aufruhr hatte sie wohl verscheucht.
Die plastikverhüllte Leiche lag unverändert da. Der Einbruch des Fußbodens hatte keine Auswirkungen auf sie gehabt, das war zumindest etwas. Ich schob mich um die Tote herum, irgendwie kam es mir pietätlos vor, sie hier oben alleine zu lassen. Doch im Moment brauchten die Lebenden meine Hilfe mehr.
Vorsichtig bewegte ich mich auf das klaffende Loch zu. Den unmittelbar danebenliegenden Trittplatten traute ich nicht mehr und hielt mich an einem Dachbalken fest, bevor ich den Hals reckte und versuchte, nach unten zu sehen. Staub stieg in langsamen Schwaden nach oben, gefangen im Licht der umgefallenen Lampe. Doch obwohl sie ins Loch zeigte, war der Winkel zu flach, um erkennen zu können, was dort am Boden lag.
«Professor Conrad!»
Ich zog mein Handy aus dem Schutzanzug und stellte die Taschenlampe an. Die Schatten zogen sich zurück und gaben den Blick auf einen chaotischen Haufen aus zerborstenem Holz, Putz und Isolierung frei. Ich beugte mich tiefer über das Loch. Das Licht huschte über etwas Blaues. Ich richtete die Taschenlampe darauf. Erst war es schwer zu erkennen, doch dann wurde mir klar, was ich sah.
Einen Schuhüberzieher aus Plastik, der unter einer Isolierungsmatte hervorlugte.
«Was zum Teufel machen Sie da?»
Ich hätte fast das Handy fallen gelassen. Immer noch den Dachbalken umklammernd, drehte ich mich um und sah Whelan über die Trittplatten auf mich zustapfen.
«Sie sollten unten stehen bleiben. Raus hier! Sofort!»
«Ich kann Conrad sehen.»
Er zögerte. «Lassen Sie mich schauen.»
Ich machte ihm Platz. «Haben Sie schon den Raum gefunden, in dem er liegt?»
«Noch nicht. Die Raumaufteilung da unten ist völlig wirr. Wir sind durch einen anderen Korridor gegangen und mussten dann kehrtmachen. Überall irgendwelche Trennwände, das erschwert die Orientierung.»
Aber doch nicht so sehr, dachte ich, verkniff mir aber, es auszusprechen. Er hielt sich am selben Dachbalken fest wie ich, beugte sich über das Loch im Boden und leuchtete mit der Taschenlampe hinein.
«Hören Sie mich, Professor Conrad?», rief er.
Keine Antwort. «Können Sie ihn sehen?», fragte ich.
«Ich sehe was», grunzte Whelan und spähte in das Loch. «Sieht aus wie sein Fuß. Vielleicht können wir …»
Schritte auf den Trittplatten kündigten Ward an. Zum ersten Mal fiel mir auf, dass sie sich unbeholfen bewegte und in dem weiten Schutzanzug unförmig wirkte.
«Tut mir leid, Ma’am, ich habe bloß …»
«Es ist meine Schuld», sagte ich. «Ich habe ein Stöhnen gehört.»
«Sind Sie sicher?» Sie warf mir einen skeptischen Blick zu. Ich fragte mich langsam selbst, ob es Einbildung gewesen war. Aber ich hatte etwas gehört.
«Wir können ihn sehen.» Whelan ersparte mir weitere Erklärungen.
«Verdammt.» Ward warf einen kurzen Blick auf die Frauenleiche und atmete tief ein. «Ist er bei Bewusstsein? Bitte sagen Sie mir, dass er lebt.»
«Das weiß ich nicht. Er liegt unter den Trümmern der Decke begraben und bewegt sich nicht.»
«Lassen Sie mich sehen.»
«Ma’am, das ist gefährlich», warnte Whelan. «Sie sollten nicht hier oben sein.»
Ich weiß nicht, was mich mehr überraschte, dass er so etwas zu seiner Vorgesetzten sagte oder dass sie ihm dafür nicht den Kopf abriss.
«Erzählen Sie mir was Neues», sagte sie nur und hielt sich auch an unserem Dachbalken fest. Ihr Atem unter der Maske klang rau. «Die Feuerwehr ist mit Rettungsgerät auf dem Weg, außerdem ein Krankenwagen und Sanitäter, aber wir haben immer noch nicht rausgefunden, wo zum Teufel er aufgeschlagen ist! Verdammte Scheiße, das gibt’s doch gar nicht!»
«Ich könnte da runter …», setzte ich an.
«Nein!», blafften Ward und Whelan einstimmig. Sie schüttelte den Kopf. «Die Feuerwehr wird gleich da sein. Die haben die richtige Ausrüstung.»
«Bis dahin könnte er tot sein.»
«Denken Sie, das weiß ich nicht?»
Whelan räusperte sich. «Ich sag’s nur ungern, aber Dr. Hunter hat recht, Ma’am. Wir wissen nicht, in welchem Zustand Conrad ist, und die Feuerwehr muss erst mal ankommen, dann müssen die ihr ganzes Zeug nach oben schleppen. Ich könnte runtersteigen und mich wenigstens mal umsehen.»
Ward starrte zu Boden, die Hände auf die Hüften gestützt.
«Legen Sie los.»
Die Polizisten im Stockwerk unter uns bekamen Anweisungen zugerufen, daraufhin wurde schnell eine Teleskopleiter auf den Dachboden gebracht. Ward wollte so wenige Beamte wie möglich hier oben haben, um das Risiko zu minimieren. Auch mich ließ sie nur widerwillig bleiben, aber ich wies darauf hin, dass bis zum Eintreffen der Sanitäter meine medizinische Ausbildung eventuell von Nutzen sein könnte.
In all dem geriet der eigentliche Grund unseres Hierseins fast in Vergessenheit: die Leichen der Frau und ihres ungeborenen Kindes, die zum Glück weit genug von dem Loch entfernt lagen, um von den hektischen Aktivitäten in Mitleidenschaft gezogen zu werden. Auf meine Bitte hin brachte man eine Plastikplane herauf, und während Whelan und ein Kollege die Teleskopleiter in das Loch hinabließen, deckte ich den mumifizierten Körper zu. Das Plastik knisterte, als ich es über das ausgetrocknete Gesicht zog, auf dem die lederartige Haut straff über den Wangenknochen saß, die runzligen Augenlider in die leeren Höhlen eingesunken. Die Plane würde weitere Verunreinigung durch die aufgewirbelten Staub- und Glasfaserteilchen verhindern, aber nicht nur deshalb wollte ich die Leiche bedecken. Die Frau hatte hier einsam und verlassen gelegen, Gott allein wusste, wie lange.
Es wäre nicht richtig gewesen, ihr keine Wertschätzung zu erweisen.
Zu meiner Frustration wies mich Ward an, weit hinten zu bleiben, während Whelan zwischen all dem Schutt, unter dem der Rechtsmediziner begraben lag, die Leiter in Position brachte. Sie hatten die Lampen so zurechtgeschoben, dass sie das Loch ausleuchteten, doch viel ließ sich nicht erkennen, nur ein Berg aus Holz und Isolierung, der Raum dahinter blieb in tiefer Dunkelheit verborgen.
«Seien Sie vorsichtig, Jack», sagte Ward.
«Genau wie beim Fensterputzen», scherzte er, während er hinabkletterte.
Die Teleskopleiter ächzte und schwankte unter seinem Gewicht. Wenige Sekunden später hatte er den Boden erreicht. Von da, wo ich stand, war er nicht mehr zu sehen, doch seine Stimme war laut und deutlich zu hören.
«Okay, ich bin unten. Ich versuche mal, ihn von diesem Zeug zu befreien …»
Ein Grunzen, dann ein scharrendes Geräusch. Eine Staubwolke stieg nach oben, als der DI den Schutt beiseiteräumte.
«Schon besser.» Er klang atemlos. «Er sieht ziemlich mitgenommen aus. Hat noch Puls, ist aber in schlechtem Zustand. Ein Bein sieht gebrochen aus, und … hier ist viel Blut.»
«Woher?», rief ich. «Aus einer Arterie?»
«Keine Ahnung, ich kann nicht sehen, woher es kommt. Könnte aus seinem Bein sein, aber das steckt fest, und ich will nicht riskieren, ihn zu bewegen. Ma’am, wenn wir nicht schnell was tun, wird er es nicht schaffen.»
Ich wandte mich an Ward. «Lassen Sie mich runter, damit ich …»
Ungeduldig brachte sie mich mit einer Geste zum Schweigen. «Wir müssen da rein, Jack. Können Sie eine Tür sehen?»
«Moment.» Eine Pause. «Sieht aus wie ein Krankenzimmer. Hier stehen noch ein paar Betten und anderer Müll, aber ich sehe keine Tür.»
«Irgendwo muss eine sein.»
«Nein, es sieht so aus, als wäre eine Seite zugemauert worden und … Scheiße!»
Gefolgt von plötzlichem Klappern.
«Jack? Jack! Alles in Ordnung?»
Sekunden später antwortete Whelan: «Ja, ich … ich hab bloß meine Taschenlampe fallen lassen.»
Ward seufzte erleichtert auf. «Verdammt, Jack, was treiben Sie da?»
«Tut mir leid, Ma’am. Diese Betten hier … Da liegen Menschen drin.»
Kapitel 4
Ward wollte mich immer noch nicht zu Whelan hinabsteigen lassen. «Ich gehe kein Risiko mehr ein, bis wir nicht wissen, womit wir es da unten zu tun haben.»
«Wir wissen, womit Conrad es zu tun hat. Wenn wir nichts tun, verblutet er.»
«Die Sanitäter und die Feuerwehr sind in fünf Minuten da …»
«So viel Zeit hat er vielleicht nicht. Bis die hier sind, kann ich zumindest versuchen, die Blutung zu stoppen.»
«Jack ist in Erster Hilfe ausgebildet …»
«Und ich bin Arzt! Wenn Sie befürchten, ich könnte möglicherweise einen Tatort verunreinigen …»
«Darum geht es nicht, das wissen Sie!»
«Dann lassen Sie mich da runtergehen!»
Ward warf den Kopf zurück. «Herrgott noch mal! In Ordnung, aber seien Sie bloß vorsichtig!»
Bevor sie es sich anders überlegen konnte, schwang ich mich auf die Leiter und begann den Abstieg. Die Leiter quietschte und ruckelte, Whelan hielt sie fest, bis ich unten ankam.
«Passen Sie auf, wo Sie hintreten.»
Es war, als stünde man am Grund eines Brunnens. Die durch das Loch in der Decke hereinfallenden Lichtstrahlen erleuchteten nur einen kleinen Bereich. Jenseits davon herrschte Finsternis. Whelan kniete neben einem Berg aus Glasfaserisolierung, Putz und Holz und hielt die Taschenlampe auf Conrad gerichtet. Er hatte ihn zumindest von dem Teil des Schutts, der nicht schwer war, befreien können, und der Rechtsmediziner lag, auf die Seite gedreht, auf Isolierungsmatten. Sein Gesicht war mit Staub und Gips verklebt und sah bleich und abgehärmt aus, dunkles Blut glänzte darauf. Er war bewusstlos, und seine Atmung gefiel mir gar nicht. Das Krankenhaus hatte hohe Decken, er war bestimmt drei oder vier Meter in die Tiefe gestürzt.