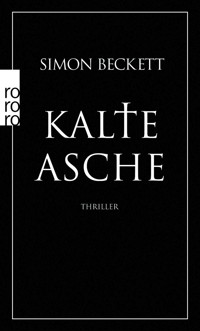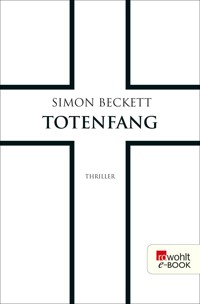
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Krimi
- Serie: David Hunter
- Sprache: Deutsch
Hunter is back! Sein fünfter Fall führt Dr. David Hunter in die Backwaters, ein unwirtliches Mündungsgebiet in Essex, wo die Grenzen zwischen Land und Wasser verschwimmen. Aber die wahren Gefahren lauern nicht in der Tiefe, sondern dort, wo er sie am wenigsten erwartet. Seit über einem Monat ist der 31-jährige Leo Villiers spurlos verschwunden. Als an einer Flussmündung zwischen Seetang und Schlamm eine stark verweste Männerleiche gefunden wird, geht die Polizei davon aus, Leo gefunden zu haben. Der Spross der einflussreichsten Familie der Gegend soll eine Affäre mit einer verheirateten Frau gehabt haben, die ebenfalls als vermisst gilt: Leo steht im Verdacht, Emma Darby und schließlich sich selbst umgebracht zu haben. Doch David Hunter kommen Zweifel an der Identität des Toten. Denn tags darauf treibt ein einzelner Fuß im Wasser, und der gehört definitiv zu einer anderen Leiche. Für die Zeit seines Aufenthalts kommt David Hunter in einem abgeschiedenen Bootshaus unter. Es gehört Andrew Trask, dessen Familie ihm mit unverhohlener Feindseligkeit begegnet. Aber sie scheinen nicht die Einzigen im Ort zu sein, die etwas zu verbergen haben. Und noch ehe der forensische Anthropologe das Rätsel um den unbekannten Toten lösen kann, fordert die erbarmungslose Wasserlandschaft erneut ihren Tribut …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 654
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Simon Beckett
Totenfang
David Hunter
Thriller
Über dieses Buch
Hunter is back!
Sein fünfter Fall führt Dr. David Hunter in die Backwaters, ein unwirtliches Mündungsgebiet in Essex, wo die Grenzen zwischen Land und Wasser verschwimmen. Aber die wahren Gefahren lauern nicht in der Tiefe, sondern dort, wo er sie am wenigsten erwartet.
Seit über einem Monat ist der 31-jährige Leo Villiers spurlos verschwunden. Als an einer Flussmündung zwischen Seetang und Schlamm eine stark verweste Männerleiche gefunden wird, geht die Polizei davon aus, Leo gefunden zu haben. Der Spross der einflussreichsten Familie der Gegend soll eine Affäre mit einer verheirateten Frau gehabt haben, die ebenfalls als vermisst gilt: Leo steht im Verdacht, Emma Darby und schließlich sich selbst umgebracht zu haben. Doch David Hunter kommen Zweifel an der Identität des Toten. Denn tags darauf treibt ein einzelner Fuß im Wasser, und der gehört definitiv zu einer anderen Leiche.
Für die Zeit seines Aufenthalts kommt David Hunter in einem abgeschiedenen Bootshaus unter. Es gehört Andrew Trask, dessen Familie ihm mit unverhohlener Feindseligkeit begegnet. Aber sie scheinen nicht die Einzigen im Ort zu sein, die etwas zu verbergen haben. Und noch ehe der forensische Anthropologe das Rätsel um den unbekannten Toten lösen kann, fordert die erbarmungslose Wasserlandschaft erneut ihren Tribut …
Vita
Simon Beckett ist einer der erfolgreichsten englischen Thrillerautoren. Bevor er sich der Schriftstellerei widmete, arbeitete er unter anderem als freier Journalist und schrieb für britische Zeitschriften und Magazine. Ein Besuch der «Body Farm» in Tennessee war die Inspiration für seine Serie um den forensischen Anthropologen David Hunter, die rund um den Globus gelesen wird: «Die Chemie des Todes», «Kalte Asche», «Leichenblässe» und «Verwesung» waren allesamt Nr.-1-Bestseller. Sein psychologischer Thriller «Der Hof» führte ebenfalls die Bestsellerliste an. Simon Beckett ist verheiratet und lebt in Sheffield.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 2017 unter dem Titel «The Restless Dead» bei Bantam Press, London.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, Oktober 2016
Copyright © 2016 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
«The Restless Dead» Copyright © 2016 by Hunter Publications Ltd.
Redaktion Susann Rehlein
Umschlaggestaltung Hafen Werbeagentur, Hamburg
ISBN 978-3-644-21831-4
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für Hilary
Kapitel 1
Der menschliche Körper, selbst zu über sechzig Prozent aus Wasser bestehend, ist nicht von sich aus schwimmfähig. Er treibt nur so lange an der Wasseroberfläche, wie Luft in den Lungen vorhanden ist. Sobald sie den Körper verlässt, sinkt er langsam auf den Grund. Ist das Wasser sehr kalt oder tief, dann bleibt er dort und durchläuft einen düsteren Auflösungsprozess, der Jahre andauern kann.
Wenn das Wasser aber warm genug ist, um Bakterien Lebensraum zu bieten, dann verwest er. In den Eingeweiden entstehen Gase, die dem Körper Auftrieb geben, sodass er an die Oberfläche zurückkehrt.
Dann erheben sich ganz buchstäblich die Toten.
Der Körper treibt in Bauchlage an oder unmittelbar unter der Wasseroberfläche, Arme und Beine hängen nach unten. Im Laufe der Zeit wird er sich in einer morbiden Umkehr seines Entstehens im Mutterleib auflösen. Zuerst die Extremitäten: Finger, Hände und Füße fallen ab. Dann Arme und Beine, zuletzt der Kopf, bis nur der Torso übrig ist. Wenn die letzten Verwesungsgase verflogen sind, sinkt der Oberkörper zum zweiten und letzten Mal in die Tiefe.
Doch das Wasser treibt noch eine weitere Transformation voran. Die Weichteile zersetzen sich, die Fettschicht unter der Haut zerfällt und ummantelt den einst lebenden Körper mit einer dicken fettigen Hülle. Diese Substanz nennt man Adipocire oder Leichenwachs, sie ist aber auch unter einem weniger makabren Namen bekannt.
Seife.
Wie in ein wachsweißes Leichentuch gehüllt, das Gewebe und Organe schützt, treibt der Körper auf seiner letzten, einsamen Reise durchs Wasser.
Bis der Zufall ihn wieder ans Tageslicht bringt.
Wie die eher grazile Knochenstruktur vermuten ließ, gehörte der Schädel zu einer jungen Frau. Das Stirnbein war lang und glatt, es gab keinen Überaugenwulst, und die Pars mastoidea unter der Ohröffnung war so klein, dass sie nicht nach einem Mann aussah. Zwar waren das nur Indizien, aber alles in allem hatte ich keinen Zweifel. Da die bleibenden Zähne zum Zeitpunkt des Todes bereits sämtlich vorhanden waren, war sie wahrscheinlich älter als zwölf gewesen, wenn auch nicht viel. Zwei Backenzähne und ein Schneidezahn waren vermutlich post mortem ausgefallen, die übrigen Zähne kaum abgenutzt. Auch ohne das restliche Skelett konnte ich sagen, dass sie bei ihrem Tod wohl noch keine sechzehn Jahre alt gewesen war.
Die Todesursache war offensichtlich. Mitten im Hinterhauptbein klaffte ein etwa dreißig mal fünfzehn Millimeter großes Loch. Die von den scharfen Kanten der Wunde kreisförmig ausstrahlenden Bruchlinien waren ein Hinweis darauf, dass der Knochen «grün» und lebendig gewesen war, als das Loch entstand. Post mortem wäre der Knochen trocken und brüchig gewesen. Als ich den Schädel zum ersten Mal in der Hand gehalten hatte, war aus dem Inneren zu meiner Überraschung ein Klappern zu hören gewesen. Ich hatte zunächst an Knochenfragmente gedacht, durch die Wucht des tödlichen Schlages in den Schädel gedrückt. Aber es klang nach etwas Größerem und Festerem. Das Röntgenbild bestätigte meinen Verdacht: Es zeigte einen schmalen, spitzen Gegenstand im Kopf des jungen Mädchens.
Eine Pfeilspitze.
Das genaue Alter des Schädels war nicht zu bestimmen, auch nicht, wie lange er schon in den windgepeitschten Mooren Northumberlands gelegen hatte. Mit einiger Sicherheit ließ sich nur sagen, dass das Mädchen seit über fünfhundert Jahren tot war, in dieser Zeit war der Pfeilschaft verfallen, und der Knochen hatte eine dunkle Karamellfarbe angenommen. Wir würden nie herausfinden, wer sie war, noch, warum sie starb. Ich hoffte, dass ihr Mörder – vor dem sie geflohen sein musste – für dieses Verbrechen auf irgendeine Art hatte büßen müssen. Aber auch das konnte niemand wissen.
Die Pfeilspitze klapperte leicht, als ich den Schädel vorsichtig mit Seidenpapier umwickelte und in die Schachtel zurücklegte. Zusammen mit anderen historischen Skeletten wurde er an der Anthropologischen Fakultät der Universität zur Ausbildung von Studienanfängern benutzt, eine morbide Kuriosität, alt genug, dass bei ihrem Anblick niemand mehr in Ohnmacht fiel. Ich war daran gewöhnt, hatte weiß Gott Schlimmeres gesehen, trotzdem rührte gerade dieses Memento mori mich immer in besonderer Weise an. Vielleicht, weil das Mädchen so jung gewesen war, vielleicht wegen der brutalen Umstände seines Todes. Wer immer sie auch war, sie hatte Eltern gehabt. Jetzt, Jahrhunderte später, wurde das, was von ihr übrig war, in einer Pappschachtel in einem Laborschrank aufbewahrt.
Dorthin schob ich die Schachtel zurück, rieb mir den steifen Nacken, ging dann in mein gläsernes Büro neben dem Labor und rief meine E-Mails ab. Dabei keimte die immer selbe Hoffnung in mir auf und wurde wie immer von Enttäuschung vertrieben. Nur der übliche Unikram – Anfragen von Studierenden, Mitteilungen von Kollegen und gelegentlich Spam, der durch den Filter gerutscht war. Sonst nichts.
So war es seit Monaten.
Eine Mail kam von Professor Harris, dem neuen Leiter der Fakultät, der mich daran erinnerte, seine Sekretärin anzurufen und einen Gesprächstermin zu vereinbaren. Um die Optionen in Bezug auf Ihre Stelle zu besprechen, so hatte er es verklausuliert. Sofort wurde mir flau, aber wirklich überrascht war ich nicht. Außerdem stand das Problem erst nächste Woche an. Ich fuhr den Computer herunter, hängte den Laborkittel an den Haken und zog meine Jacke an. Auf dem Gang kam mir eine Doktorandin entgegen.
«Tschüs, Dr. Hunter. Schönes Wochenende», sagte sie.
«Danke, Jamila, Ihnen auch.»
Die Aussicht auf das lange Feiertagswochenende dämpfte meine Stimmung noch mehr. Dummerweise hatte ich vor Wochen die Einladung von Freunden angenommen, die Tage bei ihnen in den Cotswolds zu verbringen. Damals hatte das Wochenende noch weit in der Zukunft gelegen. Jetzt stand es bevor, und ich freute mich ganz und gar nicht darauf, vor allem, weil auch andere Gäste kommen würden, die ich nicht kannte.
Zu spät. Ich stieg in meinen Wagen, wischte meine Karte über den Scanner und wartete, dass sich der Schlagbaum des Parkplatzes hob. Es war unsinnig, jeden Tag mit dem Auto zu fahren, anstatt die U-Bahn zu nehmen, trotzdem tat ich es. Als Berater der Polizei war ich meistens spontan in entlegene Landesteile gerufen worden, wenn irgendwo eine Leiche gefunden worden war. Da war es sinnvoll gewesen, sich jederzeit auf den Weg machen zu können, aber das war, bevor ich auf die schwarze Liste gesetzt worden war. Inzwischen schien die Autofahrt zur Arbeit weniger notwendige Routine als vielmehr von Wunschdenken geleitet zu sein.
Auf dem Nachhauseweg hielt ich an einem Supermarkt, um einzukaufen, was man als Gast meiner Erinnerung nach mitbringen sollte. Da ich erst am folgenden Morgen aufbrechen wollte, brauchte ich auch etwas zum Abendessen und wanderte uninspiriert durch die Gänge. Ich war schon seit einigen Tagen nicht ganz auf der Höhe, hatte das aber auf Langeweile und Frustration geschoben. Als ich merkte, dass ich vor den Fertiggerichten hängengeblieben war, gab ich mir einen Ruck und ging weiter.
Der Frühling ließ in diesem Jahr auf sich warten, auch im April fegten noch Winterwinde und Regen über das Land. Der wolkenverhangene Himmel hielt die Tage kurz, und als ich in meine Straße einbog, wurde es bereits dunkel. Ich fand einen Parkplatz und trug die Einkäufe nach Hause, in die Erdgeschosswohnung eines viktorianischen Hauses, dessen kleinen Eingangsflur ich mit der Wohnung im ersten Stock teilte. Als ich näher kam, sah ich einen Mann im Overall an der Eingangstür herumhantieren.
«’n Abend, Chef», grüßte er mich fröhlich. Er hielt einen Hobel in der Hand, aus der Tasche zu seinen Füßen ragten Werkzeuge.
«Was ist passiert?», fragte ich angesichts des nackten Holzes um das Schloss herum und der auf der Erde liegenden Holzspäne.
«Sie wohnen hier? Jemand hat versucht einzubrechen. Ihre Nachbarin hat uns angerufen, damit wir das reparieren.» Er pustete Sägemehl von der Türkante und setzte den Hobel wieder an. «In dieser Gegend lässt man die Haustür besser nicht unverschlossen.»
Ich stieg über seine Werkzeugtasche und ging nach oben, um mit meiner Nachbarin zu sprechen. Sie wohnte erst seit einigen Wochen dort, eine glamourös attraktive Russin, die, soweit ich wusste, in einem Reisebüro arbeitete. Wir hatten bisher kaum mehr als Höflichkeiten ausgetauscht, und sie bat mich auch jetzt nicht herein.
«Es war kaputt, als ich nach Hause kam», sagte sie und warf verärgert den Kopf zurück, was einen Hauch Moschusparfüm in meine Richtung trieb. «Irgendein Junkie hat versucht reinzukommen. Die klauen einfach alles.»
Das Viertel war zwar nicht besonders vornehm, hatte aber kein schlimmeres Drogenproblem als jedes andere. «Stand die Haustür offen?»
Ich hatte meine Wohnungstür überprüft, sie war intakt. Keine Anzeichen, dass jemand sich mit Gewalt Zutritt hatte verschaffen wollen. Meine Nachbarin schüttelte den Kopf, das dicke, dunkle Haar hüpfte. «Nein. Sie war nur kaputt. Der Drecksack hat Schiss bekommen oder aufgegeben.»
«Haben Sie die Polizei gerufen?»
«Die Polizei?» Sie stieß ein verächtliches Pfff aus. «Ja, aber die scheren sich nicht darum. Nehmen Fingerabdrücke, zucken mit den Schultern, gehen wieder. Am besten ein neues Schloss einbauen lassen. Diesmal ein stärkeres.»
Das wurde von ihr so betont, als ob das Versagen des alten Schlosses meine Schuld wäre. Als ich wieder nach unten kam, wurde der Schlosser gerade fertig.
«Alles erledigt, Chef. Da muss noch Farbe drauf, damit das Holz bei Regen nicht aufquillt.» Er hielt mir zwei Schlüssel hin und hob die Augenbrauen. «Und, wer will die Rechnung?»
Ich sah hoch zur Tür der Russin. Sie blieb geschlossen. Ich seufzte. «Nehmen Sie einen Scheck?»
Nachdem der Schlosser gegangen war, holte ich ein Kehrblech und fegte das Sägemehl im Flur auf. Eine Holzlocke hatte sich in der Ecke festgesetzt. Als ich mich hinkniete, um sie aufzukehren, und meine Hand über den schwarz-weißen Fliesen sah, holte mich ein Déjà-vu ein.
Ich richtete mich auf, das plötzliche Bild, wie ich mit einem Messer im Bauch auf den Fliesen liege und mein Blut sich auf dem Schachbrettmuster verteilt, hatte mein Herz zum Rasen gebracht. Ich zwang mich, tief zu atmen, um das klamme Gefühl zu vertreiben.
Rasch ließ es nach. Herrgott, dachte ich beklommen, wo kommt das denn jetzt her? Ich hatte schon lange keinen Flashback mehr gehabt, und dieser war aus dem Nichts gekommen. Inzwischen dachte ich nur noch selten an den Angriff zurück. Ich hatte mich bemüht, das Ganze hinter mir zu lassen, und auch wenn mir körperliche Narben geblieben waren, so hatte ich die seelischen Wunden für verheilt gehalten.
Waren sie offenbar doch nicht.
Noch ein wenig zittrig, kippte ich das Sägemehl in den Mülleimer und kehrte in meine Wohnung zurück, die den vertrauten Anblick von heute Morgen bot: unauffällige Möbel in einem mittelgroßen Wohnzimmer, eine Küche und nach hinten raus ein kleiner Garten. Kein schlechter Ort zum Wohnen, doch jetzt, immer noch die Bilder des Flashbacks im Kopf, fiel mir auf, wie wenige der mit diesem Ort verbundenen Erinnerungen glücklich waren. Wie bei der Autofahrt zur Arbeit war es Gewohnheit, was mich hier hielt.
Vielleicht war es Zeit für eine Veränderung.
Lustlos packte ich die Einkäufe aus und holte mir ein Bier aus dem Kühlschrank. Tatsache war, ich hing fest. Und Veränderungen würden kommen, ob ich wollte oder nicht. Obwohl ich bei der Uni angestellt war, hatte der Hauptteil meiner Arbeit lange aus Beratertätigkeiten für die Polizei bestanden. Als forensischer Anthropologe wurde ich immer dann gerufen, wenn menschliche Überreste gefunden wurden, die zu verwest oder zerstört waren, als dass ein Rechtsmediziner noch etwas mit ihnen hätte anfangen können. Das war ein spezielles Fachgebiet, auf dem sich vor allem Freiberufler wie ich tummelten, die der Polizei bei der Identifizierung von Leichen halfen und möglichst viele Informationen über Todeszeitpunkt und Todesart zusammentrugen. Ich war mit dem Tod in all seinen grausigen Facetten bestens vertraut, sprach die Sprache von Knochen, Fäulnis und Verwesung fließend. Die meisten Menschen gruselten sich vor meiner Tätigkeit, und es hatte Zeiten gegeben, in denen sie mir schwergefallen war. Nachdem vor einigen Jahren meine Frau und meine Tochter bei einem Autounfall ums Leben gekommen waren, hatte ich zunächst wieder als Hausarzt gearbeitet, um mich um die Belange der Lebenden anstatt die der Toten zu kümmern. Aber das war von kurzer Dauer gewesen. Im Guten wie im Schlechten war dies nun mal mein Job. Und ich war gut darin. Jedenfalls bis ich letzten Herbst zu einer Ermittlung gerufen wurde, an deren Ende zwei Polizisten tot waren und ein leitender Polizeibeamter den Dienst hatte quittieren müssen. Obwohl mich keine Schuld traf, hatte ich unabsichtlich einen Skandal ausgelöst, und Unruhestifter mag niemand. Schon gar nicht die Polizei.
Und plötzlich war es mit den Aufträgen vorbei gewesen.
Das hatte natürlich Auswirkungen auf die Arbeit an der Uni gehabt. Von einem Mitarbeiter, der an diversen wichtigen Mordermittlungen beteiligt ist, kann man profitieren, nicht aber von einem, der plötzlich in jeder Polizeidienststelle des Landes als Persona non grata gilt. Mein Vertrag lief in wenigen Wochen aus, und der neue Leiter der Fakultät hatte bereits verkündet, keine unnütze Last mitschleifen zu wollen.
Als die er mich sah.
Seufzend ließ ich mich in den Sessel fallen und trank einen Schluck Bier. Mir war überhaupt nicht nach einem Partywochenende, aber Jason und Anja waren alte Freunde. Ich kannte Jason seit dem Medizinstudium und hatte meine Frau bei einer von Jasons und Anjas Partys kennengelernt. Als ich nach dem Tod von Kara und unserer Tochter Alice London verließ, hatte ich unsere Freundschaft wie alles andere auch vernachlässigt und es nicht geschafft, die Fäden nach meiner Rückkehr wiederaufzunehmen.
Aber dann hatte Jason in den Berichten über die verpatzte Ermittlung meinen Namen gelesen und sich kurz vor Weihnachten gemeldet. Seitdem hatten wir uns ein paarmal getroffen, was glücklicherweise einfacher gewesen war, als ich gedacht hatte. Die beiden waren in der Zwischenzeit umgezogen, die bittersüßen Erinnerungen, die ihr altes Haus geweckt hätte, blieben mir also erspart. Jetzt wohnten sie in einem sündhaft teuren Haus in Belsize Park und besaßen ein Ferienhaus in den Cotswolds.
Dorthin würde ich morgen fahren. Erst als ich bereits zugesagt hatte, kam der Haken.
«Wir laden noch andere Leute ein», sagte Jason. «Und es gibt da eine Frau, von der Anja meint, du solltest sie kennenlernen. Sie ist Anwältin für Strafrecht, ihr habt also einiges gemeinsam. Na ja, Polizeikram und so. Außerdem ist sie Single. Gut, geschieden, aber das ist ja das Gleiche.»
«Darum geht es? Ihr wollt mich verkuppeln?»
«Ich nicht, Anja», erwiderte er. «Aber es wird dich nicht umbringen, eine attraktive Frau kennenzulernen, oder? Wenn ihr euch versteht, toll. Wenn nicht, macht es auch nichts. Komm einfach und schau, was passiert.»
Also hatte ich eingewilligt. Anja und er meinten es gut, außerdem platzte mein Terminkalender nun wirklich nicht aus den Nähten. Doch inzwischen war ein langes Wochenende mit Fremden eine grauenhafte Vorstellung. Was soll’s, zu spät. Mach einfach das Beste draus.
Müde stand ich auf und machte mir etwas zu essen. Als das Telefon klingelte, dachte ich, Jason würde sich versichern wollen, dass ich auch wirklich käme. Kurz erwog ich die Chance auf eine Ausrede in letzter Minute, bis ich sah, dass nicht seine Nummer auf dem Display stand. Ich rechnete mit einer Telefonumfrage und hätte fast nicht abgenommen. Dann siegte wieder die Macht der Gewohnheit, und ich ging ran.
«Spreche ich mit Dr. Hunter?»
Der Anrufer war ein Mann, der für eine Telefonumfrage zu alt klang. «Ja, wer ist da?»
«Detective Inspector Bob Lundy aus Essex.» Der Mann sprach gemächlich, fast langsam, und klang eher nach Norden als nach Estuary, wie das Gebiet um die Themsemündung in Essex genannt wird. Ich tippte auf Lancashire. «Passt es gerade?»
«Ja, kein Problem.» Ich stellte mein Bier ab, das Essen war vergessen.
«Tut mir leid, Ihr Wochenende zu stören, aber Detective Chief Inspector Andy Mackenzie drüben in Norfolk hat Sie empfohlen. Sie haben vor ein paar Jahren mit ihm an einer Mordermittlung gearbeitet?»
Ich erinnerte mich noch gut an Mackenzie. Zu der Zeit hatte ich als Arzt gearbeitet, eine Mordserie hatte mich zur Forensik zurückgebracht. Mackenzie war damals DI und die Beziehung nicht ganz einfach gewesen. Ich war dankbar, dass er ein gutes Wort für mich eingelegt hatte, wollte aber meine Hoffnungen nicht zu hoch schrauben.
«Das stimmt», sagte ich. «Wie kann ich Ihnen helfen?»
«Uns wurde die Sichtung einer Wasserleiche in einer Flussmündung gemeldet, ein paar Meilen nördlich von Mersea Island. Heute Nacht können wir nicht viel machen, aber wir haben eine ziemlich genaue Vorstellung, wo sie stranden wird. Kurz vor Sonnenaufgang setzt Ebbe ein, die Suchaktion beginnt also, sobald es hell genug ist. Ich weiß, das kommt sehr kurzfristig, aber könnten Sie sich vielleicht morgen früh mit uns da draußen treffen?»
Ich dachte an Jasons und Anjas Einladung. Aber nur kurz. Die beiden würden schon verstehen. «Sie wollen, dass ich bei der Bergung dabei bin?»
Ich hatte schon öfter Wasserleichen begutachtet, allerdings nur, wenn die Überreste stark zersetzt waren. War der Tote erst vor kurzem ertrunken und der Körper einigermaßen gut erhalten, gab es für einen forensischen Anthropologen nichts zu tun. Und es wäre auch nicht der erste durch einen treibenden Müllsack oder ein Kleiderbündel ausgelöste Fehlalarm. Falls nicht außergewöhnliche Umstände vorlagen, wurde ich eigentlich erst gerufen, wenn die Leiche geborgen und ihr Zustand bekannt war.
«Wenn möglich, ja», sagte Lundy. «Ein paar Freizeitsegler haben die Leiche heute Nachmittag entdeckt. Sie wollten sie an Bord ziehen, aber als sie nahe genug dran waren, um sie zu riechen, haben sie es sich anders überlegt.»
Gut so. Zwar war es möglich, post mortem entstandene Verletzungen von den tödlichen zu unterscheiden, aber am besten vermied man sie. Eine Leiche war ein Beweismittel, das leicht Schaden nahm, wenn man zu grob damit umging. Und wenn diese hier roch, schien der Verwesungsprozess fortgeschritten zu sein.
«Haben Sie eine Ahnung, wer es sein könnte?», fragte ich und machte mich auf die Suche nach Stift und Papier.
«Vor etwa sechs Wochen ist jemand hier aus der Gegend verschwunden», sagte Lundy, und wenn ich nicht so abgelenkt gewesen wäre, hätte ich sein Zögern vielleicht wahrgenommen. «Wir denken, es könnte sich um ihn handeln.»
«Dann wäre die Leiche aber ungewöhnlich lange in der Flussmündung getrieben, ohne entdeckt zu werden», sagte ich.
Kein Wunder, dass die Segler sie gerochen hatten. Manchmal blieben menschliche Überreste tatsächlich Wochen oder sogar Monate an der Oberfläche, normalerweise aber nur bei tieferen Gewässern oder draußen auf See. Flussmündungen unterlagen den Gezeiten, eine Leiche würde also mindestens zweimal am Tag stranden und gut sichtbar daliegen. Eigentlich hätte sie früher entdeckt werden müssen.
«Sie wird nicht mehr von vielen Booten befahren», sagte Lundy. «Wenn Sie hier sind, werden Sie’s sehen. Die Gegend ist ziemlich unzugänglich.»
Ich kritzelte mit dem Kugelschreiber auf dem Notizblock herum und versuchte, die Tinte zum Fließen zu bringen. «Gibt es irgendetwas Verdächtiges an den Umständen, von dem ich wissen sollte?»
Ein Zögern. «Wir haben keinen Anlass, von Fremdeinwirkung auszugehen.»
Ich ließ den Stift sinken, die Zurückhaltung des DI war mir nicht entgangen. Ohne Fremdeinwirkung hieß Unfall oder Selbstmord, und Lundys Verhalten nach schien Letzteres wahrscheinlicher. Das war tragisch, aber eigentlich kein Grund, so ausweichend zu antworten.
«Ist irgendetwas daran heikel?», fragte ich nach.
«Heikel würde ich nicht sagen.» Lundy machte den Anschein, seine Worte sorgfältig zu wählen. «Sagen wir, wir stehen unter Druck, herauszufinden, ob die Leiche die ist, für die wir sie halten. Morgen sage ich Ihnen mehr. Wir brechen von einer alten Austernfischerei aus auf, die nicht ganz einfach zu finden ist. Ich maile Ihnen die Wegbeschreibung, aber planen Sie für die Fahrt viel Zeit ein. Navis sind in dieser Ecke nicht wirklich von Nutzen.»
Als er sich verabschiedet hatte, saß ich da und starrte Löcher in die Luft. Ganz offensichtlich steckte mehr dahinter, als der DI am Telefon hatte sagen wollen, aber ich konnte mir nicht vorstellen, was. Selbstmorde gehörten zum Leben, und Polizisten waren normalerweise nicht so verdruckst.
Morgen weißt du mehr. Wenn die Polizei recht hatte und die Leiche die eines vor mehreren Wochen verschwundenen Mannes war, dann würde sie vermutlich schon ziemlich verwest sein. Das Bergen von fragilen Überresten aus Wasser – besonders aus dem Meer – war knifflig, wahrscheinlich sollte deshalb ein forensischer Anthropologe vor Ort sein. Doch auch wenn verwesende Überreste in meinen Bereich fielen, überraschte es mich, so früh gerufen zu werden. Normalerweise entschieden der leitende Ermittler und der Rechtsmediziner, wie mit einer Leiche am besten umzugehen war.
Doch wenn die Polizei mich dabeihaben wollte, hatte ich nichts dagegen. Ich dachte an Jasons und Anjas Einladung. Die Bergung dürfte nicht den ganzen Tag in Anspruch nehmen und bot mir daher keine legitime Ausrede. Von der Küste wäre die Fahrt in die Cotswolds zwar länger, aber der Gedanke an die Party hatte seinen Schrecken zumindest teilweise verloren.
Gut gelaunt wie seit Monaten nicht, machte ich mich daran, meine Sachen zu packen.
Kapitel 2
Bei meiner Abfahrt am nächsten Morgen war es noch dunkel. Sogar zu dieser Zeit herrschte schon Verkehr, die Scheinwerfer von Lkws und frühen Pendlern krochen die Straßen entlang. Als ich London in östlicher Richtung verließ, wurden sie spärlicher. Außerhalb der dichtbevölkerten Vororte waren die Straßen unbeleuchtet und die Sterne heller. Das gedimmte Licht des Navis täuschte Wärme vor, so früh am Morgen musste ich trotzdem die Heizung anstellen. Der Winter war lang und kalt gewesen, der vom Kalender verkündete Frühling blieb reine Illusion.
Ich war mit dickem Kopf und schmerzenden Gliedern aufgewacht. Hätte ich gestern Abend mehr als nur das eine Bier getrunken, ich hätte auf einen Kater getippt. Nach einer heißen Dusche und einem schnellen Frühstück fühlte ich mich schon besser, und das heute vor mir Liegende lenkte mich sowieso von meinem Befinden ab.
Auf den Straßen war es zu dieser Tageszeit noch friedlich. Die Küstenmarschen von Essex lagen nicht weit von London entfernt – platte, tiefgelegene Wiesen und Salzmarschen, die einen ewigen und oft vergeblichen Kampf mit den Gezeiten und dem Meer führten. Dieser Teil der Südostküste war mir völlig unbekannt. Die alte Austernfischerei, von der aus die Suchaktion starten sollte, lag in einer Gegend, die sich Salzmarsch-Estuary nannte. DI Lundy hatte in seiner Mail mit der Wegbeschreibung noch einmal betont, ich solle für die Fahrt viel Zeit einplanen. Ich hatte ihn für übertrieben vorsichtig gehalten, bis ich im Internet nachsah. Das Mündungsufer war von einem Labyrinth aus gewundenen Kanälen und Bächen umgeben, die auf der Karte einfach als Backwaters verzeichnet waren. Auf den Satellitenfotos sahen die Wasserwege wie Kapillaren aus, die das Marschland durchzogen, bei Ebbe leerliefen und nassen Schlick und Gräben freilegten. Jetzt wurde mir klar, was Lundy gemeint hatte. Große Teile der Landschaft sahen unpassierbar aus, und die Dämme, die die größeren Wasserwege durchquerten, waren nur bei Ebbe befahrbar.
Das Navilicht wurde schwächer, während der Himmel vor mir sich aufhellte. Auf der einen Seite lagen die Silhouetten der Raffinerie von Canvey Island, fraktale Formen mit blinkenden Lichtern. Es waren jetzt mehr Wagen unterwegs, aber als ich auf eine Seitenstraße abbog, wurde es wieder leer. Bald war ich allein und fuhr in einen verhangenen Sonnenaufgang hinein.
Kurz darauf schaltete ich das Navi aus und verließ mich von jetzt an auf Lundys Wegbeschreibung. Um mich herum lag die Landschaft da wie ein Blatt Papier, bekritzelt nur von Weißdornhecken und gelegentlich von einem Haus oder einer Scheune. Die Beschreibung des DI führte mich durch einen kleinen, trostlosen Ort namens Cruckhaven, der etwa dort lag, wo das Mündungsgebiet sich verengte. Ich kam an Rauputzbungalows und Steincottages vorbei und erreichte einen Hafen, in dem ein paar dreckverkrustete Trawler und Fischerboote schief im Schlick saßen und auf die nächste Flut warteten, die ihnen wieder zu Sinn und Würde verhelfen sollte.
Es war ein Ort ohne jeglichen Charme, den ich gerne hinter mir ließ. Die Straße führte am Fluss entlang, Hochwasser oder Wellen hatten Löcher in den Asphalt gespült. Die Schäden schienen neu zu sein. Es hatte diesen Winter viele Überschwemmungen gegeben, aber in London, mit meinen eigenen Problemen beschäftigt, hatte ich bei Nachrichten über Küstenstürme nur halb hingehört. Hier müssen sie harte Wirklichkeit sein, dachte ich, als ich toten Tang sah, der weit über die Straße gespült worden war. Unwetter und globale Erwärmung sind mehr als graue Theorie, wenn man mit den Auswirkungen leben muss.
Ich folgte der Straße bis zur Flussmündung, die bei Ebbe nur eine Schlammwüste mit Pfützen und Rinnsalen war. Als ich schon glaubte, die Abzweigung verpasst zu haben, erblickte ich vor mir an der Küstenlinie eine Reihe niedriger Gebäude, daneben mehrere Polizeiwagen, und falls mir noch Zweifel geblieben wären, bestätigte mir ein Holzschild, wo ich war: Saltmere Oyster Co.
Am Tor stand ein Police Constable. Er fragte über Funk nach, erst dann ließ er mich durch. Ich holperte über zerklüfteten Asphalt und parkte hinter den verfallenen Austernschuppen neben den dort bereits stehenden Polizeiwagen und einem Trailer. Als ich mit steifen Gliedern aus dem warmen Auto stieg, kam mir die kalte Morgenluft wie eine Eisdusche vor. Der Wind trug die klagenden Schreie der Möwen heran, vermischt mit dem Geruch verrottenden Tangs und dem erdigen Aroma von Schlick. Das Mündungsgebiet sah bei Ebbe aus, als hätte ein Riese hier eine große Handvoll Erde weggenommen und nur Schlamm und Pfützen hinterlassen. Der Anblick erinnerte an eine Mondlandschaft, doch die nächste Flut war bereits im Kommen: Die in den Grund gefurchten Kanäle wurden von zahllosen Rinnsalen gespeist, die sich zusehends mit Wasser füllten.
Der Wind änderte die Richtung und wehte das rhythmische Donnern eines Hubschraubers der Polizei oder Küstenwache heran. In der Ferne sah ich ihn als Punkt einen Zickzackkurs fliegen. Er nutzte das Tageslicht und das Niedrigwasser aus, um das Mündungsgebiet auf Sicht abzusuchen. Eine Leiche gibt normalerweise nicht genug Wärme ab, um von Infrarotkameras entdeckt zu werden, und lässt sich aus der Luft nur schwer erkennen. Vor allem, wenn sie unter der Oberfläche hängt. Hier wurde also nichts unversucht gelassen, um den Körper schnellstens zu finden, bevor die Flut kommen und ihn wieder mit sich reißen würde.
Dann steh hier nicht so rum. Ein Mann am Trailer sagte mir, dass DI Lundy am Kai zu finden wäre. Ich umrundete die verschlossenen Austernschuppen und sah oben an einer Sliprampe aus Beton auf einem Anhänger den schlanken Körper eines RHIB – eines Festrumpfschlauchboots. Jetzt verstand ich, warum die Suche von hier aus durchgeführt wurde. Die Rampe führte in einen tiefen Kanal im Schlick unmittelbar vor der Kaimauer. Die einlaufende Flut würde ihn schnell füllen, sodass das Boot zu Wasser gelassen werden und hinausfahren konnte, ohne dass das Mündungsgebiet erst ganz volllaufen musste. Noch stand das Wasser nicht hoch genug, aber den Wirbeln und Strudeln nach, die die Oberfläche kräuselten, würde es nicht mehr lange dauern.
Eine kleine Gruppe von Leuten stand mit dampfenden Plastikbechern in der Hand neben dem Polizeiboot und unterhielt sich leise. Einige trugen paramilitärisch aussehende Uniformen, dunkelblaue Hosen und Shirts unter dicken Rettungswesten, die sie als Angehörige einer Marineeinheit auswiesen, die anderen waren in Zivil.
«Ich suche DI Lundy», sagte ich.
«Das bin ich.» Einer aus der Gruppe drehte sich um. «Dr. Hunter, nehme ich an?»
Es ist schwer, von der Stimme auf das Aussehen eines Menschen zu schließen, aber in Lundys Fall passte eins perfekt zum anderen. Er war knapp über fünfzig und wie ein alternder Ringer gebaut, der langsam Fett ansetzte, nicht mehr durchtrainiert, aber Kraft und Muskeln waren noch vorhanden. Ein buschiger Schnauzbart ließ ihn wie ein freundliches Walross wirken, während das Gesicht hinter der metallgerahmten Brille gleichzeitig humorvoll und schwermütig dreinblickte.
«Sie sind früh dran. Haben Sie uns gut gefunden?» Er schüttelte mir die Hand.
«Ich war froh über Ihre Wegbeschreibung», gab ich zu. «Sie hatten recht mit dem Navi.»
«Man nennt die Gegend nicht umsonst Backwaters. Kommen Sie, wir besorgen Ihnen einen Tee.»
Ich dachte, wir würden zum Trailer gehen, doch Lundy führte mich zu seinem Wagen, einem zerbeulten Vauxhall, der genauso robust wie sein Besitzer wirkte. Er holte eine große Thermosflasche aus dem Kofferraum und goss dampfenden Tee in zwei Becher.
«Besser als das Zeug aus dem Trailer, glauben Sie mir», sagte er und schraubte den Deckel wieder fest. «Es sei denn, Sie nehmen keinen Zucker? Ich mag es leider süß.»
Ich nicht, trotzdem war ich froh über das heiße Getränk. Und ich wollte mehr über den Fall erfahren. «Schon Glück gehabt?», fragte ich, in den Tee pustend.
«Noch nicht, aber der Hubschrauber sucht seit Sonnenaufgang. Die Marineeinheit steht bereit, sobald wir etwas entdecken, können wir es auch holen. Die leitende Ermittlerin – Detective Chief Inspector Pam Clarke – und der Rechtsmediziner sind auf dem Weg hierher, aber wir haben die Genehmigung, die Leiche zu bergen, falls wir sie vor ihrem Eintreffen finden.»
Ich hatte mich schon gefragt, wo die beiden sein mochten. Bei Leichenfunden an Land waren der leitende Ermittler und der Rechtsmediziner immer vor Ort, denn dort galt der Fundort als Tatort und musste als solcher behandelt werden. Auf See, wo der Körper Tiden und Strömungen ausgesetzt war, hatte die schnellstmögliche Bergung der Leichenreste Vorrang.
«Sie sagten, Sie haben eine ziemlich genaue Vorstellung, wo die Leiche sein könnte?», fragte ich.
«Ja, wir glauben schon. Sie wurde gestern Nachmittag gegen fünf draußen in der Mündung entdeckt. Laut dem Tidenexperten, den wir befragt haben, wechselten da gerade die Gezeiten, sodass die Leiche ziemlich schnell rausgetragen wurde. Wenn sie ins Meer geschwemmt worden ist, vergeuden wir hier unsere Zeit, aber wir gehen davon aus, dass sie vorher gestrandet ist. Sehen Sie das da draußen?»
Er zeigte in Richtung des Mündungsgebiets, und vielleicht eine Meile entfernt konnte ich eine Reihe länglicher brauner Huckel ausmachen, die aus dem Schlick ragten.
«Das sind die Barrows», fuhr Lundy fort. «Sandbänke, die sich quer über das Estuary erstrecken. Sie waren mal kleiner, aber seit weiter oben der Küstenschutz ausgebaut wurde, versandet hier die ganze Region. Hat die Strömungen durcheinandergebracht, und der ganze Sand, der runtergespült wird, landet vor unserer Türschwelle. Nur noch Boote mit geringem Tiefgang kommen rein und raus, deshalb besteht trotz der Flut die Chance, dass der Körper es nicht über die Sandbänke geschafft hat.»
Ich betrachtete die Hügel in der Ferne. «Wenn Sie recht haben, wie planen Sie ihn dann zu bergen?»
Das würde mein Job sein: zu beraten, wie am besten mit der Leiche umzugehen wäre, falls diese in einem so schlechten Zustand war, dass sie auseinanderzufallen drohte. Lundy pustete sanft in seinen Tee.
«Wenn wir erst da draußen sind, bleibt uns nur: Augen zu und durch. Wir hatten überlegt, die Leiche in den Hubschrauber hochzuwinden, aber der Sand ist zu weich, um darauf zu landen. Was bedeutet, dass mindestens zwei Personen auf die Sandbank hinuntergelassen werden müssten, und wenn die stecken bleiben, haben wir den Salat. Also nehmen wir das Boot, wenn der Helikopter fündig geworden ist. Wir können nur hoffen, dass uns noch genug Zeit bleibt, bevor die Flut alles wegschwemmt.» Er grinste mich an. «Ich hoffe, Sie haben Gummistiefel dabei.»
Ich hatte sogar noch eine Wathose mitgenommen, denn ich wusste aus Erfahrung, wie nass Wasserbergungen sein konnten. Und diese hier versprach schwieriger als andere zu werden. «Sie sagten auch, Sie wüssten vielleicht, um wen es sich handelt?»
Lundy schlürfte seinen Tee und tupfte sich den Schnauzbart ab. «Stimmt. Ein einunddreißig Jahre alter Mann namens Leo Villiers, der vor einem Monat als vermisst gemeldet wurde. Der Sohn von Sir Stephen Villiers?»
Der Name sagte mir nichts. Ich schüttelte den Kopf. «Nie gehört.»
«Hier in der Gegend ist die Familie wohlbekannt. Das ganze Land da drüben?» Er zeigte auf die andere Seite des Estuary. Sie schien etwas höher zu liegen als die, auf der wir standen; anstelle von Salzmarschen und Wasserwegen erstreckten sich dort bewirtschaftete Felder, unterteilt von dunklen Hecken. «Das sind die Ländereien der Villiers’. Zumindest ein Teil davon. Auf dieser Seite gehört ihnen auch ein ganze Menge Land. Sie betreiben Landwirtschaft, aber Sir Stephen hat seine Finger in allem Möglichen. Ölschiefer, Fertigungstechnik. Diese Austernschuppen gehören ihm auch. Er hat den Betrieb vor zehn Jahren aufgekauft und dichtgemacht. Und alle entlassen.»
«Das ist bestimmt gut angekommen.» Ich verstand allmählich, wo der Druck herrührte, von dem Lundy am Telefon gesprochen hatte.
«Nicht so schlecht, wie man denken würde. Er plant, hier einen Yachthafen zu bauen. Redet davon, im Mündungsgebiet Kanäle auszuheben, ein Hotel zu errichten, die ganze Region zu verwandeln. Das würde Hunderte von Jobs bringen, da war die Schließung der Austernfischerei ein nicht ganz so harter Schlag. Aber die Umweltschützer laufen Sturm, und solange die Planungsstreitigkeiten andauern, hat er hier alles eingemottet. Er kann sich den langen Atem leisten und hat genug politischen Einfluss, um sich am Ende durchzusetzen.»
Das war bei solchen Leuten meistens so. Ich betrachtete das schlammige Bett des Mündungsgebiets, das sich bereits wieder mit Wasser füllte. «Welche Rolle spielt sein Sohn bei alldem?»
«Keine. Jedenfalls nicht direkt. Leo Villiers war das, was man als schwarzes Schaf bezeichnet. Einzelkind, die Mutter früh gestorben. Wurde aus einem privaten Militärinternat rausgeworfen und hat im letzten Studienjahr das University Officer Training Corps geschmissen. Sein Vater hat es trotzdem geschafft, ihn an der Militärakademie unterzubringen, aber er hat keinen Abschluss gemacht. Ohne offizielle Begründung, vermutlich hat sein Vater seine Beziehungen spielen lassen, um den Rausschmiss unter den Teppich zu kehren. Danach war er in einen Skandal nach dem anderen verwickelt. Von seiner Mutter hatte er einen Treuhandfonds, musste also nicht arbeiten, und es schien ihm Spaß zu machen, sich Ärger einzuhandeln. Gut aussehender Bursche, wie ein Fuchs im Hühnerstall bei den Mädchen, aber auf unschöne Art. Hat mehrere Verlobungen gelöst und sich in alle möglichen Schwierigkeiten gebracht, von Alkohol am Steuer bis zu schwerer Körperverletzung. Sein Vater will den guten Namen um jeden Preis schützen, seine Anwälte hatten also alle Hände voll zu tun. Aber nicht mal Sir Stephen konnte alles vertuschen.» Lundy warf mir einen besorgten Blick zu. «Das ist natürlich vertraulich.»
Ich verkniff mir ein Grinsen. «Ich sage kein Wort.»
Er nickte zufrieden. «Jedenfalls, um es kurz zu machen, eine Zeitlang schien es, als wäre er ruhiger geworden. Sein Vater muss das angenommen haben, denn er hat versucht, ihn in der Politik unterzubringen. Er sollte als Parlamentskandidat aufgestellt werden, hat Interviews in der Lokalpresse gegeben. Das ganze übliche Brimborium. Dann war plötzlich alles vorbei. Die Partei hier vor Ort hat sich einen anderen Kandidaten gesucht, und Leo Villiers ist abgetaucht. Wir haben noch nicht rausfinden können, warum.»
«Und in dem Moment ist er verschwunden?»
Lundy schüttelte den Kopf. «Nein, die Sache ist viel länger her. Aber jemand anders ist damals verschwunden. Eine Frau aus der Gegend, mit der er eine Affäre hatte.»
Da begriff ich, dass ich falschgelegen hatte. Es ging hier nicht darum, einen Vermissten zu finden, und Lundys Zurückhaltung hatte nichts damit zu tun, dass ein einflussreicher Vater besänftigt werden musste. Ich hatte angenommen, Leo Villiers wäre das Opfer, aber das stimmte nicht.
Er war der Verdächtige.
«Wie gesagt: Das ist streng vertraulich.» Lundy senkte die Stimme, obwohl niemand in der Nähe war. «Es spielt nicht direkt eine Rolle, aber Sie sollten über den Hintergrund Bescheid wissen.»
«Sie denken, Leo Villiers hat sie getötet?»
Der DI zuckte mit einer Schulter. «Wir haben ihre Leiche nie gefunden und konnten nichts beweisen. Aber er war der Einzige, der ernsthaft in Frage kam. Sie war Fotografin, vor zwei, drei Jahren aus London hergezogen, nachdem sie geheiratet hatte. Emma Darby – glamourös, sehr attraktiv. Nicht, was man hier erwarten würde. Er hat sie beauftragt, die Fotos für seine Wahlkampagne zu machen, und dann hat sie in seinem Haus ein paar Räume eingerichtet. Sowohl seine Haushälterin als auch der Gärtner haben unabhängig voneinander ausgesagt, in seinem Schlafzimmer eine halbnackte Frau gesehen zu haben, auf die Darbys Beschreibung passte.» Er spitzte missbilligend die Lippen, tastete seine Jackentasche ab, zog eine Packung Magentabletten heraus und drückte zwei davon aus der Folie. «Anscheinend haben sie sich überworfen», sagte er mit den Tabletten im Mund. «Wir haben mehrere Zeugen, die gehört haben, dass sie ihn auf irgendeinem protzigen Politevent angebrüllt und als arroganten Scheißwichser tituliert hat. Kurze Zeit später ist sie verschwunden.»
«Haben Sie ihn befragt?»
«Hat nichts gebracht. Er stritt die Affäre ab, hat gesagt, sie hätte sich ihm an den Hals geschmissen, und er hätte abgelehnt. Bei seiner Vorgeschichte war das schwer zu glauben, vor allem, weil er für den Tag ihres Verschwindens kein Alibi hatte. Hat behauptet, unterwegs gewesen zu sein, aber keinen Ort genannt oder irgendetwas, das seine Geschichte bestätigt hätte. Offensichtlich hatte er etwas zu verbergen, aber ohne Leiche oder Beweise waren uns die Hände gebunden. Wir haben die Gegend um das Haus herum abgesucht, in dem Emma Darby gewohnt hat, doch die besteht hauptsächlich aus Salzmarschen und Schlick und ist zu Fuß nicht passierbar. Idealer Ort, um eine Leiche loszuwerden. Da zu suchen, wäre an sich schon eine Mammutaufgabe. Dazu haben Sir Stephens Anwälte uns ständig Steine in den Weg gelegt und mit Anzeigen wegen Belästigung und Verleumdung gedroht, wenn wir Leo Villiers auch nur schief angesehen haben. Und dann ist er ebenfalls verschwunden, und das war’s mehr oder weniger.»
Ich dachte an das, was Lundy mir gestern Abend am Telefon erzählt hatte. «Sie sagten, sein Verschwinden sei nicht verdächtig, aber jemand wie er muss doch Feinde haben. Was ist mit Emma Darbys Ehemann?»
«Oh, den haben wir uns vorgeknöpft. Komisches Paar, ehrlich gesagt. Es war kein Geheimnis, dass die Ehe bereits in Schwierigkeiten steckte, bevor sie sich mit Villiers eingelassen hat, und natürlich stand ihr Mann unter Verdacht. Aber er hatte ein hieb- und stichfestes Alibi. Als seine Frau verschwand, war er außer Landes, und als ihr Liebhaber vermisst wurde, oben in Schottland.» Lundy zog die Mundwinkel nach unten. «Sie haben recht, was Villiers’ Feinde angeht, und ich denke, kaum jemand hat ihm eine Träne nachgeweint. Aber nichts deutet darauf hin, dass irgendwer sich etwas hätte zuschulden kommen lassen oder dass irgendetwas Verdächtiges an der Sache wäre. Es gibt einen Bericht, dass der Gärtner kurz vor Villiers’ Verschwinden irgendeinen Streuner vom Gelände verscheuchen musste, aber das war vermutlich nur ein Teenager aus der Gegend.»
Ich betrachtete die Austernschuppen, hinter denen das schlammige Flussbett jetzt von Wasser bedeckt war. «Sie glauben also, Villiers hat sich selbst getötet?»
Die Vorsicht des DI am Telefon ließ mich nicht an einen Unfall glauben. Lundy zuckte mit den Schultern. «Er hat unter großem Druck gestanden, und wir wissen von mindestens einem Selbstmordversuch in seiner Jugend. Wir versuchen immer noch, an seine Arztakten heranzukommen, aber dem Hörensagen nach litt er offensichtlich schon lange an Depressionen. Und es gab einen Brief.»
«Einen Abschiedsbrief?»
Er verzog das Gesicht. «Offiziell nennen wir es nicht so. Sir Stephen lässt keinen Verdacht auf einen Selbstmord seines Sohnes zu, wir müssen also äußerst vorsichtig vorgehen. Außerdem wurde der Brief im Papierkorb gefunden, es war also entweder ein Entwurf, oder Leo hat es sich anders überlegt und doch nichts schreiben wollen. Aber dort stand in seiner Handschrift, dass er nicht weitermachen könne und sein Leben hasse. So was eben. Und die Haushälterin, die den Brief fand, hat uns gesagt, dass auch seine Schrotflinte fehlte. Ein von Mowbry and Son’s handgefertigtes Stück. Kennen Sie die?»
Ich schüttelte den Kopf. Mit den Auswirkungen von Schusswaffen war ich deutlich besser vertraut als mit den Herstellern.
«Sie sind in einer Liga mit Purdey, was maßangefertigte Schusswaffen angeht. Wunderschöne Handarbeit, wenn man so was mag, und unglaublich teuer. Er hat sie zum achtzehnten Geburtstag von seinem Vater bekommen. Muss fast so viel gekostet haben wie mein Haus.»
Eine billigere Flinte wäre genauso tödlich gewesen. Aber ich begann zu verstehen, warum Lundy sich gestern so zurückhaltend geäußert hatte. Es ist für jede Familie schwer, mit einem Selbstmord umzugehen, erst recht, wenn der Tote auch noch unter Mordverdacht gestanden hat. Für Eltern ein doppelter Schlag, kein Wunder also, dass Sir Stephen Villiers das Ganze leugnen wollte. Ihn unterschied nur, dass er über genug Geld und Macht verfügte, um sich durchzusetzen.
Was schwieriger werden könnte, wenn es wirklich die Leiche seines Sohns war.
Der Hubschrauber war immer noch als Punkt in der Ferne zu sehen, doch der Wind trieb das Geräusch jetzt von uns weg. Er schien sich nicht mehr zu bewegen.
«Wieso glauben Sie, dass da draußen Villiers und nicht Emma Darby liegt?»
«Weil sie vor sieben Monaten verschwunden ist. Ich glaube kaum, dass ihr Körper nach so langer Zeit noch auftauchen würde.»
Er hatte recht. Wenn die in den Lungen gefangene Luft entwichen war, sank der Körper üblicherweise ab, bis er von Verwesungsgasen wieder an die Oberfläche aufgetrieben wurde. Dann blieb er schwimmfähig, bis er entweder zerfiel oder die Gase sich schließlich verflüchtigten. Je nach Temperatur und Umgebung konnte das Wochen oder länger dauern. Sieben Monate waren allerdings zu lang, vor allem im relativ flachen Wasser einer Flussmündung. Die Kombination aus Gezeiten, Meeresaasfressern und hungrigen Möwen hätte längst ihren Tribut gefordert.
Trotzdem gab es noch etwas, das ich nicht kapierte. Ich versuchte, die Puzzleteile, die ich von Lundy hatte, zusammenzusetzen. «Leo Villiers ist also erst sechs Monate nach Emma Darby verschwunden?»
«Ungefähr, genau wissen wir es nicht. Zwischen dem letzten Mal, dass jemand Kontakt zu ihm hatte, und der Vermisstenmeldung ist eine Lücke von zwei Wochen, aber wir sind einigermaßen sicher, dass …»
Er brach ab, als am Kai ein Pfeifen ertönte. Einer der Marinesoldaten kam zwischen den Austernschuppen zum Vorschein, hielt einen Daumen hoch und drehte wieder um.
Lundy schüttelte die letzten Tropfen aus seinem Becher. «Ich hoffe, Sie haben Lust, sich nasse Füße zu holen, Dr. Hunter», sagte er und schraubte den Becher wieder auf die Thermoskanne. «Sieht so aus, als hätte der Hubschrauber was gefunden.»
Kapitel 3
Salz brannte auf meinem Gesicht, als das Polizeiboot sich zur Seite krängte. Ich wischte mir über die Augen und klammerte mich am Sitz fest, während wir über das Wasser flogen und hüpften. Die See war hier nicht besonders rau, doch wir kämpften gegen Tide und Wind an. Die Wellen erschütterten das Boot und sprühten kalte Gischt ins offene Cockpit.
Es war inzwischen taghell, auch wenn von der Sonne im wolkenverhangenen Himmel nur ein diffuses Glühen zu sehen war. Der Gummigeruch des Bootes mischte sich mit Dieselschwaden und dem Geruch der salzverkrusteten Seile. Der Marinesergeant stand am Ruder und lenkte das Boot geschickt über die Wellen, ich saß mit Lundy und drei Marinesoldaten in Rettungswesten hinter ihm. Damit war das Boot voll. Außer uns befanden sich noch zwei Stapel Schrittplatten aus Aluminium an Bord, jeder auf einer Seite, um das Boot nicht aus dem Gleichgewicht zu bringen, sowie eine Trage.
Als wir frontal auf eine Welle krachten, wurde ich fast aus dem Sitz geschleudert. Lundy lächelte mich an, seine Brille war voller Wasserspritzer. «Alles klar bei Ihnen?», brüllte er über das Tosen des Windes und des Motors hinweg. «Wir sollten bald da sein.»
Ich nickte. In meiner Jugend war ich gesegelt, normalerweise hätte mir die stürmische Fahrt nichts ausgemacht. Aber sie brachte das Schwächegefühl vom Aufwachen zurück. Ich tat mein Bestes, es zu ignorieren. Auch ich trug eine Rettungsweste, meine war hellorange, nicht dunkelblau wie die der Marine. Die brusthohe Wathose und der wasserfeste Overall, den ich noch darunter trug, waren beim Sitzen unbequem. Aber wenn ich mir die schlammigen Ufer ansah, wusste ich, dass ich nachher noch froh darüber sein würde.
Die Flut hatte überraschend schnell eingesetzt. Als ich mich umgezogen und meinen Utensilienkoffer aus dem Auto geholt hatte, war die Marineeinheit bereits dabei, das Boot vom Anhänger zu heben und ins Wasser zu lassen. Der Kanal vor dem Kai war fast völlig geflutet, Wasser klatschte gegen die Rampe.
«Uns bleibt nicht viel Zeit», warnte mich Lundy, als wir an der Sliprampe standen. «Der Hubschrauber hat gemeldet, dass die Leiche halb auf einer Sandbank liegt, aber nicht lange dort bleiben wird. Die Flut kommt hier schneller, als Sie bis drei zählen können, wir müssen uns also beeilen.»
Und zwar sehr, wie es aussah. Die Bergung der Leiche würde ein Wettlauf mit dem Wasser werden, und ich fragte mich allmählich, ob ich wirklich von Nutzen sein konnte. Es war ja schön und gut, einen forensischen Anthropologen dabeizuhaben, vor allem aber war wichtig, die Leichenreste so schnell wie möglich zu bergen, und dazu waren Lundy und die Marineeinheit auch ohne mich bestens in der Lage.
Trotzdem war ich froh über die Chance, die Überreste in situ begutachten zu können, selbst wenn nicht viel Zeit dafür bliebe. Ich starrte über den stumpfen Bug hinweg nach vorne, als wir tieferes Wasser erreichten und Kurs auf die Barrows nahmen. Die Sandbänke lagen direkt vor uns und bildeten fast über die gesamte Mündung hinweg eine natürliche Barriere. Sie wurden von der steigenden Flut voneinander getrennt, ragten aber als glatte braune Huckel aus dem Wasser wie gestrandete Wale. Dahinter, wo das Mündungsgebiet ins offene Meer überging, erhoben sich drei merkwürdig aussehende Gebilde aus dem Wasser. Sie waren zu weit entfernt, um sie genau erkennen zu können, aber vom Boot aus sahen sie aus wie viereckige Schachteln auf nach außen geneigten Stelzen. Vielleicht Bohrtürme, obwohl sie eigentlich zu dicht an der Küste standen.
Lundy bemerkte meinen Blick. «Das ist eine Seefestung.»
«Eine was?»
Wir konnten uns nur brüllend über den Motorenlärm hinweg verständigen. «Eine Maunsell-Seefestung. Die Armee und die Navy haben die Dinger im Zweiten Weltkrieg entlang der Küste aufgestellt, um die deutschen Schiffe aus den Flussmündungen rauszuhalten. Die dort ist von der Armee. Insgesamt standen da mal sieben durch Brücken verbundene Türme, jetzt sind nur noch diese drei übrig.»
«Wird sie noch benutzt?», schrie ich. Lundys Antwort wurde vom Wind verweht. Ich schüttelte den Kopf. Er beugte sich zu mir.
«Ich sagte, nur von Möwen. Die Armeefestungen sind alle aufgegeben worden. In einigen hatten sich in den Sechzigern Piratensender eingenistet. Einer hier und zwei unten in Red Sands und Shivering Sands in der Themsemündung. Das sind die einzigen, die noch stehen. Ein paar wurden von Schiffen gerammt und sind daraufhin größtenteils abgerissen worden oder auseinandergefallen. Es gab mal das Gerücht, irgendwer wollte diese Festung hier kaufen und ein Hotel oder so was draus machen, aber daraus ist nie etwas geworden.» Lundy schüttelte den Kopf über solche Torheit. «Überrascht mich nicht. Ich würde da nicht übernachten wollen.»
Ich auch nicht, aber für den Moment gab ich weitere Kommunikationsversuche auf. Wir hatten die Barrows fast erreicht, das Boot drosselte den Motor, was zum Glück den Lärm verringerte, und fuhr langsam auf die Sandbank zu. Über uns war jetzt das Dröhnen des Hubschraubers zu vernehmen, der mit blinkenden Signallampen über dem Leichenfundort schwebte.
Der Marinesergeant lenkte das Polizeiboot vorsichtig zwischen den Sandbänken hindurch. Sie lagen wie kleine Inseln im Wasser, die Wellen schwappten gegen ihre glatten Ufer. Nicht mehr lange, dann würde die Flut sie überspülen, und ich sah mit eigenen Augen, warum Lundy gesagt hatte, die Barrows würden das Gebiet fast unpassierbar machen. Schon wenn sie zu sehen waren, war es schwierig genug, zwischen ihnen hindurchzufahren. Unter Wasser verborgen, wären sie tückisch. Wir befanden uns jetzt fast direkt unter dem Hubschrauber. Der Rotorenlärm war ohrenbetäubend, die Luftwirbel drückten die Wasseroberfläche platt.
«Da ist es.» Lundy zeigte auf eine Stelle vor uns, versperrte mir aber mit seinem massigen Körper die Sicht. Als das Boot eine langsame Kurve fuhr, sah ich die Leiche zum ersten Mal. Die Flut hatte sie auf halber Höhe einer schlammigen Sandbank abgelegt, ein tropfnasses Kleiderbündel, das die Stille ausstrahlte, die nur leblosen Dingen oder toten Wesen eigen ist. Sie lag bäuchlings, der Kopf in Wassernähe, die Beine zeigten weg von uns auf die Spitze der Sandbank zu. Eine Möwe landete, hüpfte näher heran, um den Körper zu untersuchen, und verlor rasch das Interesse.
Das sagte mir einiges.
Lundy sprach in sein Funkgerät und hob eine Hand, als der Hubschrauber aufstieg und wegflog. Nach dem Abstellen des Bootsmotors trieb uns der Schwung weiter, bis wir in der plötzlichen Stille mit einem dumpfen Geräusch auf Grund liefen. Darauf aus, mir die Leichenreste schnellstmöglich anzusehen, begann ich, aus dem Boot zu steigen. Die Sandbank machte einen relativ festen Eindruck, hatte aber die kalte, körnige Substanz von nassem Mörtel. Ich fiel fast vornüber, als ich bis zum Knie darin versank.
«Vorsicht», sagte Lundy und packte meinen Arm. «Warten Sie lieber, bis wir die Schrittplatten ausgelegt haben. Hier muss man echt aufpassen, sonst versinkt man bis zur Hüfte in dem Zeug.»
«Danke», sagte ich verlegen und befreite mein Bein. Zum Glück trug ich die Wathose. Jetzt wurde mir klar, warum die Polizei niemanden vom Hubschrauber hatte herablassen wollen. Es wäre unmöglich gewesen, die Leiche zu bergen, ohne selbst einzusinken.
Die Marinesoldaten begannen, mit den Schrittplatten einen Weg zu der Leiche zu legen. Die Platten sanken unter unserem Gewicht ein, Wasser wurde über die Ränder gedrückt. Sie waren schnell verschmiert und glitschig, aber sie würden uns gute Dienste leisten.
Ich hielt mich hinten und betrachtete die willkürliche Lage der Gliedmaßen. Die Flut hatte die Leiche mit dem Gesicht nach unten abgelegt, in dieser Position wäre sie auch getrieben. Sie trug einen langen, dunklen Mantel aus Wachstuch oder ähnlichem Material, schlammverschmiert und von der darin gefangenen Luft aufgebläht. Ein Arm lag seitlich an, der andere über dem Kopf.
Hände und Füße fehlten.
«Bevor wir ihn bewegen, würde ich gerne einen Blick auf ihn werfen», sagte ich zu Lundy, als die Männer die Platten fertig ausgelegt hatten. Er nickte.
«Aber schnell. In ein paar Minuten steht hier alles unter Wasser.»
Er hatte recht. Trotz seiner vorherigen Warnung war ich überrascht, wie schnell die Flut kam. Schon umschwappten kleine Wellen unsere Füße, das Wasser hatte mit dem Auslegen der Platten Schritt gehalten und war bis fast zur Hälfte der Sandbank gestiegen.
Vorsichtig wagte ich mich auf den glitschigen Platten zu der Leiche vor. Sie sah aus wie achtlos dort hingeworfen. Wieder hüpfte eine Möwe auf sie zu, hinterließ pfeilspitzenartig geformte Abdrücke im Sand. Als ich mich näherte, flatterte sie unter protestierendem Gekreisch von dannen. Am zinkfarbenen Himmel kreisten weitere Möwen, doch keine widmete dem, was da auf der Sandbank lag, viel Aufmerksamkeit. Was einiges über den Zustand der Leiche sagte. Wenn sogar hartgesottene Aasfresser wie Möwen kein Interesse zeigten, musste sie bereits sehr verwest sein.
Das fand sich bestätigt, als kurz darauf der Wind drehte und der Gestank verrottenden Fleisches die salzige Luft verätzte. Ich hielt ein paar Meter vor dem Körper an und betrachtete ihn. Obwohl der Tote zusammengekrümmt dalag, ließ sich erkennen, dass er im Leben überdurchschnittlich groß gewesen sein musste. Es handelte sich also wohl eher um einen Mann, obwohl sich das nicht mit letzter Sicherheit sagen ließ: Es konnte auch eine ungewöhnlich große Frau sein. Der Kopf war unter dem Mantel verborgen, der kapuzenartig zusammengeknüllt war, sodass über dem Kragen nur ein paar sandverklebte Haarsträhnen sichtbar waren. Um Arme und Beine hatte sich Seetang gewickelt, und am ganzen Körper waren winzige Bewegungen zu erkennen. Was aussah, als würden einem die Augen einen Streich spielen, waren winzige Krustentiere, Krabben und Wasserinsekten, die auf dem nassen Sand fast unsichtbar blieben.
Ich hockte mich hin, um besser sehen zu können. Aus den Hosenbeinen ragten Beinstümpfe mit bleichen Knochen und Knorpeln hervor, die Unterarme endeten an den Handgelenken. In das geschwollene Fleisch war an einer Seite eine goldene Uhr eingesunken. Von den Füßen und Händen war in der Umgebung nichts zu sehen, was mich allerdings auch überrascht hätte. Zwar wäre dies nicht die erste Leiche, bei der man die Hände entfernt hätte, um eine Identifizierung zu vereiteln, doch ich konnte keine offensichtlichen Anzeichen an den Knochen der Hand- und Fußgelenke entdecken, die darauf hätten schließen lassen. Durch Kleidung nicht geschützt, waren die Hände und Füße einfach abgefallen, nachdem sich das verbindende Weichgewebe der Gelenke aufgelöst hatte.
Ich zog meine Kamera aus der Latztasche meiner Wathose und begann, Fotos zu machen. Lundy hörte ich erst, als er mich ansprach.
«Sie können eine Kopie unseres Videos bekommen.»
Ich sah mich um. Für einen so schweren Mann bewegte er sich überraschend leichtfüßig, sogar auf den Metallplatten. «Danke, ich mache trotzdem ein paar Fotos.» Sollte ich etwas übersehen, konnte ich dann wenigstens nur mir selbst die Schuld geben.
Lundy betrachtete die Leiche. «Allem Anschein nach männlich. Und muss schon ziemlich lange im Wasser liegen, weil die Hände und Füße abgelöst sind. Würde der Zustand der Leiche zum Zeitpunkt von Leo Villiers’ Verschwinden passen?»
Ich hatte die Frage erwartet. Die Berechnung des Todeszeitpunkts war meine Spezialität. Ich war auf der allerersten Body Farm in Tennessee ausgebildet worden, wo sich an menschlichen Kadavern Verwesungsprozesse kontrolliert beobachten ließen. Dort hatte ich gelernt, den Todeszeitpunkt anhand von bakterieller Aktivität und dem Grad der Verwesung zu bestimmen und wie sich mit komplizierten Formeln der Zerfall von flüchtigen Fettsäuren im menschlichen Körper berechnen ließ. Ich konnte ohne falsche Bescheidenheit behaupten, den Lebenszyklus von Schmeißfliegen und den Besiedelungsprozess eines verwesenden Körpers durch verschiedene Insekten genauso gut zu kennen wie ein forensischer Entomologe. Ich führte das lieber auf Erfahrung als auf Instinkt zurück, auf jeden Fall war mir die Fähigkeit, solche Dinge akkurat einzuschätzen, im Laufe der Jahre zur zweiten Natur geworden.
Doch das galt an Land. Dort blieb ein Körper liegen, wo er hingelegt worden war, und die Natur fügte ihren Anteil an messbaren Kriterien hinzu.
Im Wasser war das anders.
Zwar gab es eine Vielzahl von Meeresaasfressern, doch kein im Wasser lebendes Äquivalent der Schmeißfliege, dessen Lebenszyklus eine verlässliche Stoppuhr zur Bestimmung des Zeitraums seit dem Eintritt des Todes hätte darstellen können. Im Wasser wurde ein Körper bewegt, war Strömungen und Tiden und damit Höhen- und Temperaturunterschieden ausgesetzt. Auch Salz- und Süßwasser unterschieden sich und hatten ihre eigenen Kreaturen und Gegebenheiten. Und ein Tidenästuar wie dieses, wo sich der Fluss mit dem Meer mischte, war wieder anders.
Ich betrachtete den Körper. Bis auf die abgerissenen Fuß- und Handgelenke war der Großteil unter dem Mantel verborgen. Trotzdem sah ich genug. «Unter solchen Bedingungen lösen sich Hände und Füße schnell, selbst zu dieser Jahreszeit. Also passt es vermutlich, ja …»
In letzter Sekunde hielt ich das aber zurück. Vier bis sechs Wochen waren in so flachen Gewässern sicherlich ausreichend. Das war es nicht, was mir Sorgen machte, aber ich wollte nichts sagen, bevor ich nicht mehr gesehen hatte.
Lundy musterte mich, als wartete er auf mehr. Als ich schwieg, nickte er. «Kommen Sie, bringen wir ihn ins Boot.»
Ich trat beiseite, als zwei Marinesoldaten mit der Trage über die Platten gestapft kamen. Der Sergeant folgte mit einem Leichensack und einer gefalteten Plastikplane.
«Wie machen wir das?», fragte einer, setzte die Trage ab und betrachtete angewidert den bäuchlings liegenden Leichnam.
«Rollt ihn auf die Plane, dann können wir ihn in den Leichensack heben», wies der Sergeant ihn an. Er wandte sich an Lundy, erst in letzter Sekunde dachte er daran, auch mich einzubeziehen. «Wenn Sie keine anderen Vorschläge haben?»
«Hauptsache, er bleibt in einem Stück», sagte Lundy gleichmütig. «Sind Sie einverstanden, Dr. Hunter?»
Viele Möglichkeiten blieben ohnehin nicht. Ich zuckte mit den Schultern. «Ja, gut. Bitte seien Sie vorsichtig mit ihm.»
Der Sergeant kommentierte meine Bitte mit einem Blick, den er mit einem seiner Männer austauschte. Die Flutwellen spritzten bereits über den Kopf der Leiche hinweg, als die Plastikplane ausgelegt wurde. Die Marinesoldaten waren mit Masken und dicken Gummihandschuhen ausgestattet und trugen brusthohe Wathosen. Da ich genug Fotos gemacht hatte, setzte auch ich eine Maske auf und zog dicke Handschuhe über die dünnen, die ich anhatte.
«Okay, schön mit Gefühl. Hochheben und umdrehen auf drei. Eins, zwei …»
Als der Körper sich langsam aus dem Sand löste und rücklings auf die Plastikplane befördert wurde, stiegen Schwaden fauliger, feuchter Luft auf. Einer der Marinemänner hielt sich den Arm vor die Nase und wandte sich ab.
«Oh, wunderbar.»
Das in den langen Mantel eingehüllte Ding auf der Plastikplane hatte nichts Menschliches an sich. Alter, ethnische Herkunft und Geschlecht waren nicht zu erkennen. Der Schädel war fast gänzlich von Haut und Fleisch befreit, die Augenhöhlen leere Löcher. Die leicht zugänglichen weichen Augäpfel waren eins der ersten Ziele von Aasfressern gewesen. Sogar erste Anzeichen von Adipocire hatten sich gebildet, schmutzig weiße Ablagerungen, die aussahen wie Tropfen von Kerzenwachs. Übrig war die Karikatur eines Gesichts, sandverstopfte leere Augenhöhlen, die Nase nur noch ein angenagter Knorpelstumpf. Angesichts der langen Verweilzeit des Körpers im Wasser war nichts anderes zu erwarten gewesen. Doch der untere Teil des Gesichts fehlte gänzlich. Anstelle des Mundes klaffte ein offener Schlund, durch den das zähe Knorpelgewebe hinten in der Kehle sichtbar war. Der Unterkieferknochen, auch Mandibel genannt, fehlte komplett, im Oberkiefer steckten nur noch einige zersplitterte Zahnstummel. Beim Umdrehen war der Kopf zur Seite gerollt. Da er jetzt nicht mehr vom Mantelkragen bedeckt wurde, war die faustgroße Austrittswunde am Hinterkopf deutlich zu erkennen.
Lundy betrachtete sie ungerührt und wandte sich dann an mich. «Was würden Sie sagen, Dr. Hunter? Eine Schrotflinte?»
Ich merkte, dass ich die Stirn in Falten gelegt hatte, und richtete mich auf. «Sieht danach aus», stimmte ich ihm zu. Der Grad der Zerstörung sah tatsächlich eher nach der explosiven Durchschlagskraft einer Schrotflinte als nach einer Faustfeuerwaffe aus. «Da ist irgendwas hinten in der Kehle.»
Ohne den Körper zu berühren, beugte ich mich näher heran. In dem Gewirr aus Knochen und Gewebe steckte ein Gegenstand: eine kleine bräunliche Scheibe, zu ebenmäßig, um natürlichen Ursprungs zu sein.
«Der Pfropfen einer Schrotpatrone», sagte ich, ohne den Versuch zu unternehmen, ihn herauszuziehen.
Das bestätigte die Waffenart hinreichend, auch wenn sich wahrscheinlich keine Kugeln mehr im Körper finden lassen würden. Schrotpatronenkugeln verteilen sich in dem Moment, in dem sie den Flintenlauf verlassen. Je weiter sie fliegen, desto weiter breiten sie sich aus und desto größer ist die entstehende Schusswunde. Dass diese relativ klein war, ließ vermuten, dass die Kugeln dicht zusammengedrängt gewesen und geblieben waren, als sie das Loch in den Schädel rissen. Das deutete darauf hin, dass der Schuss aus unmittelbarer Nähe abgefeuert worden war.
Direkt am Ziel.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: