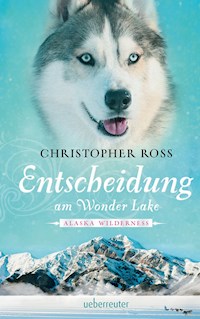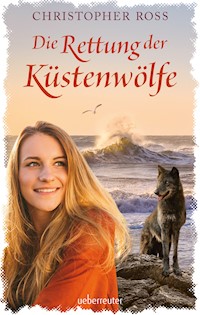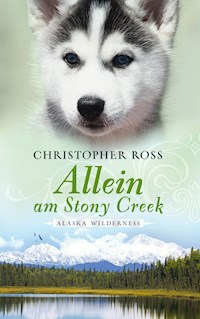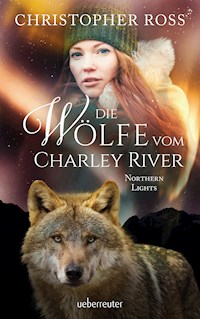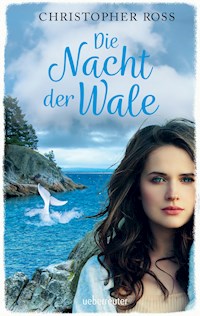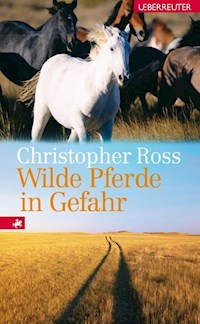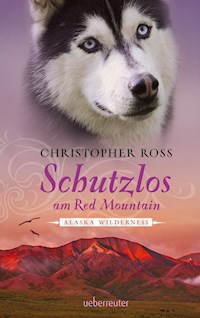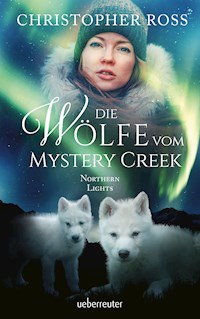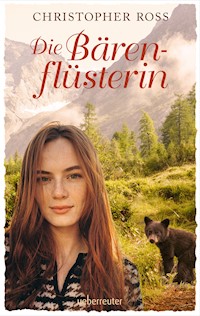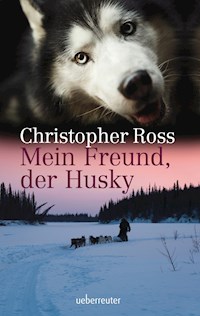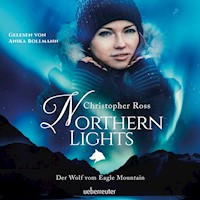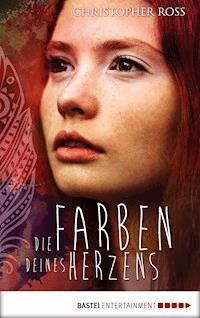
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Baumhaus
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Die 14-jährige Katrina merkt sofort, dass der Neue an der Schule anders ist. Der Indianerjunge aus dem Reservat hat etwas Geheimnisvolles an sich, und sie fühlt sich gleich zu ihm hingezogen. Aber Adam hat zwei Gesichter. Mal ist er total nett und zuvorkommend, doch im nächsten Moment wirkt er abweisend und kühl. Als dann wie aus dem Nichts immer wieder ein Coyote auftaucht, der es gerade auf die Leute abgesehen hat, die ihr und Adam das Leben schwermachen, schöpft Katrina einen unglaublichen Verdacht ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 259
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchÜber den AutorTitelImpressum12345678910111213141516171819202122EpilogÜber dieses Buch
Die 14-jährige Katrina merkt sofort, dass der Neue an der Schule anders ist. Der Indianerjunge aus dem Reservat hat etwas Geheimnisvolles an sich, und sie fühlt sich gleich zu ihm hingezogen. Aber Adam hat zwei Gesichter. Mal ist er total nett und zuvorkommend, doch im nächsten Moment wirkt er abweisend und kühl. Als dann wie aus dem Nichts immer wieder ein Coyote auftaucht, der es gerade auf die Leute abgesehen hat, die ihr und Adam das Leben schwermachen, schöpft Katrina einen unglaublichen Verdacht …
Über den Autor
Christopher Ross wuchs in Frankfurt am Main auf und lebt heute bei München und »on the road«aa in den USA und Kanada. Seit seiner Jugend zieht es ihn nach Nordamerika, immer auf der Suche nach interessanten Begegnungen und neuen Abenteuern. Für seine Bücher wurde er mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, u.a. mit dem Friedrich-Gerstäcker-Preis für das beste Abenteuerbuch des Jahres. Seine Bücher wurden in zwanzig Sprachen übersetzt. Etliche seiner Bücher, darunter Mein Freund, der Husky, Verschollen am Mount McKinley und die Bände der Clarissa-Reihe, sind Bestseller.?
CHRISTOPHER ROSS
DIE FARBEN DEINES HERZENS
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Originalausgabe
Copyright © 2017 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Silvia Bartholl, Frankfurt am Main
Umschlaggestaltung: Manuela Städele-Monverde unter Verwendung von Motiven von © Vectomart/shutterstock, © Transia Design/shutterstock und © Alohattawaii/shutterstock
eBook-Erstellung: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7325-4999-3
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
1
Das Beste an der Senior High waren die Croissants, weich und fluffig und besonders lecker, wenn man sie mit Erdnussbutter und Marmelade bestrich. Dumm war lediglich, dass es die Dinger nur freitags gab. Jeden Montag mussten wir uns mit trockenen Bagels und Cornflakes begnügen. Unser einziger Trost war der Kakao aus dem Automaten. Den konnte man zwar nur mit viel Milch genießen, und zu süß war er auch, aber es gab Schlimmeres. Und so ein kleiner Energiestoß vor dem Unterricht konnte nicht schaden.
Anne und ich saßen an einem Ecktisch in der Cafeteria. In der Junior High hatte es überhaupt kein Frühstück gegeben, da war man vom Schulbus direkt in die Unterrichtsräume gestürmt und hatte es gleich mit Mathe oder Physik zu tun bekommen. In der West Valley Senior High gehörte das Frühstück zu den täglichen Ritualen.
Meine beste Freundin Anne und ich waren Freshmen, soll heißen, wir gehörten zur jüngsten Jahrgangsstufe der Schule. Das waren die, auf denen ständig herumgetrampelt wurde, vor allem von den anderen Schülern. Die älteren Mädels lachten über uns, weil wir noch rot wurden, wenn ein Junge in unserer Nähe auftauchte. Und um bei den Cheerleaders mitzumachen, hatten wir zu viel »Babyspeck«. Ein Junge, der sich mit einer von uns zu einem Date verabredet hätte, wäre bei seinen Freunden unten durch gewesen, und bei den Abschlussbällen durften wir erst recht nicht dabei sein, es sei denn, man wurde eingeladen, und das kam nur alle hundert Jahre mal vor.
Mit Jungs hatte ich wenig im Sinn. Sie kamen mir alle so albern vor, selbst die älteren an der Senior High. Anne war da schon weiter. Mit ihren dunklen Locken und den blauen Augen kam sie bei vielen Jungs an, auch wenn die meisten einen Rückzieher machten, sobald sie ihr Alter erfuhren. Wir waren ja erst vierzehn und rangierten bei den meisten noch unter »junges Gemüse«.
Annes Smartphone summte. Als sie die Nachricht las, wurde sie rot.
»Davy?«, fragte ich. »Sag bloß!«
»Er will mit mir ins Kino gehen.«
»Superhelden bewundern?«
Sie schüttelte den Kopf. »In den Film über die russische Prinzessin, die sich in den Zarensohn verliebt. Nicht gerade sein Ding, sagt er, aber okay, wenn ich mir nächstes Mal mit ihm das Geballere auf einem fremden Planeten ansehe.«
»Davy will mit dir in einen Liebesfilm gehen?«
»Cool, was?« Sie blickte sich um, als hätte sie Angst, dass uns jemand belauschte, aber die meisten kümmerten sich nur um sich selbst oder grüßten uns flüchtig. »Ich weiß, Davy kommt ein wenig langweilig rüber. Aber das täuscht, Katrina. Das sind nur seine Klamotten. Seine Eltern haben wenig Kohle, und er steht sowieso nicht auf den modischen Kram.« Sie lächelte. »Er ist irgendwie süß, findest du nicht?«
»Ich kenn ihn doch gar nicht.« Davy ging auf eine andere Highschool.
»Er will mich mal von der Schule abholen, dann stell ich ihn dir vor. Solange du ihn mir nicht ausspannst.« Sie grinste. »Er ist wirklich nett. Zehnmal netter als der Angeber, der gerade zur Tür reinkommt.« Sie deutete quer durch den Raum auf einen älteren Jungen und seine Freundin, die gemeinsam in die Cafeteria spazierten.
Mit ihrem Auftauchen verstummte auch das leiseste Gemurmel. Die Blicke aller Anwesenden richteten sich auf die beiden, als hätten soeben der König und seine Gemahlin den Raum betreten. Und so war es ja auch. Selbst in unserem Jahrgang hatte sich inzwischen herumgesprochen, dass Jennifer Nolan beim Abschlussball des letzten Semesters zur Homecoming Queen gewählt worden war und mit Jason McGarrett im Scheinwerferlicht gestanden hatte.
»Heilige Makrele!«, flüsterte ich. »Die beiden haben mir noch zu meinem Glück gefehlt!« Der Mädchenschwarm unserer Schule, ein All-American Boy, der mit seiner athletischen Figur und der gebräunten Haut eher nach Kalifornien oder Hawaii gepasst hätte, und die attraktive Cheerleaderin, blonde Naturlocken, Beine bis zum Hals und sündhaft teure Klamotten. »Kein Wunder, dass ihr die Jungs zu Füßen liegen. So werden wir nie aussehen.«
»Sie hat reiche Eltern. Mit Geld lässt sich einiges machen.«
»Wir könnten eine ganze Woche beim Friseur sitzen und würden niemals so aussehen«, widersprach ich. »Diese It-Girls sind eine ganz besondere Rasse. Hübsch und gestylt bis zum Gehtnichtmehr, aber dafür oft dumm wie Stroh. Wie geschaffen für muskelbepackte Dummköpfe wie diesen Jason.«
»Bist du etwa eifersüchtig?«
»Auf Jennifer? Nicht die Bohne!« So ganz ehrlich klang es nicht.
»Jason hat schon was«, sagte Anne.
»Solange er den Mund hält«, konterte ich. »Einen knackigen Hintern hat er ja, aber was will ich mit einem Typen, der den ganzen Tag von Football und schnellen Autos spricht und mir an die Wäsche will? Nee, soll Jennifer doch glücklich mit ihm werden. Ich will Jason bestimmt nicht.«
»Aber du würdest ihn auch nicht davonjagen.«
»Hab ich schon«, erwiderte ich ernst. »Ich hab’s dir nicht erzählt, aber letzte Woche hat er mich blöd angemacht. Ich wäre gar nicht so übel für eine Freshman-Tussi. Dabei wollte ich gar nichts von ihm. Bin gestolpert und hab mich an seiner Jacke festgehalten. Weiter nichts.«
»Ziemlich plumpe Anmache. Hast du deshalb nichts gesagt?«
»Es war reiner Zufall, ich schwör’s. Sonst hätte ich mich eben an einem anderen festgehalten. Immer noch besser, als auf die Nase fliegen und sich zum Gespött der Leute machen. Woher sollte ich denn ahnen, dass Jason so ein großes Ding daraus macht?«
»Und wenn er dich mag?« Anne meinte es tatsächlich ernst. »Wenn Jungs so was sagen, meinen sie oft was ganz anderes. Hab ich in einem Film gesehen. Da schimpft und nörgelt dieser Typ fast den ganzen Film lang an einer hübschen Kollegin rum, um am Ende mit ihr … na, du weißt schon.«
»Das ist ja auch noch nicht alles«, sagte ich. »Du hättest mal hören sollen, wie der über Indianer spricht, sogar vor Schülern aus dem Reservat. Als wollte er sich unbedingt mit ihnen anlegen. Für so ein rassistisches Geschwätz könnten sie ihn glatt von der Schule werfen.« Wie so oft, wenn es um Indianer ging, hatte ich mich in Rage geredet. »Wir sind doch nicht beim Ku-Klux-Klan.«
»Diese Geheimbündler hätten noch was ganz anderes mit den Indianern gemacht. Aber hier in South Dakota haben die keine Chance. Und über das Gelaber von Jason würde ich mir keinen Kopf machen, der will doch nur seiner Jennifer imponieren.« Wir standen auf und stellten unsere schmutzigen Becher in die Ablage. »Du bist eben empfindlicher als alle anderen, wenn es um Indianer geht. Bevor ich nach South Dakota kam, wusste ich auch nicht, wie schlecht es ihnen in den Reservaten geht. Wer fährt schon freiwillig nach Pine Ridge? Deine Eltern vielleicht. Seid ihr nicht das ganze Wochenende im Reservat unten gewesen?«
Ich schob mich an einigen Schülern vorbei. Der Unterricht begann in wenigen Minuten, und auf einmal hatten es alle eilig. »Ja. Mit einem befreundeten Professor aus Florida. Der wollte sich vor Ort informieren und war entsetzt, wie schlecht es den Leuten im Reservat geht. Pine Ridge ist so ziemlich das armseligste Stück Land, das man in South Dakota finden kann.«
Ich war wieder mal bei meinem Lieblingsthema angekommen und hätte wahrscheinlich noch eine Weile weitergeredet, wäre in diesem Augenblick nicht etwas Seltsames passiert. Das Licht ging aus. Aufgeregtes Gemurmel setzte ein. Irgendwo lachten einige Mädels. Nicht weiter schlimm, dachte ich. Immerhin war es draußen schon einigermaßen hell, und die Straßenlampe vor dem Fenster war vom Stromausfall nicht betroffen. Wenn es denn einer war.
In der Schule fiel öfter mal der Strom aus, aber meist sprang er schon nach wenigen Sekunden wieder an. So auch dieses Mal. Doch in das Knacken, das beim Einschalten erklang, mischte sich ein seltsames Fauchen, und über die Wand hinter dem Tresen huschte der Schatten eines Hundes. Oder war es ein Wolf? Ein Coyote? So genau ließ sich das in der Eile nicht feststellen. Wahrscheinlich bildete ich mir den fauchenden Vierbeiner sowieso nur ein. Hunde waren an unserer Schule streng verboten, von Wölfen und Coyoten ganz zu schweigen. Es sei denn, der Hund des Hausmeisters hatte sich verirrt.
Das Licht flammte auf, und wir drängten weiter in den Flur.
»Hast du den Hund gesehen?«, fragte ich vorsichtig.
»Welchen Hund?«
»Ich dachte, ich …« Ich sah Annes ungläubigen Blick und wechselte rasch das Thema. »Wahrscheinlich nur Einbildung. Liegt sicher an dem Krach in der Cafeteria. Du hast Mathe, oder? Sehen wir uns heute Mittag zum Essen?«
Meine Freundin wirkte bedrückt. »Wenn ich dann noch lebe. Mrs. Stark lässt uns heute einen Test schreiben. Sie will sehen, ob wir schlau genug für die Fortgeschrittenen sind. Das wird bestimmt haarig. Vielleicht hätte ich doch den einfacheren Kurs nehmen sollen.«
»Mit uns Normalsterblichen?« Ich schüttelte lachend den Kopf. »Nix da. Du bist ein Mathegenie und wirst sicher mal Buchhalterin oder so was. Du brauchst die Herausforderung. Und den Test schaffst du mit links, ganz sicher.«
»Meinst du wirklich?«
»Logisch. Bis heute Mittag!«
An der großen Treppe trennten sich unsere Wege. Mrs. Stark unterrichtete im ersten Stock. Ich hatte mich für Sozialkunde eingeschrieben, weil dort viel diskutiert wurde und ich vorhatte, später wie mein Vater an der Uni zu unterrichten. Falls ich einigermaßen durch die Highschool kam und anschließend das College schaffte … Meine Mutter arbeitete ebenfalls an der Uni, war aber in der Verwaltung tätig, weil sie ein Händchen für Listen und Zahlen hatte. Nicht gerade meine Stärke.
Ich öffnete meinen Spind und blickte erschrocken auf die Hundehaare, die zwischen den Fotos auf der Innenseite der Tür klebten. Sechs graue Haare unterhalb der »Miss Lakota Nation«, einer indianischen Schönheitskönigin, die beim letzten Rodeo groß abgeräumt hatte. Die Haare hingen an einem durchsichtigen Klebestreifen, der sich bereits halb gelöst hatte. Ich berührte sie wie etwas Verbotenes und war überrascht, wie rau sie sich anfühlten. Zum Jagdhund des Hausmeisters gehörten sie schon mal nicht, der war braun und ließ sich nie im Flur blicken.
Hatte sich jemand einen Scherz erlaubt und die Haare an meine Tür geklebt, während ich den offenen Schrank aus den Augen verloren hatte? Total lustig, dachte ich. Hundehaare an der Schranktür. Na ja, immer noch besser als Ketchup oder eine Stinkbombe, auch die hatte man schon in Spinden gefunden. Vielleicht gehörten die Hundehaare zu irgendeinem albernen Ritual, mit dem die älteren Schüler die Freshmen willkommen hießen. Zuzutrauen wäre humorlosen Typen wie Jason ein solcher Scherz.
Ich riss die Hundehaare herunter und ließ sie auf den Boden fallen. Ohne weiter darüber nachzudenken, schnappte ich mir mein Geschichtsbuch und mein Notizheft und folgte den anderen in den Unterrichtsraum. Mein Stammplatz in der zweiten Reihe am Fenster war noch frei. Jennifer und Jason hatten es sich in der letzten Reihe bequem gemacht und empfingen mich mit spöttischen Blicken, zumindest kam es mir so vor.
Kaum saß ich, betrat Smokey den Raum. Eigentlich hieß er Erastus Brown. Aber keiner nannte ihn so. Seinen Spitznamen hatte der bärtige Lehrer bekommen, weil er dem Cartoon-Bären des National Park Service so ähnlich sah. Er war auch genauso gutmütig, wohl der Hauptgrund dafür, dass Jennifer und Jason in seinem Kurs saßen. Er als Quarterback des Footballteams und sie als Captain der Cheerleader brauchten keine Angst zu haben, das Klassenziel nicht zu erreichen, und ein Lehrer wie Smokey würde niemals wagen, ihnen mit einer schlechten Note die Karriere zu verbauen.
»Wie wir alle wissen, leben wir in den ehemaligen Jagdgründen der Lakota-Indianer«, begann Smokey mit dem Unterricht. »Die Black Hills waren ihnen heilig, doch als Gold in den Bergen gefunden wurde, brachen die Weißen die Verträge und trieben die Lakota in Reservate, wo sie vor allem auf die Lebensmittellieferungen der Regierung angewiesen waren. Ein trauriges Kapitel unserer Geschichte.« Er lehnte sich gegen seinen Schreibtisch. »Kann mir denn jemand sagen, wie die Lakota lebten, bevor die Weißen nach Westen kamen?« Er sah, dass ich mich meldete, rief aber Jasons Namen auf.
»Sie lebten in Tipis und jagten Büffel«, antwortete Jason ausnahmsweise mal richtig, schob aber gleich hinterher: »Das sollten sie mal wieder tun, anstatt zu betteln und den Weißen auf der Tasche zu liegen. Ich dachte, mit ihrem neuen Casino verdienen sie ordentlich Geld?«
»So viel ist das nicht«, hielt ich ihm entgegen. Manchmal hatte ich eine ziemlich große Klappe. »Das meiste Geld fließt in die Taschen weißer Geschäftsleute, und neue Stellen gibt es in den Casinos auch nicht wirklich. Wer Arbeit hat, wird so schlecht bezahlt, dass er damit kaum über die Runden kommt.«
»Klugscheißerin«, zischte Jason.
Jennifer lachte.
Die meisten Schüler fielen in ihr Lachen ein, vor allem die Mädchen, die ihr zu Füßen lagen, weil sie hofften, auf diese Weise bei den Cheerleadern aufgenommen zu werden. Das entschied zwar immer noch Miss Baxter, aber ein Mädchen, das Jennifer vorschlug, konnte sie schlecht ablehnen. Feiglinge, hätte ich am liebsten laut gerufen. Wenn sie euch befehlen würde, in den Missouri zu springen, würdet ihr es wahrscheinlich auch tun.
Smokey löste sich von seinem Schreibtisch und blieb vor mir stehen, behielt aber auch Jason und Jennifer im Blick. »Katrina hat recht«, sagte er. »Gegen die Armut ist kein Kraut gewachsen. Deshalb klammern sich auch viele Lakota an ihren alten Glauben. Wer weiß, wie sie ihren Gott nannten?«
Diesmal ließ ich den Finger unten. Ein Mädchen, das zumindest teilweise indianisches Blut in den Adern hatte, meldete sich und antwortete: »Wakan tanka. Das wird meist mit ›Großer Geist‹ übersetzt. Wakan tanka ist in allen Lebewesen und Dingen lebendig, sogar in den Steinen am Wegesrand. Viele glauben an beide, Gott und Wakan tanka.«
»Praktisch«, lästerte irgendjemand.
Während Smokey über den Sonnentanz sprach, mit dem die Prärieindianer alljährlich das Erwachen der Natur feierten, blickte ich durch das Fenster auf den Parkplatz vor dem Schulgebäude hinunter. Zwischen den Fahrrädern streunte ein Hund umher. Aus der Ferne konnte ich zunächst nicht erkennen, um was für eine Rasse es sich handelte, aber als er sich dem Fenster zuwandte, schnappte ich nach Luft. Ein Coyote?
Ich drehte mich zu meiner Nachbarin um. »Siehst du den Hund?«
Sie blickte an mir vorbei. »Was ist mit ihm?«
»Er sieht aus wie ein Coyote, oder?«
»Keine Ahnung. Könnte auch ein Jagdhund oder ein Schäferhund sein. So wie der vom Hausmeister.«
»Aber der ist braun.«
»Was gibt’s denn da unten zu sehen?« Smokey war unbemerkt neben uns getreten und blickte ebenfalls in den Hof hinab. »Ich wusste gar nicht, dass ein Parkplatz so aufregend sein kann.«
Ich trat die Flucht nach vorn an. »Ich dachte, ich hätte einen Coyoten gesehen, aber das kann nicht sein, nicht mitten in der Stadt, das weiß ich auch. Wahrscheinlich nur ein Hund. Tut mir leid, Mr. Brown. Ich war abgelenkt.«
»Und das ausgerechnet bei einem Thema, das dir wie auf den Leib geschneidert sein müsste. Was könnte denn der Coyote damit zu tun haben?«
»Der Coyote? Mit dem Glauben der Lakota?«
Ich überlegte eine Weile und erinnerte mich an eine Geschichte, die mir mein Vater während einer Autofahrt erzählt hatte. Von Coyote, dem Trickster, einem gemeinen Fabelwesen, das den Menschen derbe Streiche spielte. Manchmal zu ihrem Vorteil, wesentlich öfter aber zu ihrem Nachteil. Eine Figur, die in zahlreichen Legenden vorkam.
»Coyote, der Trickster?«
Smokey kehrte lächelnd zu seinem Pult zurück. »Genau den meine ich. Ich hoffe nicht, dass der Bursche da unten irgendwas mit ihm zu tun hat. Auf jeden Fall möchte ich euch bitten, euch gedanklich schon mal mit dem seltsamen Gesellen zu beschäftigen. In der nächsten Stunde werden wir ausführlich über ihn sprechen.«
Ich packte verwirrt meine Sachen zusammen. Wie in Trance ging ich zum Spind und schloss mein Geschichtsbuch ein. Die Hundehaare an der Tür kamen mir in den Sinn. Und der Schatten, den ich nach dem Stromausfall gesehen hatte. Oh Mann!, rief ich mich zur Ordnung. Coyote ist ein Fabeltier, und es gibt ihn nur in indianischen Märchen. Bevor ich noch tiefer in meinen Gedanken versinken konnte, erklang ein gefährliches Fauchen hinter mir, und ein bedrohlicher Schatten fiel über mich.
2
Ich fuhr erschrocken herum und sah Jason und Jennifer vor mir stehen. Hinter ihnen drängelten sich neugierige Schüler, die auf keinen Fall verpassen wollten, wie ihre Helden eine vorlaute »Neue« zurechtstutzten. »Was gibt’s?«, fragte ich.
Es fiel mir schwer, die Nerven zu behalten, aber ich blieb ruhig. Ich zitterte nur ein bisschen, als ich das Buch aus meinem Spind holte, das wir gerade in Englisch lasen. Ich schloss die Schranktür und blieb unschlüssig stehen.
»Du hast eine mächtig große Klappe, weißt du das?« Jennifer gab sich betont lässig und lächelte so arrogant, dass ich ihr am liebsten eine gescheuert hätte. Sie blickte Jason an. »Als wir noch Freshmen waren, hätten wir niemals eine solche Lippe riskiert. Stimmt’s?«
»Nie im Leben«, erwiderte Jason. Er benahm sich lange nicht so überheblich wie seine Freundin. Ich hatte sogar den Eindruck, ihm wäre ihr Auftritt peinlich.
»Also spiel dich gefälligst nicht so auf, Kiddo«, giftete Jennifer. »Klugscheißerinnen wie dich können wir nicht brauchen. Immer schön halblang, okay?«
Jennifer ging mir gewaltig auf die Nerven. »Ich bin nicht dein Kiddo«, wehrte ich mich. »Und nur, weil du weiter bist als ich, hast du noch lange nicht das Recht, mir Vorschriften zu machen. Kümmere dich gefälligst um deinen eigenen Kram!«
Die Gaffer hatten wohl nicht damit gerechnet, dass ich mich gegen Jennifer auflehnen würde, und blickten mich entweder erstaunt an oder lächelten verlegen. Sie befürchteten wohl das Schlimmste.
»Jetzt wird sie auch noch frech!« Jennifer fühlte sich offenbar von meiner Antwort getroffen und riss sich von Jason los. »Was glaubst du, wer du bist? So redet man nicht mit uns. Halt gefälligst die Klappe, und glaub ja nicht, dass du jemals bei den Cheerleaders landen wirst. Nicht, solange ich was zu sagen habe. Ein hässliches Entlein wie du würde die Spieler nur abtörnen.« Sie hatte sich in Rage geredet. »Und jetzt verschwinde, Kiddo!«
»Hab ich gesagt, dass ich zu den Cheerleaders will?« Ihre drohende Miene machte mich nervös, aber auch wütend. »Hast du kürzlich mal in den Spiegel gesehen? Wenn ich mich wie ein Clown anmalen muss, um bei eurem Verein mitmachen zu dürfen, habe ich sowieso keine Lust dazu.«
»Das lasse ich mir nicht bieten!«, schimpfte Jennifer.
»Lass mich durch!«, fuhr ich sie an.
Doch sie dachte nicht daran, mich kampflos ziehen zu lassen. So wie sie aussah, war sie fest entschlossen, mir eine runterzuhauen. Eine Schlägerei fehlte mir gerade noch! Ich sah mich bereits beim Direktor, blutige Schrammen im Gesicht, und einen Verweis abholen. Von einem langen Vortrag, den mir mein Vater halten würde, ganz zu schweigen.
Die Rettung kam von unerwarteter Seite. Von einem Jungen, den ich bisher noch nie gesehen hatte. Ein Lakota in Jeans, T-Shirt und Stiefeln, ungefähr so alt wie ich, die langen schwarzen Haare zu einem Pferdeschwanz gebunden, so viel konnte ich aus den Augenwinkeln erkennen. Er war wie aus dem Nichts aufgetaucht und schob sich zwischen Jason, Jennifer und mich.
»Hört auf! Hört sofort auf! Das bringt doch nichts!«
Jason und Jennifer waren viel zu überrascht, um gleich reagieren zu können. Auch ich musste erst mal nach Luft schnappen. Wer mischte sich da ein? Was brachte ihn dazu, sich für mich einzusetzen? Ich kannte ihn doch gar nicht.
»Lasst Katrina in Ruhe!«
Woher kannte er meinen Namen?
Jason und Jennifer reagierten noch immer nicht.
»Wenn ihr nicht aufhört, gibt es doch nur Ärger. Ihr müsst zum Direktor und bekommt einen Verweis, und wenn ihr Pech habt, werdet ihr für ein oder zwei Spiele gesperrt. Der Ersatz-Quarterback spielt auch nicht schlecht, und bei den Cheerleadern gibt es genug hübsche Mädchen. Also lasst den Unsinn!«
Jason fand als Erster seine Sprache wieder. »Nun sieh sich einer den kleinen Sitting Bull an! Taucht wie ein Geist auf und glaubt, den tapferen Retter spielen zu müssen. Hat man dich überhaupt schon zum Krieger gemacht? Willst wohl Eindruck bei der Freshman-Squaw schinden.«
»Pocahontas und ihr großer Bruder«, lästerte Jennifer.
Der Lakota-Junge blieb ruhig. »Auf einem Freshman-Mädchen rumzuhacken ist nicht besonders mutig, oder? Ich dachte, ihr wärt schlauer.«
Falls seine Worte Eindruck auf Jason und Jennifer machten, ließen sie sich nichts anmerken. Oder sie waren so überrascht, dass sie zu gar keiner anderen Reaktion fähig waren. »Verschwinde!«, war alles, was Jason in diesem Augenblick einfiel. »Deine Predigten kannst du woanders halten.« Er blickte mich an. »Und du verziehst dich am besten gleich mit.«
Ich war klug genug, seinen Rat anzunehmen, und ging auf den Unterrichtsraum am Ende des Ganges zu. Mein Retter war verschwunden. Ich drehte mich nicht mehr nach meinen Widersachern um, hörte nur das aufgeregte Gemurmel der Schüler, das unserer Auseinandersetzung folgte und wie ein Echo in dem langen Flur hing.
Ich hätte mich gern bei dem Jungen bedankt, bekam aber kaum Gelegenheit dazu. Obwohl er ebenfalls Amerikanische Literatur gewählt hatte, schaffte ich es gerade mal, ihm freundlich zuzunicken. Er saß drei Bankreihen von mir entfernt neben der Tür. Immerhin bekam ich seinen Namen mit. Er hieß Adam Twobulls und erinnerte mich an einen jungen Häuptling, von dem ich ein Foto gesehen, dessen Namen ich aber vergessen hatte. Adams Haut war nicht rot, wie es einem die respektlose Bezeichnung »Rothaut« weismachen wollte, eher olivfarben. Wenn das Licht auf sein Gesicht fiel, schimmerte sie wie Honig. Seine Augen leuchteten und waren ungewöhnlich wach und rege. Ein Junge, wie man ihn sonst nur in seinen Träumen sah, oder bildete ich mir das ein, weil er mich gegen Jason und Jennifer verteidigt hatte? Adam hatte unheimlich viel Mut bewiesen und dem Ruf seines Volkes alle Ehre gemacht. Ein Lakota ließ sich eben nicht einschüchtern.
Wir lasen Wer die Nachtigall stört von Harper Lee. Darin geht es um einen weißen Rechtsanwalt, der einen Schwarzen verteidigt und dafür sogar bedroht wird. Adam schien das Buch in- und auswendig zu kennen. Er wusste auf alle Fragen, die ihm unsere Lehrerin stellte, meist die richtige Antwort. Mehrmals betonte er, wie aktuell die Probleme dieses Romans auch im 21. Jahrhundert noch waren.
Als Miss Hale ihm ein Referat über dieses Thema vorschlug, nahm er bereitwillig an. Er war ein Streber, schon klar. Wahrscheinlich versuchte er, ein Stipendium für das College zu ergattern. Für ein Studium musste man eine hohe fünfstellige Summe hinblättern oder aber ein erstklassiger Schüler oder ein Sportass sein, um umsonst studieren zu können.
Nach dem Unterricht verlor ich ihn erneut aus den Augen. Als hätte er es nach dem Zwischenfall darauf angelegt, mir aus dem Weg zu gehen.
»Hey«, sagte ich wenig später zu Anne, die bereits vor der Cafeteria auf mich wartete und keinen besonders glücklichen Eindruck machte.
»Mexican Day«, seufzte sie. »Du hast die Wahl zwischen matschigen Enchiladas mit Käse, staubtrockenen Tacos mit Hackfleisch und Käse und Chili con Carne aus dem großen Eimer. Klingt verlockend, was? Ich nehme zweimal Sopapillas mit Honig. Lieber einen doppelten Nachtisch als eine dieser fetten Hauptspeisen.« Anne mochte kein mexikanisches Essen, was aber auch an dem Latino-Jungen lag, der ihr in der Junior High den Hof gemacht hatte. Seltsam. Warum konnte Anne sich vor Verehrern nicht retten, und ich stand mutterseelenallein da? Lag es an mir?
Wir aßen unsere Sopapillas und tranken Caffè Latte. Ich überlegte gerade, wie ich Anne am besten von meinem morgendlichen Abenteuer berichten könnte, als sie selbst davon anfing: »Man erzählt sich so einiges an der Schule«, sagte sie.
»Was mit mir und Jason und Jennifer zu tun hat?«
Sie nippte lächelnd an ihrem Becher. »Und mit dem Jungen, der dort drüben sitzt.« Sie deutete auf Adam, der allein an einem Tisch in der Nähe der Essensausgabe saß. »Stimmt es, dass er wie ein tapferer Ritter auf seinem weißen Pferd über die Prärie preschte und dich vor den Klauen des blonden Angebers und seiner angemalten Hexe rettete?«
»Es war nicht die Prärie, sondern der lange Flur im Erdgeschoss, und sein weißes Pferd hatte er vergessen, aber sonst hast du recht.« Ich musste grinsen, wurde aber gleich wieder ernst. »Jason und Jennifer führen sich wie Alleinherrscher auf. Und sie lästern über Indianer.«
»Typen wie die gibt’s an jeder Schule.«
»Er hat die Lakota als Bettler beschimpft.«
»Nicht jeder hat so ein großes Herz wie du. Ich hab nichts gegen Indianer, die gehören in Rapid City einfach dazu, aber ich treibe mich auch nicht jedes zweite Wochenende im Reservat herum wie du und deine Eltern. Das ist ihr Job, und du wirst bestimmt in ihre Fußstapfen treten. Du kannst gar nicht anders.«
»Ist doch egal, ob Adam ein Indianer ist. Meinetwegen könnte er auch ein Inuit vom Nordpol sein. Aber ich finde es toll, wie er für mich eingetreten ist. Das hätten nicht viele Jungen fertiggebracht. Er ist tatsächlich ein Held, so wie der Ritter, von dem du erzählt hast. Dabei hab ich ihn vorher noch nie gesehen.«
»Bist du sicher?«
»Klar bin ich sicher. Sein Gesicht hätte ich bestimmt nicht vergessen.«
Sie grinste breit. »Hey, du hast dich in ihn verliebt!«
»Quatsch! Ich kenne ihn doch gar nicht.« Ich schleckte den Honig von meinen Fingern. »Und ich habe kein einziges Wort mit ihm gewechselt. Bis vor einer Stunde wusste ich nicht mal, wie er heißt. Adam Twobulls, ein Lakota.«
»War ja klar, dass du dich in einen Indianer verguckst.«
»Ich bin nicht in ihn verliebt, verdammt!« Warum wollte das nicht in ihren Kopf? »Ich finde es lediglich toll, wie er sich für mich eingesetzt hat.«
»Und dabei bist du nicht mal geschminkt.«
»Nur ein kleines bisschen«, schränkte ich ein.
Jason und Jennifer betraten die Cafeteria. Ich hielt unwillkürlich die Luft an und merkte, wie sich auch Anne verspannte. Entsetzt beobachteten wir, wie die beiden einmal um Adams Tisch herumstolzierten und Jason das halb volle Glas mit Limonade zu Boden stieß.
Wer erwartete, dass Adam aufspringen und eine Schlägerei mit Jason anfangen würde, täuschte sich, denn der Junge reagierte anders. Er tat so, als wäre überhaupt nichts passiert, schüttelte lediglich ein paarmal den Kopf und hob das leere Glas auf.
Im selben Augenblick trat Jason in die verschüttete Limonade und verlor das Gleichgewicht. Das schadenfrohe Grinsen, das er eben noch gezeigt hatte, verschwand von seinen Lippen. Er stürzte unsanft auf den glatten Boden, stieß gegen die Beine eines schreienden Mädchens, das vor Schreck seinen Teller mit Chili vom Tablett rutschen ließ und verdächtig blass wurde, als der Eintopf auf Jason hinabtropfte.
Das schadenfrohe Gelächter aus den hinteren Reihen verstummte augenblicklich. Wütend stemmte Jason sich vom Boden hoch. Mit dem linken Ärmel wischte er sich das Chili aus dem Gesicht. »Dafür wird der Mistkerl bezahlen. Ich schlage den Kerl windelweich!«
Doch Adam war längst verschwunden. Niemand schien bemerkt zu haben, wie er den Raum verlassen hatte, auch Anne und ich nicht. Nicht ohne Schadenfreude beobachteten wir, wie Jasons Wut ins Leere ging. »Die Schlappe hatten die beiden dringend nötig«, sagte ich so leise, dass sie mich nicht hören konnten.
Viel zu spät erschien die Mittagsaufsicht in der Cafeteria. Mary Kendrick war die Vertrauenslehrerin der Schule, eine robuste Lady in einem dunklen Hosenanzug. Ihre dunkle Mähne hatte sie mit einem blonden Seidentuch gebändigt. So wie sie reagierte, hatte sie schon wesentlich Schlimmeres erlebt. Eine Schießerei vor drei Jahren zum Beispiel, wie ich gehört hatte, auch wenn der aufgebrachte Schüler nur ein paarmal mit einer Schreckschusspistole in die Luft geschossen hatte. Mit ein Grund dafür, dass sich alle Schülerinnen und Schüler jeden Morgen scannen lassen mussten, bevor sie das Gebäude betraten. Und während des Unterrichts waren alle Zimmer abgeschlossen, man durfte nicht mal auf die Toilette gehen. Nur mit einem »Hall Pass« durfte man sich während der Stunden frei bewegen. Seit den Schießereien an anderen Schulen wollte man kein Risiko eingehen.
Ich hatte mich von Anne verabschiedet und war auf dem Weg zur nächsten Stunde, als mich Mrs. Kendrick aufhielt. »Du bist im ersten Jahr hier, nicht wahr? Katrina Thompson? Wie ich höre, hattest du Streit mit Jason McGarrett und Jennifer Nolan. Heftigen Streit. Worum ging es denn, Katrina?«
Ich hatte nichts zu verbergen und berichtete ihr in wenigen Worten, was geschehen war. »Ein Schüler hat dafür gesorgt, dass Jason und seine Freundin nicht handgreiflich wurden.« Ich schilderte den Vorfall in der Cafeteria.
»Weil du ein Freshman bist, will ich nicht näher auf den Streit eingehen«, erwiderte Mrs. Kendrick. »Aber du wirst sicher verstehen, dass wir solche Auseinandersetzungen an unserer Schule auf keinen Fall dulden können. Das ist dir doch klar, nicht wahr?«
»Natürlich, Mrs. Kendrick. Von mir ging der Streit nicht aus.«
Sie lächelte. »Du bist ein Freshman, da muss man einiges einstecken, das ist nun mal so. Wenn du schlau bist, hältst du dich ein wenig zurück und bietest den Älteren keine Angriffsfläche. Und was Jason und Jennifer betrifft …« Sie rückte ihre schwarze Brille zurecht. »Die beiden sind nicht ganz pflegeleicht, das gebe ich gerne zu. Aber sie sind wichtig für das Ansehen unserer Schule. Als Quarterback unseres Footballteams und Homecoming Queen stehen sie ständig im Rampenlicht.«
»Das heißt, sie können sich alles erlauben?«
»Nein, aber du solltest daran denken, wenn du wieder mal mit ihnen diskutierst. Haben wir uns verstanden?«
»Natürlich, Mrs. Kendrick.«
»Dann ist es ja gut. Und jetzt beeil dich, der Unterricht wartet.«
3
Anne hatte mir im Schulbus einen Platz frei gehalten. Wie die meisten anderen hielt sie ihr Smartphone in den Händen, schien aber viel zu aufgeregt, um sich darauf zu konzentrieren. »Da bist du ja endlich!«, empfing sie mich nervös. »Ich dachte schon, du verpasst den Bus. Hast du von Kevin und Joey gehört?«
Ich setzte mich neben sie. »Kevin und Joey? Sind das nicht die Typen, die sich letzte Woche mit der Henderson angelegt haben? Der Sozialkundelehrerin der Seniors? Nicht mal einen Verweis sollen sie bekommen haben.«