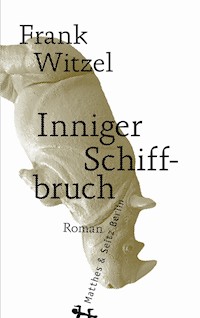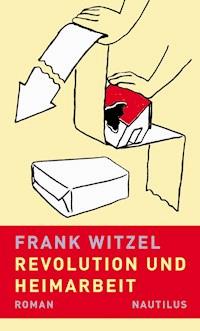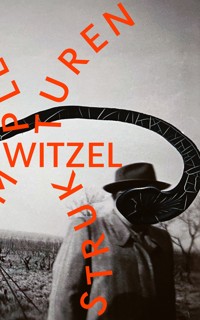Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Geschichten, die ineinandergreifen, und Geschichten in Geschichten erzählen: Mit hat Frank Witzel ein grandioses literarisches Möbiusband geflochten. Ausgehend von Alltagssituationen bohrt sich der Erzähler gemeinsam mit seinen Figuren unerbittlich bis an den Grund der Bedingungen des Menschseins. Atemlos folgt der Leser den labyrinthischen Geschichten, die ihn in einen Irrgarten der Wirklichkeit führen. Ein bunter Strauß an Lebensentwürfen, Stereotypen und Pathologien enthüllen Wirklichkeiten hinter der Wirklichkeit: Ein Pilzsammler findet im Wald eine Leiche und versucht, mögliche Konsequenzen zu umgehen; ein Paar fährt zu einem Fotoshooting auf den Todtnauberg; eine Frau mit einem Pferdewunsch muss sich mit den noch ausgefalleneren Wünschen ihrer Partner auseinandersetzen; ein Anwalt entwickelt an einem freien Nachmittag die Theorie der unlogischen Sekunde; eine Frau gerät durch Zufall in ein abgelegenes Dorf, in dem sie verschiedenen Mechanismen des Begehrens ausgesetzt wird; eine andere Frau versucht sich durch ein Voodoo-Ritual vor einem drohenden Schicksalsschlag zu bewahren. Durch das Witzel'sche Prisma bricht sich das Licht des Alltags, offenbart eine andere Wirklichkeit und gibt einen Blick auf die unterschiedlichen Beweggründe menschlichen Handelns und die Rückseiten der Kulissen unserer Welt frei. Wie der Maler in jenem berühmten chinesischen Gleichnis, so verschwindet der Erzähler in den Geschichten, die zum Spiegelkabinett der Wirklichkeit werden und vom Geheimnis des Lebens erzählen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 506
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die fernen Orte des Versagens
Frank Witzel
Die fernen Orte des Versagens
Erzählungen
Ein Erdklos ist der Mensch, von Gottes Odem durchweht und belebt, also ein Duplum, weder ganz Gott, noch ganz Thier, weder reiner Geist, noch blosser Körper, weder Engel, noch Teufel, sondern ein Gemisch, ein Compositum aus beiden, und nur bei jenem glücklichen Maass und jener glücklichen Mischung seiner verschiedensten Kräfte im Verhältniss zueinander kann er das sein und ganz sein, was er seinem Wesen nach nur sein soll: Mensch.
Franz von Baader
INHALT
Von der Arbeit des Verfehlens
Alltag eines Empiriokritikers
Fesseln
Todtnauberg
Der Leberfleckmann
Eisvogel
Ein substanzloses Wochenende
Ein Pilzsammler
Notwendige Ungenauigkeiten des Erinnerns
Familienfotos
Pubertät und Ehebruch
Nach dem Gesetz
Hekate
Traurige Rekorde
VON DER ARBEIT DES VERFEHLENS
Lieber Christian,
am Mittwoch vor einer Woche, als ich wieder einmal mein Bücherregal nach einer Anregung für mein immer weiter stockendes und sich selbst torpedierendes Projekt abging, machte ich einen Fehler, einen ganz grundsätzlichen Fehler, den man bei jeder Begegnung mit einem Buch um alles in der Welt vermeiden muss. Nachdem ich nämlich, ohne auf den Rücken zu achten, ein Buch herausgezogen hatte, sah ich, anstatt dieses Buch unmittelbar aufzuschlagen, auf die Rückseite dieses Buches, was mir nur passieren konnte, weil ich in Gedanken an meine banal unzulänglichen Erzählungsstümpfe war. Nein, ich sah nicht nur auf die Rückseite des Buches – es handelte sich übrigens um einen Band von Thomas Bernhard –, sondern ich las, was dort stand. Natürlich ist bereits das eine Unverschämtheit: auf ein Buch die Beurteilung dieses Buches von wem auch immer zu drucken, wobei es ja gerade nicht eine Beurteilung von wem auch immer ist, denn das würde ich mir vielleicht noch gefallen lassen, sondern eine Beurteilung aus sogenanntem »berufenen Munde«, in diesem Fall dem Feuilleton des Tagesspiegels, an dieser Stelle nicht weiter namentlich gekennzeichnet, weil es sich wohl um keinen »klingenden Namen« handelte, der diese Beurteilung verfasst hatte, weshalb verschwiegen wurde, wer sich hinter diesem Decknamen Tagesspiegel verbarg und wessen banale und unbegründete Meinungshaftigkeit durch die Nennung des Organs aufgewertet werden sollte, das diese banale und unbegründete Meinung abgedruckt hatte. Der Satz, den ich dort las, lautete: »Ganz einfach, menschlich; es ist vielleicht das schönste, das Bernhard geschrieben hat.« Und es war dieser Satz, der das Schicksal meines Erzählungsbandes besiegelte, auch wenn ich noch einige Wochen dagegen anzukämpfen und mich immer wieder zu ermahnen versuchte, mich doch nicht von einem solch banalen Satz von einer Arbeit abbringen zu lassen, an der ich, um es nicht allzu pathetisch zu machen und von »einem halben Leben« zu sprechen, doch immerhin die letzten zweieinhalb Jahre gearbeitet, vergeblich gearbeitet, unnötig gearbeitet, in die falsche Richtung gearbeitet, aber dennoch gearbeitet hatte. Doch ließ mich dieser Satz in seiner erschreckenden Banalität, in seiner völligen Aufgabe, Literatur, wenn dieser Satz schon nicht in der Lage war, sie zu erfassen, so doch wenigstens zu belassen, nicht mehr zur Ruhe kommen. Dieser Satz besiegelte in seiner vermeintlich gutgemeinten Harmlosigkeit, die tatsächlich eine bösartige Unverschämtheit war, jedoch nicht nur das Schicksal meines Erzählbandes, sondern auch mein Schicksal als Schriftsteller. Ich übertreibe? Ja, ich übertreibe. Aber das heißt nicht, dass diese Übertreibung nicht dennoch wahr wäre, oder gäbe es eine andere adäquate Reaktion auf diesen Satz, als sich nicht länger mit einer Welt gemein zu machen, in der ein solcher Satz existiert? Hätte dort wenigstens gestanden: »Es ist das schönste, das Bernhard geschrieben hat«, aber nein, selbst das wurde nicht gewagt. Stattdessen wurde der gewählte Superlativ im selben Moment, in dem er ausgesprochen wurde, bereits wieder zurückgenommen, weil dieser Rezensent, dessen Namen ich nicht kenne und auch nicht kennen will, dieser Journalist, den ich mir abwechselnd als Mann, dann wieder als Frau vorstellte, ohne ausmachen zu können, welches dieser Aussage zugeordnete Geschlecht diese Aussage verstärken würde, denn eine Entkräftigung gab es für diese Aussage nicht, weil also dieser Rezensent es noch nicht einmal wagte, eine Hyperbel in den Raum zu stellen und als Hyperbel stehen zu lassen, sondern sich absichern wollte, damit nicht ein anderer daherkommt und sagt: »Das ist aber gar nicht das schönste, was Bernhard geschrieben hat, das schönste ist das hier«, was zur Folge gehabt hätte, dass die beiden sich eine Weile im Feuilleton hätten anhampeln müssen und damit für kurze Zeit eine vermeintliche Lebendigkeit des in Wirklichkeit nicht länger nur dahinsiechenden, sondern längst mausetoten Feuilletons simuliert hätten. Kann man von einem Schriftsteller ernsthaft verlangen, in diese Welt, in der solche Sätze in Bezug auf Literatur geschrieben und gedruckt und dann von den Verlagen abgeschrieben und auf die Rückseiten von Büchern platziert werden, noch etwas hineingeben beziehungsweise hineinschreiben zu wollen?
Ich gebe zu, es ist, selbst wenn alles stimmt, was ich sage, gleichzeitig auch eine Ausrede. Endlich habe ich einen Grund gefunden, um mein bereits zuvor gescheitertes Projekt nun mit gerechtem Zorn zu beenden. Ich mache mir und Dir da nichts vor, dennoch gab es diesen Moment, in dem ich erkennen musste, dass sich eine Auseinandersetzung mit der Welt nicht länger lohnt, wahrscheinlich noch nie gelohnt hat, aber mittlerweile gar nicht mehr lohnt. »Sollen meine Erzählstümpfe doch Erzählstümpfe bleiben«, dachte ich mit einem gewissen Grimm, besser noch Ingrimm, als wäre ich selbst eine Figur aus diesen unvollständigen, unfertigen und vor allem unzulänglichen Erzählstümpfen, die nun ungelesen bleiben würden, damit – so meine Rechtfertigung – nicht irgendein Lohnschreiber die Gelegenheit bekäme, einen Gedanken zu formulieren, den er im selben Moment mit einem ängstlichen »vielleicht« wieder relativiert. Diesem Betrieb wenigstens an einer, wenn auch noch so kleinen und unbedeutenden Stelle das Futter entzogen zu haben, das imaginierte ich mir kurzzeitig als möglichen Trost, den ich, wenn auch nicht in diesem Moment, jedoch vielleicht eines Tages als solchen würde empfinden können. Reicht es denn nicht, Tag für Tag mit den allergrößten Unverschämtheiten und Lügen konfrontiert zu werden, muss denn auch noch die Literatur mit der Ohrfeige eines »vielleicht« bedacht werden? Wobei bereits das Wort »schön« Kennzeichen einer intellektuellen Bankrotterklärung, einer ästhetischen Bankrotterklärung, sprechen wir es aus, einer menschlichen Bankrotterklärung ist. Schön, das ist der Zugang zur Hölle der Beliebigkeit, die erbarmungsloseste aller Höllen, weil in ihr mit ausgestellter Gleichgültigkeit gefoltert wird.
Da Du so lange zu mir gehalten und auf mich vertraut hast, kann ich diese Sammlung von Erzählstümpfen nicht einfach irgendwo auf einer imaginären Halde verrotten lassen, sondern muss diese Erzählstümpfe vor dem Verrotten noch einmal einzeln zusammen mit Dir anschauen, quasi als Arbeitsnachweis, damit Du nicht das Gefühl hast, ich hätte Dich lediglich hingehalten und Dir etwas vorgespielt, während ich längst wusste, dass ich nicht mehr in der Lage sein würde, irgendeinen Text, ganz zu schweigen einen Band mit Erzählungen, fertigzustellen. Bevor ich Dir allerdings diese Erzählstümpfe wie in einer makaber pathologischen Nummernrevue vorführe, muss ich noch kurz ein anderes Thema streifen und aus dem Weg räumen. Meine vermeintliche Krankheit, dieser unbedeutende Schwächeanfall, der mich vor einigen Wochen unerwartet heimsuchte, hat nämlich mit meiner Entscheidung, meine Arbeit an dem Band mit Erzählungen auf immer und unwiderruflich einzustellen, nicht das Geringste zu tun. Sollte Dir Kamilla in diesem Zusammenhang geschrieben haben, was ich befürchten muss, da sie unnötigerweise sogar meine Schwester und meine Mutter kontaktiert hat, so muss ich Dir sagen, falls Du es nicht ohnehin ahnst, dass sie leider, was mich angeht, zu einer Überängstlichkeit neigt, eine Eigenschaft, die ich selbst verursacht habe, da ich mich ihr gegenüber schlecht verstellen kann, mehr noch eine unwillkürliche Tendenz verspüre, ihr meinen Zustand aus dem Moment heraus dramatischer zu schildern als wahrscheinlich angemessen. Wie gesagt, ich hatte einen kleinen Schwächeanfall, nichts weiter, und war lediglich ein paar Tage im Krankenhaus zur Beobachtung. Dort hat man nichts Außergewöhnliches festgestellt und mich mit ein paar guten Ratschlägen und dem Rezept für einen Gemütsaufheller wieder entlassen. Die Ratschläge waren gleichermaßen banal wie weltfremd, denn natürlich würde auch ich gern einen Feierabend und ein freies Wochenende haben und mich liebend gern an geregelte Arbeitszeiten halten. Dass ich das nun kann, ist ein eher zufälliger Nebeneffekt, der jedoch nichts mit besagtem Krankenhausaufenthalt und den komplett weltfremden Ratschlägen, die mir während dieses Krankenhausaufenthalts erteilt wurden, zu tun hat. Geschweige denn mit meiner Medikation, da ich diesen Gemütsaufheller rasch abgesetzt habe, denn er hellte nicht mein Gemüt auf, sondern dämpfte lediglich meine Affekte ab, was man nur in ärztlicher Verblendung für dasselbe halten kann. Aber jetzt habe ich schon mehr Worte zu diesem Thema verloren, als mir lieb ist. Kurz gesagt, vergiss alles, was Du in Bezug auf meinen Gesundheitszustand gehört haben magst und lass Deine Haltung mir gegenüber nicht von irgendwelchen falschen Vorstellungen beeinflussen, ich bin, wie es so schön heißt, im vollen Besitz meiner körperlichen und geistigen Kräfte und brauche deshalb keine falsche Rücksichtnahme, sondern nur die übliche Form der Rücksichtnahme, die man jemandem gegenüber beinahe automatisch walten lassen sollte, der von sich behauptet, er sei im vollen Besitz von was auch immer.
Gerade weil es nichts Besonderes war, weshalb ich ins Krankenhaus kam, konnte sich dieser Aufenthalt mit einer gnadenlosen Schwerkraft in mir entfalten. Gerade weil ich nicht schon hinfällig war und von Schmerzen zu Boden gedrückt, konnte ich diese Flure und Zimmer und Untersuchungsräume in ihrer grundsätzlichen Wesenheit wahrnehmen. Weil im Krankenhausbetrieb alles nach Kriterien der Unübersichtlichkeit, Unzweckmäßigkeit und Unbrauchbarkeit eingerichtet ist, werden diese Flure, Zimmer und Untersuchungsräume seit Jahrzehnten von Erstsemester-Architekten entworfen, da man für den Entwurf eines solchen Betriebs eben Menschen braucht, die komplett überfordert mit einem solchen Entwurf sind, und das sind nun einmal Erstsemesterstudenten, denen man, kaum dass sie einen Stift halten und ein Reißbrett auf ihren Oberschenkeln balancieren können, sagt: »Nun entwerfen Sie mal ein Krankenhaus. Nur zu, keine Hemmungen. Nein, Sie brauchen keine weiteren Informationen, Sie wissen ja, wie es ist, da liegen Menschen in Betten und dann gibt es Räume, da werden diese Menschen untersucht, und dann Räume, da werden sie operiert, und dann Räume, da kommen die Verstorbenen hin, und dann noch eine Küche und eine Waschküche, ach ja, und auch noch eine Caféteria. Machen Sie das einfach mal so, wie Sie sich das vorstellen, und dann reden wir anschließend darüber.« Aber anschließend wird nicht darüber geredet. Im Gegenteil, keine einzige Silbe wird mehr darüber verloren. Stattdessen werden die Entwürfe von einem Gremium der unfähigsten Bürokraten durchgesehen, um daraus den unübersichtlichsten, unzweckmäßigsten und unbrauchbarsten Entwurf auszuwählen, nach dem anschließend das neue Krankenhaus gebaut wird. Das ist seit Jahrzehnten so Usus. Wichtig ist, dass niemand, weder Personal noch Patienten, irgendwo in diesem Krankenhausbetrieb das Gefühl bekommen darf, sich wohl oder gar heimisch zu fühlen. Jede Form der Privatheit muss einem in dieser Umgebung als deplatziert und komplett absurd erscheinen, damit das Gefühl verstärkt wird, auch wirklich krank, am besten todsterbenskrank zu sein, sobald man auch nur einen Fuß in diese dysfunktionale Erstsemester-Architektur setzt, in der natürlich auch die liebliche Farbgestaltung nicht fehlen darf, die das Siechtum aufhellen soll, wobei gerade diese erzwungene und sich mühselig abgerungene Menschlichkeit in einer sonst komplett verbauten Umgebung genau das Gegenteil von Menschlichkeit ausdrückt, weil sie an diesem Ort, an dem Menschlichkeit nicht wirklich, sondern nur ausgestellt existiert, genötigt ist, diesen unwirklichen Umgang mit Menschlichkeit gleichermaßen auszustellen.
Nachdem ich diesen Ort verlassen hatte, war mir klar, dass ich diesen Ort niemals wieder betreten würde, zumindest nicht in einem Zustand, in dem ich noch einen Rest meines Verstandes, meines Gefühls oder meiner körperlichen Kräfte zur Verfügung hätte, einem Zustand, in dem ich nicht durch rasende Schmerzen oder eine akut lebensbedrohliche Erkrankung derart zu Boden gezwungen wäre, dass ich die Unzulänglichkeitsarchitektur dieses Krankenhauses nicht länger als solche wahrnehmen würde können, sondern als das annehmen würde müssen, als das sie gemeint war, eine Architektur der Unterwerfung und der Ausweglosigkeit, in der die Kriterien von Ästhetik und Menschlichkeit nicht nur außer Kraft gesetzt sind, sondern dieses Außer-Kraft-gesetzt-Sein offen präsentiert wird, weil nur der hier Einlass findet, der seinen Willen bereits maßgeblich eingebüßt hat und keine Kraft mehr besitzt, sich gegen diese ausgestellte Unverschämtheit von Unzulänglichkeiten zur Wehr zu setzen. Dieser angeblich nach funktionalen Maßstäben eingerichtete Betrieb verleugnet und erniedrigt das Individuum, um das es doch konkret geht oder gehen müsste. Tatsächlich hat das Individuum jedoch seine Individualität bereits durch die Krankheit eingebüßt, denn die Diagnose wird nicht erstellt, um das Individuum entsprechend individuell zu behandeln und seine Individualität zu bewahren oder wiederherzustellen, vielmehr ist die Diagnose der erste Schritt zur Auf lösung des Individuums, das, ganz so wie es die Unfähigkeitsarchitektur der Krankenhäuser diktiert, auch diagnostisch auf einen Erstsemester-Bauplan des Menschen zurechtgeschrumpft wird, mit einem ungefähren Körperumriss, in dem die wesentlichen Organe innerhalb des reduzierten Kreislaufs angeordnet sind, den man glücklicherweise vor einigen Jahrhunderten entdeckt hat. Mehr Wissen braucht man nicht, weil alles andere die Labore machen. Aus dem Kreislauf zapft man mehr oder minder geschickt Blut ab, und das wird anschließend untersucht, damit man eine beeindruckende Zahl von sogenannten Werten erhält, die man entsprechend mit Medikamenten reguliert. Hilft das nichts, wird begonnen, an den Organen herumzuschneiden.
Hätte ich mich demnach nicht freuen müssen, diesem Unzulänglichkeitsapparat noch einmal entkommen zu sein? Hätte ich nicht mit frischer Kraft meine zurückgelassene Arbeit wieder aufnehmen können, mich nicht länger von falschen Zweifeln aufhalten lassen, sondern mich fortan ausschließlich der Aufzucht und Pflege meiner Erzählstümpfe widmen? Genau das Gegenteil trat ein. Anfänglich schob ich meine Unkonzentriertheit noch auf die gerade erst erlebte Diskrepanz zwischen meiner Arbeit, in der ich versucht hatte, in immer subtilere Regionen der Empfindung vorzudringen, zumindest gemeint hatte, das zu versuchen, und dieser gerade erlebten Reduzierung des Körpers, vom Geist war ja dort nie die Rede, auf entkontextualisierte Organe und einen willenlosen Kreislauf, mit dem ich nicht nur ausgestattet war, sondern aus dem ich bestand, der ich kurz gesagt war. Ich war Kreislauf, ich war Leber, Niere, Herz – ganz so wie das Personal untereinander die Patienten auch benannte (»Die Milz von 207 wird heute Mittag verlegt«) – und wie diese entsprechend austauschbar. Zurückgekehrt empfand ich jedoch beim Lesen meiner Erzählungen diese ebenfalls als austauschbar, als beliebig, als unzulänglich, kurz als Erstsemesterliteratur, von jemandem geschrieben, der irgendwo einmal aufgeschnappt hatte, dass es Erzählungen gibt, und in seiner Unfähigkeit, Literatur zu begreifen, in seiner mangelnden Fähigkeit zu erkennen, was es mit Literatur auf sich hat, nun anfing, nachdem er vielleicht noch ein, zwei Erzählungen anderer Autoren mehr überflogen als tatsächlich gelesen hatte, mit einer Erstsemestervorstellung vom Aufbau einer solchen Erzählung, die Ähnlichkeiten mit dem Erstsemesteraufbau des menschlichen Körpers und dem Erstsemesterentwurf eines Krankenhauses hatte, selbst eine Erzählung zu schreiben. Ich begriff die eigene Unfähigkeit und verstand, dass es auch in der Literatur allein um die Verwaltung dieser Unfähigkeit geht und dass die Verwaltung entsprechend der Unfähigkeit immer weiter zugenommen hatte und zunehmen hatte müssen, weshalb es vor hundert Jahren noch weniger Verwaltung dieser literarischen Unfähigkeit gegeben hatte, was nicht unbedingt daran lag, dass die Autoren fähiger gewesen wären, sondern dass sie noch von der Idee getrieben waren, die Literatur weiterzuentwickeln, weshalb man ihnen keinen Vorwurf machen konnte, so wie man Harvey die reduzierte Vorstellung des Kreislaufs nicht hätte vorwerfen können, sondern ihn im Gegenteil dafür hätte loben müssen, weil er überhaupt darauf gekommen war, dass es einen Kreislauf gab, während man allerdings denen, die diesen Kreislauf nun über Jahrhunderte nicht wesentlich weiterentwickelt, sondern nur die Verwaltung dieses Kreislaufs aufgeblasen hatten, durchaus einen Vorwurf machen konnte, wie man der Verwaltung der Literatur, denn um nichts anderes ging es heute noch, natürlich einen Vorwurf machen und sich fragen muss, ob man an diesem Verwaltungsakt noch länger Anteil haben will. Ich konnte mich nicht länger damit herausreden, dass es nun einmal auf diese Weise um die Literatur bestellt war und dass Literatur heute eben vor allem aus Verwaltungsakten besteht, wie überhaupt alles auf der Welt nur noch aus Verwaltungsakten besteht, und dass es sinnlos und ein Kampf gegen Windmühlen ist, sich gegen diese Verwaltungsakte zur Wehr setzen zu wollen, weil durch dieses Zur-Wehr-Setzen lediglich weitere Verwaltungsakte hervorgerufen werden, wenn die vornehmliche Aufgabe doch darin bestehen sollte, in dieser Welt von Verwaltungsakten den in Verwaltungsakten gefangenen Menschen etwas Ablenkung zu verschaffen, wenn schon keinen Trost, denn in einer Welt von Verwaltungsakten kann es keinen Trost geben, dann wenigstens noch Ablenkung.
Ungefähr an diesem Punkt meiner Überlegungen angelangt, ging ich mein Bücherregal ab und zog besagten Band von Thomas Bernhard heraus, weil ich dachte, womöglich war Bernhard der letzte Schriftsteller, der sich gegen diese verwaltete Literatureindämmung noch hatte zur Wehr setzen und ihr etwas entgegenhalten können, etwas, das die Literatur noch einmal, wenn auch nur kurzzeitig, über den reinen Verwaltungsakt hinausgeführt hatte. Dann aber las ich auf der Rückseite des von mir herausgezogenen Buches diesen Erstsemester-Tagesspiegel-Satz einer vermeintlichen Literaturkritik, diese komplette Bankrotterklärung einer Literaturkritik, diesen Erstsemesterverwaltungsakt, der aber selbst in seiner Verwaltung scheiterte, weil er nicht bereit war, die Verantwortung für diese Verwaltung zu übernehmen, obwohl er doch angetreten war, zu verwalten, und nichts anderes im Sinn hatte, als zu verwalten, aber selbst nicht begriff, dass mit einem »vielleicht« nicht verwaltet werden kann, während ich umgekehrt begriff, dass selbst die Verwaltung auf einer unteren Verfallsstufe angekommen war, auf der die Verwaltung selbst nichts mehr über ihre Tätigkeit des Verwaltens wusste, sondern sich genauso vor dem Verwalten drückte, wie sich die Literatur davor drückte, Literatur zu sein, das heißt die Literatur weiterzuentwickeln. Die Literatur hatte sich der Verwaltung untergeordnet und die Verwaltung weigerte sich zu verwalten, nachdem sie sich jahrzehntelang mit ihren Verwaltungsakten aufgespielt hatte. Es war ein gegenseitiges Zugeschachere von Verantwortungslosigkeiten, konkreter von verantwortungslosen Verwaltungsakten. Die Verwaltungsakte hatten sich verselbstständigt und waren für die Literatur zu dem geworden, was die Laborwerte für die Medizin waren: Zahlen, hinter denen man sich versteckte und die man selbst nicht mehr begriff. Ich hingegen begriff, dass die Literatur am Ende war, dass wir in einer Welt des »vielleicht schönsten« lebten. Alles war ein zurückgenommener Superlativ. Wir lebten nicht länger in der »besten aller möglichen Welten«, sondern in der »möglicherweise besten aller Welten«. Selbst das Meinen, diese niedrigste Stufe des Denkens, war zu einem Meinen über das Meinen verkommen. Phantasie wurde nur noch dafür eingesetzt, das eigene Denken einzuschränken und weitere Möglichkeiten dieser Einschränkung zu ersinnen. Mussten die Schriftsteller früherer Epochen ihre Werke bei der Zensur einreichen, also bereits im Vorfeld in ihrem Schreiben versuchen, diese Zensur zu umgehen, woraus sich eine stilistische Überlegenheit entwickelte, so existierte heute der Verwaltungsakt als die schlimmere Zensur, weil er alles auf ein Mittelmaß zurechtstutzte. Egal, was ich schreiben würde, es würde ohnehin zurechtgestutzt. Und entweder ich würde diesem Zurechtstutzen vorausgreifen und es auf diese Weise noch etwas zu kontrollieren versuchen, oder ich würde mich ihm unterwerfen, so wie selbst Bernhard ihm unterworfen wurde und mit ihm alle anderen, die je etwas geschrieben hatten.
Und hier, genau an dieser Stelle, zeigte sich erneut meine Unfähigkeit dem Leben und der Literatur gegenüber, denn ein anderer hätte sich durch diese feuilletonistische Bankrotterklärung angespornt gefühlt, hätte sich befreit gefühlt gegenüber einem solchen Maß an Beschränktheit und Blödheit, das ihm die Möglichkeit eröffnete, sich in einem Anfall von Trotz über alle literarischen Verwaltungsakte hinwegzusetzen und wenigstens eine Zeile hinzuschreiben, die sich den literarischen Verwaltungsakten vielleicht nicht entzog, sie aber zumindest sichtbar machte. Nicht jedoch ich, denn was tat ich in meiner nicht minder großen Blödheit? Ich zog ein zweites Buch von Bernhard hervor und schaute diesmal nicht unbeabsichtigt und wie nebenbei, sondern ganz bewusst auf die Rückseite, um zu sehen, was dort stand, als hoffte ich in kindlich verstrickter Abhängigkeit dort einen anderen Satz vorzufinden, einen nicht vor Blödheit strotzenden, sondern vor Eingebung schillernden Satz. Hoffnung aber ist alles andere als das Lebenselixier als das sie uns verkauft wird, sondern ebenfalls nur ein Verwaltungsakt, der unsere Wiederholungszwänge und unsere Unfähigkeit, zu lernen, mit entsprechenden Rechtfertigungen ausstattet. So war ich letztlich froh, erneut mit dem Kopf auf diesen Umstand gestoßen zu werden, den man allzu leicht vergisst und einen Satz vorzufinden, der – wie auch anders? – dem ersten um nichts nachstand. Dieser Satz, der diesmal aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung stammte, beschwor nicht das Vielleicht-Schönste, sondern sprach von etwas ganz anderem, nämlich von »absoluter Wahrhaftigkeit«, die man von Bernhard »lernen« könne. Diese absolute Wahrhaftigkeit war natürlich um keinen Deut besser als das Vielleicht-Schönste, sondern verriegelte im Gegenteil den letzten Notausgang auf der Flucht vor diesem Vielleicht-Schönsten, so dass ich mich nun vom Vielleicht-Schönsten und Absolut-Wahrhaftigen eingekesselt fand, wie jemand, der ins Fegfeuer geworfen wird und im Fegfeuer erkennen muss, dass Himmel und Hölle sich nicht unterscheiden, weil sie beide gleichermaßen von dem einzigen Ort entfernt sind, an dem eine Abwehr des Vielleicht-Schönsten und Absolut-Wahrhaftigen möglich gewesen wäre. Das ist der vermaledeite Irrtum, dass man sich nach einer Auflösung sehnt, obwohl doch die Erde, da hatte Leibniz, wenn auch auf ganz andere Weise, recht, gerade deshalb die beste aller möglichen ist, weil sie sich in der Schwebe zwischen Himmel und Hölle befindet, weil sie beides sein kann, und deshalb keins von beiden sein muss. Aber genau diese Schwebe konnte ich nicht länger spüren. Das Vielleicht-Schönste hämmerte gegen das Absolut-Wahrhaftige an, und umgekehrt. Ich wollte nicht mehr Teil sein einer Welt, in der solch ein Unsinn verzapft wird, wenn es doch Kennzeichen der Welt ist, dass sie aus sich heraus unsinnig und ungerecht und niemals absolut und niemals wahrhaftig und vielleicht manchmal schön, aber niemals schön im Superlativ ist, sondern eben nur zufällig schön, schön wie schmerzfrei, schön, weil gerade einmal kein Unglück in Reichweite geschieht, das, was die Presse ja genau herunterspielen will, dieses Nebenbei-Schöne, das einfach geschieht und verklingt, weshalb sie, die Presse, einem beständig einhämmert, dass immer ein Unglück in Reichweite geschieht, permanent, von früh bis spät. Und während sie sich mit ausgestellter Empörung an dem Entsetzlichen weidet und versucht, ihr billiges Meinen in klingende Münze zu verwandeln, indem sie so tut, als habe die permanente Bekanntmachung des Unglücks in Reichweite eine tragende Bedeutung für das Leben jedes Einzelnen, laufen wir mit gebeugtem Nacken und der uns von außen aufgedrängten Frage, welchen Sinn unsere jämmerliche Existenz in Bezug auf das Unglück in Reichweite noch haben könnte auf einem uns vorgezeichneten Kreis, anstatt stehen zu bleiben und einen winzigen Schritt zur Seite zu machen, um den uns vorgezeichneten Kreis zu verlassen. Und obwohl es nur ein Schritt war, ein einziger Schritt, wollte mir dieser Schritt nicht mehr gelingen. Weshalb, kann ich Dir nicht sagen. War ich zu müde? Zu alt? Zu resigniert? Ich kann es Dir nicht sagen.
Die Frage, was eine Erzählung ist, die scheinbar zwangsläufig zu der Frage führt, was Erzählen überhaupt ist und sein kann, ist eine Frage, die mich vom ersten Tag meines Schreibens an verfolgte und die ich über die Jahre und Jahrzehnte, die dieses Schreiben mittlerweile andauert, immer wieder zu verdrängen versucht habe, ohne sie je ganz abschütteln zu können. Sie erweiterte sich zu Beginn meines Klinikaufenthalts übrigens zu der Frage, was überhaupt das Leben ist, weshalb ich in den ersten Tagen, als man mich medikamentös noch nicht richtig eingestellt hatte, meinte, ich müsste nun, angefangen vom banalsten Zweifel bis hinauf zur existenziellen Krise, sämtliche Fragen klären, die sich mir in meinem bisherigen Leben einmal gestellt hatten und bislang unbeantwortet geblieben waren. Solch ein Eingeständnis der eigenen Unfähigkeit müsste doch, so könnte man meinen, befreiend wirken. Nun ja, bei mir hatte es zur Folge, dass ich in eine seltsame Denkspirale geriet, die sich zu einem Drehschwindel auswuchs, in Verlauf dessen ich zeitweise glaubte, ohne dass ich mich noch rühren oder aufrecht sitzen konnte, die Lösung für meine Schreibhemmung gefunden zu haben, da ich in meinem Delirium der Auffassung war, ich müsste während des Schreibens lediglich das Blatt beständig drehen, um die einengende Linearität zu durchbrechen, die mich bislang daran gehindert hatte, eine passende Form für mein Erzählen zu finden. Als wäre ich auf eine ganz grundsätzliche Erkenntnis gestoßen, war ich für einige Stunden beglückt, endlich begriffen zu haben, dass sich nicht nur der Stift auf dem Papier, sondern gleichzeitig auch das Papier unter dem Stift bewegen muss, um ein uneingeschränktes Schreiben zu bewirken, ganz so wie sich ja auch die Erde unter uns bewegt, während wir uns auf ihr bewegen. Die groteske Lächerlichkeit dieses Einfalls kam mir ebenso plötzlich zu Bewusstsein, und ich fühlte mich wie jemand, der in der Diele seiner Wohnung steht, auf ein Blatt Papier in seiner Hand starrt und auf diesem Blatt seine Unterschrift erkennt, mit der er gerade den Kauf einer vierundzwanzigbändigen Enzyklopädie abgeschlossen hat, weil der Vertreter an der Tür es verstand, ihm eine Welt auszumalen, in der es nichts Begehrenswerteres gab als den Besitz genau dieser vierundzwanzigbändigen Enzyklopädie, und der nun spürt, kaum dass er die Tür geschlossen hat und die etwas eiligen Schritte des Vertreters im Hausflur verklingen hört, wie sich die vom Vertreter entworfene Welt auflöst und die Aussicht auf die nächsten zwei Jahre freigibt, in denen er Monat für Monat einen Kunstlederband dieser Enzyklopädie zugesandt bekommen wird, so dass er, abgesehen von den horrenden Kosten, erst in zwei Jahren etwas über die Zirbeldrüse in Erfahrung wird bringen können, die dafür sorgt, dass Melatonin zur rechten Zeit ausgeschüttet wird und einen erholsamen Schlaf bereitet, einen Schlaf, in dem es kurzzeitig gelingt, die Scham zu vergessen, die einen im Angesicht der eigenen Gedanken, Worte und Werke überkommt und nicht allein das Vergangene zweifelhaft erscheinen lässt, sondern auch alles zukünftige Handeln, da man sich nun selbst nicht mehr über den Weg trauen kann. Meine Exaltiertheit verwandelte sich umgehend in einen Stupor, der nur sehr zögerlich wieder abklang, ohne je ganz zu verschwinden, weshalb mich die grundsätzliche Skepsis, die mich seinerzeit überfiel, der Verdacht, um es einmal in aller Deutlichkeit zu sagen, nicht lediglich ein Versager, sondern schlicht und einfach ein Vollidiot zu sein, seitdem nicht mehr richtig verlassen hat.
Du merkst an meinem antiquierten Beispiel mit der Enzyklopädie, dass ich mich gedanklich in einer untergegangenen Welt aufhalte, einer Welt, in der Bücher noch eine Bedeutung hatten und somit auch das Schreiben. Aber wie kann ich schreiben, wenn ich dem Schreiben nicht einen Wert zumesse, mag er auch noch so marginal und im Abgespult-Werden des Zeitenlaufs vernachlässigbar sein? Liegt hier überhaupt die Lösung der von mir zu einem Drama hochstilisierten privaten Farce? Kann ich nur allein deshalb keine vergangenen Zeiten heraufbeschwören, weil ich selbst aus der Zeit gefallen bin und als untauglicher Fremdkörper, noch nicht einmal als schädliches Bakterium, das einem Metabolismus schaden oder ihn gar zum Erliegen bringen könnte, einflusslos durch diese Welt schwebe, die mich wie nebenbei verdaut und unbemerkt wieder ausscheidet? So bleibt eben auch meine Kritik schal, weil sie nirgendwo mehr anzusetzen versteht, sondern sich in Beliebigkeiten verliert, verlieren muss, weil ich aufgehört habe, irgendwelche Interessen zu teilen, aufgehört habe, an irgendetwas teilzunehmen, von irgendetwas noch Teil zu sein. Warum ich mich dann nicht einfach zu einem weltabgewandten Solipsisten mache, der in seiner Klause sitzt und vor sich hin räsoniert? Ganz einfach, weil es mir dazu an Format fehlt. Dieses losgelöste, monadische Andere kann ich weder entwerfen noch selbst sein, weil mich die sentimentale Sehnsucht, »dazuzugehören«, nie ganz verlassen hat. Wahrscheinlich ist das der Grund, warum ich in meinen Erzählstümpfen in die siebziger Jahre zurückgekehrt bin, als ich von der Welt noch nichts wusste, weshalb sie mir sämtliche Möglichkeiten zu bieten schien. Und weil ich immer noch nicht mehr von dieser Welt weiß, klammere ich mich weiterhin an unzureichende Lebensentwürfe.
Oder ist das, was ich zu einem existenziellen, teilweise individuellen, dann wieder allgemeinen Problem einer untergehenden Generation und ihrer Zeit hochstilisiere, in Wirklichkeit völlig banal, muss jeder, der schreibt, erfahren, dass am Ende immer etwas anderes dasteht als das, was er zu verfassen vorgehabt hatte? Wird das Ziel letztlich immer verfehlt, so gibt es jedoch innerhalb dieses Verfehlens Unterschiede, etwa, indem trotz offensichtlicher Mängel das fertige Produkt als solches belassen und der Öffentlichkeit übergeben werden kann, weil die notwendigen Verbesserungen im nächsten Buch an einem verwandten Stoff vollzogen werden. Eine für den Schreibprozess sehr lohnende Praxis, die ich jedoch nie selbst habe anwenden können, da mich das Gefühl, kläglich versagt zu haben, unmittelbar einem anderen, neuen und möglichst weit entfernten Sujet in die Arme trieb, das ich auf gänzlich andere Art und Weise zu behandeln versuchte, um nur nicht an meine Schmach erinnert zu werden. Das hatte zur Folge – eine Erkenntnis, die mir erst spät, wahrscheinlich zu spät kam –, dass ich nichts dazulernte, mich folglich nicht entwickelte. Ich war wie jemand, der beim Schach scheitert und dann zum Damespiel, von dort zu Mühle und immer so weiter wechselt, bis er zuletzt bei Mensch-ärgere-dich-nicht angelangt ist und erkennen muss, dass er sämtliche Brettspiele hinter sich gebracht hat, ohne dabei grundsätzlich etwas an seiner Spielhaltung geändert beziehungsweise verbessert zu haben. Nun, da er nicht mehr weiter fliehen kann, muss er sich sein Scheitern eingestehen. In etwa so wie dieser armen Kreatur, wobei ich nicht weiß, ob es überhaupt professionelle Mensch-ärgere-dich-nicht-Spieler gibt, geht es mir, und was für diesen das Mensch-ärgere-dich-nicht, das ist für mich, nach Romanen, Theaterstücken, Essaybänden, ja, selbst einem Gedichtband und zwei Kinderbüchern, dieser Band mit Erzählungen.
Du kannst und musst mir glauben – und bitte glaube mir, auch wenn ich mich wiederhole –, dass ich über die vergangenen Monate mit allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln versucht habe, wenn schon nicht ein Verhältnis mit, so doch zumindest eine Haltung zu meinem Stoff und seiner Form zu erlangen. Nach vielen Kämpfen war ich, erschöpft und von meinem eigenen Anspruch gedemütigt, schließlich zu jedem Kompromiss bereit, doch selbst für den faulsten aller Kompromisse fehlte mir eine Grundlage, eben jene Fähigkeit, die ich versäumt hatte, mir im Laufe meiner Arbeitsjahre anzueignen. Ich musste feststellen, dass ich einen Kompromiss, wie ich ihn beinahe täglich im Umgang mit anderen Menschen eingehe, meiner eigenen Arbeit gegenüber nicht eingehen konnte. Ja, das mag in Deinen Ohren wieder nach dieser von Dir zu Recht gescholtenen Haltung klingen, die Du das eine Mal als »überzogenen Anspruch«, dann wieder als »aufgesetzte Radikalität« bezeichnet hast, ohne dabei, und bitte verstehe das nicht als Vorwurf, die Not zu erkennen, die mich dazu trieb und immer weiter dazu treibt, entsprechende Phrasen zu benutzen. Was ich damit sagen will, die von Dir zu Recht kritisierten Äußerungen waren keineswegs Darlegungen genau durchdachter Analysen und daraus abgeleiteter Schlussfolgerungen, sondern im Gegenteil Ausdruck meiner Unfähigkeit, das Problem selbst in Worte fassen zu können. Oder, um es doch noch einmal zu versuchen: Ich bin, so glaube ich zumindest, auf das dunkle Geheimnis der Literatur gestoßen, den Grund für das Scheitern so vieler Existenzen, dass nämlich die Fähigkeit, komplizierte Sachverhalte, weitverzweigte Lebensgeschichten und komplexe Theorien zu formulieren, bedauerlicherweise nicht die Fähigkeit miteinschließt, wahlweise die eigene Bedürftigkeit oder eigene Unfähigkeit, die sich auf gewisse Weise beide bedingen, artikulieren zu können. Es ist erschreckend simpel: Ein Romancier kann ein Familienleben schildern, ohne eine Familie gründen zu können, ein Philosoph kann über Charakterwandel nachdenken, ohne zu einer Selbsttherapie fähig zu sein, ein Soziologe die Liebe analysieren, ohne je geliebt zu haben, und so weiter. Und dieses Geheimnis ist keineswegs deshalb dunkel, weil es so geheim wäre, sondern es ist so dunkel, weil es nahezu offensichtlich ist, dennoch immer wieder aufs Neue von allen Beteiligten verschwiegen werden muss, weil sonst das letzte simulierte Fädchen des bereits fadenscheinigen Konstrukts unserer Weltenordnung reißen und uns damit die letzte, wenn natürlich auch lediglich imaginierte Möglichkeit zur Orientierung rauben würde. Der Literat erscheint wie eine der symbolischen Gestalten aus der antiken Mythologie, die für die Fähigkeit, über alles schreiben zu können, etwas hatte opfern müssen, was sich am Ende als noch wertvoller als das dafür Erhaltene herausstellen würde, nämlich die Fähigkeit, über sich selbst zu sprechen. Von alldem aber ahnte ich lange Zeit nichts, sondern versuchte stattdessen weiterhin beharrlich, mein eigenes Interesse zum Ausgangspunkt von Literatur zu machen. Dieser grundsätzlich verkehrte Ansatz führte ganz notwendigerweise zu einem Gefühl des Versagens, das mich dazu brachte, meine eigenen Schreibfähigkeiten infrage zu stellen und, weil ich die Ursache des Problems nicht erkannte, auf völlig verkehrte Weise nach Abhilfe zu suchen. Wie ein Anfänger durchforstete ich Schreibratgeber, legte alle Scham ab, machte brav die vorgegebenen Übungen, untersuchte meine Erzählstümpfe auf die angegebenen Kriterien hin und versuchte sie entsprechend umzuschreiben. Ich wechselte die Perspektive, verfasste für jede Figur eine eigene Vita, verlegte die Handlung an andere Orte und in andere Zeiten, tauschte die Geschlechter, ließ alle sterben und post mortem erzählen, dann wieder in einer reflexhaften Umkehr ante natum, dividierte die Figuren einer Geschichte auseinander und siedelte sie in andere Geschichten um, fügte alle Geschichten zu einer einzigen zusammen, nur um diese erneut aufzuteilen, komponierte Zyklen und Reigen, erzählte barock, dann wieder reduziert, bis ich, anders kann ich es nicht sagen, diesen Wechsel von kurz aufflammender Euphorie, die mich bei jeder neuen Idee überfiel, und tiefer Verzweiflung, in die diese Euphorie spätestens am nächsten Tag umschlug, nicht länger, selbst mithilfe einer immer größeren Menge Alkohol, ertragen konnte. Ich las Erzählungen von Schiller, Roth, Borges, Carver, Leskov, Cortázar und unzähligen anderen, hielt mich dann wieder vollkommen abstinent und tat so, als gäbe es nur das leere Blatt und darüber hinaus kein Wissen, keine Idee, keinen bereits geschriebenen Satz, sondern allein mein monadisches Ich, das durch eine wortlose Leere schwebte. Doch alles, was mir in den Sinn kam, wollte sich unmittelbar an bereits Geschriebenes und Gedachtes anschmiegen. Also schrieb ich die Titel meiner Erzählstümpfe auf ein Blatt, setzte mich davor und versuchte mir vorzustellen, ich würde den Band eines mir unbekannten Autors aufschlagen, dort diese Titel im Inhaltsverzeichnis lesen und mich als einen mit dem Stoff völlig Unvertrauten fragen, was ich mir unter der jeweiligen Überschrift vorstellen beziehungsweise welchen Text ich selbst gern lesen würde.
Waldweg, Johanna, Stiftungsfest, Mitternachtsbus, Am Bahngleis, Madeira, Zeichen der Gewalt, Paddenberg, Hoffmanns Höllenfahrt, Pfandhaus, Ein Koffer aus Salzburg, Kamillas letzter Freund, Der Tag danach. Lag es am Ende an den Titeln, aus denen einfach nichts entstehen konnte, obwohl ich die meisten von ihnen provisorisch gewählt hatte, sobald die ersten Umrisse einer Erzählung skizziert waren, immer in der Gewissheit, am Ende, wenn die Erzählung einmal abgeschlossen sein würde, sie entsprechend abändern und anpassen zu können? Nun hatten sich diese, zugegebenermaßen meist banalen Überschriften über die Wochen und Monate gefestigt und einen Wall um die Erzählstümpfe gebildet, der mir eine weitere Bearbeitung der einzelnen Geschichten unmöglich machte. Ich kann verstehen, wenn Du eine solche Bemerkung, solltest Du sie nicht einfach überlesen haben, für übertrieben hältst, allerdings hat sich in mir mittlerweile eine leicht paranoide Haltung der Sprache gegenüber entwickelt, die mir mit jedem zu Papier gebrachten Satz eine Verantwortung aufbürdet, als handele es sich um einen Gerichtsspruch, ein Urteil über Leben und Tod. Dabei sitze ich doch nur an meinem Schreibtisch, ohne irgendeine Bedeutung für die Welt, die sich ungerührt weiterdreht. Eigentlich wäre ich völlig frei, würde mich nicht die Idee verfolgen, etwas erzählen zu wollen, die diese vermeintliche Freiheit bereits nach dem ersten hingeschriebenen Wort als Schein entlarvt.
Natürlich klingt mir an dieser Stelle sofort Dein altbekanntes »Du willst zu viel« in den Ohren. Nachdem ich es oft abgetan habe, erscheint es mir mittlerweile wie eine Variante des Satzes, den mir meine Lehrer mit auf meinen Lebensweg gaben und der seinerzeit lautete: »Du willst zu wenig«. Ob zu viel oder zu wenig, das ist, wie ich habe erfahren müssen, völlig gleichgültig. Es geht um das rechte Maß, sowohl im Leben als auch im Schreiben. Und es scheint genau dieses Maß zu sein, das mir fehlt. Eigenartigerweise konnte ich über dieses Fehlen in keinem der Ratgeber und in keiner der von mir fieberhaft verschlungenen Selbstreflexionen anderer Autoren etwas finden. Vielleicht, so mein Verdacht, weil es sich um eine so grundsätzliche, so banale Voraussetzung handelt, dass sie der Erwähnung einfach nicht wert ist. Dieses Maß aber, so mittlerweile meine Überzeugung, ist Bedingung für alles Übrige, Grundlage, um überhaupt eine Erzählform und einen Stil entwickeln zu können. So muss ich nun anhand der gescheiterten Erzählungen feststellen, dass nichts von dem übrig bleibt, was ich als »mein Schreiben« bezeichnen könnte, mehr noch, dass es nichts von alldem tatsächlich gab, was ich bislang zu besitzen meinte. Du wirst an dieser Stelle meine bereits veröffentlichten Bücher ins Feld führen, aber wenn Du Dir die Mühe machst, sie etwas genauer zu betrachten, wirst Du feststellen, dass sie für eine Entkräftung meiner Argumente nicht taugen. Es handelt sich in gewisser Weise um Zufallsprodukte, Sujets, die sich mir aufgedrängt, Themen, die sich quasi von selbst entwickelt haben, ohne eine grundsätzliche Haltung von mir zu fordern. Du kannst mich mit einem Mann vergleichen, der eine Klassenkameradin oder Kommilitonin heiratet, der das Geschäft des Vaters übernimmt oder Finanzbeamter wird, weil ihm dieser Berufsweg nach einem zufällig ergriffenen Praktikum angeboten wurde. Diese Ehen, Berufsleben und Karrieren müssen deshalb nicht missglücken, doch sie erforderten nie das, was ich unter einer Entscheidung verstehe, diese Möglichkeit, die sich mir, ohne dass ich im Geringsten damit gerechnet hätte, in den letzten Monaten präsentierte und immer beharrlicher ihr Recht einforderte, so dass ich sie, denn natürlich habe ich auch das versucht, nicht mehr abschütteln konnte. Mehr noch, es gelang mir nicht länger, zu meinem bisherigen Schreiben (und Leben) zurückzukehren, indem ich mich wie bislang einfach um eine Entscheidung herumdrückte und blindlings zum nächsten Projekt überging. Plötzlich verstand ich die einschneidenden Krisen in anderen Biographien, die von einem Tag auf den anderen alles verändern und die ich bislang immer mit einem gewissen Unverständnis betrachtet oder mir mit fadenscheinigen Begründungen hinwegzuerklären versucht hatte. Ich begriff nun, dass es Herausforderungen gibt, bei denen man nicht die Wahl hat, ob man sich ihnen stellen will oder nicht – und sei es nur, dass es keinen weiteren Ort gibt, zu dem man vor ihnen fliehen könnte.
Ich will Dich aber nicht länger mit abstrakten Erklärungsversuchen aufhalten, sondern Dir einige ganz konkrete Beispiele nennen, damit Du besser verstehen kannst, von was ich überhaupt spreche. Würdest Du mich fragen, was ich in meinen Erzählungen erzählen will, so könnte ich Dir darauf eine, wenn auch unzureichende Antwort geben. Würdest Du mich allerdings nach dem »Warum« fragen, so müsste ich Dir die Antwort schuldig bleiben. Ich weiß es nicht. Auch wenn ich mir den Kopf noch so sehr zermartere, ich finde keine Antwort auf die Frage, warum ich, bleiben wir einmal ganz konkret bei besagten Erzählungen, diese Geschichten erzählen will. Aber es ist noch schlimmer. Vertiefe ich mich nämlich ernsthaft in diese Frage nach dem Warum des Erzählens, so merke ich, dass mir auch das Was abhandenkommt, denn dieses Was scheint – ein Umstand, der mir zuvor nicht bewusst war – ganz direkt mit der Frage nach dem Warum verbunden. Wenn ich nicht weiß, warum ich etwas erzählen soll, dann weiß ich auch nicht mehr, was ich erzählen wollte. Das klingt unlogisch? Glaub mir, ich habe längst aufgegeben, nach einer allgemein gültigen Logik zu suchen. Die von mir geforderte Entscheidung hat die gängigen Argumentationsmuster, mit denen ich mich bislang über Wasser gehalten habe, außer Kraft gesetzt.
Für kurze Zeit glaubte ich, ohne zuvor die Frage nach dem Warum beantwortet zu haben, folglich ohne Grund etwas schildern zu können, etwa so, wie man eine Pflicht erfüllt oder aus Gewohnheit an einem Ritual festhält, das man selbst als unsinnig oder zumindest als fragwürdig erkannt hat. Doch meinem Schreiben gegenüber versagten diese Versuche. Die Frage nach dem Warum entpuppte sich als Hydra, denn sobald ich meinte, einen Grund gefunden zu haben – tatsächlich waren es, wie sich schon bald herausstellte, immer nur billige Ausreden –, sprang mich diese weiterhin unbeantwortete Frage in vervielfachter Form aus jeder noch so banalen Alltagsverrichtung an, als wollte sie mir sagen: Versuchst du dich vor mir zu drücken, so mache ich dir dein Leben generell zur Hölle.
Ich musste mich ihr also stellen, musste mir selbst gegenüber Rechenschaft ablegen, was ich konkret zu erzählen vorgehabt hatte. Als Titel für den Erzählband hatte ich immer wieder zwischen 281 Stunden, 281 Leben oder ähnlichen Varianten geschwankt. Bitte frag mich nicht, was die Zahl 281 bedeutet, sie war mir irgendwann in den Sinn gekommen und sollte einfach eine große, ungenaue Summe benennen, denn es ging mir darum, so meinte ich zumindest, eine ebenso große Anzahl von Leben miteinander zu verknüpfen und notgedrungen unscharf und lediglich exemplarisch anhand kurzer Episoden zu beleuchten. Doch warum? Wollte ich eine Mischung aus Bestimmung und Zufall beschreiben, die in jedem Leben wirksam wird? Das hieße, das Pferd von hinten aufzäumen und quasi mit dem Ergebnis im Kopf etwas darstellen. Doch warum etwas aufschreiben, was ich selbst bereits weiß? Um andere zu belehren? Dieses Interesse hatte ich noch nie. Wahrscheinlich wollte ich einer bestimmten menschlichen Verfasstheit Ausdruck verleihen. Ich sage »wahrscheinlich«, denn genauer kann ich es nach wie vor nicht formulieren.
Als ich mir das letzte Mal vor meinem Krankenhausaufenthalt die Erzählungen vorgenommen hatte, musste ich feststellen, dass sich meine Zweifel dem Schreiben gegenüber in die Texte selbst eingeschrieben hatten. Meine Sprache war zögerlich, meine Figuren liefen wie auf rohen Eiern durch die Handlung und verhielten sich so, als seien sie allesamt Bluter oder litten an der Glasknochenkrankheit. Feige und zimperlich war ich mit ihnen umgegangen, wenn ich mich überhaupt an sie herangetraut hatte. Aus irgendeiner falsch verstandenen Ehrfurcht heraus hatte ich sie, kaum dass sie auf der Bildfläche erschienen, sich selbst überlassen, damit sie sich ganz frei und ungezwungen ihrem ureigenen Naturell gemäß würden entwickeln können. Das hatte zur Folge, dass sie als ununterscheidbare Abziehbilder gesellschaftlicher Klischees Banalitäten und Alltagsweisheiten austauschten. Und um hier keinerlei Zweifel aufkommen zu lassen, das waren keine mehr oder minder gekonnten Darstellungen sozialer Gepflogenheiten, sondern Beispiele meiner Beschreibungsunfähigkeit. Zuerst überkam mich ein Gefühl der Ohnmacht, und dann, wie es sich für einen Verfasser von Klischees gehört, ebenso klischeehaft ein Gefühl der Wut. Nachdem ich sie bislang wie Porzellanfigürchen behandelt hatte, lechzte ich nun nach Mord und Totschlag, aber nicht so wie im Krimi, diesem Verwaltungsakt von Mord und Totschlag, der dem Mord das Mordige und dem Totschlag das Totschlagende nimmt und es in ein Gefühl der kalkulierten Spannung hineinkanalisiert. Was war denn bei diesem allgemein vorgeführten Grusel noch an Spannung zu ertragen? Ein platter Nervenkitzel, der aus herausgeplärrten Effekten bestand und sich an nichts weiter zu messen hatte als an einer platt konstruierten Krimi-Realität, die überall das Eigenartige und Besondere versprach, anstatt sich schweigend in ihr Schicksal vorhersagbarer Austauschbarkeiten zu fügen. Früher lag die wirkliche Spannung noch in ihrer subtilen Beziehung zur Langeweile. Schließlich hatte die vornehmliche Aufgabe der Literatur einst darin bestanden, den Leser zu langweilen. Und erst diese Langeweile, die in der Literatur gepflegt wurde, bildete das Substrat, auf dem das Triviale gedeihen konnte. Aber wie ist es heute darum bestellt? Ich erspare Dir und mir an dieser Stelle weitere Einlassungen.
In dieser Verfassung, einerseits bereit zu langweilen, andererseits bereit, meine Figuren in einer letzten Vernichtungsschlacht aufeinander zu hetzen, damit sie sich gegenseitig die Schädel einschlagen und dem ganzen Spuk endlich ein Ende bereiten, nahm ich die erste Erzählung, Waldweg, vor, die mit der Schilderung eines Mannes beginnt, der im Bahnhof des kleinen Ortes Mühlthal, nördlich von Starnberg, einen Kiosk betreibt. Dieser Herr Huber ist im Jahr 1926 geboren. Ich muss noch einmal zu Deiner Orientierung wiederholen, dass sämtliche Erzählungen in den 1970er Jahren spielen. Huber ist also Ende vierzig und der Bahnhof Mühlthal noch in Betrieb. 2004 wurde die Gleisanlage endgültig stillgelegt, in den folgenden Jahren das Schotterbett aufgeschüttet und schließlich ein Rückbau der Bahnsteige in die Wege geleitet. Das Gebäude befindet sich meines Wissens in Privatbesitz, steht allerdings unter Denkmalschutz, weil 1854 von dem Architekten Georg Friedrich Bürklein gebaut, der auch die Bahnhöfe von München, Augsburg, Bamberg, Würzburg und zusammen mit dem Maximilianeum die Maximilianstraße entworfen hat. Ich erwähne das deshalb, weil hier gleich zu Beginn ein erstes Problem in Bezug auf das von mir erwähnte richtige Maß auftaucht, denn mein Versuch, eine Erzählstruktur zu etablieren, die keine Figur bevorzugt, sondern alle gleichberechtigt in ein sich immer weiter ausbreitendes Geflecht einbindet, führte dazu, dass sich die Figuren schon bald gegenseitig zu behindern begannen. Mein irriges Erzählvorhaben, in dem ich den Architekten des über hundert Jahre zuvor gebauten Bahnhofs ebenso wichtig nahm wie den Kioskbetreiber, ein Ansatz, der mir aus irgendeinem für mich nicht länger nachvollziehbaren Grund einmal vielversprechend erschienen war, führte ganz anders, als ich es mir vorgestellt hatte, nicht zu einer faszinierenden Verzweigung, sondern zu einer kompletten Beliebigkeit.
Hatte ich etwa versucht, mich durch ausufernde Recherchearbeiten, das Hineinversenken in immer neue Biographien, vor dem konkreten Schreiben zu drücken, um noch für eine Galgenfrist mit dem Gefühl, etwas zu tun, am Schreibtisch sitzen zu können, ohne tatsächlich herausgefordert zu werden? Auch das mag eine Rolle gespielt haben, tatsächlich aber suchte ich nach einem Impuls, der mein irriges Erzählvorhaben würde tragen können. Wenn ich las, dass der einst gefeierte Architekt Bürklein an einem bestimmten Punkt die Gunst des Königs Maximilian II. verliert und von diesem den Hamburger Baumeister Semper vor die Nase gesetzt bekommt, ein Umstand, der Bürklein letztlich in den Wahnsinn treibt, dann fühlte ich mich dem Erzählen ganz nah. Mehr noch, wenn sich zufällig Parallelen auftaten wie etwa in dem Umstand, dass Bürklein im Jahr 1872, also genau hundert Jahre vor der eigentlichen Geschichte, die ich erzählen wollte, in die Kreisirrenanstalt Schloss Werneck eingeliefert wird, in der er kurze Zeit später stirbt, jener Anstalt, die durch den König Maximilian überhaupt erst ermöglicht wurde, als er der Gemeinde Unterfranken das Schloss zur entsprechenden Nutzung überließ. Doch das, was mir für Momente das Erzählen zu ermöglichen schien, verhinderte es im nächsten Augenblick schon wieder, weil ich mir eingestehen musste, dass genau das, auf was ich stieß, doch bereits erzählt war, weshalb ich nicht länger wusste, warum ich es nun noch einmal erzählen sollte.
Ich befürchte, ich hatte mich zu sehr in den Gedanken verliebt, gewisse unzusammenhängende Biographien, die sich an nicht selten weit auseinanderliegenden oder von den Beteiligten selbst nicht bemerkten Punkten kreuzten, auf eine Weise miteinander zu verknüpfen, in der ich keine schicksalhafte Bestimmung suggerieren, sondern das Zufällige weiter erhalten wollte. Dies aber hatte beinahe zwangsläufig zur Folge, dass das von mir Erzählte, ich erwähnte es bereits, den Eindruck des Beliebigen bekam. Gegen die umgekehrte Vorgehensweise, eine Schlüssigkeit zu konstruieren, um damit eine Bedeutung zu suggerieren, hatte ich mich von Anfang an entschieden, nicht nur, weil ich fürchtete, schon bald Opfer besagter paranoider Sichtweise zu werden, in der alles mit Bedeutung aufgeladen wird und die mich, ich gebe es gern zu, auf andere Weise dann doch heimsuchte, sondern weil es mir schlicht und einfach nicht um eine bestimmte Bedeutung ging, vielmehr um die Schilderung des Schicksalhaften, das über den individuellen Lebensentwurf hinausführt, ohne ihn dabei generell infrage zu stellen. Erzählte ich jedoch von Bürklein, verschwand mit einem Mal Huber, tauchte die Irrenanstalt von Werneck auf, verblasste der Bahnhof von Mühlthal. Dort wurde übrigens am 14. Juni 1999 gegen 23 Uhr ein Rentnerehepaar überfallen, das gerade mit der S-Bahn von einem Konzertbesuch aus München zurückkam und zu seinem dort abgestellten Auto wollte. Die beiden Täter drückten dem Mann das linke Auge aus und prügelten die Frau zu Tode. Hatte ich diese Meldung anfänglich ausgelassen, kam sie mir nun auf meiner Suche nach Gewaltexzessen gerade recht. Und so fing ich an, auch das Leben des bislang harmlosen Herrn Huber entsprechend zu modifizieren. Dass er noch kurz vor Kriegsende als Flakhelfer eingezogen worden war und sich später mit verschiedenen Aushilfsjobs über Wasser hielt, bevor er Ende der 1950er Jahre den Kiosk in Mühlthal zur Pacht angeboten bekam, reichte mir nicht mehr aus. Ich nahm die ihm zugeschriebene Angewohnheit, ohne dass ihm jemand widersprochen hätte, bei Erzählungen regelmäßig den Satz anzufügen: »Das können meine Frau und meine Kinder jederzeit bestätigen«, zum Anlass, ihn gewissen Verdächtigungen auszusetzen. Besagte Formel klang aus seinem Mund gerade deshalb merkwürdig, weil man weder seine Frau noch seine Kinder je in Mühlthal gesehen hatte. Dabei hätte es sich doch zumindest im Sommer während der Ferien angeboten, einen Ausflug zu unternehmen und ihn dort draußen einmal aufzusuchen. So erscheint es fraglich, und das lasse ich bewusst offen, ob Huber überhaupt Familie hat. Ein zweites Gerücht ließ ihn mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Hier greife ich einen konkreten Fall auf, der damals durch die Presse ging. Am Abend des 20. Januar 1971 durchsuchte die Münchener Kriminalpolizei einem Hinweis folgend Hubers Haus in Feldmoching und fand dort auf dem Speicher zusammen mit zwei Engeln, einem Christus und einer weiteren Marienfigur aus der Blutenburger Schlosskapelle eine gotische Madonna aus dem 15. Jahrhundert. Huber, der angeblich durch geschickten An- und Verkauf von Antiquitäten sowie Immobiliengeschäfte zwischenzeitlich zu Geld gekommen war, dies aber nach außen hin verheimlichte, lediglich immer öfter seinen Ziehsohn den Bahnhofskiosk betreiben ließ, besaß tatsächlich eine Sammlung von Sakralfiguren, gab allerdings vor, einen der drei Männer, die diese Figuren nachweislich gestohlen hatten, zufällig auf dem Oktoberfest kennengelernt und von diesem gebeten worden zu sein, Umzugsgut vorübergehend auf seinem Dachboden einlagern zu dürfen, was Huber ihm gestattete, ohne zu wissen, was genau sich in den Kartons befand. Kaum hatten Hubers Bekanntschaften ihr Diebesgut bei ihm untergebracht, forderten sie von der Bayerischen Schlösserverwaltung 300 000 DM für die Herausgabe der Blutenburger Madonna, bekamen jedoch lediglich zum Schein 100 000 DM geboten und wurden im Laufe der Verhandlungen inhaftiert. Als Huber bei Verhören belastet wurde, kam auch er vorübergehend in Haft, wurde jedoch bereits nach wenigen Tagen wieder freigelassen. Allerdings dauerte es noch zwei weitere Jahre, bis er von den Vorwürfen der Mitwisserschaft und Hehlerei offiziell freigesprochen wurde. Mit keinem Wort wurde damals in den Zeitungsmeldungen etwas von Hubers Familie erwähnt, was natürlich nicht zwangsläufig bedeutet, dass sie nicht dennoch existierte. Mit besagtem Ziehsohn verstritt Huber sich im Mai 1990 wegen Unregelmäßigkeiten bei den Abrechnungen des Kiosks, den jener mittlerweile ganz übernommen hatte. Zwei Monate später suchte der Ziehsohn unter einem Vorwand Huber in seiner Schwabinger Wohnung auf, wo es zu einem absurden Streit, gefolgt von einem sinnlosen Gewaltverbrechen kam, bei dem Huber zuerst mit mehreren Messerstichen an Hals und Nieren verletzt und anschließend mit einem Hammer erschlagen wurde. Die Geschichte beginnt allerdings ganz anders, nämlich folgendermaßen, damit Du einen konkreten Eindruck bekommst:
Nicht weit vom Mühlthaler Bahnhof liegt in einer Talsenke, über der sich das Wetter oft mehrfach am Tag ändert, eine kleine Siedlung, die gerade einmal aus vier Straßenzügen mit Einfamilienhäusern besteht. Dort wohnt der Haushaltsschullehrer Rudolf Manger zusammen mit seiner Mutter. Mangers Mutter ist die Tochter eines Sägewerkbesitzers, wurde 1892 in Wiesbaden geboren und war erst drei Jahre zuvor, nach dem Tod ihres Mannes, zu ihrem alleinstehenden Sohn gezogen. Die erste Ehefrau ihres Mannes, des Heimatdichters Otto Sutter, war die Opernsängerin Beatrice Lauer-Kottlar, die Sutter in Frankfurt kennengelernt hatte, wo sie als Gesangslehrerin am Hoch’schen Konservatorium arbeitete und unter anderem 1924, ein Jahr vor der offiziellen Uraufführung, drei Szenen aus Alban Bergs Wozzeck unter der Leitung von Hermann Scherchen vortrug. Im selben Jahr kaufte sie das Barockschloss Liel im Schwarzwald, nahe der französischen Grenze, in dem in den ersten Jahren vor allem ihr Mann lebte. 1932 löste sie ihren Vertrag mit der Frankfurter Oper aus Gesundheitsgründen auf und beendete die Lehrtätigkeit am Konservatorium. 1935, sie war gerade Anfang fünfzig, starb sie unter ungeklärten Umständen. Ihr Mann ließ im nahe gelegenen Eggenertal in Erinnerung an sie ein Holzkreuz aufstellen, verkaufte das Schloss 1940 an die Gemeinde und zog nach Gengenbach.
Ich zitiere das alles nur deshalb so ausführlich, damit Du das Problem meiner Erzählweise unmittelbar erkennst. Meine Idee, diese unterschiedlichen Biographien, die sich in dieser ersten Geschichte aus rein zufälligen Gründen im Umfeld des Mühlthalers Bahnhof begegnen, exemplarisch darzustellen – der Lehrer Manger etwa hatte die Angewohnheit, seine Zeitung beim nahegelegenen Kiosk Hubers zu kaufen –, wurde unter den von mir angesammelten Fakten erstickt. Ursprünglich hatte ich zeigen wollen, welche unterschiedlichen Kräfte Tag für Tag aufeinander wirken, wie viele Schicksale miteinander verkettet sind, ohne dass sie voneinander wissen. Ich wollte mich auf einzelne Momente konzentrieren, in denen das darunterliegende Geflecht für einen kurzen Augenblick sichtbar wird, und habe dabei die Erzählung selbst aus den Augen verloren. Zusätzlich wurde mir die unheimliche Grundstimmung, die aus diesem letztlich schicksalsergebenen Blick auf die Welt entsteht, so wichtig, dass ich die Normalität des Alltäglichen vernachlässigte, die doch nötig ist, um das Besondere überhaupt kenntlich zu machen. Jedoch ausschließlich die Geschichte von Huber oder Mangers Mutter oder wem auch immer zu erzählen, das erschien mir zu wenig. So wechsle ich von Mangers Mutter unmittelbar zu Manger selbst, der am nächsten Tag gegen halb elf im Klassenraum steht und die Valenzstrichformel für das Flüssiggas Butan an die Tafel schreibt, als die Schulleiterin, Frau Dr. Göbel, den Klassenraum betritt, um den Schülerinnen etwas Organisatorisches mitzuteilen. Manger legt die Kreide ab, geht zu einem Bücherregal an der Längswand und nimmt in einer Verlegenheitsgeste aus dem obersten Fach das Buch Film – Licht – Farbe von Hilmar Mehnert, Autor zahlreicher Bücher zum Thema Film und Fotografie, das 1958 im Fotokinoverlag Halle/Saale erschienen war und lange Zeit als Standardwerk für den Lichtbestimmer galt. Ich streife darauf kurz Mehnerts Leben, erweitere den Blick auf das Leben in der DDR, die er Anfang der sechziger Jahre verlassen hatte, um zur Schulleiterin Frau Dr. Göbel zurückzukehren und von ihrer Schauspielkarriere vor dem Krieg zu erzählen, als sie in dem Film Die Finanzen des Großherzogs debütierte, den Gustaf Gründgens 1933 drehte. Bereits zwei Jahre später spielte sie in ihrem fünften Kinofilm, Traumulus, nach einem Stück von Arno Holz. Adolf Hitler besaß eine Privatkopie des Films, dessen Aufführung nach 1945 von den Alliierten verboten wurde. Die Rolle des weltfremden und aus der Zeit gefallenen Schuldirektors mit dem Spitznamen Traumulus hatte Emil Jannings übernommen. Nach dem Krieg konnte Frau Göbel als Schauspielerin nicht mehr richtig Fuß fassen, weshalb sie Lehrerin wurde und Ende der sechziger Jahre die Stelle als Direktorin der Haushaltsschule übernahm. Wann sie in diesen Jahren ihren Doktortitel erwarb, ist unklar.
Solltest Du an dieser Stelle immer noch das Gefühl haben, hier könnten sich literarische Spuren befinden, so konnte dieser Eindruck nur entstehen, weil es mir immer noch nicht gelungen ist, Dir die grundsätzliche Problematik zu erläutern, die mich hat scheitern lassen. Und das ist nur schlüssig, denn wäre ich in der Lage, Dir einen wirklichen Grund nennen, so meine Vermutung, könnte ich womöglich auch diese Erzählstümpfe wieder aufpäppeln und mit einem Provisorium versehen oder sie wenigstens endgültig herunterraspeln. Zudem erhältst Du durch die wenigen Zitate und ungenauen Beschreibungen ein ohnehin unvollständiges, wenn nicht gar völlig falsches Bild, da ich die zwölf Geschichten nacheinander verfasst und genau das versucht habe, was ich bislang bei meinen Büchern versäumt hatte, nämlich mit jeder weiteren Erzählung die offensichtlichen Mängel der vorhergehenden auszugleichen. So nehme ich in der zweiten Erzählung, Johanna, die vielen Fakten und Daten wieder etwas zurück und beginne mit einem eher stimmungsvollen Bild, das ich Dir hier zur Abwechslung einmal etwas ausführlicher zitiere:
Nicht abwehren oder übergehen, sondern insistieren müssten wir auf der Ereignislosigkeit und Langeweile, die das Leben jedes Einzelnen von uns über weite Strecken stärker bestimmen, als in dem Resümee unserer Existenz, mit seinen in wenigen Zeilen zusammengerafften Daten, am Ende deutlich wird. Das jugendliche Ausharren vor einem Glas Cola neben dem defekten Flipper und der Musikbox, für die das Kleingeld fehlt. Wobei das verheißungsvolle Hineingehen in die Kneipe bereits das Ende der Erwartung markiert. »Wo warst du?« und »Warum kommst du denn so spät?« sind keine Fragen, die auf eine Antwort zielen, sondern nur zeigen, dass sich wieder einmal dort, wo Hoffnung war, nichts erfüllte. Lähmend spulen sich Tage und Wochen ab, entsteht eine unerträgliche Starre, während die Jahreszeiten unbekümmert vorüberziehen, das Tageslicht unbeachtet zwischen den Dachgiebeln der Häuserreihen wechselt. Und natürlich kann leicht die Idee entstehen, nachdem man sich das Rauchen und das Schminken, das Aussuchen der Kleider – orangerotes Shirt zu schwarzer Hose –, das morgendliche Umlegen einer passenden Kette und das Anstecken von zwei roten Ringen Modeschmuck am Ringfinger der linken Hand beigebracht hat, es könne sich alles ändern, wenn man nur eine ganz bestimmte Person »aus dem Weg räumt«, anstatt auf den vergilbten Vorhang zu achten und die namenlosen Sukkulenten auf dem Fensterbrett und die verblasste Plastikgießkanne, die allesamt da sind, obwohl niemand sie bewusst angeschafft hat. Dinge, die mitgenommen werden und nicht eigens gekauft, unverabredet dagelassen, vereinbarungslos vererbt.
Alfred, Roswithas wesentlich älterer Freund, trägt zum Autofahren hellbraune Handschuhe aus perforiertem Leder, die mit einem Druckknopf an der Handschlaufe zusammengehalten werden. Roswitha versäumt, sich zu fragen, ob es eine bewusst gewählte Angewohnheit von ihm ist, etwa, weil er Huschke von Hanstein imitiert, der nach seiner Arbeit als Leiter bei Porsche immer noch Rennen fährt und im Fernsehen Interviews gibt, ehemaliges Mitglied des NSKK, der NSDAP und der SS, die ihm einen BMW 328 mit SS-Runen auf den Wagentüren zur Verfügung stellte, oder ob die Handschuhe ein Geschenk seiner Frau sind und er sie allein deshalb anzieht, um sein anfängliches Missfallen auszugleichen. Männer entwickeln in der Regel keinen eigenen Kleidungsstil, tragen einen beliebigen Pullover über einem gestreiften Hemd, in dessen Kragenform sich wie von fern ein Modetrend spiegelt, so dass später vielleicht das ein oder andere Foto zeitlich genauer zuzuordnen ist: Damals lebte Martha noch und war unentschieden, ob sie nun ins Wochenendhaus wollte oder nicht. Natürlich waren noch Sachen zusammenzupacken, nur warum hatte sie es mit dem Verkauf plötzlich so eilig? Vielleicht wollte sie nicht immer wieder an ihren ersten Mann erinnert werden. Nach dessen Tod vor zwei Jahren hatte sie die Drogerie zu schnell verkauft, allerdings zu lange gezögert, sich auch vom Wochenendhaus zu trennen. Durch die Geschäftsauflösung waren sich Martha und Alfred, der bei ihrem Mann als Ausfahrer gearbeitet hatte, nähergekommen, um schließlich vor einem halben Jahr zu heiraten.
Jetzt ist es kurz vor drei. Das Wetter tritt für einen Moment farblos in den Hintergrund. Die Kneipe ist für die Uhrzeit relativ voll. Roswitha und Alfred gehen nach nebenan in den Billardraum und ziehen den braunen Filzvorhang mit dem Sichtfenster aus Plastik hinter sich zu. Roswitha tanzt zwischen den hochgestellten Stühlen und dem Billardtisch und den aus Bequemlichkeit hängen gelassenen bunten Papiergirlanden vom Fasching zu einem Song von Neil Diamond, nachdem Alfred ihr Geld für die Musikbox gegeben hat. Sie lebt mit ihren Eltern, der Vater Frührentner, in einer engen Wohnung ohne Telefon am Ostbahnhof. Vom Hausflur betritt man gleich die Wohnküche, von der eine Tür zu Roswithas Zimmer abgeht. Will man Roswitha erreichen, ruft man einen Stock tiefer Herrn Heine an, der seinen elfjährigen Sohn nach oben schickt, um Roswitha an den Apparat zu holen. Was man in einem Wochenendhaus macht, kann Roswitha sich nicht vorstellen. »Sie hat da noch Sachen von ihrem ersten Mann«, sagt Alfred, der seine Frau nur selten dorthin begleitet.
Das Wochenendhaus ist von Rosen umrankt. Die Eltern von Marthas erstem Mann haben es sich 1911 bauen lassen. Martha betrachtet ein gerahmtes Foto ihres Mannes und legt es in einen Koffer. Es ist Abend geworden. Ihr Rücken schmerzt. Sie trägt ein kariertes Kostüm. Zusammenhangslos fällt ihr das Jahr 1933 ein, Alfreds Geburtsjahr, als sie so alt war wie Roswitha jetzt, neunzehn, und aus Berlin nach Paris fliehen musste, wo sie mit ihrer Schwester Johanna als Les Soeurs Viennoises auftrat, um sich über Wasser zu halten. Anschließend gingen die beiden nach London und 1945 in die USA, wo Johanna blieb, während Martha 1954 nach Deutschland zurückkehrte und dort wenig später den Drogisten heiratete, genau genommen bereits ihr zweiter Mann, denn sie war schon in den USA verheiratet, hatte sich jedoch scheiden lassen, nachdem sie erfahren musste, dass ihr Mann sie betrog, als sich seine Geliebte mit Schlaftabletten in der gemeinschaftlichen Wohnung das Leben nahm. Diese Ehe aber hatte Martha bei ihrer Rückkehr nach Deutschland nicht nur den Behörden, sondern auch ihrem zukünftigen Ehemann verschwiegen.
Als Alfred an diesem Abend im Wochenendhaus erscheint, weiß Martha mit einem Blick, was er vorhat, denn er hat die Handschuhe nicht wie üblich beim Aussteigen aus dem Auto abgestreift, sondern angelassen. Sie reagiert, wie sie in ihrem Leben in scheinbar ausweglosen Situationen immer reagiert hat, mit einem unbewussten Trotz, denn sie scheut den Tod nicht so sehr wie den Verlust des eigenen Willens. Ohne dass Albert etwas gesagt hätte, geht sie auf ihn zu und ohrfeigt ihn zweimal. Dann befiehlt sie ihm: »Mach das Licht aus im Schlafzimmer!«, und: »Nimm den Koffer!«, und: »Geh mir voraus!« Auf dem Weg zum Auto dann: »Weiter!«, und: »Du fährst!« Alfred schweigt zu alldem und fragt erst im Wagen beinahe schüchtern: »Wohin fahren wir? Nach Hause?« Martha lacht auf. »Nach Hause? Du hast kein Zuhause mehr. Wir fahren zur Polizei.«