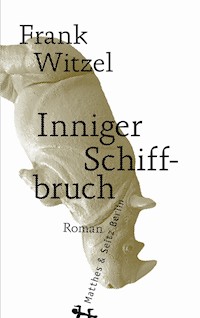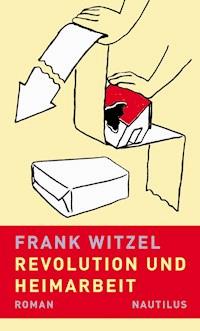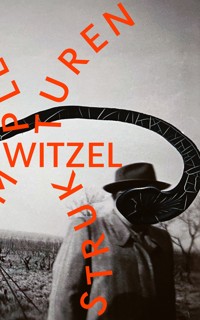Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Nautilus
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Frank Witzels rasanter Roman erzählt aus dem Leben ganz unterschiedlicher Menschen während eines langen Wochenendes; wie es war, wie es ist, wie es hätte sein können: die Geschichte des Gymnasiallehrers Hugo Rhäs oder der Professorin für Gender Studies Sabine Rikke; die der alternden Schlagersänger Tamara Tajenka und Bodo Silber; des Gratful-Dead-Fans Abbie Kofflager oder des Psychiaters Rubinblad und anderer in Deutschland, den USA und Kenia. Begegnen sie sich zufällig oder ist doch alles vom CIA arrangiert? Sind Paranoia und "Lethephobie" gerechtfertigt, wird Wirklichkeit konstruiert oder suggeriert? Ein ebenso intelligenter wie satirisch-komischer Roman, der den Leser den Boden unter den Füßen verlieren läßt. Frank Witzel ist der Gewinner des Deutschen Buchpreises 2015 mit dem Titel "Die Erfindung der Roten Armee Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 462
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edition Nautilus Verlag Lutz Schulenburg
Schützenstraße 49 a · D-22761 Hamburg
www.edition-nautilus.de
Alle Rechte Vorbehalten · © Edition Nautilus 2001
Umschlaggestaltung: Maja Bechert, Hamburg
1. Printauflage 2001 ·
ePub ISBN 978-3-86438-190-4
Like a Rolling Stone. Like the F.B.I. And the C.I.A. And the B.B.C. B.B.King. And Doris Day. Matt Busby. Dig it. Dig it. Dig it. Dig it.
The Beatles
Erster Teil
Do I understand the question, man, is it hopeless and forlorn?
Bob Dylan
1
Siebzehn Jahre Deutschunterricht im staatlichen Dienst haben Hugo Rhäs nicht gut getan.
Am Freitag dem 9. Juli gegen halb sechs biegt er mit seinem alten Buckelvolvo von der Erich-Ollenhauer-Straße in den kleinen namenlosen Pfad neben der Papierfabrik Achenkerber ab. Schon seit Tagen ist es unerträglich heiß. Wie soll das erst im August werden? Er versucht, den Schlaglöchern auszuweichen. Auf der Rückbank werden Lehrbücher, Ordner und Manuskripte durcheinandergeworfen. Aus einer abgegriffenen Ledertasche rutschen Disketten. John Malkovich, der aus dem übersteuert aufgedrehten Kassettenrekorder auf dem Beifahrersitz Auszüge aus Naked Lunch liest, klingt stellenweise wie unter Helium. Für Hugo Rhäs ist Burroughs Höhe- und Endpunkt der Literatur des zwanzigsten Jahrhunderts. Wenn nicht sogar der Literatur überhaupt.
In knapp drei Jahren wird Hugo Rhäs fünfzig. Da hatte Burroughs schon seine Frau unter die Erde gebracht und war wieder aus Tanger zurück. Nicht, daß es hier auf dem stillgelegten Fabrikgelände gänzlich harmlos zuging. Anders eben. Einsamer. Manchmal huschten nachts finstere Schatten über das Grundstück, aber wenn er das Schlafzimmerfenster geräuschvoll öffnete und sich in die Nachtluft hinaus räusperte, schienen die auch schnell wieder verschwunden. Ab und zu wurden in einer der leeren Werkshallen ein paar Scheiben eingeworfen. Hugo Rhäs hatte mit der Wachgesellschaft telefoniert und erfahren, daß deren Vertrag noch zwei Jahre lief. So lange wie seine Schonfrist in dem ehemaligen Hausmeisterhäuschen. Nach dem Anruf sah er nachts hin und wieder einen Mann in schwarzem Leder über das Gelände schlendern und ihm, während er hinter den Gardinen am Fenster stand, mit der Taschenlampe in einer Art Geheimzeichen zublinken.
Burroughs hätte bestimmt näheren Kontakt zu dem Wachmann gesucht, ihn hereingebeten auf einen Kaffee, besser einen Whiskey, später dann zu noch härteren Drogen und noch später hätten sie mit großkalibrigen Gewehren herumgefeuert, selbst ein paar Scheiben zertrümmert oder sogar einen kleinen Brand gelegt. Warum auch nicht? Manchmal muß man dem dumpf ablaufenden Schicksal eben zuvorkommen.
Für andere mochte der Schuldienst Erfüllung genug sein. Die würden erst was merken, wenn sie mit Frau und Kindern auf dem Sonntagsausflug an den noch frisch dampfenden Trümmern der alten Papierfabrik vorbeikommen und das rotglühende Signet seiner verzweifelten Wut erkennen würden. Nachdem nun schon sein theoretisches Werk durch fremde Hand in Flammen aufgegangen war, warum nicht das Ganze zu Ende denken und mit Hilfe einiger Benzinkanister auch selbst bewerkstelligen?
„Sag mal, hat da nicht dieser komische Kollege von dir gewohnt?“
„Ja, ich überleg auch grade. Hoffentlich ist da nichts weiter passiert. Ich hab nämlich nicht die geringste Lust, am Montag seine Stunden zu übernehmen.“
Stunden! Viel weiter reichte deren Horizont wirklich nicht. Höchstens noch bis zu den Pausen zwischen den Stunden. Aber daß es eine geistige Verfassung gibt, einen Zustand, der völlig Besitz von einem ergreift und noch nicht mal mehr die kleine Pause um neun, geschweige denn die große um viertel vor zehn, zuläßt, davon hatten diese Beamtenseelen natürlich nicht die geringste Ahnung.
Es sind diese sich regelmäßig Freitagabend einstellenden Gewaltphantasien, die Hugo Rhäs so erschöpfen, daß er am nächsten Tag erst am frühen Nachmittag mit ausgetrocknetem Mund aus einem schweren Schlaf erwacht. Das fröhliche Samstageinkaufslicht fällt beunruhigend durch die Ritzen der Läden. Allein der Gedanke, daß es unten im Wohnzimmer schon lange hell ist und seine Kollegen sich gerade nach einem kleinen Bummel durch das Menschengewühl der Innenstadt auf Eiscaféterrassen breit machen, läßt die kurz vergessene Wut wieder in einem stechenden Schmerz auflodern.
Mit sieben durfte er einmal das ganze Wochenende nicht raus, weil seine Mutter auf den blöden Reporter wartete. Er war auf dem Linoleumboden in der Küche immer im Kreis gerannt und hatte das Heulen einer Sirene nachgemacht. Jetzt rasen die Krankenwagen mit amerikanisiertem Signalhornklang an seinem Häuschen vorbei zu mediokren Auffahrunfällen. Neben ihm auf dem Nachttisch, hinter den Burroughsbänden in Schlangenlederimitat, tickt der beige Wecker wie eine dilettantisch selbst zusammengebastelte Zeitbombe. Burroughs lebte die letzten zwanzig Jahre in einem umgebauten Keller. Genies sind wie zarte Aquarelle: sie scheuen das Licht.
2
Die Julisonne ist in den Vereinigten Staaten von Amerika greller und fast beißend. Am Nachmittag desselben 9. Juli bescheint sie um sieben Stunden zeitversetzt das etwa vier Kilometer weit abgesperrte Stück einer Landstraße parallel zur Bundesstraße 52 im Bundesstaat Wisconsin, etwas nördlich eines Ortes mit Namen Polar. Die Hitze macht dort vor allem den Beamten gewisser Geheimdienststellen zu schaffen, die eine Arbeit außerhalb klimatisierter Räume oder gleichermaßen klimatisierter Dienstwagen nicht gewohnt sind.
Der Asphaltbelag scheint zu schmelzen. Durch das Flimmern hindurch erkennt man in ungefähr sechshundert Meter Entfernung eine Farm. In dieser Farm halten sich religiöse Fanatiker auf. Erste Schätzungen gehen von mindestens 25 Sektenmitgliedern aus. Der harte Kern der Vereinigung. Nicht gerechnet die unschuldigen Opfer, darunter auch Kinder, die diese fehlgeleiteten und zum Äußersten bereiten Wahnsinnigen in ihrer Gewalt haben. Man vermutet, daß diese mindestens noch einmal soviel zählen.
Die Aufklärungshubschrauber kreisen über dem beinah fünf Hektar großen Grundstück. In einem gebührenden Sicherheitsabstand haben die Fernsehstationen Zelte aufgebaut und ihre Übertragungswagen abgestellt. Regelmäßig versuchen Schaulustige, in die Nähe des Gebietes zu gelangen. Manchmal kommt es zu vereinzelten Zwischenfällen. So zum Beispiel als ein mit vier Schülern besetztes Auto eine der Straßenabsperrungen durchbricht, sich dabei überschlägt und gegen einen Baum prallt. Die Einsatzkräfte befreien die stark angetrunkenen Jugendlichen, die wie durch ein Wunder mit ein paar Schürfwunden und dem Schrecken davongekommen sind, und übergeben sie den Eltern. Dann kehrt auf dem abgesperrten Abschnitt wieder der Alltag des Wartens ein.
3
In einer Stadt in Mittelhessen steht eine 43 Jahre alte Professorin für Frauenstudien fertig zum Ausgehen und mit dem Schlüssel in der Hand vor dem laufenden Fernsehgerät. Sie will zu einer Vernissage in die Grundwiesenstraße. In einem ehemaligen Buchladen, der jetzt einem Schmuckmacherkollektiv gehört, wird Perlenschmuck gezeigt. Es gibt Borschtsch zu essen und italienischen Landwein zu trinken. Die Broschen liegen in mit Sand gefüllten Blecheimern und werden mit kleinen Strahlern angeleuchtet. Die Ringe hängen an langen Zimmermannsnägeln, die man in die unverputzt belassenen Dachbalken geschlagen hat, und die Ketten sind um Stamm und Ast einer großen Yukka geflochten.
Der Lebenspartner der Professorin für Frauenstudien, ein zur Zeit arbeitsloser Spieleerfinder aus Graubünden, ist freitagabends regelmäßig zum Schach verabredet und deshalb schon aus dem Haus.
Die Professorin ist gerade noch von dem Beitrag des politischen Magazins eines öffentlich-rechtlichen Senders fasziniert. Nicht weit entfernt von Polar im Bundesstaat Wisconsin wird zur Stunde ein ohne Knochen geborener Siebzehnjähriger in einen Schacht gelassen, um mit Hilfe einer an seinem Kopf befestigten hochsensiblen Infrarotkamera, die ihre Bilder wahlweise in Bombenangriffsgrün oder Nachtüberwachungsblau liefert, herauszufinden, ob es über die Kanalisation einen Zugang zu dem Hauptquartier einer gefährlichen Sekte geben kann. Die Sekte nennt sich, so erfährt man nicht nur durch die Sprecherin, sondern auch auf einer vorbereiteten Tafel übersetzt „Die nackten Zeugen von Armagehdon“ (The bare witnesses of Armagehdon). Professorin Rikke lacht auf, denn man hat in der Fernsehredaktion das Wort „Armageddon“ falsch geschrieben.
In der Eile der sich überstürzenden Ereignisse läßt sich nicht jedes Detail recherchieren. So beantwortet das grobgerastert eingeblendete Foto von Douglas Douglas Jr., dem jungen Mann ohne Knochen, auch nur sehr unzureichend die Frage, was „ohne Knochen“ genau bedeutet. Eine Art Schädel scheint er jedenfalls zu besitzen, auch wenn er vielleicht etwas schmal erscheinen mag. Professorin Rikke schaltet auf Teletext. Um zehn soll in einer Sondersendung ausführlich über Douglas Douglas Jr. und die Hintergründe der Geiselnahme berichtet werden. Vielleicht ist sie bis dahin zurück.
Sie schaltet den Fernseher aus und verläßt das Haus. An der immer noch heißen Luft, die in den Straßen steht und sich sofort auf ihre Kopfhaut legt, wird sie daran erinnert, daß sie sich die Haare zu kleinen Stacheln zusammengegelt hatte. Im Fenster des Penny-Marktes vergewissert sie sich, daß die Spitzen noch einigermaßen gleichmäßig von ihrem Kopf abstehen. In der japanischen Mythologie gibt es ein Kind ohne Knochen, das von seinen Eltern, wie so viele Helden, gleich nach der Geburt ausgesetzt wird. Fast ein Ereignis von mythologischem Gehalt, das sich dort in Amerika abspielt, denkt sie, während sie durch den Fußgängertunnel unter der Eisenbahnlinie geht.
Als sie den Schmuckladen betritt, ist gerade die neue Lebensgefährtin des grünen Außenministers im Mittelpunkt des Interesses. Professorin Rikke dreht sich einmal unauffällig im Kreis, um zu sehen, ob der Außenminister selbst auch anwesend ist. Sie kennt ihn noch aus der Zeit, als er das alternative Kino der Stadt in einem Kollektiv organisierte. Eigentlich müßte er schon an den in seiner Nähe herumstehenden Bodyguards zu erkennen sein. Aber wer einmal neben Madeleine Albright im Palais Schaumburg Hammelnüßchen Braganza zu sich genommen hat, wird wohl kaum nach Feierabend in der Mittelseestraße im Stehen einen Teller Borschtsch löffeln.
Professorin Rikke kennt die Lebensgefährtin bisher nur aus der Zeitung. Sie ist knapp über dreißig und war Volontärin beim Fernsehen. Es heißt, sie sei schwanger. Obwohl sich die beiden erst seit einem Vierteljahr kennen. Anders hat sie ihn wohl nicht binden können. Ein Lachen geht durch den Kreis, der die Lebensgefährtin umringt. Sie hält sich gerade zwei lange, fast unsichtbare Schnüre an die Ohrläppchen, um zu sehen, wie ihr dieses Ensemble steht. Ungefähr in Höhe ihres Busens schweben zwei glitzernde Perlen als symbolische Brustwarzen über ihrem bauchfreien Oberteil. Es wird genickt. Besonders von den Vertretern des Schmuckkollektivs. Aber sie plaziert das Ohrgehänge wieder zurück an den Stahlnagel, von dem sie es heruntergenommen hat, und bückt sich über einen der Blecheimer, wobei sie ihren prallen Hintern in den Schein eines Spots schiebt.
Professorin Rikke dreht sich um. Ein befreundeter Künstler aus dem städtischen Kunstverein betritt gerade mit einem nach frischer Ölfarbe riechenden und in eine alte Decke eingeschlagenen Rechteck unter dem Arm den Laden. Vielleicht würde sie mit ihm über die mythologischen Implikationen dieses Falls in Wisconsin reden können.
4
Man kann den Beruf des Wachmanns durchaus als eine Art Vertrauensstellung bezeichnen. Es reicht bei weitem nicht aus, in eine schwarze Kluft gehüllt Präsenz zu zeigen. Oft gerät man in Situationen, in denen innerhalb von wenigen Sekunden lebenswichtige Entscheidungen zu treffen sind. So hatte Kalle an einem Montagvormittag vor gut einem Vierteljahr zu entscheiden, ob das nur angelehnte Küchenfenster des ehemaligen Hausmeisterhäuschens auf dem Gelände der stillgelegten Papierfabrik Achenkerber keine besondere Auffälligkeit darstellte und so verbleiben konnte, oder ob er es zu sichern hatte.
Daß Kalle, ein untersetzter Mann Anfang fünfzig, der den Kampf mit seiner Alkoholkrankheit noch nicht ganz gewonnen hatte, bei der Firma für Sicherheitskonzepte Allwell zu der Zeit noch seine vierzehntägige Probezeit ableistete, erleichterte ihm die Entscheidung nicht. Auch die Tatsache, daß er außerhalb seiner eingeteilten Dienstzeit, die gewöhnlich in den Nachtstunden lag, auf dem Gelände erschienen war, war ihm keine besondere Hilfe.
Von dem Ausbildungswochenende in Dickschied hatte Kalle den Merksatz behalten „nach Möglichkeit zusätzliche Informationen einholen“. Auf ein mehrfaches Schellen an der Tür, gefolgt von einem resoluten Klopfen, hatte jedoch niemand reagiert. Da von außen nichts weiter zu sehen war, nahm er seinen Schlagstock, stieß das angelehnte Fenster noch ein Stück weiter auf, um sich mit einiger Mühe, begleitet vom angenehmen Knirschen seiner neuen schwarzen Dienstlederjacke, ins Innere zu zwängen. Zwei Tassen gingen zu Bruch. Ein Verlust, den man bei einer solchen Aktion in Kauf nehmen mußte.
Nach dieser körperlichen Anstrengung wurde der Wachbeamte von einem fürchterlichen Durstgefühl überfallen. Er ging zum Kühlschrank, entdeckte dort aber nur eine angefangene Flasche Fruchtsaft, Milch und ein Stück Käse. Auch sonst war in der Küche außer einem Kasten Mineralwasser nichts Trinkbares zu sehen.
Im ganzen übrigen Haus waren die Läden geschlossen, was Kalles malträtierten Augen gut tat. Er nahm seine Stablampe vom Gürtel, ging in das neben der Küche liegende Wohnzimmer und suchte den Raum mit dem Lichtkegel ab. Eine alte Couch, ein Tisch, zwei Stühle und überall Bücher: in Regalen an den Wänden, in Stapeln auf dem Boden, noch unausgepackt in Umzugskartons und quer verstreut auf allen Sitzgelegenheiten. Von einer Hausbar war nichts zu sehen.
Kalle leuchtete sich den Weg in den Flur und stieg dort die kleine knarrende Treppe hoch ins oberste Stockwerk. Die Zunge klebte ihm am Gaumen. Er kannte alle Verstecke und würde sie auch finden. Als erstes ging er ins Schlafzimmer, öffnete den Kleiderschrank und schaute hinter Hemden und Handtüchern nach. Nichts. Dann durchsuchte er den Nachttischschrank. Noch nicht mal ein Flachmann. Er schraubte die Thermosflasche auf, die neben dem ungemachten Bett stand und roch daran. Kaffee. Vielleicht mit einem Schuß Rum? Er kostete vorsichtig. Von wegen. Schwarz und ohne Zucker.
Kalle ging ins Bad. Rasierwasser ohne Parfum und Alkohol. Komischer Heiliger. Es blieb noch ein Zimmer übrig. Irgendwo mußte er das Zeug doch haben. Um die Spannung für sich noch etwas zu erhöhen, vernachlässigte er bewußt alle Regeln der Eigensicherung, schloß die Augen, stieß die Tür des letzten Zimmers mit dem Fuß auf und trat wie zu einer Bescherung ein.
Ein langer Schreibtisch stand vor dem Fenster, davor ein Stuhl, daneben ein schmales Regal, an den Wänden mit Notizen übersäte Pinnwände, und überall im Zimmer Zettel und Papiere. Zettel und Papiere. Kalle versetzte einem kleinen Stapel auf dem Boden unwillkürlich einen Stoß mit dem Fuß.
Das mußte ein Schwachsinniger sein, der hier wohnte. Der hätte die Haustür auch gleich ganz auflassen können. So einen Krempel wollte doch niemand geschenkt. Andererseits: warum wurden noch regelmäßig Runden hier gedreht, wenn es nichts zu schützen gab? Kalle wußte natürlich nicht, daß die Firma für Sicherheitskonzepte Allwell ihre monatlichen Überweisungen eher versehentlich durch einen Konkursverwalter erhielt und sich schon deshalb, besonders aber nach dem Anruf von Hugo Rhäs, verpflichtet fühlte, ab und zu jemanden bei der Fabrik vorbeizuschicken. Außerdem eignete sich das Grundstück vortrefflich zur Erprobung neuer Kräfte. Es konnte kein Schaden angerichtet werden, während man mit Hilfe zweier noch funktionierender Überwachungskameras am Hauptgebäude sehen konnte, wie sich die Aspiranten in dem von ihnen angestrebten Job anstellten. Auch davon hatte Kalle nicht die geringste Ahnung. Und weil er weder das eine noch das andere wußte, zählte er zwei und zwei zusammen und schloß, daß es sich bei den vielen mit Formeln bedeckten Blättern und Notizen um eine wissenschaftliche Erfindung von höchster Geheimhaltungsstufe handeln mußte.
Erfinder waren verrückt und lebten ohne einen Tropfen in den unmöglichsten Verstecken. Sie mußten sich vor der Bedrohung durch alle möglichen Staaten schützen und untertauchen, um ungestört arbeiten zu können. Kalle fing einer inneren Eingebung folgend an, die Papiere zusammenzuräumen. Dann rannte er hinunter ins Wohnzimmer, leerte einen mittelgroßen Bücherkarton aus und füllte ihn mit den gesammelten Notizen von Hugo Rhäs.
5
Der spektakuläre Auftritt des knochenlosen Douglas Douglas Jr. im amerikanischen Fernsehen rief innerhalb kürzester Zeit alle möglichen Randexistenzen des nationalen Showgeschäfts auf den Plan. Schlangenmenschen und Torsionisten, Liliputaner und Spinnengestalten, kurzum alles, was bequem in eine Kanalöffnung paßte, traf in buntbemalten Bussen und Wohnwagen in Polar ein. Sie wurden dort von Hilfskräften der Bundespolizei in Empfang genommen und auf der Bundesstraße 64 in Richtung Langlade in ein fünfzehn Meilen entferntes Camp gebracht, das schon nach wenigen Tagen aussah wie die Müllhalde sämtlicher André-Heller-Projekte.
Die Lage war heikel. In einem Land, in dem man dazu übergegangen war, einen kurzen Menschen als „vertikal herausgefordert“ und etwas Langweiliges als „reizfrei“ zu bezeichnen, konnte man die freiwilligen Hilfsangebote einer ganzen Bevölkerungsgruppe nicht einfach ablehnen, ohne dabei Gefahr zu laufen, bekannte, registrierte und organisierte sowie bislang noch unbekannte Minderheiten zu diskriminieren.
Ganze vom Aussterben bedrohte Berufszweige witterten ihre letzte Chance. Wenn in immer mehr Staaten, um ein Beispiel zu nennen, das Zwergenwerfen verboten wurde, so konnte doch niemand etwas dagegen haben, daß man einen Zwerg in Richtung einer Kanalöffnung warf, damit dieser dort den Zugang zu der Farm einer gefährlichen Sekte erforschen konnte. Ein Mann, der sich trotz seiner Einszweiundneunzig so zusammenzufalten verstand, daß er bequem in der Verpackung eines Videorecorders Platz fand, und zwar zwischen den Styroporeinsätzen, schlug vor, ihn als Päckchen getarnt auf der Veranda der Ranch abzulegen. Ein zweiter Houdini wollte sich in Eisenketten legen lassen, mit dem Argument, daß ihn die Sektenmitglieder als ungefährlich genug erachten würde, um ihn ins Haus zu holen.
Man hatte ein Komitee eingerichtet, daß sich auf dem Platz geduldig alle Vorführungen und Kunststückchen ansah, um die Artisten anschließend mit dem Versprechen, sie umgehend zu verständigen, wenn man sie brauchte, wieder nach Hause zu schicken. Obwohl man in abwechselnden Schichten und rund um die Uhr arbeitete, wurde man des Ansturms nicht Herr. Im Gegenteil: ein gesellschaftliches Problem drohte aufzubrechen. Die durch die Verbreitung des Fernsehens verdrängten Varieté- und Zirkuskünstler klammerten sich mit dem selbstlosen Einsatz ihres geschulten Körpers an ihre vielleicht letzte Möglichkeit, noch einmal im Rampenlicht zu stehen.
In ihrem Schlepptau kam eine Reihe von Menschen, bei denen der gute Wille das künstlerische Vermögen übertraf. Ein Mann, der einen Ventilator mit der Zunge anhielt. Eine Frau, die ihren Büstenhalter unter ihrer Bluse ausziehen konnte. Ein Junge, der die Einzelteile eines ganzen Fahrrads aufaß. Ein anderer Junge, der aus einer Handvoll in die Luft geworfener M&Ms ein rotes mit der Zunge auffing. Eine Frau, die ihre Augäpfel erschreckend weit aus den Höhlen holte. Ein Mann, der Zigarettenqualm aus den Ohren blies.
Da das Komitee in seinen Ablehnungen zu vorsichtig war, wurden die Kriterien immer verschwommener und lockten immer mehr Menschen an. Männer, die verschiedene Biersorten am Geschmack erkannten. Frauen, die alle Songs der Three Degrees, auf Wunsch auch rückwärts, vorsingen konnten. Generell Personen, die gerne auf Jahrmärkten herumlungerten.
Das Camp platzte aus allen Nähten. Mehr noch, es erdrückte Ranton, den kleinen Ort, der sich anfänglich noch an den leergekauften Supermärkten und kahlgefressenen Imbissen erfreut hatte. Das hier war eine Mischung aus Woodstock und Zirkus Barnum, nur mit mehr Stars als Zuschauern. Das heißt, Zuschauer gab es, die sechs ehrenamtlichen Herren des Prüfungskomitees einmal ausgenommen, so gut wie keine mehr. Und wie in Woodstock drohte auch hier ein ordentlicher Platzregen die ganze Veranstaltung in eine Katastrophe zu treiben und den unbefestigten Platz zu unterspülen.
Da die Bürger von Ranton nicht ahnten, daß man die herannahende Gewitterfront nur erfunden hatte, um die Stars endlich aus der Manege zu bekommen, verlangten sie ein schnelles und resolutes Eingreifen der Regierung.
Die Überlegungen der Bundesbehörde, ein Sperrgebiet zu errichten, kamen nicht weiter, da sie sich gleichzeitig noch mit dem Anlaß dieses ganzen Treibens, der Farm mit den Sektenmitgliedern, zu beschäftigen hatte. Und schon in der Nähe von Polar hatte man eine zeitweilige Sperrung von Landstraßen und Zugangswegen nur mit Not und Gerichtsbeschlüssen erwirken können.
Unterstützt durch entsprechende Vorhersagen, verdunkelte sich der Himmel für die Bürger von Ranton tatsächlich. Die Dorfbewohner griffen nach Jahr und Tag wieder zu Mistgabel und Fackel und zogen mit Teereimern und Federn in Richtung Camp. Das, was man gerade hatte verhindern wollen, die Diskriminierung von Minderheiten, schien sich hier vor den Augen der Weltöffentlichkeit in einem ungeheuren Fanal entladen zu wollen. Wie sollte man das zum Beispiel dem deutschen Außenminister oder anderen sensibilisierten Organen der Weltöffentlichkeit erklären?
Die sechs Ehrenamtlichen bemerkten das Anschwellen von Menschenstimmen vor ihrem Zelt. Dazwischen das Heulen von Motoren. Der Boden wurde von herumfahrenden Wagen erschüttert. Sollten die Künstler endlich ein Einsehen bekommen haben und weiterziehen? Sie bedankten sich bei dem Bauchredner, dessen Nummer sie gerade begutachtet hatten und traten nach draußen. Die Zirkusleute hatten ihre Wohnwagen und Transporter vor den offenen Eingang des umzäunten und mit Sträuchern umwachsenen Platzes gefahren. Hinter den Wagen, auf der Straße zum Dorf, waren unter lodernden Fackeln in der Abenddämmerung die weit aufgerissenen Münder der schreienden Dorfbewohner zu sehen. Es war ein gräßliches Bild. Einer der Ehrenamtlichen lief in das Zelt zurück und versuchte zu telefonieren. Doch die Verbindung war unterbrochen. Eine erste über die Autobarrikade geschleuderte Fackel wurde von einem Feuerschlucker geschickt aufgefangen und gelöscht. Ein zweites und drittes der flammenden Geschosse nahm ein Jongleur auf. Trotzdem würde das nicht lange gut gehen. Plötzlich gab es einen Moment der Stille. Die aufgebrachten Bewohner von Ranton schauten zum Himmel, weil sie die befürchtete Sintflut erwarteten. Doch stattdessen hörte man ein dumpfes Grollen, das aus den Schreien von Raubvögeln und dem Brüllen von Löwen und Tigern zu bestehen schien.
Die Tiere waren angekommen.
6
Glücklicherweise besaß die Hebamme so kurz nach dem Krieg schon ein Auto. Sie nahm das frisch entbundene Kind, wickelte es in eine Decke, zeigte der Mutter nur kurz den blutverschmierten Kopf und lief die Treppe hinunter zu ihrem Renault, um ins nächste Krankenhaus zu fahren. Der Vater rief ihr in seinem gebrochenen Deutsch nach, ob etwas mit dem Baby nicht stimme, doch sie sagte nur, er solle sich um seine Frau kümmern, sie habe jetzt keine Zeit.
Die Ärzte im Krankenhaus standen vor einem Rätsel. Sie untersuchten das Kind mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln, konnten aber nur feststellen, daß etwas mit dem Skelett nicht stimmte. Wenn da überhaupt ein Skelett vorhanden war. Da der Vater des Kindes Soldat der amerikanischen Besatzungsmacht war, empfahlen sie der Hebamme, das Kind ins Armeehospital zu bringen.
Tatsächlich war den amerikanischen Ärzten das Phänomen der knochenlosen Geburt vertrauter als ihren deutschen Kollegen, auch wenn es bis dahin in den Vereinigten Staaten nicht mehr als ein Dutzend dokumentierter Fälle gegeben hatte. Das Problem war nur, daß man hier noch weniger als in den Staaten auf einen etwaigen Fall vorbereitet war. Das Neugeborene bekam über den Tropf eine Infusion mit Kieselsäure und Kalzium, wurde in ein Wärmebettchen gelegt und mit einem Trockenmilchpräparat gefüttert, das mit Folsäure versetzt war. Damit waren die Mittel, die man zu dieser Zeit besaß, ausgeschöpft.
Auf diese Art und Weise wurde es ein knappes dreiviertel Jahr am Leben erhalten. Es befand sich in einer winzigen Kammer, die nur Ärzte und Pfleger betreten durften. Sonst niemand. Auch Vater und Mutter nicht. Nicht nur wegen des ungewohnten Anblicks, der einen Laien schnell hätte verwirren können, sondern auch und besonders aus hygienischen Gründen. Dann starb das Kind.
An einem Donnerstagnachmittag bestellte man Frau Howardt und ihren Mann in das Hospital. Sie mußten in einem gekachelten Flur auf einer braunlackierten Bank auf die Ärzte warten. Frau Howardt kannte diesen Flur. Hier hatte sie kurz vor Kriegsende schon einmal gesessen, um sich innerhalb einer großangelegten Untersuchung im mittelhessischen Raum ihre Gebärfähigkeit bestätigen zu lassen.
Damals war sie von einem Arzt in SS-Uniform in einen ebenfalls gekachelten Raum geführt worden, wo er ihren Beckenumfang und ihre Schenkelbreite maß. Er nahm noch andere Daten auf, zum Beispiel die Länge vom Nabel bis zum Ansatz der Schambehaarung, und den Winkel, in dem sie ihre Beine zu spreizen in der Lage war. Dann durfte sie sich wieder anziehen. Fast zwei Stunden mußte sie anschließend auf dem Gang warten. Schließlich wurde ihr die Mitteilung gemacht, daß ihre Gebärfähigkeit über dem geforderten Mindestmaß liege und sie folglich den Vorzug besäße, an einer weiteren Untersuchungsreihe teilzunehmen.
Nun stand sie, keine drei Jahre später, vor einem Spalier weißbekittelter Armeeärzte, die ihrem Mann etwas auf Englisch sagten und ihr mit bedauerndem Gesichtsausdruck die Hand drückten. Als sie es übersetzt haben wollte, schüttelte ihr Mann nur den Kopf. Ob sie nicht jetzt wenigstens das Kind einmal sehen durfte? Ihr Mann sagte, es sei besser, wenn er zuerst hineinging. Die zehn Minuten, die sie allein auf dem Flur warten mußte, waren fast unerträglich. Irgendetwas veränderte sich, und sie konnte es nicht aufhalten. Als ihr Mann aus dem Zimmer kam, war sein Gesicht flach und konturlos. Er sagte, sie solle den Kleinen so in Erinnerung behalten, wie sie ihn kurz nach der Geburt gesehen hatte. Sie konnte sich an kein genaues Bild erinnern, gab aber trotzdem nach.
An diesem Abend sprachen die beiden kein Wort. Auch am nächsten Abend redeten sie nicht. Sie saßen sich nur in der engen Küche gegenüber und hörten auf ein entferntes Schaben im Kamin. Am übernächsten Abend zog Samuel Howardt seine Uniform an und verließ die Wohnung. Seine Frau hörte nun allein auf das Schaben. Drei Tage. Dann kam ihr Mann zurück. Betrunken. Er sagte nichts. Nur sein Atem ging laut und unregelmäßig.
7
Mit sechsundzwanzig hatte Hugo Rhäs Heinrich Böll die Hand gegeben. Er hatte Danke zu ihm gesagt. Ein paar Jahre später schämte er sich für dieses Danke. Zeitweise fand er sogar, daß dieses Danke seinen schwachen Charakter und seine Unfähigkeit zu schreiben in einem Wort zusammenfaßte. Eine jener packenden Metaphern, um die er sich in seinen eigenen Texten immer wieder vergeblich bemühte.
Fast jahrzehntelang hatte ihn dieses Danke davon abgehalten, seinen Brief an Burroughs abzuschicken. Solange, bis dieser schließlich gestorben war. Im nachhinein war ihm auch das recht. Er hatte darin nämlich den Satz geschrieben: „I’ve been searching so long to find an answer.“ Und dieser Satz, so war ihm später eingefallen, war wörtlich aus einem Lied von Chicago entlehnt. Den späten Chicago, also denen jenseits der fünften LP, als sie langsam anfingen, sich in Süßlichkeit und Peter Cetera aufzulösen. Der Name Cetera wäre vielleicht noch einen Aphorismus wert gewesen, aber bestimmt nicht dieses Gesäusel. Terry Kath hatte sich erschossen. Rechtzeitig? Aber wie sollte sich denn die Kategorie des Todes auf das Leben anwenden lassen? War Kerouac zu früh gestorben? Oder Burroughs zu spät? Und was war mit Ginsberg? Werden wir nur im Tod unverwechselbar? Der eine im Bett bei seiner Mutter mit dem Kruzifix an der Wand, der andere in einem leergeräumten Keller. Und was bleibt vom Leben? Zwei Dosen mit einer nach eigenem Rezept hergestellten Suppe im Gefrierfach von Ginsbergs Kühlschrank. Die stehen jetzt auch in einem Museum. Das Vermächtnis eines Poeten.
Gab es denn nur diese beiden Extreme? Oder gab es selbst die nur in Rhäs’ Einbildung? Gab es dann vielleicht nur den Tod? War alles nur ein einziges Zurasen auf den Tod?
Wenn er die Augen schloß, konnte er in der Ferne, über den Platz der alten Papierfabrik hinweg das Rauschen der Autobahn hören. So waren seine Gedanken. So war das ganze Leben. Die Schüler, wie sie hinausströmten in den Pausenhof. Die Lehrer, wie sie hinausströmten auf den Lehrerparkplatz. Alles nur Metaphern für das eine Strömen. Alles strömt. Das heißt: alles stirbt. Vielleicht konnte Hugo Rhäs das Licht am Samstag nicht ertragen, weil es doch auch nur starb, und weil der Samstag sich doch auch nur in den tristen Sonntag auflöste und der dann wieder in die Woche. Und so immer weiter. Als wäre jeder Anfang gleichzeitig ein Ende. Bis wir irgendwann aufgeben, vom Wahn zerstört, hungrig, hysterisch, nackt.
8
Auch wenn Dietmar Kuhn eine manchmal recht langatmige und umständliche Art hatte, freute sich Professorin Rikke, ihn auf der Schmuckausstellung zu sehen. Er deponierte sein Bild unter dem Buffettisch, nahm sich ein Glas Wein und einen Teller Borschtsch, um ihr gleich darauf seine neusten Pläne mitzuteilen.
„Die von der Stadt sind Feuer und Flamme. Man muß denen die Idee eben nur richtig verkaufen. Und vor allem: sich gleich an die richtige Adresse wenden. Wir machen das nämlich nicht über das Kultur-, sondern über das Verkehrsamt.“
Professorin Rikke hatte schon mehrfach mit Dietmar zusammengearbeitet. Zum Beispiel bei der Wagenparade zur Sommersonnenwende auf dem Mainzer Lerchenberg. Ihre Studentinnen hatten bunte Sonnengefährte gebaut, mit denen sie den Lauf der Sonne als Kreisen um den weiblichen Zyklus symbolisierten. Und es war Dietmar, der die Idee hatte, das Ziel dieses Umzugs auf das ZDF-Gelände zu legen, so daß sie gleichzeitig in der Sendung Fernsehgarten, damals noch mit Ilona Christensen, auftreten konnten. Nachdem einer der Osmonds einen alten Hit zum Vollplayback nachgemimt hatte, waren sie winkend in das bunte Rund gezogen. Erst erklärte Dietmar mit ein paar geschickten Worten den künstlerischen Aspekt der Aktion, und dann bekam sie die einmalige Chance, ein Millionenpublikum an einem Sonntagvormittag über die Existenz des Fachbereichs Frauenstudien aufzuklären; auch wenn ihr die anschließende Überleitung etwas mißglückt erschien, da man zwei Zuschauerinnen auf die Bühne holte, die sich laut Anmoderation bereit erklärt hatten, bei einem Frisör und einer Visagistin „zu studieren, um das Beste aus ihrem Typ zu machen“. Dietmar hatte sie damals mit dem Hinweis auf einen gar nicht mehr auszurechnenden Multiplikator zu trösten versucht. Und tatsächlich war sie wenig später zu einem Symposium über die mythische Bedeutung des Ballspiels nach Worms eingeladen worden.
Dietmar tunkte ein Stück Weißbrot in seine Suppe. „Ich hab denen gesagt, ihr könnt doch nicht immer dasselbe machen zum Tag der offenen Tür. Da fährt die Feuerwehr vor, rollt Schlauch und Leiter aus und damit hat sich’s. Damit lockt man niemanden mehr hinterm Ofen vor. Der Stadtmanager ist da durchaus aufgeschlossen. Der merkt das auch. Es fehlen eben nur die Ideen. Also, hab ich gesagt, wir müssen zum Ursprung zurück und das ganze wörtlich nehmen.“ Er legte eine Kunstpause ein, wischte den letzten Rest Suppe aus seinem Teller, stellte den Teller hinter sich auf eine Vitrine mit Ringen aus unbehandeltem Baustahl und beugte sich fast verschwörerisch zu Professorin Rikke, die gerade versuchte, den Auftritt der Lebensgefährtin des Außenministers nicht ganz aus den Augen zu verlieren.
„Natürlich kostet das ’ne Kleinigkeit, aber dafür kriegen sie auch was geboten. Folgendes: Im Rathaus und allen anderen öffentlichen Stellen und Ämtern werden am Tag der offenen Tür die Türen ausgehängt. Aber das ist noch nicht alles. Wir sind uns noch nicht ganz einig, welche Lösung wir nehmen, aber entweder werden die Türen selbst verfremdet, also bemalt, beklebt und so weiter, oder es werden neue Türen entworfen, die statt der alten eingesetzt werden. Also eher Vorhänge aus Stoff, oder mit Bändern und Schnüren, da gibt’s ja alles mögliche. Du hast doch auch mal ein Seminar über Türen gemacht?“
„Ja, über das Fehlen der Tür bei den Sedang.“
„Stimmt. Vielleicht könnten wir da irgendwas koppeln. Das wird nämlich eine größere Sache. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wieviel Türen so ein Amt hat. Wirklich nicht auszumalen – im wahrsten Sinne des Wortes. Fünfzehntausend haben sie bislang sicher zugesagt. Über den Rest muß man noch mal reden. Vielleicht kann man das mit den ausländischen Gruppen koppeln und kriegt aus dem Topf noch was.“
Die Lebensgefährtin machte sich gerade zum Gehen auf und trug sich als letzte Amtshandlung umständlich und mit großem Gekicher in das Gästebuch ein.
„Was schreib ich denn nur?“ flötete sie.
„Am besten eine Bestellung“, rief jemand aus dem Hintergrund. Durch das darauffolgende Lachen wurde auch Dietmar Kuhns Aufmerksamkeit abgelenkt. „Ach, die ist auch da. Bist du so gut und paßt mal ’nen Moment auf mein Bild auf? Ja?“ Mit diesen Worten schlängelte er sich geschickt durch die Herumstehenden und sah der Lebensgefährtin über die Schulter, während sie auf das handgeschöpfte Bütten schrieb: „Ein schmuckvoller Abend – rundum gelungen. Euer Geschäft: eine versteckte Perle.“
9
Das Milieu im Bahnhofsviertel wußte mit der Radix-Theorie von Hugo Rhäs seltsamerweise nicht das Geringste anzufangen. Selbst die unter dem Namen „Professor“ bekannte Szenefigur, ein Mann jenseits der sechzig, von dem es hieß, er habe Abitur und sei sogar Berufsschullehrer gewesen, schüttelte nur bedauernd den Kopf und warf die Blätter mit den ellenlangen Bruchstrichen, um die sich ein endloser Zug von Variablen und Konstanten hangelte, wieder in den Karton auf dem Barhocker zurück. Es roch stark nach Schweiß und frischem Leder, so wie in einem der Dominastudios nebenan.
Kalle war seit drei Tagen nicht mehr aus seiner Allwell-Lederkluft gekommen. Nachdem ihm mit seinem Fund vom Gelände der ehemaligen Papierfabrik nicht der gewünschte Erfolg beschieden war, hatte er die anfänglich noch gewahrte Geheimhaltung immer mehr aufgegeben und schließlich jedem, der zufällig neben ihm an einem Tisch saß, einen Blick in den Karton aufgedrängt. Vielleicht war man hier aber auch einfach zu provinziell für ein Ding von diesem Format. Die Leute hatten einfach keine Ahnung. Die beiden Hütchenspieler, an die er die Papiere schon gleich am Montagabend verspielt hatte, ließen ihm den Karton durch eine Rotznase, die für sie Botengänge erledigte, zurückbringen. Zusammen mit der Drohung, er solle ihnen bis Ende der Woche die fünf Blauen vorbeibringen.
Als man ihm schließlich am Donnerstag, nachdem er bis zum Professor vorgedrungen war, in derselben Kneipe irgendwas ins Bier tat und er wie bewußtlos bis zum Abend durchschlief, vermißte er nach dem Aufwachen nur Lederjacke, Gummiknüppel, Stablampe und den Allwell-Blechstern, während der Karton mit den Papieren unangerührt neben ihm stand. Der Kellner kam, um abzukassieren, aber Kalle hatte schon am Mittag kein Geld mehr gehabt. Er bot einen Teil der Papiere als Pfand an. Zwei Schlägertypen packten ihn und warfen ihn auf die Straße. Die Papiere flogen hinterher.
Kalle stand mühsam auf. Ihm war schwindlig. Am rechten Knie seiner Allwell-Diensthose klaffte ein breiter Riß. Der Wind der Aprilnacht drückte sein durchgeschwitztes Hemd unangenehm klamm gegen seine Brust. Und wenn sie alle hier keine Ahnung hatten, einer kannte den Wert der Papiere mit Sicherheit: der, dem sie gehörten. Kalle würde sie dem Mann im ehemaligen Hausmeisterhäuschen gegen die Zahlung von, sagen wir mal, 250.000 Mark zurückgeben. Natürlich nicht alle Papiere. Das konnte der überhaupt nicht so schnell überprüfen. Und so würde er in absehbarer Zeit noch mal ein schönes Sümmchen einheimsen. Um diesen neuen Plan auszuführen, brauchte Kalle allerdings die Telefonnummer von Hugo Rhäs. Da er jedoch dessen Namen nicht kannte, konnte er nicht einfach im Telefonbuch nachschauen, sondern mußte sich die Nummer auf eine andere Weise verschaffen.
Und so kam es, daß der Nachtdienst der Firma für Sicherheitskonzepte Allwell an diesem Abend gegen halb zehn relativ kurz hintereinander zwei Anrufe erhielt. Im ersten Anruf fragte jemand mit offensichtlich verstellter Stimme, ob man ihm die Nummer des Hausmeisterhäuschens auf dem Achenkerberschen Gelände geben könnte. Er sei ein an den Rollstuhl gefesselter Nachbar, der gerade zufällig von seiner Wohnung aus gesehen habe, wie das Küchenfenster gefährlich im Wind schlagen würde. Nachdem man dieser Bitte aus Datenschutzgründen nicht nachkommen konnte, jedoch versicherte, umgehend ein Mitglied des eigenen Wachpersonals darüber in Kenntnis zu setzen, rief dreißig Sekunden später und wie durch eine Fügung des Himmels Kalle an.
„Ich mach hier gerade Dienst beim alten Achenkerber, und da ist mir aufgefallen, daß das Küchenfenster in der früheren Bude vom Hausmeister so klappert. Der Typ reagiert aber nicht auf mein Klingeln. Gebt mir doch mal kurz seine Nummer, vielleicht krieg ich ihn übers Handy.“
Die Allwell-Zentrale war über jeden Schritt Kalles seit Montag informiert. Er stand unter ständiger Bewachung und mit einem gewissen Amusement und auf der Suche nach weiteren Kündigungsgründen ließ man ihn weitermachen und gab ihm auch jetzt bereitwillig die Nummer von Hugo Rhäs. Schaden konnte er keinen mehr anrichten, dafür würde man schon sorgen.
10
Ein Ara ist kein billiger Vogel. Ein dressierter Ara jedoch, einer, der mit dem Schnabel Zuckerstückchen aus einer Dose holt oder einen Büstenhalterverschluß zu öffnen versteht, ist nahezu unbezahlbar. Hat man aber schon einmal so viel Geld für Anschaffung und Aufzucht ausgegeben, dann sollte sich das Tier auch auf irgendeine Art amortisieren. Nun sind Filme, in denen Papageien tragende Rollen spielen, leider rar. Oft tut es auch ein ausgestopftes Tier, dem Hans Clarin mit verstellter Stimme ein paar Wörter unterlegt, ganz zu schweigen von den immer perfekteren Computeranimationen.
Kein Wunder also, daß sich auch alle möglichen Tierbesitzer zusammen mit ihren Schützlingen in Richtung Polar, Wisconsin, aufmachten. Da sich die Behörden jedoch außerstande sahen, noch ein drittes Lager aufzuschlagen, wurden die Tierhalter ebenfalls in Richtung Langlade, zu dem Camp vor den Toren des kleinen Dörfchens Ranton umgeleitet.
Tiertransporte sind eine diffizile Angelegenheit und nicht so ohne weiteres zu bewerkstelligen. Glücklicherweise fand sich jedoch ein Organisator, der die verschiedenen dressierten Schützlinge gegen eine Aufwandsentschädigung zu einem Konvoi zusammenfaßte, die Fahrtroute erstellte und die Reise organisierte.
Neben einer Unmenge Vögel, die in einer alten fahrbaren Zirkusvoliere transportiert wurden, gab es so gut wie alles: normale Haustiere wie Katzen, Hunde, Hamster, Hühner, Schweine, die sich auf irgendein Kunststück verstanden, dann Schlangen, Reptilien, riesige Käfer und exotische Schmetterlinge, die vor allem durch ihr ungewöhnliches Aussehen faszinierten. Schließlich natürlich Löwen, Tiger, Geparden, Panther und andere Raubtiere. Ein Elefant und ein halbes Dutzend Pferde rundeten diese Arche Noah auf Rädern ab.
Wer weiß, was allein ein Elefant jeden Tag frißt, ahnt, daß das Konzept des Organisators, der blauäugig von einem gemeinsamen Topf gesprochen hatte, nicht aufgehen konnte. Ein hypernervöses Schwein starb als erstes. Es folgten drei Wellensittiche. Und so ging es weiter. Die Entsorgung der Kadaver, die man unter den Augen einer wachsenden Öffentlichkeit nicht einfach an andere Tiere verfüttern konnte, verschlang zusätzliches Geld. Obwohl der Zug nur drei Tage unterwegs war, ging es am Ende bloß noch darum, durchzuhalten und das Ziel zu erreichen.
Von dem Ziel hatte man natürlich völlig falsche Vorstellungen, obgleich es immer mehr Beteiligten dämmerte, daß der große Tierpark, in dem alle ihr Auskommen finden würden, auf diese Art und Weise bestimmt nicht existierte. Daß sie aber nichts weiter als einen mit Wohnwagen belegten Platz vorfanden, als sie am Abend des dritten Tages in Ranton ankamen, überstieg ihre schlimmsten Befürchtungen.
Man versuchte, den Organisator zur Rede zu stellen, doch der hatte sich kurz vor Polar aus dem Staub gemacht. Obwohl dem Konvoi mitgeteilt wurde, daß der Festplatz in Ranton aus allen Nähten platzte, beschloß der nun führerlose Zug, einfach immer weiter in das Dorf zu fahren. Es wurde langsam dunkel, und da man sich in der unbekannten und schlecht ausgeschilderten Gegend nach einem Lichtschein in der Ferne orientierte, stieß man schließlich auf den Fackelzug der aufgebrachten Bevölkerung.
Die Tiere wurden durch das Geschrei und den Schein der Fackeln unruhig und schlugen gegen die Wände ihrer Käfige. Schließlich verlor irgendwer die Nerven. Mit einem Mal waren die Wagen und Transporter offen und die Tiere in Freiheit. Da die meisten von ihnen Licht und Lärm verabscheuten, verteilten sie sich in den ausgestorbenen Straßen des Ortes und drangen in die leeren Häuser ein.
Und so kam in Ranton doch noch alles zu einem einigermaßen glücklichen Ende. Nun hatten die Behörden einen Grund, das Dorf abzusperren und jegliche Presse fernzuhalten. Da es sich teilweise um exotische Tiere handelte, deren Herkunft und Gesundheitszustand überprüft werden mußten, konnte eine vorübergehende Quarantäne verhängt werden. Die Dorfbewohner, die sich nur mit dem gewöhnlichen Vieh auskannten, waren auf die Hilfe der anwesenden Artisten angewiesen. Diese allein konnten aus Panik in Wasserleitungen geflüchtete Ozelote befreien, Leguane von den Bäumen pflücken und Tiger mit Hilfe eines vorgehaltenen Stuhls von den Stallungen weglocken. Alle arbeiteten in den nächsten Tagen so gut zusammen, daß die außergewöhnlichen, größeren und wertvolleren Tiere fast vollständig eingefangen werden konnten. Es fehlte am Ende nur ein dressierter Ara, ein äußerst sensibler Vogel, der mehrere zehntausend Dollar wert war. In der freien Natur kaum lebensfähig, machte sein Besitzer sich die allergrößten Sorgen und ließ mehrere Suchdurchsagen in lokalen Radiostationen schalten. Leider ohne den gewünschten Erfolg.
11
Wäre Kalle noch am Abend seines Diebstahls auf den Gedanken gekommen, Hugo Rhäs anzurufen, um ihm dessen Papiere zum Wiederkauf anzubieten, hätte er vielleicht sogar Glück damit gehabt. Natürlich hätte Hugo Rhäs nicht 250.000 Mark zahlen können und wollen, aber vielleicht 500. Ein Angebot, auf das Kalle nach kurzem Überlegen bestimmt eingegangen wäre. Jetzt allerdings, am Donnerstagabend, hatte Hugo Rhäs den Verlust seiner monatelangen Arbeit schon fast verwunden, oder vielmehr als neue persönliche Herausforderung umgedeutet.
Vielleicht war die Radix-Theorie noch nicht ausgereift genug. Schon gar nicht ihre Umsetzung in eine mathematische Formel. Hugo Rhäs ging in seinem Arbeitszimmer auf und ab. John Steinbecks Hund hatte die erste Fassung von Jenseits von Eden aufgefressen. Der erzwungene Neubeginn wurde zum Welterfolg. Doch was bedeutete das für Rhäs? Hin- und hergerissen zwischen dem Versuch einer Rekonstruktion und einem radikalen Neuanfang, entfernte sich das mühsam herbeigedachte Thema immer weiter von ihm.
Am Donnerstagnachmittag erhielt er dann einen Anruf der Firma Allwell. Man bat ihn, zum Schein auf das mögliche Angebot eines Wiederkaufs seiner Papiere einzugehen, weil man bei dieser Gelegenheit den Dieb stellen wolle. Hugo Rhäs erklärte sich einverstanden.
„Wenn ich Ihnen noch eine Frage stellen dürfte“, sagte der Allwell-Mitarbeiter.
„Ja, natürlich.“
„Um was für Papiere handelt es sich da eigentlich genau, falls das nicht einer strengen Geheimhaltung unterliegt?“
„Ganz und gar nicht. Es sind Notizen für eine sogenannte Radix-Theorie.“
„Radix?“
„Radix heißt soviel wie Wurzel. Ich verwende den Begriff, um ursprüngliche Gedanken zu bezeichnen. Einfälle, die einem spontan in den Sinn kommen, das, was Joyce als Epiphanien bezeichnet, was …“
„Also nichts von wirtschaftlicher Bedeutung?“
„Das würde ich so nicht sagen. Auf den ersten Blick vielleicht…“
„Was ich meine: wer könnte konkret noch ein Interesse an Ihren Unterlagen besitzen?“
„Nun, alle möglichen … das heißt im momentanen Zustand, der eher fragmentarisch ist, ja, wie soll ich sagen, im Grunde kann damit kaum jemand etwas anfangen. Es ist noch zu kryptisch, noch…“
„Ja, so ähnlich haben wir das auch eingeschätzt. Aber trotzdem vielen Dank für die Auskunft, und natürlich auch für Ihre Bereitschaft zur Zusammenarbeit. Wie gesagt, wenn jemand anruft und Ihnen die Papiere anbietet, dann gehen Sie bitte auf alle Forderungen ein. Wir haben Ihr Telefon angezapft und setzen uns dann wieder mit Ihnen in Verbindung.“
Der Allwell-Mitarbeiter ließ Hugo Rhäs mit einem Gefühl der Unzufriedenheit zurück. Es stimmte ihn nachdenklich, daß er seine Theorie noch nicht einmal ansatzweise hatte vermitteln können. Die mußten ihn für einen Spinner halten. Nichts von wirtschaftlicher Bedeutung! Was wußten die denn? Immerhin hatte sich ja jemand die Arbeit gemacht, die Papiere zu stehlen.
Eine Viertelstunde später klingelte das Telefon.
„Rhäs.“
„Ich glaube, ich habe hier etwas, das Sie interessieren dürfte.“
„Ja?“
„Ja. Oder vermissen Sie etwa nichts?“
„Wie man’s nimmt.“
„Papiere.“
„Ja, ja, kommen Sie zur Sache.“
„Ich bin durch einen Zufall in den Besitz Ihrer Aufzeichnungen geraten und würde sie Ihnen gern zurückgeben.“
„Ja, dann tun Sie das doch.“
„Hören Sie mal, ich meine, Sie verstehen doch wohl, daß ich dafür eine kleine Aufwandsentschädigung erwarten darf.“ „Ja natürlich, das verstehe ich. Wieviel?
„Ich hatte an 250.000 Mark gedacht.“
„In Ordnung.“
„Was heißt das?“
„Ich habe gesagt: in Ordnung.“
„Und ich habe Sie gefragt, was das heißt.“
„Was heißt das wohl? Daß ich einverstanden bin.“
„Ich möchte 250.000 Mark.“
„Das habe ich verstanden.“
„Eine Viertelmillion. Und Sie haben nur bis heute Abend Zeit, um das Geld aufzutreiben.“
„In Ordnung.“
„In kleinen und unnumerierten Scheinen. Und wenn Ihnen das Probleme machen sollte, dann sage ich nur…“
„Es macht mir keine Probleme.“
„Keine Probleme?“
„Keine Probleme.“
„Um so besser. Ich melde mich mit weiteren Anweisungen.“
12
Als Professorin Rikke um viertel nach elf nach Hause zurückkam, war die Sondersendung über Douglas Douglas Jr., den knochenlosen Siebzehnjährigen, schon vorbei. Wansl, ihr Lebensgefährte, war vom Schachspiel heimgekehrt und saß mit einem Katalog für Elektronikbauteile im Sessel vor dem Fenster. In der Küche summte leise die Spülmaschine, die sie nach Erhalt ihrer Professur als erstes angeschafft hatte.
„Hast du zufällig ferngesehen?“ fragte sie.
„Nur kurz. Es gab irgendwas über Schlangenmenschen und Feuerschlucker. Völliger Blödsinn. Hat mich nicht weiter interessiert.“
„Aber mich hätte es vielleicht interessiert. Außerdem ist das kein Schlangenmensch, sondern ein Junge ohne Knochen.“
Sie zog ihre Jacke aus und hängte sie an die Garderobe. Dietmar hatte wirklich keine Hemmungen. Ohne Überleitung hatte er angefangen, auf die Lebensgefährtin des Außenministers einzureden und sie zu allem Überfluß auch noch mit zu ihr gezerrt.
„Wenn Sie sich für Kunst interessieren, dann hab ich etwas ganz Besonderes für Sie.“ Dietmar hatte das eingepackte Bild unter dem Buffettisch hervorgeholt, die Schnur gelöst und die Decke auseinandergeschlagen. „Sei doch so gut, Sabine, und halt das mal kurz.“ Und so mußte Professorin Rikke das Bild in die Höhe halten, während Dietmar der Lebensgefährtin die Einzelheiten erklärte. „Ich setze mich gerade mit der Schrift in der Malerei auseinander. Ein Rückgriff auf den Kubismus. Malerei selbst ist ja auch Schrift. Und so frage ich mich, inwieweit Schrift nicht vielleicht umgekehrt, innerhalb eines Bildes, zum reinen Objekt werden kann.“ Er machte beim Sprechen mit den ausgestreckten Handflächen kreisende Bewegungen über der Leinwand, so als wollte er das Gesagte in das Bild hineinreiben.
„Riechen Sie? Noch ganz frisch. Ich war den ganzen Tag im Atelier. Das dürfte Sie vielleicht interessieren. Wenn Sie mal vorbeikommen wollen, jederzeit. Warten Sie, ich gebe Ihnen mal mein Kärtchen. Danke, Sabine.“ Dietmar nahm Professorin Rikke das Bild wieder ab und stellte es auf den Boden. Um die Pause zu überbrücken, während er in seinem Organizer nach seiner Karte suchte, stellte er Sabine der Lebensgefährtin vor.
„Sie ist Professorin für Frauenstudien in Gießen.“
„Interessant“, sagte die Lebensgefährtin und musterte dabei Professorin Rikke.
„Ist irgendwas?“
„Nein, nein. Ich überlege nur, ob ich Sie nicht von irgendwoher kenne.“
„Ich wüßte nicht.“
„Na, nicht so bescheiden“, mischte sich Dietmar wieder ein, während er der Lebensgefährtin seine Karte überreichte. „Vielleicht kennen Sie uns aus dem Fernsehen.“
„Stimmt“, ein Lächeln ging über das Gesicht der ehemaligen Fernsehvolontärin. „Sie waren mal im Fernsehgarten, richtig?“
„Haargenau“, strahlte Dietmar. Professorin Rikke war die Situation eher peinlich.
„Da hab ich damals mitgearbeitet. Sie haben da Frauen beraten, wie sie das Beste aus ihrem Typ machen können, nicht wahr?“
Dietmar konnte so etwas mit Humor nehmen. „Hahaha, na ja, nicht so ganz. Es ging um die Bedeutung der Sommersonnenwende in unserer Kultur.“
„Ach, das mit den Seifenkisten, ja das war schön. Ich durfte nachher auch mal mit einer fahren. Toll war das. Das kam bei den Kindern gut an.“
„Und hatte gleichzeitig noch einen tieferen Sinn.“ Dietmar versuchte das Gespräch für Professorin Rikke erträglich zu halten, doch es war zu spät. Sie hatte sich reserviert höflich verabschiedet und den Laden verlassen.
„Und sonst haben die nichts gezeigt im Fernsehen?“ fragte sie Wansl noch einmal, während sie sich selbst die verspannte Schulter massierte.
„In irgendeinem amerikanischen Kaff wollten die Bewohner irgendwelche Tiere aus einem Zoo in Teer sieden, und dabei ist ein unheimlich wertvoller Ara abhanden gekommen. Jetzt suchen die den bundesweit, weil es ein einmaliges Tier ist. Der kann mit seinem Schnabel Zahlen addieren und sogar schreiben.“
13
Kalle haßte dieses Gefühl der Unsicherheit. Warum war Hugo Rhäs nur so schnell auf alles eingegangen? Da konnte doch irgendetwas nicht stimmen. Wahrscheinlich waren die Papiere viel mehr wert als eine lumpige Viertelmillion. Aber egal. Die Zeit drängte. Die Groschen, die er vom Teller eines unbewachten Zeitungsstands genommen hatte, reichten gerade noch für einen Anruf. Außerdem hatte er seit fast fünf Stunden nichts getrunken. So übernächtigt und durchgeschwitzt wie er aussah, ohne Jacke, unrasiert und mit einer Pappschachtel unterm Arm, flog er selbst im Bahnhofsviertel gleich aus jeder Kneipe. Und auf Pump würden sie ihm erst recht nichts geben.
Kalle machte sich in Richtung der alten Papierfabrik auf. Einen Plan hatte er nicht direkt, aber das Gelände war dort unübersichtlich genug. Das Problem lag eher in der Tatsache, daß er alles allein machen mußte. Und daß er noch gut vier Stunden bis Sonnenuntergang zu warten hatte. Er fuhr einige Stationen schwarz mit der Straßenbahn, anschließend ein ganzes Stück mit dem Bus. Dann lief er schräg durch den Hartmann-Park und schlich sich von hinten an den Kiosk hinter dem Europa-Denkmal an.
Wie immer war die Gegend verlassen. Ein Mädchen kaufte gerade für eine Mark Brausebonbons. Sonst war niemand zu sehen. Nachdem das Mädchen bezahlt hatte, ließ sich der Kioskbesitzer wieder in seinen Korbstuhl fallen und schaute abwesend auf den laufenden Fernseher. Draußen vor dem Park fuhr eine Straßenbahn heulend über die Schienen. Die Kiosktür nach hinten war offen, so wie Kalle es erwartet hatte. Dort standen aber nur Bierkästen. Das nützte ihm nichts. Bis er sich an denen vorbeigequetscht hatte, war der Alte schon aufgesprungen und hatte nach seinem Baseballschläger gelangt. Einfach von vorn hingehen und eine Flasche Korn verlangen ging auch nicht, denn der Alte würde sie so lange in der Hand behalten, bis er das Geld auf den Zahlteller gelegt hätte.
Kalles Hände wurden schwitzig. Er stellte den Karton mit den Entwürfen für eine Radixtheorie ab und überlegte. Er hatte nichts mehr am Leib, das er als Gegenwert hätte anbieten können, soviel stand fest. Gewaltbereit war er nur bis zu einem gewissen Maß. Für eine ausgefeilte List hatte er weder Zeit noch Nerven. Außerdem mußte er seinen Grips für die Geldübergabe bei der Papierfabrik zusammenhalten. Er schaute sich noch einmal um. Die Europa lag im untergehenden Aprillicht lasziv auf ihrem Stier. Ganz in der Ferne kam eine alte Frau mit Stock angeschlichen. Hinter dem Zaun des Parks gingen wenige Leute von der Arbeit nach Hause. Kalle schloß die Augen und fing an, bis zehn zu zählen. Bei fünf hielt er es nicht mehr aus. Er riß die Augen wieder auf und stürmte von hinten in den Kiosk.
Der schmale Gang zwischen den aufeinandergestapelten Bierkästen war so eng, daß Kalle sich etwas zur Seite drehen mußte, um hindurchzukommen. Zum Glück saß der Alte mit dem Rücken zu ihm, wodurch er etwas Zeit gewann. Hinter ihm fielen Flaschen um. Jetzt gleich nach links. Chips, Kaugummis, Snickers, Mars, Zigaretten, irgendwo ganz oben stand der Klare.
„Sag mal, ich glaube, du spinnst! Was soll denn das?“ Der Alte brauchte sich gar nicht nach dem Baseballschläger zu bücken, denn er hatte ihn schon in der Hand. Kalle konnte sich jetzt nicht von seiner Suche ablenken lassen. Ja richtig, dort oben. Er ging einen Schritt zur Seite und griff sich zwei Flaschen Wodka. Dadurch verfehlte ihn der erste Schlag des Kioskbesitzers. Der Schläger hinterließ im Deckel der Tiefkühltruhe eine tiefe Delle. Kalle sprang zurück und wollte wieder nach hinten raus. Doch dort lagen die umgefallenen Flaschen und Kisten und versperrten ihm den Weg. Der Alte holte zu seinem nächsten Schlag aus. Er mußte schnell handeln, und so opferte er eine der beiden Wodkaflaschen und warf sie nach dem Mann. Die Flasche traf ihn an der Brust, fiel zu Boden und zersprang. Diesen Moment nutzte Kalle aus, um sich umzudrehen und über die Kisten nach hinten zu klettern. Er warf dabei absichtlich andere Stapel um und versperrte dem Alten so den Weg.
Draußen hielt er kurz hinter dem Europadenkmal an, schraubte die Flasche auf und nahm einen tiefen Schluck. Dann einen zweiten. Aus dem Kiosk kam ein dumpfes Poltern. Kalle schraubte die Flasche wieder zu und rannte jetzt über die Wiese, dann den kleinen Kiesweg hoch zum Ausgang und dort über die Straße, wo gerade eine Straßenbahn hielt, die ihn fast bis zur Papierfabrik brachte.
14
Klara Rhäs, geborene Sammel, geschiedene Howardt, war im April 1944 im Kreiskrankenhaus innerhalb ihrer Untersuchung zur Gebärbefähigung nicht nur verschiedentlich vermessen, sondern auch fotografiert worden. Und es waren diese Fotos, die ihr ein unangenehmes Gefühl verursachten. Nicht, daß die Vermessungen angenehm gewesen wären. Das kalte Maßband auf ihrem Bauch und zwischen ihren Beinen verursachte einen Schwindel, wie sie ihn nur einmal bei einer Bergwanderung in großer Kälte verspürt hatte. Der Atem war ihr für einen Moment weggeblieben und stattdessen war ihr die klare Bergluft, ohne daß ihre Lungen etwas dazu getan hätten, in den Brustkorb geströmt. Ungeatmet hineingeströmt, um ungeatmet wieder hinauszuströmen. Nicht sie hatte die Luft gebraucht, benutzt, über die Bronchien in ihre Lungen gesogen und ihrem Blut Sauerstoff zugeführt, sondern die Luft war in sie gedrungen, wie in eine vom Ruß verkohlte Höhle, um nachzusehen, ob sich da vielleicht etwas befand. Wäre Klara Rhäs religiöser gewesen, sie hätte diese klare Bergluft als ein Licht empfunden, das in sie gefahren war, um ihr den Weg zu weisen, von dem sie im Begriff war abzukommen. Stattdessen sackte sie nach hinten und riß sich die Hand an einem tiefhängenden Tannenzweig auf. Die jungen Burschen, mit denen sie unterwegs war, kamen zurückgelaufen. Aus einer kleinen Wunde zwischen Handschuh und Armbündchen tropfte etwas Blut. Aber Klara lachte, weil sie wieder atmen konnte.
Auf dem Untersuchungsstuhl, der ihre Beine weit auseinanderspreizte, hielt sie selbst die Luft an, um dem fremden Ersticken zuvorzukommen. Glücklicherweise gelang ihr das auch. Die Messungen dauerten eine gute Viertelstunde. Dann bat der junge Arzt in Uniform, sie möge doch ihre Schuhe anziehen. Sie verstand nicht recht und wollte sich ganz ankleiden. Doch er wies sie ausdrücklich darauf hin, daß die Schuhe vollkommen ausreichend seien. Während sie dies tat, rückte er einen Wandschirm zur Seite. Dahinter stand auf einem schweren Stativ eine Kamera. Links und rechts waren zwei Blitzlichter angebracht. Klara Sammel stand nun bis auf ein schon fadenscheiniges Hemdchen, das gerade ihren Busen bedeckte und nicht einmal bis zum Nabel reichte, nackt und in Schuhen neben dem Untersuchungsstuhl. Der Arzt bat sie nun in die Mitte des Raums vor die Kamera und ließ sie allerlei verschiedene Posen einnehmen, um die Ausformung ihres Beckens hinreichend dokumentieren zu können. Insgesamt machte er nicht mehr als sechs, vielleicht sieben Aufnahmen. Der Grund dafür lag jedoch nicht etwa an einer während seines Tuns aufkeimenden Zurückhaltung, sondern allein an dem zur damaligen Zeit äußerst spärlich vorhandenen Filmmaterial.
Um diese und andere Aufnahmen von jungen Frauen zu machen, hatten die Beteiligten einen ganzen Aufklärungsflug sozusagen „leer fliegen“ lassen müssen und sogar gehofft, daß das Flugzeug ein Opfer der feindlichen Abwehr werden würde, um diese ungeheure Manipulation zu vertuschen. Doch wie es eben so geht: Maschine, Besatzung und Ausrüstung waren unversehrt zurückgekommen. Zwar hatte es einige Nachforschungen gegeben, aber so etwas konnte, gerade in den chaotischen letzten Kriegsjahren, durchaus mal passieren. Und die Mitglieder der Untersuchungskommission hingen selbst mit drin.
So war nach einer weiteren Viertelstunde alles vorbei. Klara Sammel durfte sich anziehen und draußen Platz nehmen. Auf derselben Bank, auf der sie wenige Jahre später mit ihrem ersten Mann sitzen und auf die Mitteilung der amerikanischen Militärärzte warten würde, die besagte, daß man ihr Kind nicht hatte retten können.
15
Die nackten Zeugen von Armageddon, die sich immer noch im Hinterland von Wisconsin in ihrer Farm verschanzt hielten, waren von ungetrübter Stimmung und bei bester Laune. Gerade näherte sich der siebte Tag der Belagerung durch die Bundesbehörden seinem Ende, und noch hatten sie Nahrungsmittel und Wasser in Überfluß. In den Zeitungen erschienen Bleistiftzeichnungen, auf denen Illustratoren versuchten, mit Hilfe der Informationen des selbstverständlich ahnungslosen Hausbesitzers ein Bild vom Innenleben der Farm zu geben.
Es ging das Gerücht, die Sekte werde von drei weisen Männern mit den Namen Arnon, Arod und Arioch geführt. Auf den Kreideskizzen routinierter Gerichtszeichner sah man sie alle drei mit ununterscheidbar langen Bärten und wallendem Haar auf einem Podest stehen, das sich angeblich im nach hinten gelegenen Versammlungsraum der Farm befand und nach neusten Gesichtspunkten der Bühnentechnik ausgestattet sein sollte. Mit Hilfe von Scheinwerfern, Trockeneis und Theaternebel konnten sie so den zu ihren Füßen gescharten Anhängern noch eindringlicher ihre flammenden Durchhalteparolen predigen.
In Fernsehprogrammen wurden ähnliche Szenen mit der Kennzeichnung „Reenactment“ nachgespielt. Dazwischen zeigte man Archivmaterial, bestehend aus Berichten über andere Sekten und Religionsgemeinschaften. Leser und Zuschauer waren so schon bald tief in eine phantastische Welt eingetaucht, die sich irgendwo zwischen Quo Vadis, Twilight Zone und einem ZZ-Top-Videoclip befand, und damit natürlich ganz hoch in der Publikumsgunst stand.
Schließlich stellte sich auch den Fernsehanstalten nicht länger die Frage nach dem Wahrheitsgehalt der von ihnen in Bilder übertragenen Vermutungen. Entscheidend war allein, daß genügend Sendezeit aus dem spärlichen Material herausgepreßt werden konnte. Den Polizeibehörden war das alles nur recht. Mit dem Dreigespann Arnon, Arod und Arioch, das schon bald den Wiederholungen der Three Stooges den Rang abgelaufen hatte, konnten die amtlichen Pressesprecher in ihren Fernsehkonferenzen, von denen ebenfalls ein gewisser Unterhaltungswert erwartet wurde, frei schalten und walten, ohne dabei Gefahr zu laufen, tatsächliche Ermittlungsergebnisse preiszugeben.