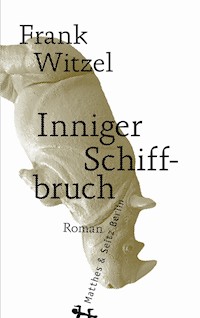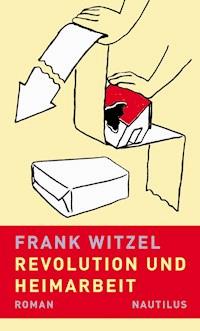Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Zu den großen Wundern des Literaturbetriebs zählt die grandiose Wiederentdeckung eines übersehenen Genies, einer zu Unrecht Vergessenen, eines verfemten oder verdrängten Künstlers, dessen Werk unter den Augen der Nachgeborenen plötzlich in ganz neuem Licht erscheint und uns Heutigen etwas zu sagen hat. Frank Witzel hat sich auf die Suche nach solchen ins Dunkel der Geschichte gefallenen Schriftstellerinnen und Schriftstellern begeben und erstaunliche Entdeckungen gemacht. Dabei geht es ihm aber um mehr als um Wiedergutmachung: Die über hundert Entdeckungen, von denen er in diesem faszinierenden, erstmals in der Zeitschrift Schreibheft veröffentlichten und gefeierten und nun für diese Ausgabe aktualisierten und erweiterten Essay berichtet, umfassen auch Werke von Erfolglosen, Besessenen, Gescheiterten und völlig unbekannten Autoren. Wie nebenbei entsteht in diesem ganz persönlichen Kanon eine Poetik des Literaturbetriebs und seiner Ironien, Albernheiten, enttäuschten Hoffnungen und großen Erwartungen, die auch einen Blick in die Abgründe der Schreibstube erlaubt. Dort lauert die Sehnsucht nach dem vollkommenen Text zusammen mit der drohenden Möglichkeit des Scheiterns, das nie endgültig scheint – denn eine posthume Entdeckung und der große Erfolg in Form von Nachruhm scheinen immer möglich. Oder ist auch das nur ein Phantasma des Marktes? Frank Witzels Essay liefert mehr als eine Antwort und entwirft ein Spiegelkabinett des Autors in all seinen Möglichkeiten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 291
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Meine Literaturgeschichte des 20. Jahrhunderts
Frank Witzel
Meine Literaturgeschichte des 20. Jahrhunderts
Ohne Lesen bin ich nichts. Im Lesen, mit ihmund durch es bin ich Niemand und Jeder.
PETER HANDKE
In einem Traum befand ich mich neulich an einem großen See. Es war früher Abend, die Sonne ging langsam unter. Ich stand am Wasser und schaute in die Ferne. Da erschienen Kinder in Begleitung von Erwachsenen, von denen ich annahm, dass es nicht ihre Eltern waren, weil sie die Kinder zwangen, mit ihnen in das Wasser zu gehen, bis ihre kleinen Köpfe unter der Wasseroberfläche verschwanden. Immer mehr Kinder strömten von allen Seiten herbei, und ich begann zwischen ihnen herumzuirren, auf der Suche nach einem Kind, das ich würde retten können. Warum nur ein Kind? Ich weiß es nicht. Vielleicht traute ich mir im Traum nicht zu, für mehr als ein Kind zu sorgen. Gleichzeitig war ich unsicher, nach welchen Kriterien ich dieses eine Kind würde auswählen können. Sollte ich mich von subjektiven Gesichtspunkten, der unwillkürlichen Sympathie, gar des Aussehens leiten lassen, oder umgekehrt genau das Kind wählen, das mir am hilflosesten, am unscheinbarsten, ja, am unattraktivsten erschien? Es war eine gespenstische Szenerie, in der ich mich befand: der nicht enden wollende Zug von Kindern, die dem Wasser zustrebten, ohne dabei das auf sie wartende Grauen zu erahnen, die Erwachsenen, die sie teilweise an Händen hineinführten, selbst aber nicht ertranken.
Dieser Traum hat weder in seiner Stimmung noch durch seine Symbolik etwas mit dem Thema dieses Buches zu tun, dennoch kam er mir beim Schreiben wieder in Erinnerung: Eine unüberschaubare Menge Autoren, aus denen ich nur einzelne auswählen kann, bevor sie alle im See des Vergessens untergehen. Wen sollte ich wählen? Welche Kriterien anwenden? Reichten allein persönliche Vorlieben aus? Wenn nicht, wie konnte ich mir objektive Kriterien aneignen? Würde nicht immer der Zweifel bleiben, nach falschen Maßstäben entschieden zu haben?
Der Schriftsteller FRIEDEMANN BERGER, geb. am 13. 4. 1940 in Schroda, gest. am 14. 4. 2009 in Leipzig, (Krippe bei Torres, 1971, Ortszeichen, 1973, Einfache Sätze, 1987), schreibt im Jahr 1979 in seiner Funktion als Verlagsleiter von Kiepenheuer Leipzig in einem Vorwort zu Paul Wieglers Sammlung Literarischer Porträts, Figuren: »Zu diesen verschwiegenen Männern des Essays gehörte auch der 1878 geborene PAUL WIEGLER (geb. am 15. 9. 1878 in Frankfurt a. M., gest. am 23. 8. 1949 in Berlin), dessen mutige Porträts von Abseitigen und dessen grandios vorgetragene literarische Unterredungen noch heute alle ihre Kräfte aufbieten, lehrreich, nützlich und besonders gesellig zu sein.« Ich zitiere diesen etwas ungelenken Satz, um den scheinbar infiniten Regress anzudeuten, der sich bereits bei einem willkürlich ausgewählten Beispiel aufzutun scheint: Ein Vergessener (Berger) erwähnt einen Vergessenen bzw. »Verschwiegenen« (Wiegler), der über Vergessene bzw. »Abseitige« schrieb, etwa über JOHANN WILHELM RITTER, geb. am 16. 12. 1776 in Samitz, gest. am 23. 1. 1810 in München, der in seinem 1807 erschienenen Buch über den Siderismus mehrfach den Italiener Francesco Campetti erwähnt, »der durch das bloße Gefühl«, wie Ritter schreibt, »unter ihm in der Erde verborgene Metalle entdecke, wenn er über die Stelle derselben mit besonderer Aufmerksamkeit langsam weggehe«.
Nun kann dem, der sich mit der Romantik beschäftigt, vor allem mit Novalis (»Ritter ist Ritter und wir sind nur Knappen«) oder auch E. T. A. Hoffmann, der seinen Johannes Kreislers Lehrbrief vor allem auf Zitate des dort als »geistreichen Physiker« firmierenden Ritter aufbaut, Ritter durchaus bekannt vorkommen, ebenso wie jemand, der sich für die Verlagsgeschichte von Kiepenheuer interessiert, von Berger weiß, oder wer die Geschichte der Zeitschrift Sinn und Form kennt, von Weigler, deren Mitbegründer er war. Doch spätestens bei Francesco Campetti wird es schwierig, da dieser nur bei Ritter aufzutauchen scheint und eine zweite Quelle über ihn ohne längere Recherchen schwer zu finden sein dürfte. Bereits hier stellt sich die Frage, die während meiner Suche nach womöglich ungerechtfertigt Vergessenen in der Literatur immer wieder auftauchte: Kann es mir genügen, allein den Namen eines Autors genannt zu bekommen und dazu vielleicht noch einige Titel seiner Werke, und hilft mir ein kurzer Textauszug tatsächlich weiter? Ich als Schriftsteller wäre damit zufrieden, denn nicht selten vermeide ich die Lektüre eines Buches, wenn mir bereits sein Titel eine Inspiration verheißt, die durch den Text womöglich zerstört werden könnte. Ebenso geht es mir mit einer kurzen biographischen Notiz, in der scheinbar ein ganzes Leben »auf den Punkt gebracht wird«, gerade weil das meiste ohnehin ungesagt und im Dunkeln verbleiben und von meiner eigenen Phantasie ergänzt werden muss.
Solche Epiphanien tauchen in der Regel zufällig auf, und da ich kein Literaturwissenschaftler bin, folglich gar nicht wüsste, nach wem oder was ich suchen könnte, habe ich mich bei der Zusammenstellung dieser »Literaturgeschichte« ganz dem Zufall und meinen persönlichen Vorlieben überlassen und mir eher an verschiedenen Stellen Einhalt geboten, um mich nicht allzu sehr zu verzetteln. Dabei gab ich dem mir selbst Unbekannten immer den Vorrang vor dem Bekannten, das in der Regel auch an anderer Stelle aufzufinden ist. Wenn ich also in dem 1970 von Thomas Beckermann herausgegebenen Materialienband Über Martin Walser las, so interessierten mich neben der unabgeschlossenen Rezeptionsgeschichte eines Autors, der noch nicht einmal die Mitte seiner Karriere erreicht hatte, vor allem die vier »jungen Autoren«, die der Suhrkamp Verlag in einem Einlegeblatt mit ersten Werken vorstellte: HERBERT ACHTERNBUSCH, geb. am 23. 11. 1938 in München, gest. am 10. 1. 2022 ebenda, mit seinem Erzählungsband Das Kamel, G. F. JONKE, geb. am 8. 2. 1946 in Klagenfurt, gest. am 4. 1. 2002 in Wien, mit Glashausbesichtigung, ERICA PEDRETTI, geb. am 25. 2. 1930 in Mährisch-Sternberg, gest. am 14. 7. 2022 in Tenna (Graubünden), mit Harmloses, bitte und HUBERT WIEDFELD, geb. am 13. 6. 1937 in Braunschweig, gest. am 2. 6. 2013 in Hamburg, mit dem Roman Rätzel. Die literarischen Werke von Herbert Achternbusch kenne ich recht gut, zwar nicht Das Kamel, aber den im selben Jahr 1970 erschienenen Band Die Macht des Löwengebrülls. Dort hieß es im Klappentext noch lakonisch: »Herbert Achternbusch, der Hörspiele schreibt und Filmpläne hat, lebt in Starnberg.« Achternbusch wurde für seine ersten beiden Bände mit Erzählungen, Hülle und eben Das Kamel, mit teils überschwänglichem, teils fragwürdigem Lob bedacht. »Unverfrorener hat sich wohl selten ein Pfuscher zum Schriftsteller aufgeworfen«, lässt Reinhold Grimm im Hessischen Rundfunk verlauten. »Da es sich um etwas ganz und gar Vergängliches, Verderbliches handelt, sollte man, wenn schon, dann schnell zugreifen. Bücher seien vergänglich wie Bananen, behauptet Sartre. Auf dieses zumindest trifft es zu«, schreibt Reinhard Baumgart im Spiegel. Entsprechend der damaligen Zeit geht die kurze Einführung im Buch auf den aktuellen Stand der Kritik ein und gibt sich apologetisch: »Die Prosa von Herbert Achternbusch gerät allzu leicht in den Verdacht, Ausdruck einer zwar phantasievollen aber harmlosen Subjektivität zu sein. Das beschriebene Milieu, die Sprachgebung scheinen hierfür Beweis genug zu sein. Doch das täuscht. Die radikale Selbstaussage, die sich weder von Gattungsgesetzen noch von sprachlichen und grammatikalischen Formeln festlegen läßt, ist Protest.« Mit dem zeitlichen Abstand erscheinen sowohl die Aussagen der Kritik als auch die des Verlags allesamt verwunderlich, sowie immer das am schnellsten unzugänglich wird, das sich am besten in die jeweilige Zeit einzufügen versucht. Je sperriger und interessanter mir die Autoren dieser Jahre erscheinen, desto unbedeutender wirkt die Kritik an ihnen, und fast erscheint es aus heutiger Sicht unverständlich, wie groß der Einfluss des Feuilletons auf den Literaturbetrieb seinerzeit war; beispielhaft nicht nur an dem Materialienband von Walser zu sehen, sondern etwa auch an einem von Gert Loschütz herausgegebenen Band zu Günter Grass, Von Buch zu Buch – Günter Grass in der Kritik, aus dem Jahr 1968, das »56 deutschsprachige Rezensionen, einen Antrag, die Novelle Katz und Maus in die Liste der jugendgefährdenden Schriften aufzunehmen, und die Korrespondenz, die sich daraus entwickelte, sowie vier Gutachten zu Katz und Maus« enthält. Diese vier abgedruckten Gutachten von Kasimir Edschmid, Hans Magnus Enzensberger, Walter Jens und Fritz Martini sind lediglich Teil eines Konvoluts von insgesamt neun Gutachten, das der Luchterhand Verlag in Auftrag gab und ihn »sehr viel Geld« kostete. Der Antrag, Katz und Maus als jugendgefährdend einzuordnen, wurde schließlich abgelehnt. Die Kritik aber beschäftigte sich auf unterschiedliche Weise weiter mit der »lustvoll im Obszönen und Fäkalischen gründelnden Phantasie« des Autors, wie es Heinrich Vormweg formulierte.
Die Werke von G. F. Jonke sind mir einerseits durch ihre Titel sehr präsent, was ihren Inhalt angeht eher ungenau in Erinnerung, aus dem Gedächtnis könnte ich Geometrischer Heimatroman von 1969 und Die Vermehrung der Leuchttürme aus dem Jahr 1971 nennen. Erica Pedretti und Hubert Wiedfeld kannte ich hingegen beide nicht. Rätzel blieb Wiedfelds einziger Roman, nach dem er sich vor allem dem Hörspiel zuwandte. Pedretti kam vom Hörspiel, schrieb dann Prosa und war gleichzeitig bildende Künstlerin. Das verschiedenen Bänden der edition suhrkamp beigelegte Faltblatt mit den vier Autoren war der Versuch des Verlags, die damals noch unbekannten Namen etwas mehr in die Öffentlichkeit zu rücken. So notiert der Verleger Siegfried Unseld im März 1970 in seiner Verlagschronik: »Die Autorin (Erica Pedretti) steht unter dem Eindruck, daß ihr Buch wie warme Semmeln gehe und daß die kleine Auflage wohl kaum lange reichen wird. Aber die Verhältnisse sind ja doch etwas anders. In einer St. Moritzer Buchhandlung erlebte ich, wie die Buchhändlerin einer Kundin das Buch eher vorenthalten wollte, weil es zu abstrakt, zu modern sei.« Und von einem zweiten Treffen im Juni 1970 heißt es: »Die Autorin war etwas enttäuscht, das ist nicht unverständlich. Sie lebt in einer Umgebung, die ihr einen sehr großen Erfolg suggeriert, und sie will nicht begreifen, daß dieser Erfolg sich nun nicht auf die gesamte Umwelt überträgt. Sie ist mit dem, was wir vorhaben (Beilagen in der es) einverstanden.« Das Leben der Autoren scheint somit eingerahmt vom weiten Meer der Anonymität, dem sie mit großer Kraftanstrengung entsteigen müssen, um mit ebenso großer Mühe zu verhindern, allzu bald wieder dorthin zurückzukehren. Von den vier Autoren der »Beilage« wäre heute vielleicht noch Achternbusch außerhalb der germanistischen Seminare ein Begriff, und dort womöglich auch nur auf Grund seiner Filme.
Umgekehrt ist heute kaum vorstellbar, wie vergleichsweise unbekannt im Jahr 1970 PAUL CELAN, geb. am 23. 11. 1920 in Czernowitz, gest. am 20. 4. 1970 in Paris, war. Ab dem 19. April galt Celan als verschwunden. Seine Leiche wurde am 1. Mai aus der Seine geborgen. Die Beerdigung fand am frühen Vormittag des 12. Mai auf dem außerhalb gelegenen Cimetière parisien de Thiais statt. Unseld schreibt dazu: »Es war eine Dichterbeerdigung, wie man sie sich in schlechten Filmen vorstellt: es war die kürzeste und sicherlich liebloseste Beerdigung. Vor dem Haupteingang wartete Frau Celan in einem Auto, ich kam mit einem Taxi, es stellten sich noch weitere vier bis fünf Autos ein, die alle warteten. Strömender Regen, aufgeweichter Boden, kalt. Schließlich kam der Leichenwagen. Die Autos fädelten sich in einen Konvoi ein, der dann in den riesigen Friedhof einfuhr. Bis alle ausgestiegen waren, war der Sarg schon aus dem Auto gebracht und in das Grab gelassen. Man ging noch an der Grube vorbei, verabschiedete sich; in ein paar Minuten war alles vorbei.«
Allein die Autoren des Suhrkamp Verlags, die im Jahr 1970 aktiv waren, könnten ein Buch füllen und würden stellvertretend die verschiedenen Spielarten einer literarischen Existenz abbilden. Da ist etwa ERNST AUGUSTIN, geb. am 31. 10. 1927 in Hirschberg, gest. am 3. 1. 2019 in München, dessen dritter Roman, der erste bei Suhrkamp, Mamma, erscheint und sich, ähnlich wie gleichzeitig Uwe Johnsons erster Band der Jahrestage, »schlechter verkauft als erwartet«, und das, obwohl der Verlag das Buch mit dem Spruch »Achtung: Es wird wieder erzählt!« bewarb. Unseld: »Augustin, der sich mehr und mehr in die Rolle eines Märtyrers gedrängt fühlt. Er erklärte mir, daß er bei allen Interviews erwähnen würde, sein Buch errege bei den Kritikern – ihm unverständlicherweise – Haß.« Der Dramatiker ALF POSS, geb. am 2. 8. 1936 in Ulm, gest. am 7. 1. 2003 in München, hat hingegen an den bundesdeutschen Bühnen Probleme mit der Aufführung seiner ersten beiden Stücke. 2 Hühner werden geschlachtet löst in Essen einen Skandal aus, weil in dem Stück zwei Hühner geschlachtet werden, Wie ein Auto funktioniert wird einerseits als »nicht gesellschafts-politisch relevant genug«, andererseits als »unzumutbares Un-Stück« bezeichnet. Und dann gibt es noch WOLFGANG KOEPPEN, geb. am 23. 6. 1906 in Greifswald, gest. am 15. 3. 1996 in München. Mitte Februar heißt es von ihm bei Unseld: »Er versichert noch einmal, daß wir Ende März das Manuskript oder seine Leiche haben.« Im März dann: »Er benötigt noch sechs Wochen. Aber diese Auskünfte sind nicht anders als die, die ich schon vor Jahren erhielt, und deswegen doch sehr wenig glaubwürdig.« Im Monat darauf: »Ich habe Koeppen noch einmal ernstlich gemahnt, er weiß es jetzt auch selber, daß für ihn entweder der sofortige Abschluß des Manuskripts oder eine ausweglose Katastrophe zur Wahl steht.« Und Mitte Dezember schließlich: »Er braucht jetzt nur noch 50 Seiten. Die würde er bis Januar, spätestens Februar geschrieben haben. Ich selber sagte zu ihm, daß ich daran nicht glaube, schlug ihm aber vor, diese 50 Seiten jetzt noch in einer Eil-Anstrengung bis zum Jahresende zu schreiben; ich hielt ihm das Beispiel Bachmann vor, die mit gebrochenen Rippen und Schlüsselbein in einem Korsett an einen Stuhl gefesselt die letzten Seiten diktiert habe.«
REINHARD LETTAU, geb. am 10. 9. 1929 in Erfurt, gest. am 17. 6. 1996 in Karlsruhe, fällt mir im Zusammenhang mit Jonke ein, vor allem mit seinem Schwierigkeiten beim Häuserbauen vom Anfang der 1960er Jahre, diesen »immer kürzer werdenden Geschichten«, die zwischen Anekdote und momentaner Beschreibung eine sehr eigene Form entwickelten, die sich in Auftritt Manigs von 1963 fortsetzt, als Lettau eine Figur kreiert, die sich in eine Reihe mit Valérys Monsieur Teste, Michauxs Plume, Calvinos Palomar oder auch Brechts Herr Keuner einfügt. Wichtig waren für mich in den 1970ern auch Täglicher Faschismus von 1971 und Frühstücksgespräche in Miami von 1977, die inzwischen stärker verblasst sind als seine früheren Texte. INGOMAR VON KIESERITZKY, geb. am 21. 2. 1944 in Dresden, gest. am 5. 5. 2019 in Berlin, der mit seinen in den 1980er Jahren veröffentlichten Romanen, die im Umfeld einer Abschaffel-Welt spielten, einen gewissen Erfolg hatte, publizierte Anfang der 1970er Jahre unter dem Namen Kieseritzky experimentierfreudige Romane wie Tief oben, 1970, oder das eine wie das andere, 1971: »Schuß 1 prallte vom Gitter ab und traf Hamel über der Braue; er hob diese Braue und bemerkte: denn das sind nur Leseerfahrungen. Dann besah er sich die plattgedrückte Bleikugel und beroch sie sogar.«
Selbst MARTIN WALSER, geb. am 24. 3. 1926 in Wasserburg, gest. am 26. 7. 2023 in Überlingen, schrieb damals eine überbordend wütende und vor allem ideenreiche Prosa, die jedoch von der Literaturkritik und Germanistik, wie aus dem zeitlichen Abstand unschwer zu erkennen ist, nicht entsprechend gewürdigt werden konnte, da man vor allem bemüht schien, die recht unterschiedlichen literarischen Ansätze des Autors unter eine einheitliche gesellschaftliche Sichtweise zu subsumieren. So schreibt Thomas Beckermann in einem Vor-Satz zu dem erwähnten Walser-Materialienband: »Er (Walser) versuchte es mit konzentrierten Fabeln kurzer Erzählungen, mit dem realistischen, d. h. Geschehen und Umwelt abbildenden Episodenroman, mit der monologischen Prosa; mit der satirischen Farce, dem epischen Parabelstück, der Bewußtseinsbühne. All das sind Manifestationen der Unruhe, sich selbst und die vertretenen Interessen gegen eine erstarrende Gesellschaft zu behaupten.« Mit dem Abstand von einem halben Jahrhundert erscheint mir diese Sammlung von Interpretationen der ersten Bücher Walsers und Dokumentationen verschiedener feuilletonistischer Auseinandersetzungen, wie sie damals an der Tagesordnung waren, selbst aus literaturwissenschaftlicher Sicht befremdlich. So wird Walsers erster Band mit Erzählungen, Ein Flugzeug über dem Haus (1955), so gut wie in jeder Besprechung mit Kafka verglichen oder in Bezug zu Kafka gesetzt, während ich Kafka in den Texten weder sprachlich noch thematisch erkennen kann. Das mag zum einen dem Umstand geschuldet sein, dass Kafka auf dem Umschlag von Walsers Buch erwähnt wird und Walser zusätzlich 1952 über Kafka promovierte, zum anderen, so meine Vermutung, dass sich mit dem Namen Kafka in den 1960er Jahren etwas anderes verband als heute.
Gerade am Beispiel FRANZ KAFKA, geb. am 3. 7. 1883 in Prag, gest. am 3. 6. 1924 in Kierling, lässt sich sehr gut erkennen, wie sich die Figur des Autors und seine Biographie über die Jahre mit dem von ihm verfassten Text zu einer Einheit verbinden, die in ihrer ganz spezifischen Mischung überhaupt erst zu einer Herausbildung des Begriffs »kafkaesk« führen konnte, der gleichermaßen der überlieferten Lebensweise des Autors geschuldet ist, seinem Verhältnis zu Frauen, seiner Arbeit in der Arbeiter-Unfall-Versicherungsanstalt, den wenigen Veröffentlichungen zu Lebzeiten, dem frühen Tod, wie auch der Tatsache, dass er eine untergehende Epoche literarisch in unauflösbare Parabeln und Bilder fasste. So stellt sich die Frage, wie stark die Vorstellung von einem Verfasser das im Text Gesagte mit beeinflusst und ob der Lesevorgang nicht immer zwischen dem Text an sich und einer Vorstellung von demjenigen, der diesen Text verfasste, changiert. FERNANDO PESSOA, geb. am 3. 6. 1888 in Lissabon, gest. am 30. 11. 1935 ebenda, erfand zu seinen recht unterschiedlichen Texten nicht allein fast 80 Heteronyme, von denen viele mit ausführlichen biographischen Angaben versehen sind, sondern verwendete auch seinen eigenen Namen auf so unterschiedliche Weise, dass die Forschung zwischen der tatsächlichen Person Pessoa, dem Autonym Pessoa (Pessoa schreibt mit seinem tatsächlichen Namen über sich selbst), dem Orthonym Pessoa (Pessoa benutzt seinen »richtigen« Namen, schreibt aber nicht als »Person« Pessoa) und Heteronym (der Name Fernando Pessoa wird für eine andere Person benutzt, nämlich für einen Schüler Alberto Caeiros, einem weiteren Heteronym von Pessoa) unterscheidet. Was auf den ersten Blick kompliziert erscheint, entpuppt sich auf den zweiten, wenn vielleicht auch nicht in diesem exzessiven Maße, als gängige Praxis literarischen Schreibens; so machte sich E. T. A. HOFFMANN, geb. am 24. 1. 1776 in Königsberg, gest. am 25. 6. 1822 in Berlin, um nur ein einziges Beispiel zu nennen, zum Herausgeber der Aufzeichnungen des Kapellmeisters Johannes Kreisler, der einen Namen trägt, den Hoffmann selbst benutzte, wenn er Musikkritiken in der Leipziger Allgemeinen Zeitung verfasste. Und könnte man nicht auch die folgenden Texte der vielen Unbekannten als einen Text lesen, von einem Autor verfasst und mit entsprechenden Heteronymen versehen? Denn dass Texte auch in ihrem zufälligen Aufeinandertreffen miteinander korrespondieren, entdeckte ich schon früh als Student in der Handausleihe der Frankfurter Universitätsbibliothek, die nicht nach Autoren oder Themen, sondern allein nach dem Datum der Einstellung sortiert war, so dass ich mir angewöhnte, immer auch die beiden Bücher mitzunehmen, die sich links und rechts neben dem Band befanden, den ich mir zur Ausleihe ausgesucht hatte, um den Text des von mir bewusst gewählten Buches durch den Zufall in einen neuen Kontext zu setzen.
Ob sich ein Text in der Biographie seines Verfassers verankert oder sich im Gegenteil von ihr abhebt und in einem Kontrast zu ihr steht, spielt dabei nicht die entscheidende Rolle. Ja, selbst bei einem Text, der aus historischen oder persönlichen Gründen anonym bleibt, wird sich zusammen mit der Lektüre die Phantasie über einen vermeintlichen Verfasser einstellen, die in der Regel nicht ungenauer und »unwahrer« ist als die ausschnitthaften Daten und willkürlichen Begebenheiten, aus denen ich mir die Biographien tatsächlich existierender Autoren konstruiere. So ist die Autorenbiographie im Verhältnis zu den jeweiligen Texten nicht mehr, aber auch nicht weniger als ein weiterer Text. Als ich etwa auf die wenigen biographischen Fragmente des mir unbekannten Schriftstellers KLAUS NONNENMANN, geb. am 9. 8. 1922 in Pforzheim, gest. 11. 12. 1993 ebenda, stieß, versuchte ich unwillkürlich, mir aus ihnen eine Vorstellung über seine mir gleichermaßen unbekannten Werke zu erschließen. Dabei beeindruckte mich vor allem die Tatsache, dass er mit seinen ersten beiden Romanen »wenig Erfolg« hatte und sich nach dem Selbstmord seiner Frau »aus dem Literaturbetrieb zurückzog«. Natürlich wird hier offensichtlich, dass ich einem romantischtragischen Künstlerbild nachhänge, als könnte die Tragik eines Lebens Garant eines interessanten Werks sein, wo sie dies doch in der Realität oft verhindert. Die Tatsache, die mich außerdem für Nonnenmann einnahm, nämlich in einem Ort wie Pforzheim sowohl geboren zu sein als auch zu sterben, wurde durch die Information geschmälert, dass er zwischenzeitlich mehrere Jahre in Gaienhofen und Straubenhardt lebte – immerhin hatte er Baden-Württemberg nicht verlassen. Das heißt, ich legte das Raster einer vermeintlich »interessanten« Autorenbiographie über die mir von Nonnenmann zur Verfügung stehenden Daten und erstellte daraus einen fragwürdigen Maßstab, der es mir ermöglichen sollte, herauszufinden, ob ich mich mit Nonnenmanns Werk beschäftigen sollte oder nicht.
Nicht nur ein Leben, sondern auch die Erinnerung an eine Person oder ein Werk durchläuft jedoch verschiedene Phasen, so dass Martin Walser bereits heute, relativ kurz nach seinem Ableben, anders beurteilt wird, als noch vor einem Jahr oder eben im Jahr 1970, als er Anfang vierzig war und, wie wir jetzt wissen, noch nicht einmal einen Bruchteil seiner Werke verfasst hatte. Zufällig fand ich in einem Antiquariat die Erstausgabe seines gerade einmal 80 Seiten starken Buches Fiction, das im selben Jahr wie der Materialienband erschien und in der dort aufgelisteten Bibliographie zusammen mit dem Theaterstück Kinderspiel aus demselben Jahr als letzter Eintrag zwar bereits aufgeführt wird, aber noch nicht Thema eines Beitrags ist. In einer Besprechung in der Süddeutschen Zeitung erwähnt Joachim Kaiser, »das Büchlein (habe) Bestürzung hervorgerufen«, weil man aus ihm herauslesen könne, dass Walser sich in einer Krise befinde. Unmittelbar darauf relativiert Kaiser diesen Begriff mit einem Böll-Zitat: »Die immer wiederkehrende, nachgerade schon peinliche Parole, der oder jener Autor stecke in einer Krise, ist nur unbewußte und versteckte Schmeichelei, denn Autor und In-einer-Krise-sein sind ja identische Begriffe.« Überschrieben ist der Artikel mit »Martin Walser fällt sich ins Wort – Ein Romancier sucht nach neuen Wegen«. Bevor Kaiser zu dem Schluss kommt, dass »ein solches Buch (…) nicht ›gelingen‹« kann, weil es tatsächlich Ausdruck »einer fürchterlichen Krise« sei, in der er Walser zu bleiben wünsche, listet er die verschiedenen Versuche einer »Selbst-Enthemmung« auf, in der Walser »um sich schlägt, blasphemisch wird, Sauereien probiert und sich einem nichtsmehr sagenden, besagenden, aussagenden Wortrausch überläßt«. Auch wenn Walser hier in eine Rolle schlüpft, kommt er einerseits dem Brinkmann von Westwärts 1 & 2 ganz nah (»Ich. Es gibt. Ich gehe. In die Stadt. Eine Menge Menschen. Es gibt immer. Wo ich hinkomme. Eine Menge Bilder. Ich folge. Es kommt mir bekannt vor. Jeder erzählt, daß er ging.«), erscheinen andererseits Passagen von traumhafter Sicherheit: »Meine 11jährige Tochter stellt mir ihren Mann vor. Er ist Witwer, Weißgerber und weitsichtig, an der linken Hand hat er sechs Finger. Wie eine Gräfin von Waldburg. Jetzt arbeitet er als Tankwart, Sie wissen, die Gerberei, ein Opfer des Kunststoffs, einverstanden? Auch er hat den allgemein herrschenden Katarrh. Er sagt, er sei sehr glücklich. Wie bitte, sage ich. Ich bin sehr glücklich, sagt er. Ich sage, ich verstehe immer nur Bahnhof. Das ging mir auch so, sagt er, aber jetzt bin ich sehr glücklich. Ich, sage ich, frage jetzt zum letzten Mal, was es zum Abendessen gibt. Das war bei mir genau so, sagt er, aber jetzt bin ich sehr glücklich.« Was, frage ich mich, wäre mein Eindruck von diesem Autor, wenn es das Einzige wäre, das ich von ihm kennte, zusammen mit ein paar Daten seiner Vita?
Walser stellte sich diese Frage Anfang der 1970er Jahre selbst, denn nach dem Misserfolg seines Theaterstücks Kinderspiel besorgte er sich eine Postanschrift in Berlin und schickte seinem Lektor und Herausgeber des gerade erschienenen Materialienbands, Thomas Beckermann, das Manuskript für seinen neuen Roman, Die Gallistl’sche Krankheit, unter dem Namen Carl O. Abrell, der in Walsers von Namen wimmelndem Roman Das Einhorn aus dem Jahr 1966 ein einziges Mal kurz auftaucht. »Die Augenbrauen berühren einander noch auf der hohen Nasenwurzel. Die könnte von den Madlehners von Ramsegg sein. Oder von den Fugunts von Ramsenbühl. Jardes von Atlashofen sind auch so haarig, aber nicht so dunkel. Vielleicht eine komplizierte Verwandte, eine Kalbrecht von Liebenau. Sind Sie von Liebenau, frag ich. Nein, von Retterschen. Ach, noch näher. Retterschen, also Zayfang? Nein! Abrell? Nein! Also frag ich: Grabherr? Ja. Leider hält sie es für ganz selbstverständlich, daß jedermann, woher er auch komme, die Familien von Retterschen kenne.« Dass der Name Abrell hier eingerahmt von einem wiederholten »Nein!« erscheint, hätte natürlich Hinweis sein können, doch selbst bei einem so profunden Kenner des Walser’schen Werks, wie es Beckermann zweifellos war, kann eine Erinnerung an diesen Namen nicht vorausgesetzt werden. Beckermann las also das Manuskript des unbekannten Autors Carl O. Abrell und entschloss sich, es mit der Begründung »Dieser Roman ist teilweise gut geschrieben, doch stellt sich auf die Dauer ein ungutes Gefühl ein« abzulehnen. Walser schickte das Manuskript daraufhin an Unseld, der Beckermann die unangenehme Aufgabe zuteilte, den Text noch ein zweites Mal mit Kenntnis des tatsächlichen Verfassers zu lesen. Auch wenn Beckermann jetzt erkannte, dass es sich um einen »Schlüsseltext« handelte, war das Verhältnis von Autor und Lektor zerrüttet, weshalb sich die Lyrikerin Elisabeth Borchers, die gerade neu zu Suhrkamp gekommen war, von nun an um Walsers Texte kümmerte. Ich muss Beckermann hier ausdrücklich in Schutz nehmen, denn natürlich ist Walsers Text beides, einerseits ein Schlüsseltext, andererseits ein Text, bei dem sich dennoch ein ungutes Gefühl einstellt. Kein Text lebt unabhängig von seinem Verfasser, und mögen wir es uns auch noch so sehr wünschen und gibt es auch immer wieder literaturkritische Ansätze, die sich einem Text gern auf diese »unbefangene« Weise nähern wollen, denn selbst wenn wir den Verfasser nicht kennen, weil er tatsächlich unbekannt ist, so werden wir uns ihn auf irgendeine Weise imaginieren, um überhaupt mit dem Text in Verbindung treten zu können, und das unterscheidet die Literatur ganz wesentlich von der Musik oder der bildenden Kunst, bei denen ich die Lebensdaten der Künstler vielleicht benötige, um ihre Werke stilistisch besser einordnen, nicht aber, um sie überhaupt hören oder betrachten zu können.
Ich selbst habe Anfang der 1980er Jahre meinem damaligen Verlag ebenfalls ein Manuskript unter einem anderen Namen geschickt, tatsächlich auch über eine Berliner Deckadresse, da eine Freundin damals wissenschaftliche Mitarbeiterin eines Professors an der FU war, der nichts dagegen hatte, seine Dienstadresse für dieses Experiment zur Verfügung zu stellen und die Antwortbriefe des Verlags ungeöffnet an uns weiterzugeben. Mein Grund war allerdings ein anderer als bei Walser, ich wollte mich nicht der Stellung des Verlags meinem Schreiben gegenüber vergewissern, vielmehr hatte ich einen Text geschrieben, besser: hatte sich ein Text im Schreiben entwickelt, der inhaltlich und stilistisch ganz anders war als die Gedichte, die ich damals schrieb. Ja, diese manische Fieberphantasie schien mir aus einer anderen Zeit zu stammen, etwa der des deutschen Expressionismus. Deshalb erfand ich zu ihr eine entsprechende Autorenbiographie und ließ besagten Professor, der in Wirklichkeit Assyriologe war, Entdecker und Herausgeber des Textes sein. Die Reaktion meines Verlags, von der ich außer durch einen offiziellen Antwortbrief auch privat erfuhr, war der von Walsers Lektor genau entgegengesetzt: das Verleger-Ehepaar war begeistert und schickte unmittelbar einen Vertrag. Ich wusste nun nicht, wie ich mich weiter verhalten sollte und ließ erst einmal Zeit verstreichen. Zwei weitere Briefe mit Nachfragen legte ich ebenfalls beiseite. Als ich bei einem Telefonat mit der Verlegerin zufällig erfuhr, dass sie am nächsten Tag nach Berlin fahren wolle, um den Entdecker des expressionistischen Autors persönlich aufzusuchen, da er auf ihre Briefe nicht reagierte, blieb mir nichts anderes übrig als zu gestehen, dass ich Verfasser dieses Textes sei. Und nun geschah etwas, das mich lediglich damals verwundern konnte: Das Interesse des Verlags an dem Text erlosch. Von einer Veröffentlichung war nicht mehr die Rede, obwohl man mir noch kurz zuvor begeistert Auszüge meines eigenen Textes hatte zukommen lassen. Natürlich war auch hier die Wirkung des Textes abhängig von der Vorstellung, er sei vor über einem halben Jahrhundert und in einer anderen Epoche verfasst worden, zudem von einem bislang völlig unbekannten Autor, der nun entdeckt worden war. Ob wir es uns nun eingestehen wollen oder nicht, das alles spielt eine Rolle, wenn wir uns mit einem Text beschäftigen. Damit aber ist jeder Text einem Wandel unterzogen, der mit dem Tod des Autors noch lange nicht endet. Doch selbst zu Lebzeiten ändern sich Voraussetzungen, so wie der Suhrkamp Verlag und Walser sich im Jahr 2004 trennten, weil Walser eine mangelnde Unterstützung des Verlags beklagte, als er wegen seines Buches Tod eines Kritikers angegriffen wurde. Wir können es uns heute schlecht vorstellen, aber es mag durchaus möglich sein, dass Martin Walser in fünfzig Jahren, wenn nach ihm auch seine heutigen Leser nicht länger existieren, nur noch hier und da als Name erinnert wird, wie gegenwärtig etwa Paul Wiegler. Einem viel größeren Teil von Autoren ist jedoch noch nicht einmal das vergönnt.
Als ich Anfang der 1970er Jahre zu schreiben begann, gehörte Walser nicht zu den Autoren, die mich literarisch inspirierten. Beeindruckt war ich vor allem von der seinerzeit aktuellen deutschen und amerikanischen Lyrik – Rolf Dieter Brinkmann, Jürgen Theobaldy, Allen Ginsberg, Joe Brainard –, allerdings versuchte ich diese oft wütenden, manchmal sentimentalen, jedoch immer eher ernsthaften Ansätze mit einem ironischen Ton zu verbinden, den ich in Uli Beckers 1977 bei der Edition Nautilus erschienenen Debüt Meine Fresse! entdeckt hatte. Beckers Einfluss auf meinen ersten Gedichtband war recht dominant und drängte meinen damaligen Orientierungs- und Fixpunkt, Rolf Dieter Brinkmann, dessen Geist meinen zweiten Gedichtband, ein Langgedicht mit dem Titel Tage ohne Ende (Hamburg 1980), durchwehte, zeitweise etwas zurück. ULI BECKER, geb. am 14. 9. 1953 in Hagen, könnte somit als einer der ersten in der langen Reihe von Vergessenen genannt werden, denen sich dieses Buch widmet. Über die Gründe, weshalb er ab dem Jahr 2000, also seit bereits über zwei Jahrzehnten, nichts mehr publiziert, würde ich allerdings nicht zu spekulieren wagen, gerade weil sich unsere Wege bereits zehn Jahre vor diesem Datum getrennt hatten. Anfang der 1980er Jahre sah es für seine Karriere hingegen sehr gut aus. Während ich mich zurückzog und mein am Ende ebenfalls zwei Jahrzehnte dauerndes »abgeschiedenes Prosaschreiben« begann, kamen Beckers Gedichte in der damals für zeitgenössische Lyrik und Prosa führenden Reihe das neue buch bei Rowohlt heraus. Er wurde in die Villa Massimo eingeladen und wechselte später zu Haffmans, dessen etwas undurchsichtige und teilweise unrühmliche Verlagsgeschichte aber wohl kaum allein für Beckers öffentliches Verstummen verantwortlich gemacht werden kann. Beinahe scheint er, weniger literarisch als vielmehr biographisch, in die Fußstapfen des alles überragenden Vorbilds unserer gemeinsamen Anfänge, Thomas Pynchon, getreten zu sein, denn es existieren weder aktuelle Fotos noch andere Lebenszeichen von ihm. Auch wenn der Titel seiner letzten Publikation Dr. Dolittles Dolcefarnienteauf einen Rückzug ins Privatleben hinzuweisen scheint, so ist vielleicht doch noch – Becker wurde im September 2023 immerhin erst siebzig – mit einem Alterswerk zu rechnen.
Verbunden sind Becker und ich – zumindest was unsere Wikipedia-Einträge angeht – über den Namen Erwin Kliffert, angeblich das Pseudonym, unter dem wir 1987 im Rowohlt Verlag eine Anthologie mit dem Titel Ich mal wieder – Ein selbstverliebtes Lesebuch herausgegeben haben sollen. Das ist allerdings nur zum Teil richtig und war eine damals aus vielerlei, vor allem rechtlichen Gründen von Becker in einem Spiegel-Interview, in dem ich lediglich als namenloser »Freund« erwähnt werde, vorgeschobene Behauptung. Tatsächlich existierte der Herausgeber dieser Anthologie, ERWIN »KLIFFERT« KLIFFA, geb. am 13. 10. 1954 in Siegen, durchaus. Es handelte sich um einen abgebrochenen Germanisten und genialischen Dichter, den Becker in seiner Aachener Zeit kennengelernt hatte. Kliffa hatte mit dem Rowohlt Verlag die Herausgabe besagter Anthologie vereinbart, dabei aber von Anfang an geplant, sämtliche Beiträge selbst zu verfassen. Natürlicherweise überfordert von dieser Unternehmung, wandte er sich wenige Monate vor dem vereinbarten Abgabetermin des Manuskripts an Becker und bat um Hilfe. Becker wiederum kontaktierte mich, und wir beide steuerten verschiedene Beiträge bei, die sich hinter Pseudonymen verbargen wie etwa: Hanna Bormann-Troost, geb. 1949 in Paderborn, Publikationen: Ausgependelt (1977), Gänsehaut (1980), Und wenn Frau Holle streikt? (1985); Peter M. Ehrein, geb. 1937 in München, Publikationen: texturen (1962), gerinnsel (1964), Kuba für Kinder (mit Schallplatte) (1969), Schichtenwechsel (1973), In diesem kalten Land (1978); Manfred Guhl, geb. 1953 in Dreieich, Publikationen: Zeilenbrechreiz, Versuche zu einer Poetik des anything goes (1983), Kopf unter dem Arm und andere Stücke (1983) oder Herbert Neuwirt, geb. 1933 in Heidelberg, Publikationen: Langmutder Flechte (1954), Dort wo Wolken (1957), In meiner Situation immer (1971). Kliffa, dessen hohe literarische Ansprüche bereits die Arbeit an der eigenen Lyrik immer wieder zum Erliegen gebracht hatten, verwand dieses persönliche Scheitern des von ihm mit großem Enthusiasmus begonnenen Projekts, das nun, anders als von ihm intendiert, einen eher parodistischen Ton bekam, nicht, schickte uns zusammen mit dem von ihm noch fertiggestellten Teil des Manuskripts seine gesamte, vor allem lyrische Produktion und verschwand quasi über Nacht von der Bildfläche. Wie wir später erfuhren, war er zwei Wochen später zu Fuß auf einer Autobahn im belgischen Grenzgebiet aufgegriffen und in die Psychiatrie in Lüttich eingewiesen worden. Nach einer wohl länger andauernden Krise fand er wieder zurück ins bürgerliche Leben, hatte jedoch, wie er mir zuletzt in einem Brief aus dem März 1994 schrieb, »der Literatur – und das meine ich wirklich und wortwörtlich und selbst in meiner Rolle als Leser – für immer den Rücken« gekehrt. Um sein Verdienst um diese Anthologie, mit der er selbst nicht mehr in Verbindung gebracht werden wollte, dennoch zu würdigen, wandelten wir lediglich seinen Nachnamen leicht ab und erstellten ihm eine erfundene Vita. Als Beweis von Erwin Kliffas Können mag ein Prosagedicht aus seinen allesamt unveröffentlichten Arbeiten genügen. Es ist mit dem 11. Dezember 1981 datiert und trägt keinen Titel.
Das beruhigende Geräusch der Kreissäge wenn ich als Kind im Schatten der Schreinerei auf der Wiese saß weil dort nur zersägt wurde um neu zusammenzusetzen ein Haus zu bauen eine Hütte das beruhigende Geräusch das mich in eine Zeit treibt vor der Hoffnung die ich nicht mehr erreiche denn natürlich denke ich hier im Gedicht das dennoch zu schreiben was mir das Sprechen versagt dennoch das zu leben was ich mir selbst im Leben versage spüren ohne überwältigt zu werden weil ich immer wieder zum Geräusch der Kreissäge zurückkehren kann zum Sommer zu meinem Körper im Sommer im beruhigenden Kreisen der Säge die fern genug doch nah genug war meinem Körper bevor er aus sich herausgewachsen vom Regiment des Hirns zerteilt und zerlegt nicht länger Körper war eingerollt im Gras im Kreissägegeräusch dem glänzenden Holzstaub dem Licht das durch die Lücken zwischen den Schuppenbrettern fiel und dem Geruch von frischgeschnittenem Holz von Staub von meinem Körper im Gras vergessen der weder mir noch einem anderen gehörte und mit einem Film Spucke auf den Lippen die Augen halb offen im Sonnenlicht lag.