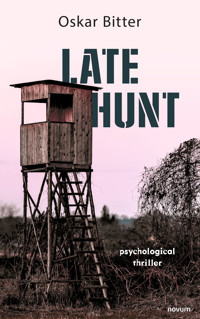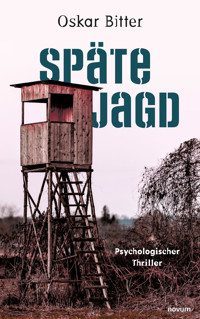Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Philipp Mahrong möchte Berufsbetreuer werden. Die Kontaktaufnahme mit der zuständigen Behörde verläuft kurios. Nach langer Wartezeit wird ihm ein problematischer Einstiegsfall angeboten. Mahrong lässt sich ködern - und gerät ins Schleudern.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 495
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Furcht ist egoistischer als Mut, denn sie ist bedürftiger.
Jean Paul (1763 - 1825)
Oskar Bitter ist von Beruf Statistiker. Nach langjähriger Mitarbeit in einer großen Versicherung hat er sich als freiberuflicher Experte selbständig gemacht. Seit einiger Zeit verfasst er spannende psychologische Romane. Die Inhalte entspringen seiner Phantasie, ergänzt durch allerlei Recherchen. Am liebsten zieht er sich zum Schreiben auf eine bewaldete Insel mit langen Sandstränden zurück. Begleitet von den Rufen der Möwen und Seeschwalben, lässt er dort den Gedanken freien Lauf.
Tätlicher Angriff im Einkaufszentrum
Eibenstädt. Eine Besucherin (51) erlitt gestern im Eingangsbereich der Rosengarten-Mall gefährliche Verletzungen. Nach einer kurzen, lautstarken Auseinandersetzung drehte ihr ein stark alkoholisierter Mann (45) hinterrücks den linken Arm so brutal um, dass sie zu Boden stürzte, mit dem Kopf aufschlug und für kurze Zeit die Besinnung verlor.
Die Mitarbeiterinnen der Kundeninformation riefen sofort Hilfe herbei. Während das Wachpersonal den Angreifer stellte, brachte der Rettungsdienst das Opfer ins Krankenhaus. Dort wird die Frau stationär versorgt. Weitere Informationen über ihren Gesundheitszustand liegen bislang nicht vor.
Die Polizei nahm den Straftäter in Gewahrsam. Kriminalkommissar Lars May: „Diese Person ist bei uns kein unbeschriebenes Blatt.“ Der Festgenommene wurde dem Haftrichter vorgeführt und vorübergehend in eine forensische Klinik eingewiesen.
Center-Manager Nico Novak-Brill: „In unserem Hause geschieht so etwas normalerweise nicht. Wir sind zutiefst betroffen über diesen Vorfall und wünschen der Geschädigten eine schnelle Genesung.“ (imu)
Hochwald-Kurier
Inhaltsverzeichnis
Teil I
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
Teil II
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
Teil III
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
Teil IV
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
Teil V
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
Teil VI
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
Teil VII
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
I
1.
Das Bewusstsein klopft zaghaft an und bittet um Einlass. In ihrem Kopf dreht sich ein Karussell, das immer langsamer wird, aber nicht zum Stillstand kommt. Es dauert eine ganze Weile, bis sie ihre erbärmliche Lage bruchstückhaft erkennt. Sie sitzt im Schneidersitz auf dem kalten Fußboden des winzigen Kabuffs. Es ist so eng, dass ihr nach vorne fallender Kopf gegen die Tür schlägt. Sie spürt es kaum. Sie ist total betrunken. Ihre Jeans klatschnass. Von oben bis unten eingepinkelt. Ein Eimer steht in der Ecke - unerreichbar für sie. Wozu auch? Jetzt kämpft sie dagegen an, das Gleichgewicht zu verlieren und seitlich wegzukippen. Um Hilfe rufen geht nicht. Die Zunge ist taub. Aus ihrem Mund kommt ein lallendes Gestammel. Mehr bringt sie nicht zustande. Sie hat seinen Namen vergessen. Sie weiß überhaupt nichts mehr. Als die Wirkung des Alkohols schwächer wird, fühlt sie sich eingemauert. Wie lebendig begraben. Der Drang, aus diesem Gefängnis zu fliehen, wird unerträglich. Sie kann wieder schreien. Aber darauf folgt nichts. Nach einer Weile hört sie damit auf, um neue Kräfte zu sammeln. Mit größter Mühe schafft sie es, den linken Arm hochzuheben und die Klinke herunterzudrücken. Aber die Tür ist verschlossen. Dahinter herrscht Totenstille. Einsamkeit. Wie am Ende der Welt. Von allen verlassen schläft sie ein und entschwindet durch weiße Wolkenschwaden ins Nichts.
Irgendwann wacht sie auf, völlig verkatert, durchgefroren, der Unterkörper durchnässt, verkrampft. Sie zittert wie Espenlaub. Die Tür steht sperrangelweit auf. Zuerst kann sie sich kaum bewegen. Als die eingeschlafenen Füße wieder einigermaßen durchblutet werden, gelingt es ihr, in den Flur zu taumeln. Er steht kerzengerade neben einem Regal und blickt sie vorwurfsvoll an. Mit strenger Miene im bleichen Gesicht. Die Augen rot umrändert. Er scheint sich an ihrem erbärmlichen Anblick zu weiden. Ohne ein Wort zu sagen, weist er mit der linken Hand zum Badezimmer, in das sie vorsichtig hinein schwankt. Sie findet keinen Schlüssel, um von innen abzuschließen. Egal. Hauptsache, das Badewasser läuft ein. Nur mühsam entledigt sie sich ihrer Klamotten. Vom anderen Ende der Wohnung hört sie ein lautes Hämmern. Ist er wieder in der Kammer zugange? Wie lange hat er sie dort eingesperrt? Die Sonne scheint aufs Fensterbrett. Es ist helllichter Tag. Bevor sie in die Wanne steigt, erbricht sie sich über der Kloschüssel. Als sie in das warme Nass eintaucht, will sie davontreiben. Weit weg. Allein. An einen hellgelben Strand unter strahlend blauem Himmel.
Gleich wird er kommen.
*
Nach Ablauf der Haftzeit kauert sie hinter der geöffneten Tür auf dem Boden. Sie ist tatsächlich da. Mit Leib und Seele. Seine Aufregung lässt nach.
„Wieviel Stunden sind es diesmal gewesen?“
Er muss eine Weile überlegen, bis er die gesamte Zeitspanne erfasst hat. Dann schlägt er mit Hammer und Meißel auf die Wand ein. Hierher werden alle gebracht, die ihm das Leben schwer machen. Er denkt sie sich in diesen Raum hinein. Von einer Sekunde zur anderen kommen sie hinter Schloss und Riegel. Für die Dauer des Gewahrsams wendet er strenge Regeln an: „Arrestbestimmungsmaß nach Schädlichkeitsbeweis“. Während sie ihre Strafe absitzen, winseln sie unentwegt um Gnade. Aber er bleibt unerbittlich. Weil es keinen Grund gibt, sie vorzeitig zu entlassen. Bei ihr ist es das dritte Mal. Warum hat er die anderen nicht genauso - wie sie - vor sich gesehen?
Er erinnert sich an den gutmütigen jungen Mann, der nach Angst riecht. An die Frau von der Behörde, die nicht verbirgt, was unter ihrer Kleidung zu erwarten ist. An den Vermieter, der ihn durch das winzige Loch in der Wohnzimmerdecke heimlich beobachtet. Er hat ihre Seelen eingefangen und jedes Mal ganz deutlich ihre Nähe gespürt. Für wie lange? Das zeigen ihm die „Haftzeiterfassungskerben“ in der Wand. Tief eingehauen für die Ewigkeit.
Eine Stimme in seinem Kopf sagt: „Sie wartet schon.“
Er geht ins Badezimmer.
2.
Ein weiteres Lebensjahr war wie im Flug vergangen. Ein neues eilte auf ihn zu. Philipp Mahrong dachte an seinen siebenundfünfzigsten Geburtstag:
„In einer Woche ist es soweit!“
Sollte er sich darauf freuen, noch älter zu werden? Jünger fühlte er sich auf jeden Fall. Dass er mittlerweile schon einige Federn gelassen hatte, beeinträchtigte seine Vitalität keineswegs. Natürlich war er nicht mehr so überschäumend und draufgängerisch wie früher. Aber für Juliane, seine geliebte Ehefrau, schien er immer noch ganz der Alte zu sein. Wenigstens neckte sie ihn öfters damit, dass sie ihn „mein Held“ nannte. Eine kleine Festlichkeit war ihm das durchaus wert. Für den 25. November hatte er Gäste eingeladen.
Wie schon in den letzten Jahren wollte er im kleinen Kreis feiern: Sein Jugendfreund Georg und ihre gemeinsame Freundin Mary Ann standen ganz oben auf der Liste, gefolgt von Steuerberater Klaus Kreuzer und dessen Ehefrau Miranda. Ein lediges Pärchen, das Juliane im ersten Semester an der Fachhochschule kennengelernt hatte, zählte seit vielen Jahren auch zu seinen Gästen. Neuerdings gehörte noch ein Unternehmensberater dazu, mit dem Mahrong sporadisch zusammenarbeitete. Seine beiden Söhne waren aus beruflichen Gründen verhindert. Der eine hielt sich gerade in Polen auf, der andere lebte seit drei Jahren in Spanien. Sie versuchten, Weihnachten vorbeizukommen.
Juliane bestärkte ihn in seinem Vorhaben, Gerichte aus der österreichischen Küche auf den Tisch zu zaubern. Das würde bei allen gut ankommen. Ihn amüsierte das zwanglose Plaudern in gemütlicher Runde. Gelegentlich verbargen sich hinter dem Austausch scheinbarer Belanglosigkeiten wichtige Neuigkeiten. Über die Anekdoten aus den gemeinsam erlebten Zeiten würde wieder viel gelacht werden. Mit jedem Glas mehr.
*
Ansonsten beschäftigte er sich mit Zukunftsplänen. Mahrong war seit dreiundzwanzig Jahren als Freiberufler tätig. Mit seiner „Praxis für Beratung, Bildung und Coaching“ hatte er gute Umsätze erzielt und rechtzeitig fürs Alter vorgesorgt: unter anderem durch den Kauf von drei Eigentumswohnungen. Wie hoch waren eigentlich die monatlichen Einnahmen aus den Vermietungen? Was blieb nach Abzug von Kosten und Steuern davon übrig? Würde es zusammen mit seinen sonstigen Rücklagen ausreichen, um sich zur Ruhe zu setzten?
„Knapp“, vermutete er.
Die genaue Kalkulation stand noch aus. Dafür müsste er die Auflösung seines kleinen Unternehmens planen. Die „Liquidation“. Später, mit fünfundsechzig, käme eine private Rente hinzu. Die Ansprüche aus der kurzen Phase als abhängig Beschäftigter würden vergleichsweise gering ausfallen. Juliane war fünf Jahre jünger als er und arbeitete im öffentlichen Dienst.
„Wenn ich mich aus dem Arbeitsleben zurückziehe und als Privatier auftrete, bin ich frei von allen beruflichen Zwängen!“
Dieser Gedanke faszinierte Mahrong. Gleichzeitig schreckte er ihn auch ab:
„Was kommt danach? Ich könnte mir einen Hund zulegen, ausgedehnte Spaziergänge machen und Juliane jeden Tag von der Arbeit abholen.“
Das war Monotonie pur! Gähnende Leere tat sich vor ihm auf.
Seit einigen Jahren bot er Seminare für Fortbildungsinstitute an. Die Veranstaltungen wurden gut besucht. Als Dozent erhielt er meistens ein sehr positives Feedback. Doch er fühlte sich zeitweilig ziemlich ausgelaugt. An manchen Tagen bemerkte er, wie seine Motivation nachließ. Irgendwie fehlte ihm dann der richtige Kick. Missmutig grübelte er vor sich hin:
„Vielleicht mache ich das schon viel zu lange? Bin ich etwa ausgebrannt?“
Des Öfteren ging ihm „ … because I feel so ausgeburnt …“ aus dem Song eines bekannten Komikers über die Lippen.1 Mahrong liebte Veränderungen. War die Zeit reif dafür?
Hinzu kam etwas, das ihn zunehmend beunruhigte. Er hatte seine Position bisher sicher behauptet. Inzwischen tauchten immer mehr Neueinsteiger auf, die ihm Konkurrenz machten. Während ihm früher die Aufträge nur so zugeflogen waren, musste er momentan mächtig die Werbetrommel rühren. Es gab nichts, was er mehr verabscheute, als Klinken zu putzen. Im Kollegenkreis wurden seine Eindrücke bestätigt. Sie machten die gleichen Erfahrungen.
„Bin ich zu verwöhnt gewesen?“, fragte er sich.
In seiner Funktion als Coach fiel Mahrong in letzter Zeit die Zusammenarbeit mit einigen Klienten recht schwer. Manchmal interessierten ihn die Fragen, mit denen sie zu ihm kamen, nicht sonderlich. Sie ödeten ihn eher an und gingen ihm mehr oder minder auf die Nerven: Wenn er wegen ewig zurückgehaltener Geschäftsideen in Anspruch genommen wurde. Wenn ihn jemand wegen ständig verdrängter Karrierewünsche konsultierte. Wenn er Konflikte im Stadium radikaler Zuspitzung moderieren sollte. Entweder war der Zug längst abgefahren oder der Karren steckte zu tief im Dreck. Ohne eine vernünftige Antwort zu erwarten, fragte er dann:
„Warum sind Sie in dieser Angelegenheit nicht schon früher zu mir gekommen?“
Manche Sitzungen verliefen sehr zähflüssig. Als würde eine Fliege versuchen, sich auf dem Honigstreifen fortzubewegen. Immerhin stellte er diese Leute wieder auf die Füße und holte sie in die Wirklichkeit zurück. Mehr ließ sich beim besten Willen nicht erreichen.
Sicherlich könnte er das noch ein paar Jahre so weitermachen. Er besaß gute Kontakte und Verbindungen. Um neue Zielgruppen zu erreichen, müsste er nur „Vitamin B“ aktivieren. Das fiel ihm aber ausgesprochen schwer. Möglich, dass sich die Vorzeichen dadurch wieder zu seinen Gunsten ändern würden. Möglich? Das war zu ungewiss. Warum klammerte er sich überhaupt an dem bisherigen Weg fest? Der Gedanke an einen Kurswechsel ergriff stärker denn je Besitz von Mahrong. Er war Betriebswirt und Pädagoge. Zweifellos gab es für ihn berufliche Alternativen.
Dann kam ihm etwas in den Sinn, das er oft beiseitegeschoben hatte: Der tragische Verkehrsunfall vor dreieinhalb Jahren. Auf einer Landstraße war ein angetrunkener Fahrer urplötzlich auf die entgegenkommende Spur geraten und mit dem Wagen seiner Eltern frontal zusammengestoßen. Die Mutter saß am Steuer und verstarb noch am gleichen Tag, ebenso der Verursacher des Unfalls. Kurz darauf bat ihn der Vater im Krankenhaus darum, seine Betreuung zu übernehmen. Mahrong setzte sich mit dem Gericht in Verbindung. Aufgrund der Dringlichkeit bestellte ihn die Behörde in einem beschleunigten Verfahren zum ehrenamtlichen Betreuer und stattete ihn mit umfassenden Vollmachten aus. Neben dem regelmäßig anfallenden Schriftverkehr ging es vor allem um die Vertretung in medizinischen Fragen. Nach einer vorübergehenden Besserung verschlechterte sich der Gesundheitszustand des Vaters dramatisch und er schlief für immer ein.
Mahrong hatte in diesem Dreivierteljahr alles in seiner Macht stehende unternommen, um dem Willen seines Schützlings gerecht zu werden. Die Ausübung der Betreuung ging ihm, trotz der tragischen Begleitumstände, gut von der Hand. Er konnte sich vorstellen, dies auch für andere Menschen zu tun. Nicht nur ehrenamtlich, sondern als Berufsbetreuer. Diese Idee ließ ihn seit heute nicht mehr los.
*
Manchmal dachte er sogar darüber nach, wenn er abends nach Hause ging. Einmal war er so in Gedanken versunken, dass er den Schlüssel vor dem Eingang zum Nachbarhaus aus der Aktentasche holte. Ausgerechnet in diesem Augenblick öffnete sich die Tür. Frau Kramer trat heraus und machte sich über ihn lustig:
„Herr Mahrong, sind Sie etwa umgezogen. Hat Ihre Frau Sie rausgeworfen?“
„Nein, nein. Was für ein Zufall! Frau Kramer, ich will zu Ihnen. Sie haben mir doch neulich Ihren Schlüssel gegeben. Für ein Stelldichein.“
Die alte Dame erblasste. Dann lief sie puterrot an und sagte empört an ihren Hund gerichtet:
„Komm, Rüdi. Wir gehen Gassi!“
Der Mops schnüffelte unbeirrt an Mahrongs Schuhen herum. Frau Kramer ruckte kräftig an der Leine und eilte mit ihrem Schätzchen im Schlepptau von dannen. Vor Aufregung bemerkte sie nicht, wie ihr das schwarze, leicht parfümierte Plastiktütchen, das sie vorausschauend in der freien Hand hielt, entglitt und auf den Bürgersteig schwebte. Mahrong hob es besorgt auf, holte Frau Kramer schnellen Schrittes ein, streckte ihr das Utensil entgegen und sagte kurzatmig:
„Vereint im Kampf gegen die Hundehaufen!“
Ohne sich zu bedanken, riss sie die Entsorgungshilfe an sich und entgegnete mit einem anzüglichen Grinsen:
„Freue mich schon auf ein Wiedersehen!“
Jetzt zog der Mops wie besessen sein Frauchen hinter sich her. Der Kleine hatte mächtigen Druck! Mahrong wusste, zu was Rüdi fähig war. Und, dass es so nicht weitergehen konnte. Mit ihm selbst. Er musste mit seinen endlosen Grübeleien endlich mal auf den Punkt kommen. Nägel mit Köpfen machen. Statt wie eine Katze um den heißen Brei herumzulaufen. Die Zeit, um sich in neues Fahrwasser zu begeben, zerrann ihm zwischen den Fingern. Jetzt oder nie!
*
Die Geburtstagsfeier verlief ganz nach seinen Vorstellungen. Alle lobten Mahrongs Krautstrudel und den faschierten Braten mit Paradeiserfüllung. Die Frauen sprachen rotem Zweigelt und Marillenlikör zu, während die Männer Weizenbier und Obstler bevorzugten. Wie erwartet gab es exklusive Informationen über bahnbrechende Ereignisse im Freundes- und Bekanntenkreis: in einer Bandbreite von lustig bis traurig. Schnell erreichten sie den Punkt, an dem sie die Stories „von ganz früher“ nicht mehr zurückhalten konnten. Mahrong hörte begeistert zu und vergaß, die Schallplatte zur gedämpften Hintergrunduntermalung umzudrehen. Insgeheim wartete er fieberhaft auf eine Gelegenheit, endlich loszulegen.
Schließlich war es soweit.
„Habe ich euch jemals die Geschichte von meinem Abschlussball erzählt?“
Alle sahen ihn mit großen Augen an.
„Das liegt so weit zurück. Ich hatte wohl ein paar Gläschen Sekt zu viel getrunken und Georgs Tanzpartnerin bei Damenwahl zum Rumba aufgefordert. Oh mein Gott, wie peinlich!“
Bevor er weiterredete, machte er eine kleine Pause. Er blickte an den anderen vorbei, als würde sich diese Szene gerade vor seinen Augen abspielen. Dabei wollte er nur die Spannung steigern. Dann legte er los:
„Schon nach ein paar Takten hatte ich mich falsch herum gedreht und mit der Ärmsten verknotet. Louisa, meine Abschlussball-Dame, half mir zum Glück aus der Bredouille. Anschließend führte sie mich mit einem Unheil verheißenden Blick, den ich nie vergessen werde, von der Tanzfläche. Dann ließ sie mich einfach am Rand stehen. Ohne sie wären meine Partnerin und ich wohl nicht so leicht voneinander losgekommen. Sondern voll auf das Parkett geknallt! Es war der letzte Tanz an diesem Abend. Meine Eltern nahmen mich unauffällig unter die Arme und schleiften mich zum Taxi. Dem Himmel sei Dank: Ich musste mich erst zu Hause übergeben.“
Die anderen prusteten vor Lachen. Schadenfreude und Begeisterung hielten sich die Waage. Für sie war er immer noch ein toller Hecht. Darüber konnte nichts hinwegtäuschen. Das glaubte Mahrong jedenfalls und daran sollte sich auch in Zukunft nichts ändern. Denn die Geschichte, die er zum Besten gegeben hatte, entsprach nicht ganz der Wahrheit. Es handelte sich um eine stark beschönigte Version dessen, was ihm seine Eltern und Georg am Tag nach dem Ball erzählt hatten. Was wirklich vorgefallen war, wusste er nicht. Er hatte einen Filmriss gehabt. Georg erinnerte sich erfreulicherweise nur noch lückenhaft an diese Begebenheit.
Louisa sah prinzipiell durch ihn hindurch, wenn sie sich zufällig begegneten. Dann schämte er sich für seinen Fauxpas auch heute noch in Grund und Boden. Er hatte sich nie bei ihr entschuldigt. Dazu war es jetzt auch viel zu spät. Zumindest redete er sich das ein. Anstatt es einfach mal auszuprobieren. Vielleicht würde sich Louisa ja darüber freuen und ihn mit einer belustigten und zugleich verzeihenden Miene anlächeln. Mahrong behielt das alles lieber für sich. Das gehörte nicht hierher. Wozu sollte er sich selbst die Show stehlen?
Zu vorgerückter Stunde spielten sie ein Quizz, das „Besserwisser“ hieß. Manche Fragen waren ungeheuer witzig, andere absolut schwachsinnig. Unabhängig davon beklagten sich alle darüber, dass nur sie die schwierigsten und die anderen immer ganz leichte Fragen beantworten mussten. Es wurde lebhafter. Der Geräuschpegel stieg. Als es darum ging, welcher Form der Penis eines Ebers ähnelt, zeigte Georg auf den Korkenzieher, der neben der Weinflasche auf dem Tisch lag. So viel wie heute wurde selten herumgealbert. Das tat gut! Georg hatte Recht. Er bekam einen Punkt. Gegen zwei Uhr verabschiedeten sich die Gäste in bester Stimmung.
*
Am nächsten Morgen ließ Mahrong das Frühstück aus und ging verhältnismäßig früh ins Büro. Dort trank er ein Glas Wasser, setzte sich an den Computer und fand die gewünschten Informationen auf der Internetseite der Stadtverwaltung. Er musste sich an Alfons Neumeyer wenden, den Leiter des Betreuungsamtes. Heute wollte er seinen inneren Schweinehund überwinden und die Sache endlich mal angehen. Also rief er im Eibenstädter Rathaus an. Als sich der Anrufbeantworter einschaltete, legte er auf. Kurz vor Mittag startete Mahrong den nächsten Versuch. Diesmal hatte er Glück:
„Betreuungsamt Eibenstädt, Amtsleitung, Alfons Neumeyer.
Wie kann ich Ihnen weiterhelfen?“
In der kernigen, sympathischen Stimme schwang ein würdevoller Unterton mit.
„Mein Name ist Philipp Mahrong. Mich interessiert der Einstieg in die berufliche Betreuung. Ich möchte mich für Mitbürger einsetzen, die nicht in der Lage sind, ihre Angelegenheiten selbst zu regeln. Mich motiviert die Aufgabe, den Willen dieser Personen gegenüber anderen zu vertreten und durchzusetzen. Ein weiterer Punkt ist, dass ich damit Geld verdienen will.“
„So, so. Naja gut. Hm …“, kam es vom anderen Ende der Leitung.
Das klang wie eine Aufforderung zum Weiterreden. Mahrong ging jetzt auf sein bisheriges Engagement für Menschen in schwierigen Lebenslagen ein: beruflich und im privaten Umfeld. Oft habe er die Zähne zusammenbeißen und nach vorne schauen müssen, statt sich von den bedrückenden Umständen einschüchtern zu lassen.
„Auf diese Erfahrungen kann ich bauen.“
Währenddessen hatte Neumeyer hin und wieder ein verständiges „Ach ja?“ oder ein fast beeindruckt klingendes „Tatsächlich?“ vernehmen lassen. Der Amtsleiter schien ihm gespannt zuzuhören. Biss er schon an? Durch den Verlauf des Gesprächs angespornt, steuerte Mahrong auf das Nonplusultra seiner Ausführungen zu: Die Betreuung des Vaters. Weil sich dessen Gesamtzustand zum Schluss leider von Tag zu Tag verschlechtert habe, sei er von ihm - nach einer wahrhaften Odyssee von Klinik zu Klinik - darum gebeten worden, alle weiteren ärztlichen Eingriffe zu unterbinden.
„Trotz seiner flüsternden Stimme habe ich ihn genau verstanden. Er wollte nur noch sterben.“
Der anfängliche Widerstand der zuständigen Ärzte sei nahezu unüberwindbar gewesen. Davon habe er sich aber nicht beirren lassen und am Ende seien sie seinen Argumenten gefolgt. Der Todkranke habe - mit einer Morphiumspritze zur Linderung der Qualen - endlich einschlafen dürfen. Dies sei ja sicher eine wichtige Vorerfahrung für die neue Herausforderung. Er habe damals einzig und allein gemäß dem Willen und zum Wohl des Betreuten gehandelt, schloss Mahrong seine Ausführungen. Er setzte auf die Wirkung der letzten Worte. Wie schrecklich die Erinnerungen an diese Zeit auch immer waren, kam es ihm vor, als hätte er gerade beim Skat einen Trumpf ausgespielt.
„Das war ein Kreuz Bauer. Volltreffer!“, jubelte er innerlich.
Im selben Augenblick erteilte er sich dafür eine Rüge. Er wurde übermütig. Diese abwegigen Assoziationen resultierten aus einer Anspannung, die er bis dahin überhaupt nicht wahrgenommen hatte. Wenn er das Gespräch weiterhin erfolgreich bestreiten wollte, musste er sich stärker kontrollieren, um solche nassforschen Aussetzer wie eben zu unterbinden! Sonst würde ihm seine Unbedachtheit noch zum Verhängnis werden. Immerhin betrat er neues Terrain.
„Herr Mahrong, das hört sich ja alles schon recht gut an. Damit erfüllen Sie unbestreitbar einige wichtige Voraussetzungen. Viele Bewerber haben leider Gottes ganz falsche Vorstellungen von dem, was auf sie zukommt. Für den netten, bettlägerigen Großvater oder das liebe, verwirrte Großmütterchen im Altenheim sind ausreichend Freiwillige im Einsatz. Der Bedarf ist gut abgedeckt. Aber für die schwierigen Fälle suchen wir händeringend neue Berufsbetreuer: Suchtkrankheiten, starke psychische Störungen und damit einhergehende Verwahrlosung. Diese Probleme fallen nicht selten bei einer einzigen Person zusammen.“
Neumeyer verstummte. Er schien sich zu besinnen. Mahrong sagte nichts und wartete gespannt. Als würde er ein neues Kapitel beginnen, fuhr der Amtsleiter fort:
„Ich vertrete den Standpunkt, dass ein zu intensiver Kontakt mit den betreuten Personen nicht unbedingt von Vorteil ist. Manche setzen viel zu viel auf ‚Verbundenheit‘, wie sie das hochtrabend nennen. Und verheddern sich, weil sie beim Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung nicht recht vorankommen. Der Löwenanteil ist aber Büroarbeit: Formulare ausfüllen, Anträge stellen. Und zwar rechtzeitig! Damit Fristen eingehalten werden. Ich sage es Ihnen lieber nochmal in aller Deutlichkeit: Zuviel Nähe zum Betroffenen kann schädlich sein. Der Umgang ist oft schwierig. Der persönliche Kontakt muss in der Regel nur einmal pro Monat gewährleistet sein. Aber bitte mit dem nötigen Abstand! Ach, und viele von denen sind nicht gerade nett zu Ihnen!“
Mahrong beteuerte, dass er den Umgang mit schwierigen Fällen nicht scheue. Sonst hätte er sich nicht an Neumeyer gewandt. Ihm sei schon bewusst, was auf ihn zukomme. Dann stellte er die entscheidende Frage:
„Können Sie sich denn vorstellen, dass mich Ihre Behörde als Berufsbetreuer vorschlägt?“
„Ich glaube schon. Zuerst müssen Sie uns aber Ihre schriftliche Bewerbung schicken, samt Lebenslauf, polizeilichem Führungszeugnis und Diplomurkunde. Wir benötigen eine ausführliche Begründung, warum Sie das tun wollen und was Sie dazu im Einzelnen befähigt. Wenn Sie uns im Vorstellungsgespräch überzeugen, steht einer Zusammenarbeit nichts im Wege. Ich gehe davon aus, dass wir das wollen, nach allem, was ich von Ihnen gehört habe.“
Bevor er auflegte, fügte Neumeyer noch hinzu:
„Ansonsten finde ich es gut, dass Sie über ein separates Büro verfügen, um dort die gesamte Administration einzurichten. Privates und Berufliches sollte grundsätzlich getrennt werden. Vielen Dank für Ihren Anruf. Bis dann.“
Mahrong empfand das Gespräch insgesamt als angenehm. Insgesamt? Etwas befremdete ihn. Neumeyer hatte geradewegs schwierige Betreuungen angesprochen: Fälle, die sich unverkennbar nach Stress anhörten. Aber wenn er ihn richtig verstand, saß man diesen Personen gar nicht so oft gegenüber. Auf den Punkt gebracht, lautete die Botschaft des Amtsleiters:
„Bloß nicht so viel direkten Kontakt. Bearbeiten Sie den Fall mit Ihren Vollmachten vom Büro aus.“
War der Aufbau einer persönlichen Beziehung nicht die wichtigste Voraussetzung schlechthin? Vor welchem Hintergrund kam Neumeyer zu solchen Aussagen? Bezog er sich auf die schon einige Jahre zurückliegende Gesetzesnovelle? Mahrong hatte einen Artikel gelesen, in dem „rechtliche Vertretung“ und „Administration“ stärker betont wurden. Gleichzeitig galt aber nach wie vor auch die „Besprechungspflicht“, um sich im persönlichen Kontakt ein genaues Bild der betreuten Person zu machen. Bei Gelegenheit würde er Neumeyer noch einmal darauf ansprechen. Jetzt kümmerte er sich lieber um seine Bewerbung.
3.
Endlich geht sein größter Wunsch in Erfüllung: In diesen Sommerferien darf Philipp seine Verwandten allein besuchen. Wie er sich darauf gefreut hat! Tante Lydia und Onkel Henry wohnen in einem kleinen Dorf in ihrem Fachwerkhaus, zusammen mit den Eltern von Onkel Henry. Tante Lydia ist den ganzen Tag in ihrem riesigen Obst- und Gemüsegarten zu Gange. Er wird bald sechs, klettert in den Apfelbäumen herum oder spielt mit den Katzenjungen. Drei sind es in diesem Jahr. Wenn Onkel Henry aus dem Sägewerk kommt, geht er mit ihm durch den Garten zum Bach hinunter. Sie bauen Wasserräder und schnitzen Borkenkähne. Von Onkel Henry hat er auch einen Kescher bekommen. Damit fängt er Stichlinge und Steinkrebse. Die setzt er in ein mit Bachwasser gefülltes Gurkenglas. Für Philipp ist es das Paradies. Er denkt kaum an seine Eltern, hat ihnen aber auf Drängen von Tante Lydia ein Bild mit den drei Kätzchen gemalt, das sie zusammen mit ihrem Brief abgeschickt hat.
Im Wohnzimmer ist der Kaffeetisch gedeckt. Eine Platte mit Apfel- und Kirschkuchen steht vor ihm. Dampf steigt aus seinem Kakaobecher auf. Er sitzt neben der Tante auf dem Sofa. Onkel Henry kommt herein und hat ein eigenartiges Grinsen im Gesicht. Zuerst schaut er sie beide flüchtig an, lässt den Blick durch den Raum schweifen und sieht kurz auf die Holzdielen. Dann starren seine Augen unentwegt auf Tante Lydia. Sie leuchten komisch, flackern ein bisschen.
„Endlich eine Tasse heißen Kaffee! Lydia, dein Kuchen duftet unwiderstehlich.“
Das Lächeln, das er dabei aufsetzt, friert ein. Mit der flachen Hand fegt Onkel Henry das Geschirr vom Tisch und trampelt darauf herum. Die Holzdielen sind von Scherben übersät. Pfützen aus Kaffee und Kakao breiten sich auf dem Boden aus. Überall liegen Kuchenstücke herum. Einige sind völlig zertreten. Zermatscht. Der Onkel rutscht fast auf ihnen aus, kann sich aber im letzten Moment noch fangen. Mit einem brutalen Ruck am linken Unterarm, den sie wie zum Schutz vor ihre Stirn hält, reißt er seine Frau zu sich und blafft sie an:
„Er steht wieder neben den Johannisbeeren am Gartenzaun, dieser Lackaffe! Hugo, dein Schulkamerad. Mit dem du so viele Jahre in der Laienspielgruppe gewesen bist. Der war noch nie hier? Von wegen! Der will dich abfangen, wenn ich nachher nochmal zum Chef in die Firma muss. Du hast dich mit ihm verabredet!“
Er stößt die Worte schnell heraus. Kalt. Hart. Laut.
„Das ist nicht seine Stimme“, denkt Philipp.
Tante Lydia schreit wie am Spieß und muss höllische Schmerzen haben. Onkel Henry lässt sie los, ihr Arm hängt jetzt ganz schlaff herunter. Unbeweglich. Ausgekugelt. Sie hört nicht auf zu schreien. Er fängt an, sie mit seinen kräftigen Händen am Hals zu würgen. Von oben poltert es auf den Treppenstufen. Opa Arnd stürzt ins Zimmer und schlägt mit den Fäusten auf Onkel Henry ein. Ins Gesicht. Auf die Brust.
„Henry, hör auf! Lass sie sofort los!“, brüllt er.
Wie betäubt lockert der Onkel den Griff, taumelt einen Schritt zurück und blickt ratlos in die Runde. Das Gesicht ist ganz angespannt. Verzerrt. Philipp ist fassungslos:
"Was ist los mit ihm? Warum ist er so anders als sonst?“
Nach dem großen Knall läuft jetzt alles ganz langsam vor seinen Augen ab. Er hat furchtbare Angst. Er muss aus dem Zimmer. Sonst erstickt er. Mit einem Satz springt er zur Tür und hechtet sich in den Flur. Flink wie Tinka, die Mutter der Kätzchen.
Entsetzt läuft er Oma Änne direkt in die Arme. Sie bringt ihn nach nebenan. Zu den Nachbarn. Dort sitzt er auf einem Melkschemel draußen vor dem Eingang zum Kuhstall und schnitzt mit seinem kleinen Taschenmesser an einem Weidenstock herum. Ab und zu macht er eine Pause und stiert vor sich hin, ohne sich von der Stelle zu rühren. Das Wurstbrot, das ihm die Nachbarin mit einem Becher Pflaumensaft neben das Stallfenster auf den kleinen Blechtisch gestellt hat, bleibt unberührt. Von dem Most trinkt er nur ein paar Schlucke. Am Abend, als der Boden vor seinen Füßen über und über mit Spänen bedeckt ist, holen ihn seine Eltern mit betretenen Gesichtern ab. Philipp ist froh, dass sie endlich gekommen sind. Während sich der Vater im Auto wortlos auf die Straße konzentriert, sagt die Mutter:
„Onkel Henry ist krank, er braucht Hilfe. Er ist nicht böse, nur eben krank. Arme Lydia!“
Für Philipp kehrt danach die Normalität zurück. Geredet wird darüber nie. Seine Eltern schweigen zu diesem Thema und er stellt keine Fragen. Wozu auch? Sein kleines, großes Paradies ist verschwunden. Zerstört in einem einzigen Augenblick. Für immer. Er will es gut in Erinnerung behalten. Alles. Auch Onkel Henry. Für immer.
*
Philipp ging in die achte Klasse auf dem Gymnasium. Jeden ersten Dienstag im Monat kam Tante Lydia zu Besuch. Sie saß gerade allein mit ihm in der Stube, weil die Mutter etwas aus dem Keller holte. In kurzen Zügen klärte sie ihn über die Hintergründe von Henrys damaligem „Aussetzer“ auf. Demnach wurde sein Onkel von Wahnvorstellungen heimgesucht und litt unter krankhafter Eifersucht. Den anderen Mann am Gartenzaun hatte er tatsächlich gesehen. Obwohl Hugo gar nicht mehr im Dorf wohnte. Traurig fügte sie noch hinzu:
„Die Ärzte nennen das ‚paranoide Psychose‘. In seinem Fall bestehen kaum Heilungschancen.“
Deshalb wurde Onkel Henry in einer psychiatrischen Klinik untergebracht. In der geschlossenen Abteilung. Als die Mutter zurückkam, verstummte Tante Lydia und sah Philipp mit einem vielsagenden Blick an. Heimlich schob sie ihm ein Foto zu, das er vorsichtig unter dem Kissen, an das er sich anlehnte, versteckte. Die Mutter balancierte zwei fast randvoll eingeschenkte Sherrygläser - und ein halbvolles für den Junior - auf einem Tablett. Jetzt wurde über den bevorstehenden Urlaub am Meer geredet. Tante Lydia kam mit. Wie immer.
Seit diesem kurzen Gespräch blendete Philipp das Thema „Aussetzer“ vollkommen aus. Ein für alle Mal? Mittlerweile waren außer ihm alle damals Beteiligten verstorben. Die Erinnerung an das Paradies bei Tante Lydia und Onkel Henry hingegen verlor in all den Jahren nichts an ihrer Schärfe. Er konnte sie abrufen, wann immer er wollte. Die Bilder aus seinem Kindheitsglück begleiteten ihn wie ein unauslöschliches Leitbild. Sie waren ein fester Bestandteil seines Bewusstseins. Wie gern würde er das Erlebte mit ihnen teilen. Er vermisste die Möglichkeit, sich darüber mit Tante Lydia und Onkel Henry zu unterhalten und ihnen seine Dankbarkeit zu zeigen. Abgesehen von damals, als er hin und wieder vor ihrem gemeinsamen Grabstein gestanden und irgendwie zu ihnen geredet hatte. Mit ihnen? Ja, auch mit ihnen. Aber seit geraumer Zeit ergab es sich einfach nicht, dass er dorthin kam.
Ihm war nicht bewusst, dass es mit „damals“ zusammenhing. Aber seitdem verhielt er sich gegenüber bestimmten Personen besonders vorsichtig. Meistens gelang es ihm frühzeitig, ihre Gesellschaft zu meiden: Ein einziger Blick aus sicherem Abstand genügte und er wich ihnen instinktiv aus. Wenn dies nicht möglich war, zwang er sich dazu, nach außen hin ruhig zu bleiben und sich die aufkeimende Vorahnung von Gefahr nicht anmerken zu lassen. Bis es einen Anlass gab, sich zu verabschieden. Und den fand er immer! Es waren Menschen, Männer wie Frauen, die dieses eigentümliche Leuchten in den Augen hatten.
Er wusste, was möglich war.
4.
Die Behörde hatte ihn für heute, den 15. Dezember, um vierzehn Uhr zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Weil er zehn Minuten zu früh im Rathaus ankam, ging er den weitläufigen Flur gemächlich auf und ab. Dabei passierte er mehrmals die Tür des Zimmers, dessen Nummer man ihm angegeben hatte. Hinter der hellgrau gestrichenen Holztür hörte er ein eifriges Gewirr von Stimmen, konnte aber nichts verstehen. Er wollte nicht lauschen. Aufgeschnappte Wortfetzen führten nur zu Missverständnissen. Es war genau vierzehn Uhr. Also klopfte er kurz entschlossen an und öffnete die Tür. Er betrat eine geräumige Amtsstube. Sechs Personen hatten sich um einen länglichen, ovalen Tisch versammelt. Augenblicklich verstummten sie wie auf Kommando und blickten in seine Richtung. Ein hemdsärmeliger älterer Herr mit graumelierten Haaren und glattrasiertem Gesicht saß ihm direkt gegenüber. Durch die Gläser seiner Halbrandbrille mit dunkelgrünem Gestell schaute er ihn ungehalten an. Das war Alfons Neumeyer, dem er sich bei der Abgabe der Bewerbungsunterlagen kurz vorgestellt hatte. An alle gewandt sagte er:
„Guten Tag! Ich bin Philipp Mahrong. Sie haben mich für vierzehn Uhr zum Gespräch eingeladen.“
„So warten Sie doch draußen! Wenn wir so weit sind, werden Sie hereingerufen“, entgegnete Neumeyer. „Bis dahin gedulden Sie sich bitte noch einen winzigen Augenblick.“
Das klang eine Spur zu mürrisch. Mahrong fühlte sich vor den Kopf gestoßen, trat zurück, zog die Tür hinter sich zu und holte tief Luft. Wie waren die denn drauf? Das Stimmgewirr wurde noch lauter als zuvor. Gelangweilt schlenderte er den Gang aufs Neue von einem Ende zum anderen. Plötzlich verließ Neumeyer das Zimmer. Als Mahrong auf ihn zugehen wollte, entfernte er sich in die andere Richtung und rief ihm gereizt zu:
„Noch nicht! Ich bin gleich wieder da.“
Nach kurzer Zeit kam er zurückgeeilt, würdigte den Bewerber keines Blickes und verschwand im Besprechungsraum. Mahrong ließ sich ungern vorführen. Er war kein Bittsteller, sondern wollte in dem Gespräch für sich abklären, ob dies der richtige Weg für ihn sei. Nun begann ihn schon der formale Rahmen abzuschrecken. So, wie es hier lief, war es ganz einfach falsch. Die Uhr zeigte 14:27 an. Jedem anderen hätte er in dieser Situation geraten, das Rathaus umgehend zu verlassen. Was hielt ihn davon ab? Er stand gerade vor dem Getränkeautomaten, als er eine dunkle, laute Stimme vernahm:
„Oh, ist er schon weg?“
Eine reichlich korpulente Frau, die wesentlich größer war als er, hielt nach ihm Ausschau. Ihre kurzgeschnittenen, gegelten schwarzen Haare sahen aus wie die Badekappe einer Sportschwimmerin. Sie trug einen weitgeschnittenen, grauen Hosenanzug, von dem ein blaurot gefärbtes, locker sitzendes Halstuch ablenkte. Durch die schwarze Hornbrille stierte sie in alle Richtungen. Ihr Gesicht klarte auf, als sie ihn entdeckte.
„Herr Mahrong, da sind Sie ja! Wir können sofort anfangen. Bitte kommen Sie doch herein.“
Die Frau wirkte überschwänglich und hektisch zugleich.
„Von wegen sofort!“, dachte er verstimmt, sagte aber nichts.
Dann gab er sich einen Ruck und ging durch die Tür.
*
Er war aufgeregt. Nachdem er sich gesetzt hatte, legte er beide Hände auf den Tisch, lehnte sich ganz leicht zurück und nahm kurz - aber keinesfalls zu intensiv - Blickkontakt mit allen auf. Er spürte seine Nervosität weiter ansteigen. Neumeyer eröffnete das Spiel:
„Herr Mahrong, ich bitte Sie um Verständnis, dass wir nicht eher angefangen haben. Aber wir mussten uns noch über eine andere Anfrage austauschen. In diesem Fall haben wir einige Bedenken gegen den Bewerber, die wir nicht ganz ausräumen konnten. Es wird ein zweites Gespräch geben. Und da wir gerade so schön zusammensitzen, haben wir das erstmal vorgezogen. Aber jetzt sind Sie an der Reihe.“
Wenn er einfach gegangen wäre, statt nahezu endlos zu warten, hätten sie ihre geschwätzige Runde ungestört fortsetzen können. Sollte er ihnen das jetzt anbieten? Aber er sagte nur:
„Schon klar, kein Thema. Das kenne ich.“
Mahrong brachte das in einem überzeugend gleichgültigen Tonfall heraus. Stoischer ging es nicht. Und es war voll gelogen.
Neumeyer stellte die drei Frauen und zwei Männer am Tisch mit ihren Funktionen vor. Links neben dem Amtsleiter saß seine Stellvertreterin. Einer der Herren kam aus der Kostenstelle. Die anderen Mitarbeiter wurden bestimmten Buchstaben zugeordnet. Das hatte etwas mit den Fällen zu tun, für die sie als Amtsbetreuer zuständig waren. Rechts neben ihm saß die korpulente Schwarzhaarige. Sie rutschte unruhig auf ihrem Stuhl hin und her und schien auf eine Gelegenheit zu lauern, das Wort zu ergreifen. Doch Neumeyer fuhr unbeirrt fort. Mahrongs Anschreiben sei bei allen der hier Versammelten gut angekommen. Seine Begründung klinge plausibel. Auch die anderen Unterlagen habe man sich gründlich angesehen. Sie seien sich darin einig, ihn kennenlernen zu wollen. Dann zog er ein handschriftlich beschriebenes Blatt aus einem Aktendeckel hervor und stieg direkt in die Thematik ein:
„Es geht um einen psychisch instabilen, gebrechlichen älteren Herrn, der sich nur mühselig mit dem Rollator fortbewegen kann. Er hat sich in sein Eigenheim zurückgezogen und verlässt es nur selten. Eine Sozialarbeiterin ist auf ihn aufmerksam geworden. Offenbar kümmert sich niemand um ihn. Haus und Garten sind in einem schlechten Zustand. Wir haben eine Betreuung angeregt, wovon der Mann nicht begeistert war. Er hat nur zögernd zugestimmt. Herr Mahrong, als Betreuer müssen Sie das erste Gespräch in seinem Haus führen. Fraglich ist, ob er sich darauf einlässt. Sie sollen prüfen, ob die Unterbringung in einer seniorengerechten Wohnanlage sinnvoll ist.“
Neumeyer warf ihm den Ball direkt zu:
„Wie würden Sie vorgehen?“
Der Hintergrund der Frage war leicht zu durchschauen. Kernpunkt: wie kam er an diese Person heran? Wenn er diese Hürde genommen hatte, konnte er sich den eigentlichen Fragen widmen. Falle: Er durfte nichts gegen den Willen des Betreuten unternehmen. Allmählich fiel die Aufregung von ihm ab. Mahrong schilderte der Jury seine Herangehensweise:
„Als Erstes vereinbare ich einen Termin, am besten telefonisch. Funktioniert das nicht, kündige ich meinen Besuch schriftlich an. Wenn ich Pech habe, stehe ich mehrmals vor verschlossenem Haus. Dann mache ich mich vor der Tür bemerkbar und stelle mich vor. Vielleicht hört mich der Mann. Außerdem werfe ich meine Visitenkarte in den Briefkasten. Irgendwann wird er Vertrauen zu mir fassen und mich hereinlassen. Da bin ich mir ganz sicher. Bestimmt ist er ein bisschen neugierig auf mich. Und auf das, was ich als Betreuer für ihn tun kann.“
Langsam hatte er sich warm geredet und die Jury hing an seinen Lippen. Das lief ja wie geschmiert! Zielsicher setzte er seine Ausführungen fort:
„Als Nächstes schaue ich mir die verwandtschaftlichen Beziehungen an. Lässt sich jemand finden, zu dem der alte Mann irgendwie in Kontakt steht? Dann kommt das weitere Umfeld dran: Freunde, Nachbarn, Ärzte. Wer auch immer. Was wissen sie über ihn? Stück für Stück setze ich mir mein Bild zusammen. Wie bei einem Mosaik. Nur so bekomme ich eine Vorstellung von dem, was für diesen Mann wichtig ist und was er überhaupt will.“
Vom Gefühl her hatte er sein fiktives Zeitbudget noch lange nicht überschritten, deshalb wollte er jetzt ausführlich auf Neumeyers zentrale Frage des Aufenthaltsortes eingehen.
Vorher machte er eine winzige Pause.
Eine tiefe, wie um Luft ringende Stimme zerschnitt die Stille. Das war die Frau, die ihn ins Zimmer geholt hatte. Loni Schmidt, wie er inzwischen wusste. Bei ihr hatte sich etwas aufgestaut, das danach drang, sich in einem riesigen Schwall in den Raum zu ergießen. Die anderen, außer Neumeyer, sahen sich für den Bruchteil einer Sekunde wissend an. Schmidt überschüttete Mahrong mit einer Flut von Einwürfen. Sie bezogen sich auf den Widerstand solcher Personen gegenüber allen nur erdenklichen Hilfsangeboten. In drastischen Bildern zeigte sie vielfältige Schwierigkeiten auf. Wiederholt warf sie ihrem Chef um Zustimmung bemühte Blicke zu, die dieser mit anerkennenden Gesten erwiderte. Neumeyers resolute Mitarbeiterin hatte sich zu ihrem Thema durchgewütet und blieb stabil in dieser Spur. Sie ging auf zahlreiche Fälle ein, in denen sie unter dem heroisch anmutenden Einsatz ihrer umfassenden Fachkompetenz Lösungen gefunden hatte. Schließlich kam sie auf ihr Lieblingsbeispiel zu sprechen: Ein künstliches Kniegelenk. Es platzte nur so aus ihr heraus:
„Der Betreute hatte panische Angst, weil er befürchtete, damit noch schlechter gehen zu können. Zweifellos war das Risiko enorm groß. Zudem spritzte der Mann schon damals Insulin. Aber ohne diese Operation wäre seine Mobilität irgendwann gleich Null gewesen. Nach endlosem Für und Wider stimmte er zu und wir konnten den Ärzten grünes Licht geben! Trotz aller Zweifel, trotz der ungeheuren Verantwortung: Für mich war das die einzig richtige Entscheidung. Die Operation ist erfolgreich verlaufen. Der Mann kann inzwischen wieder ganz normal laufen.“
Schmidt setzte sich so vehement in Szene, als stände sie selbst auf dem Prüfstand. Vorsichtig warf Mahrong ein, dass er bei seinem Vater die Einwilligung zu einem Luftröhrenschnitt gegeben habe. Wegen der schwerwiegenden Folgen eines solchen Eingriffs seien lange Gespräche mit dem behandelnden Arzt geführt worden …
Weiter kam er nicht.
„Das ist ja ein relativ einfacher Vorgang, im Vergleich“, unterbrach ihn Schmidt, immer noch außer Atem.
Die Stellvertreterin des Amtsleiters hatte Mahrong direkt angeschaut und ihm mehrfach zugenickt, als er über die Erfahrungen mit seinem Vater berichtete. Neumeyer schaltete sich ein, um Schmidt für den damaligen „fast übermenschlichen Einsatz“ Lob zu zollen. Zufrieden setzte sie ihre Offensive fort:
„Herr Mahrong, meine Tochter ist mit Ihrem Sohn auf die gleiche Schule, in die gleiche Klasse gegangen. Dieser Fall muss Ihnen doch bekannt vorkommen: Es ging damals um den Großvater einer Mitschülerin, der sich von seiner Familie losgesagt hatte. Er stand unter gesetzlicher Betreuung. Der Mann war todkrank, aber nicht zu belehren. Total unvernünftig. Ihre Frau arbeitet doch im Sozialamt. Wir standen damals in ständigem Kontakt. Ich hatte dauernd mit ihr zu tun. Das wissen Sie bestimmt noch.“
Als der Bewerber völlig entgeistert mit den Achseln zuckte, nannte sie den Namen des Großvaters. Daraufhin hielt ihr Mahrong entgegen:
„Wir reden zu Hause nicht über die Fälle meiner Frau. Auch nicht über meine Mandanten. Wenn überhaupt, sind Beispiele anonym gehalten. Wir tauschen uns fachlich aus. Übrigens arbeitet meine Frau dort nicht mehr. Sie hat die Stelle gewechselt.“
Er fühlte sich überrollt. An eine Loni Schmidt, geschweige denn an eine gemeinsame Schulzeit der Kinder, konnte er sich beim besten Willen nicht erinnern. Warum war sie so aufdringlich? Neumeyer hatte ein Pokerface aufgesetzt, die anderen wirkten peinlich berührt. Jetzt meldete sich der Herr zu Wort, der für die Buchstaben D bis G zuständig war. Egon Grantler. Seine Frage zielte darauf, was zu tun sei, wenn eine Person den Eintritt in die Wohnung oder das Haus permanent verweigere: eine typische Wiederholungsfrage. Mahrong griff teilweise auf das zurück, was er bereits ausgeführt hatte und wich nicht davon ab. Hielt sich kurz. Dann ergänzte er noch ein paar zusätzliche Aspekte, auf die er ausführlicher einging. Das kam bei allen gut an. Er sah das an ihren interessierten Blicken. Vereinzelt brachten sie ihre Zustimmung zum Ausdruck:
„Ganz genau!“ - „Da haben Sie recht.“ - „So sehen wir das auch.“
Nur Schmidt war auf den Stapel Papier fixiert, der vor ihr auf dem Tisch lag und schien angestrengt nachzudenken. Es folgten einige fachliche Fragen von den anderen, die sich bisher noch nicht geäußert hatten. Mahrong beantwortete sie sicher und knapp. Dann ergriff der Amtsleiter wieder das Wort. Jeder beginne mit ehrenamtlichen Fällen, die man später in Berufsbetreuungen umwandle. Bei Mahrongs Qualifikation sei dies schon nach kurzer Zeit möglich:
„Ein bis zwei ehrenamtliche Betreuungen, dann sind Sie drin. Wenn Sie sich denn bewähren!“
Dabei sah er den Kandidaten mit strenger, in seiner amtlichen Autorität ruhender Miene und einem langandauernden, prüfenden Blick an. Nach Details zum Honorar und zum sonstigen Status des Berufsbetreuers ergriff Mahrong die Initiative und kam auf einen entscheidenden Punkt zu sprechen:
„Für mich gibt es bei schwierigen Klienten eine Grenze. Menschen, von denen Gewalttätigkeit ausgeht, werde ich nicht betreuen. Damit meine ich nicht eine verwirrte Person, die mich am Arm rüttelt oder die mir wütend auf die Brust klopft. Ich meine körperliche Gewalt.“
„Da hat jeder seine eigene Hemmschwelle“, sagte die Stellvertreterin.
Schmidt wirkte vollkommen unbeteiligt.
Mahrong wollte es genauer wissen und fragte in die Runde:
„Ich bin ja nicht besonders zimperlich oder ängstlich. Ich komme mit den meisten Leuten zurecht. Aber was ist, wenn ich merke, dass es in einem Fall nicht geht? Weil sich das Verhältnis so verschlechtert hat, dass es irgendwann unzumutbar für mich ist. Kann ich die Betreuung dann beenden?“
Als dürfe jetzt keine Atempause entstehen, räusperte sich Neumeyer unverzüglich und sagte in verständnisvoller Manier:
„Na freilich! Ja, warum denn nicht? Naja, das kann schon mal vorkommen, dass jemand aussteigen will. Besser gesagt: aussteigen muss. Wenn ich Sie richtig verstehe?“
Mahrong nickte ihm zu.
„In dem einen oder anderen Fall gibt es berechtigte Gründe“, erklärte Neumeyer. „Das geschieht aber selten. So gut wie nie. Natürlich! Ja, Sie kommen da wieder raus. Aber selbstverständlich! Das entscheidet das Betreuungsgericht. Der Richter wird Sie entlassen, sowie ein neuer Betreuer gefunden ist. Danach sind Sie für den Klienten nicht mehr verantwortlich. Aber das habe ich Ihnen neulich ja schon gesagt. Vieles ist also reine Verwaltungsarbeit, Büroarbeit.“
Damit gab sich der Bewerber zufrieden. Seine Frage zielte auf Extremfälle. Er würde sicher mit einem Fall beginnen, der nicht einfach, aber zu bewältigen sei.
„Alles andere macht ja überhaupt keinen Sinn“, dachte er zuversichtlich.
Deshalb teilte er der Jury mit, dass sich sein Interesse, in die Berufsbetreuung einzusteigen, durch dieses Gespräch gefestigt habe. Allerdings erwarte er als Neuling eine intensive Unterstützung. Ob man ihm dies zusagen könne?
„Definitiv“, sagten Grantler und Schmidt wie aus einem Mund.
Einhelliges Nicken in der Runde.
„Das versteht sich von selbst“, wurde ihm auch von Frieda Tröndel, so hieß Neumeyers Stellvertreterin, zugesichert.
Schmidt gab Mahrong den Rat, sich mit der Behörde abzusprechen, statt alles auf eigene Faust zu unternehmen. Kooperation mit den Betreuern werde groß geschrieben. Neumeyer reichte ihm ein Info-Blatt und fragte stirnrunzelnd:
„Habe ich Ihnen bei unserer letzten Begegnung nicht davon erzählt? In Eibenstädt hat sich so ein kleines Netzwerk aus Berufsbetreuern gebildet. Die treffen sich regelmäßig und helfen Ihnen bestimmt auch mal, wenn es brennt.“
Der Kandidat wurde hinausgebeten. Diesmal wartete er nur zwei Minuten, dann saß er wieder an ihrem Tisch. Tröndel teilte die Entscheidung mit:
„Herr Mahrong, das Betreuungsamt will gern mit Ihnen zusammenarbeiten.“
Sobald ein geeigneter Fall für ihn in Sicht sei, werde er dem Gericht als Betreuer vorgeschlagen und dann gehe es los. Das könne schon sehr bald sein. Schmidt ließ von ihrer Tochter Lucia einen Gruß an Jonathan, seinen jüngeren Sohn, ausrichten. Er nahm diese Leutseligkeit entgegen, ohne weiter darauf einzugehen. Dann verabschiedete er sich bei allen mit Handschlag. Diese Hürde hatte er genommen.
*
Einerseits freute er sich. Andererseits versuchte er, den Ablauf dieses Gesprächs zu verstehen. Er hatte weit über das übliche Maß hinaus warten müssen und widerwillig mitgespielt. Bestimmt folgerten sie daraus, dass er ganz „heiß“ auf den Job sei. Schmidts Distanzlosigkeit verblüffte ihn. Besaß sie einen Freibrief? Oder steckte dahinter ein taktisches Vorgehen, eine Kunst der Gesprächsführung, die sich ihm gänzlich verschloss? Jedenfalls hatte er ihr dreistes Verhalten beharrlich ignoriert. Vielleicht wollten sie ja nur wissen, dass ihn nichts so leicht aus der Fassung bringen konnte. Im Hinblick auf seine zukünftigen Aufgaben als Betreuer verwunderte ihn Schmidts unermüdliches Einwirken auf Klienten:
„Sie stellt den persönlichen Kontakt in den Vordergrund. Mit keinem Wort ist sie auf Verwaltungsarbeiten eingegangen.“
Das stand im krassen Gegensatz zu dem, was ihm Neumeyer als genuine Aufgabe eines Betreuers beschrieben hatte. Wer war hier eigentlich Ross, und wer Reiter? Abschließend brachte er die Angelegenheit für sich auf den Punkt:
„Es geht nur darum, dass ich von Neumeyer und seinen Leuten beim Gericht als geeigneter Betreuer empfohlen werde. Für meinen ersten Fall. Später habe ich vorwiegend mit den Rechtspflegern beim Betreuungsgericht zu tun. Jetzt muss ich gute Miene zum bösen Spiel machen und mich diplomatisch verhalten: Ruhe bewahren, um reinzukommen.“
Auch wenn er sich noch keinen Vers darauf machen konnte.
*
In einiger Entfernung vom Rathaus fand er einen kleinen Bäckereiladen. An der Stehtheke trank er in Ruhe seinen geliebten Espresso, nicht ohne dabei andächtig ein Stück Streuselkuchen mit Mohnfüllung zu verspeisen. Durch die Schaufensterscheibe beobachtete er den gemächlichen Strom der Passanten. Ein junger Mann schob gerade einen älteren Herrn, der eine Einkaufstüte fest an sich gepresst hielt, im Rollstuhl vom Zebrastreifen auf den Gehweg. Mahrong dachte an seinen Vater. Und daran, wieviel Zeit er dem Schwerkranken in den letzten Monaten gewidmet hatte. Selbstvorwürfe stiegen in ihm auf:
„War das genug? Zwischendurch muss er schrecklich allein gewesen sein. Warum habe ich mir nicht noch mehr Zeit freigeschaufelt? Möglich wäre es gewesen …“
Dann vertrieb er die beklemmenden Gedanken, indem er Julianes Dienstnummer wählte. Da es schon nach sechzehn Uhr war, wollte er sich mit ihr in der Einkaufszone treffen. Sie erwartete seinen Bericht. Vor Neugier war sie ganz zappelig. Nach einem kurzen Bummel durch ein paar Geschäfte und ersten bruchstückhaften Informationen zogen sie sich in eine ungestörte Ecke im erstbesten Restaurant zurück. Sie bestellten sich italienischen Nudelsalat und dazu ein Gläschen Rosato Frizzante. Beim Essen erzählte Mahrong alles noch einmal en détail und wohlsortiert. Danach ließen sie sich zwei Brandys bringen, die sie aber nicht so recht genießen konnten. Juliane fand den Ablauf des Vorstellungsgesprächs auch eigenartig. Allerdings schien sie das nicht zu überraschen. Sie war mit der öffentlichen Verwaltung besser vertraut als er.
„Was weißt du über Frau Schmidt und ihre Tochter?“, fragte er ungeduldig und klopfte mit den Fingern auf den Tisch.
„Jetzt fällt es mir wieder ein: Lucia! So heißt die Tochter von der Schmidt. Die ist in der Quarta in dieselbe Klasse wie Jonathan gegangen. Dann hat sie die Schule gewechselt.“
Schmidt habe sich auf Elternabenden des Öfteren an sie gewandt, um über einen bestimmten Fall zu reden. Juliane bearbeitete damals etwas in einer Sache, mit der sich auch ihre Kollegin befasste. Es ging um Leistungsansprüche, die ein alleinstehender Rentner gestellt hatte. Dessen Tochter sollte zu seinem Lebensunterhalt zuzahlen. Juliane musste das überprüfen. Die Enkeltochter des Bedürftigen sei zufällig mit Jonathan und Lucia in der gleichen Klasse gewesen. Das habe sie aber erst von Schmidt erfahren. Die Mutter der Schülerin, um deren Großvater es ging, sei ebenfalls an den Elternabenden anwesend gewesen. Sie erinnere sich noch genau an die aufdringliche, übergriffige Art von Schmidt:
„Obwohl es der Mutter offensichtlich unangenehm war, ging sie bei jeder Gelegenheit auf die arme Frau los. Das gehörte absolut nicht dahin.“
Auch wie sich Schmidt immer mit ihrem Status als Alleinerziehende aufgeführt habe. Das sei irgendwie auffallend gewesen:
„Sie fühlte sich dadurch extrem benachteiligt. Angeblich hatte sie es viel schwerer als alle anderen. Loni - so heißt die Frau mit Vornamen - nahm sich selbst unheimlich wichtig. Als sei sie das Maß aller Dinge. Da gibt es noch etwas, was mich an ihrem Verhalten irritiert hat: Loni Schmidt stand immer unter Volldampf. Wie eine Dampfwalze. Sie wirkte durch und durch gehetzt. Als müsste sie vor etwas weglaufen“.
Juliane nippte an ihrem Brandy und sagte dann:
„Die Kinder haben überhaupt keinen Kontakt miteinander gehabt. Außer eben, dass sie vorübergehend in dieselbe Klasse gegangen sind. Du hast in dem betreffenden Jahr keine Elternabende in der Schule besucht. Du bist froh gewesen, mal außer der Reihe in Eibenstädt zu sein - statt bei diesem Bildungsträger im hohen Norden.“
Mahrong erinnerte sich, dass er damals über mehrere Monate berufliche Fortbildungen durchgeführt hatte. Für ein Institut in Hærvingskylpy, dem kleinen Städtchen und Erholungsort direkt an der Landesgrenze. Seine Eltern waren oft zu Besuch gekommen, um Juliane zu unterstützen. Und natürlich wegen der Jungs, wegen Jonathan und Wilfrido. Er verstand nicht, was Schmidt mit den Anspielungen bezweckte. Wollte sie um jeden Preis eine Verbindung zu ihm herstellen? Was hatten sie miteinander zu tun gehabt, das so lange zurücklag, dass er sich nicht mehr daran erinnerte? Oder wollte sie nur beachtet werden? Abends telefonierte er mit seinem Sohn in Krakau. Jonathan war überrascht, als er von der Sache mit Schmidt hörte:
„An eine Lucia kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Papa, ging die vielleicht in die Parallelklasse?“
*
Am Morgen des einunddreißigsten Januar fiel Eisregen vom grauen Himmel. Gehwege und Straßen in Eibenstädt waren unpassierbar. Mahrong sagte alle Termine ab und blieb zu Hause. Für den nächsten Tag plante er ebenfalls nichts. Er wollte abwarten, ob sich das Wetter hielt. Juliane machte einen Kurzurlaub in Spanien. Sie besuchte Wilfrido und dessen Freundin Rosaura in Mérida. Sie würde am Samstag wieder zurück sein, jetzt war es Dienstag. Mahrong nahm den dampfenden Kessel vom Herd und goss einen dünnen Strahl Wasser durch den Teefilter in die kleine Porzellankanne. Ostfriesenmischung. Heute Vormittag ließ er es ruhig angehen und widmete sich ganz der Vorbereitung seiner neuen Mission.
Vom Betreuungsamt hatte er nichts mehr gehört. Sechs Wochen waren seit seiner erfolgreichen Bewerbung vergangen. Obwohl es sich um einen offiziellen Vorgang handelte, besaß er keine schriftlichen Unterlagen darüber - außer der Einladung zum Gespräch. Warum dauerte es nur so lange, bis er den ersten Fall bekam? Alle wussten, dass er in den Startlöchern stand. Dass er den richtigen Biss hatte. Stagnierte in Eibenstädt die Nachfrage nach beruflichen Betreuern?
Auf dem Couchtisch lagen zahlreiche amtliche Broschüren sowie ein Handbuch zum Betreuungsrecht. Daneben stand das Notebook, weil er das eine oder andere googlen musste. In den verschiedenen Foren fand er interessante Berichte aus der Praxis. Er vertiefte sich in die Lektüre. Gelegentlich griff er zu einem der Mohnplätzchen in der Schale, zerkaute es genüsslich und trank einen großen Schluck Tee hinterher.
„Irgendwann werde ich für meine Nascherei die Quittung bekommen“, ging ihm beim Kauen durch den Kopf. „Habe ich mir jemals die Nährwerttabelle für gemahlenen Mohn angeschaut? Keineswegs! Ich habe nicht den leisesten Schimmer, was ich mir damit antue.“
Wie gewöhnlich blieben solche Gedankenspiele folgenlos. Im Gegenteil, sein Appetit wurde danach noch zügelloser. Aus Angst vor denkbaren Einschränkungen. Nachdem er das letzte Plätzchen verschlungen hatte, befasste er sich wieder mit seinem Lesestoff. Vor dem ersten Einsatz versuchte er die Welt der Betreuung theoretisch zu erfassen. Das Kribbeln im Bauch deutete er als ein Zeichen der Vorfreude. Vielleicht war es auch nur die Aufregung vor etwas Neuem. Denn je mehr er sich in die Materie einlas, desto verworrener wurden seine Vorstellungen von dem, was auf ihn zukommen würde. Theorie ohne Praxis war keine gute Vorbereitung. In beinahe philosophischer Anwandlung dachte er:
„Das ist wie Kraut und Rüben. Es fehlt die ordnende Kraft des Faktischen.“
5.
In der ersten Februarwoche wurde es milder. Von Glatteis keine Spur. Er hielt sich im nahegelegenen Lurchheim auf, um mit dem Inhaber einer Holzfachhandlung etwas zu besprechen. Sie hatten sich in den Konferenzraum im Verwaltungsgebäude zurückgezogen. Plötzlich klingelte Mahrongs Smartphone. Dass er es nicht abgestellt hatte, war kein Problem. Denn Laurenz Jühlink, so hieß sein Auftraggeber, stand immer in telefonischer Bereitschaft. Wenn es sich nicht vermeiden ließ, unterbrach er schon mal eine Unterredung. Jetzt nickte ihm der Geschäftsmann aufmunternd zu. Im Display wurde eine Weiterleitung aus seinem Büro angezeigt. Sollte er rangehen? Es gab doch den Anrufbeantworter. Die Neugier siegte:
„Praxis für Beratung, Bildung und Coaching. Philipp Mahrong. Hallo?“
„Loni Schmidt am Apparat. Herr Mahrong, störe ich gerade oder haben Sie einen kurzen Augenblick Zeit für mich? Herr Neumeyer und ich hatten vorhin ein längeres Gespräch. Dabei sind Sie uns wieder eingefallen. Es geht um Herrn Ottmar Kindler, für den dringend ein Betreuerwechsel ansteht. Kindler hat nämlich seinen Betreuer …“.
Sie gab schon wieder Vollgas.
“Moment mal, Frau Schmidt! Ich bin gerade in einer Besprechung mit einem Kunden. Das wird sich noch bis heute Nachmittag hinziehen. Können wir nicht später telefonieren? Nach sechzehn Uhr?“
„Ich bin auch gerade in vielen Gesprächen und habe gleich einen wichtigen Termin. Nachher ist es mir zu spät.“
Ihre Unverfrorenheit spottete jeder Beschreibung. Unschlüssig schaute er zu Jühlink, der mit der Hand auf einen kleinen Nebenraum wies. Mahrong ging dankend hinein, zog die Tür hinter sich zu und setze sich auf den Hocker neben dem Kopierer. Während er zuhörte, blickte er aus der kleinen Fensterluke vom zweiten Stock auf eine Grabreihe des Lurchheimer Stadtfriedhofs, der hinter einer Ligusterhecke an Jühlinks Firmengrundstück angrenzte. Wie unangenehm, mitten in der Arbeit so penetrant gestört zu werden.
*
Schmidt informierte ihn über einen ungewöhnlichen Klienten, für den ein neuer Betreuer gesucht wurde. Der Mann hatte vor zwei Jahren seine Lebensgefährtin im Krankenhaus besuchen wollen, die dort wegen eines Krebsleidens behandelt wurde. Leider musste er erfahren, dass sie kurz vorher an einem plötzlichen Herztod verstorben war. Die Klinikleitung hatte sich bereits mit den Angehörigen in Verbindung gesetzt. Die Eltern wollten ihre Tochter in die Gemeinde Moritzhain überführen lassen und im Familiengrab bestatten.
„Als Kindler das hörte, war alles zu spät. Seine Lebensgefährtin sollte unbedingt in Eibenstädt beerdigt werden. Allerdings gab es dazu keine schriftliche Erklärung der Verstorbenen und die Totensorge fiel den Eltern zu. Das kam bei Kindler nicht gut an. Ständig redete er von einer ‚kriminellen Entführung‘. Davor wollte er sie beschützen.“
„Wie bitte?“, fragte Mahrong.
„Also seine Freundin, oder, besser gesagt, die Leiche. Kindler war völlig durchgedreht. Stark angetrunken. Wahrscheinlich wusste er gar nicht, was er tat. Aber er hat richtig Randale auf der Station gemacht. Das muss total abartig gewesen sein. Die Polizei hat uns dazu geholt. Ich habe für Kindler eine Betreuung eingerichtet. Das ist anfangs auch gut gegangen. Nur hat Kindler dann seinen Betreuer, Herrn Ewald Kreiss, in der Bankfiliale tätlich angegriffen. Ihn ins Gesicht geboxt und mit voller Wucht ans Schienenbein und an den Oberschenkel getreten. Und dann noch angespuckt. Kreiss hat nicht aufgepasst. Der ist immer viel zu nachgiebig gewesen. Statt energischer aufzutreten: mit glasklaren Ansagen. Kindler braucht Orientierung! Ich habe diesen Quälgeist ja auch zweimal bei uns im Rathaus in seine Schranken verwiesen. Das hätten Sie mal sehen sollen! Kindler ist auf einmal zahm wie ein Lamm geworden. Ach, soweit ich weiß, hat er sich nach dem Auftritt im Krankenhaus nicht ein einziges Mal danach erkundigt, wo seine Lebensgefährtin beigesetzt wurde. Komisch, Kindler ist wohl nie an ihrer letzten Ruhestätte gewesen.“
Sie atmete einmal tief durch.
Mahrong bemühte sich, das Gehörte zu verarbeiten. Und schon setzte Schmidt ihre langatmige Einführung hastig fort:
„Naja, das ist nochmal gut gegangen! Kreiss war nur leicht verletzt, stand aber unter Schock. Er wollte deswegen nicht zum Arzt gehen, sondern fuhr mit dem Taxi nach Hause. Zwei sportliche, durchtrainierte Mitarbeiter der Bank haben Kindler beiseite gezerrt und im Pausenraum in Schach gehalten. Gegebenenfalls hätten sie die Polizei eingeschaltet. Weil er wieder ruhiger geworden ist, haben sie ihn ausnahmsweise gehen lassen. Aber an Hausverbot und Kontoauflösung ist er nicht vorbeigekommen. Gott sei Dank hat Kreiss auf eine Anzeige verzichtet. Dafür kann mir Kindler ewig dankbar sein.“
„Es hat keine Anzeige gegeben?“
„Herr Mahrong, dadurch ist uns eine Menge Ärger erspart geblieben. Aber lassen Sie mich bitte ausreden! Also, Kreiss wollte die Betreuung abgeben. Kindler zeigte sich reumütig. So etwas wie in der Bankfiliale würde nie wieder vorkommen. Er wollte keinen anderen Betreuer. Er hat Kreiss förmlich angefleht, weiterzumachen. Aber Kreiss ist stur geblieben. Für mich ist das eine übertriebene Haltung gewesen, denn die beiden haben sich vorher sehr gut verstanden. Vorher ist nichts Vergleichbares vorgefallen. Warum sollte sich die Zusammenarbeit nicht wieder einrenken lassen? Wir alle lernen dazu, auch ein Herr Kindler. Schließlich habe ich Kreiss doch noch überredet. Langsam hat er ja gewusst, worauf er achten muss.“
Sie machte wieder eine kurze Pause. Als wollte sie den letzten Satz doppelt unterstreichen. Mahrong versuchte die Flut dessen, was gerade auf ihn hereinbrach, wenigstens ansatzweise zu strukturieren. Weit kam er damit nicht. Schmidt ging jetzt auf den aktuellen Sachstand ein:
„Inzwischen will Kindler einen neuen Betreuer. Er beschwert sich ständig: Kreiss soll bei ihm Schulden gemacht haben, die er nicht zurückzahlen will. Angeblich geht es um sehr viel Geld. Kindler behauptet, dass Kreiss ihn mehrmals geschlagen hat. Das ist absurd! Kompletter Blödsinn! Jetzt hat Kreiss zu guter Letzt doch noch die Entlassung beantragt. Und ich soll Ihnen von Herrn Neumeyer sagen: Ihm tut es unendlich leid, dass wir Ihnen einen Fall antragen, der mit Gewalt zu tun hatte. Mir übrigens auch.“
Ihre Stimme nahm einen weinerlichen Klang an. Er hätte ihr diese zarte Facette niemals zugetraut. Enttarnte sich Schmidt gerade als Gefühlsmensch?
„Wir haben keinen, der das machen kann. Alle, die dafür in Frage kommen, sind gerade voll ausgelastet. Aber der Herr Neumeyer und ich, wie auch alle anderen bei uns im Amt, also wir halten Sie für geeignet, dass Sie die Betreuung von Herrn Kindler übernehmen. Wir trauen Ihnen das zu, Herr Mahrong. Und wir helfen Ihnen natürlich, besonders jetzt am Anfang.“
Diese Beredsamkeit war bemerkenswert. Mahrong fragte kurz nach einigen Details, die für ihn wichtig waren. Daraus ergab sich für ihn folgendes Bild:
Kindler hatte fast sechsundzwanzig Jahre seinen Beruf als Feinmechaniker ausgeübt und war nach der Entlassung aus einem kleinen Eibenstädter Familienunternehmen immer mehr abgerutscht. Am Anfang zehrte er von seinem gar nicht so geringen Vermögen. Eine Zeitlang lebte er auf großem Fuß und ließ es richtig krachen. Dabei geriet er immer wieder in Streitereien, die auch mal in Handgreiflichkeiten ausarteten: gegen eine Taxifahrerin, gegen einen Aufseher in einer Spielhalle und gegen einen Kellner in einem Gartenlokal. Als er einmal mit 3,4 Promille und einem Nasenbeinbruch in ein Krankenhaus eingeliefert wurde, schlug er so wild um sich, dass ihn die Pfleger nur mit größter Mühe bändigen konnten. Kindler war bei der örtlichen Polizei bekannt. Nachdem er alles mit vollen Händen ausgegeben hatte, war er auf Hilfe angewiesen.
Seit dem Vorfall mit Kreiss hatte es offiziell keine Gewalttätigkeiten mehr gegeben. Das war für Mahrong entscheidend.
„Ich mache das, um endlich mal loszulegen. Obwohl ich ja genau bei körperlicher Gewalt die Trennlinie gezogen habe.“
Schweigen am anderen Ende.