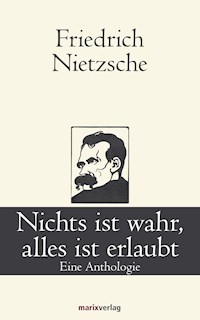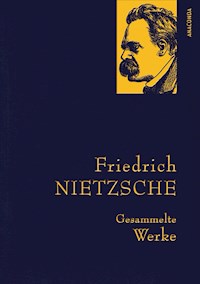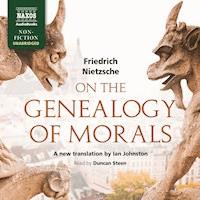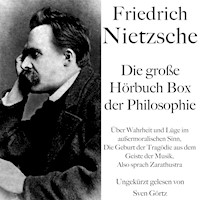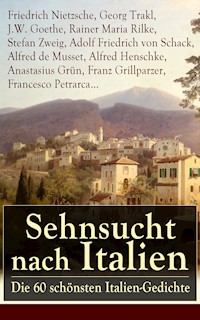Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die fröhliche Wissenschaft (später mit dem Untertitel "la gaya scienza") ist ein zuerst 1882 erschienenes, 1887 ergänztes Werk Friedrich Nietzsches. Das Buch enthält Gedanken zu unterschiedlichsten Themen in fast 400 Aphorismen verschiedener Länge. Es gilt als abschließendes Werk der "freigeistigen" Periode Nietzsches, das gleichzeitig die neue Stimmung des nachfolgenden Also sprach Zarathustra ankündigt. (aus wikipedia.de)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 397
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die fröhliche Wissenschaft.
Friedrich Nietzsche
Inhalt:
Friedrich Nietzsche – Biografie und Bibliografie
Die fröhliche Wissenschaft.
Vorrede zur zweiten Ausgabe.
“Scherz, List und Rache.” Vorspiel in deutschen Reimen.
Erstes Buch.
Zweites Buch.
Drittes Buch.
Viertes Buch.
Fünftes Buch.
Anhang: Lieder des Prinzen Vogelfrei.
Die fröhliche Wissenschaft, Friedrich Nietzsche
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849616267
www.jazzybee-verlag.de
Friedrich Nietzsche – Biografie und Bibliografie
Namhafter philosophischer Schriftsteller, geb. 15. Okt. 1844 in Röcken bei Lützen, gest. 25. Aug. 1900 in Weimar, war der Sohn eines Pfarrers, der zeitig starb, wurde von seiner Mutter in Naumburg a. S. erzogen, besuchte die Landesschule Pforta und studierte von 1864–67 in Bonn und Leipzig klassische Philologie. Frühreif, ein bevorzugter Schüler Ritschls, erhielt er noch vor seiner Promotion (1869) einen Ruf als außerordentlicher Professor der klassischen Philologie an die Universität Basel, wurde 1870 schon ordentlicher Professor daselbst, welche Stellung er bis 1870 bekleidete. In diesem Jahre nötigte ihn ein schweres Augenleiden, verbunden mit Überreizung des Gehirns, sein Amt aufzugeben, nachdem er schon den Winter 1876/77 in Sorrent zugebracht hatte. Von da ab führte er, beständig schriftstellerisch äußerst tätig, ein Wanderleben, hielt sich mit Vorliebe in Venedig, in der Schweiz, in Turin, Genua, Nizza, bisweilen auch in Leipzig und Naumburg auf, bis er im Frühjahr 1889 in Turin nach übermäßiger geistiger Anstrengung und zu starkem Gebrauch von Schlafmitteln geisteskrank wurde. Kürzere Zeit brachte er in der Heilanstalt in Jena zu, wo ihm keine Genesung wurde; dann lebte er wieder bei seiner Mutter in Naumburg und nach deren Tode in treuester Pflege seiner Schwester zu Weimar in einer oberhalb der Stadt gelegenen Villa, wo sich jetzt das Nietzsche-Archiv befindet (vgl. Kühn, Das Nietzsche-Archiv zu Weimar, Darmst. 1904). Mit Rich. Wagner war er längere Jahre eng befreundet, brach aber den Verkehr später mit ihm hauptsächlich wegen dessen religiösen Ansichten ab. Im persönlichen Umgange sehr gewinnend, aber doch die Einsamkeit liebend, ging er in seinen Schriften schonungslos gegen alles ihm nicht Gefallende vor. Als Stilist ist er in der Gegenwart unübertroffen, seine Sprache hat oft einen geradezu bestrickenden Zauber, und ihr ist zum Teil die große Wirkung seiner Werke zuzuschreiben.
Seine schriftstellerische Laufbahn begann N. mit kürzern philologischen Arbeiten über Theognis und Diogenes Laertius, aber schon in seiner ersten größern Schrift: »Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik« (Leipz. 1872), wandte er sich von der rein philologischen Methode ab, indem er sich von allgemeinen philosophischen und künstlerischen Anschauungen, namentlich solchen Schopenhauers u. Wagners, leiten ließ. Derselben Richtung folgt er auch, zugleich ein deutsches Kulturideal anstrebend'. in den »Unzeitgemäßen Betrachtungen« (4 Stücke, Leipz. 1873–76), verläßt sie aber in seinen weitern aphoristischen Werken: »Menschliches, Allzumenschliches. Ein Buch für freie Geister« (Chemn. 1878–80, 3 Tle.); »Morgenröte. Gedanken über moralische Vorurteile« (das. 1881); »Die fröhliche Wissenschaft« (das. 1882), wo der Glaube an Ideale preisgegeben, der Mensch als reines Naturprodukt betrachtet wird, auch die Sittlichkeit sich mit ihren Gesetzen nicht von höhern Mächten oder der allgemeinen Vernunft, sondern aus den natürlichen Trieben der Menschen herleiten soll. So hatte N. mit aller sittlichen und religiösen Tradition gebrochen, war nicht mehr an Vorurteile, nicht mehr an die sogen. ewigen Gesetze der Vernunft gebunden, namentlich nicht an die christliche Welt- und Lebensanschauung, von der diese unsre Welt im Gegensatz zu einer erdichteten jenseitigen mißachtet werde, bei der die natürlichen Triebe des Menschen nicht zu ihrem Rechte kämen, aber die Schwäche der Unterwerfung für das Höhere gelte. Der Mensch muß nach N. seine Instinkte möglichst befriedigen, sich selbst zum Zweck seines Daseins setzen, diesen nicht außer sich, nicht in selbstlosen Handlungen suchen, er muß sich selbst leben, den Willen zur Macht, den er hat, möglichst zur Erfüllung bringen, die Tugenden nicht über sich stellen, nicht ihnen dienen, sie vielmehr als sein Machwerk betrachten. So zeichnet N. die Gestalt des Übermenschen, der nur sich selbst will und sich seine Welt gewinnt, für den nur gut ist, was er will, der weltfreudig und stark ist in seinem Wollen und alles, was sich ihm entgegenstellt, niederwirft, nichts von Ergebung weiß, nichts von Mitleid, das nur die Tugend des Schwachen ist. Nicht alle können gleiche Macht und gleichen Genuß haben, nur gemäß ihrer verschiedenen Stärke können die einzelnen das Ziel des Menschen erreichen; deshalb gibt es auch nicht gleiche Rechte für alle Menschen: der Starke hat das Recht, der Schwache muß ihm zur Erreichung seiner Ziele dienen. Diese Gedanken sind ausgeführt in. »Also sprach Zarathustra« (1.–3. Teil, Chemn. 1883 bis 1884; 4. Teil, Leipz. 1891); »Jenseits von Gut und Böse. Vorspiel zu einer Philosophie der Zukunft« (Leipz. 1886); »Zur Genealogie der Moral« (das. 1887); »Der Fall Wagner« (das. 1888); »Götzendämmerung oder Wie man mit dem Hammer philosophiert« (das. 1889). Alle diese Werke sind in einer Reihe von Auflagen erschienen. Von »Also sprach Zarathustra« sind schon 50,000 Exemplare gedruckt. Von der Gesamtausgabe der »Werke« Nietzsches enthält die erste Abteilung (Leipz. 1895, 8 Bde.) das von N. selbst Veröffentlichte und außerdem: »N. contra Wagner«, »Der Antichrist. Versuch einer Kritik des Christentums« und »Gedichte«. Eine 1893 schon begonnene (von Peter Gast) mußte nach Ausgabe von 5 Bänden abgebrochen werden. Der »Antichrist« ist das erste Buch des nicht vollendeten philosophischen Hauptwerkes Nietzsches: »Der Wille zur Macht. Versuch einer Umwertung aller Werte«, dessen unvollendete weitere drei Bücher den Titel haben: »Der freie Geist. Kritik der Philosophie als einer nihilistischen Bewegung«, »Der Immoralist. Kritik der verhängnisvollsten Art von Unwissenheit der Moral«, »Dionysos, Philosophie der ewigen Wiederkunft«. Von der ersten Abteilung der Werke ist 1899 auch eine Ausgabe in kleinerm Format erschienen. Die zweite Abteilung der Gesamtausgabe ist in 7 Bänden 1901–04 erschienen und enthält aus den ungedruckten Papieren Nietzsches die unvollendeten Schriften und Fragmente, Entwürfe, Nachträge und Aphorismen. Übersetzungen der ersten Abteilung der gesamten Schriften ins Englische und Französische erschienen in London 1897 ff. und Paris 1899 ff. Von Nietzsches gesammelten Briefen sind 3 Bände veröffentlicht worden (Berl. u. Leipz. 1900–05), besonders wichtig sind die an Erwin Rhode und Malvida v. Meysenbug. Das »Leben Fr. Nietzsches« ist von seiner Schwester Elisabeth Förster-Nietzsche (Leipz. 1895 bis 1904, 2 Bde.) geschrieben. Das Werk enthält auch viele Briefe und Aufzeichnungen Nietzsches. Sein Bildnis s. Tafel »Deutsche Philosophen II«.
Die Nietzscheschen Ansichten haben viele Gegner gefunden, wie dies bei dem vielen Paradoxen und Umstürzenden in ihnen natürlich, anderseits auch viele Freunde besonders in der jüngern Generation, in dieser zum Teil wegen der Zersetzung des Traditionellen. Im ganzen hat die Verehrung Nietzsches nach seinem Tod eher noch zu-als abgenommen; namentlich hat sein »Zarathustra« große Verbreitung und Bewunderung erfahren. Man fängt an, das dauernd Wertvolle bei N., namentlich sein Streben nach einer höhern Kultur und seinen Individualismus anzuerkennen und betont, daß N. selbst eine vornehme reine Natur voller Ideale war, und daß niedriger Egoismus in seiner Lehre keine Stelle findet. Manche seiner Ansichten freilich, so die von ihm selbst hochbewertete von der ewigen Wiederkunft des Gleichen, finden wenig Anerkennung. Infolge der verschiedenen Stellung zu N. ist eine große Reihe von Schriften und Abhandlungen über ihn, gegen ihn und für ihn erschienen, von denen hier nur die wichtigsten genannt sein mögen: O. Hansson, Friedrich N. (Leipz. 1890); Kaatz, Die Weltanschauung Fr. Nietzsches (Dresd. 1892–93, 2 Tle.; 2. Aufl. 1898); L. Stein, Fr. Nietzsches Weltanschauung und ihre Gefahren (Berl. 1893); Andreas-Salomé, Friedr. N. in seinen Werken (Wien 1894); Steiner, Friedr. N., ein Kämpfer gegen seine Zeit (Weim. 1895); Meta v. Salis-Marschlins, Philosoph und Edelmensch (Leipz. 1897); Th. Ziegler, Friedr. N. (Berl. 1900); Schellwien, Max Stirner und Friedr. N., Erscheinungen des modernen Geistes und das Wesen des Menschen (Leipz. 1892); Alex. Tille, Von Darwin bis N. Ein Buch Entwickelungsethik (das. 1895); Riehl, Fr. N. der Künstler und der Denker (Stuttg. 1897, 3. Aufl. 1901); Deussen, Erinnerungen an F. N. (Leipz. 1901); Vaihinger, N. als Philosoph (Berl. 1902, 3. Aufl. 1905); Richter, F. N. Sein Leben und sein Werk (Leipz. 1903); Ewald, Nietzsches Lehre in ihren Grundbegriffen (Berl. 1903); Drews, Nietzsches Philosophie (Heidelb. 1904); Lichtenberger, La philosophie de Fr. N. (Par. 1898, 6. Aufl. 1901; deutsch, 2. Aufl., Dresd.1900); J. de Gaultier, De Kant à N. (2. Aufl., Par. 1900) und N. et la réforme philosophique (das. 1905); Seillière, Apollon ou Dionysos. Étude critique sur F. N. (das. 1905; deutsch, Berl. 1905); Zoccoli, Federico N. La filosofia religiosa, la morale, l'estetica (Modena 1898, 2.Aufl. 1901); Orestano, Le idee fondamentali di Fed. N. (Palermo 1903).
Die fröhliche Wissenschaft.
Vorrede zur zweiten Ausgabe.
1.
Diesem Buche thut vielleicht nicht nur Eine Vorrede noth; und zuletzt bliebe immer noch der Zweifel bestehn, ob Jemand, ohne etwas Aehnliches erlebt zu haben, dem Erlebnisse dieses Buchs durch Vorreden näher gebracht werden kann. Es scheint in der Sprache des Thauwinds geschrieben: es ist Uebermuth, Unruhe, Widerspruch, Aprilwetter darin, so dass man beständig ebenso an die Nähe des Winters als an den Sieg über den Winter gemahnt wird, der kommt, kommen muss, vielleicht schon gekommen ist… Die Dankbarkeit strömt fortwährend aus, als ob eben das Unerwartetste geschehn sei, die Dankbarkeit eines Genesenden, — denn die Genesung war dieses Unerwartetste. „Fröhliche Wissenschaft“: das bedeutet die Saturnalien eines Geistes, der einem furchtbaren langen Drucke geduldig widerstanden hat — geduldig, streng, kalt, ohne sich zu unterwerfen, aber ohne Hoffnung —, und der jetzt mit Einem Male von der Hoffnung angefallen wird, von der Hoffnung auf Gesundheit, von der Trunkenheit der Genesung. Was Wunders, dass dabei viel Unvernünftiges und Närrisches an’s Licht kommt, viel muthwillige Zärtlichkeit, selbst auf Probleme verschwendet, die ein stachlichtes Fell haben und nicht darnach angethan sind, geliebkost und gelockt zu werden. Dies ganze Buch ist eben Nichts als eine Lustbarkeit nach langer Entbehrung und Ohnmacht, das Frohlocken der wiederkehrenden Kraft, des neu erwachten Glaubens an ein Morgen und Uebermorgen, des plötzlichen Gefühls und Vorgefühls von Zukunft, von nahen Abenteuern, von wieder offenen Meeren, von wieder erlaubten, wieder geglaubten Zielen. Und was lag nunmehr Alles hinter mir! Dieses Stück Wüste, Erschöpfung, Unglaube, Vereisung mitten in der Jugend, dieses eingeschaltete Greisenthum an unrechter Stelle, diese Tyrannei des Schmerzes überboten noch durch die Tyrannei des Stolzes, der die Folgerungen des Schmerzes ablehnte — und Folgerungen sind Tröstungen —, diese radikale Vereinsamung als Nothwehr gegen eine krankhaft hellseherisch gewordene Menschenverachtung, diese grundsätzliche Einschränkung auf das Bittere, Herbe, Wehethuende der Erkenntniss, wie sie der Ekel verordnete, der aus einer unvorsichtigen geistigen Diät und Verwöhnung — man heisst sie Romantik — allmählich gewachsen war —, oh wer mir das Alles nachfühlen könnte! Wer es aber könnte, würde mir sicher noch mehr zu Gute halten als etwas Thorheit, Ausgelassenheit, „fröhliche Wissenschaft“, — zum Beispiel die Handvoll Lieder, welche dem Buche dies Mal beigegeben sind — Lieder, in denen sich ein Dichter auf eine schwer verzeihliche Weise über alle Dichter lustig macht. — Ach, es sind nicht nur die Dichter und ihre schönen „lyrischen Gefühle“, an denen dieser Wieder-Erstandene seine Bosheit auslassen muss: wer weiss, was für ein Opfer er sich sucht, was für ein Unthier von parodischem Stoff ihn in Kürze reizen wird? „Incipit tragoedia“ — heisst es am Schlusse dieses bedenklich-unbedenklichen Buchs: man sei auf seiner Hut! Irgend etwas ausbündig Schlimmes und Boshaftes kündigt sich an: incipit parodia, es ist kein Zweifel…
2.
— Aber lassen wir Herrn Nietzsche: was geht es uns an, dass Herr Nietzsche wieder gesund wurde?… Ein Psychologe kennt wenig so anziehende Fragen, wie die nach dem Verhältniss von Gesundheit und Philosophie, und für den Fall, dass er selber krank wird, bringt er seine ganze wissenschaftliche Neugierde mit in seine Krankheit. Man hat nämlich, vorausgesetzt, dass man eine Person ist, nothwendig auch die Philosophie seiner Person: doch giebt es da einen erheblichen Unterschied. Bei dem Einen sind es seine Mängel, welche philosophiren, bei dem Andern seine Reichthümer und Kräfte. Ersterer hat seine Philosophie nöthig, sei es als Halt, Beruhigung, Arznei, Erlösung, Erhebung, Selbstentfremdung; bei Letzterem ist sie nur ein schöner Luxus, im besten Falle die Wollust einer triumphirenden Dankbarkeit, welche sich zuletzt noch in kosmischen Majuskeln an den Himmel der Begriffe schreiben muss. Im andren, gewöhnlicheren Falle aber, wenn die Nothstände Philosophie treiben, wie bei allen kranken Denkern — und vielleicht überwiegen die kranken Denker in der Geschichte der Philosophie —: was wird aus dem Gedanken selbst werden, der unter den Druck der Krankheit gebracht wird? Dies ist die Frage, die den Psychologen angeht: und hier ist das Experiment möglich. Nicht anders als es ein Reisender macht, der sich vorsetzt, zu einer bestimmten Stunde aufzuwachen und sich dann ruhig dem Schlafe überlässt: so ergeben wir Philosophen, gesetzt, dass wir krank werden, uns zeitweilig mit Leib und Seele der Krankheit — wir machen gleichsam vor uns die Augen zu. Und wie Jener weiss, dass irgend Etwas nicht schläft, irgend Etwas die Stunden abzählt und ihn aufwecken wird, so wissen auch wir, dass der entscheidende Augenblick uns wach finden wird, — dass dann Etwas hervorspringt und den Geist auf der That ertappt, ich meine auf der Schwäche oder Umkehr oder Ergebung oder Verhärtung oder Verdüsterung und wie alle die krankhaften Zustände des Geistes heissen, welche in gesunden Tagen den Stolz des Geistes wider sich haben (denn es bleibt bei dem alten Reime „der stolze Geist, der Pfau, das Pferd sind die drei stölzesten Thier’ auf der Erd“ —). Man lernt nach einer derartigen Selbst-Befragung, Selbst-Versuchung, mit einem feineren Auge nach Allem, was überhaupt bisher philosophirt worden ist, hinsehn; man erräth besser als vorher die unwillkürlichen Abwege, Seitengassen, Ruhestellen, Sonnenstellen des Gedankens, auf die leidende Denker gerade als Leidende geführt und verführt werden, man weiss nunmehr, wohin unbewusst der kranke Leib und sein Bedürfniss den Geist drängt, stösst, lockt — nach Sonne, Stille, Milde, Geduld, Arznei, Labsal in irgend einem Sinne. Jede Philosophie, welche den Frieden höher stellt als den Krieg, jede Ethik mit einer negativen Fassung des Begriffs Glück, jede Metaphysik und Physik, welche ein Finale kennt, einen Endzustand irgend welcher Art, jedes vorwiegend aesthetische oder religiöse Verlangen nach einem Abseits, Jenseits, Ausserhalb, Oberhalb erlaubt zu fragen, ob nicht die Krankheit das gewesen ist, was den Philosophen inspirirt hat. Die unbewusste Verkleidung physiologischer Bedürfnisse unter die Mäntel des Objektiven, Ideellen, Rein-Geistigen geht bis zum Erschrecken weit, — und oft genug habe ich mich gefragt, ob nicht, im Grossen gerechnet, Philosophie bisher überhaupt nur eine Auslegung des Leibes und ein Missverständniss des Leibes gewesen ist. Hinter den höchsten Werthurtheilen, von denen bisher die Geschichte des Gedankens geleitet wurde, liegen Missverständnisse der leiblichen Beschaffenheit verborgen, sei es von Einzelnen, sei es von Ständen oder ganzen Rassen. Man darf alle jene kühnen Tollheiten der Metaphysik, sonderlich deren Antworten auf die Frage nach dem Werth des Daseins, zunächst immer als Symptome bestimmter Leiber ansehn; und wenn derartigen Welt-Bejahungen oder Welt-Verneinungen in Bausch und Bogen, wissenschaftlich gemessen, nicht ein Korn von Bedeutung innewohnt, so geben sie doch dem Historiker und Psychologen um so werthvollere Winke, als Symptome, wie gesagt, des Leibes, seines Gerathens und Missrathens, seiner Fülle, Mächtigkeit, Selbstherrlichkeit in der Geschichte, oder aber seiner Hemmungen, Ermüdungen, Verarmungen, seines Vorgefühls vom Ende, seines Willens zum Ende. Ich erwarte immer noch, dass ein philosophischer Arzt im ausnahmsweisen Sinne des Wortes — ein Solcher, der dem Problem der Gesammt-Gesundheit von Volk, Zeit, Rasse, Menschheit nachzugehn hat — einmal den Muth haben wird, meinen Verdacht auf die Spitze zu bringen und den Satz zu wagen: bei allem Philosophiren handelte es sich bisher gar nicht um „Wahrheit“, sondern um etwas Anderes, sagen wir um Gesundheit, Zukunft, Wachsthum, Macht, Leben…
3.
— Man erräth, dass ich nicht mit Undankbarkeit von jener Zeit schweren Siechthums Abschied nehmen möchte, deren Gewinn auch heute noch nicht für mich ausgeschöpft ist: so wie ich mir gut genug bewusst bin, was ich überhaupt in meiner wechselreichen Gesundheit vor allen Vierschrötigen des Geistes voraus habe. Ein Philosoph, der den Gang durch viele Gesundheiten gemacht hat und immer wieder macht, ist auch durch ebensoviele Philosophien hindurchgegangen: er kann eben nicht anders als seinen Zustand jedes Mal in die geistigste Form und Ferne umzusetzen, — diese Kunst der Transfiguration ist eben Philosophie. Es steht uns Philosophen nicht frei, zwischen Seele und Leib zu trennen, wie das Volk trennt, es steht uns noch weniger frei, zwischen Seele und Geist zu trennen. Wir sind keine denkenden Frösche, keine Objektivir- und Registrir-Apparate mit kalt gestellten Eingeweiden, — wir müssen beständig unsre Gedanken aus unsrem Schmerz gebären und mütterlich ihnen Alles mitgeben, was wir von Blut, Herz, Feuer, Lust, Leidenschaft, Qual, Gewissen, Schicksal, Verhängniss in uns haben. Leben — das heisst für uns Alles, was wir sind, beständig in Licht und Flamme verwandeln, auch Alles, was uns trifft, wir können gar nicht anders. Und was die Krankheit angeht: würden wir nicht fast zu fragen versucht sein, ob sie uns überhaupt entbehrlich ist? Erst der grosse Schmerz ist der letzte Befreier des Geistes, als der Lehrmeister des grossen Verdachtes, der aus jedem U ein X macht, ein ächtes rechtes X, das heisst den vorletzten Buchstaben vor dem letzten… Erst der grosse Schmerz, jener lange langsame Schmerz, der sich Zeit nimmt, in dem wir gleichsam wie mit grünem Holze verbrannt werden, zwingt uns Philosophen, in unsre letzte Tiefe zu steigen und alles Vertrauen, alles Gutmüthige, Verschleiernde, Milde, Mittlere, wohinein wir vielleicht vordem unsre Menschlichkeit gesetzt haben, von uns zu thun. Ich zweifle, ob ein solcher Schmerz „verbessert“ —; aber ich weiss, dass er uns vertieft. Sei es nun, dass wir ihm unsern Stolz, unsern Hohn, unsre Willenskraft entgegenstellen lernen und es dem Indianer gleichthun, der, wie schlimm auch gepeinigt, sich an seinem Peiniger durch die Bosheit seiner Zunge schadlos hält; sei es, dass wir uns vor dem Schmerz in jenes orientalische Nichts zurückziehn — man heisst es Nirvana —, in das stumme, starre, taube Sich-Ergeben, Sich-Vergessen, Sich-Auslöschen: man kommt aus solchen langen gefährlichen Uebungen der Herrschaft über sich als ein andrer Mensch heraus, mit einigen Fragezeichen mehr, vor Allem mit dem Willen, fürderhin mehr, tiefer, strenger, härter, böser, stiller zu fragen als man bis dahin gefragt hatte. Das Vertrauen zum Leben ist dahin: das Leben selbst wurde zum Problem. — Möge man ja nicht glauben, dass Einer damit nothwendig zum Düsterling geworden sei! Selbst die Liebe zum Leben ist noch möglich, — nur liebt man anders. Es ist die Liebe zu einem Weibe, das uns Zweifel macht… Der Reiz alles Problematischen, die Freude am X ist aber bei solchen geistigeren, vergeistigteren Menschen zu gross, als dass diese Freude nicht immer wieder wie eine helle Gluth über alle Noth des Problematischen, über alle Gefahr der Unsicherheit, selbst über die Eifersucht des Liebenden zusammenschlüge. Wir kennen ein neues Glück…
4.
Zuletzt, dass das Wesentlichste nicht ungesagt bleibe: man kommt aus solchen Abgründen, aus solchem schweren Siechthum, auch aus dem Siechthum des schweren Verdachts, neugeboren zurück, gehäutet, kitzlicher, boshafter, mit einem feineren Geschmacke für die Freude, mit einer zarteren Zunge für alle guten Dinge, mit lustigeren Sinnen, mit einer zweiten gefährlicheren Unschuld in der Freude, kindlicher zugleich und hundert Mal raffinirter als man jemals vorher gewesen war. Oh wie Einem nunmehr der Genuss zuwider ist, der grobe dumpfe braune Genuss, wie ihn sonst die Geniessenden, unsre „Gebildeten“, unsre Reichen und Regierenden verstehn! Wie boshaft wir nunmehr dem grossen Jahrmarkts-Bumbum zuhören, mit dem sich der „gebildete Mensch“ und Grossstädter heute durch Kunst, Buch und Musik zu „geistigen Genüssen“, unter Mithülfe geistiger Getränke, nothzüchtigen lässt! Wie uns jetzt der Theater-Schrei der Leidenschaft in den Ohren weh thut, wie unsrem Geschmacke der ganze romantische Aufruhr und Sinnen-Wirrwarr, den der gebildete Pöbel liebt, sammt seinen Aspirationen nach dem Erhabenen, Gehobenen, Verschrobenen fremd geworden ist! Nein, wenn wir Genesenden überhaupt eine Kunst noch brauchen, so ist es eine andre Kunst — eine spöttische, leichte, flüchtige, göttlich unbehelligte, göttlich künstliche Kunst, welche wie eine helle Flamme in einen unbewölkten Himmel hineinlodert! Vor Allem: eine Kunst für Künstler, nur für Künstler! Wir verstehn uns hinterdrein besser auf Das, was dazu zuerst noth thut, die Heiterkeit, jede Heiterkeit, meine Freunde! auch als Künstler —: ich möchte es beweisen. Wir wissen Einiges jetzt zu gut, wir Wissenden: oh wie wir nunmehr lernen, gut zu vergessen, gut nicht-zu-wissen, als Künstler! Und was unsere Zukunft betrifft: man wird uns schwerlich wieder auf den Pfaden jener ägyptischen Jünglinge finden, welche Nachts Tempel unsicher machen, Bildsäulen umarmen und durchaus Alles, was mit guten Gründen verdeckt gehalten wird, entschleiern, aufdecken, in helles Licht stellen wollen. Nein, dieser schlechte Geschmack, dieser Wille zur Wahrheit, zur „Wahrheit um jeden Preis“, dieser Jünglings-Wahnsinn in der Liebe zur Wahrheit — ist uns verleidet: dazu sind wir zu erfahren, zu ernst, zu lustig, zu gebrannt, zu tief… Wir glauben nicht mehr daran, dass Wahrheit noch Wahrheit bleibt, wenn man ihr die Schleier abzieht; wir haben genug gelebt, um dies zu glauben. Heute gilt es uns als eine Sache der Schicklichkeit, dass man nicht Alles nackt sehn, nicht bei Allem dabei sein, nicht Alles verstehn und „wissen“ wolle. „Ist es wahr, dass der liebe Gott überall zugegen ist?“ fragte ein kleines Mädchen seine Mutter: „aber ich finde das unanständig“ — ein Wink für Philosophen! Man sollte die Scham besser in Ehren halten, mit der sich die Natur hinter Räthsel und bunte Ungewissheiten versteckt hat. Vielleicht ist die Wahrheit ein Weib, das Gründe hat, ihre Gründe nicht sehn zu lassen? Vielleicht ist ihr Name, griechisch zu reden, Baubo?… Oh diese Griechen! Sie verstanden sich darauf, zu leben: dazu thut Noth, tapfer bei der Oberfläche, der Falte, der Haut stehen zu bleiben, den Schein anzubeten, an Formen, an Töne, an Worte, an den ganzen Olymp des Scheins zu glauben! Diese Griechen waren oberflächlich — aus Tiefe! Und kommen wir nicht eben darauf zurück, wir Wagehalse des Geistes, die wir die höchste und gefährlichste Spitze des gegenwärtigen Gedankens erklettert und uns von da aus umgesehn haben, die wir von da aus hinabgesehn haben? Sind wir nicht eben darin — Griechen? Anbeter der Formen, der Töne, der Worte? Eben darum — Künstler?
Ruta bei Genua,
im Herbst 1886.
“Scherz, List und Rache.” Vorspiel in deutschen Reimen.
1. Einladung.
Wagt’s mit meiner Kost, ihr Esser!
Morgen schmeckt sie euch schon besser
Und schon übermorgen gut!
Wollt ihr dann noch mehr, — so machen
Meine alten sieben Sachen
Mir zu sieben neuen Muth.
2. Mein Glück.
Seit ich des Suchens müde ward,
Erlernte ich das Finden.
Seit mir ein Wind hielt Widerpart,
Segl’ ich mit allen Winden.
3. Unverzagt.
Wo du stehst, grab tief hinein!
Drunten ist die Quelle!
Lass die dunklen Männer schrein:
„Stets ist drunten — Hölle!“
4. Zwiegespräch.
A. War ich krank? Bin ich genesen?
Und wer ist mein Arzt gewesen?
Wie vergass ich alles Das!
B. Jetzt erst glaub ich dich genesen:
Denn gesund ist, wer vergass.
5. An die Tugendsamen.
Unseren Tugenden auch soll’n leicht die Füsse sich heben:
Gleich den Versen Homer’s müssen sie kommen und gehn!
6. Welt-Klugheit.
Bleib nicht auf ebnem Feld!
Steig nicht zu hoch hinaus!
Am schönsten sieht die Welt
Von halber Höhe aus.
7. Vademecum — Vadetecum.
Es lockt dich meine Art und Sprach,
Du folgest mir, du gehst mir nach?
Geh nur dir selber treulich nach: —
So folgst du mir — gemach! gemach!
8. Bei der dritten Häutung.
Schon krümmt und bricht sich mir die Haut,
Schon giert mit neuem Drange,
So viel sie Erde schon verdaut,
Nach Erd’ in mir die Schlange.
Schon kriech’ ich zwischen Stein und Gras
Hungrig auf krummer Fährte,
Zu essen Das, was stets ich ass,
Dich, Schlangenkost, dich, Erde!
9. Meine Rosen.
Ja! Mein Glück — es will beglücken —,
Alles Glück will ja beglücken!
Wollt ihr meine Rosen pflücken?
Müsst euch bücken und verstecken
Zwischen Fels und Dornenhecken,
Oft die Fingerchen euch lecken!
Denn mein Glück — es liebt das Necken!
Denn mein Glück — es liebt die Tücken! —
Wollt ihr meine Rosen pflücken?
10. Der Verächter.
Vieles lass ich fall’n und rollen,
Und ihr nennt mich drum Verächter.
Wer da trinkt aus allzuvollen
Bechern, lässt viel fall’n und rollen —,
Denkt vom Weine drum nicht schlechter.
11. Das Sprüchwort spricht.
Scharf und milde, grob und fein,
Vertraut und seltsam, schmutzig und rein,
Der Narren und Weisen Stelldichein:
Diess Alles bin ich, will ich sein,
Taube zugleich, Schlange und Schwein!
12. An einen Lichtfreund.
Willst du nicht Aug’ und Sinn ermatten,
Lauf’ auch der Sonne nach im Schatten!
13. Für Tänzer.
Glattes Eis
Ein Paradeis
Für Den, der gut zu tanzen weiss.
14. Der Brave.
Lieber aus ganzem Holz eine Feindschaft,
Als eine geleimte Freundschaft!
15. Rost.
Auch Rost thut Noth: Scharfsein ist nicht genung!
Sonst sagt man stets von dir: „er ist zu jung!“
16. Aufwärts.
„Wie komm ich am besten den Berg hinan?“
Steig nur hinauf und denk nicht dran!
17. Spruch des Gewaltmenschen.
Bitte nie! Lass diess Gewimmer!
Nimm, ich bitte dich, nimm immer!
18. Schmale Seelen.
Schmale Seelen sind mir verhasst;
Da steht nichts Gutes, nichts Böses fast.
19. Der unfreiwillige Verführer.
Er schoss ein leeres Wort zum Zeitvertreib
In’s Blaue — und doch fiel darob ein Weib.
20. Zur Erwägung.
Zwiefacher Schmerz ist leichter zu tragen,
Als Ein Schmerz: willst du darauf es wagen?
21. Gegen die Hoffahrt.
Blas dich nicht auf: sonst bringet dich
Zum Platzen schon ein kleiner Stich.
22. Mann und Weib.
„Raub dir das Weib, für das dein Herze fühlt!“ —
So denkt der Mann; das Weib raubt nicht, es stiehlt.
23. Interpretation.
Leg ich mich aus, so leg ich mich hinein:
Ich kann nicht selbst mein Interprete sein.
Doch wer nur steigt auf seiner eignen Bahn,
Trägt auch mein Bild zu hellerm Licht hinan.
24. Pessimisten-Arznei.
Du klagst, dass Nichts dir schmackhaft sei?
Noch immer, Freund, die alten Mucken?
Ich hör dich lästern, lärmen, spucken —
Geduld und Herz bricht mir dabei.
Folg mir, mein Freund! Entschliess dich frei,
Ein fettes Krötchen zu verschlucken,
Geschwind und ohne hinzugucken! —
Das hilft dir von der Dyspepsei!
25. Bitte.
Ich kenne mancher Menschen Sinn
Und weiss nicht, wer ich selber bin!
Mein Auge ist mir viel zu nah —
Ich bin nicht, was ich seh und sah.
Ich wollte mir schon besser nützen,
Könnt’ ich mir selber ferner sitzen.
Zwar nicht so ferne wie mein Feind!
Zu fern sitzt schon der nächste Freund —
Doch zwischen dem und mir die Mitte!
Errathet ihr, um was ich bitte?
26. Meine Härte.
Ich muss weg über hundert Stufen,
Ich muss empor und hör euch rufen:
„Hart bist du; Sind wir denn von Stein?“ —
Ich muss weg über hundert Stufen,
Und Niemand möchte Stufe sein.
27. Der Wandrer.
„Kein Pfad mehr! Abgrund rings und Todtenstille!“ —
So wolltest du’s! Vom Pfade wich dein Wille!
Nun, Wandrer, gilt’s! Nun blicke kalt und klar!
Verloren bist du, glaubst du — an Gefahr.
28. Trost für Anfänger.
Seht das Kind umgrunzt von Schweinen,
Hülflos, mit verkrümmten Zeh’n!
Weinen kann es, Nichts als weinen —
Lernt es jemals stehn und gehn?
Unverzagt! Bald, sollt’ ich meinen,
Könnt das Kind ihr tanzen sehn!
Steht es erst auf beiden Beinen,
Wird’s auch auf dem Kopfe stehn.
29. Sternen-Egoismus.
Rollt’ ich mich rundes Rollefass
Nicht um mich selbst ohn’ Unterlass,
Wie hielt’ ich’s aus, ohne anzubrennen,
Der heissen Sonne nachzurennen?
30. Der Nächste.
Nah hab den Nächsten ich nicht gerne:
Fort mit ihm in die Höh und Ferne!
Wie würd’ er sonst zu meinem Sterne? —
31. Der verkappte Heilige.
Dass dein Glück uns nicht bedrücke,
Legst du um dich Teufelstücke,
Teufelswitz und Teufelskleid.
Doch umsonst! Aus deinem Blicke
Blickt hervor die Heiligkeit!
32. Der Unfreie.
A. Er steht und horcht: was konnt ihn irren?
Was hört er vor den Ohren schwirren?
Was war’s, das ihn darniederschlug?
B. Wie Jeder, der einst Ketten trug,
Hört überall er — Kettenklirren.
33. Der Einsame.
Verhasst ist mir das Folgen und das Führen.
Gehorchen? Nein! Und aber nein — Regieren!
Wer sich nicht schrecklich ist, macht Niemand Schrecken:
Und nur wer Schrecken macht, kann Andre führen.
Verhasst ist mir’s schon, selber mich zu führen!
Ich liebe es, gleich Wald- und Meeresthieren,
Mich für ein gutes Weilchen zu verlieren,
In holder Irrniss grüblerisch zu hocken,
Von ferne her mich endlich heimzulocken,
Mich selber zu mir selber — zu verführen.
34. Seneca et hoc genus omne.
Das schreibt und schreibt sein unaussteh-
lich weises Larifari,
Als gält es primum scribere,
Deinde philosophari.
35. Eis.
Ja! Mitunter mach’ ich Eis:
Nützlich ist Eis zum Verdauen!
Hättet ihr viel zu verdauen,
Oh wie liebtet ihr mein Eis!
36. Jugendschriften.
Meiner Weisheit A und O
Klang mir hier: was hört’ ich doch!
Jetzo klingt mir’s nicht mehr so,
Nur das ew’ge Ah! und Oh!
Meiner Jugend hör ich noch.
37. Vorsicht.
In jener Gegend reist man jetzt nicht gut;
Und hast du Geist, sei doppelt auf der Hut!
Man lockt und liebt dich, bis man dich zerreisst:
Schwarmgeister sind’s —: da fehlt es stets an Geist!
38. Der Fromme spricht.
Gott liebt uns, weil er uns erschuf! —
„Der Mensch schuf Gott!“ — sagt drauf ihr Feinen.
Und soll nicht lieben, was er schuf?
Soll’s gar, weil er es schuf, verneinen?
Das hinkt, das trägt des Teufels Huf.
39. Im Sommer.
Im Schweisse unsres Angesichts
Soll’n unser Brod wir essen?
Im Schweisse isst man lieber Nichts,
Nach weiser Aerzte Ermessen.
Der Hundsstern winkt: woran gebricht’s?
Was will sein feurig Winken?
Im Schweisse unsres Angesichts
Soll’n unsren Wein wir trinken!
40. Ohne Neid.
Ja, neidlos blickt er: und ihr ehrt ihn drum?
Er blickt sich nicht nach euren Ehren um;
Er hat des Adlers Auge für die Ferne,
Er sieht euch nicht! — er sieht nur Sterne, Sterne.
41. Heraklitismus.
Alles Glück auf Erden,
Freunde, giebt der Kampf!
Ja, um Freund zu werden,
Braucht es Pulverdampf!
Eins in Drei’n sind Freunde:
Brüder vor der Noth,
Gleiche vor dem Feinde,
Freie — vor dem Tod!
42. Grundsatz der Allzufeinen.
Lieber auf den Zehen noch,
Als auf allen Vieren!
Lieber durch ein Schlüsselloch,
Als durch offne Thüren!
43. Zuspruch.
Auf Ruhm hast du den Sinn gericht?
Dann acht’ der Lehre:
Bei Zeiten leiste frei Verzicht
Auf Ehre!
44. Der Gründliche.
Ein Forscher ich? Oh spart diess Wort! —
Ich bin nur schwer — so manche Pfund’!
Ich falle, falle immerfort
Und endlich auf den Grund!
45. Für immer.
„Heut komm’ ich, weil mir’s heute frommt“ —
Denkt Jeder, der für immer kommt.
Was ficht ihn an der Welt Gered’:
„Du kommst zu früh! Du kommst zu spät!“
46. Urtheile der Müden.
Der Sonne fluchen alle Matten;
Der Bäume Werth ist ihnen — Schatten!
47. Niedergang.
„Er sinkt, er fällt jetzt“ — höhnt ihr hin und wieder;
Die Wahrheit ist: er steigt zu euch hernieder!
Sein Ueberglück ward ihm zum Ungemach,
Sein Ueberlicht geht eurem Dunkel nach.
48. Gegen die Gesetze.
Von heut an hängt an härner Schnur
Um meinen Hals die Stunden-Uhr:
Von heut an hört der Sterne Lauf,
Sonn’, Hahnenschrei und Schatten auf,
Und was mir je die Zeit verkünd’t,
Das ist jetzt stumm und taub und blind: —
Es schweigt mir jegliche Natur
Beim Tiktak von Gesetz und Uhr.
49. Der Weise spricht.
Dem Volke fremd und nützlich doch dem Volke,
Zieh ich des Weges, Sonne bald, bald Wolke —
Und immer über diesem Volke!
50. Den Kopf verloren.
Sie hat jetzt Geist — wie kam’s, dass sie ihn fand?
Ein Mann verlor durch sie jüngst den Verstand,
Sein Kopf war reich vor diesem Zeitvertreibe:
Zum Teufel gieng sein Kopf — nein! nein! zum Weibe!
51. Fromme Wünsche.
„Mögen alle Schlüssel doch
Flugs verloren gehen,
Und in jedem Schlüsselloch
Sich der Dietrich drehen!“
Also denkt zu jeder Frist
Jeder, der — ein Dietrich ist.
52. Mit dem Fusse schreiben.
Ich schreib nicht mit der Hand allein:
Der Fuss will stets mit Schreiber sein.
Fest, frei und tapfer läuft er mir
Bald durch das Feld, bald durchs Papier.
53. „Menschliches, Allzumenschliches.“ Ein Buch.
Schwermüthig scheu, solang du rückwärts schaust,
Der Zukunft trauend, wo du selbst dir traust:
Oh Vogel, rechn’ ich dich den Adlern zu?
Bist du Minerva’s Liebling U-hu-hu?
54. Meinem Leser.
Ein gut Gebiss und einen guten Magen —
Diess wünsch’ ich dir!
Und hast du erst mein Buch vertragen,
Verträgst du dich gewiss mit mir!
55. Der realistische Maler.
„Treu die Natur und ganz!“ — Wie fängt er’s an:
Wann wäre je Natur im Bilde abgethan?
Unendlich ist das kleinste Stück der Welt! —
Er malt zuletzt davon, was ihm gefällt.
Und was gefällt ihm? Was er malen kann!
56. Dichter-Eitelkeit.
1.
Die Lehrer vom Zwecke des Daseins — Ich mag nun mit gutem oder bösem Blicke auf die Menschen sehen, ich finde sie immer bei Einer Aufgabe, Alle und jeden Einzelnen in Sonderheit: Das zu thun, was der Erhaltung der menschlichen Gattung frommt. Und zwar wahrlich nicht aus einem Gefühl der Liebe für diese Gattung, sondern einfach, weil Nichts in ihnen älter, stärker, unerbittlicher, unüberwindlicher ist, als jener Instinct, — weil dieser Instinct eben das Wesen unserer Art und Heerde ist. Ob man schon schnell genug mit der üblichen Kurzsichtigkeit auf fünf Schritt hin seine Nächsten säuberlich in nützliche und schädliche, gute und böse Menschen auseinander zu thun pflegt, bei einer Abrechnung im Grossen, bei einem längeren Nachdenken über das Ganze wird man gegen dieses Säubern und Auseinanderthun misstrauisch und lässt es endlich sein. Auch der schädlichste Mensch ist vielleicht immer noch der allernützlichste, in Hinsicht auf die Erhaltung der Art; denn er unterhält bei sich oder, durch seine Wirkung, bei Anderen Triebe, ohne welche die Menschheit längst erschlafft oder verfault wäre. Der Hass, die Schadenfreude, die Raub- und Herrschsucht und was Alles sonst böse genannt wird: es gehört zu der erstaunlichen Oekonomie der Arterhaltung, freilich zu einer kostspieligen, verschwenderischen und im Ganzen höchst thörichten Oekonomie: — welche aber bewiesener Maassen unser Geschlecht bisher erhalten hat. Ich weiss nicht mehr, ob du, mein lieber Mitmensch und Nächster, überhaupt zu Ungunsten der Art, also „unvernünftig“ und „schlecht“ leben kannst; Das, was der Art hätte schaden können, ist vielleicht seit vielen Jahrtausenden schon ausgestorben und gehört jetzt zu den Dingen, die selbst bei Gott nicht mehr möglich sind. Hänge deinen besten oder deinen schlechtesten Begierden nach und vor Allem: geh’ zu Grunde! — in Beidem bist du wahrscheinlich immer noch irgendwie der Förderer und Wohlthäter der Menschheit und darfst dir daraufhin deine Lobredner halten — und ebenso deine Spötter! Aber du wirst nie den finden, der dich, den Einzelnen, auch in deinem Besten ganz zu verspotten verstünde, der deine grenzenlose Fliegen- und Frosch-Armseligkeit dir so genügend, wie es sich mit der Wahrheit vertrüge, zu Gemüthe führen könnte! Ueber sich selber lachen, wie man lachen müsste, um aus der ganzen Wahrheit heraus zu lachen, — dazu hatten bisher die Besten nicht genug Wahrheitssinn und die Begabtesten viel zu wenig Genie! Es giebt vielleicht auch für das Lachen noch eine Zukunft! Dann, wenn der Satz „die Art ist Alles, Einer ist immer Keiner“ — sich der Menschheit einverleibt hat und Jedem jederzeit der Zugang zu dieser letzten Befreiung und Unverantwortlichkeit offen steht. Vielleicht wird sich dann das Lachen mit der Weisheit verbündet haben, vielleicht giebt es dann nur noch „fröhliche Wissenschaft“. Einstweilen ist es noch ganz anders, einstweilen ist die Komödie des Daseins sich selber noch nicht „bewusst geworden“, einstweilen ist es immer noch die Zeit der Tragödie, die Zeit der Moralen und Religionen. Was bedeutet das immer neue Erscheinen jener Stifter der Moralen und Religionen, jener Urheber des Kampfes um sittliche Schätzungen, jener Lehrer der Gewissensbisse und der Religionskriege? Was bedeuten diese Helden auf dieser Bühne? Denn es waren bisher die Helden derselben, und alles Uebrige, zeitweilig allein Sichtbare und Allzunahe, hat immer nur zur Vorbereitung dieser Helden gedient, sei es als Maschinerie und Coulisse oder in der Rolle von Vertrauten und Kammerdienern. (Die Poeten zum Beispiel waren immer die Kammerdiener irgend einer Moral.) — Es versteht sich von selber, dass auch diese Tragöden im Interesse der Art arbeiten, wenn sie auch glauben mögen, im Interesse Gottes und als Sendlinge Gottes zu arbeiten. Auch sie fördern das Leben der Gattung, indem sie den Glauben an das Leben fördern. „Es ist werth zu leben — so ruft ein Jeder von ihnen — es hat Etwas auf sich mit diesem Leben, das Leben hat Etwas hinter sich, unter sich, nehmt euch in Acht!“ Jener Trieb, welcher in den höchsten und gemeinsten Menschen gleichmässig waltet, der Trieb der Arterhaltung, bricht von Zeit zu Zeit als Vernunft und Leidenschaft des Geistes hervor; er hat dann ein glänzendes Gefolge von Gründen um sich und will mit aller Gewalt vergessen machen, dass er im Grunde Trieb, Instinct, Thorheit, Grundlosigkeit ist. Das Leben soll geliebt werden, denn! Der Mensch soll sich und seinen Nächsten fördern, denn! Und wie alle diese Soll’s und Denn’s heissen und in Zukunft noch heissen mögen! Damit Das, was nothwendig und immer, von sich aus und ohne allen Zweck geschieht, von jetzt an auf einen Zweck hin gethan erscheine und dem Menschen als Vernunft und letztes Gebot einleuchte, — dazu tritt der ethische Lehrer auf, als der Lehrer vom Zweck des Daseins; dazu erfindet er ein zweites und anderes Dasein und hebt mittelst seiner neuen Mechanik dieses alte gemeine Dasein aus seinen alten gemeinen Angeln. Ja! er will durchaus nicht, dass wir über das Dasein lachen, noch auch über uns, — noch auch über ihn; für ihn ist Einer immer Einer, etwas Erstes und Letztes und Ungeheures, für ihn giebt es keine Art, keine Summen, keine Nullen. Wie thöricht und schwärmerisch auch seine Erfindungen und Schätzungen sein mögen, wie sehr er den Gang der Natur verkennt und ihre Bedingungen verleugnet: — und alle Ethiken waren zeither bis zu dem Grade thöricht und widernatürlich, dass an jeder von ihnen die Menschheit zu Grunde gegangen sein würde, falls sie sich der Menschheit bemächtigt hätte — immerhin! jedesmal wenn „der Held“ auf die Bühne trat, wurde etwas Neues erreicht, das schauerliche Gegenstück des Lachens, jene tiefe Erschütterung vieler Einzelner bei dem Gedanken: „ja, es ist werth zu leben! ja, ich bin werth zu leben!“ — das Leben und ich und du und wir Alle einander wurden uns wieder einmal für einige Zeit interessant. — Es ist nicht zu leugnen, dass auf die Dauer über jeden Einzelnen dieser grossen Zwecklehrer bisher das Lachen und die Vernunft und die Natur Herr geworden ist: die kurze Tragödie gieng schliesslich immer in die ewige Komödie des Daseins über und zurück, und die „Wellen unzähligen Gelächters“ — mit Aeschylus zu reden — müssen zuletzt auch über den grössten dieser Tragöden noch hinwegschlagen. Aber bei alle diesem corrigirenden Lachen ist im Ganzen doch durch diess immer neue Erscheinen jener Lehrer vom Zweck des Daseins die menschliche Natur verändert worden, — sie hat jetzt ein Bedürfniss mehr, eben das Bedürfniss nach dem immer neuen Erscheinen solcher Lehrer und Lehren vom „Zweck“. Der Mensch ist allmählich zu einem phantastischen Thiere geworden, welches eine Existenz-Bedingung mehr, als jedes andere Thier, zu erfüllen hat: der Mensch muss von Zeit zu Zeit glauben, zu wissen, warum er existirt, seine Gattung kann nicht gedeihen ohne ein periodisches Zutrauen zu dem Leben! Ohne Glauben an die Vernunft im Leben! Und immer wieder wird von Zeit zu Zeit das menschliche Geschlecht decretiren: „es giebt Etwas, über das absolut nicht mehr gelacht werden darf!“ Und der vorsichtigste Menschenfreund wird hinzufügen: „nicht nur das Lachen und die fröhliche Weisheit, sondern auch das Tragische mit all seiner erhabenen Unvernunft gehört unter die Mittel und Nothwendigkeiten der Arterhaltung!“ — Und folglich! Folglich! Folglich! Oh versteht ihr mich, meine Brüder? Versteht ihr dieses neue Gesetz der Ebbe und Fluth? Auch wir haben unsere Zeit!
2.
Das intellectuale Gewissen. — Ich mache immer wieder die gleiche Erfahrung und sträube mich ebenso immer von Neuem gegen sie, ich will es nicht glauben, ob ich es gleich mit Händen greife: den Allermeisten fehlt das intellectuale Gewissen; ja es wollte mir oft scheinen, als ob man mit der Forderung eines solchen in den volkreichsten Städten einsam wie in der Wüste sei. Es sieht dich Jeder mit fremden Augen an und handhabt seine Wage weiter, diess gut, jenes böse nennend; es macht Niemandem eine Schamröthe, wenn du merken lässest, dass diese Gewichte nicht vollwichtig sind, — es macht auch keine Empörung gegen dich: vielleicht lacht man über deinen Zweifel. Ich will sagen: die Allermeisten finden es nicht verächtlich, diess oder jenes zu glauben und darnach zu leben, ohne sich vorher der letzten und sichersten Gründe für und wider bewusst worden zu sein und ohne sich auch nur die Mühe um solche Gründe hinterdrein zu geben, — die begabtesten Männer und die edelsten Frauen gehören noch zu diesen „Allermeisten“. Was ist mir aber Gutherzigkeit, Feinheit und Genie, wenn der Mensch dieser Tugenden schlaffe Gefühle im Glauben und Urtheilen bei sich duldet, wenn das Verlangen nach Gewissheit ihm nicht als die innerste Begierde und tiefste Noth gilt, — als Das, was die höheren Menschen von den niederen scheidet! Ich fand bei gewissen Frommen einen Hass gegen die Vernunft vor und war ihnen gut dafür: so verrieth sich doch wenigstens noch das böse intellectuale Gewissen! Aber inmitten dieser rerum concordia discors und der ganzen wundervollen Ungewissheit und Vieldeutigkeit des Daseins stehen und nicht fragen, nicht zittern vor Begierde und Lust des Fragens, nicht einmal den Fragenden hassen, vielleicht gar noch an ihm sich matt ergötzen — das ist es, was ich als verächtlich empfinde, und diese Empfindung ist es, nach der ich zuerst bei Jedermann suche: — irgend eine Narrheit überredet mich immer wieder, jeder Mensch habe diese Empfindung, als Mensch. Es ist meine Art von Ungerechtigkeit.
3.
Edel und Gemein. — Den gemeinen Naturen erscheinen alle edlen, grossmüthigen Gefühle als unzweckmässig und desshalb zu allererst als unglaubwürdig: sie zwinkern mit den Augen, wenn sie von dergleichen hören, und scheinen sagen zu wollen „es wird wohl irgend ein guter Vortheil dabei sein, man kann nicht durch alle Wände sehen“: — sie sind argwöhnisch gegen den Edlen, als ob er den Vortheil auf Schleichwegen suche. Werden sie von der Abwesenheit selbstischer Absichten und Gewinnste allzu deutlich überzeugt, so gilt ihnen der Edle als eine Art von Narren: sie verachten ihn in seiner Freude und lachen über den Glanz seiner Augen. „Wie kann man sich darüber freuen im Nachtheil zu sein, wie kann man mit offnen Augen in Nachtheil gerathen wollen! Es muss eine Krankheit der Vernunft mit der edlen Affection verbunden sein“ — so denken sie und blicken geringschätzig dabei: wie sie die Freude geringschätzen, welche der Irrsinnige von seiner fixen Idee her hat. Die gemeine Natur ist dadurch ausgezeichnet, dass sie ihren Vortheil unverrückt im Auge behält und dass diess Denken an Zweck und Vortheil selbst stärker, als die stärksten Triebe in ihr ist: sich durch jene Triebe nicht zu unzweckmässigen Handlungen verleiten lassen — das ist ihre Weisheit und ihr Selbstgefühl. Im Vergleich mit ihr ist die höhere Natur die unvernünftigere: — denn der Edle, Grossmüthige, Aufopfernde unterliegt in der That seinen Trieben, und in seinen besten Augenblicken pausirt seine Vernunft. Ein Thier, das mit Lebensgefahr seine Jungen beschützt oder in der Zeit der Brunst dem Weibchen auch in den Tod folgt, denkt nicht an die Gefahr und den Tod, seine Vernunft pausirt ebenfalls, weil die Lust an seiner Brut oder an dem Weibchen und die Furcht, dieser Lust beraubt zu werden es ganz beherrschen; es wird dümmer, als es sonst ist, gleich dem Edlen und Grossmüthigen. Dieser besitzt einige Lust- und Unlust-Gefühle in solcher Stärke, dass der Intellect dagegen schweigen oder sich zu ihrem Dienste hergeben muss: es tritt dann bei ihnen das Herz in den Kopf und man spricht nunmehr von „Leidenschaft“. (Hier und da kommt auch wohl der Gegensatz dazu und gleichsam die „Umkehrung der Leidenschaft“ vor, zum Beispiel bei Fontenelle, dem Jemand einmal die Hand auf das Herz legte, mit den Worten: „Was Sie da haben, mein Theuerster, ist auch Gehirn“.) Die Unvernunft oder Quervernunft der Leidenschaft ist es, die der Gemeine am Edlen verachtet, zumal wenn diese sich auf Objecte richtet, deren Werth ihm ganz phantastisch und willkürlich zu sein scheint. Er ärgert sich über Den, welcher der Leidenschaft des Bauches unterliegt, aber er begreift doch den Reiz, welcher hier den Tyrannen macht; aber er begreift es nicht, wie man zum Beispiel einer Leidenschaft der Erkenntniss zu Liebe seine Gesundheit und Ehre auf’s Spiel setzen könne. Der Geschmack der höheren Natur richtet sich auf Ausnahmen, auf Dinge, die gewöhnlich kalt lassen und keine Süssigkeit zu haben scheinen; die höhere Natur hat ein singuläres Werthmaass. Dazu ist sie meistens des Glaubens, nicht ein singuläres Werthmaass in ihrer Idiosynkrasie des Geschmacks zu haben, sie setzt vielmehr ihre Werthe und Unwerthe als die überhaupt gültigen Werthe und Unwerthe an, und geräth damit in’s Unverständliche und Unpraktische. Es ist sehr selten, dass eine höhere Natur soviel Vernunft übrig behält, um Alltags-Menschen als solche zu verstehen und zu behandeln: zu allermeist glaubt sie an ihre Leidenschaft als an die verborgen gehaltene Leidenschaft Aller und ist gerade in diesem Glauben voller Gluth und Beredtsamkeit. Wenn nun solche Ausnahme-Menschen sich selber nicht als Ausnahmen fühlen, wie sollten sie jemals die gemeinen Naturen verstehen und die Regel billig abschätzen können! — und so reden auch sie von der Thorheit, Zweckwidrigkeit und Phantasterei der Menschheit, voller Verwunderung, wie toll die Welt laufe und warum sie sich nicht zu dem bekennen wolle, was „ihr Noth thue“. — Diess ist die ewige Ungerechtigkeit der Edlen.
4.