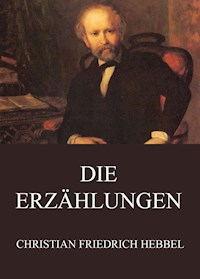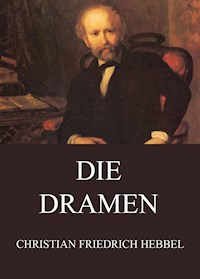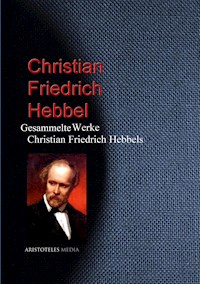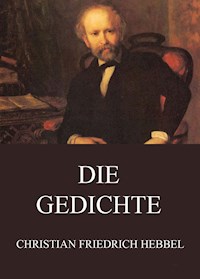
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Christian Friedrich Hebbel war ein deutscher Dramatiker und Lyriker. Dieser Band beinhaltet folgende Gedichtsammlungen: Lieder Balladen und Verwandtes Vermischte Gedichte Dem Schmerz sein Recht Des Dichters Testament Sonette u.a.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 315
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Gedichte
Christian Friedrich Hebbel
Inhalt:
Friedrich Hebbel – Biografie und Bibliografie
Lieder
Balladen und Verwandtes
Vermischte Gedichte
Dem Schmerz sein Recht
Des Dichters Testament
Sonette
Epigramme und Verwandtes
I. Bilder
II. Gnomen
III. Kunst
IV. Geschichte
V. Ethisches
VI. Persönliches
VII. Buntes
VIII. Gereimte
Die Gedichte, C. F. Hebbel
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN:9783849627331
www.jazzybee-verlag.de
Dieses Werk bzw. Inhalt und Zusammenstellung steht unter einer Creative Commons Namensnennung 3.0 Deutschland Lizenz. Die Details der Lizenz und zu der Weiterverwertung dieses Werks finden Sie unter http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/. Der Inhalt und die Zusammenstellung oder Teile davon wurden der TextGrid-Datenbank entnommen, wo der Inhalt und die Zusammenstellung oder Teile davon ebenfalls unter voriger Lizenz verfügbar sind. Eine bereits bestehende Allgemeinfreiheit der Texte bleibt von der Lizensierung unberührt.
Friedrich Hebbel – Biografie und Bibliografie
Hervorragender Dichter, geb. 18. März 1813 zu Wesselburen in Dithmarschen, gest. 13. Dez. 1863 in Wien, verlebte seine Jugend in den Marschen und Meeresumgebungen seiner Heimat, nährte eine früh erwachte gestaltenreiche Phantasie an wenigen Büchern, wurde mit 14 Jahren Schreiber des Kirchspielvogts Mohr in Wesselburen und erhielt 1834 durch Gönner die Mittel, sich nach Hamburg zu begeben, um die Lücken seiner Bildung auszufüllen. Hier rang sich sein Genius in heftiger, schmerzenreicher Gärung empor und seinem leidenschaftlichen Liebesbedürfnis begegnete die aufopfernde Treue seiner hingebenden Freundin Elise Lensing. Die innern Kämpfe setzten sich in den eindrucksreichen, aber oft durch bitterste Notgetrübten Universitätsjahren fort. H. studierte im Sommer 1836 in Heidelberg, von da an bis Ostern 1839 in München, gewann hier namentlich durch Schelling tiefe Eindrücke und erkannte seine unzweifelhafte Bestimmung zum Dichter. 1839 nach Hamburg zurückgekehrt, dichtete er hier seine Erstlingstragödie: »Judith« (Hamb. 1841, 2. Aufl. 1873), der wenig später »Genoveva« (das. 1843) folgte. In beiden Tragödien zeigte sich eine ungewöhnliche dramatische Dichterkraft, namentlich eine Gewalt der Charakteristik, eine Unmittelbarkeit und Glut der Leidenschaft, die H. auf der Stelle als ein Talent ersten Ranges erkennen ließen. Daneben mußte freilich die Neigung des Dichters zum Krassen und Bizarren und mehr noch die dicht neben seiner natürlichen Leidenschaft stehende Neigung zu einer zersetzenden Reflexion erschrecken. Eine Sammlung seiner »Gedichte« (Hamb. 1842; »Neue Gedichte«, Leipz. 1848; vervollständigte Gesamtausgabe, Stuttg. 1857) bewies indes, daß dem Dichter auch die zarten und innigen Töne der Lyrik zu Gebote standen. 1843 kam er nach Kopenhagen, wurde hier vom König-Herzog seines Heimatlandes Holstein mit einem mehrjährigen Reisestipendium bedacht, ging zuerst nach Paris, wo er das bürgerliche Trauerspiel »Maria Magdalene« (Hamb. 1844) dichtete, mit Heine und Ruge bekannt wurde und in Bamberg einen treuergebenen Freund für das Leben gewann. »Maria Magdalene«, obwohl schroff, herb und in der Voraussetzung peinlich, wirkte dennoch durch meisterhafte Charakteristik und Entwickelung und war das reifste Produkt der ersten Periode Hebbels. Tiefen Schmerz bereitete ihm die Nachricht von dem Tode seines Söhnchens Max; im Mai 1844 schenkte Elise Lensing, die vergeblich um eheliche Sanktionierung des Liebesbundes bat, einem zweiten Knaben das Leben. Vom September 1844 bis Oktober 1845 weilte H. in Italien, kehrte auf der Rückreise in Wien ein und ließ sich durch das Entgegenkommen begeisterter Verehrer bewegen, hier dauernd seinen Wohnsitz zu nehmen. Insbesondere fesselte ihn die geistvolle Schauspielerin des Burgtheaters Christine Enghaus, der H. 26. Mai 1846 die Hand am Altar reichte, ein Schritt, der zugleich das Lebensglück seiner treuen Jugendfreundin Elise Lensing vernichtete. Äußern Sorgen nunmehr enthoben, fand H. an der Seite seiner ebenso edlen wie gebildeten Gattin, die mit den Jahren immer tiefer auf ihn einwirkte, den Frieden der Seele, den er zuvor vergebens erstrebt hatte, wenn auch bereits in den lyrischen Dichtungen seiner italienischen Wandertage eine gewisse Lösung von der dunkelpessimistischen Weltanschauung seiner Jugend zu bemerken war. Eine schmerzliche Reaktion erlebte er jedoch wieder durch die Eindrücke der Revolution von 1848 und der nächstfolgenden Jahre. Die dramatischen Dichtungen dieser zweiten Periode: »Der Diamant«, Komödie (Hamb. 1847), »Herodes und Mariamne« (Wien 1850), »Julia«, Trauerspiel (Leipz. 1851), »Der Rubin«, Märchenlustspiel (das. 1851), »Ein Trauerspiel in Sizilien«, Tragikomödie (das. 1851), zeigten wohl im Ausdruck weniger Überschwenglichkeit, waren aber dafür bizarrer, herber, kälter als die Werke der Jugendzeit Hebbels; sie konnten die Bühne nicht zum Aufgeben ihres spröden Widerstandes gegen Hebbels starre Originalität veranlassen. Im Verlauf der 1850er Jahre begann sich dann der Dichter in bemerkenswerter Weise zu läutern und neben der Erhabenheit auch Schönheit der Darstellung zu erstreben. Diese dritte Periode begann mit dem kleinen Drama »Michel Angelo« (Wien 1855), einer anmutigen poetischen Selbstverteidigung, und mit der Tragödie »Agnes Bernauer« (das. 1855), bis auf die menschlich widerstrebende Staatsidee ein Werk voll Frische, Kraft und anmutigen Reizes; sie setzte sich fort in dem formell schönen, aber im Konflikt unversöhnlich herben Trauerspiel »Gyges und sein Ring« (das. 1856) und gipfelte in den lyrischen Dichtungen dieser Jahre, in der prächtigen epischen Dichtung »Mutter und Kind« (Hamb. 1859) und im Meisterwerk des Dichters, der dramatischen Trilogie »Die Nibelungen« (das. 1862, 3. Aufl. 1874), in der H. den gewaltigen epischen Stoff als den großen Konflikt zwischen der heidnischen und christlichen Weltanschauung vollständig dramatisierte. Die Früchte seines endlichen Erfolgs zu pflücken, war aber dem Dichter so wenig beschieden wie die Beendigung seiner letzten bedeutenden Tragödie »Demetrius« (Hamb. 1864). Nach seinem Tod erschienen seine »Sämtlichen Werke« (hrsg. von Emil Kuh und A. Glaser, Hamb. 1866–68, 12 Bde.); eine andre Ausgabe besorgte Krumm (das. 1892, 12 Bde.), die beste Gesamtausgabe R. M. Werner (Berl. 1901–03, 12 Bde.); eine gut kommentierte Auswahl K. Zeiß für Meyers Klassiker-Bibliothek (Leipz. 1899, 4 Bde.), eine andre R. Specht (Stuttg. 1903, 6 Bde.). Seine gedankenreichen »Tagebücher« gab zuerst Felix Bamberg heraus (Berl. 1885–86, 2 Bde.), neuerdings besser (als 2. Abteilung der »Sämtlichen Werke«) R. M. Werner (das. 1903, 4 Bde.; 3. Aufl. 1904), den »Briefwechsel mit Freunden und berühmten Zeitgenossen« (das. 1890–92, 2 Bde.) ebenfalls Bamberg und dazu eine »Nachlese« R. M. Werner (das. 1900, 2 Bde.). Vgl. E. Kuh, Biographie F. Hebbels (Wien 1877, 2 Bde.); Kulke, Erinnerungen an Fr. H. (Wien 1878); Ad. Stern, Zur Literatur der Gegenwart (Leipz. 1880); A. Bartels, Friedrich H. (in Reclams Universal-Bibliothek); A. Neumann, Aus Friedrich Hebbels Werdezeit (Zitt. 1899); J. Krumm, Friedrich H. (Flensb. 1899); K. Böhrig, Die Probleme der Hebbelschen Tragödie (Leipz. 1899); Th. Popp, Friedrich H. und sein Drama (Berl. 1899); R. Graf von Schwerin, Hebbels tragische Theorie (Rost. 1903); A. Scheunert, Der Pantragismus als System der Weltanschauung und Ästhetik F. Hebbels (Hamb. 1903); W. Waetzoldt, H. und die Philosophie seiner Zeit (Berl. 1903); E. A. Georgy, Die Tragödie F. Hebbels nach ihrem Ideengehalt (Leipz. 1904); F. Zinkernagel, Die Grundlagen der Hebbelschen Tragödie (Berl. 1904); R. M. Werner, H., ein Lebensbild (das. 1904).
Lieder
Nachtlied
Quellende, schwellende Nacht,
Voll von Lichtern und Sternen:
In den ewigen Fernen,
Sage, was ist da erwacht!
Herz in der Brust wird beengt,
Steigendes, neigendes Leben,
Riesenhaft fühle ich's weben,
Welches das meine verdrängt.
Schlaf, da nahst du dich leis,
Wie dem Kinde die Amme,
Und um die dürftige Flamme
Ziehst du den schützenden Kreis.
Sturmabend
Rausche nur vorüber, Wind!
Wühl' im Laub und knicke,
Während ich mein süßes Kind
An die Brust hier drücke!
Nestle aus dem dunklen Haar
Ihr die junge Rose,
Wirf sie ihr zu Füßen dar,
Während ich hier kose.
Eine Todesgöttin, tritt
Sie die zarte Schwester
In den Staub mit stolzem Schritt
Und umschlingt mich fester;
Läßt dir willig gar das Tuch,
Das ihr, wenn ich neckte,
Sonst noch niemals dicht genug
Hals und Busen deckte.
Rausche, Wind! Wir seh'n die Zeit
So, wie dich, entfliehen,
Doch, bevor sie Asche streut,
Wagen wir zu glühen!
Lockend vor mir, rund und roth,
Ihre Feuerlippe!
Zwei Schritt hinter mir der Tod
Mit geschwungner Hippe.
Das letzte Glas
Das letzte Glas! Wer mag es denken!
Und dennoch muß ein letztes sein!
Mich drängt's, es hastig einzuschenken,
Fällt auch die Thräne mit hinein.
Stoß an! Du stießest gar zu heftig!
In tausend Scherben liegt das Glas.
Ein neues bringt mir schon geschäftig
Der Kellner; nochmals füll' ich das.
Das letzte Glas! Wer mag es schauen!
Und dennoch muß ein letztes sein!
Du ziehst nun bald in ferne Gauen:
Denkst du im fremden Land noch mein?
Stoß an! Ich zitt're gar zu heftig!
In tausend Scherben liegt das Glas.
Ein neues bringt mir schon geschäftig
Der Kellner; nochmals füll' ich das.
Das letzte Glas! Wer mag es trinken!
Und dennoch muß ein letztes sein!
Dir werden neue Freunde winken,
Ich aber bleib' hier ganz allein!
Stoß an! Zu Boden werf' ich's heftig!
Warum schon jetzt das letzte Glas!
Ein neues bringt mir schon geschäftig
Der Kellner; nochmals füll' ich das.
Das letzte Glas! Wir lassen's stehen!
Versiegle und verschließ den Wein!
Wenn wir dereinst uns wieder sehen,
So soll es unser erstes sein!
Komm, an den Mund press' ich dich heftig,
Als wärst du selbst mein letztes Glas!
Was wir uns sind, das fühl' ich kräftig,
Jetzt geh mit Gott! Wir bleiben das!
Der junge Schiffer
Dort bläht ein Schiff die Segel,
Frisch saus't hinein der Wind;
Der Anker wird gelichtet,
Das Steuer flugs gerichtet,
Nun fliegt's hinaus geschwind.
Ein kühner Wasservogel
Kreis't grüßend um den Mast,
Die Sonne brennt herunter,
Manch Fischlein, blank und munter,
Umgaukelt keck den Gast.
Wär' gern hinein gesprungen,
Da draußen ist mein Reich!
Ich bin ja jung von Jahren,
Da ist's mir nur um's Fahren,
Wohin? Das gilt mir gleich!
Vorwärts
Steine, sie liegen hier,
Liebchen, im Wege dir,
Klotzig herum!
Gerne ja bückt' ich mich,
Schaffte sie fort für dich,
Würd' ich bloß krumm;
Aber, ich seh's genau,
Du auch, du würdest grau,
Wär' das nicht dumm?
Lebenslang würd' es ja
Währen, so viel sind da,
Vorwärts darum!
Siehst du, wie das uns frommt,
Wie man hinüber kommt,
Lustig und schnell?
Rings schon der kühle Wald,
Duftige Beeren bald,
Drüben ein Quell
Weiter drum, weiter noch,
Gehst du auf Moos ja doch
Jetzt bis zur Stell'!
Heisa, nun ruhen wir,
Hätt' ich zwei Flügel, hier
Kappt' ich sie schnell!
Knabentod
Vom Berg, der Knab',
Der zieht hinab
In heißen Sommertagen;
Im Tannenwald,
Da macht er Halt,
Er kann sich kaum noch tragen.
Den wilden Bach,
Er sieht ihn jach
In's Thal herunter schäumen;
Ihn dürstet sehr,
Nun noch viel mehr:
Nur hin! Wer würde säumen!
Da ist die Flut!
O, in der Glut,
Was kann so köstlich blinken!
Er schöpft und trinkt,
Er stürzt und sinkt
Und trinkt noch im Versinken!
Das Lied ist aus,
Und macht's dir Graus:
Wer wird's im Winter singen!
Zur Sommerzeit
Bist du bereit,
Dem Knaben nachzuspringen.
Schiffers Abschied
Hier steh'n wir unter'm Apfelbaum,
Hier will ich von dir scheiden,
Hier träumte ich so manchen Traum,
Hier trägt sich auch ein Leiden.
Hier sah ich dich zum ersten Mal,
In winterlicher Oede!
Wie war der Baum so nackt und kahl,
Wie warst du kalt und spröde!
Doch bald ergrünte Zweig nach Zweig,
Und alle Knospen trieben.
Da sprang dein Herz, den Knospen gleich,
Da fingst du an, zu lieben.
Wie ist er jetzt von Blüten voll!
Wie wird er reichlich tragen!
Doch, wer ihn für dich schütteln soll,
Das wüßt' ich nicht zu sagen.
Hei! Wie dich säuselnd jener Ast
Mit rothem Schnee bestreute,
Als ob er schon die schwere Last
Der künft'gen Früchte scheute!
Wenn über's Meer der Herbstwind pfeift
Und an dem Mast mir rüttelt,
So denke ich: sie sind gereift,
Und er ist's, der sie schüttelt!
Und muß mein Schiff vor seinem Braus
Gar an ein Felsriff prallen,
So ruf' ich noch im Scheitern aus:
Die schönste will nicht fallen!
Zu Pferd! Zu Pferd!
Zu Pferd! Zu Pferd! Es saus't der Wind!
Schneewolken, düstre, jagen!
Die schütten nun den Winter aus!
Zu Pferd! Zu Pferd! Durch Saus und Braus
Die heiße Brust zu tragen!
Mit krausen Nüstern prüft das Roß
Die Luft, dann wiehert's muthig;
Nur wie ich herrsche, dient das Thier,
Ein Druck: von dannen fliegt's mit mir,
Als wär' mein Sporn schon blutig.
In meinem Mantel wühlt der Wind,
Er raubt mir fast die Mütze;
Ich hab' ihn gern auf meiner Spur,
An seiner Wuth erprob' ich's nur,
Wie fest ich oben sitze.
Requiem
Seele, vergiß sie nicht,
Seele, vergiß nicht die Todten!
Sieh, sie umschweben dich,
Schauernd, verlassen,
Und in den heiligen Gluten,
Die den Armen die Liebe schürt,
Athmen sie auf und erwarmen,
Und genießen zum letzten Mal
Ihr verglimmendes Leben.
Seele, vergiß sie nicht,
Seele, vergiß nicht die Todten!
Sieh, sie umschweben dich,
Schauernd, verlassen,
Und wenn du dich erkaltend
Ihnen verschließest, erstarren sie
Bis hinein in das Tiefste.
Dann ergreift sie der Sturm der Nacht,
Dem sie, zusammengekrampft in sich,
Trotzten im Schooße der Liebe,
Und er jagt sie mit Ungestüm
Durch die unendliche Wüste hin,
Wo nicht Leben mehr ist, nur Kampf
Losgelassener Kräfte
Um erneuertes Sein!
Seele, vergiß sie nicht,
Seele, vergiß nicht die Todten!
Ein nächtliches Echo
Blitzend
Zieh'n die Sterne auf am Himmelsrand,
Spritzend
Senkt der Thau sich auf das durst'ge Land.
»Liebe!«
Singt der Knabe in die Nacht hinein.
»Liebe!«
Klingt es wieder aus dem Myrthenhain.
Säuselnd
Schleicht der Wind durch die gewürzte Luft,
Kräuselnd
Jeden Blütenzweig voll Hauch und Duft.
»O Traum!«
Ruft der Knabe aus in süßem Schmerz.
»O Traum!«
Hallt's zurück, als hätt' die Nacht ein Herz.
Knabe
Glaubt entzückt, was Seel' und Sinn ihm füllt,
Habe
Schmeichelnd sich in Luft und Duft gehüllt.
»Komm! Komm!«
Quillt es ihm aus heißer Brust hervor.
»Komm! Komm!«
Spielt es lind und weich ihm um das Ohr.
Seine
Seufzer giebt der Wald ihm treu zurück,
Keine
Himmlische Gestalt erscheint dem Blick.
»Nur Schall!«
Ruft er endlich, und er ruft nicht mehr.
»Nur Schall!«
Klingt es hinter dem Verstummten her.
Lied
Komm, wir wollen Erdbeer'n pflücken,
Ist es doch nicht weit zum Wald,
Wollen junge Rosen brechen,
Sie verwelken ja so bald!
Droben jene Wetterwolke,
Die dich ängstigt, fürcht' ich nicht;
Nein, sie ist mir sehr willkommen,
Denn die Mittagssonne sticht.
All die sengend-heißen Stralen,
Die uns drohen, löscht sie aus,
Und wenn sie sich selbst entladet,
Sind wir lange schon zu Haus!
Tändelnd flecht' ich dann die Rosen
In dein dunkelbraunes Haar,
Und du bietest Beer' um Beere
Meinen durst'gen Lippen dar.
Das Vöglein
Vöglein vom Zweig
Gaukelt hernieder;
Lustig sogleich
Schwingt es sich wieder.
Jetzt dir so nah',
Jetzt sich versteckend;
Abermals da,
Scherzend und neckend.
Tastest du zu,
Bist du betrogen,
Spottend im Nu
Ist es entflogen.
Still! Bis zur Hand
Wird's dir noch hüpfen,
Bist du gewandt,
Kann's nicht entschlüpfen.
Ist's denn so schwer
Das zu erwarten?
Schau' um dich her:
Blühender Garten!
Ei, du verzagst?
Laß es gewähren,
Bis du's erjagst,
Kannst du's entbehren.
Wird's doch auch dann
Wenig nur bringen,
Aber es kann
Süßestes singen.
Scheidelieder
1.
Kein Lebewohl, kein banges Scheiden!
Viel lieber ein Geschiedensein!
Ertragen kann ich jedes Leiden,
Doch trinken kann ich's nicht, wie Wein.
Wir saßen gestern noch beisammen,
Von Trennung wußt' ich selbst noch kaum!
Das Herz trieb seine alten Flammen,
Die Seele spann den alten Traum.
Dann rasch ein Kuß vom lieben Munde,
Nicht Schmerz getränkt, nicht Angst verkürzt!
Das nenn' ich eine Abschiedsstunde,
Die leere Ewigkeiten würzt.
2.
Das ist ein eitles Wähnen!
Sei nicht so feig, mein Herz!
Gieb redlich Thränen um Thränen,
Nimm tapfer Schmerz um Schmerz!
Ich will dich weinen sehen,
Zum ersten und letzten Mal!
Will selbst nicht widerstehen,
Da löscht sich Qual in Qual!
In diesem bittren Leiden
Hab' ich nur darum Muth,
Nur darum Kraft zum Scheiden,
Weil es so weh' uns thut.
Frühlingslied
Ringt um des Jubels Krone!
Die Sonne ruft zum Strauß
Vom blauen Himmelsraume,
Auch schaut aus jedem Baume
Der Frühling schon heraus.
Ringt um des Jubels Krone!
Das Veilchen ist schon da
Und sendet seine Düfte
Verschwendrisch in die Lüfte
Und würzt sie fern und nah'.
Ringt um des Jubels Krone!
Die Lerche trinkt den Hauch
Und schmettert ihre Lieder
In frohem Dank hernieder
Und weckt den Menschen auch.
Ringt um des Jubels Krone!
Das Mägdlein, das ihr lauscht,
Erglüht im tiefsten Herzen
Und fühlt die süßen Schmerzen,
Die sie noch nie berauscht.
Ringt um des Jubels Krone!
Der Jüngling ahnt sein Glück,
Und als er ihr mit Beben
Den ersten Kuß gegeben,
Giebt sie ihn halb zurück.
Ringt um des Jubels Krone!
Ihr seht, daß jeder Lust
Ein Funke sich verbündet,
An dem sie weiter zündet
In einer fremden Brust.
Ringt um des Jubels Krone!
Dieß ist das Weltgebot.
Die trunkenste der Seelen
Wird Gott sich selbst vermählen
Durch sel'gen Freudentod.
Das erste Zechgelag
Er sitzt zum ersten Mal –
Gebt Acht, gebt Acht! –
Vor dem Pocal –
Ob ihr ihn taumlig macht!
Das ist für ihn so viel,
Wie für die Maid
Der erste Kuß, der ihr für's süße Spiel
Die Lippen weiht.
Er trinkt schon tapfer mit
Und wird schon roth!
Gleich übertritt
Der Knabe ein Gebot.
Paßt auf, er spitzt den Mund!
Gewiß, er thut
Uns seinen letzten Kirschen-Diebstahl kund
Und stralt von Muth.
Wir sind bei'm dritten Glas!
Noch immer still?
Was ist denn das,
Daß er nicht plaudern will?
Kann er schon mehr vertrau'n?
Hat er verzagt
Schon zum Versuche hinter'm Gartenzaun
Den Kuß gewagt?
Wir schenken wieder voll!
Nun winkt er mir!
Was ich wohl soll?
Nur zu! Ich horche dir! –
Er schlich sich heimlich her,
Denn, als er bat,
Verbot die Mutter ihm das Zechen schwer:
Da ist die That!
Balladen und Verwandtes
Liebeszauber
Schwül wird diese Nacht. Am Himmelsbogen
Zieh'n die Wolken dichter sich zusammen,
Breit beglänzt von Wetterleuchtens Flammen
Und von rothen Blitzen scharf durchzogen.
Alles Leben ist in sich verschlossen,
Kaum nur, daß ich mühsam Athem hole;
Selbst im Beete dort die Nachtviole
Hat den süßen Duft noch nicht ergossen.
Jedes Auge wär' schon zugefallen,
Doch die Herzen sind voll Angst und zittern
Vor den zwei sich kreuzenden Gewittern,
Deren Donnergrüße bald erschallen.
Jene Alte schleppt sich zur Kapelle,
Doch sie wird den Heil'gen nicht erblicken,
Eh' die Wolken ihre Blitze schicken,
Betend kauert sie sich auf der Schwelle.
Ist das nicht des Liebchens taube Muhme?
Ja! So will ich hier nicht länger weilen,
Will zu ihr, zu ihrem Fenster eilen,
Und dort lauschen, statt am Heiligthume.
Weiß ich's denn? Kann nicht ein Blitz da zünden?
Kann ich, wenn ich aus der Glut sie rette,
Nicht – o daß er schon gezündet hätte! –
Ihr mein süß Geheimniß endlich künden?
Sieh, da bin ich schon! Bei'm Lampenlichte
Sitzt sie, in die weiße Hand das Köpfchen
Stützend, mit noch aufgeflochtnen Zöpfchen,
Stillen Schmerz im blassen Angesichte.
Horch', der erste Donnerschlag! Es krachen
Thür und Thor! Sie scheint es nicht zu hören!
Wessen denkt sie? Wüßt' ich's, würd' ich schwören:
Heut' noch will ich den Garaus ihm machen.
Sie erlebt sich. Willst du dich entkleiden?
Gute Nacht! Warum? Zur rechten Stunde
Löscht sie selbst das Licht, und giebt dir Kunde:
Mehr ist nicht erlaubt! Dann magst du scheiden!
Was? Sie knüpft ein Tuch um ihre Locken?
Hüllt sich in der Muhme alten Mantel?
Ist sie – Oder stach mich die Tarantel?
Wird sie – Die Besinnung will mir stocken?
Ja, schon knarrt die Thür. Da kommt sie. Nimmer
Würd' ich selbst sie, so vermummt, erkennen,
Hätt' ich nicht – – Die Lampe läßt man brennen,
Daß es scheint, man sei im frommen Zimmer.
Rasch an mir vorbei! Sie ist, wie Alle!
Folg' ich ihr? Ja freilich! Um zu schauen,
Ob man ihr mit braunen oder blauen
Augen – schwarze hab' ich selbst – gefalle.
Waldhorn-Klänge aus dem Jägerhäuschen!
Bei'm Gewitter? O, das ist ein Zeichen!
So ist das der Jüngling sonder Gleichen?
Wohl! Doch nächstens pflücken wir ein Sträußchen.
Und weshalb? Hat sie dir was versprochen?
Nein! Und dennoch muß ich sie verklagen,
Daß sie, ja, so darf, so darf ich sagen,
Einen stillen Bund mit mir gebrochen.
Weiter! Weiter? So vergieb, Geliebte!
Doch wohin? Hier zieht der Wald sich düster,
Und dort wohnt die Alte an der Rüster,
Die in mancher dunklen Kunst geübte.
Gilt es der? Halt ein! Dein Herz muß klopfen!
Rastlos donnert's ja, zur Feuergarbe
Schwillt der Blitz, blutroth wird seine Farbe,
Und noch immer fällt kein milder Tropfen.
Fort! Und fort! Und unter falschen Bäumen,
Die der Blitz – – Ihr näher! daß sie keiner
Treffen kann, der mich verschont, nicht einer!
Schritt auf Schritt ihr nach! Wer würde säumen!
Ist sie nun am Ziel? Da ist die Hütte!
Ja, sie pocht. Man öffnet ihr. Ich spähe
Durch den Ritz. Wer weiß, was ihr geschähe,
Wenn ich nicht – – Ein Kreis! Sie in der Mitte!
Wie sie da steht, fast zum Schnee erbleichend,
Und die Alte, in der Ecke kauernd,
Dreht ein Bild aus Wachs. Sie sieht es schauernd.
Jetzt spricht die zu ihr, das Bild ihr reichend:
Zieh dir nun die Nadel aus den Haaren,
Rufe den Geliebten, laut und deutlich,
Und durchstich dies Bild, dann wirst du bräutlich
Ihn umfangen und ihn dir bewahren.
Schweigt, ihr Donner! Praßle noch nicht, Regen,
Daß ich noch den Einen Laut vernehme,
Ob er auch des Herzens Schlag mir lähme
Und der Pulse feuriges Bewegen!
Wie sie zögert! Wie sie mit Erröthen
In die Locken greift und eine Nadel
Auszieht auf der Alten stummen Tadel
Und noch säumt, als gälte es, zu tödten!
Endlich zückt sie die, und – meine Sinne
Reißen! – ruft – hinein! Zu ihren Füßen! –
Ruft mich selbst mit Worten, stammelnd-süßen,
Als den Einen, den sie heimlich minne! – –
Und dem Zagen kommt der Muth, behende
Weicht die Thür. Wer durfte sich erfrechen,
Ruft die Alte, und den Zauber brechen? –
Ohne Furcht! Hier kommt nur, der ihn ende!
Sie entweicht mit holden Schaam-Geberden;
Da umschließt er sie, und Glut und Sehnen
Lös't bei Beiden sich in linden Thränen,
Die der Mensch nur einmal weint auf Erden.
Und so steh'n sie, wechseln keine Küsse,
Still gesättigt und in sich versunken,
Schon berauscht, bevor sie noch getrunken,
In der Ahnung dämmernder Genüsse.
Und auch draußen lös't sich jetzt die Schwüle,
Die zerrißnen Wolken, Regen schwanger,
Schütten ihn herab auf Hain und Anger,
Und hinein zur Hütte dringt die Kühle.
Als nun auch der Regen ausgewüthet,
Wallen sie, die Alte gern verlassend,
Kinderfromm sich an den Händen fassend,
Wieder heim, von Engeln still behütet.
Als sie aber scheiden will, da ziehen
Glühendheiß die Nachtviolendüfte
An ihm hin im sanften Spiel der Lüfte,
Und nun küßt er sie noch im Entfliehen.
Ein Dithmarsischer Bauer
Der warme Sommer scheidet
Mit seinem letzten Stral;
Der Sohn des Südens schneidet
Das Korn zum zweiten Mal;
Man bäckt's am Donaustrande,
Man mahlt's am Rhein und Main,
Und führt's am fernsten Rande
Des Reichs zum Dreschen ein.
Hier liegt nun, rings umflossen
Vom Elb- und Eiderfluß,
Ein Freiland, wohl verschlossen,
Dem Kaiser zum Verdruß,
Der's längst dem Kronenträger
Von Dänemark verlieh'n,
Doch, wie den Leu dem Jäger:
Fang ihn, so hast du ihn!
Dort gilt es, sich zu rühren,
Daß nicht der Hagelschlag,
Den manche Ernten spüren,
Die Frucht noch zehnten mag;
Drum rücken alle Hände
Dithmarschens auch in's Feld,
Und zur Quatember-Wende
Ist stets das Werk bestellt!
Nun spricht ein greiser Bauer
In seiner Knechte Kreis:
Wir haben's heute sauer,
Es gilt den letzten Schweiß;
Auf morgen fürcht' ich Regen,
Die Wolken sind zu kraus,
Drum muß der Gottes-Segen
Mir noch vor Nacht in's Haus!
Er spricht's im barschen Tone,
Und fügt kein Wort hinzu
Von doppelt großem Lohne
Und langer Sonntagsruh;
Doch hört man Keinen fluchen,
Denn durch das Weihnachtsbrot
Und durch den Osterkuchen
Vergilt er das Gebot.
Nun geht die Arbeit wacker
Und fröhlich ihren Gang,
Der Weg vom Hof zum Acker
Scheint nur noch halb so lang,
Die vollen Wagen fliegen,
Wie sonst die leeren kaum,
Und ganze Felder schmiegen
Sich unter'm Windelbaum.
Doch immer dunkler thürmen
Die Wolken sich empor;
Der erste von den Stürmen
Des Herbstes steht bevor.
Die weißen Möven wagen
Sich kreischend über'n Deich;
Die Krähen flieh'n mit Zagen,
Die Spatzen folgen gleich.
Der Junge bringt das Essen:
Zurück! Noch fehlt die Zeit!
Der Mittag sei vergessen,
Der Abend ist nicht weit!
Die Pferde selbst gedulden
Sich heut' und springen froh,
Auch zahl' ich meine Schulden
In Hafer, nicht in Stroh!
Und trüber wird's und trüber,
Je mehr die Dämm'rung naht;
Wie pfeift es schon herüber
Vom hohlen Seegestad!
Hinan zum Deiche trabend,
Denkt jetzt der Alte still:
Die haben Feierabend,
Ich – Nun, wie Gott es will!
Jetzt muß das Wetter brechen!
Gleichviel, wir sind gedeckt,
Denn schon wird mit dem Rechen
Die letzte Fuhr besteckt!
Sie kommt auch ohne Schaden
Noch vor der Scheune an,
Doch gar zu hoch beladen,
Klemmt sie im Thor sich dann!
Vorwärts! Die Pferde beißen
In ihr Geschirr vor Wuth,
Die dicken Stränge reißen,
Zum Schweiße fließt schon Blut!
Doch hilft nicht Kraft, noch Schnelle,
Die Scheune selber rückt
Wohl eher von der Stelle,
Als daß die Durchfuhr glückt!
Und plötzlich bricht das Rasen
Der Elemente los,
Der Winde scharfes Blasen
Zerschlitzt der Wolken Schooß,
Da kann ihn Nichts mehr stopfen,
Den neuen Sündflut-Born,
Und jeder Wassertropfen
Fällt, wie ein Hagelkorn.
Nun speit der Alte Flammen:
Der Pferde sind nur zwei,
Der Kerle fünf beisammen,
So tretet selbst herbei!
Gebt Acht, wir werden's zwingen,
Wenn ihr die Räder packt
Und ich vor allen Dingen
Die Deichsel, bis sie knackt.
Die Knechte aber denken:
Ein Thor ist, wer so spricht,
Auch darf man's ihm nicht schenken,
Er kennt die Gränze nicht!
Man muß ihm einmal geigen,
Sonst ist er toll genug
Und spannt uns noch als eigen
Im Frühling vor den Pflug.
Sie schweigen zwar, und nicken,
Als wär' es ihnen recht,
Doch merkt man wohl, sie schicken
In den Befehl sich schlecht.
Sie glotzen dumm und dämisch,
Wie er die Deichsel faßt,
Und grinsen mehr, als flämisch,
Bei seinem: Aufgepaßt!
Und doch! Es ist gelungen
Auf einen einz'gen Ruck!
Habt Dank, ihr braven Jungen!
Nun giebt's auch einen Schluck!
Ich geb' euch eine Tonne
Hamburger Bier zur Nacht,
So zecht denn, bis die Sonne
Dem Spaß ein Ende macht!
Die Knechte aber stehen
Mit offnem Munde da,
Als hätten sie gesehen,
Was nie noch Einer sah;
Dann rufen sie: Sie nennen
Euch längst den Goliath,
Ihr dürft euch wohl bekennen.
Ich mach' auch den noch matt!
Was rühmt ihr meine Stärke?
Seid ihr nicht selbst erhitzt?
Ihr habt ja Theil am Werke,
Bin ich es denn, der schwitzt?
Wir dürfen euch schon loben
Für dieses Teufelsstück:
Wir haben nicht geschoben,
Wir hielten bloß zurück!
So will ich kurz mich fassen:
Ich bin dem Spaß nicht hold,
Doch mögt ihr heute prassen,
So toll ihr immer wollt,
Auch sei auf eure Mühe
Euch nicht die Rast verwehrt,
Nur, daß ihr in der Frühe
Euch gleich vom Hof mir scheert!
Jetzt naht sich aus der Küche
Die Frau mit stolzem Schritt
Und bringt die Wohlgerüche
In ihren Röcken mit;
Sie ruft mit krauser Stirne:
Ei, Wirth, was säumt ihr noch?
Den Stall versieht die Dirne
Und fertig ist der Koch!
Frau, mich soll Gott behüten
Vor Speis' und auch vor Trank
Bei solcher Stürme Wüthen,
Doch habt für diese Dank!
Die können ruhig trinken,
Es wird darum kein Schiff
Auf finstrer See versinken
Am Helgolander Riff!
Nun nickt er ihr, dann reitet
Er eilig wieder fort,
Zum Deich zurück und leitet
Die Strand- und Schiffswacht dort;
Er hat dafür zu sorgen,
So will's das Schlüteramt,
Daß hell bis an den Morgen
Die Feuertonne flammt.
Der Haideknabe
Der Knabe träumt, man schicke ihn fort
Mit dreizig Thalern zum Haide-Ort,
Er ward drum erschlagen am Wege
Und war doch nicht langsam und träge.
Noch liegt er im Angstschweiß, da rüttelt ihn
Sein Meister, und heißt ihm, sich anzuzieh'n
Und legt ihm das Geld auf die Decke
Und fragt ihn, warum er erschrecke.
»Ach Meister, mein Meister, sie schlagen mich todt,
Die Sonne, sie ist ja wie Blut so roth!«
Sie ist es für dich nicht alleine,
Drum schnell, sonst mach' ich dir Beine!
»Ach Meister, mein Meister, so sprachst du schon,
Das war das Gesicht, der Blick, der Ton,
Gleich greifst du« – zum Stock, will er sagen,
Es sagt's nicht, er wird schon geschlagen.
»Ach Meister, mein Meister, ich geh', ich geh',
Bring meiner Frau Mutter das letzte Ade!
Und sucht sie nach allen vier Winden,
Am Weidenbaum bin ich zu finden!«
Hinaus aus der Stadt! Und da dehnt sie sich,
Die Haide, nebelnd, gespenstiglich,
Die Winde darüber sausend,
»Ach, wär' hier Ein Schritt, wie tausend!«
Und Alles so still, und Alles so stumm,
Man sieht sich umsonst nach Lebendigem um,
Nur hungrige Vögel schießen
Aus Wolken, um Würmer zu spießen.
Er kommt an's einsame Hirtenhaus,
Der alte Hirt schaut eben heraus,
Des Knaben Angst ist gestiegen,
Am Wege bleibt er noch liegen.
»Ach Hirte, du bist ja von frommer Art,
Vier gute Groschen hab' ich erspart,
Gieb deinen Knecht mir zur Seite,
Daß er bis zum Dorf mich begleite.
Ich will sie ihm geben, er trinke dafür
Am nächsten Sonntag ein gutes Bier,
Dies Geld hier, ich trag' es mit Beben,
Man nahm mir im Traum drum das Leben!«
Der Hirt, der winkte dem langen Knecht,
Er schnitt sich eben den Stecken zurecht,
Jetzt trat er hervor – wie graute
Dem Knaben, als er ihn schaute!
»Ach Meister Hirte, ach nein, ach nein,
Es ist doch besser, ich geh' allein!«
Der Lange spricht grinsend zum Alten:
Er will die vier Groschen behalten.
»Da sind die vier Groschen!« Er wirft sie hin
Und eilt hinweg mit verstörtem Sinn.
Schon kann er die Weide erblicken,
Da klopft ihn der Knecht in den Rücken.
Du hältst es nicht aus, du gehst zu geschwind,
Ei, Eile mit Weile, du bist ja noch Kind,
Auch muß das Geld dich beschweren,
Wer kann dir das Ausruh'n verwehren!
Komm, setz' dich unter den Weidenbaum
Und dort erzähl' mir den häßlichen Traum,
Mir träumte – Gott soll mich verdammen,
Trifft's nicht mit deinem zusammen!
Er faßt den Knaben wohl bei der Hand,
Der leistet auch nimmermehr Widerstand,
Die Blätter flüstern so schaurig,
Das Wässerlein rieselt so traurig!
Nun sprich, du träumtest – »Es kam ein Mann –«
War ich das? Sieh mich doch näher an,
Ich denke, du hast mich gesehen!
Nun weiter, wie ist es geschehen?
»Er zog ein Messer!« – War das, wie dieß? –
»Ach ja, ach ja!« – Er zog's? – »Und stieß –«
Er stieß dir's wohl so durch die Kehle?
Was hilft es auch, daß ich dich quäle!
Und fragt ihr, wie's weiter gekommen sei?
So fragt zwei Vögel, sie saßen dabei,
Der Rabe verweilte gar heiter,
Die Taube konnte nicht weiter!
Der Rabe erzählt, was der Böse noch that,
Und auch, wie's der Henker gerochen hat,
Die Taube erzählt, wie der Knabe
Geweint und gebetet habe.
Vater unser
Blitze lauern hinter Wolken,
In den Eichen wühlt der Sturm;
Dicker Wald; ein Nothgeläute
Hallt schon dumpf von manchem Thurm.
Ruhig unter'm breiten Baume,
Seine Pfeife in dem Mund,
Liegt der alte Räuberhauptmann;
Ihm zu Füßen schläft sein Hund.
Und ein Jüngling, bleich, wie Keiner,
Streckt sich ihm zur Seite hin.
»Schleif dein Messer!« spricht der Alte,
Er gehorcht mit schwerem Sinn.
Roth und zischend zwischen Beide
Springt ein Blitz, doch trifft er nicht.
»Vater unser!« ruft der Jüngling,
Doch der Alte flucht und spricht:
»Vater unser lass' ich gelten,
Wenn man auf dem Richtstuhl sitzt,
Wenn die Scheere in den Haaren
Und das Beil im Nacken blitzt.
Jetzt verbiet' ich dir das Beten,
Denn zum Herrn erkorst du mich,
Und ich stell' den Mord noch heute
Dunkel zwischen Gott und dich!
Ja, ich schwör's, du sollst den Ersten,
Den du hier erblicken wirst,
Tödten, daß du nicht noch einmal
Dich von mir zu Gott verirrst.
Du erschrickst? Ich will's nicht schelten,
Mir auch schien das einst gar viel,
Und auch du erlebst die Zeiten,
Wo du's treibst, wie ich, als Spiel.
Mir ist solch ein Muth gekommen,
Seit ich, weil er zornig sprach
Vom Gericht und andern Dingen,
Meinen Vater niederstach.«
Angstgeschüttelt ruft der Jüngling:
»Nimmer, nimmer that'st du das!«
Kräftig schmauchend spricht der Alte:
»Ei, ich that's, und ist's denn was?«
»Wohl, da muß ich's freilich halten,
Was du schwurst, und thu's mit Lust!«
Ruft's, und stößt dem grausen Alten
Fest sein Messer in die Brust.
Jener ballt die Hand, verröchelnd,
Doch er sieht es ohne Graus,
Betet, wie nach einem Opfer,
Laut sein Vaterunser aus.
Die Polen sollen leben
(Neujahrsnacht 1835.)
Zu Hamburg in dem Saale,
Voll Lichterglanz und Pracht,
Sitzt mancher Gast beim Mahle
In heil'ger Neujahrsnacht;
Die Fremden sind's, sie wären gern
Im Vaterland, doch das ist fern,
Nun wird denn sein gedacht.
Erst haben sich die Gäste
Kalt in's Gesicht geschaut,
Doch werden sie bei'm Feste
Bald froh und wohlvertraut.
Nur Einer, welchen Niemand kennt,
Blickt stumm in's Licht, wie's niederbrennt,
Jung, aber schon ergraut.
Ihm dünken sie Gespenster
In ihrer Lust zu sein;
Er kehrt sich ab; in's Fenster
Wirft hell der Mond den Schein.
Er spricht: du überschaust die Welt,
So sag', ob Polen steht, ob fällt! –
Die Wolke hüllt ihn ein.
Sein Herz will zornig wallen,
Da schwört er still sich zu:
Magst steh'n, mein Volk, magst fallen,
Ich steh' und fall', wie du!
Gewiß der Erste, wär' ich dort,
Der Letzte hier am fremden Ort,
Mein Dolch bringt mich zur Ruh.
Der Glockenthurm thut eben
Die zwölfte Stunde kund,
Die Polen sollen leben!
Ruft er mit lautem Mund.
Ein Jeder greift, wie er, zum Glas,
Sie All' erglüh'n, doch er sinkt blaß
Zurück, ist todt zur Stund'.
Sie gießen, statt zu trinken,
Den Wein jetzt in den Sand;
Sie sah'n das Schicksal winken
Und haben's wohl erkannt,
Daß Polen bald dem Todten gleicht,
Doch Keiner ahnt, wie bald vielleicht
Die Welt dem Polenland.
Schön Hedwig
Im Kreise der Vasallen sitzt
Der Ritter, jung und kühn;
Sein dunkles Feuerauge blitzt,
Als wollt' er zieh'n zum Kampfe,
Und seine Wangen glüh'n.
Ein zartes Mägdlein tritt heran
Und füllt ihm den Pocal.
Zurück mit Lächeln tritt sie dann,
Da fällt auf ihre Stirne
Der klarste Morgenstral.
Der Ritter aber faßt sie schnell
Bei ihrer weißen Hand.
Ihr blaues Auge, frisch und hell,
Sie schlägt es erst zu Boden,
Dann hebt sie's unverwandt.
»Schön Hedwig, die du vor mir stehst,
Drei Dinge sag' mir frei:
Woher du kommst, wohin du gehst,
Warum du stets mir folgest;
Das sind der Dinge drei!«
Woher ich komm'? Ich komm' von Gott,
So hat man mir gesagt,
Als ich, verfolgt von Hohn und Spott,
Nach Vater und nach Mutter
Mit Thränen einst gefragt.
Wohin ich geh'? Nichts treibt mich fort,
Die Welt ist gar zu weit.
Was tauscht' ich eitel Ort um Ort?
Sie ist ja allenthalben
Voll Lust und Herrlichkeit.
Warum ich folg', wohin du winkst?
Ei, sprich, wie könnt' ich ruh'n?
Ich schenk' den Wein dir, den du trinkst,
Ich bat dich drum auf Knieen
Und mögt' es ewig thun!
»So frage ich, du blondes Kind,
Noch um ein Viertes dich;
Dies Letzte sag' mir an geschwind,
Dann frag' ich dich Nichts weiter,
Sag', Mägdlein, liebst du mich?«
Im Anfang steht sie starr und stumm,
Dann schaut sie langsam sich
Im Kreis der ernsten Gäste um,
Und faltet ihre Hände
Und spricht: Ich liebe dich!
Nun aber weiß ich auch, wohin
Ich gehen muß von hier;
Wohl ist's mir klar in meinem Sinn:
Nachdem ich dieß gestanden,
Ziemt nur der Schleier mir?
»Und wenn du sagst, du kommst von Gott,
So fühl' ich, das ist wahr.
Drum führ' ich auch, trotz Hohn und Spott,
Als seine liebste Tochter
Noch heut' dich zum Altar.
Ihr edlen Herrn, ich lud verblümt
Zu einem Fest euch ein;
Ihr Ritter, stolz und hoch gerühmt,
So folgt mir zur Kapelle,
Es soll mein schönstes sein!«
's ist Mitternacht
's ist Mitternacht!
Der Eine schläft, der And're wacht.
Er schaut bei'm blauen Mondenlicht
Dem Schläfer still in's Angesicht;
D'rin thut ein böser Traum sich kund
Wie seltsam zuckt er mit dem Mund!
's ist Mitternacht,
Der Eine schläft, der And're wacht.
's ist Mitternacht!
Der Eine schläft, der And're wacht!
»So sah der Freund noch immer aus,
Er greift zum Dolch, es macht mir Graus,
Er stößt, er lacht – du triffst ja mich!
Erwache doch! Ich rüttle dich!«
's ist Mitternacht!
Der And're ist nur halb erwacht.
's ist Mitternacht!
Der And're ist nur halb erwacht!
Die Spanierin
»Flasche, wunderbar versiegelt,
Deinen Glutwein trink' ich jetzt,
Daß er meinen Geist, beflügelt,
Nach Hispania versetzt!
Daß ich jenen Hügel schaue,
D'rauf er wuchs und Feuer sog,
Und das Felsenhaupt, das graue,
Das sich auf ihn niederbog.
Und das Mädchen, das ihn streifte
Mit des Flammenauges Stral,
Daß er doppelt schneller reifte,
Wenn sie kam aus ihrem Thal.
Das sich oft in seinem Schatten
An den Reben still entzückt,
Und zuletzt die feuersatten
Für ein Festmahl ausgedrückt.«
Wie aus einer Ader, schäumend
In den Becher rinnt der Wein,
Hastig trinkt der Jüngling, träumend
Blickt er dann in's Glas hinein.
Eine dunkle Rebenlaube
Sieht er vor sich, heimlich, dicht,
Traube drängt sich d'rin an Traube,
Doch das Mädchen sieht er nicht.