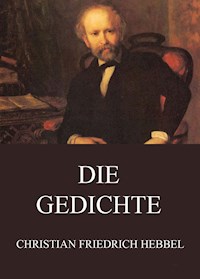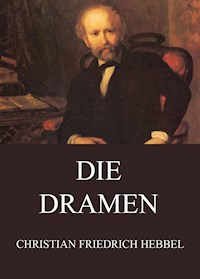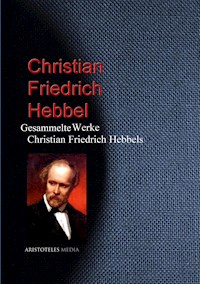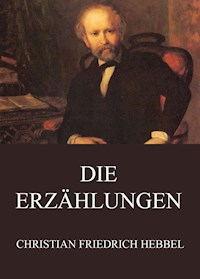
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Christian Friedrich Hebbel war ein deutscher Dramatiker und Lyriker. Dieser Band beinhaltet seine schönsten Erzählungen: Die einsamen Kinder Anna Schnock Matteo Die Kuh
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 209
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Erzählungen
Christian Friedrich Hebbel
Inhalt:
Friedrich Hebbel – Biografie und Bibliografie
Die einsamen Kinder
Anna
Schnock
Matteo
Die Kuh
Die Erzählungen, C. F. Hebbel
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN:9783849627317
www.jazzybee-verlag.de
Dieses Werk bzw. Inhalt und Zusammenstellung steht unter einer Creative Commons Namensnennung 3.0 Deutschland Lizenz. Die Details der Lizenz und zu der Weiterverwertung dieses Werks finden Sie unter http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/. Der Inhalt und die Zusammenstellung oder Teile davon wurden der TextGrid-Datenbank entnommen, wo der Inhalt und die Zusammenstellung oder Teile davon ebenfalls unter voriger Lizenz verfügbar sind. Eine bereits bestehende Allgemeinfreiheit der Texte bleibt von der Lizensierung unberührt.
Friedrich Hebbel – Biografie und Bibliografie
Hervorragender Dichter, geb. 18. März 1813 zu Wesselburen in Dithmarschen, gest. 13. Dez. 1863 in Wien, verlebte seine Jugend in den Marschen und Meeresumgebungen seiner Heimat, nährte eine früh erwachte gestaltenreiche Phantasie an wenigen Büchern, wurde mit 14 Jahren Schreiber des Kirchspielvogts Mohr in Wesselburen und erhielt 1834 durch Gönner die Mittel, sich nach Hamburg zu begeben, um die Lücken seiner Bildung auszufüllen. Hier rang sich sein Genius in heftiger, schmerzenreicher Gärung empor und seinem leidenschaftlichen Liebesbedürfnis begegnete die aufopfernde Treue seiner hingebenden Freundin Elise Lensing. Die innern Kämpfe setzten sich in den eindrucksreichen, aber oft durch bitterste Notgetrübten Universitätsjahren fort. H. studierte im Sommer 1836 in Heidelberg, von da an bis Ostern 1839 in München, gewann hier namentlich durch Schelling tiefe Eindrücke und erkannte seine unzweifelhafte Bestimmung zum Dichter. 1839 nach Hamburg zurückgekehrt, dichtete er hier seine Erstlingstragödie: »Judith« (Hamb. 1841, 2. Aufl. 1873), der wenig später »Genoveva« (das. 1843) folgte. In beiden Tragödien zeigte sich eine ungewöhnliche dramatische Dichterkraft, namentlich eine Gewalt der Charakteristik, eine Unmittelbarkeit und Glut der Leidenschaft, die H. auf der Stelle als ein Talent ersten Ranges erkennen ließen. Daneben mußte freilich die Neigung des Dichters zum Krassen und Bizarren und mehr noch die dicht neben seiner natürlichen Leidenschaft stehende Neigung zu einer zersetzenden Reflexion erschrecken. Eine Sammlung seiner »Gedichte« (Hamb. 1842; »Neue Gedichte«, Leipz. 1848; vervollständigte Gesamtausgabe, Stuttg. 1857) bewies indes, daß dem Dichter auch die zarten und innigen Töne der Lyrik zu Gebote standen. 1843 kam er nach Kopenhagen, wurde hier vom König-Herzog seines Heimatlandes Holstein mit einem mehrjährigen Reisestipendium bedacht, ging zuerst nach Paris, wo er das bürgerliche Trauerspiel »Maria Magdalene« (Hamb. 1844) dichtete, mit Heine und Ruge bekannt wurde und in Bamberg einen treuergebenen Freund für das Leben gewann. »Maria Magdalene«, obwohl schroff, herb und in der Voraussetzung peinlich, wirkte dennoch durch meisterhafte Charakteristik und Entwickelung und war das reifste Produkt der ersten Periode Hebbels. Tiefen Schmerz bereitete ihm die Nachricht von dem Tode seines Söhnchens Max; im Mai 1844 schenkte Elise Lensing, die vergeblich um eheliche Sanktionierung des Liebesbundes bat, einem zweiten Knaben das Leben. Vom September 1844 bis Oktober 1845 weilte H. in Italien, kehrte auf der Rückreise in Wien ein und ließ sich durch das Entgegenkommen begeisterter Verehrer bewegen, hier dauernd seinen Wohnsitz zu nehmen. Insbesondere fesselte ihn die geistvolle Schauspielerin des Burgtheaters Christine Enghaus, der H. 26. Mai 1846 die Hand am Altar reichte, ein Schritt, der zugleich das Lebensglück seiner treuen Jugendfreundin Elise Lensing vernichtete. Äußern Sorgen nunmehr enthoben, fand H. an der Seite seiner ebenso edlen wie gebildeten Gattin, die mit den Jahren immer tiefer auf ihn einwirkte, den Frieden der Seele, den er zuvor vergebens erstrebt hatte, wenn auch bereits in den lyrischen Dichtungen seiner italienischen Wandertage eine gewisse Lösung von der dunkelpessimistischen Weltanschauung seiner Jugend zu bemerken war. Eine schmerzliche Reaktion erlebte er jedoch wieder durch die Eindrücke der Revolution von 1848 und der nächstfolgenden Jahre. Die dramatischen Dichtungen dieser zweiten Periode: »Der Diamant«, Komödie (Hamb. 1847), »Herodes und Mariamne« (Wien 1850), »Julia«, Trauerspiel (Leipz. 1851), »Der Rubin«, Märchenlustspiel (das. 1851), »Ein Trauerspiel in Sizilien«, Tragikomödie (das. 1851), zeigten wohl im Ausdruck weniger Überschwenglichkeit, waren aber dafür bizarrer, herber, kälter als die Werke der Jugendzeit Hebbels; sie konnten die Bühne nicht zum Aufgeben ihres spröden Widerstandes gegen Hebbels starre Originalität veranlassen. Im Verlauf der 1850er Jahre begann sich dann der Dichter in bemerkenswerter Weise zu läutern und neben der Erhabenheit auch Schönheit der Darstellung zu erstreben. Diese dritte Periode begann mit dem kleinen Drama »Michel Angelo« (Wien 1855), einer anmutigen poetischen Selbstverteidigung, und mit der Tragödie »Agnes Bernauer« (das. 1855), bis auf die menschlich widerstrebende Staatsidee ein Werk voll Frische, Kraft und anmutigen Reizes; sie setzte sich fort in dem formell schönen, aber im Konflikt unversöhnlich herben Trauerspiel »Gyges und sein Ring« (das. 1856) und gipfelte in den lyrischen Dichtungen dieser Jahre, in der prächtigen epischen Dichtung »Mutter und Kind« (Hamb. 1859) und im Meisterwerk des Dichters, der dramatischen Trilogie »Die Nibelungen« (das. 1862, 3. Aufl. 1874), in der H. den gewaltigen epischen Stoff als den großen Konflikt zwischen der heidnischen und christlichen Weltanschauung vollständig dramatisierte. Die Früchte seines endlichen Erfolgs zu pflücken, war aber dem Dichter so wenig beschieden wie die Beendigung seiner letzten bedeutenden Tragödie »Demetrius« (Hamb. 1864). Nach seinem Tod erschienen seine »Sämtlichen Werke« (hrsg. von Emil Kuh und A. Glaser, Hamb. 1866–68, 12 Bde.); eine andre Ausgabe besorgte Krumm (das. 1892, 12 Bde.), die beste Gesamtausgabe R. M. Werner (Berl. 1901–03, 12 Bde.); eine gut kommentierte Auswahl K. Zeiß für Meyers Klassiker-Bibliothek (Leipz. 1899, 4 Bde.), eine andre R. Specht (Stuttg. 1903, 6 Bde.). Seine gedankenreichen »Tagebücher« gab zuerst Felix Bamberg heraus (Berl. 1885–86, 2 Bde.), neuerdings besser (als 2. Abteilung der »Sämtlichen Werke«) R. M. Werner (das. 1903, 4 Bde.; 3. Aufl. 1904), den »Briefwechsel mit Freunden und berühmten Zeitgenossen« (das. 1890–92, 2 Bde.) ebenfalls Bamberg und dazu eine »Nachlese« R. M. Werner (das. 1900, 2 Bde.). Vgl. E. Kuh, Biographie F. Hebbels (Wien 1877, 2 Bde.); Kulke, Erinnerungen an Fr. H. (Wien 1878); Ad. Stern, Zur Literatur der Gegenwart (Leipz. 1880); A. Bartels, Friedrich H. (in Reclams Universal-Bibliothek); A. Neumann, Aus Friedrich Hebbels Werdezeit (Zitt. 1899); J. Krumm, Friedrich H. (Flensb. 1899); K. Böhrig, Die Probleme der Hebbelschen Tragödie (Leipz. 1899); Th. Popp, Friedrich H. und sein Drama (Berl. 1899); R. Graf von Schwerin, Hebbels tragische Theorie (Rost. 1903); A. Scheunert, Der Pantragismus als System der Weltanschauung und Ästhetik F. Hebbels (Hamb. 1903); W. Waetzoldt, H. und die Philosophie seiner Zeit (Berl. 1903); E. A. Georgy, Die Tragödie F. Hebbels nach ihrem Ideengehalt (Leipz. 1904); F. Zinkernagel, Die Grundlagen der Hebbelschen Tragödie (Berl. 1904); R. M. Werner, H., ein Lebensbild (das. 1904).
Die einsamen Kinder
Märchen
1
Es war ein schauerlicher Winterabend. Der Sturm brauste um die Dachhaube, als ob er sie abreißen wollte, der Regen schlug in dicken Tropfen an die kleinen, hier und da mit Papier verklebten Bleifenster, und in dem elenden Kämmerlein, in welches ich euch hineinführe, brannte kein lustiges Kaminfeuer. Dennoch hatten Wilhelm und Theodor, die armen, verwaisten Kinder, sich dicht nebeneinander auf die kalte Ofenbank gekauert, vielleicht, um dort von einem warmen Ofen und hinreichenden Abendbrot zu träumen, vielleicht, um sich glücklicherer Stunden an dem Platze, wo sie sie vorzugsweise genossen haben mochten, zu erinnern. Doch die Kälte war zu scharf, der Hunger zu groß, als daß sie von Träumen warm oder von Erinnerung satt hätten werden können; sie seufzten, sie sahen einander mit tränenvollen Blicken an, und als zuletzt gar die armselige Lampe, welche bisher noch einen schwachen Schimmer in der großen, leeren Stube, die sich bei dem gänzlichen Mangel an Möbeln fast unheimlich ausnahm, verbreitet hatte, ganz und gar ausging, schauderte der kleine Theodor zusammen und sagte halbleise zu seinem Bruder:
»Wilhelm, ich fürchte mich, laß uns zu Bett gehen!«
»Ich fürchte mich nicht«, gab Wilhelm zur Antwort, »aber ich friere und hungere, und wenn ich auch zu Bett gehe, so kann ich doch vor Hunger nicht schlafen!«
»Schlafen kann ich«, erwiderte Theodor, »und ich träume dann immer sehr angenehm, ich gehe mit Vater und Mutter spazieren im Walde, wir pflücken Erdbeeren, Mutter schneidet mir große Butterbröte, oder Vater bringt mir etwas mit aus der Stadt.
Träumst du nicht, Wilhelm?«
»O ja«, versetzte dieser, »aber meine Träume sind anderer Art.
Einmal sah ich, wie die Hütte über uns zusammenstürzte, ich sprang aus dem Fenster, du warst zu langsam und wurdest zerschmettert; ich sehe dich noch unter den Balken liegen mit dem blutigen, zerquetschten Kopfe. Ein anderes Mal gingen wir zusammen im Walde; du fandest eine schöne Frucht, wie wir noch niemals gesehen hatten, als wir sie aber essen wollten, kam plötzlich ein großer Raubvogel und riß sie dir mit dem hungrigen Schnabel aus der Hand; ich erhaschte ihn bei den Flügeln; er aber hackte mir ins Auge, so daß ich ihn loslassen mußte.«
»Armer Wilhelm«, sagte Theodor, »ich wollte, daß ich dir meine Träume mitteilen könnte! Es ist doch schlimm, daß du in dem selben Augenblick, wo mir träumt, du begleitest mich, issest mit mir und teilst meine Freuden, in Angstschweiß liegen und mit Ungeheuern kämpfen mußt.«
»Ach was«, entgegnete Wilhelm unwillig, »mit meinen Träumen wollte ich leicht fertig werden, wenn wir nur am Tage etwas zu essen hätten. Du bist auch viel ungeschickter als ich; weißt du wohl, daß ich gestern und vorgestern beide Male eine Drossel fing? Wenn es mir aber mit dem Fange nicht geglückt, du bringst nie das Geringste nach Hause. Ich weiß kaum, warum ich noch immer mit dir teile; wärst du nicht gewesen, so hätte ich noch Kartoffeln und Brot die Menge gehabt.«
»Du bist wieder einmal recht sehr hart gegen mich«, antwortete Theodor nach einer ziemlich langen Pause, »ich weiß wohl, daß ich selten oder niemals Glück habe, wenn ich in den Wald gehe, um Wurzeln zu suchen oder ein kleines Tier, einen Vogel usw. für unseren Tisch zu fangen, aber ich lasse es doch an gutem willen nicht fehlen und bin ja auch noch nicht so groß wie du.«
Ein tiefes Stillschweigen entstand. Schauriger brauste der Sturm. Nach einer Weile sagte Theodor:
»Wilhelm, ich lege mich zu Bett; es ängstigt mich gar zu sehr, ich meine bei jedem Windstoß, daß die Hütte zusammenbricht.«
»Gehe nicht zu Bett, lieber Theodor«, versetzte Wilhelm und faßte seine Hand, »fühlst du nicht, wie ich zittere? Es war mir eben, als ob Vater vor mir stände, so blaß und entstellt, wie er draußen in der Kammer liegt; weiß du noch, wir sahen ihn zum letztenmal, als wir Mutter hineintrugen. Er drohte mir mit dem Finger, o, Theodor, ich will dich recht lieb haben!«
»Ach, Wilhelm«, entgegnete Theodor leise, »mich grauset bei deinen Worten. Ich glaubte, unsere Mutter zu sehen, sie schaute mit trüben, ernsthaften Blicken auf dich und schlug ihre Augen dann gen Himmel. Sollten unsere Eltern wirklich noch leben; sollten sie in einem tieferen Schlafe liegen und nur selten er wachen dürfen? Wollen wir einmal in die Kammer gehen?«
»Nein, nein!« antwortete Wilhelm hastig, »ich gehe nicht in die Kammer. Vater und Mutter sind tot; sie haben uns oft gesagt, daß die Toten vor dem Jüngsten Tage nicht wieder erwachen.«
»Wie, Wilhelm«, versetzte Theodor, »wenn heute der Jüngste Tag wäre? Hast du jemals einen solchen Sturm erlebt? Es ist, als ob alle Bäume aus der Erde gerissen würden.«
»Wir wollen beten«, sagte Wilhelm, »bete, Theodor!«
»Und ich will den lieben Gott um den Jüngsten Tag bitten«, antwortete Theodor und faltete seine Hände.
Plötzlich ließ sich vor den Fenstern ein wildes Gelächter vernehmen, und es war, als ob an die Tür gepocht würde.
»Was war das?« rief Wilhelm.
»Bruder, Bruder, bete!« rief Theodor.
Das Gelächter wurde stärker und wilder wiederholt, ein helles Licht drang in das Fenster, und seltsame Gestalten huschten, wie Schattenbilder, vorüber. Theodor klammerte sich ängstlich an seinen Bruder, dieser aber rief: »Laß mich los, laß mich los, ich will hinaus!«
»Um Gottes willen nicht, Bruder!« ermahnte Theodor. Doch Wilhelm ließ sich nicht halten, sondern eilte fort. Kaum hatte er die Tür geöffnet, als der Sturm auf einmal schwieg; liebliche Klänge und Gesänge schallten ihm entgegen, schöne Blumen erfüllten die Luft mit Wohlgerüchen, und es war heller Tag. Wilhelm traute seinen Augen nicht und fragte sich selbst: hab ich denn einen von Theodors Träumen? Plötzlich stand ein langer, hagerer Mann mit einem eingefallenen, düsteren Gesicht vor ihm und rief ihm mit dumpfer Stimme zu: »Laß die Gedanken an den Bruder und sieh dich hier um!« Wilhelm wagte kaum, den Mann anzusehen, obgleich dieser sich auf alle Weise bestrebte, ungewöhnliche Freundlichkeit in seine Mienen zu legen; umso lieber aber folgte er dem Geheiß desselben, sich umzusehen, und bewunderte die seltene Pracht und Herrlichkeit, die ihn umgab und die sich mit jeder Minute veränderte. Bald sah er einen großen, von köstlichen Gärten eingefaßten, dunkelblauen See, in welchem das Bild der Sonne schwamm, wie eine goldene Kugel, und dessen sanfte Wellen, sowie ein leiser Luftzug sie bewegte, in allen Farben spielten; bald ein lustig grünendes Wäldchen mit Rehen, Hirschen und Eichhörnchen; jetzt schaute er in einen mächtigen Palast hinein, mit Pforten von gediegenem Silber und Wänden von Stahl, und jetzt stieg ein riesenhafter Turm vor seinen Blicken in die Höhe, und all diese ungeheuren Erscheinungen schienen nicht tote Massen zu sein, sie schienen ein eigentümliches Leben zu haben und nach eigener Willkür zu kommen und zu verschwinden. Wilhelm verwandte kein Auge von dem Turm, denn ihm war, also ob er ganz oben in einem der vielen Erker das Bild seiner Mutter gewahre, die ihn unverwandt und wehmütig, fast bittend ansah; der hagere, finstere Mann sah auch hinauf, ein düsterer Schatten lief über sein Gesicht, und er fragte den Knaben hastig, um ihn von der Betrachtung des Turmes abzuziehen, ob er auch vielleicht hungrig sei.
»Ach, recht sehr«, antwortete Wilhelm, »ich habe den ganzen Tag nichts gegessen.«
»Den ganzen Tag nicht?« entgegnete der Hagere, »ei, ei, wo waren denn deine Eltern, daß sie dir nicht zu essen gaben?«
»Meine Eltern sind tot, mein Vater starb vor vierzehn Tagen, meine Mutter vor acht.«
»Tot« versetzte der Hagere mit einer unangenehmen höhnischen Lache, »ja, ich weiß, ich weiß! Faul Volk, faul Volk! Wenn das nicht mehr arbeiten mag, so legt sichs auf den Rücken und stellt sich tot! Hä! hä! hä!«
»Lache nicht, Mann«, sagte Wilhelm, und kalte Schauer rieselten ihm durch Mark und Bein, »mein Vater und meine Mutter sind tot!«
»Es gibt keinen Tod«, erwiderte der Hagere, »es gibt nur Leben, nur Leben. Was sich tot stellt, das kehrt die alte Spielerei um, schläft bei Tage und verlädt bei Nacht sein Grab, um zu hüpfen und zu springen. Wo liegt dein Vater und deine Mutter? führ mich hin, führ mich hin, sollen schon heraus, mögen wollen oder nicht!«
Wilhelm starrte ihn an. Dann sagte er: Mein Vater und meine Mutter liegen in der Kammer, den Vater trug die Mutter dahin, als er gestorben war, die Mutter wir, ich und mein Bruder. Da sah ich meinen Vater zum letztenmal; seine Augen waren aufgesprungen, seine Wangen entsetzlich aufgedunsen – »o, er ist wohl tot!«
Der Hagere lachte. Wilhelm war es, als ob er durch dies Gelächter vernichtet würde, er schrie laut auf und wollte entfliehen. Doch auf einmal stand ein mit den schönsten Speisen besetzter Tisch vor ihm, und der Hagere rief ihm zu:
»Dummer Knabe, willst denn verhungern? Bleib doch! Iß, iß! Hab dich längst gerufen, hab dich lieb!«
Der Hunger erwachte wieder mit aller Gewalt in Wilhelm, als er die Gelegenheit, ihn zu stillen, vor sich sah. Er aß und trank gierig und war schon halb gesättigt, als er sich seines armen Bruders erinnerte und den Hageren bat, doch auch diesen herbeizurufen. Der aber machte ein falsches Gesicht und sagte:
»Davon kein Wort. Sorge für dich! Siehst du jenen Baum? Neben ihm steht einer, der dem Ausgehen nahe ist; er kümmert sich nicht darum, er saugt ruhig aus Luft und Erde seine Nahrung ein.«
»Das klingt ganz anders, als Vater und Mutter mir sagten!« erwiderte Wilhelm schüchtern.
»Weiß wohl«, erwiderte der Hagere, »hab aber recht, hab immer recht.«
Wilhelm schwieg, doch aß er nur noch wenig mehr.
»Willst zurück in deine Hütte?« fragte der Hagere, »will dich heut abend nicht länger aufhalten, werden uns schon noch kennenlernen. Nimm mit zu essen, was du willst, habs übrig!«
Er steckte Wilhelm alle Taschen voll Obst und Backwerk. Dann fuhr er fort:
»Sollst lieben Vater, liebe Mutter doch schnell noch einmal sehen, siehst sie wohl gern?«
Auf einmal war es eine kalte Mondnacht, Wilhelm befand sich mit dem langen, hageren Manne auf einem luftigen Revier, ihm klapperten die Zähne, halb vor Angst, halb vor Frost. Der Mond verhüllte sich hinter Wolken; Na erschien tänzeln und spielend ein langer Zug kaum sichtbarer Gestalten, unter welchen Wilhelm mit Entsetzen seine Eltern erkannte. Diese gebärdeten sich vor allen lustig; sie hüpften an ihm vorüber und warfen, obgleich sie ihn wohl bemerkten, gleichgültige Blicke auf ihn. Der Hagere nickte ihm mit grinsendem Lächeln zu und sagte: »Hast dus gesehen? Hätte Theodor hier gestanden, wären sie freundlicher gewesen; wirsts glauben!«
Plötzlich kehrte die alte Dunkelheit zurück, der Sturm brauste fürchterlich, der Regen klatschte, und Wilhelm stand vor der Hüttentür. Er trat schnell hinein.
»Ach, Wilhelm, bist du wieder da?« rief Theodor ihm entgegen, »ich fürchtete, daß ich dich niemals wiedersehen würde, denn ich sah dich in einem wilden Meer von Flammen, die sich immer dichter um dich zusammenringelten und dich zuweilen ganz zu verschlingen schienen; ja einmal kam es mir sogar vor, als ob du Flammen äßest. Ich stand am Fenster und rief dir zu, du möchtest beten; dann aber lachte es auf gräßliche Weise hinter mir; ach, Wilhelm, laß mich nicht wieder allein.«
»Ich bringe dir etwas zu essen mit«, erwiderte Wilhelm einsilbig, »nimm hin, Obst und Kuchen!«
Der kleine Theodor streckte hastig die Hand aus nach den dargebotenen Leckerbissen, doch kaum hatte er sie zum Munde geführt, als er ausrief: »Pfui, Wilhelm, das ist unartig von dir, mich jetzt zu necken; du gibst mir ja nichts als faules Holz!«
»Was?« versetzte Wilhelm, »diese Kuchen und diese schönen Birnen wären faules Holz? Dich hat der Hunger wohl schon verrückt gemacht. Mir schmecken sie vortrefflich!«
Mit großem Vergnügen verzehrte er noch einen der Kuchen.
Theodor versuchte sie abermals, als er sie indes wieder ausspeien mußte, fing er an, bitterlich zu weinen.
2
Es war schon spät am Morgen, die Sonne schaute in die trüben Fenster, als Wilhelm erwachte. Seltsame Träume, die unvermeidlichen Ergebnisse der Vorgänge des vorigen Abends, hatten ihn umgaukelt, und wie er die Augen aufschlug, stieß er seinen Bruder in die Seite und rief: »Theodor wo ist doch der lange, hagere Mann geblieben, der mich die fremden Spiele lehrte und mir einmal sogar Flügel an die Schultern setzte, womit ich mich hätte in die Lüfte aufschwingen können, wenn mich die Angst nur nicht zurückgehalten hätte?« Theodor aber gab keine Antwort, sondern ächzte und stöhnte tief Wilhelm wandte sich nach ihm um und sah, daß sein Gesicht kreideweiß war; er erschrak heftig und schrie ängstlich: »Theodor, bester Bruder, was fehlt dir?« Theodor richtete einen matten Blick auf ihn und sagte: »Ich weiß es selbst nicht, lieber Bruder, ich fühle mich gelähmt an allen Gliedern, ich habe die ganze Nacht keine Luft schöpfen können, mir war, als ob dicker Qualm die Stube erfülle, und du lagst in einem so schweren Schlaf, daß ich geglaubt haben würde, du wärest schon erstickt, wenn ich nicht deine regelmäßigen Atemzüge hätte hören können. Ach, Wilhelm, ich glaube, der Rauch kam von den Sachen, die du mitgebracht hast, ich wäre gern aufgestanden und hätte sie aus dem Fenster geworfen, aber ich konnte mich nicht rühren; wirf du sie doch fort und gehe des Abends nie wieder hinaus!«
»Das Fieber spricht aus dir«, erwiderte Wilhelm verdrießlich, indem er aufstand; »siehst du diese schönen Kuchen? Sie sollen uns köstlich zum Morgenimbiß munden!«
»Komme mir nicht nahe damit«, schrie Theodor entsetzt, als Wilhelm ihm ein Stück Kuchen hinreichen wollte; »ach, Bruder, wirf sie weg, denn gewiß hat sie dir kein anderer gegeben als der böse Geist, von welchem Mutter uns erzählte, daß er im Walde rumore und uns feindlich gesinnt sei.«
»Der böse Geist!« antwortete Wilhelm und fuhr dann leise und von Schauern gerüttelt fort: »ja, der Mann war sehr finster, und ich zitterte und bebte, als ich ihm zum ersten Male in die hohlen Augen sah; doch er belustigte mich ja durch allerlei Wunderwerke, die er mich sehen ließ, und statt mir etwas zuleide zu tun, gab er mir zu essen. Er konnte unmöglich der böse Geist sein! Und gesetzt, es wäre der böse Geist gewesen – warum zürnte er auf uns?«
»Das weiß ich auch nicht!« erwiderte Theodor und bat seinen Bruder um etwas kaltes Wasser, welches dieser ihm in einem irdenen Napf hinreichte.
»Auf Vater und Mutter«, begann Wilhelm abermals, »mochte der Geist zürnen; sie erzählten uns von ihm ja nichts als Böses, und das würde mich selbst verdrießen.«
»Weißt du wohl noch«, sagte Theodor, »wie Vater eines Abends nach Hause kam und von Blut triefte? Das hatte der böse Geist getan!«
»Dies machte die Mutter uns weis«, entgegnete Wilhelm, »weil der Vater unserer Fragen wegen ärgerlich wurde; nachher sagte sie mir, der Vater wäre mit einem Jäger im Walde zusammengekommen, der habe ihm das Schießen verbieten und ihn ergreifen wollen und den Vater, als er sich zur Wehr gesetzt, in den Arm geschossen.«
»Was ist das, ein Jäger?« fragte Theodor.
»Ein Mann«, entgegnete Wilhelm, »der Tiere schießt, wie unser Vater, denn es leben noch viel mehr Menschen als wir beide auf der Welt, und die Welt ist viel größer als dieser Wald.«
»Das weiß ich«, versetzte Theodor, »Vater ging ja manchmal des Abends, wenn er einen großen Rehbock oder gar einen stattlichen Hirsch ausgeweidet hatte, zu den Menschen und brachte dann Brot und sonstige Lebensmittel mit; aber er war dabei immer so scheu und ängstlich, daß er sie gewiß sehr fürchtete, und daß ich selbst zittere, wenn ich daran denke, es könne einmal einer den Weg zu unserer Hütte finden.«
»Darum zittere ich gar nicht«, erwiderte Wilhelm, »ich wollte nur, daß ich aus dem dicken Walde herauszukommen wüßte; dann suchte ich die Menschen sogleich auf, Vater und Mutter waren ja auch Menschen.«
»Ach, Wilhelm«, klagte Theodor, »ich bin so hungrig, solltest du nicht einige wilde Wurzeln ausgraben können?«
»Ich wills versuchen«, entgegnete Wilhelm, »da du nun einmal glaubst, daß du meine Kuchen nicht essen kannst.«
Er ging hinaus. Der Tag war unfreundlich geworden, ein trübes, unangenehmes Grau bedeckte den Himmel. Wilhelm ging tiefer in das Gebüsch. Da stand auf einmal ein kleines Männchen mit einem aschfarbenen Gesicht vor ihm und fragte, wo er hinwolle.
»Ich will einige Wurzeln suchen«, war seine Antwort.
»Ei, ei«, fuhr das Männchen fort, »was sollen die Wurzeln denn?«
»Mein Bruder will sie essen!« entgegnete Wilhelm.
»Aha, der Bruder«, erwiderte das Männchen, »was gibt der Bruder dir denn dafür, daß du bei dieser Kälte für ihn in den Wald hinausläufst und Wurzeln suchst? Doch, du bist ja einmal solch ein Narr, daß du es tust; komm mit mir, ich will dir zeigen, wo die schmackhaftesten stehen.«
Das Männchen setzte sich in einen sonderbaren Trab, und Wilhelm wagte es nicht, es dadurch, daß er nicht folgte und so seinen guten Willen zurückwies, zum Zorn zu reizen. Er eilte ihm nach; es ging in die Kreuz und Quer, und oft schlugen die bereiften Zweige der Bäume den armen Knaben ins Gesicht. Endlich stand das Männchen still; Wilhelm befand sich in einer wildfremden Gegend, wo er noch niemals gewesen war, und er sah nicht ohne Herzklopfen umher. Das Männchen zeigte mit seiner kleinen, spitzigen Hand auf eine Stelle, wo Wurzeln zu stehen schienen; Wilhelm zog sein Messer aus der Tasche und begann sie auszugraben. Dies gelang ihm, obgleich die Erde hart gefroren war, über die Maßen schnell. Als er die Wurzeln in sein Taschentuch gepackt hatte, sagte das Männchen zu ihm: »Nun habe ich mein Wort gehalten und muß eilen, daß ich nach Hause komme; ich wohne auf dem Abendstern und bin meines Berufs ein Scharfrichter!«
Wilhelm starrte das Männchen sprachlos an; dieses wandte sich gleichgültig ab und setzte sich wieder in seinen Trab, Wilhelm aber ergriff den einen Zipfel seines Rockes und schrie:
»Ich lasse dich nicht, du mußt mir erst den Weg zeigen, allein finde ich mich nicht zu der Hütte zurück.«
»Das kann geschehen«, versetzte das Männchen trocken, »wenn wir über den Preis, den ich dafür fordern muß, einig werden können. Ich habe mir eine köstliche Sammlung von Edelsteinen angelegt, die mir viel Vergnügen macht, und wenn ich dir den Weg, den du allein allerdings nicht finden wirst, zeigen soll, so mußt du dich schon bequemen, diese meine Sammlung mit einem guten Stein von echtem Feuer zu vermehren.«
»Ich habe keine Edelsteine«, entgegnete Wilhelm, »und kann dir deswegen auch keine geben.«
»Doch, doch«, erwiderte das Männchen, »ich meine keine anderen Edelsteine als deine braunen, blitzenden Augen.«